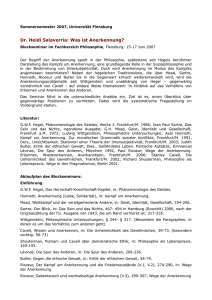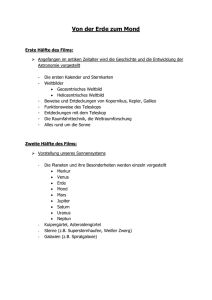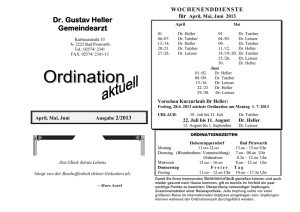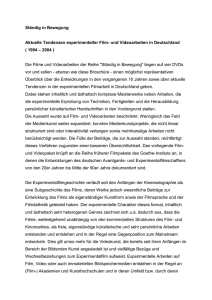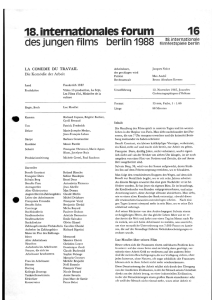zWiSchen erfahrung und zeichen filmtheorie als
Werbung

— Zwischen Erfahrung und Zeichen Filmtheorie als Brückenschlag von Malte Hagener Franziska Heller, Filmästhetik des Fluiden. Strömungen des Erzählens von Vigo bis Tarkowskij, von Huston bis Cameron, München, Paderborn (Wilhelm Fink) 2010 (Zugleich Dissertation Ruhr-Universität Bochum 2009). Thomas Morsch, Medienästhetik des Films. Verkörperte Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung im Kino, München, Paderborn (Wilhelm Fink) 2011 (Zugleich Dissertation Freie Universität Berlin 2008). Herbert Schwaab, Erfahrung des Gewöhnlichen. Stanley Cavells Filmphilosophie als Theorie der Populärkultur, Münster (Lit Verlag) 2010 (Zugleich Dissertation Ruhr-Universität Bochum). — Wissenschaftliche Entwicklung verläuft nicht linear und teleologisch, auf immer größere Erkenntnis zu, sondern eher wellenförmig und intermittierend, von plötzlichen Richtungswechseln und paradoxen Zeitstrukturen geprägt. Das lässt sich deutlich ausmachen etwa am Verhältnis von Theorie und Geschichte in der filmwissenschaftlichen Forschung der vergangenen Jahrzehnte: Nachdem in den 1970er und bis in die 80er Jahre hinein die Filmtheorie unter der Überschrift der screen theory die Filmwissenschaft geprägt hatte, dominierte die Filmgeschichte nach der Wende zur new film history in den 80er Jahren bis Ende der 90er Jahre den Diskurs. In den letzten zehn Jahren hingegen ist ein Wiedererstarken der Filmtheorie zu beobachten: Neue Publikationsforen wurden entwickelt und institutionalisiert, neue Theorieansätze und Denkschulen erprobt und diskutiert. Es ist in diesem Zusammenhang uneingeschränkt zu begrüßen, dass auch in deutschsprachigen Qualifikationsarbeiten der Anschluss an internatio- nale Forschungsfelder und Diskurse gesucht wird. In allen drei vorliegenden Arbeiten sind der angelsächsische Raum (vor allem die Vereinigten Staaten) und Frankreich die Bezugspunkte, andere Weltregionen kommen nicht vor. Ähnlich wellenförmig gegeneinander verschoben wie die Beziehung von Theorie und Geschichte verlaufen auch die Konjunkturzyklen von phänomenologischen und formalistisch-semiotischen Ansätzen, die sich in solchen polarisierenden Gegenüberstellungen wie Phänomenologie und Konstruktivismus, Mimesis und Text oder Erfahrung und Zeichen finden. Es ist die Frage nach dem Verhältnis zwischen diesen beiden Polen, die alle drei Arbeiten antreibt, jedoch jeweils in eigenständiger Weise. Tendenziell geben sie sich versöhnlich: Sie ergreifen nicht Partei für eine Seite, sondern bemühen sich, Brücken zu bauen und Kontakt herzustellen. Ganz unterschiedlich sind dagegen die Ansatzpunkte: Während Franziska Heller von einem filmischen Motiv ausgeht und hieraus eine Gesamtästhetik des Films entwickeln will, geht es Thomas Morsch um die Versöhnung von ästhetischer Erfahrung und Medientheorie im Film, und Herbert Schwaab wiederum greift auf Stanley Cavells Filmphilosophie zurück, um diese für das Fernsehen fruchtbar zu machen. Film als Fluss Das Interesse an filmischen Motiven scheint derzeit groß zu sein.1 Franziska Heller widmet sich in Filmästhetik des ­Fluiden dem Motiv des Fließens und des Flüssigen, woraus sie das Strukturmerkmal des Fluiden für die Wahrnehmung des Filmischen insgesamt ableitet. Ausgehend von der filmischen Narratologie, die Heller dafür kritisiert, allzu stark auf literaturtheoretische Modelle des sprachlichen Erzählens zu rekurrieren, soll eine Brücke geschlagen wer- 247 Malte Hagener den zum «wahrnehmungsbildlichen Charakter des Films» sowie zum «raum-zeitliche[n] Wahrnehmungsprozess der filmischen Erzählung» (31). Heller knüpft zunächst an französischsprachige Debatten an, die sich im Anschluss an Roland Barthes, Gérard Genette und Christian Metz um Fragen der Enunziation entwickelt haben, und führt diese mit einem phänomenologischen Subjektbegriff zusammen. Zusätzlich gestützt auf Gaston Bachelard, Henri Bergson und Gilles Deleuze entwickelt sie ein eigenständiges Modell davon, wie sich narrative und audiovisuelle Themenkomplexe berühren und ineinander verschränken. Das Motiv kann visuell wie auditiv, narrativ wie thematisch sein, und verschafft der Analyse zugleich ihre Begriffe wie auch einen Resonanzraum, weil – diese Annahme liegt dem Ansatz implizit zugrunde – ein Film durch die Evokation eines solchen Motivs selbst einen Vorschlag unterbreitet, wie er zu verstehen ist. Die ästhetischaudiovisuelle Modellierung des Films, gerade in seiner Mikrostruktur, arbeitet also aufs Engste zusammen mit der narrativen Makrostruktur, wodurch sich die für das Filmische (wie für das Fluide) kennzeichnenden dynamischen Austauschprozesse und Auflösungen fester Kategorien wie Subjekt/Objekt, Innen/Außen und Selbst/ Anderer ergeben. Im Kern geht es um jene «unvorhersehbaren, dauerhaften Bewegungsprinzipien […], die dem Wasser eigen sind […] als strukturbildendes und damit wahrnehmungsbestimmendes Prinzip» (15). Anders als in der klassischen Motivforschung geht es jedoch nicht einfach um ein Motiv in seiner historischen Entwicklung, sondern um ein strukturelles Grundmotiv – Veränderung, Fluss und Bewegung – und damit im Kern um die mediale Form des Films. Der zentrale Teil der Arbeit (S. 83 – 262) besteht aus einer Reihe theoriegeleiteter Filmlektüren, an die sich ein kurzes Kapitel (S. 263 – 298) anschließt, das als Apotheose die «Immersion ins Fluide […] anhand der schwerelosen Bewegungsform des Gleitens von Licht wie des Kaders» (263) thematisiert. Betrachtet man das Fluide derart als Strukturprinzip der bildlichen Wahrnehmung wie der zeichenhaften Erzählung, so korrespondiert dies mit der Entgrenzung und Destabilisierung von Bedeutung in der Filmerfahrung. Das Fluide ist ständiger Veränderung un- 248 terworfen, bricht das Licht (als einen zentralen filmischen ‹Baustoff›), erzeugt Durchblicke, aber auch Spiegelungen. Insofern «wird ein Konzept, das Subjekte wie Objekte als stabil, also mit einsinnigen, eindeutigen Zuschreibungen ausstattet, voraussetzt, weitgehend in Frage gestellt.» (200) Das Fluide wird damit als Moment der Transformation, der Zeitlichkeit und der Bewegung zum grundlegenden medialen Prinzip des Films erklärt. In diesem Zusammenhang erstaunt die Absenz von Vivian Sobchack, deren Adaption von Maurice Merleau-Ponty in den letzten Jahren auf breiter Front rezipiert wurde und auch jenseits der Filmtheorie Beachtung findet. Gerade angesichts der Tatsache, dass Heller sich auf MerleauPonty beruft und auch Husserls Leibbewusstsein unter dem Stichwort einer «doppelten Leiblichkeit» diskutiert (45 f ), hätte eine Auseinandersetzung mit Sobchack geholfen, die wechselseitige Verschränkung von subjektiver Ausdruckserfahrung und objektivierbarem Erfahrungsausdruck zu pointieren. Die gut lesbaren Filmlektüren, aus denen das Buch überwiegend besteht, laufen auf das Argument hinaus, dass es sich bei dem Fluiden keinesfalls um ein beliebiges Motiv handelt, sondern um ein grundlegendes Prinzip des Filmischen. Dies mag auch in der Wahl der Filmbeispiele begründet liegen, die aus dem europäischen Kunstkinokanon stammen (Tarkovskij, Fellini und Antonioni tauchen mehrfach auf ), aber auch postklassische Action- und Mindgamefilme umfassen. Dies erklärt weiterhin, weshalb Heller das Fluide als eine Form der Medienreflexion sieht, die den Zuschauer als sinnliche Funktionsgröße der filmischen Gestaltung denkt. Dass der einzig ausführlich diskutierte Film aus dem klassischen Hollywood ausgerechnet der Metafilm Sunset Boulevard (US 1950, Billy Wilder) ist, wirft die Frage auf, ob dieser Ansatz allgemeine Gültigkeit beansprucht oder nur auf einen bestimmten Korpus angewendet werden kann. Ästhetische Medienerfahrung Während Heller von der Filmanalyse ausgeht, nähert sich Thomas Morsch dem Spannungsfeld von körperlicher Wahrnehmung und textueller Struktur, die grundlegend ZfM 6, 1/2012 Zwischen Erfahrung und Zeichen für alle Facetten der Rezeption – von der affektiven Reizung bis zur komplexen Bedeutungsgenerierung – ist, vor allem über die Theorie. Man könnte hier auch von induktiver und deduktiver Vorgehensweise sprechen. Während bei Hellers Induktion die Detailanalyse des filmischen Materials im Vordergrund steht, sind es bei Morsch theoretische Positionen und Argumente – nicht zufällig ist Hellers Arbeit reich illustriert und sogar mit einer Reihe von Farbtafeln versehen, während bei Morsch sich selbst das Titelbild als einzige bildartige Erscheinung einer eindeutigen Identifikation entzieht. Der Titel Medientheorie des Films, der auf den ersten Blick täuschend deskriptiv wirken mag, ist programmatisch gemeint, will er doch die oft getrennten, wenn nicht gar schematisch gegenübergestellten Ansätze der Medientheorie (mit ihrer Apriorisierung des Technischen) und der ästhetischen Theorie in Beziehung zueinander setzen. Die Arbeit versucht also, «die technischen, dispositiven und diskursiven Apriori, die in Medien eine apparativ verfestigte Form erlangen, auf ihre ästhetisch-kommunikativen Konsequenzen hin zu befragen, ohne die ästhetische Kommunikation eines Mediums als bloße Konsequenz dieses Apriori misszuverstehen. Umgekehrt beanspruchen die auskristallisierten ästhetischen Parameter eines Mediums nicht den Charakter von definierenden Eigenschaften, sondern benennen Potenziale, die genutzt werden können – oder eben nicht.» (135) Der Körper wird dabei zum Ort des Kontakts, Konflikts oder Austausches zwischen den ästhetischen Potenzialen und den medialen Rahmenbedingungen. Die Studie besteht aus drei Abschnitten, die sich inten- siv mit einem breiten Angebot an Theorien auseinander setzen. Der erste Teil versammelt poststrukturalistische Positionen, die Körperlichkeit betrachten als «Überschreitung des Symbolischen, Repräsentationalen und Semantischen, und damit […] Überschreitung derjenigen Schichten des Filmischen, die primär Verstand und Bewusstsein des Betrachters adressieren» (50). Der mittlere Teil, der (nicht nur vom Umfang her) als Zentrum der Studie gelten kann, fokussiert über phänomenologische Positionen das Actionkino und den Schock als genuin filmische Ausdrucksformen, ja als «strukturelles ästhetisches Programm des Mediums» (212). Der Körper wird dabei weder empiristisch auf messbare Daten reduziert noch als etwas dem Sinn Entgegenstehendes konzeptualisiert; vielmehr kommt dem Somatischen «ein eigener Sinn zu, der in wesentlichen Teilen auf der präkognitiven und vorindividuellen Beziehung des Körpers zu seiner Umwelt beruht.» (166) Eine Analyse von Takashi Miikes Audition (JP 1999), die die Körperlichkeit des Rezipienten als produktive Kraft ästhetischer Erfahrung herausarbeitet, bringt dann nach über der Hälfte der Arbeit endlich einen konkreten Film ins Spiel. Gerne hätte man die Theorie in stärkerer Interaktion mit den häufig evozierten, aber nie eingehend diskutierten Beispielen aus dem Mainstream gesehen. In der zentralen Frage nach der Beziehung von Kognition und Affekt, von Narration und Spektakel, von Sinn und präsubjektiver Körperlichkeit schlägt sich Morsch nicht auf eine der Seiten, sondern betrachtet die Spannung zwischen beiden Polen als konstitutiv für das Medium. Es ist aber schließlich die Phänomenologie Sobchack’scher Prägung, 249 Malte Hagener die im Anschluss an Merleau-Ponty die Unhintergehbarkeit leiblicher Erfahrung zum Horizont des Medialen erklärt: «Sinngebung ist im Medium des Films nur mittels der Herstellung von Wahrnehmungen – als Gegenstände der Wahrnehmung – möglich. Der ästhetische Kern des Mediums liegt […] in der prozessualen und performativen Herstellung von Wahrnehmung, die nicht allein ‹kommuniziert›, sondern im ästhetischen Bild zum Ausdruck gebracht und damit zum Gegenstand einer weiteren Wahrnehmung wird, einer Wahrnehmung zweiter Ordnung, die zwischen Wahrgenommenem und Wahrnehmung im Rahmen der eigenen Wahrnehmung des filmischen Bildes unterscheiden kann. […] Im Kino machen die Zuschauer nicht nur eine Wahrnehmungserfahrung, sondern sie werden gleichzeitig des Ausdrucks einer Wahrnehmungserfahrung ansichtig.» (260f.) Im dritten Teil rückt dann die ästhetische Erfahrung ins Zentrum der Aufmerksamkeit, ehe Deleuze fast als eine Art deus ex machina auf den Plan tritt, der über die Defizite von Phänomenologie, Konstruktivismus und philosophischer Ästhetik hinausführt zur «Möglichkeit eines körperlichen Verstehens, einer viszeralen Sinnbildung und einer neben der Sprache herlaufenden sinnlichen Semantik» (277). Man könnte dieser Arbeit mangelnde Originalität vorwerfen, weil sie sich immer wieder an bestehenden Positionen abarbeitet und die seit der Jahrtausendwende geführte Debatte so synthetisiert, dass die Reichweite und Produktivität semiotischer wie phänomenologischer Ansätzen herausgearbeitet wird. Sie tut dies jedoch mit so großer Präzision und sprachlicher Genauigkeit, dass, wer einen hervorragenden Überblick mit nuanciert-ausgewogenen Theoriedarstellungen sucht, hier fündig wird. Neuland allerdings erschließt die Arbeit nicht. Erfahrung des Gewöhnlichen Will Heller den Abgrund zwischen Deleuze und den Narratologen überbrücken, geht es Morsch um den Anschluss von ästhetischer Theorie und Medientheorie, so verbindet Herbert Schwaab Positionen des US-amerikanischen Philosophen Stanley Cavell mit Ansätzen aus der Populärkulturforschung. Auch hier wiederum spielt der Abstand zwischen Erfahrung und Textualität eine Rolle: Die Cultural Studies waren – trotz der Rede von Aneignung und oppositionellen Lesarten – lange Zeit auf den Text fixiert, 250 während Cavell sich von seiner eigenen Erfahrung und Position aus schreibend den Dingen näherte. Prinzipiell hat es Schwaab abgesehen auf eine «Kulturwissenschaft, die sich stärker mit Einzelgegenständen beschäftigt und dabei auch die eigene Beteiligung oder Subjektivität mitthematisiert.» (289) Über lange Strecken liest sich die Arbeit zunächst wie ein kritischer Literaturüberblick: Die ersten 250 Seiten fassen detailliert und kompetent Cavells wichtigste Schriften zum Film zusammen, daran schließt sich ein längerer Abschnitt an, der Haupterkenntnisse der Cultural Studies Revue passieren lässt. Immer wieder gibt es dabei Einschübe, die Aspekte des Alltäglichen und Gewöhnlichen unterstreichen, doch erst auf den letzten 90 Seiten wird anhand einiger Fernsehserien ein zusammenführendes Modell skizziert. Dieses kann jedoch aufgrund der Kürze nur eine (durchaus inspirierende) Andeutung bleiben, denn was ließe sich schon auf 10-20 Seiten über eine Serie mit vielen Stunden Laufzeit sagen. Zentral ist bei Schwaab der Begriff des ‹Gewöhnlichen›, unter dem nicht das ‹Alltägliche›, sondern das, was sich dem wissenschaftlichen Zugriff entzieht, zu verstehen ist: «Es ist ein Rest, der nicht zur Projektion unseres Wissens wird und so unsere Selbstgewissheit erschüttert.» (329) Anders als in ideologiekritischen Lesarten geht es jedoch nicht darum, Medientexte aus einer Position der Macht darüber aufzuklären, was ihr ‹eigentlicher› Gehalt sei: «die Populärkultur [weiß] von ihrer seltsamen Exterritorialität […] und [erforscht…] deswegen die Bedingungen dieses Raumes» (407). Über Cavell werden (der späte) Wittgenstein sowie die US-amerikanischen Transzendentalisten Emerson und Thoreau in Stellung gebracht als Kronzeugen für eine Zuwendung zu den Dingen, die ­normalerweise aufgrund ihrer Unauffälligkeit unsichtbar bleiben. Wenn Schwaab derart das Moment des Gewöhnlichen ZfM 6, 1/2012 Zwischen Erfahrung und Zeichen für das Fernsehen in Stellung bringt, so fragt sich, ob er das nicht eben zu jenem Zeitpunkt tut, zu dem sich Cavell dem klassischen Hollywoodkino zuwandte – nämlich just, als diese spezifische mediale Form ihre Dominanz und Hegemonie verloren hatte. Und so ist es nur konsequent, wenn neue Verbreitungs- und Rezeptionsformen – von illegalen Downloads bis zu DVD-Boxen – negativ bewertet werden, weil so «das kulturelle Forum des Fernsehens zu einer Einöde wird» (392). Anders gesagt: Ist eine Cavell’sche Haltung überhaupt nur solchen Ausdrucksformen gegenüber möglich, deren Historizität wir erkennen, eben weil sie nicht länger als stabil erscheinen, sondern als kontingente und kulturell-historisch spezifischen Umständen geschuldete Artefakte? Die derzeitige Blüte der US-Serie wäre dann ein Anzeichen dafür, dass das Fernsehen in seiner Gewöhnlichkeit nicht länger mehr existiert. Schwaabs Arbeit, gerade in ihrer Konzentration auf nicht diesem (HBO-)Kanon zugehörigen Serien (24, King of Queens) bietet wertvolle Ansatzpunkte für eine theoretisch avancierte Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. filmaffinen Philosophen von Jacques Rancière bis Slavoj Žižek – zu einer zentralen Bezugsgröße geworden. Was bedeutet dies für die Filmtheorie – einen ultimativen Triumph, die Musealisierung oder gar eine feindliche Übernahme? Wohl von allem ein wenig, wobei die Filmwissenschaft gut beraten wäre, diese Entwicklungen nicht nur im Auge zu behalten und darauf zu reagieren, sondern sie vielmehr aktiv mit voranzutreiben. Die Erinnerung daran, dass das Weltkino mehr zu bieten hat als den Cahiers du Cinéma-Kanon (Deleuze) oder klassische Hollywoodgenres (Cavell), wäre nur ein notwendiger erster Schritt, auch die Geschichte der Filmtheorie müsste noch einmal systematisch neu gelesen werden angesichts der Begegnung mit der Philosophie. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen könnte man die Frage stellen, ob sich die Filmwissenschaft in ‹splendid isolation› zurück ziehen sollte oder ob das Kino nur noch in Bezug auf philosophische Fragestellungen seine Relevanz behaupten kann. Doch vielleicht gibt es noch einen dritten Weg, der sich in den hier diskutierten Arbeiten andeutet und der anhand solcher Fragen wie der nach der Beziehung von Textualität und Erfahrung eine Brücke eröffnet, über die Filmtheorie und Philosophie miteinander in produktiven Kontakt treten können. — 1 Siehe dazu etwa den Schwerpunkt ‹Motive› der Zeitschrift für Medienwissenschaft 1/2009, und Christine N. Brinckmann, Britta Hartmann, Ludger Kaczmarek (Hg.), Motive des Films. Ein kasuistischer Fischzug, Marburg (Schüren) 2011. Film als Philosophie? Es fällt auf, dass sich Philosophen allerlei Couleur derzeit intensiv mit dem Kino auseinandersetzen: US-amerikanische Pragmatisten (Stanley Cavell, Robert Pippin), französische Postalthusserianer und Postheideggerianer (Gilles Deleuze, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy), italienische Postoperaisten (Maurizio ­Lazzarato, Giorgio Agamben) und auch deutsche Philosophen ­suchen Anschluss an den Film als Medium (Martin Seel, Joseph Früchtl). Fast scheint es, als würde die moderne ­Philosophie, von Kant bis Heidegger, von Hegel bis ­Bergson inzwischen den Fluchtpunkt der Filmtheorie bilden. Insbesondere der deutsche Idealismus ist dabei – bei 251