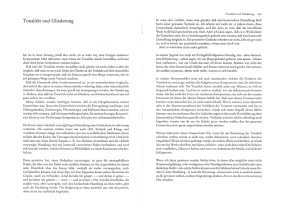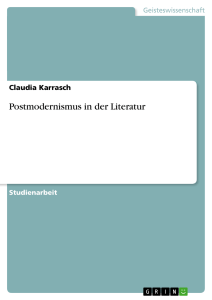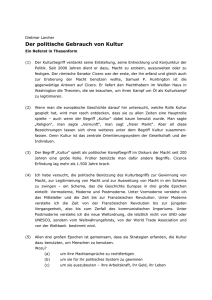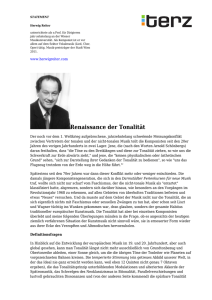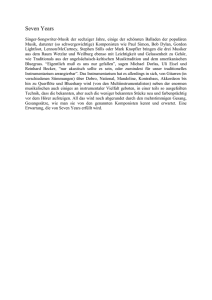Zwischen Prähistorie und Postmoderne
Werbung

Zwischen Prähistorie und Postmoderne Nachträgliche Vorbemerkung Ich habe den folgenden Text im Oktober 1986 auf Italienisch geschrieben (s. Anmerkung 23). Für die deutsche Veröffentlichung habe ich ihn hier und da verändert, ohne aber mit Gewalt Widersprüchliches zu tilgen. Er ist nur eine Station auf dem Weg. Morgen werde ich—hoffentlich—die Dinge anders sehen, das heißt Aspekte entdecken, die mir verborgen geblieben waren. Wer ein geschlossenes System vorzuweisen hat, werfe den ersten Stein (am besten allerdings auf das System selber). Da der Widerspruch der Motor jeden Fortschreitens ist, ist es mir nicht nur Recht, wenn er im Text vorhanden ist, sondern auch, wenn er welchen erzeugt. So kann vielleicht gemeinsam ein Schritt weiter gegangen werden. Die italienische Fassung des Textes hat tatsächlich einigen Widerspruch provoziert (s. dazu auch Anmerkung 29). Das hat mich nicht weiter gewundert. Verwundert aber war ich über die Verwunderung, die auch—vor allem—bei Freunden meine neuen Positionen hervorgerufen haben. Neu? Nun, ich weiß nicht. Sie spiegeln Erfahrungen wider, die ich in den letzten Jahren sowohl auf musikalischem, wie auch auf philosophischem und politischem Gebiet gemacht habe. Ich sehe diese nicht als Zurücknahme früherer Positionen, sondern als deren Entwicklung. Wenn ich über die Verwunderung verwundert war (vielleicht zu Unrecht), so war ich aber enttäuscht (ich glaube mit Recht), dass mancher nicht bereit war, andere Positionen als seine eigenen gelten zu lassen. Solche nämlich, die den Konsensus einer mehr oder weniger homogenen Gruppe sprengen. Ich will keinen überzeugen, der sich nicht überzeugen lassen will, will aber auch nicht auf eigene Überzeugungen verzichten müssen. Keiner hat die Wahrheit gepachtet (zumal es keine gibt...). Ich denke, dass wir in einer Zeit der Umwertung vieler, wenn nicht aller Werte, lernen müssen, Andersdenkenden zuzuhören. Manchmal wird gegen differierende Meinungen das Argument ins Feld gebracht, sie würden „dem Feinde nützen“. Deswegen, und nicht aus sachlichen Gründen, werden sie zurückgewiesen. Dies ist aber eine gefährliche Begründung, und wir sollten den Mut haben damit aufzuräumen. Das Freund-FeindDenken, das Denken in Fronten ist leider auf allen Gebieten verbreitet und es zeitigt auch auf allen Gebieten verheerende Folgen. Vor allem auf politischem Gebiet. Die Anklage, „objektiv“ der Konterrevolution zuzuspielen, ist eine beliebte Begründung, mit der Gegner von Stalin liquidiert wurden. Spuren dieser manichäischen Haltung sind auch auf dem vergleichsweise harmlosen Gebiet der Musik vorhanden (auch wenn heute niemand—niemand?—mehr behaupten würde: Schönberg ist grundsätzlich gut, weil atonal, Strawinsky grundsätzlich schlecht, weil tonal). Die musikalische Diskussion (der musikalische Diskurs der Moderne) ist zu lange ideologisch, nämlich aufgrund vorgefasster Anschauungen geführt worden. Schauen wir uns lieber ohne ideologische Brille die Sache selber an, nämlich die Musik. Die Theorie muss sich nach der Musik richten, nicht die Musik nach der Theorie. Das beanspruche ich auch mit Nachdruck für mich selber: mit dem, was ich musikalisch mache, mag ich dem, was ich theoretisch denke, widersprechen. Die Theorie ist in diesem Falle ein Versuch, im nachhinein zu verstehen, was man eigentlich gemacht hat. Sie kann jederzeit durch die Musik selber verifiziert oder falsifiziert werden. (November 1987) *** Die Krise der zeitgenössischen Musik ist eine zugleich technische und ideelle. Die Situation ist paradox: eine enorme Erweiterung der technischen Möglichkeiten geht mit einer Verflachung der ideellen Motivation und überhaupt der sozialen Funktion der Musik einher. Die zeitgenössische Musik führt eine Randexistenz. Es wird immer schwieriger, eine vernünftige Antwort auf die Frage zu geben: Warum schreibt man Musik? Der Prozess der Säkularisierung, der den Beginn der Moderne in der Kunst anzeigt, ist an einem extremen Punkt angelangt. Es scheint nicht mehr möglich, in dieser Richtung weiterzugehen. Und in der Tat, schon lässt sich eine Tendenzwende ausmachen, die ein Überdenken der grundlegenden Motivation Musik zu machen mit sich bringen wird. Sicher, der Sinn des Musikmachens kann heute nicht getrennt betrachtet werden vom Sinn, den wir unserer gesamten Aktivität als Menschen geben. Diese Aktivität erscheint indessen immer sinnloser und die Welt als eine verwundbare Absurdität—eine manchmal erschreckende Absurdität. Ein Wassertropfen ist eine Welt und unsere Welt ist ein Wassertropfen im Universum. Es entgehen uns die Proportionen, der Ursprung, die Bestimmung dieser Welt. Umsomehr entgeht uns der Sinn dieser Lebewesen, die sich Menschen genannt haben, die bis vor kurzem wie die Tiere lebten und binnen kurzer Zeit zur mächtigsten Gattung geworden sind, enorme Gedankengebäude errichtet haben und jetzt mit dem Gedanken spielen, ob man diesen unendlich kleinen Punkt des Universums, der Erde heißt, in die Luft jagen soll oder nicht. Niemandem würde es auffallen, im Universum. Alles ginge weiter wie seit undenklichen Zeiten. Wer sich nicht auf die Krücken stützt, die ihm der Glaube—sei er religiös oder weltlich—liefert, muss ein Schwindelgefühl empfinden. Es ist lächerlich zu glauben, unser Leben füge sich in einen unerforschlichen göttlichen Plan. Es ist lächerlich, aber es hilft zu leben. Es ist lächerlich zu glauben, die Menschen könnten eine Gesellschaft bauen, die Freiheit und Gerechtigkeit verwirkliche und eine Alternative zum Paradies darstelle. Es ist lächerlich, aber auch dieser Glaube hilft zu leben. Aber wenn man nicht glaubt? Wenn man die „Erzählungen“, die die Epoche der Moderne gekennzeichnet haben, in Frage stellt? Das Projekt der Moderne ist von großen theoretischen Systemen gelenkt worden, oder, wie Lyotard sagt,1 von großen Erzählungen. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit. die Freiheit, die universale Brüderlichkeit: Begriffe, auf denen die Legitimation oder die Kritik der Ideen und der Handlungen gründeten. Die Ungläubigkeit gegenüber den Erzählungen und den Meta-Erzählungen (Geschichtsphilosophien) ist laut Lyotard das, was die postmoderne Epoche kennzeichnet. Aber wird der Postmodernismus nicht selber zur Meta-Erzählung in dem Augenblick, in dem er einen Interpretationsschlüssel zu liefern vorgibt? Außerdem: Obwohl er sich im Bereich der westlichen Gesellschaften entwickelt, leugnet der Postmodernismus implizit wie explizit die Vorherrschaft der westeuropäischen gegenüber den anderen Kulturen. In Wirklichkeit aber bekräftigt er diese in dem Maße, in dem er eine Theorie für allgemeingültig erklärt, die ihre Voraussetzungen in der Situation der postindustriellen Gesellschaften hat. Welchen Sinn hat es, in Afrika, Indien oder Lateinamerika von Postmoderne zu reden? Der Postmodernismus, im Sinne von alles geht/nichts geht, alles ist möglich/nichts ist möglich, übersteigt die Kritik der Vernunft und wird zur Bejahung der zynischen Vernunft. Gegen den Zynismus gibt es kein Argument. Außer einem, das stärker ist, je schwächer es zu sein scheint. Schwach, weil es sich auf keine äußere Instanz stützt; stark, weil es sich auf die einzige Instanz stützt, die für die Menschen zählt: ihre Geschichte. Die Geschichte der Menschen ist der Versuch, dem Sinn zu verleihen, was keinen hat. Ein herrischer und vergeblicher Versuch, denn der Sinn der Geschichte scheint derjenige zu sein, dass sie keinen hat, jedenfalls keinen als metaphysisch verstandenen. Der metaphysische Sinn wird durch die mühsame Konstruktion einer geschichtlichen Rationalität ersetzt. Ein prometheisches Unternehmen. Allerdings muss man oft mehr als an Prometheus an Sisyphus denken. Camus unterschied zwischen dem metaphysisch und dem historisch Absurden. Gegen ersteres können wir nichts tun. Die Sinnlosigkeit der Welt, Krankheit und Tod sind unveräußerlicher Bestandteil des menschlichen Seins. Das historisch Absurde hingegen—die Ungerechtigkeit, die Unfreiheit, der Krieg—kann und muss von den Menschen bekämpft werden, wenn sie aus ihrer Vorgeschichte heraus wollen. Für Marx bewegten sich die Menschen noch in ihrer Vorgeschichte.2 Die Geschichte dieses Jahrhunderts kann dies nur bestätigen. Trotz 1917—und wir können auch 1949 und 1961 hinzuzählen—steht die Grausamkeit der Menschen in nichts derjenigen früherer Zeitalter nach, die wir als dunkle betrachten. Licht—wenn man dasjenige der am Welthimmel leuchtenden Bomben außer Betracht lässt—gab es nur wenig zu sehen. Heiner Müller hat Recht: Die Sonne der Folter, von der Artaud spricht, ist die einzige. die gleichzeitig alle Kontinente dieses Planeten beleuchtet.3 Der neue Mensch wurde nirgends gesichtet, sondern nur Verwandlungen des Wolfes, der seit jeher der Mensch für den Menschen gewesen ist. Die Ideale von 1789 sind immer noch Utopie. Blut ist das wahre Symbol dieses Jahrhunderts, dessen Fortschritte auch in der Bereitstellung von immer mehr und immer schnelleren Tötungsmitteln besteht. Das Finale der Neunten Sinfonie hat sich als eine tragische Verhöhnung erwiesen, als eine Hintergrundsmusik, die die Schreie der in den Gaskammern ermordeten Menschen übertönen soll. Angesichts des Scheiterns des Projektes der Moderne werden dessen Voraussetzungen kritisiert. Damit riskiert man jedoch, von einem Extrem ins andere zu fallen, sofern das Ablassen von einer linearen und mechanischen, metaphysischen Idee der Freiheit auch den Verzicht, das historisch Absurde zu bekämpfen bedeutet. In Wirklichkeit ist die Kritik der Moderne integraler Bestandteil des Projektes der Moderne. Und zwar seit der Kritik der reinen Vernunft. In jüngerer Zeit haben Benjamin, Bloch, Adorno, Horkheimer und Habermas gezeigt, dass es möglich, ja sogar notwendig ist, Aspekte des Projektes der Moderne zu kritisieren; ohne deshalb auf eine artikulierte Idee von Rationalität zu verzichten. Die Krise der Vernunft wird nicht überwunden, indem man sich der Unvernunft überlässt. Sie verlangt im Gegenteil ein größeres Maß an Rationalität, die von einem vielfältigeren, differenzierteren Begriff von Vernunft ausgeht. Wie zu Zeiten Kants bedarf die Philosophie auch heute einer Kritik der Vernunft mittels der Vernunft, und nicht ihrer Abschaffung. Viele werden schon einen Ameisenhaufen betrachtet und sich dabei vorgestellt haben, dass unsere eigene Aktivität aus einer anderen Perspektive—analog derjenigen eines Menschen, der einen Ameisenhaufen betrachtet—Ähnlichkeit mit der Aktivität der Ameisen aufweisen könnte. Im Unterschied zu den Ameisen haben wir die Fähigkeit von der Situation, in der wir uns befinden, zu abstrahieren und uns wie von weitem zu sehen. Wir können, zumindest für kurze Augenblicke, zu Betrachtern von uns selbst werden. Auf diese Weise können wir uns der Irrelelvanz und der Banalität vieler unserer größten Probleme bewusst werden. Auf diese Weise relativieren wir, was uns als lebensnotwendige Fragen erscheinen. Auf diese Weise werden wir uns der Absurdität des Lebens bewusst. Auf die Dauer müssen wir jedoch zu unserer alltäglichen Perspektive zurückkehren. Wenn wir nicht verrückt werden wollen, wenn wir den Selbstmord ablehnen,4 müssen wir in den Ameisenhaufen zurückkehren und uns an unseren eigenen Problemen messen, 1 Vgl. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris: Les Editions de Minuit, 1979. Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Vorwort), Berlin: Dietz Verlag, 1971, S. 16. 3 Heiner Müller, Vortragstext zu einer Diskussion über Postmodernismus, New York, 1978, o.O., o.J. 4 Baudelaire, ein Verfechter der Moderne, sprach vom Selbstmord als von der "passion particulière de la vie moderne". Für Baudelaire.ist der Selbstmord das Siegel unter einem heroischen Wollen, das—so Benjamin—der ihm 2 die uns sofort wieder groß, bedeutend, schwierig, oft unüberwindlich erscheinen werden. Wir müssten uns jedoch an diese geistige Gymnastik gewöhnen, die darin besteht, uns wie von oben zu beobachten. Wir würden feststellen, dass mit dem Wechsel der Perspektive sich die Bedeutung unserer Ideen und unserer Handlungen relativiert. Es genügt ein minimaler Wechsel der Perspektive, um die Dinge in einem gänzlich anderen Licht zu sehen. Das gilt auch für das Gebiet der Musik. Ein Blick von oben oder ganz einfach aus einer anderen Perspektive zeigt uns, dass die Probleme, die die Welt der zeitgenössischen Musik bewegen, ein Sturm im Wasserglas sind, und dass die Welt der zeitgenössischen Musik zur realen Welt absolut marginal ist. Es ist angebracht, diese Tatsache in Erinnerung zu rufen, bevor wir uns mit der gebotenen Energie den Problemen der zeitgenössischen Musik zuwenden und sie ins Zentrum unserer Interessen stellen. Unsere „vorgeschichtliche“ und zugleich postmoderne Epoche wird vom Bewusstsein der Pluralität der Kulturen bestimmt, sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch im Weltmaßstab.5 Als ich vor einigen Jahren in San Francisco ein Geschenk für meine Frau kaufen wollte, fragte ich einen befreundeten Komponisten um Rat. „Ich würde ihr gern etwas typisch Amerikanisches schenken“, sagte ich zu ihm. „Schenk’ ihr einen Kimono“, lautete seine Antwort. „Wirklich?“ wunderte ich mich, „ein Kimono scheint mir aber keine typisch amerikanische Sache zu sein“. „Warum nicht? Die japanische Kultur ist ein integraler Bestandteil unserer Kultur“, antwortete er und erzählt dann, dass es in der Schule, die er als Kind besucht hatte, mehr Japaner als Amerikaner gab und dass ihm die japanische Kultur genauso vertraut sei wie die amerikanische, auch wenn er noch nie in Japan war. Der Kimono, der Cowboy-Hut, die neapolitanische Pizza, der Hot-dog, Dallas und „Der Name der Rose“, die Rockmusik und die Minimal Music: alles gehört zum Angebot des großen Supermarktes, den die Welt darstellt. Die Haltung meines kalifornischen Freundes, der in Tuchfühlung mit der japanischen Kultur aufgewachsne ist, aber im IRCAM arbeitet, ist eine postmoderne Haltung. Es ist dieselbe Haltung, wie sie ein anderer mir befreundeter Komponsit, der als Sohn polnischer Eltern in den USA geboren ist, in Rom lebt, in Lüttich lehrt und einen japanischen Verleger hat, an den Tag legte, als er mir vor Jahren sagte, er habe den Eindruck, sich innerhalb einer einzigen Stadt zu bewegen, deren westliche Grenzen in Los Angeles und deren östliche Grenzen in Berlin liegen. Wir sind immer mehr an die Gleichzeitigkeit des Vielfältigen gewöhnt. An die Überlagerung unterschiedlicher Zeitebenen. An die Polyphonie der verschiedenen Kulturen. An das „Multiversum“ Ernst Blochs, der diesen sehr schönen Begriff—dem eines kompakten Universums entgegengesetzt— von William James übernommen hat.6 Diese Situation gilt natürlich auch für die Musik. Kurz vor dem neuen Jahrhundert wissen wir, dass die Musik des zu Ende gehenden Jahrhunderts nicht nur gekennzeichnet ist durch die Linie Schönberg, die das Erbe der großen deutschösterreichischen Tradition aufgreift und bis zur seriellen Musik der fünfziger Jahre reicht, sondern auch durch das Eindringen von unterschiedlichen Musikkulturen in die Szene der euro-okzidentalen Kunstmusik, durch die immer größere Bedeutung, welche die Nebenwege gegenüber den Hauptwegen erlangt haben, bis es keine Haupt- und Nebenwege mehr geben wird, sondern eine Vielzahl von zu entdeckenden und zu erfindenden Routen. Janáček, Bartók, Ives, Varèse, Weill, Schostakowitsch, Eisler, Cage, Partch, Nancarrow, Scelsi: alles Musiker, die den großen Fluss der modernen Musik mit unterschiedlichsten Erfahrungen angereichert haben. Sei es durch das Zurückgreifen auf den reichen Fundus der Volksmusik (eine Art großer Tunnel unter der Geschichte, in dem sich viel von dem erhalten hat, was oben von den Kriegen, Revolutionen und von einer rücksichtslosen Zivilisation zerstört worden ist); sei es durch Beachtung der „natürlichen“, „malerischen“ Grundlagen des Klanges; sei es durch die Aufnahme von Einflüssen orientalischen Gedankengutes; sei es durch Nicht-Verzichten auf die strukturbilden Möglichkeiten der tonalen Anziehungskraft, wenn sie auch durch den Sturm des zwanzigsten Jahrhunderts hindurchgegangen ist. Wir sind nunmehr in einer Situation, in der die Beschreibung der Kultur in zeitlichen Begriffen ersetzt wird durch eine Beschreibung in räumlichen Begriffen; in der die Geschichte der Kultur immer mehr einer Geographie der Kultur weicht. Im Vergleich zur mehr oder weniger linearen Entwicklung der traditionellen euro-okzidentalen Kultur sehen wir uns heute einer Gleichzeitigkeit von Kulturen gegenüber, die sich unterschiedlich—auch zeitlich unterschiedlich— entwickeln. Diese mehr oder weniger bewusst erfahrene Situation, die aber de facto in den letzten Jahren immer schwerer wiegt, hat zu einer progressiven inneren Aushöhlung des Avantgarde-Begriffs beigetragen. Auch für die Musik gilt, mutatis mutandis, die am Beginn des Jahrhunderts von der Relativitätstheorie beschriebene Situation. Die Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Projekte kann Verwirrung stiften und zu Anarchie führen. Für die Kunst ist die Anarchie zwar vital, wenn sie aber institutionalisiert wird, gerät sie in Widerspruch zu sich selbst und wird zur schieren Unordnung, zur Willkür. feindlichen Gesinnung nichts zugesteht. "Dieser Selbstmord ist nicht Verzicht sondern heroische Passion. Er ist die Eroberung der Moderne im Bereiche der Leidenschaften". (Vgl. Walter Benjamin, „Die Moderne“ in Das Argument, 10. Jahrgang, Nr. 46 (1968), S. 50. Heute, in einer Epoche der Ungläubigkeit gegenüber Erzählungen ist auch der Sinn des Selbstmordes ein anderer. 5 Siehe auch L. Lombardi, „Konstruktion der Freiheit“, in Europäische Gegenwartsmusik, Mainz: Schott, 1984; und auch in Schnittpunkte Mensch/Musik, Regensburg: Bosse, 1985. 6 Vgl. Remo Bodei, Multiversum. Tempo e storie in Ernst Bloch, Napoli: Bibliopolis, 1982. Mancher fühlt sich aufgrund der veränderten kulturellen Situation berechtigt zu behaupten, dass man alles dürfe. Nichts könnte falscher sein. Dilettantismus darf nach wie vor nicht sein. Im Deutschen gibt es das Sprichwort: „Kunst kommt von Können“. Schönberg hat es modifiziert zu „Kunst kommt von Müssen“, und befand sich somit noch völlig im Idealismus. Heute denken viele, Kunst bedeute weder „Können“ noch „Müssen“, sondern „Wollen“. Das ist eine dilettantische Einstellung. Der postmoderne Dilettant unterscheidet sich vom modernen Dilettanten. Der moderne Dilettant wollte, konnte aber nicht. Der postmoderne Dilettant kann nicht, begnügt sich aber mit dem Wollen. So gesehen ist Kunst das, von dem man will, dass es Kunst sei. Der Dilettantismus, von dem ich spreche, bedeutet nicht notgedrungen Abwesenheit von handwerklichem Können. Es ist kein Dilettantismus der Ausführung, sondern intellektueller Art. Dilettantismus kann mit akademischer Glätte auftreten. Das beweist die überwiegende Mehrheit der gegenwärtigen kompositorischen Produktion in Italien. Wie es kürzlich von Gentilucci formuliert wurde: „Eine kombinatorische Komposition zu schreiben hat heute den gleichen Sinn wie das Verfassen einer Schulfuge nach der Methode des illustren Herrn Theodor Dubois“.7 Ob die angewandte Technik nun kombinatorisch sei oder nicht: man hat oft den Eindruck, es mit einer Schulaufgabe zu tun zu haben, mit der Anwendung eines Kochrezeptes. Unabhängig von der italienischen Situation zeigt sich das auffällige Phänomen der letzten fünfzehn, zwanzig Jahre in dem verschiedenartigen Wiederaufblühen von mehr oder weniger deutlichen Elementen der Tonalität. Schon in den frühen sechziger Jahren kehrte der US-amerikanische Komponist Rochberg, ein Anhänger Schönbergs und ein Freund Dallapiccolas, zur harmlosesten Tonalität zurück. Bernd Alois Zimmermann integrierte verschiedene historische Tonsprachen einschließlich der Tonalität in sein großes Projekt eines musikalischen Pluralismus, das die umfangreichste Verwirklichung in der zwischen 1958 und 1960 komponierten Oper Die Soldaten gefunden hat. Kurz darauf setzte sich auch Pousseur—bei der Arbeit an Votre Faust—mit dem Problem der Reintegration von Elementen der Vergangenheit auseinander. Hymnen von Stockhausen datiert aus dem Jahr 1967, Berios Sinfonia aus dem Jahr 1968. Die nordamerikanische repetitive und minimalistische Musik begann sich etwa um die Jahrzehntwende 1970 zu verbreiten. Ich erinnere mich, wie Ligeti 1969 in Darmstadt In C von Riley vorstellte. Auch in der Sowjetunion vollzogen Komponisten, die.an der westlichen Avantgarde Anteil genommen hatten—wie Schnittke—, eine neo-tonale Wende. Mitte der siebziger Jahre tritt in der Bundesrepublik Deutschland eine Gruppe von Komponisten in Erscheinung, die unter der Bezeichnung "Neue Einfachheit" zusammengefasst werden. In Wirklichkeit wurde der Begriff "Neue Einfachheit" öffentlich erstmals anlässlich einer Konzertreihe des Westdeutschen Rundfunks Köln benutzt, die den nordamerikanischen Minimal-Komponisten und deren vereinzelten deutschen Entsprechungen galt. Und in der Tat ist die repetitive und minimalistische Musik von La Monte Young, Riley, Reich und teilweise von Rzewski auf ihre Art einfach und neu. Es war ein Missverständnis, die gleiche Bezeichnung den deutschen Komponisten zuzuordnen, die mit der Tonalität (wenn auch oft einer mehr intendierten als "beherrschten") die Formen und Besetzungen der spätromantischen Tradition wiedereinführen wollten. Eine im wesentlichen restaurative Haltung, von der sich dann einige wieder distanziert haben, indem sie produktivere Wege einschlugen. Aber so steril diese Haltung auch gewesen sein mag, auch sie hatte wie die anderen erwähnten Phänomene symptomatischen Charakter. Um zu verstehen, wo wir stehen und wohin wir gehen, müssen wir die verschiedensten Symptome interpretieren, und sicher nicht nur diejenigen, die uns gefallen. Dies gilt auch für jene italienische Strömung, die. unter der selbstgewählten Bezeichnung "Neoromantik" kursiert—eine offensichtlich absurde Bezeichnung, sofern der Begriff „Romantik“ auf die gleichnamige komplexe historische und kulturelle Bewegung Bezug nehmen will. Der Begriff wird hier jedoch vielmehr in seiner Vulgärbedeutung benutzt: ein romantischer Spaziergang, eine romantische Nacht, ein romantisches Abendessen bei Kerzenlicht. Es reicht schon so wenig, um "romantisch" zu sein! Eine solche Karikatur der Romantik weist Berührungspunkte auf mit jenem Musikstil, den ich vor Jahren als "neogalant“ bezeichnete. Nicht so sehr im Sinne des 18. Jahrhunderts, als vielmehr im allgemeineren Sinne von elegant, angenehm, salonhaft, oberflächlich. Beide Strömungen lehnen implizit oder explizit die Wiener oder Darmstädter Tradition ab und gehen dagegen von einer Rückbesinnung auf französische Erfahrungen aus: Der Impressionismus in einem Fall, die „Groupe des six“ im anderen. Bei den „Neoromantikern“ (ich nenne sie weiterhin so in Ermangelung einer besseren Bezeichnung: sie sind in der Tat undefinierbar) kommt noch das Kokettieren mit der Rockmusik und die Verehrung für Puccini hinzu. Was aber die Produktion dieser Komponisten wirklich ärgerlich erscheinen lässt ist ihre technische Unzulänglichkeit. Die Tonalität ist kein Slogan, sondern ein über Jahrhundete entwickeltes, musiksprachliches System, das selbst bei einfachster Anwendung eine beachtliche Fähigkeit zur Erfindung und Konstruktion verlangt. Insbesondere wenn man sie heute wieder einsetzen will. Die Beatles wussten damit umzugehen; die Neo-Undefinierbaren nicht. Hier ist Kunst weder das was man muss, noch was man will, und noch weniger das, was man kann. Es ist das, was man nicht kann. Solches vorausgesetzt, denke ich aber, dass wir auch diesen Phänomenen Rechnung tragen müssen. Auch dies ist ein zu analysierendes Symptom. Eine neue Haltung kann sich als Unduldsamkeit gegenüber der alten Haltung manifestieren. 7 Armando Gentilucci, “La musica contemporanea a cavallo tra due decenni: 1970-1980”, in Musica/Realtà Nr. 20, S. 67. Und sie kann am Anfang in grober Form auftreten.8 Alle diese Symptome signalisieren immer deutlicher die Krise und die Randständigkeit der zeitgenössischen Musik. Ihre Unfähigkeit, die Menschen zu interessieren. Ihre Trennung vom Leben. Sie signalisieren die Tatsache, dass die von der Kultur ausgeschaltete tonale Schwerkraft auf die Dauer wieder auftaucht und mit Nachdruck ihre Rechte geltend macht. Eine Bestätigung dafür liefert diejenige Musik, die im Publikum die weiteste Verbreitung findet und am meisten in und durch die Massenkommunikationsmittel eindringt. Abgesehen davon, was ihr wirklicher Wert sein könnte, handelt es sich um Musik, die auf die eine oder andere Weise eine tonale Polarität berücksichtigt. Der Sinn für die tonale Anziehungskraft scheint dem Menschen auf solch anthropologische und archetypische Weise zu eigen zu sein, dass er manchmal ein bescheidenes tonales Stück einem guten atonalen vorzieht. Anders lässt sich nicht erklären, warum Hindemith, obwohl er aus der kritischen Diskussion praktisch verschwunden ist, weiterhin zu den am meisten aufgeführten deutschen Komponisten gehört. Ebenso wie Respighi—außerhalb Italiens—weiterhin einer der am meisten aufgeführten italienischen Komponisten ist. Damit will ich hier keine allzu leichte Polemik gegen diese Komponisten führen, gegenüber denen die neuen Undefinierbaren verblassen müssten, wenn sie nicht schon blutleer wären. Aber anders lässt sich nicht erklären, warum Strawinsky (um von bei weitem blutvolleren Musikern zu sprechen) unendlich häufiger aufgeführt wird als Schönberg. Und Bartók häufiger als Varèse. Um nicht zu sprechen von der Welt der Unterhaltungsmusik, die, wenngleich in verkommeneren Formen, auf einer Art tonalem Gemeinsinn beruht. Man kann nicht alles den perfiden Machenschaften des Marktes oder der multinationalen Konzerne oder der Massenmedien zuschreiben. Es ist wahr, dass niemals soviel Musik der Vergangenheit gehört wurde wie in unserer Epoche, und dass diese Tatsache die Rezeption des Neuen objektiv erschwert. Es ist wahr, dass—zumindest in Italien—Musikunterricht praktisch nicht vorhanden ist. Aber das erklärt nicht alles. Es ist auch wahr, dass nicht alles allen gefalIen kann und dass die Massengesellschaften vor allem zu einer Massierung des schlechten Geschmacks führen. Aber auch das kann nicht alles erklären. Ich persönlich gäbe für die atonalen Fünf Orchesterstücke von Schönberg einige Tonnen neotonaler Musik. Ich denke aber, dass die Abwesenheit einer tonalen Schwerkraft nicht die 8 Zu diesem Problem vergleiche die klugen Ausführungen Hanns Eislers in den Gesprächen mit Bunge: Man hat mir in meiner Jugend vorgeworfen, dass ich ein grober, plumper Herr bin, dessen Arbeiterlieder kraftvoll, schreiend—und auch ästhetisch dann eben unmöglich sind für die Töchter der Bankiers oder für die verwöhnten Musikbesucher. Und .dieser Einwand hat gestimmt. Ich war grob, unelegant und schreiend. Wenn sich ein solcher Mensch—es gibt auch eine Menge Arbeiterhörer, die mir das vorgeworfen haben— gegen meine Musik ausgesprochen hat, dann erinnere ich mich an alte Zeiten. (Sie wissen doch, dass ich— leider—eine gute Erziehung gehabt habe von den Jesuiten.) Ich frage mich: Wie hat sich die neue Kunst durchgesetzt vor 1500 Jahren? Das war genauso kompliziert und interessant, wie es heute ist. Denn ein guter Kenner der Musik würde auch in meinen ersten Anfängen eine neue Funktion, einen neuen Pfiff, eine neue Art gehört haben. Ich versuche das jetzt zu vergleichen. Mein Vergleich hinkt, genauso wie meine Sprache. Da gab es zum Beispiel 425 nach unserer Zeitrechnung einen kleinen Dichter, der hieß Sidonius Apollinaris. Er lebte am Hof der Franken bei den Wisigoten, also am Hof von Bordeaux. Er war ein Dichter der lateinischen klassizistischen Schule, der Epik und Lyrik betrieb. Er sagte: "Es ist mir unmöglich, Gedichte zu schreiben, wenn ich die neuen Völkerschaften sehe, die sich mit schmieriger Butter die Haare einschmieren". Tatsächlich waren die Völkerschaften—darunter auch die Germanen—mit Butter eingeschmiert, so dass sie gestunken haben wie die Pest. "Ich kann nicht eine Ode an die Göttin Venus schreiben, wenn diese Barbaren, die deutschen Barbaren, zu uns kommen, und ich sehe mit Entsetzen, dass bereits meine Kinder anfangen, deutsch zu lernen!" Vor allem missfielen ihm die blauäugigen Sachsen, die nach schlechter Butter stanken und die weder Lateinisch noch irgend überhaupt etwas konnten, nur etwas: töten. Darüber hat dieser Mann ein sehr schönes Gedicht geschrieben. Es ist unbekannt. Nun versuche ich, dieses Gedicht lateinisch vozulesen. Ich nehme nicht an, dass es ankommt; aber in der.Hoffnung. dass unsere Schüler in 20 Jahren Latein besser können werden als ich, versuche ich jetzt, das vorzulesen. Ich habe das Gedicht aufgeschrieben, als ich mit einem Herzinfarkt in einem.Spital in Wien lag. Jedenfalls wollte der Apollinaris folgendes sagen: Es ist.abscheulich, dass ich überhaupt nicht mehr über Kunst sprechen kann, wenn diese stinkenden Barbaren kommen. Ich will großartige Epen schreiben über die Vergangenheit—nun kommen ganz neue Leute! Da klingt eine Glocke in mir. Das erinnert mich an meine Jugend, und das erinnert mich an heute. Denn es ist ungeheuer wichtig zu sehen, dass eine neue Kultur, eine neue Funktion der Kultur, oft barbarisch auftritt, so dass die alten Herren, die die Künste der Venus beschreiben wollen. blass und verstört werden. Aber vergessen wir nicht, dass der Dichter Sidonius Apollinaris 475 nach unserer Zeitrechnung getroffen hat die zukünftigen Shakespeares, Schillers, Goethes, Brechts. Er hat sie noch nicht erkannt. Sie stanken zu sehr nach schlechter Butter. Nun, heute ist das vereinfachter. Sie wissen, dass Brecht einer der größten Meister nicht nur dieses Jahrhunderts ist. Aber diese Art, Kunst zu betrachten, geht nicht. Wir müssen uns frei machen von Dummheiten. Wir dürfen nicht zurückschauen, sondern müssen nach vorn schauen. Das ist eine vielleicht nicht sehr angenehme Betrachtungsweise, aber ich möchte sie doch einmal abgeliefert haben. (Man muss allerdings hinzufügen, dass sich eine neue Musik in dem von Eisler hypothesierten Sinne nicht entwickelt hat und dass somit, in seinem Fall, die anhand der Anekdote von dem lateinischen Dichter exemplifizierte, historische Dialektik nicht funktioniert hat. Ob sie für die hier untersuchte Situation Gültigkeit hat. wird sich in Zukunft zeigen.) normale Bedingung der Musik sein kann. Ich denke, dass, fast am Ende dieses Jahrhunderts der Errungenschaften, aber auch der Furcht und des Elends (die oft die Kehrseite der Errungenschaften darstellen) angelangt, eine Umkehrung der Tendenz nottut. Immer mehr habe ich den Eindruck, dass die großartige Epoche der Emanzipation der Dissonanz und der Atonalität selbst eine große Dissonanz sei, die aufgelöst werden muss. In einer neuen Konsonanz, um das schöne Wort zu gebrauchen, das der Vereinigung den Namen gibt, für die ich die Ehre zu sprechen habe. 9 Ich brauche nicht zu sagen, dass ich mich, wenn ich von Konsonanz oder von tonalen Elementen spreche, nicht auf das musiksprachliche System beziehe, wie es sich historisch seit der Renaissance entwickelt hat. Ich beziehe mich auf die „Polaritäten“, wie sie in der Musik aller Zeiten vorhanden sind. Polaritäten, die auf letztlich „objektiven“ Voraussetzungen beruhen, wie es die Unterteilung des Monochordes oder die Obertonreihe sind. Es stellt sich hier die Frage nach der Beziehung zwischen Musik und Natur, was wiederum einen Teilaspekt des umfassenden Problems der Beziehung zwischen Natur und Kultur darstellt. "Die Natur der Dinge ist nichts anderes als ihre Geburt innerhalb einer bestimmten Zeit und mit einer bestimmten Art und Weise", sagt Vico.10 Die Kultur ist vermenschlichte Natur. Sie kann zur zweiten Natur werden. Aber sie kann sich auch gegen die Vernunft (in Anführungsstrichen) der Natur wenden. Wie es die Lebensfeindlichkeit der Metropolen, die Umweltverschmutzung, die Gefahren der Atomenergie zeigen. Der Mensch lebt aufgrund physiologischer Mechanismen, deren Ursprung sich im Dunkel der Zeiten verliert. Die jüngere Menschheitsgeschichte, die sich in wenigen Jahrtausenden bemisst, kennt keine anthropologischen Mutationen. Trotz der Natürlichkeit—oder besser: Selbstverständlichkeit—mit der wir uns der raffiniertesten Instrumente des Fortschritts bedienen, ähneln unsere Verhaltungsweisen noch insgesamt denen unserer ältesten Vorfahren. Unter dem frischen Lack der historischen Veränderungen bleibt die Struktur, die uns mit der größeren—und nicht immer schönen—Familie der Tiere und Pflanzen verbindet, praktisch unverändert. Wie vermittelt auch immer—unsere Beziehung zur Natur bleibt eine Nabelschnur, die wir nicht durchschneiden können. Es sei denn, wir wollen uns selbst zerstören. An Zeichen eines mehr oder weniger unbewussten Selbstzerstörungswillens fehlt es nicht. Diese Zeichen rufen allerdings entgegengesetzte Zeichen hervor: die Unduldsamkeit gegenüber einem Leben, das immer mehr auf dem Tod der Natur beruht: die Bewegung für den Umweltschutz, die ökologische Politik. In unserem Jahrhundert des Grauens hat die authentischste Kunst das Grauen dargestellt. Sie hat es nicht so sehr oder nicht nur im programmatischen Sinne dargestellt, sondern aufgrund ihrer eigenen Struktur, durch die Unnatürlichkeit (in Anführungsstrichen) ihrer Mittel. Nicht alles, was natürlich ist, ist gut, wie nicht alles künstliche schlecht ist. Tiere zu töten, um sie zu essen, scheint natürlich zu sein. Die Sprache Weberns—künstlich, wenn auch von Goetheschen Reflexionen über die Natur beeinflusst—gehört zu den beachtlichen Leistungen menschlichen Denkens. Aber ist nicht jede Sprache künstlich, umsomehr diejenige der Musik? Doch, aber sie stützt sich auf eine letztlich natürliche Basis. Nicht im Sinne einer reaktionären Interpretation Rameaus (für den die tonale Harmonie auf natürlichen Phänomenen beruhte), und damit auch nicht in dem Sinne, eine historische Sprache zu hypostasieren. Also nicht im Sinne Hindemiths. Eher schon im Sinne des Theoretikers Busoni, der eine Überwindung der Tonalität nicht gegen, sondern durch eine veränderte Beziehung zu den natürlichen Grundlagen der Musik hypothesierte. Im Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst schrieb Busoni: „Wir haben die Oktave in zwölf gleiche Stufen unterteilt, weil wir uns irgendwie behelfen mussten (...). Vor allem die Tasteninstrumente haben unser Gehör so sehr geprägt, dass uns alle Töne außer den zwölf Halbtönen unrein erscheinen. Doch die Natur hat eine unendliche Einteilung—eine unendliche!— geschaffen“.11 Das schrieb Busoni im Jahre 1906. In den achtzig Jahren, die seitdem vergangen sind, hat die Musik viele Prognosen Busonis erfüllt und damit gezeigt—wie es die gesamte Musikgeschichte zeigt—dass die Beachtung der natürlichen Grundlagen der Musik nicht das Aktionsfeld einengt, sondern es vielmehr auszudehnen vermag auf die unterschiedlichsten musikalischen Systeme. Nur das System, das den Blick auf jene natürlichen Grundlagen verliert, erweist sich auf die Dauer als steril. Ich zitiere einen anderen Abschnitt von Busoni: "Jedes Motiv (...) schließt seinen Lebensimpuls in sich ein wie ein Samenkorn. Unterschiedliche Samen erzeugen unterschiedliche Pflanzen, die sich voneinander abheben durch Form, Blattwerk (Laub), Blüten, Früchte, Wachstum und Farben. Selbst die gleiche Pflanzenart wächst in jedem Exemplar unterschiedlich hinsichtlich Entwicklung, Aussehen und Kraft. Ebenso existiert in jedem Motiv seine schon a priori vorgeprägte, vollkommene Form; jedes einzelne Thema muss sich unterschiedlich entfalten, aber jedes folgt dabei der Notwendigkeit der ewigen Harmonie. Diese Form bleibt unzerstörbar und ist sich doch niemals gleich."12 Auch hier bezieht sich Busoni auf die Natur, indem er praktisch Goethe zitiert, nicht um die menschliche Kreativität in irgendwelche, von den zeitlichen wie örtlichen Bedingungen unabhängige Regeln einzubinden, sondern um sie im Gegenteil zu befreien von den Zwängen einer einseitig kulturell ausgerichteten Entwicklung. Die Gedanken Busonis könnten eine Erörterung des Formproblems anregen, eines der am wenigsten 9 Dieser Text ist die leicht veränderte Version eines Vortrages, den ich am 6. November 1986 in Rom anlässlich eines von der musikalischen Vereinigung „Nuova Consonanza“ im Goethe-Institut veranstalteten Kongresses gehalten habe. Die Veranstaltung stand unter dem Thema: "Die Vielfalt von Poetiken und Sprachen in der Musik von heute". Gianbattista Vico, “Scienza Nuova” 147, in Vico, Autobiografia, Poesie, Scienza Nuova, Milano: Garzanti, 1983, S.248. 11 Ferrucio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Wiesbaden: Insel-Verlag, 1954, S.35. 12 Ebda, S. 46. 10 gelösten Probleme in der heutigen Musik, die sich oft zwischen Unförmigkeit und Schema bewegt. Sprache und Form sind untrennbar miteinander verbunden. Die Form, jedesmal verschieden, kann nicht unabhängig von der verwendeten Sprache bestehen. Für das eine wie das andere beruft sich Busoni—der sich selbst als einen Verehrer der Form bezeichnet—auf die unendliche Vielfalt, die in der Natur aus einem einheitlichen Prinzip erwächst. Heute wissen wir, dass das Geheimnis des Lebens, jeden Lebens von den einzelligen Bakterien bis zum Menschen, in einem Molekül liegt, das wiederum in den Chromosomen eines jeden Lebewesens enthalten ist und Desoxyribonucleinsäure (DNS) genannt wird. Es geht nicht darum, Kunst und Natur, Entwicklungsprinzip organischen Lebens und Konstruktion menschlichen Denkens zu verwechseln. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Verwechseln der beiden Bereiche und dem expliziten oder faktischen Leugnen jeglicher Beziehung zwischen ihnen. Der Mensch—geschaffen, um auf seinen zwei Beinen zu gehen—hat Maschinen erfunden, um sich auf der Erde, im Wasser und in der Luft schneller fortzubewegen. Er kann auch den Bedingungen der Erdanziehungskraft entfliehen und die Erdatmosphäre verlassen. Früher oder später muss er jedoch zur.Erde zurückkehren, mit den Füßen auf der Erde stehen und sich seiner natürlichen Mittel bedienen. Dies gilt auch für die Musik. Die tonale Anziehungskraft (im weitesten Sinne verstanden) kann für mehr oder weniger lange Zeitabschnitte ausgeschlossen werden. Die im Zustand der Schwerelosigkeit durchgeführten Erkundungen können besonders reizvoll sein. Früher oder später aber wird die tonale Schwerkraft ihren Anspruch geltend machen und den Menschen zwingen, sie zu berücksichtigen. Abgesehen von der Lösung des Bruches zwischen Leben und Kunst, zwischen Kunst und Natur, werden sich die kommenden Generationen vor die Aufgabe gestellt sehen, den Bruch zwischen Mensch und Natur zu überwinden. Marx nannte diese Lösung Kommunismus. Als vollendeter Naturalismus wird er zum Humanismus, als vollendeter Humanismus zum Naturalismus. Dies hielt Marx in seinen ökonomisch-philosophischen Schriften für die wahre Lösung des Gegensatzes zwischen Mensch und Natur wie zwischen den Menschen untereinander. Leider besitze ich jedoch nicht mehr die Naivität zu glauben, diese Utopie könne auf der Basis der metaphysischen Konzeption einer geschichtlichen Dialektik verwirklicht werden, und umsoweniger glaube ich, man dürfe sich Rettungsprojekten von Gesellschaften anvertrauen, die im Namen der Freiheit Unfreiheit praktizieren. Und doch bleibt diese Utopie, wenn sie von ihrem teleologisch-messianisch-idealistischen Charakter befreit wird, die große Triebfeder, die den Schwindel des metaphysisch Absurden im Namen des Kampfes gegen das historisch Absurde zu überwinden erlaubt. Für Marx ist die vorkommunistische Gesellschaft gleichbedeutend mit der Vorgeschichte der Menschheit. Ich erinnere hier an ein Heinz Klaus Metzger zugesprochenes Bonmot: Alle sprechen von der Posthistorie, ich warte immer noch darauf, dass die Geschichte endlich beginnt. Befinden wir uns also noch in der Prähistorie? Oder in der Postmoderne? Oder nicht vielmehr in einer postmodernen Prähistorie? Die Krise oder—wie gesagt worden ist—die Undurchsichtigkeit der gegenwärtigen Situation hat ihren Ursprung einerseits in der Krise des europäischen Gesellschaftsmodells, das die Basis für die bürgerliche oder moderne Gesellschaft bildete; andererseits im Eindringen anderer Kulturen, für die andere Modelle gelten, auf die Weltbühne und in das Bewusstsein der Menschen. Der Okzident steht für das Werden, die Entwicklung, die Dynamik, die Dialektik, die Zeit, die Geschichte. Der Orient steht für die Wiederholung, die Statik, den Raum, die Natur, die Ewigkeit. Das ist eine schematische Vereinfachung, die jedoch nicht jeglicher Grundlage entbehrt. Man denke nur an die europäische Musik im Gegensatz zu den Traditionen der arabischen, indischen oder chinesischen Musik. Orient und Okzident sind niemals voneinander streng, getrennte Bezirke gewesen. Wechselseitige Einflüsse können in allen Bereichen beobachtet werden, von der Religion über die Philosophie bis hin zur Kunst. Das westliche Modell befindet sich heute in einer Sackgasse. Die Lebensfeindlichkeit unserer Städte, unserer Gesellschaften fordert auf alIen Ebenen ein Überdenken unserer grundlegenden Lebensmotivationen. Doch indem wir uns klarmachen, dass unser Modell weder das einzige noch das beste ist, übernehmen wir nicht einfach Modelle, die sich in anderen kulturellen Kontexten entwickelt haben. Die östlichen Kulturen, oder doch zumindest einige von ihnen, übernehmen umgekehrt auch typische Elemente der westlichen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, ohne deshalb notwendigerweise auf das Erbe ihrer besonderen Kultur zu verzichten. Zur Charakteristik der Postmoderne gehört auch die Gewöhnung an das Nebeneinander, sei es von Kimono und Cowboy-Hut, wie von Islam und Sozialismus, von Prähistorie und Utopie. Der Physiker Niels Bohr behauptete, eine grundlegende Wahrheit sei diejenige, deren Gegenteil ebenfalls eine grundlegende Wahrheit ist. Und auf die Frage: Was ist das Gegenteil der Wahrheit? gab er zur Antwort: Nicht die Lüge, aber die Klarheit.13 Hegel konnte angesichts der Ankunft Napoleons in Jena noch glauben, er habe den Weltgeist zu Pferd gesehen. Wir heute können den Weltgeist sicher nicht mit Reagan identifizieren (ob er nun mit Cowboy-Hut auf einem Pferd sitzt oder nicht). Aber auch nicht mit Gorbatschow oder Deng Xiao Ping, auch nicht mit Khomeini oder Gaddhafi. Es ist unmöglich, eine absolute Wahrbeit durch eine andere zu ersetzen. Wir müssen im Gegenteil die komplexe Pluralität von Wahrheiten zur Kenntnis nehmen, wie grundlegend sie auch sein mögen. Zur Kenntnis nehmen heißt nicht akzeptieren. Wir können und müssen eine Wahl treffen. Die Wahl wird weder aufgrund der Angst vor dem Jüngsten 13 Zitiert nach: Eugenio Barba, „Leoni impazziti nel deserto“, in Oxyrhymeus Evangeliet, Holstebrö (Dänemark): o.J. (1986). Gericht noch aufgrund der illusorischen Hoffnung auf das Paradies auf Erden stattfinden. Sie kann sinnvollerweise nur auf der Basis unserer Geschichte erfolgen. Im Gewirr der Fäden, aus denen sich jenes überaus zerbrechliche und großartige Spinnennetz zusammensetzt, das von Menschen in Jahrtausende währender Geschichte gewebt worden ist, wird der Mensch anknüpfen an jene Fäden, die dazu beitragen können, immer besser das zu definieren, was wert ist, menschlich genannt zu werden. Die veränderte Situation der Menschen auf dem Planeten wird auch im Bereich der Kunst zu einem.anderen Ordnungsgefüge führen. Aber dieses neue Ordnungsgefüge, eine neue Identität der Kunst, kann nicht aus einem voluntaristisch aufgebauten System hervorgehen. Auch hinsichtlich der Musik bezeugt die Geschichte unseres Jahrhunderts die Willkür solcher Systeme—wie Dodekaphonie und Serialismus—welche zu früh die Konsequenzen aus der Entropie der Tonalität gezogen haben—vor allem, weil die Konsequenzen im Sinne einer voluntaristischen Rückkehr zur Ordnung gezogen worden sind. Die Tonalität hat sich auf der Basis einiger "objektiver" Voraussetzungen in einem graduellen Annäherungsprozess zu dem entwickelt, was wir heute als solche ansehen. So werden sich auch die neuen Regeln des musikalischen Metabolismus stufenweise entwickeln aufgrund der theoretischen Reflexion und der kompositorischen Praxis derjenigen, die in den verschiedenen kulturellen Situationen arbeiten. Ich bin überzeugt, dass theoretische Reflexion und kompositorische Praxis dem Rechnung tragen werden müssen, was ich bei anderer Gelegenheit "inklusive" Musik genannt habe,14 d.h. eine Musik. die auf dem Bewusstsein von der Pluralität der Traditionen, Sprachen, Materialien, Techniken beruht. Ich denke, dass dies eine der großen Fragen ist, die sich den Komponisten in den nächsten Jahrzehnten stellen werden. Und in der Tat: So wie die verschiedentliche Rückkehr zur tonalen Polarität das Symptom der Notwendigkeit einer Tendenzwende ist, so fehlen sicherlich nicht die Zeichen einer Bewusstheit gegenüber dem Erfordernis, den verschiedenen musikalischen Wirklichkeiten Rechnung zu tragen. Von Ives bis Zimmermann, von Stockhausen und Berio bis zu den wechselseitigen Einflüssen zwischen westlichen und östlichen Traditionen, zwischen Rockmusik und Kunstmusik, gibt es schon vielfältige und zahlreiche Beispiele von Durchlässigkeit der kulturellen und sprachlichen Kodes. Oft handelt es sich um diskutable Beispiele, aber darauf kommt es nicht an. Sie sind zu verstehen als Symptome einer veränderten und in Zukunft noch weiter sich verändernden Situation. Die andere große, schon angedeutete Fragestellung betrifft eine erneuerte Beziehung zur Natur, selbstverständlich nicht verstanden als eine ideale, abstrakte und unbewegliche Realität, jedoch als Grundlage unseres gesamten Verhaltens, auf die auch das musikalische Verhalten zurückzuführen ist. Es ist die Frage einer Ökologie der Musik. Eine verzerrte Idee des Entwicklungs- und Fortschrittsprinzips hat zu einer Welt geführt, die kurz vor dem kollektiven Selbstmord steht. Jene verzerrte Idee des Entwicklungs- und Fortschrittsprinzips hat auch den Bereich der Kunst und der Musik verseucht. Wenn ich bisher den Begriff „Tendenz-Wende“ gebrauchte, so möchte ich ihn nun ersetzen durch den Ausdruck "Kurswechsel", um nicht das Missverständnis zu erzeugen, ich meinte ein Umkehren. Selbst wenn jedes Zurück unmöglich ist, so ist es doch auch so, dass der Verlauf der Geschichte nicht alles mit sich schleppt. Es gibt grüne und abgestorbene Zweige; die abgestorbenen Zweige können durchaus ihre Bedeutung und Wichtigkeit gehabt haben: als sie noch grün waren. Es ist zu unterscheiden, was heute grün und was abgestorben ist. Der Begriff Ökologie könnte ein anderes Missverständnis hervorrufen. So wie es bei der Ökologie nicht einfach und vereinfachend darum geht, im Namen einer vermeintlichen Rückkehr zum Naturzustand auf die Instrumente des technischen Fortschritts zu verzichten, so kann auch die Rückführung der Musik auf ihre natürliche Grundlage sich der neuen elektro-akustischen Instrumente und des Computers bedienen. Die Ergebnisse einer Musik, die sich noch und wieder auf ihre natürlichen Grundlagen stützt, werden theoretisch unendlich sein, so wie auch die möglichen Formen in der Natur unendlich sind. Die Natur antwortet je nach dem, wie wir sie fragen. Es handelt sich also nicht darum—das will ich noch einmal unterstreichen—, als Lösung eine bestimmte Organisation des musikalischen Materials vorzuschlagen. sondern eine allgemeinere Haltung aufzuzeigen; wenn sie schon für den kleinen Bereich der Musik gilt, müsste sie mit umso größerer Berechtigung auch für die anderen Bereiche menschlicher Aktivität gelten: die Notwendigkeit einer harmonischeren Beziehung zu den in letzter Instanz natürlichen Grundlagen unseres Lebens.15 Die tendenzielle Aufhebung der Kluft zwischen Musik und Natur wird sich positiv auf Siehe “Konstruktion der Freiheit”, a.a.O. Meine Darlegungen haben den Musikkritiker Dino Villatico veranlasst zu schreiben, ich würde mir ein „Zurück zur Natur“ wünschen. In der Folge hat sich zwischen mir und Villatico ein nützlicher Briefdiskurs entwickelt, der gegenwärtig (Februar 1987) noch andauert. In diesern Zusammenhang schrieb ich in einem Brief vom 5.1.1987: Mir scheint, dass Du einen Teil meiner Rede gut zusammengefasst hast: Dass die moderne Musik aus dem Gleis geraten ist durch einen falsch verstandenen Fortschrittsbegriff und dass es angebracht wäre, die Funktion jener Bezugspunkte zu überdenken, zwischen denen sich die musikalischen Kulturen (oder auch nur unsere 14 15 eine dritte wichtige Problematik auswirken können: auf diejenige der Funktion oder besser des Nichtvorhandenseins einer sozialen Funktion und infolgedessen der Randständigkeit der zeitgenössischen Musik. Eine Problematik, die noch weniger als die anderen voluntaristisch in Angriff genommen werden kann, die aber zweifellos zu den Hauptursachen für den Wahnsinn der gegenwärtigen Situation gehört. Eines der Bilder, die mich in meinem Leben am meisten beeindruckt haben, ist dasjenige am Anfang eines GodardFilmes, den ich vor zwanzig Jahren gesehen habe: Man glaubt zunächst einen Teil des Universums zu sehen, mit seinen umkreisenden Sonnensystemen und Galaxien, aber mit der Zeit—indem die Kamera langsam von der Nahaufnahme in die Totale übergeht—erkennt man, dass es sich urn Bewegungen handelt, die von einem Löffel in einer Tasse Kaffee verursacht werden. Bei den von mir hier dargelegten Gedanken habe ich auch wechseln wollen zwischen Nahaufnahme und Totale. Es scheint mir nützlich, die Ebenen zu wechseln und die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Es ist richtig, sich auf die Probleme der zeitgenössischen Musik einzulassen und sie mit allem notwendigen Ernst zu behandeln, als ob es sich um die wichtigste Sache der Welt handelte. Und für uns, die wir diese Arbeit tun, sind sie es auch. Aber gerade um die Probleme mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Strenge anzupacken, sollte man sie manchmal wie aus der Ferne betrachten. Nur das Bewusstsein von der. Grund-Losigkeit des großen Welt-Spiels erlaubt es uns, dass wir uns rückhaltlos unseren Glasperlenspielen hingeben. Der ungarische Komponist Kurtag hat seiner Komposition Omaggio a Luigi Nono einen Satz von Lermontow vorangestellt: "Das Leben ist, wenn Du Dich mit kalter Aufmerksamkeit umschaust, ein leerer und alberner Scherz". Nietzsche zitiert, im 628. Aphorismus von Menschlich, allzu menschlich Platon: "Alles Menschliche insgesamt ist des großen Ernstes nicht wert, trotzdem ...“ Es ist dieses „trotzdem“, was das Leben des Lebens und die Musik des Komponierens würdig macht. westliche Kultur) historisch bewegt haben. Der Vergleich, den ich anstelle mit anderen Bereichen menschlichen Handelns, in denen das „Fortschrittsdenken“ zu ernsthaften Problemen geführt hat, mag gewaltsam erscheinen. Sicher ist die Luftversehmutzung eine andere Sache als die Nutzlosigkeit oder Hässlichkeit mancher Musik, die heute geschrieben wird (die jedoch auch schädlich sein kann), und dennoch, jenseits jeder polemischen Übertreibung, denke ich tatsächlich (ich mag mich irren, aber ich glaube es nicht), dass die Musik im Guten wie im Schlechten teilhat an der allgemeinen Orientierung des Denkens in einem bestimmten historischen Zeitabschnitt, und dass sich somit für die Musik ebenso wie für andere Bereiche das Problem.stellt, darüber nachzudenken, ob wir zufrieden sind mit dem was wir tun oder ob es nicht vielmehr an der Zeit ist, unserer Arbeit (unserem Leben) eine Wende zu geben in eine Richtung, die einerseits zwar berücksichtigt, was unsere Kultur bisher geprägt hat, andererseits aber auch dem Rechnung trägt, was unsere physische wie psychische Natur charakterisiert. Es ist klar, dass der Fortschritt der Menschheit (ein Fortschritt, den ich in wohlverstandenem Sinn sicherlich nicht leugnen will) auch in einer wachsenden Befreiung, von Fesseln der Natur besteht—um ein triviales Beispiel zu geben: ich bin zufrieden, dass wir uns inzwischen ziemlich gut gegen Erdbeben zu schützen wissen—, aber abgesehen davon, dass der zu beschreitende Weg noch sehr lang ist, gibt es Bedingungen, vor denen wir nicht entfliehen können, Bedingungen, die wir nicht ignorieren können—auch wenn wir sie in der Tat ignorieren, in dem Sinne, dass wir noch sehr wenig wissen über die Arbeitsweise unseres Gehirns genausowenig wie wir über unseren eigenen Schatten springen können. Vielleicht sind alle unsere Reden über Rationalität und Emotionalität, und vielleicht der größte Teil unserer ästhetischen Begriffe in Wirklichkeit dilettantisch, weil sie nicht den neurophysiologischen Prozessen Rechnung tragen, die, jenseits aller unserer ästhetischen Konstruktionen, unsere .Reaktionen des Gefallens oder Missfallens bestimmen. Ich gestehe zu, dass ich in meinem Text mit zu großer Entschiedenheit Probleme behandelt habe, die eigentlich mit großer Vorsicht angegangen werden müssten. Ich habe jedoch das Gefühl, auch wenn mir selbst noch lange nicht alles klar ist, mich in die richtige Richtung bewegt zu haben. Eine gewisse Bestätigung geben mir die Ergebnisse, zu denen beispielsweise Linguisten wie Chomsky gelangt sind, welcher zeigen konnte, dass die Satzstrukturen verschiedener Sprachen, sofern man von deren spezifischen Eigenheiten absieht, Gemeinsamkeiten aufweisen, die auf universale Gesetze hindeuten, welche wiederum wahrscheinlich auf die Struktur und die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns zurückzuführen sind. Diese Erkenntnis verhindert zwar keineswegs eine riesige Vielfalt an Sprachen, aber sie kann erklären helfen, warum diese unterschiedlichen Sprachen gemeinsame Strukturen haben oder, anders ausgedrückt, warum sich Sprachen mit völlig atypischer Struktur nicht durchsetzen (...).