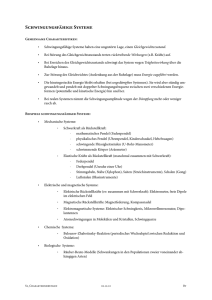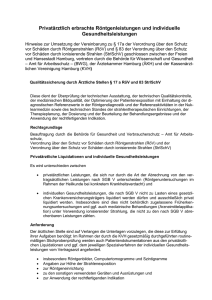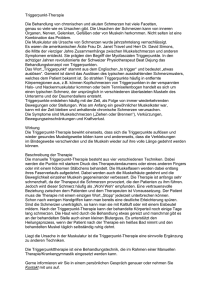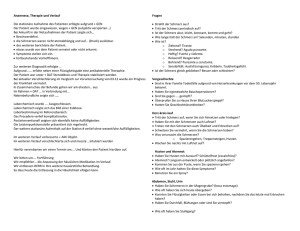Ausgabe 02/09
Werbung
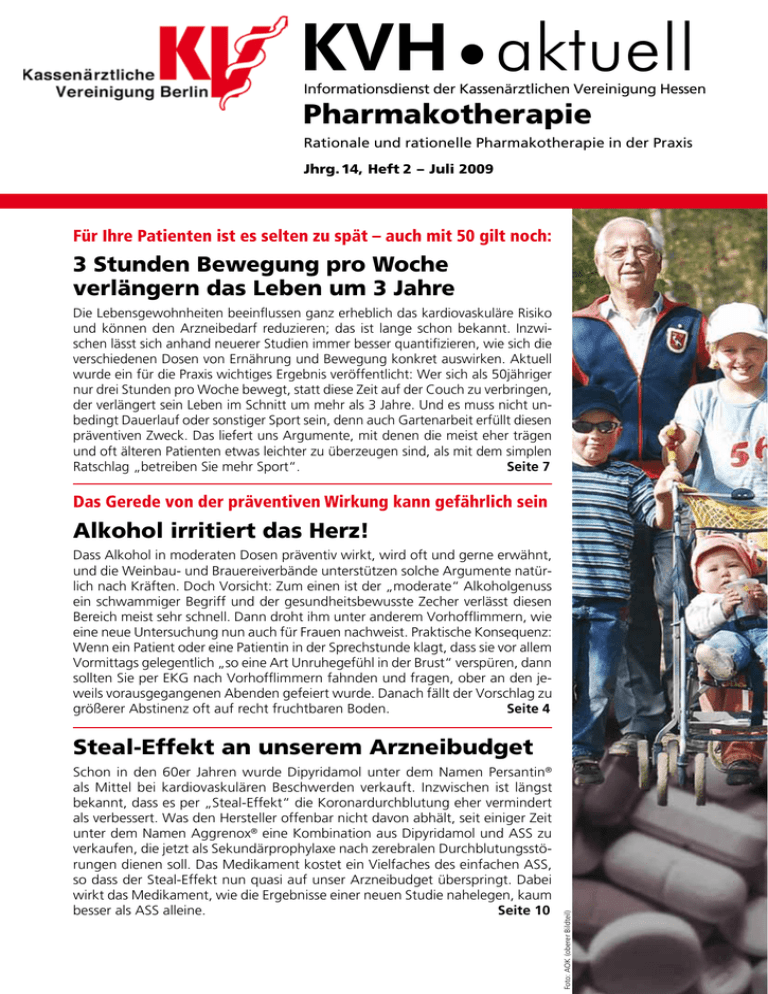
KVH • aktuell Informationsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen Pharmakotherapie Rationale und rationelle Pharmakotherapie in der Praxis Jhrg. 14, Heft 2 – Juli 2009 Für Ihre Patienten ist es selten zu spät – auch mit 50 gilt noch: 3 Stunden Bewegung pro Woche verlängern das Leben um 3 Jahre Die Lebensgewohnheiten beeinflussen ganz erheblich das kardiovaskuläre Risiko und können den Arzneibedarf reduzieren; das ist lange schon bekannt. Inzwischen lässt sich anhand neuerer Studien immer besser quantifizieren, wie sich die verschiedenen Dosen von Ernährung und Bewegung konkret auswirken. Aktuell wurde ein für die Praxis wichtiges Ergebnis veröffentlicht: Wer sich als 50jähriger nur drei Stunden pro Woche bewegt, statt diese Zeit auf der Couch zu verbringen, der verlängert sein Leben im Schnitt um mehr als 3 Jahre. Und es muss nicht unbedingt Dauerlauf oder sonstiger Sport sein, denn auch Gartenarbeit erfüllt diesen präventiven Zweck. Das liefert uns Argumente, mit denen die meist eher trägen und oft älteren Patienten etwas leichter zu überzeugen sind, als mit dem simplen Ratschlag „betreiben Sie mehr Sport“. Seite 7 Das Gerede von der präventiven Wirkung kann gefährlich sein Alkohol irritiert das Herz! Dass Alkohol in moderaten Dosen präventiv wirkt, wird oft und gerne erwähnt, und die Weinbau- und Brauereiverbände unterstützen solche Argumente natürlich nach Kräften. Doch Vorsicht: Zum einen ist der „moderate“ Alkoholgenuss ein schwammiger Begriff und der gesundheitsbewusste Zecher verlässt diesen Bereich meist sehr schnell. Dann droht ihm unter anderem Vorhofflimmern, wie eine neue Untersuchung nun auch für Frauen nachweist. Praktische Konsequenz: Wenn ein Patient oder eine Patientin in der Sprechstunde klagt, dass sie vor allem Vormittags gelegentlich „so eine Art Unruhegefühl in der Brust“ verspüren, dann sollten Sie per EKG nach Vorhofflimmern fahnden und fragen, ober an den jeweils vorausgegangenen Abenden gefeiert wurde. Danach fällt der Vorschlag zu größerer Abstinenz oft auf recht fruchtbaren Boden. Seite 4 Schon in den 60er Jahren wurde Dipyridamol unter dem Namen Persantin® als Mittel bei kardiovaskulären Beschwerden verkauft. Inzwischen ist längst bekannt, dass es per „Steal-Effekt“ die Koronardurchblutung eher vermindert als verbessert. Was den Hersteller offenbar nicht davon abhält, seit einiger Zeit unter dem Namen Aggrenox® eine Kombination aus Dipyridamol und ASS zu verkaufen, die jetzt als Sekundärprophylaxe nach zerebralen Durchblutungsstörungen dienen soll. Das Medikament kostet ein Vielfaches des einfachen ASS, so dass der Steal-Effekt nun quasi auf unser Arzneibudget überspringt. Dabei wirkt das Medikament, wie die Ergebnisse einer neuen Studie nahelegen, kaum besser als ASS alleine. Seite 10 Foto: AOK (oberer Bildteil) Steal-Effekt an unserem Arzneibudget KVH • aktuell Seite 2 Nr. 2 / 2009 Nach der Wahl ist vor der Wahl! Editorial Liebe Kolleginnen und Kollegen, bald ist es wieder soweit: Die Bundestagswahlen stehen im Herbst an. Das ist Anlass für mich für einen kurzen Rückblick. Was ist übrig von den Reformen und Gesetzesänderungen, die nach der letzten Wahl erfolgt sind? Nehmen wir das Beispiel Bonus-Malus-Regelung, eine „Erfindung“ aus dem Hause Ulla Schmidt. Damit wollte die Gesundheitsministerin die Arzneimittelausgaben in den Griff bekommen. Das Verschreibungsverhalten der Vertragsärzte sollte kontrolliert werden, bei unwirtschaftlichem Verordnen drohte dem Arzt ein individueller Malus. Bereits im Oktober 2007 einigten sich KBV und Krankenkassen, die Bonus-Malus-Regelung ab 2008 nicht mehr anzuwenden. Grund: die Rabattverträge. Die offiziellen Arzneimittelpreise repräsentieren nicht mehr die von den Kassen getragenen, tatsächlichen Arzneimittelkosten. Die mit großem Brimborium gefeierte Regelung funktionierte nicht und ist einfach heimlich still und leise von der Bildfläche verschwunden. Apropos Arzneimittel-Rabattverträge: Auch diese sorgten seinerzeit für viele Schlagzeilen. Patienten waren vielerorts verunsichert, weil sie ihr gewohntes Präparat nicht mehr bekamen. Sie als Ärzte hatten in Ihrem eh schon knappen Behandlungszeitfenster auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ulla Schmidt erhoffte sich dadurch neben der Kostenreduktion im Arzneimittelsektor u. a. eine verbesserte Qualität der Patientenversorgung und weniger Bürokratie. Doch was ist daraus geworden? Sie erreichte genau das Gegenteil: Die Rabattverträge führten besonders anfangs bei den Vertrags-Arzneimittelherstellern mit bis dahin geringem Marktanteil zu Versorgungsengpässen, also eher zu einer verminderten Versorgungsqualität der Patienten. Dieses Problem tritt selbst heute ab und an noch auf. Auch der erhoffte Bürokratieabbau verkehrte sich bei allen beteiligten Akteuren ins Gegenteil. Nennenswerte Einsparungen sind bis heute nicht erkennbar! Geblieben sind jedoch ein Mehr an Bürokratie sowie in vielen Fällen eine Belastung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Das Problem der Arzneimittelausgaben ist nach wie vor jedoch nicht gelöst! Gerade in Berlin bekommen wir Ärzte das zu spüren. Die Patienten kommen besonders für die fachärztliche spezialisierte Behandlung oft auch aus dem Umland in die Hauptstadt. Das trägt nicht zur Entspannung der Ausgaben-Problematik bei. Daher wollen wir Ihnen auch weiterhin mit KVH aktuell Pharmakotherapie wertvolle Tipps für wirtschaftliches Verordnen geben. So können Sie in dieser Ausgabe nachlesen, wie Sie Schluss machen mit dem „Steal-Effekt“ in Ihrem Arzneimittelbudget durch teure Fixkombinationen wie Aggrenox®: In dem Artikel „Der neue ‚Steal-Effekt‘ durch Dipyridamol“ wird kritisch hinterfragt, ob die en vogue gekommene Kombination von Dipyridamol mit ASS wirklich die bessere Alternative zur ASS-Monotherapie darstellt. Wussten Sie eigentlich, dass die Kombination Aggrenox® gegenüber ASS 50 Mal teurer, die Effektivität jedoch nur unwesentlich besser ist? ASS ist jedoch nicht bei allen Leiden ein probates Arzneimittel. So ergab die PROPADAD-Studie, dass „Bei Diabetikern ASS und Vitamine als Primärprophylaxe nutzlos“ sind. Hingegen eignen sich Maßnahmen wie Rauchverzicht, mediterrane Kost oder Bewegung zur primären Prävention. Dass Bewegung nicht schadet, sondern sogar eine nicht medikamentöse Möglichkeit zur Verlängerung der Lebenszeit ist, können Sie in dem Artikel „Neue Faustregel für 50-Jährige“ nachlesen. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre des aktuellen Heftes wie immer viel Spaß und viele wertvolle Tipps für Ihre Praxis! Ihre Angelika Prehn Vorstandsvorsitzende der KV Berlin Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 3 Editorial (nicht in allen Ausgaben) 2 Alkohol und Vorhofflimmern Dr. med. Klaus Ehrenthal 4 Beschichtete Stents brauchen länger eine duale Plättchenhemmung 6 Neue Faustregel für 50-Jährige Drei Stunden Gartenarbeit pro Woche bringen über drei zusätzliche Lebensjahre Dr. med. Klaus Ehrenthal Der neue„Steal-Effekt“ durch Dipyridamol Dr. med. Henning Harder 12 Antidepressiva im Vergleich Welches ist für die Praxis am besten? Dr. med. Klaus Ehrenthal Inhaltsverzeichnis 7 10 12 Schmerztherapie Der richtige Umgang mit starken Opiaten 14 Ergebnis der POPADAD-Studie Bei Diabetikern sind ASS und Vitamine als Primärprophylaxe nutzlos 18 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf Masern-Impfung: Aufarbeitung einer Epidemie in NRW Internethandel: Aktuelle Warnungen 19 Rezept des Monats: Warum müssen es gleich drei Benzos sein? 20 Exotische Therapie bei chronischen Wunden Sind Fliegenmaden wirklich besser als Hydrokolloid-Verbände? Dr. med. Joachim Feßler 20 Hausärztliche Leitlinie Psychosomatische Medizin Psychische Störungen: Psychosomatische Anteile Verhaltensstörungen und psychische Auffälligkeiten Risikofaktoren und ihre psychosomatischen Ursachen Suchtprobleme 22 23 29 37 38 Hausärztliche Leitlinie Palliativmedizin – die Tischversion zum Ausschneiden, Teil 3 43 19 19 Impressum Verlag: XtraDoc Verlag Dr. med. Bernhard Wiedemann, Pfingstbornstr. 38, 65207 Wiesbaden Herausgeber: Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt Redaktionsstab: Dr. med. Joachim Feßler (verantw.), Dr. med. Klaus Ehrenthal, Dr. med. Margareta Frank-Doss, Dr. med. Jan Geldmacher, Dr. med. Harald Herholz, Klaus Hollmann, Dr. med. Günter Hopf, Dr. med. Wolfgang LangHeinrich, Dr. med. Alexander Liesenfeld, Renata Naumann , Karl Matthias Roth, Dr. med. Michael Viapiano, Cornelia Wachsen, Dr. med. Jutta Witzke-Groß Fax Redaktion: 069 / 79502 8467 Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. med. Ferdinand Gerlach, Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt; Prof. Dr. med. Sebastian Harder, Institut für klinische Pharmakologie der Universität Frankfurt Die von Mitgliedern der Redaktion oder des Beirats gekennzeichneten Berichte und Kommentare sind redaktionseigene Beiträge; darin zum Ausdruck gebrachte Meinungen entsprechen der Auffassung des Herausgebers. Mit anderen als redaktionseignen Signa oder mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung der Verfasser wieder und decken sich nicht zwangsläufig mit der Auffassung des Herausgebers. Sie dienen der umfassenden Meinungsbildung. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Veröffentlichung berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- oder Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Wie alle anderen Wissenschaften sind Medizin und Pharmazie ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere, was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in dieser Broschüre eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autor und Herausgeber große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angaben dem Wissensstand bei Fertigstellung der Broschüre entsprechen. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Herausgeber jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. KVH • aktuell Seite 4 Für Sie gelesen Nr. 2 / 2009 Alkohol und Vorhofflimmern Dr. med. Klaus Ehrenthal Die Autoren David Conen et al. veröffentlichten 2008 in JAMA die Ergebnisse einer Studie [1], in der sie die Wirkung von mäßigem bis erheblichem Alkoholgebrauch auf den Herzrhythmus bei Frauen untersucht hatten. Seit Längerem ist die Entstehung verschiedener kardiovasulärer Risiken wie Arrhythmien und Schlaganfall durch Alkoholgebrauch bekannt [2, 3, 4]. Dabei galt es als erwiesen, dass ein nur geringer Alkoholgebrauch („consuming moderate amounts of alcohol“ = weniger als zwei Drinks am Tag – siehe Kasten „Was ist ein Drink?“ auf dieser Seite) eher mit einem reduzierten Risiko für KHK, Schlaganfall und kongestive Kardiomyopathie einherging. Dies war allerdings beim Konsum von exzessiven Mengen (= mindestens zwei Drinks pro Tag) genau umgekehrt: Das Risiko stieg an für Herzinfarkt, Schlaganfall, kongestive Kardiomyopathie und Vorhofflimmern. Weitere Untersuchungen erbrachten sich widersprechende Resultate sowohl für Männer als auch für Frauen: das Risiko für akute Vorhofflimmerattacken durch mäßiges bis starkes Alkoholtrinken (= täglich mindestens zwei Drinks) wurde für Männer bestätigt, nicht aber für Frauen. Die Aussagekraft dieser Studien war allerdings wegen zu kleiner Probandenzahlen von Was ist ein Drink? moderat bis stark trinkenden Frauen in den Untersuchungen Um mit dem Maßstab „Drink“ nicht gesichert. in einer Studie zu argumentieren, ist natürlich eine Definition Um zu klären, wie sich regelmäßiger Alkoholgenuss auf das Risiko notwendig: Ein angelsächsischer von Vorhofflimmern bei Frauen auswirkt, wurde von Conen et al. Drink meint 25 ml Schnaps, altereine gut zwölf Jahre dauernde randomisierte kontrollierte Studie nativ 50 ml Likör, 0,25 l Bier oder bei 34.715 gesunden Frauen im Alter von über 45 Jahren, Teil0,1 l Wein mit jeweils etwa acht nehmerinnen der Women’s- Health-Study in den USA mit NachunGramm reinem Alkohol. tersuchungen von 1993 bis zum Oktober 2006 durchgeführt. [1] Diese Frauen hatten zu Beginn der Untersuchung kein Vorhofflimmern gehabt. Sie wurden zu ihrem Alkoholgebrauch befragt mit einer Nachbefragung nach 48 Monaten. Sie wurden nach ihrem Alkoholkonsum in vier Gruppen eingruppiert („Ich trinke nie Alkohol / gelegentlich einen Drink oder höchstens einen Drink am Tag / ein bis zwei Drinks täglich / mindestens zwei Drinks am Tag“). 15.370 Frauen (44,3 Prozent) tranken nie, 15.758 (45 Prozent) tranken weniger als 1 Drink am Tag, 2.228 (6,4 Prozent) tranken täglich ein bis zwei Drinks und 1.359 (3,9 Prozent) tranken zwei oder mehr Drinks pro Tag. Die Ergebnisse der weiteren regelmäßigen Nachuntersuchungen bis zum Ende der zwölfjährigen Beobachtungszeit wurden mit anderen Risiken (Diabetes, Hypercholesterinämie, HDL-Cholesterol, BMI, Blutdruck, Rauchen, ethnischer Zugehörigkeit) in den einzelnen Gruppen unterschiedlich gelistet und statistisch sorgfältig analysiert. Ergebnisse Bei einem Alkoholgebrauch von bis zu zwei Drinks am Tag durch gesunde Frauen im mittleren Lebensalter fand sich keine Häufung von akutem Vorhofflimmern. Wurden jedoch regelmässig täglich zwei oder mehr Drinks eingenommen (1.359 Frauen = 3,9 Prozent aller 34.715 Untersuchten), fanden die Autoren in ihrer großen, mit den Nachuntersuchungen über zwölf Jahre laufenden Studie, ein signifikant vermehrtes Vorhofflimmern, das auch als Ausgangsrisiko für Apoplexien gesehen werden muss. Das Risiko war 1,6-fach erhöht gegenüber den Nichttrinkerinnen. Interpretation Nicht nur bei Männern [3], sondern auch bei Frauen ist somit Alkohol als ein deutlich dosis­abhängiger Risikofaktor für das Entstehen von Vorhofflimmern bewiesen. Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Die Mär vom „French Paradox“ (Alkohol schützt angeblich Herz und Koronarien) sollte keinesfalls als dosisunabhängig gesichert dargestellt werden. Dieses beliebte Pseudoargument wird oft von medizinischen Laien für einen regelmäßigen und viel zu hohen Alkoholgebrauch vorgeschoben. Die Wahrheit ist: Nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen ist regelmäßiger Alkoholgenuss als kardiotoxisch einzustufen. Dieses Risiko ist individuell und dosisabhängig je nach Konstitution, Körpergewicht und Komorbidität (z.B. Leberfunktion, Stoffwechselkonstellation, Arteriosklerose usw.) zu werten. Seite 5 Angeblich kardioprotektive Wirkung verführt Laien zum Suff Weitere Probleme, die dabei auftreten: Interaktionen durch Ethanol mit Medikamenten sind möglich, Alkohol ist Substrat von Cytochrom P450 (CYP 1A2, 2E1, 3A4) und induziert andererseits auch CYP 2E1 und 3A4. Die abbauende Alkoholdehydrogenase kommt interindividuell sehr unterschiedlich vor. Sie liegt vor allem im Magendarmkanal vor und ist in der Regel bei Frauen gegenüber Männern deutlich vermindert. Dadurch ist der first-pass-Effekt der Verstoffwechselung von Ethanol bei Frauen gegenüber Männern (23 Prozent versus 59 Prozent) vermindert [6]. Dieses Ferment ist auch vermindert bei Ostasiaten, indigenen Bewohnern Amerikas sowie Aborigines in Australien. Die Gefahr einer Abhängigkeit ist je nach dem Vorliegen einer Suchtpersönlichkeit und der zugeführten Dosis von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Ethylalkohol kann auch schon bei geringen aber regelmäßig eingenommenen Mengen zur Sucht führen, die dann oft geleugnet oder sorgfältig versteckt wird. Was bedeutet das für die Praxis? Bei Patienten mit Flimmerarrhythmie sollte der Hausarzt deswegen immer nach der Regelmäßigkeit von Alkoholgebrauch und eventueller leber- und/ oder neurotoxischer Komedikation fragen und außerdem die Trinkmenge erfragen. Auch hierzu sollte das Beratungsergebnis häufig einmal zu dem ärztlichen Ratschlag von „drug holidays“ führen, da der oft versteckte und gerne verschwiegene, gesundheitsgefährdende regelmäßige Alkoholmissbrauch Herz und Hirn bei Mann und Frau gefährden kann. Ist es zu einem dauerhaften Vorhofflimmern gekommen, so ist dann zur Prophylaxe einer Hirnembolie in geeigneten Fällen eine Marcumartherapie zu diskutieren, die hierzulande immer noch zu wenig angewendet wird. Einzelheiten dazu finden sich in der Hausärztlichen Leitlinie „Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten“ der Hessischen Leitliniengruppe [5]. Dass Alkohol Herz und Gefäße schützt, sollte auf keinen Fall in der Sprechstunde betont werden – die geringe protektive Dosis wird viel zu leicht überschritten. Interessenkonflikte: keine Literatur: 1 Conen D, Tedrow UB, Cook NR, Morthy MV, Buring JE, Albert CM: Alcohol Consumption and Risk of Incident Atrial Fibrillation in Women. JAMA 2008;300(21): 2489-2496 (doi:10.1001/jama.2008.755) http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/300/21/2489 2 Stampfer CH, Colditz GA, Willett WC, Speizer FE, Hennekens CH: A prospective study of moderate alcohol consumption and the risk of coronary disease and stroke in women. N Engl J Med.1988;319(5):267-273 3 Hansagi H, Romelsjo A, Gerhardsson de Verdier M, Andreasson S, Leifman A: Alcohol consumption and stroke mortality: 20-year-follow-up of 15.077 men and women. Stroke.1995;26(10):1768-1773 4 Ettinger PO, Wu CF, De La Cruz Jr, Weisse AB, Ahmed SS, Regan TJ: Arrhythmias and the „holiday heart“: alcohol-associated cardiac rhythm disorders. Am Heart J. 1978;95(5): 555-562 5 Hausärztliche Leitlinie der Leitliniengruppe Hessen: Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten, Version vom 21.01.2009 www.pmvforschungsgruppe.de > publikationen > leitlinien oder www.pmvforschungsgruppe.de/content/03_publikationen/03_d_leitlinien.htm oder auf den Seiten des ÄZQ: www.leitlinien.de/leitlinienanbieter/deutsch/pdf/hessenantikoagulation 6 Frezza M, di Padova C, Pozzato G, Terpin M, Baraona E, Lieber CS: High blood alcohol levels in women. The role of decreased gastric alcohol dehydrogenase activity and first-pass metabolism. N Engl J Med. 1990;322:95-99 Bedeutung für unsere Praxis Praxis-Tipp Unspezifische thorakale Unruhe Bei diesen häufigen Beschwerden sollte man auch an intermittierendes Vorhofflimmern nach Alkoholgenuss denken (z. B.: Tag nach der Party!) KVH • aktuell Seite 6 Der Gastbeitrag Nr. 2 / 2009 Beschichtete Stents brauchen länger eine duale Plättchenhemmung Studienziele Mit der Beschichtung von koronaren Gefäßstützen (Stents) mit Sirolimus oder Paclitaxel konnte man die Häufigkeit der Restenosierung in den mit einem Stent versorgten Koronarien, nicht aber die Gesamtmortalität verringern. In einer MetaAnalyse mit Diabeteskranken war die Mortalität mit Sirolimus-beschichteten Stents gar 2,9-mal so hoch wie mit nicht-beschichteten Metallstents. Mit einer NetzwerkMetaanalyse wurde versucht, die Resultate mit den verschiedenen Stents bei Personen mit und ohne Diabetes- Erkrankung zu vergleichen.1 Methoden Verschiedene elektronische Datenbanken, relevante Internetseiten, Bücher und andere Quellen ohne Rücksicht auf die Sprache wurden nach entsprechenden Studien durchsucht. Eingeschlossen in die Meta-Analyse wurden Doppelblindstudien von mindestens sechs Monaten Dauer. Primäre Endpunkte waren die Gesamtmortalität und notwendige Revaskularisationen des mit einem Stent versorgten Gebietes. Ergebnisse 35 Studien mit rund 4.000 Diabeteskranken und 11.000 Personen ohne Diabetes mellitus konnten für die Analyse verwendet werden. Die Gesamtmortalität bei den Diabeteskranken erschien in verschiedenen Studien heterogen und stark von der Dauer der dualen Plättchenhemmung mit Acetylsalicylsäure (ASS, Aspirin® u.a.) plus Clopidogrel (Plavix®) abhängig zu sein. Nach Ausschluss der Studien mit einer Behandlungsdauer von weniger als sechs Monaten waren die Resultate homogener und die Gesamtmortalität war bei den verschiedenen Stents ungefähr gleich. So betrug das relative Risiko für Sirolimus-Stents gegenüber einfachen Metall-Stents 0,88 (95%-CI 0,55 - 1,30), für Paclitaxel-Stents gegenüber Metallstents 0,91 (0,60 - 1,38) und für Sirolimus-Stents gegenüber Paclitaxel-Stents 0,95 (0,63 - 1,43). Bei Personen ohne Diabetes hatte die obige Einschränkung keinen Einfluss auf die relativen Risiken. Bei den beschichteten Stents waren weniger Revaskularisationen notwendig als bei den einfachen Metall-Stents, sowohl bei Diabetikern wie auch bei Personen ohne Diabetes. Schlussfolgerungen Wenn die duale Plättchenaggregationshemmung mit Acetylsalicylsäure und Clopidogrel während mindestens sechs Monaten durchgeführt wurde, waren medikamentös beschichtete Stents bei Diabeteskranken und Personen ohne Diabetes mellitus wirksam und sicher. Zusammengefasst von Peter Koller Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des infomed-Verlags aus infomed-Screen Nr. 6/2008 Diese komplizierte, aber sorgfältig durchgeführte Meta-Analyse zeigt, dass Diabeteskranke von medikamentös beschichteten Stents bezüglich Verminderung von erneuten Revaskularisationen nicht nur mehr profitieren als Nichtdiabetiker, sondern dass diese Stents, bei adäquater Nachbehandlung, auch gleich sicher sind wie nichtbeschichtete Stents. Nachdem neue Daten in gleicher Weise keinen Mortalitätsnachteil der perkutanen Intervention gegenüber der Bypasschirurgie bei Diabeteskranken gezeigt haben, kann die weniger invasive perkutane Revaskularisation damit den häufig polymorbiden diabetischen Patientinnen und Patienten empfohlen werden. Franz R. Eberli Literatur: 1: Stettler C, Allemann S, Wandel S et al. Drug eluting and bare metal stents in people with and without diabetes: collaborative network metaanalysis. BMJ 2008 (29. August); 337: a1331 Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Neue Faustregel für 50-Jährige Drei Stunden Gartenarbeit pro Woche bringen über drei zusätzliche Lebensjahre Seite 7 Für Sie gelesen Dr. med. Klaus Ehrenthal Bereits in Heft 1/2008 von KVH aktuell Pharmakotherapie haben wir über besondere nichtmedikamentöse Möglichkeiten, die Lebenszeit zu verlängern, anhand der „EPIC-Norfolk Prospective Population Study“ berichtet [1, 2]. Dabei waren vier Maßnahmen der Änderung des Lebensstils von signifikanten Erfolgen belohnt: Nichtrauchen Körperliche Aktivität Alkoholreduktion ausreichender Verzehr von Obst und Gemüse Je nach der Intensität der Teilnahme an entsprechenden nachhaltigen Änderungen des Lebensstils (Bewertung mittels eines Punktescores) konnte dabei ein Lebenszeitgewinn von maximal 14 Jahren errechnet werden. Inzwischen sind weitere Langzeit-Untersuchungen erschienen, die besonders die körperliche Aktivität untersuchten [3, 4]. Byberg et al. [3] untersuchten in Uppsala mit einer sorgfältigen, über 35 Jahre (1970 bis 2006) fortgeführten Kohortenstudie alle dort im Jahr 1920 geborenen Männer. 1970 wurden 2.841 50-jährige Bürger angesprochen, von ihnen nahmen 2.205 freiwillig an den Gesundheits-Survey-Untersuchungen teil. Nachuntersuchungen fanden bei ihnen im Alter von 60, 70, 77 und 82 Jahren statt. Dabei wurden unter anderem folgende Parameter zu den körperlichen Freizeitaktivitäten ermittelt und entprechend eingestuft: Gruppe 1:meist sitzende Freizeittätigkeiten (Lesen, Fernsehen, Kinogänge usw.) Gruppe 2:Freizeitaktivitäten wie Wandern, Fahrradfahren Gruppe 3:Freizeitsport (3 Stunden Sport, gleichwertig 3 Stunden körperlich aktive Gartenarbeit pro Woche) Gruppe 4:regelmäßige anstrengende körperliche Aktivitäten (sportliches Training, Sportwettkämpfe) Außerdem wurden untersucht bzw. erfragt: Größe und Gewicht (BMI) Systolischer und diastolischer Blutdruck Allgemeiner Gesundheitsstatus Labor: Serumcholesterin, Diabetesdiagnostik Medikamentengebrauch Rauchgewohnheiten Alkoholgewohnheiten Aufgrund der numerischen Personenkennzeichung aller schwedischen Bürger konnten bis zum Studienende 2006 alle lebenden Männer vollständig (ohne Drop-out-Fälle!) nachuntersucht und nachbefragt werden. Es wurde anschliessend zu verschiedenen Fragestellungen eine sorgfältige statistische Berechnung vorgenommen. Ergebnisse der Freizeitsportuntersuchung aus Uppsala Bei der Untersuchung der kumulativen Mortalität bis zum Ende der Untersu- Vergleich zwischen Sofahocker und Freizeitgärtnern KVH • aktuell Seite 8 Nr. 2 / 2009 chungen zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Lebenserwartung besonders in Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität: Gruppe Aktivität Mortaltätsrate* 1 geringe körperliche Aktivität 27,1 2 mittlere körperliche Aktivität 23,6 3+4 starke körperlichen Aktivität 18,4 Cumulative total mortality (%) * Mortalitätsrate pro 1000 Probanden 100 Das Ergebnis entsprach, wenn man andere Faktoren subtrahierte (körperlich aktive Männer hatten einen besseren BMI, bessere Laborparameter und Blutdruckwerte), einem Gewinn in Lebensjahren von Gruppe 2:1,8 Lebensjahren Gruppe 3+4 : 3,8 Lebensjahren Low physical activity Medium physical activity High physical activity 80 60 30 20 0 50 60 70 80 90 Age (years) 60 70 77 82 End of study 1904 1406 1123 933 876 Schon relativ wenig Bewegung hat hohe Wirkung! Das bedeutet: Alleine die körperliche Freizeitaktivität von 3 Stunden wöchentlich ab dem 50. Lebensjahr (entsprechend Gartenarbeit oder anderen AktiviFig Grafik 2 | Cumulative mortality from age 50 (Cox regression) zeigt täten) konnte das Leben der untersuchten Männer Diese aus der Originalveröffentlichung to leisure time physical level and total Akdie according kumulative Mortalität bei activity unterschiedlichen deutlich verlängern. Eine weitere Feststellung aus mortality. At end of follow-up, estimated proportions of deaths tivitätsmustern. Obere Linie: Stark steigende Morden Ergebnissen dieses Gesundheitssurveys war, were 81.4 (95% confidence interval 80.8 to 82.0) for low talität beiactivity, den Bequemen der for Gruppe Mittlere physical 72.0 (71.5 to 72.5) medium,1. and 61.8 dass diese gewonnenen Lebensjahre in der gleichen (61.4 to 62.2) for high gestrichelte Linie: Gruppe 2. Untere Linie: Gerings- Größenordnung lagen, wie sie durch das Einstellen ter Anstieg der Mortalität bei den Gruppen 3+4. des Rauchens erreicht werden konnten. Der Effekt von regelmäßigen körperlichen Aktivitäten über drei Stunden pro Woche auf die Lebenserwartung war nach den Berechnungen der Untersucher deutlich höher als der Benefit, der mit der Absenkung des Serumcholesterins um 1 mmol/l und ebenfalls höher, als er durch eine antihypertensive Behandlung erreicht Bewegung bringt werden konnte. gleichen Effekt wie antihypertensive In einer weiteren Langzeitstudie über 21 Jahre untersuchten Chakravarty et al. [4] Behandlung in Nordkalifornien die Überlebenszeit von 538 Mitgliedern von Laufsportgruppen im Vergleich mit 423 gesunden, nicht laufenden Kontrollfällen. Erfasst wurde auch der Gesundheitszustand (Gesundheits-Check, Health Disability Index, HAQ-DI mit Scores von 0 = keine Probleme bis 3 = die Unfähigkeit, bestimmte Alltagsaktivitäten durchzuführen). Alle Probanden waren 50 Jahre alt oder älter. Untersucht wurden Lauf- und Übungshäufigkeit, der BMI und Ausfälle beim Gesundheits-Check. Age 50 Men at 2205 risk Gruppenläufer bleiben im Alter selbständiger Die Todesfälle bei den Probanden wurden anhand des nationalen Sterberegisters festgestellt, so dass hier lückenlose Daten zur Verfügung standen. Das Ergebnis: Nach 19 Jahren waren nur 15 Prozent der Läufer verstorben gegenüber 34 Prozent der Kontrollen (in absoluten Zahlen: 81 versus 144). Das bedeutet eine NNT von 5 als Überlebensvorteil der Läufer nach 19 Jahren! Nach 21 Jahren, im Jahr 2005, kamen von den 538 Laufgruppenteilnehmern Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 9 284 zur Nachuntersuchung, von den 423 gesunden Kontrollfällen ohne Laufsport waren es 156. Die Untersuchung dieser Probanden zeigte, dass der HAQ-DisabilityIndex bei den Läufern einen deutlich besseren Verlauf als in der Kontrollgruppe genommen hatte. Er war zwar mit voranschreitendem Alter in beiden Gruppen angestiegen, jedoch deutlich stärker bei den Kontrollen (von 0,095 auf 0,43) als bei den Läufern (von 0,029 auf 0,2). Im Klartext: Die Gruppenläufer bewältigten ihr Alltagsleben besser und waren signifikant weniger beeinträchtigt bzw. behindert als die Leute in der Kontrollgruppe. Auch ältere Patienten profitieren noch Bedeutung Auch in der Lebensmitte lohnt es sich noch, mit regelmäßiger körperlicher Aktivität (z.B. Freizeitsport, Gartenarbeit und vergleichbaren körperlichen Tätigkeiten) [3] zu beginnen: es kommen immer mehr Langzeituntersuchungen (hier über 21 und 35 Jahre) zu dem signifikanten Ergebnis einer Verlängerung der Lebenszeit durch regelmässige körperliche Bewegung [3, 4]. Dadurch wurde der Benefit einer Cholesterinsenkung sowie einer Blutdrucksenkung im späteren Alter sogar noch übertroffen, ganz zu schweigen von Vorteilen beim erhöhten BMI, beim metabolischen Syndrom, beim Typ-2-Diabetes, bei einem kognitiven Altersabbau und bei einer Sturzprophylaxe durch bessere O2-Versorgung und Muskelaufbau sowie durch bessere kardiovaskuläre Fitness [4]. Der Benefit, den das Einstellen des Rauchens gab, lag in der gleichen Größenordnung, wie der Benefit durch körperliche Aktivität [4]. für unsere Praxis Schon drei Stunden Bewegung pro Woche können für TablettenVerweigerer eine Alternative sein. Bei einer medikamentösen Behandlung der genannten Krankheitsbilder sollte also der Hausarzt auch in der zweiten Lebenshälfte dem Patienten, wo immer das möglich ist, eine regelmäßige körperliche Aktivierung als wichtigste nichtmedikamentöse Maßnahme (neben dem Einstellen des Rauchens) ans Herz legen. Nicht nur, weil er damit „Chemie einsparen kann“, sondern weil dadurch in vielen Fällen Krankheiten ursächlich behandelt werden können. Literatur: 1 Khaw KT, Wareham N, Bingham S, Welch A, Luben R, Day N: Combined Impact of Health Behaviors and Mortality in Men and Women. The EPIC-Norfolk Prospective Population Study. PloS Medicine 2008;5:e12 www.plosmedicine.org / Jan 2008;(5), 1,e12:0001-0009 http://www.srl.cam.ac.uk/epic/ 2 Ehrenthal K. Vier Punkte verlängern das Leben um 14 Jahre. KVH aktuell Pharmakotherapie, März 2008; (13)1:12-13 3 Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundström J, Ahlborn A, Zethelius B, Berglund LG, Wolk A, Michaelsson K. Total Mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort. BMJ 2009;338:b688 doi:10.1136/bmj.b688 4 Chakravarty EF, Hubert HB, Lingala VB, Fries JF. Reduced Disability and Mortality Among Aging Runners. A 21-Year Longitudinal Study. Arch Intern Med. 2008;(15):1638-46 Foto: BW Interessenkonflikte: keine Drei Stunden pro Woche im Garten arbeiten, statt vor dem Fernseher zu hocken – das bringt bereits eine Lebensverlängerung von mehr als drei Jahren. Und zwar selbst dann, wenn man erst mit 50 beginnt. Seite 10 Für Sie gelesen KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Der neue„Steal-Effekt“ durch Dipyridamol Dr. med. Henning Harder „Was viele Meinungsführer behaupten, kann doch so falsch nicht sein“ – dieses Prinzip spiegelt sich in vielen Leitlinien wider. Bereits in den sechziger Jahren wurde Dipyridamol unter dem Markennamen Persantin® als Hilfe bei chronischer koronarer Herzkrankheit, zur Vorbeugung und Nachbehandlung des Herzinfarktes, beim „Altersherz“, bei arteriellen Durchblutungsstörungen und zur Thromboseprophylaxe angepriesen. Persumbran®, die Kombination von Dypiridamol mit Oxazepam zur Frühbehandlung der Angina pectoris, hat wohl so manchen Patienten in die Benzodiazepin-Abhängigkeit geführt. Mittlerweile ist der „Steal-Effekt“ gut bekannt. Dypiridamol als Vasodilatator weitet die gesunden Gefäßabschnitte auf und entzieht damit dem Versorgungsgebiet stenosierter Gefäßabschnitte die Sauerstoffzufuhr. Bei der Myokardszintigraphie ist dies ein anerkanntes diagnostisches Prinzip zum Ischämienachweis. Sekundärprophylaxe Empfehlung basiert auf fragwürdigen Studien Nun ist Dipyridamol in der Kombination mit ASS wieder en vogue zur Sekundärprophylaxe nach zerebralen Durchblutungsstörungen. Für Patienten mit hohem Risikoprofil hat es die Fixkombination bereits in die Leitlinien einiger Fachgesellschaften geschafft. Allgemeinmediziner sahen sowohl die wissenschaftliche Evidenz als auch die Alltagsrelevanz der Fixkombination ASS/Dipyridamol (Aggrenox®) sehr kritisch und konnten sich den Empfehlungen nicht anschließen. Die wissenschaftliche Evidenz einer Überlegenheit der Fixkombination gegenüber einer Monotherapie mit ASS ist aus folgenden Gründen mager: In Metaanalysen aller für diese Fragestellung relevanten doppelverblindeten, randomisierten Studien gab die ESPS-2-Studie den Ausschlag für eine Überlegenheit der Fixkombination, war jedoch vom Hersteller finanziert und zog nur den Vergleich mit ASS 50 mg (unüblicher Niedrigdosisbereich). Die viel beworbene ESPRIT-Studie zur Untermauerung der Überlegenheit der teuren Fixkombination war unverblindet und eher als offene Beobachtung angelegt und als Wirksamkeitsnachweis zu anfällig für Verzerrung und Fehler (siehe Tabelle 1). Viel wichtiger für den Hausarzt ist jedoch die Relevanz wissenschaftlicher Studien in der Praxis. In der ESPRIT-Studie brechen ein Drittel der Teilnehmer die Behandlung mit ASS/Dipyridamol vornehmlich aufgrund von Kopfschmerzen ab. Die Fixkombination muss zweimal täglich gegeben werden. Durch schlechtere Compliance verkehrt sich im Alltag der fragwürdige Vorteil eines neuen Medikaments für den Patienten zum Nachteil. Tabelle 1: Kritikpunkte an der ESPRIT-Studie häufiger Vergleich mit ASS-Niedrigdosis Beeinflussung durch Studienarzt möglich unklare Begleittherapien Intention-to-treat-Analyse wäre besser gewesen als on-treatment-Analyse hohe Abbrecherquote andere ASS-Dosierung und Galenik von Dipyridamol als in Aggrenox® Rückenstärkung für skeptische Haltung Nun bekommen Allgemeinmediziner auch auf der Ebene wissenschaftlicher Evidenz Rückenstärkung für ihre skeptische Haltung gegenüber Aggrenox®. Über 20.000 Patienten nahmen an der doppelverblindeten, randomisierten PRoFESS-Studie teil, die vom Hersteller von Aggrenox® gesponsert wurde. Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 11 Es wurde Aggrenox® gegen Clopidogrel in der Sekundärprophylaxe nach ischämischem Insult getestet. Sowohl für den primären Endpunkt (Schlaganfallrezidiv) als auch für den kombinierten Endpunkt (Schlaganfall, Myokardinfarkt oder Tod aufgrund vaskulärer Ursache) zeigte sich nach im Mittel 2,5 Jahren keine Überlegenheit eines der beiden Wirkprinzipien. Das begleitende Editorial im „The New England Journal of Medicine“ kommentiert den Widerspruch zwischen einerseits angeblich besserer Studienlage für ASS/ Dipyridamol versus ASS-Monotherapie (ESPRIT und ESPS- 2), sowie den Ergebnissen der bekannten CAPRIE-Studie, in der Clopidogrel gegenüber ASS für diese Fragestellung nicht besser abschneidet, und andererseits den neuen Ergebnissen der PRoFESS-Studie. Kann Aggrenox® wirksamer als ASS sein, wenn es nicht wirksamer als Clopidogrel ist, welches wiederum mit ASS gleichwertig ist? Beide Optionen besser, aber nur unwesentlich Unter Berücksichtigung der Anzahl aller Studienteilnehmer mit und ohne Erreichen eines der Endpunkte in den einzelnen Studien kommen die Autoren des Editorials mit Hilfe eines indirekten Vergleichs (Netzwerk-Metaanalyse) zur Schlussfolgerung, dass Aggrenox® und Clopidogrel ähnlich effektiv sind, und beide Optionen besser sind, aber nur unwesentlich, als ASS alleine. Ihr Fazit: „For stroke prevention use an antiplatelet drug. Treat hypertension.” Unter Berücksichtigung von Kosten und Nebenwirkungsprofil der verschiedenen Alternativen für die klinische Versorgungsrelevanz spricht alles für die ASS-Monotherapie. Mit dem „Steal-Effekt“ durch die teure Fixkombination ASS/ Dipyridamol in unserem Arzneimittelbudget sollten wir Schluss machen. Dr. Henning Harder ist niedergelassener Allgemeinmediziner in Hamburg. Interessenkonflikte: keine Nachdruck aus dem Hamburger Ärzteblatt mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion des Hamburger Ärzteblatts Aggrenox nach Schlaganfall: Empfehlung nicht ausreichend begründet Auch der Arzneimittelbrief kommt zu dem Ergebnis, dass es keinen Grund gibt, Aggrenox als Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall einzusetzen. Hier die Zusammenfassung eines ausführlicheren Beitrags: Die präferenzielle Empfehlung für die Kombination ASS plus Dipyridamol (Aggrenox®) als Sekundärprophylaxe nach akutem Schlaganfall ist nicht ausreichend begründet. Zudem ist diese Kombination gegenüber ASS etwa 50-fach teurer. Bei Patienten nach Schlaganfall, die nicht antikoaguliert werden müssen, ist ein Thrombozytenaggregationshemmer zwingend indiziert. Die Auswahl der Substanz ist nach UAW (Magenverträglichkeit, Kopfschmerzen), Begleiterkrankungen (Ulkusanamnese, pAVK), Compliance (ein- oder zweimalige Gabe pro Tag) und ganz wesentlich nach dem Preis zu treffen. Es gibt auch keine Studien, die nachweisen, dass es sinnvoll ist, bei einem Rezidiv-Hirninfarkt, der unter einem Aggregationshemmer aufgetreten ist, auf ein anderes Medikament zu wechseln. Aus einem Beitrag im Arzneimittelbrief 2008, 42, 93. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des Arzneimittelbriefs. Schluss mit dem Steal-Effekt im Arzneibudget! Alles spricht für ASS-Monotherapie Seite 12 Für Sie gelesen KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 12 Antidepressiva im Vergleich Welches ist für die Praxis am besten? Dr. med. Klaus Ehrenthal Während trizyklische Antidepressiva (TZA, nichtselektive Monoamin-Reuptakehemmer wie Amitriptylin, Nortriptylin u.a.) in der Behandlung von Majordepressionen (früher „endogener Depressionen“) immer noch als Standardmedikation gelten [1, 2], so haben deren ausgeprägte anticholinerge und weitere unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), wie Interaktionen im P-450-Isoenzym-System (besonders bei Multimedikation) nicht selten zu Behandlungsproblemen und Unverträglichkeiten geführt (Ungeeignet bei Patienten über 65 Jahren, mit ischämischen Herzkrankheiten, mit Herzrhythmusstörungen u.a.). Die große Zahl von neueren Antidepressiva (SSRI = selektive Serotonin-Reuptakehemmer und andere) hat auch durch die Vermarktungsbemühungen der Hersteller zu einer erheblichen Verunsicherung bei der Wahl des richtigen Wirkstoffes geführt. Hierbei sind die UAW weniger durch anticholinerge Störungen und Interaktionen sondern mehr durch zentral stimulierende Effekte geprägt (zentrale Exzitation, Sexualstörungen, Magen-Darmstörungen, Entzugssymptome, Immunerkrankungen). Im Prinzip sind auch die SSRI wie die TZA zur Behandlung von Majordepressionen geeignet [1, 2]. Am 29.01.09 erschien im Lancet eine ausführliche und sehr sorgfältig gemachte Metaanalyse [3] zur Wirkung von zwölf unterschiedlichen Antidepressiva der so genannten „second generation“ zur Behandlung einer unipolaren Majordepression von Erwachsenen. Es wurden dabei 117 randomisierte und kontrollierte Studien untersucht mit insgesamt 25.928 Teilnehmern, die von 1991 bis zum 30.11.2007 publiziert worden waren. Folgende Wirkstoffe, die in Studien mit Monotherapie bei einer Majordepression in der akuten Phase bei Erwachsenen (nicht bei Frauen mit Wochenbettdepression) angewandt worden waren, wurden dabei untersucht: Bupropion (Noradrenalin-Dopamin-Reuptakehemmer) Reboxetin (selektiver Noradrenalin-Reuptakehemmer) Duloxetin (Serotonin-Noradrenalin-Reuptakehemmer) Milnacipram (Serotonin-Noradrenalin-Reuptakehemmer) Venlafaxin (SSRI + Noradrenalin-Reuptakehemmer) Citalopram (SSRI) Escitalopram (SSRI) Fluoxetin (SSRI) Fluvoxamin (SSRI) Paroxetin (SSRI) Sertralin (SSRI) Mirtazapin (tetrazyklisches Antidepressivum) Als Outcome wurde die Zahl der Patienten mit wirksamer Behandlung verglichen mit der Zahl der Studienabbrecher in einer Intention-to-treat-Analyse. Hierbei wurde der Therapieerfolg und die Quote der verschiedenen Nebenwirkungen, die zur Nichtakzeptanz der Therapie geführt hatten, analysiert. Die untersuchte Behandlungsphase (Therapiedauer) betrug acht Behandlungswochen in den meisten untersuchten Studien. Konnte in einer Studie diese Zeitspanne nicht gefunden werden, wurde eine gewichtete Behandlungszeit zwischen sechs und zwölf Wochen verwendet. Als Erfolg der Therapie wurde eine 50-prozentige Reduktion vom Ausgangsscore der Hamilton-depression-rating-Skala (HDRS) der Montgomery-Asberg-depressionrating-Skala (MADRS) oder die Beurteilung „ sehr gebessert“ oder „sehr stark Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 13 gebessert“ nach acht Wochen nach der „Clinical-globe-impression“-Skala (CGI) gewertet. Als Nichtakzeptanz der Therapie wurde gewertet, wenn aus unterschiedlichen Gründen die Behandlung in den ersten acht Wochen abgebrochen wurde. Ergebnisse Mirtazapin, Escitalopram, Venlafaxin und Sertralin waren signifikant wirksamer als Duloxetin, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin und Reboxetin. Reboxetin war signifikant weniger wirksam als alle anderen untersuchten Antidepressiva. Die Behandlung mit Escitalopram oder Sertralin zeigte das beste Wirkprofil, da diese Medikamente zu weniger Behandlungsabbrüchen führten als Duloxetin, Fluvoxamin, Paroxetin, Reboxetin und Venlafaxin. Interpretation Zwischen den üblicherweise verschriebenen Antidepressiva fanden sich im Vergleich klinisch bedeutsame Unterschiede sowohl in der Wirksamkeit als auch bei der Akzeptanz zugunsten von Escitalopram und Sertralin. Sertralin ist vielleicht die beste Wahl beim Behandlungsbeginn von Erwachsenen mit einer moderaten bis schweren unipolaren Majordepression, da es die günstigste Balance zwischen Benefit, Akzeptanz und Verordnungskosten hat. Was bedeutet das für die Praxis? Wenn kostengünstige trizyklische Antidepressiva (TZA) wegen Unverträglichkeiten, Komorbidität oder Interaktionen bei Komedikation nicht angewendet werden können und wenn deswegen auf einen selektiven Serotonin-Reuptake-Hemmer (SSRI) ausgewichen werden soll, sind die deutlichen Unterschiede der Wirksamkeit und der nebenwirkungsbedingten Abbruchraten zu beachten. Die vorliegende Metaanalyse hat Unterschiede der SSRI und auch der neueren Antidepressiva herausgestellt und Vorteile bei der Therapie mit den SSRI Sertralin (Gladem®, Zoloft®, diverse Generika im Handel) und Escitalopram (Cipralex®, dem linksdrehenden reinen S-Enantiomer des Racemats Citalopram (Cipramil®, diverse Generika im Handel) aufgezeigt. Im Hinblick auf die oben besprochene Behandlungsoptimierung aus den untersuchten Parametern Benefit beim Patienten, Akzeptanz durch die Patienten wegen möglicher Beeinträchtigung durch UAW und Verordnungskosten erscheint mir Sertralin (s.o., sowie diverse Generika) optimal. Escitalopram, bei dem in einem kürzlich erschienen Cochrane Review [4] geringe Vorteile gegenüber dem Razemat Citalopram (s.o., sowie diverse Generika) beschrieben wurden, ist deutlich teurer als das schon länger im Handel befindliche Citalopram. In Hessen gelten für die Leitsubstanzen Citalopram/Fluoxetin ein Verordnungsanteil (Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz, AVWG) von 61,3 Prozent der Verordnungen im entsprechenden Indiaktionsgebiet. Da hiervon nur bei Unverträglichkeit abgewichen werden soll, ist der Spielraum für andere Therapien, ohne dass wesentliche Vorteile z.B. beim Escitalopram erkennbar sind, eingeschränkt. Literatur: 1 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: Arzneiverordnungen 21. Aufl. 2006, Deutscher Ärzte-Verlag Köln, S. 442 ff 2 A.V.I. Arzneimittel-Verlags-GmbH Berlin. Arzneimittelkursbuch 2007/2008, 15.Ausgabe,S.1901 3 Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Geddes JR, Higgins JPT, Churchill R, Watanabe N, Nakagawa A, Omori IM, McGuire H, Tansella M, Barbui C: Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis.The Lancet 29.01.09 www.thelancet.com DOI:10.1016/501406736(09)60046-5 4 Cipriani A, Santilli C, Furukawa TA, Signoretti A, Nakagawa A, McGuire H, Churchill R, Barbui C: Escitalopram versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue2.Art. No.: CD006532. DOI:10.1002/14651858.CD006532.pub2. Diese Metaanalyse wirft die Frage auf, ob die Wahl der Leitsubstanzen nicht überprüft werden muss KVH • aktuell Seite 14 Der Gastbeitrag Nr. 2 / 2009 Beratungsursache 7: Der richtige Umgang mit starken Opiaten Tumorschmerzen und Schmerz ist eine Sinneswahrnehmung und entsteht, wenn mechanische, thermische, sonstige chemische oder schwere elektrische Reizechronische einen SchwellenwertSchmerzen über­schreiten und dadurch meist zu einer Gewebeschädigung mit Freisetzung von Schmerzmediatoren sowie zur Bildung von Schmerzimpulsen führen. Die Schmerzwahrnehmung hat Ì WHO-Stufenschema für den Menschen eine essenzielle Schutzfunktion. Für die Schmerzwahrnehmung sind beim Menschen nicht nur die nozizeptiven Eingangssignale wichtig, sondern auch die Vorerfahrungen, Erwartungen, Gedanken und Gefühle. Erkennbar ist dies besonders bei psychosomatischen Beschwerden „ohne organische Ursache“ und bei den Effekten einer „Placeboanalgesie“, deren Responderrate meist mit 30 bis 40 Prozent angegeben wird. frühzeitig undstellt ausreichend wirksam den Schmerz Tumorschmerzen und schwere Diesonstige Diagnostik und adäquate Schmerztherapie den behandelnden Arzt, insbeim hausärztlichen Bereich, derum Komplexität des klinischen Bildes zuaufgrund behandeln, einer Chronifizierung entgegen Schmerzen (s. hierzusondere Leitlinie Palliativversorgung) und der biopsychosozialen Zusammenhänge bei der Entstehung von Schmerzen zu wirken. Bei der Entstehung von chronischen Schmerzen wieder vor große Herausforderungen. Nicht zuletzt unterscheidet aufgrund derman: hohen Bei chronischen Schmerzen spielt die Ausbildung immer des Schmerzgedächtnisses oderSomatische bedeutet die Be­hgut andlung von eine entscheidende Kosten Rolle. „moderner“ Sehr starkeWirkstoffe oder Schmerzen – scharf, lokalisier Arzneiformen Schmerzpatienten eine große medi­zinische und wirtschaftliche Verantwortung. wiederholte Schmerzreize können auf Dauer zu bar (z. B. Knochen- und Periostschmerz, Hauteiner Senkung der Schmerzschwelle führen mit und Weichteilschmerz, Ischämieschmerz) Der folgende Text soll ganz sicher kein vollständiges therapeutisches Manual werder Folge, dass auch geringe Reize starke Viszerale Schmerzen – dumpf, schlechtOpiate/ lokali rationalen den, sondern ein Schlaglicht auf den Einsatz stark wirksamer Schmerzen auslösenOpioide können.werfen. U. U. kann der sierbar Patient sogar Schmerzen empfinden ohne aktuelNeuropathische Schmerzen – attackenweise zum Für umfassendere Informationen Thema „Rationale Schmerztherapie“ emplen Reiz, allein durch fehlen spontane Neueinschießend oder der auch brennender Dauerwir Aktivität Ihnen dievon Hausärztliche Leitlinie „Schmerz“ Leitliniengruppe Hessen ronen. Es ist von größter Bedeutung, möglichst schmerzsowie die Therapieempfehlungen (www.pmvforschungsgruppe.de/Leitlinien) Stufe 3 schwere chronische Schmerzen Stufe 2 starke chronische Schmerzen Stufe 1 chronische leichte bis mittelschwere Schmerzen Nichtopioid-Analgetikum Ibuprofen retard Naproxen Diclofenac Paracetamol (nur geringe antiphlogistische Wirkung) Metamizol (zusätzlich: spasmolytische Wirkung) Nichtopioid-Analgetikum plus schwach wirkende Opioidanalgetika Tramadol, Tilidin Dihydrocodein Nichtopioid-Analgetikum plus Stark wirkende oral oder subkutan applizierte Opioidanalgetika Morphin Buprenorphin Fentanyl Oxycodon Hydromorphon ggf. extra lang wirkende Darreichungsformen (Pflaster, wenn orale Therapie nicht möglich ist). Hinweis: für Patienten mit PEGSonde sind verschiedene Morphine als Granulat erhältlich oder peridurale Morphinapplikation Adjuvans und Ko-Analgetika: Antiemetika, Laxanzien, Antidepressiva, Neuroleptika, Antikonvulsiva, Cortison, Lokalanästhesie Stufenschema der WHO (Grafik aus der Hausärztlichen Leitlinie Schmerz; siehe auch KVH aktuell Nr. 3/2008, Seiten 31 bis 42.) Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 15 der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzte­schaft (www.akdae.de, Tumorschmerz, 3. Auflage 2007, Kreuzschmerz, 3. Auflage 2007). Schmerztherapie nach dem Stufenschema der WHO Die Therapie erfolgt dabei nach dem Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Grundregeln der WHO wurden in mehreren Untersuchungen validiert und werden daher allgemein zu Recht akzeptiert und empfohlen. Sie haben wesentlich zur Akzeptanz und Verbreitung einer einfachen und wirksamen Schmerztherapie beigetragen. Nach der WHO Stufe I werden bei leichten Schmerzen Nichtopioide wie Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Paracetamol oder Metamizol verabreicht. Die Gabe von antipyretisch wirksamen Analgetika wie Metamizol oder Paracetamol scheint bei viszeralen Nozizeptorschmerzen von Vorteil zu sein, die Gabe von nichtsteroidalen Anti­rheumatika (NSAR) wie Diclofenac, Ibuprofen oder Naproxen bei somatischen Nozizeptorschmerzen. Gemäß der WHO Stufe II wird die Therapie bei unzureichender Analgesie oder mäßig starken Schmerzen durch ein mittelstarkes Opioid wie Dihydrocodein, Tramadol oder Tilidin-Naloxon ergänzt. Nichtretardierte Präparate sind dabei zur Dosistitration und als Zusatzmedikation bei Schmerzspitzen geeignet. Zur Langzeittherapie werden Retardpräparate eingesetzt. Ist der Schmerz mit der Kombination von Nichtopioiden und schwachen Opioiden nicht ausreichend thera­pierbar, kombiniert man nach WHO Stufe III das nichtopioide Analgetikum mit einem stark wirksa­men Opioid. Als stark wirksame Opioide kommen die reinen Opiatagonisten Morphin, Hydromor­phon, Fentanyl, Oxycodon oder Levomethadon zum Einsatz, die den Vorteil einer starken analgeti­schen Wirkung ohne Wirkbegrenzung bei Do­sissteigerung haben. Die Kombination von schwach wirkenden Opioiden der Stufe II mit stark wirken­den Opioiden der Stufe III ist phamakologisch nicht sinnvoll. Die WHO empfiehlt so genannte Koanalgetika wie zum Beispiel Antidepressiva und Glukokortikoide bei Tumorschmerzen, Bisphosphonate bei Knochenschmerzen, Antiepileptika bei neuropathischen Schmerzen, zu Analgetika der Stufen I bis III bei speziellen Schmerzsyndromen. Diese können die Opioid-Analgesie verbessern und dadurch zu einer reduzierten Opioid-Dosis führen. Stark wirkende Opiat/Opioid-Analgetika (WHO Stufe III) Wirkstoffe und Applikationsformen (Beispiele) Morphin, Morphin retard, Morphin ultraretard Buprenorphin Buprenorphin TTS Fentanyl TTS Fentanyl oral transmukös Oxycodon Oxycodon retard Hydromorphon retard Zugelassene Indikationen Starke bis sehr starke (stärkste) Schmerzen, die eine Anwendung von Opioiden erfordern. Wirkungsweise Die Opioid-Analgetika Morphin, Fentanyl, Oxyco­don und Hydromorphon sind volle Agonisten am Opioid-Rezeptor. Hydromorphon ist etwa 7,5-mal stärker, Oxycodon etwas stärker wirksam als Morphin, Fentanyl etwa 100-mal stärker als Morphin. Nicht nur Dosis erhöhen, sondern auch an ZusatzMedikamente denken Seite 16 KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Buprenorphin ist ein partieller Agonist am Opiod-Rezeptor und besitzt als solcher einen „Ceiling-Effekt“ (trotz Dosissteigerung keine Zunahme der Wirkungen). Buprenorphin wirkt bei parenteraler Anwendung etwa 40-mal stärker als Morphin. Partialagonisten sollten nicht mit Agonisten kombiniert werden, da sie die analgetische Wirkung der Agonisten aufheben und Entzugssymptome provozieren können. Im Falle einer Überdosierung mit einem Partialagonisten lassen sich Intoxikationssymptome nur beschränkt mit einem Antagonisten aufheben. Nebenwirkungen Wie bei allen Opioiden sind Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Schwindel, Sedierung, Juckreiz und Schwitzen sehr häufig. Mundtrockenheit, Miktionsstörungen, Exantheme, Stimmungs- und Antriebsänderungen, Ödeme, Blutdrucksenkung und Dyspnoe sind weitere Nebenwirkungen. Entzugssymptome nach Absetzen sind möglich, bei kon­trollierter, korrekter Anwendung ist die Gefahr einer Opioid-Abhängigkeit bei (Tumor-)Schmerzpatienten gering. Kontraindikationen Kontraindikationen ergeben sich aus dem Nebenwirkungsspektrum: schwerwiegende Störung der Atemregulation und -funktion, Alkohol- und/oder OpioidAbhängigkeit usw. Interaktionen Die gleichzeitige Gabe zentral dämpfender Pharmaka sowie von Alkohol verstärkt die entsprechenden Nebenwirkungen der Opioide. Hinweise für eine wirtschaftliche Verordnungsweise Praxis-Tipp Bei DurchbruchSchmerzen auch ein stark wirksames Opioid geben. Tramadol und Tilidin sind hier ungeeignet! Bitte beachten: Tilidin comp enthält einen OpioidAntagonisten. Ein parallel gegebenes stark wirksames Opioid wird antagonisiert! Tumorschmerzen Stark wirkende Opioid-Analgetika sind die Hauptstütze der Therapie mittelstarker und starker Tumorschmerzen. Morphin ist bei mittleren bis schweren Tumorschmerzen Opioid der ersten Wahl. Der optimale Applikationsweg ist oral. Idealerweise werden zwei Applikationsformen benötigt: mit normaler Freisetzung (zur Dosisfindung) und modifizierter Freisetzung (zur Erhaltungstherapie). In der Praxis haben sich lang wirkende Opioide, wie zum Beispiel retardierte Morphintabletten mit acht bis zwölf Stunden Wirkdauer bewährt. Bei Durchbruchschmerzen oder in der initialen Titrationsphase sind kurzwirksame Opioide indiziert. In der Regel lassen sich drei Viertel aller Tumorschmerzpatienten mit Tagesdosierungen bis 250 mg Morphin ausreichend analgetisch behandeln; die notwendigen Tagesdosierungen können aber auch weit höher liegen (bis zu mehreren Gramm). Bei Entwicklung intolerabler Nebenwirkungen unter der oralen Therapie mit Morphin ist der Wechsel auf ein anderes Opioid bzw. einen anderen Applikationsweg zu erwägen. Kreuzschmerzen Der Einsatz von Opioiden bei akuten und chronischen unspezifischen Kreuzschmerzen sollte nur nach strenger Indikationsstellung, wenn andere Analgetika nicht wirken, und nur über einen begrenzten Zeitraum erfolgen (akut: ein bis drei Tage, chronisch zwei bis drei Wochen). Stark wirkende Opioid-Analgetika der Stufe III des WHO-Stufenplanschemas in retardierter, oraler Applikationsform sind nur in Ausnahmefällen sinnvoll und notwendig. Tritt die gewünschte Schmerzlinderung bzw. Funktionsverbesserung nicht ein, ist die Fortsetzung der Opioid-Therapie kontraindiziert. Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 17 Neuropathischer Schmerz Die starken Opioide sind erst dann indiziert, wenn eine Therapieresistenz gegen kurative und medikamentöse Basistherapien im interdisziplinären Konsens gesichert ist. Sie sollten in Form von lang wirksamen Präparaten (bevorzugt orale retardierte Zubereitungen) eingesetzt werden. Sonstige nicht tumorbedingte Schmerzsyndrome Die Wirksamkeit von Opioiden ist nur für einige chronische Schmerzsyndrome durch placebo­kontrollierte Studien nachgewiesen worden. Eine klare Indikation zur Langzeittherapie mit Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen kann aus den bis dato verfügbaren Daten nicht abgeleitet werden. Aufgrund klinischer Beobachtungen kann jedoch zwischen mehr oder weniger Erfolg verspre­chenden Anwendungsbereichen unterschieden werden. Nach gegenwärtigem Wissensstand ist bei allen primären Kopfschmerzen, funktionellen kardialen, gastrointestinalen, urologischen und gynäkologischen Störungen, somatoformen und anderen psychisch mit bedingten Schmerzzuständen sowie ausschließlich attackenweise auftretenden Schmerzen (zum Beispiel Gesichtsneuralgien) von einer Opioidlangzeitanwendung abzuraten. Besondere Arzneiformen Die Gabe von Opioid-Pflastern stellt eine Alternative dar zur oralen Applikation bei Patienten mit Passagehindernis oder therapieresistentem Erbrechen. Opioid-Pflaster sind bedingt durch ihre Galenik nicht geeignet für Patienten mit – s t a r k s c h w a n k e n d e r Schmerzintensität oder – hohem Opioid-Bedarf und – häufigen Durchbruchschmerzen Die in den letzten Jahren zunehmende Verschreibungspräferenz von TTS gegenüber oralen Retardpräparaten ist nicht durch die Ergebnisse von Studien zu rechtfertigen. Aufgrund der Ähnlichkeit zu Wundpflastern und weiteren Besonderheiten in der Handhabung (siehe auch nebenstehenden Kasten) erfordert der Umgang mit Opioid-Pflastern auch vom Patienten bzw. von Seiten des Pflegepersonals besondere Sorgfalt. Bei Patienten mit Magensonde sind retardierte, sondengängige Morphinpräparate (zum Beispiel MST®-Retardgranulat, Capros® 1 x tägl. Hartkapseln) als Alternative zu erwägen. Bei etlichen Schmerzarten sind Opiate nicht sinnvoll So umgehen Sie die Tücken der Fentanylpflaster Fentanylhaltige Transdermalpflaster stellen bei richtiger Anwendung eine sichere Schmerztherapie dar. Als stark wirksames Opioid steht Fentanyl auf Stufe III des Stufenschemas für chronischen Tumorschmerz der Weltgesundheitsorganisation WH0. Da sich wiederholt Zwischenfälle durch Fentanyl-Überdosierung ereignet haben, wird in diesem Bericht noch einmal auf die Anwendungsbeschränkungen und die richtige Handhabung hingewiesen: Beachtung des Stufenschemas: Indiziert ist die Gabe von Fentanylpflastern nur bei chronischen Schmerzen und nur, wenn sowohl alleinige Schmerztherapie mit Nichtopioiden als auch die Kombinationstherapie von Nichtopioiden mit schwach wirksamen Opioiden nicht zum Erfolg geführt hat. Keine Anwendung bei „opioid-naiven“ Patienten: Vor Beginn der Therapie mit Fentanylpflastern muss das individuelle Ansprechen des Patienten auf Opioide bekannt sein (Toleranz von mindestens 60 mg Morphin über mindestens eine Woche). Applikation nur auf unverletzte, saubere Haut: Die Haut sollte frei sein von Fett, Nässe, Haaren, Verletzungen, Wunden, Narben und Hautfalten; Druck durch Sitzen/Liegen sowie Scheuern durch Kleidung etc. sind zu vermeiden. Überdosierungsgefahr durch Hitzeeinwirkung: Starke Erwärmung des Pflasters auf der Haut (heiße Dusche, Solarium, Sauna, Wärmflasche etc; u. U. auch Fieber!) kann zu erhöhter Fentanylfreisetzung führen. Überdosierungsgefahr durch Wirkstoffdepot in der Haut auch nach Entfernen des Pflasters, daher Überdosierung bei verfrühter oder zusätzlicher Applikation von weiteren Pflastern oder weiteren Opioiden unbedingt vermeiden! Quelle: Arzneiverordnung in der Praxis, Band 36, Ausgabe 2, März 2009 Seite 18 KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Bei der Behandlung von Durchbruchschmerzen kann der Einsatz von oral transmukös appli­ziertem Fentanyl (Actiq®-Lutschtablette) erwogen werden, aufgrund der begrenzten klinischen Erfahrung sollte dieser jedoch nur zurückhaltend erfolgen. Nachdruck aus dem Verordnungsforum der KV Baden-Württemberg Nr. 8/2008 mit freundlicher Genehmigung der KV Baden-Württemberg. Literatur zum Thema: – Mutschler et al. Arzneimittelwirkungen, Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, 8. Auflage 2001 – Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: Tumorschmerzen, 3. Auflage 2007 – Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommis­sion der deutschen Ärzteschaft: Kreuzschmerzen, 3. Auflage 2007 – Hausärztliche Leitlinie, Therapie von Schmer­zen, Leitliniengruppe Hessen. Version 3.02 vom 23.01.2008 – KV Hessen Pharmakotherapie aktuell Nr. 3/2008 – Morphin und andere Opioide in der Tumor­schmerztherapie: die Empfehlungen der EAPC (European Association for palliative Care), Der Schmerz 2002, 16:186–193 – Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie; Diagnostik und Therapie neuropathischer Schmerzen, Stand 2005, www.awmf.de – Schwabe U, Paffrath D. Arzneiverordnungsreport 2008 – Sorgatz et al. Langzeitanwendung von Opioiden bei nichttumorbedingten Schmerzen, Dt. Ärzte­blatt Nr. 33, August 2002 – Fachinformationen der jeweiligen Arzneimittel Kurz referiert Als Primärprophylaxe eignen sich nur allgemeine Maßnahmen: Rauchverzicht Bewegung mediterrane Kost Ergebnis der POPADAD-Studie Bei Diabetikern sind ASS und Vitamine als Primärprophylaxe nutzlos Diabetiker haben per se ein hohes kardiovaskuläres Risiko, weshalb auch die Leitlinien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft ASS als Primärprophylaxe empfehlen. Das klingt zunächst plausibel, denn immerhin ist beispielsweise nach Herzinfarkt oder Schlaganfall die Verordnung von ASS völlig unumstritten. Aber lassen sich die gesicherten Erkenntnisse der Sekundärprophylaxe wirklich auf die Primärprävention bei Diabetikern übertragen? Die randomisierte POPADAD1-Studie [1] widerlegt diesen Analogschluss: ASS hat die Diabetiker leider nicht geschützt. Auch ein gleichzeitig getestetes Multivitaminpräparat blieb wirkungslos. Teilgenommen haben 1276 Diabetiker – sowohl Typ 1 wie auch Typ 2 – mit zusätzlicher asymptomatischer peripherer Verschlusskrankheit. Letztere war sehr großzügig diagnostiziert worden, nämlich schon bei einem Knöchel-Arm-Index von 0,99. Die Patienten hatten dann im Schnitt 6,7 Jahre lang täglich zwei Tabletten bekommen. Eine enthielt entweder 100 mg ASS oder Placebo, die andere entweder einen Mix aus antioxidativen Vitaminen und Spurenelementen oder Placebo. Das Ergebnis war ernüchternd: Der primäre Endpunkt (Tod an KHK bzw. Schlaganfall, überlebter Myokardinfark bzw. Schlaganfall, Amputation oberhalb des Knöchels) wurde in allen Gruppen von 18,2 bis 18,3 Prozent der Patienten erreicht, Unterschiede gab es also praktisch keine. Betrachtete man nur tödliche Ereignisse, dann schnitten die Gruppen mit ASS und Multivitamin-Präparaten tendenziell sogar schlechter ab. Die Studie zeigt wieder einmal: Analogschlüsse sind zwar beliebt, aber in der Medizin nicht hilfreich. Und wenn Patienten durch einen solchen Analogschluss mit einem wirkungslosen Prinzip behandelt werden, bleibt von der Therapie nur das Risiko übrig und gefährdet unnötig den Patienten. BW/JF Literatur: 1 POPADAD: Prevention Of Progression of Arterial Disease And Diabetes. Veröffentlicht in BMJ 2008; 337; a1840 Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Masern-Impfung: Aufarbeitung einer Epidemie in NRW Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die 2006 in NRW aufgetretene Masern-Epidemie (mehr als 1750 Erkrankungen, zwei Todesfälle) aufgearbeitet und nach Gründen für den fehlenden Impfschutz der Kinder und Jugendlichen gesucht (bei sieben Prozent der Kinder trat eine Pneumonie auf, bei 16 Prozent eine Otitis media). Insbesondere die nach Jahren auftretenden bekannten Spätfolgen (Panenzephalitis), die oft nicht der Ursache zugeschrieben werden, sind dabei nicht berücksichtigt. Nach Befragung von 81 Prozent der betroffenen Eltern ergab sich folgendes Bild: 36,4 Prozent gaben an, dass sie die Impfung einfach vergessen hatten, 25 Prozent lehnten Impfungen ab (zumeist aus Angst vor Nebenwirkungen), 16,8 Prozent gaben an, dass der Haus- oder Kinderarzt von der Impfung abgeraten hatte. Nur bei einer geringen Anzahl von Kindern bestand eine echte Kontraindikation gegen eine Masernimpfung (nach Ansicht der Autoren nur zwei Prozent der Kinder, bei denen Haus- und Kinderärzte von einer Impfung abgeraten hatten). Der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte fordert einen Impfnachweis für alle Kinder in öffentlichen Kindergärten und Schulen. Aufgrund der Datenlage ist es jedoch vordringlich, dass die Meinungsbildner in Sachen Schutzimpfung selbst umdenken, aktiv auf „vergessliche“ Eltern zugehen und sie beraten. Gemeint sind auch medizinische Assistenzberufe wie Krankenschwestern, Arzthelferinnen und Hebammen. Schließlich geht es nicht nur um das Wohl des einzelnen Kindes, sondern auch um eine Begrenzung einer neu auftretenden Epidemie. Das Ziel der WHO, Europa bis 2010 von den Masern zu befreien, kann dabei helfen. Quelle: Bull. WHO 2009; 87: 81-160, zitiert nach www.aerzteblatt.de Internethandel: Aktuelle Warnungen Ärztinnen und Ärzte sollten ihre Patienten wiederholt davor warnen, Arzneimittel mit unklaren Herstellerangaben aus dem Internet zu bestellen. Meist handelt es sich um asiatische Firmen, die insbesondere Potenzmittel als „rein pflanzlich“ anpreisen, ihren Präparaten jedoch ohne Deklaration hochwirksame Arzneistoffe zumischen (z.B. kanadische Warnungen über Präparate aus Hongkong mit undeklarierten Glukokortikoiden, Sildenafil-/Vardenafil-Derivaten, Antidiabetika). Nun warnt unsere Überwachungsbehörde BfArM auch vor einem europäischen Hersteller aus den Niederlanden, der unter der Bezeichnung „SensaMen“ ein angeblich rein pflanzliches Potenzmittel als Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Das Produkt enthält Sildenafil-Derivate (Dimethylsildenafil und Dimethylthiosildenafil). Das gesundheitliche Risiko dieser in klinischen Studien nicht untersuchten Stoffe ist nicht beurteilbar, im Gegensatz zu den unerwünschten Wirkungen des bekannten Arzneimittels Sildenafil (Viagra®). Die zuständigen Überwachungsbehörden haben zwar den Vertrieb dieser Kapseln mit sofortiger Wirkung untersagt, Kostengründe und leichter Bezug dieser obskuren Mittel werden jedoch Patienten weiter zu einer schnellen und bequemen Bestellung aus dem Ausland verführen. Grundsätzlich sollten bei geplanten Internetbestellungen deutsche Herstelleradressen empfohlen werden, bei denen u.a. die pharmazeutische Qualität und die Reinheit des Produktes eher gewährleistet ist (Ausnahme siehe oben) sowie etwaige Reklamationen leichter durchsetzbar sind. Quellen: www.hc-sc.gc.ca, Dtsch. Apo.Ztg. 2009; 149: 390 Seite 19 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf KVH • aktuell Seite 20 Warum müssen es gleich drei Benzos sein? Rezept des Monats Medikament morgens mittags abends ASS 100 0 1 0 Plavix® 75 1 0 0 LOCOL® 80 0 0 1 Pentalong® 50 1/2 0 1/2 Omeprazol 20 1 0 0 Durogesic TTS® 25µg alle drei Tage Lendormin® 0 0 1 1/4 1/4 1/4 Diazepam 5 mg bei Bedarf Bromazepam Carbimazol 5 mg 1/2 0 0 Kreon® 20.000 1 1 1 Votum® 10 mg 1 0 0 Nebilet® 5 mg 0 0 1/4 Berodual® bei Bedarf Decortin® 5 mg Nr. 2 / 2009 b. B 1 1 0 Patient, 57 Jahre alt, männlich, aus der kardiologischen Abteilung eines hessischen Krankenhauses entlassen. Koronare Dreigefäßerkrankung Zustand nach aortokoronarer BypassOperation vor acht Jahren Zustand nach kleinem Hinterwandinfarkt mit Lyse vor zwölf Jahren Gering eingeschränkte LV-Funktion (EF 70%) Verschluss des Venenbypass zum RCx und zum Ramus diagonalis Zustand nach Mehrfach-PTCA Hauptstamm, Ramus intermedius, Ramus circumflexus und des Venenbypass zur RCA, pAVK mit Zustand nach Mehrfach-PTA beidseits Verdacht auf depressives Syndrom Labile arterielle Hypertonie Chronisches BWS-Syndrom COPD Angesichts der 15 Medikamente stellen sich schon einige Fragen: Muss ein BWS-Syndrom mit Morphium und drei verschiedenen Benzodiazepinen behandelt werden? Warum orales Kortison? Warum Kreon? Warum Carbimazol? Würde man dies weglassen, nähme der Patient immer noch acht Medikamente – das dürfte für die vorhandenen Krankheiten reichen und die Gefahr von Interaktionen reduzieren. Für Sie gelesen Exotische Therapie bei chronischen Wunden Sind Fliegenmaden wirklich besser als Hydrokolloid-Verbände? Dr. med. Joachim Feßler Wer von uns Hausärzten kennt nicht die Crux mit den chronischen Wunden? Ihre Rezidivneigung? Den Ärger mit der Kostenfrage? Die Schwierigkeiten mit der diagnostischen Abklärung dieser häufig immobilen Patienten? Und dann die Vorschläge der Patienten oder ihrer Angehörigen, die beim offensichtlichen Versagen der Schulmedizin auf alternativmedizinische Ansätze drängen. Ein solcher Ansatz ist die Therapie mit Maden. Ihr wird in der Laienwerbung eine teils schon mystische Wirkung zugeschrieben. Als Hausarzt weiss man oft nicht, wie man bei einer solchen Fragestellung argumentieren soll. Nun ist zu diesem Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 21 Thema eine randomisierte kontrollierte Studie erschienen, die VenUS II Studie [1]. Studiendesign: Teilnehmer waren 267 ambulante Patienten mit einem venösen oder gemischt venös-arteriell bedingten Ulcus cruris, das zumindest zu einem Viertel mit nekrotischem Gewebe bedeckt war. 40 Prozent waren Männer, das Durchschnittsalter betrug 74 Jahre, bei 57 Prozent bestand das Ulcus länger als sechs Monate. Die Patienten wurden in drei Gruppen randomisiert: In der ersten Gruppe wurden die Larven frei auf die Wundoberfläche aufgebracht, in der zweiten Gruppe waren sie in ein Gazenetz verpackt, in der dritten Gruppe (Kontrollgruppe) erfolgte die Wundbehandlung mit einem Hydrocolloid-Verband ohne Larven. Primärer Endpunkt war die Abheilung des Ulcus. Ergebnisse: Mit der Larvenbehandlung waren die Ulcera im Median nach 236 Tagen abgeheilt, unter Hydrocolloid Gel nach 245 Tagen. Der Unterschied ist statitisch nicht signifikant und auch klinisch nicht relevant. Die nekrotischen Beläge (Debridgement) waren unter Madentherapie allerdings schneller entfernt: die freien Maden hatten die Wunde nach 14 Tagen, die verpackten nach 24 Tagen von nekrotischen Belägen befreit. Unter Hydrocolloid Gel Behandlung dauerte dies 72 Tage. Die Unterschiede waren signifikant, aber wider Erwarten für den Endpunkt, die abschließende Wundheilung, nicht relevant. Es fanden sich keine Unterschiede in der Lebensqualität (Messung mit standardisiertem Fragebogen SF 12) oder in der bakteriellen Besiedlung der Wunden. Als Nachteil der Madentherapie wurden die etwas stärkeren Schmerzen in den ersten 24 Stunden vor dem ersten Verbandswechsel beschrieben. Die Kosten der Madentherapie waren geringradig höher. Wunden sind schneller sauber, aber nicht schneller verheilt Patient muss mitentscheiden Bedeutung Diese Studie zeigt eindrucksvoll, dass die Madentherapie keinen Vorteil gegenüber einer Wundbehandlung mit Hydrocolloidverbänden liefert, allen Gerüchten zum Trotz. Die Wunden heilen gleich schnell ab. Somit ist die Wahl der Therapie unter dem Gesichtspunkt der Patientenpräferenz und der Kosten gerechtfertigt (eine Madentherapie wird in Deutschland nicht von den gesetzlichen Kassen erstattet). Man kann also den Patienten dahingehend beraten, dass die für ihn deutlich höheren Kosten einer Madentherapie keine schnellere Abheilung bedeuten. Inwiefern die schnellere „Wundreinigung“ relevant ist für den Patienten, ist im Einzelfall mit ihm zu klären. für unsere Praxis Es gibt für mich einen weiteren wichtigen Aspekt. Die Madentherapie stammt aus dem großen heterogenen Gebiet der alternativen Therpaieformen, für die es bisher überwiegend keine wissenschaftliche Evidenz zu ihren Therapieerfolgen gibt. Gemeinsam ist diesen sehr unterschiedlichen Ansätzen, dass ihre Vetreter immer wieder behaupten, die besonderen Ausgestaltungen und Bedingungen dieser Therapien verschließen sie für eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung und erlauben somit auch nicht, evidenzbasierte Empfehlungen über ihren Erfolg abzugeben. Diese Studie widerlegt diese Aussagen auf eine bestechende Art und Weise. Das Studiendesign einer randomisierten, kontrollierten Studie, die eine Alternativtherapie im Vergleich zu einer etablierten Therapie untersucht, liefert wissenschaftlich haltbare Ergebnisse zur Vergleichbarkeit der Endpunkte, der Nebenwirkungen, Risiken und der Lebensqualität. Dies sollte Anlass sein, solche Studien auch von vielen anderen alternativen Theraieformen zu fordern, bevor wir sie in der Entscheidungsfindung mit unseren Patienten berücksichtigen. Interessenkonflikte: keine Literatur: 1 Dumville JC, et all. Larval therapy for leg ulcers (VenUS II): randomised controlled trial. BMJ 2009;338:b773. DOI:10.1136/bmj.b773 Studie beweist: Auch alternative Therapien kann man mit den Kriterien der evidenzbasierten Medizin und in ordentlichen Studien untersuchen. So können sich auch exotische Therapien bewähren KVH • aktuell Seite 22 Nr. 2 / 2009 Hausärztliche Leitlinie Psychosomatische Medizin Konsentierung Version 1.00 09.04.2008 Revision bis spätestens Mai 2011 Version 1.01 vom 29.04.2008 Hausärztliche Leitlinie Psychosomatische Medizin Anmerkung: Konsentierung Version 1.00 Die Leitlinie Psychosomatische Medizin umfasst insgesamt 90 Seiten.09.04.2008 Wir veröffentlichen angesichts des Umfangs nur die wichtigsten Aspekte. Den ersten Teil finden Sie im letzten Heft (Nr. 1/2009), den zweiten Teil veröffentlichen Revision bis spätestens wir in diesem Heft. Mai 2011 Die gesamte Leitlinie einschließlich der im Text erwähnten Anhänge und Literaturstellen (Ziffern in Klammern), die hier nicht abgedruckt sind, finden Sie im Internet unter www.pmvforschungsgruppe.de. Version 1.01 vom 29.04.2008Auf dieser Webseite bitte den Cursor in der Menü-Leiste im oberen Teil der Seite auf Publikationen positionieren und im aufklappenden Untermenü auf Leitlinien klicken. Dann können Sie die gesamte Leitlinie einsehen bzw. als PDFDatei auf Ihren Computer herunterladen. Eine weitere Bezugsquelle finden Sie unter www.leitlinien.de. Dort auf Leitlinienanbieter klicken, dann Leitlinien aus dem ambulanten Bereich/vertragsärztliche Qualitätszirkel auswählen, anschließend führt der Link unten auf der Seite zu den hausärztlichen Leitlinien. F. W. Bergert M. Braun H. Clarius K. Ehrenthal J. Feßler J. Gross K. Gundermann H. Hesse J. Hintze U. Hüttner B. Kluthe W. LangHeinrich A. Liesenfeld E. Luther R. Pchalek J. Seffrin G. Vetter H.-J. Wolfring U. Zimmermann Unter Mitwirkung ärztlicher Psychotherapeuten K. Born J. Klauenflügel H. Neubig F. W. Bergert M. Braun H. Clarius K. Ehrenthal J. Feßler J. Gross K. Gundermann H. Hesse J. Hintze U. Hüttner B. Kluthe W. LangHeinrich A. Liesenfeld E. Luther R. Pchalek J. Seffrin G. Vetter H.-J. Wolfring U. Zimmermann Unter Mitwirkung ärztlicher Psychotherapeuten K. Born J. Klauenflügel H. Neubig Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Seite 23 Psychische Störungen: psychosomatische Anteile Psyche und Asthma [nach 137] Asthma ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege und nicht primär psychisch verursacht. Zur Behandlung des Asthma stehen heute potente Medikamente mit gesicherter Wirkung zur Verfügung. Die standardisierte Stufentherapie wird durch Präventivmaßnahmen und allgemeine Maßnahmen ergänzt [81]. Wesentliches Element der Dauerbehandlung ist die antiinflammatorische Therapie, bei der inhalative Steroide das Mittel der Wahl sind [75, 96, 125]. Asthma kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich reduzieren, wobei Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit ebenso eine Rolle spielen wie emotionale und soziale Faktoren [81]. »Das Hauptsymptom »Atemnot« jedoch wirkt sich verständlicherweise durch Angst auf die Krankheitsgestaltung aus. Je besser ein Patient über seine Krankheitsursachen aufgeklärt und therapiert ist, um so mehr sind Verhaltenstherapien und Entspannungstechniken äußerst hilfreiche Maßnahmen. Selbsthilfegruppen sind dabei eine wertvolle Unterstützung [134].« Unabhängig von der entzündlichen/allergischen Genese des Asthma bronchiale und der Möglichkeit einer kausalen Therapie, ist schon lange bekannt, dass Veränderungen psychosozialer Faktoren und emotionaler Befindlichkeit Zusammenhänge mit der Ausprägung von Asthmabeschwerden aufweisen. Positive und negative Stimmung verbessert bzw. verschlechtert signifikant den Peakflow und vermindern respektive erhöhen die Intensität der wahrgenommenen Asthmasymptome. Das Zusammensein mit Menschen, die nicht zum bekannten privaten Umfeld gehören, vermindert die Schwere der Asthmasymptome und verbessert den Peakflow, was mit einer Verschiebung der Aufmerksamkeit vom eigenen Körper zum fremden Gegenüber erklärt wird. Dies spricht dafür, dass innerfamiliäre Belastungsfaktoren beim Asthma z. B. unbearbeitete Verlassenheitsängste, überbehütete Mutter-Kind-Beziehungen von Bedeutung sind. Insbesondere Stimmungen die sich entlang der Achse »glücklich – traurig« und »ruhig – ängstlich« anordnen lassen, führen zu Veränderungen der protokollierten Asthmasymptome. Die PeakflowWerte als Ausdruck des Atemwegswiderstands werden hingegen durch das Ausmaß der Aktivierung entlang der Achse »aktiv – passiv« und »aufgedreht – schläfrig« beeinflusst. Bei Kindern konnte gezeigt werden, dass sich akut schwerwiegende Ereignisse (wie Verlust einer nahe stehenden Person, Umfeldänderungen wie Scheidung der Eltern) sowie chronische Belastungen (wie Hänseln in der Schule, Substanzmissbrauch von Bezugspersonen) auf die Häufigkeit von Asthmaanfällen auswirken. Eine Erklärung ist, dass Atmung am emotionalen Geschehen und am Austausch eines Individuums mit seiner Umwelt unmittelbar beteiligt ist. Das subjektive Gefühl von Atemnot oder Enge in der Brust ist kein schlichtes Abbild physiologischer Veränderungen, sondern spiegelt auch psychologische Befindlichkeiten wider. Tinnitus (modifiziert nach [70]) Tinnitus ist ein häufiger Beratungsanlass beim Hausarzt. Beim Tinnitus handelt es sich um ein Ohrgeräusch unterschiedlicher Dauer und Lautstärke, das nicht durch ein Sinnessignal hervorgerufen wird. Infolge des Tinnitus kann es zu konsekutiven Schlafstörungen und psychischer Dekompensation kommen. Ursachen: Vielfalt und Unklarheit Eine organische Ursache lässt sich für dieses Krankheitsbild selten finden, auch wenn als Auslöser folgende Erkrankungen wie Hörbeeinträchtigungen, Lärmschäden, Knalltraumen, Morbus Menière möglich sind und im Einzelfall vorliegen mögen. Auch der Hörsturz ist oftmals von einem Tinnitus begleitet. Patienten benennen auch Stress als Auslöser. Bei bis zu 50% der Betroffenen geht eine Geräuschempfindlichkeit (Hyperakusis) voraus [49]. Im Vergleich zur Schwerhörigkeit treten beim Tinnitus jedoch häufiger zusätzlich therapiebedürftige psychosomatische Störungen auf [110]. Seite 24 KVH • aktuell Tinnituspatienten, die ihren Tinnitus als erheblichen Stressor bezeichneten, zeigen häufiger Angst und Depressionen [48]. Vor allem gedankliche Reaktionen der Betroffenen auf den Tinnitus (Aufmerksamkeitsfokussierung) gelten als maßgeblicher Einfluss auf die Empfindung, den Tinnitus als Stressor verantwortlich zu machen [48]. Doch entgegen der Popularität der Tinnitus-Stress-Genese gibt es keine ausreichend methodisch angemessenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Diagnostik Aus hausärztlicher Sicht wird bei akut aufgetretenem Tinnitus nach Basisuntersuchung empfohlen, zunächst abzuwarten. Sollte in den nächsten Tagen keine Besserung auftreten, wird die Erhebung der psychosozialen Belastungsfaktoren und eine abklärende Diagnostik zum Ausschluss eines organischen Befundes empfohlen. Bei chronischem Tinnitus sind wiederholte organische Abklärungsversuche nicht zielführend. Ziel der Behandlung ist nicht die vollständige Beseitigung des Tinnitus, sondern eine Besserung durch den Versuch, die Aufmerksamkeit des Patienten auf das Ohrgeräusch zu reduzieren. Der Patient soll lernen, den bisher als Katastrophenalarm aufgefassten Tinnitus als ungefährliches und unwichtiges Signal zu interpretieren und schließlich zu überhören [48]. Dem Patienten ist nach Ausschluss organischer Erkrankungen zu vermitteln, dass es sich um eine Störung der Wahrnehmung und deren Bewertung handelt, die oftmals psychosoziale Ursachen hat. Nr. 2 / 2009 tischen Abklärung verschlossen. Eine Psychose und Depression sollten ausgeschlossen werden. Psychiatrische Hilfe kann notwendig werden beim komplexen Leiden am Tinnitus mit Angstentwicklung und depressiver Symptomatik (Dekompensationen, Suizidgefahr) [116]. Hinweis: Gespräche mit dem Patienten über die begrenzten Therapiemöglichkeiten führen, um die Fixierung auf (oder verzweifelte Suche nach) Verfahren außerhalb der wissenschaftlich orientierten Medizin mit nicht haltbaren Heilsversprechen zu vermeiden. Es gibt keine Evidenz für eine Wirksamkeit bei Tinnitus für Ginkgo biloba [62], Sauerstofftherapie (Hyperbaric oxygen therapy) [15], Antidepressiva [9], »durchblutungsfördernde« Maßnahmen. Therapie Aufklärung über die Harmlosigkeit des Symptoms (hausärztliche Erfahrung einer hohen Spontanheilungsquote). Geduldige Auseinandersetzung (Empathie) mit den Ängsten des Tinnitus-Patienten. Hilfreich sind leise externe Geräuschquellen. Entspannungsverfahren zur Stressreduktion, psychotherapeutische Verfahren [90]. Bei Dekompensation (d. h. erhebliche Einschränkung der Lebensqualität; Suizidgedanken): Stationärer Aufenthalt. Bei ausgeprägter Schlaflosigkeit kann die Gabe eines trizyklischen Antidepressivums erwogen werden. Tinnitus-Patienten sind meist auf eine organische Erkrankung fixiert und einer psychotherapeu- Schwindel (modifiziert nach [70]) Schwindel ist eines der häufigsten Symptome überhaupt und imponiert als unangenehme Verzerrung der Raum- und Bewegungswahrnehmung mit Gleichgewichtsstörungen. »2% der Arztbesuche in Allgemeinpraxen sollen aufgrund von Schwindelsymptomen erfolgen und mehr als 20% aller neurologischen Patienten stellen sich mit einer Schwindelsymptomatik vor, womit Schwindel nach Kopfschmerz das zweithäufigste Leitsymptom in diesem Rahmen darstellt« (zitiert nach [80]). Häufige Ursachen organischen Schwindels sind HNO-Erkrankungen wie Morbus Menière, Neu- ronitis vestibularis und der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Als weitere Ursachen sind neurologische, orthopädische und internistische Erkrankungen auszuschließen. Das therapeutische Vorgehen ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen organischem und psychogenem Schwindel (zur Differenzialdiagnose siehe auch Tabelle auf der folgenden Seite). Schwindelsymptome, die mit Beschwerden und Ängsten bei bestimmten Situationen und Orten verbunden werden (z. B. Akrophobie »Höhenangst«, Agoraphobie, Klaustrophobie), entsprechen KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 am ehesten Unterformen von Angststörungen (Phobischer Schwankschwindel). Seite 25 zahlreiche (> 5) Medikamente eingenommen werden. Präsynkopen mit Schwarzwerden vor den Augen, Kopfleere, drohender Ohnmacht und Blässe bessern sich im Liegen. Ursache ist eine Ì temporär Schwindel verminderte Gehirndurchblutung, z. B. durch Orthostase, Rhythmusstörung oder Atherosklerose der hirnversorgenden Gefäße und des Karotissinus, oft akzentuiert durch Antihypertensiva. Diese Schwindelform ist bei kardiovaskulär geschädigten Patienten häufig. Schwindelformen im Zusammenhang mit Depressivität, Angststörung, Muskelschwäche oder Herzinsuffizienz. Psychische Störungen: psychosomatische Anteile Der psychogene oder psychosomatische Schwindel, der nicht an Angstsymptome gekoppelt ist, ist den somatoformen Störungen zuzuordnen [80, 122]. Bei etwa einem Drittel bis der Hälfte der Patienten mit chronischen unklaren Schwindelerkrankungen sind psychosomatische Störungen die Ursache [38]. Als Folge der Schwindelsymptomatik kann es zum Auftreten von Ängsten vor deren Wiederauftreten kommen, so dass sich als komorbide Störung eine sekundäre Angsterkrankung oder, aufgrund der Einschränkung der Lebensqualität, eine depressive Schwindel (modifiziert nach [70]) Störung entwickelt [80]. Schwindel ist eines der häufigsten Symptome Schwindel imimponiert Alter als unangenehme Verzerüberhaupt und Etwa 30% der alten Bevölkerung klagen über rung der Raum- und Bewegungswahrnehmung mit Schwindel, fast jeder Patient aber unter Gleichgewichtsstörungen. »2% versteht der Arztbesuche in Schwindel etwas anderes. Die folgenden HauptkaAllgemeinpraxen sollen aufgrund von Schwindeltegorien dienen der diagnostischen Orientierung. symptomen erfolgen und mehr als 20% aller neurologischen Patienten stellen sich mit einer Häufig sind in der Hausarztpraxis: Schwindelsymptomatik vor, womit Schwindel nach Gleichgewichtsstörung, unsicherer Gang Kopfschmerz zweithäufigste Leitsymptom in und Standdas resultieren oft aus dem Zusamdiesem Rahmen neuromuskulärer darstellt« (zitiert nach [80]). (Musmenwirken Faktoren kelschwäche, Trainingsmangel, Übergewicht, Häufige Ursachen organischen Schwindels sind Polyneuropa-thie), degenerativen Veränderungen (Gonarthrose, HWS-Spondylarthrose), HNO-Erkrankungen wie Morbus Menière, Neuronischlechtemund Sehen Hören sowie der LageFurcht tis vestibularis der und benigne paroxysmale vor Stürzen. Als weitere Ursachen sind neurorungsschwindel. Nebenwirkung von Medikamenten (Neulogische, orthopädische und internistische Erkranroleptika, Antidepressiva, Sedativa, Parkinsonkungen auszuschließen. Das therapeutische VorMedikamente, Antihypertensiva, Mittel gegen gehen ergibt sich aus der Unterscheidung zwiUrininkontinenz, nichtsteroidale Antiphlogistischen organischem und psychogenem Schwindel. ka, starke Schmerzmittel), insbesondere wenn Eher selten sind: Schwindelsymptome, die mitmit Beschwerden und Drehschwindel (Vertigo) pathologischer Ängsten bei bestimmten Situationen undUmgeOrten Bewegungsempfindung (Patient oder bung dreht sich). (z. Mögliche Ursachen: Läsioverbunden werden B. Akrophobie »Höhennen entweder im Innenohr, z. B. M. Menière angst«, Agoraphobie, Klaustrophobie), entspre(Tinnitus, Nausea, Vomitus) oder so genannter chen am ehesten Unterformen von AngststörungLagerungsschwindel en gutartiger (Phobischeranfallsweiser Schwankschwindel). (ausgelöst durch Kopfbewegungen beim Hinlegen, Aufsetzen oder Drehen im Bett, Der psychogene oder psychosomatische SchwinBücken) oder Läsionen im Hirnstamm, z. B. del, der nicht an Angstsymptome gekoppelt ist, ist nach Apoplex (schweres Krankheitsbild, oft denmitsomatoformen Störungen zuzuordnen [80, anderen neurologischen Zeichen wie 122]. Bei etwa einem Drittel bis derimHälfte der Doppelbildern, Taubheitsgefühl Gesicht, Patienten mit chronischen unklaren SchwindelerDysarthrie) [143]. krankungen sind psychosomatische Störungen die Besonders bei geriatrischen Patienten steht die Ursache [38]. Einschätzung des Sturzrisikos im Zentrum präventiver Hierzu sollen folgende Hinweise Als Maßnahmen. Folge der Schwindelsymptomatik kann es zum beitragen: Auftreten von Ängsten vor deren Wiederauftreten kommen, so dass sich als komorbide Störung eine Hinweise auf ein erhöhtes Sturzrisiko [143] sekundäre Angsterkrankung oder, aufgrund der Stürze in der Anamnese (Patient gezielt danach Einschränkung der Lebensqualität, eine depresfragen) sive Störung entwickelt [80]. Unterscheidungsmöglichkeit des Innenohrbedingten Schwindels vom psychogenen Schwindel [117] Somatoformer (»psychogener«) Vestibulärer Schwindelanfall Schwindel-Zustand Fixieren eines Gegenstandes nicht möglich möglich Heftiges Auftreten oder Aufnicht möglich, führt zu erneuten stampfen im Geh- u. Tretversuch Anfällen möglich Anwesenheit vertrauter Menschen ohne direkten Einfluss kann das Schwindelerlebnis bessern Nystagmus vorhanden nicht vorhanden Beschreibung des Schwindels Drehschwindel »diffuse« Beschreibung Audiogramm Tieftonverluste ohne pathologischen Befund Seite 26 KVH • aktuell Das Gangbild wirkt ungleichmäßig und unsicher Zum Aufstehen vom Stuhl wird Armhilfe nötig Unsicherheiten im Romberg-Test Patient kann weniger als zehn Sekunden in Seiltänzer-Fußstellung stehen Gehgeschwindigkeit < 1 m/s; braucht > 5s für 5m Fünfmal Aufstehen vom Stuhl dauert länger als 15 Sekunden Patient braucht mehr als zwölf Schritte für eine 360-Grad-Drehung Fallbeispiel: Schwindel Eine 39-jährige Frau erwacht mit Schwindel, der so stark ist, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Ein Krankenwagen bringt sie zum Neurologen, der keine Ausfälle feststellt und die Patientin zum CT schickt. Auch hier findet sich ein Normalbefund. Ebenso beim HNO Arzt und beim Internisten. Die Laborparameter sind auch unauffällig. Die Patientin bleibt sechs Wochen zu Hause im Bett, ernährt sich fast ausschließlich von frischer Vollmilch, schläft auch tagsüber viele Stunden. Ihre Eltern versorgen den Haushalt und die vier Kinder. Nr. 2 / 2009 Die Krankengymnastin (Schwindeltraining) kommt 2 x pro Woche. In der fünften Woche tritt langsam eine Besserung des Schwindels ein. Die Vorgeschichte: Die Patientin heiratet mit zwei Kindern, 5 und 12 Jahre alt, in zweiter Ehe einen Elektroingenieur, der vor zwei Jahren sein Geschäft eröffnet hat. Die Patientin bekommt zwei weitere Kinder in 14-monatigem Abstand. Zweimal baut das Ehepaar am eigenen Haus an. Wochenenden gibt es fast nicht. Um Geld einzusparen, übernimmt die Patientin nach der Heirat die gesamte Rechnungsstellung und die Führung der Konten des Elektrikergeschäfts. Wochen vor der akuten Erkrankung tritt 2-mal eine heftige Migräne auf, die weder die Patientin noch den hart arbeitenden Ehemann zum Nachdenken bringt. Kommentar: Die sorgfältige somatische Abklärung war im akuten Geschehen erforderlich; im Verlauf zeigte sich, dass der Schwindel vorrangig Ausdruck der Überlastungssituation war. Heiserkeit (modifiziert nach [70]) Bei der Heiserkeit handelt es sich um eine Veränderung des Stimmklanges ggf. mit lokalen Missempfindungen und Räusperzwang. Bei 30 bis 50% dieser Patienten ergibt sich kein organischer Befund. Hierbei handelt es sich um funktionelle und psychogene Stimmstörungen mit guter Prognose. Spezielle Therapien sind in der Regel nicht erforderlich. Selten sind Psychotherapiemethoden und logopädische Behandlung mit Übungen zur Atmung und Entspannung erforderlich. Dermatologie Die psychosomatische Dermatologie beschäftigt sich mit Hautkrankheiten, bei denen psychosomatische Ursachen, Folgen oder Begleitumstände einen wesentlichen und therapeutisch bedeutsamen Einfluss haben. Hautpatienten in Fachkliniken haben in 25 bis 30% psychische Probleme [70]. Dermatosen, bei denen die Psyche eine Rolle spielen kann – sowohl auslösend als auch mit nachfolgenden psychischen Beschwerden [70, 133] sind z. B.: Akne Alopecia areata Dyshidrosiformes Ekzem Herpes labialis und genitalis Hyperhidrose Kontaktekzem Neurodermitis Psoriasis Pruritus sine materia Prurigo simplex subacuta Urticaria Vitiligo Davon abgegrenzt werden psychiatrische Hauterkrankungen, bei denen psychopathologische Aspekte im Vordergrund stehen. In diese Gruppe gehören bewusst und unbewusst vorgetäuschte chronische Störungen: Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Simulationen (bewusst vorgetäuschte Verletzungen oder Erkrankungen z. B. zur Vorteilserlangung) Paraartefakte (Manipulation einer bestehenden Dermatose infolge mangelnder Impulskontrolle, z. B. Trichotillomanie) Artefakte (unbewusste Selbstverletzung) und vermeintliche Dermatosen infolge von Wahnvorstellungen oder Halluzinationen (z. B. Dermatozoenwahn). Sekundäre psychische Störungen (somato-psychische Erkrankungen) können infolge von schweren Seite 27 oder entstellenden Dermatosen auftreten und sich als Anpassungsstörungen, Depression oder Angststörungen zeigen [133]. Der betreuende Hausarzt sollte bei unklaren Hautbefunden oder unerwarteten Verschlechterungen auch an die Möglichkeit psychiatrischer oder psychosomatischer Dermatosen denken. Die Überweisung des Patienten zu einem Hautarzt ist für den Betroffenen naheliegend und entspricht meist auch der Erwartungshaltung der Patienten. Frauenheilkunde Psychosomatische Störungen im Bereich der Frauenheilkunde betreffen die Organe, die mit Sexualität, Fortpflanzung und der weiblichen Identität assoziiert sind. Entsprechende Krankheitsbilder können sich als Folge von körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen in geschlechtsspezifischen Lebensphasen (Pubertät, Schwangerschaft, Wochenbett, Klimakterium) oder auch als Reaktion auf Lebensereignisse entwickeln. Bei folgenden kritischen Lebensereignissen sind schwerwiegende psychosomatische Folgereaktionen möglich, die die Patientin stark beeinträchtigen können: unerfüllter Kinderwunsch (Sterilität, Infertilität), Mitteilung pathologischer Diagnosen in der Schwangerschaft oder beim Neugeborenen, traumatisch erlebte Geburt, Abort, Totgeburt, Tod des Neugeborenen, plötzlicher Kindstod, schwere Erkrankung des Kindes, schwere Erkrankung oder Tod des Partners, Karzinomerkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane, sexuelle Traumatisierung, psychosoziale Entmachtung. Zu beachten ist: Bei so gut wie allen Symptomen und Krankheitsbildern der Gynäkologie und Geburtshilfe können sowohl somatische als auch psychische und soziale Ursachen vorliegen. Nicht selten fühlen sich Patientinnen mit (chronischen) gynäkologischen Erkrankungen stark psychisch beeinträchtigt, wie z. B. Blutungsstörungen (Stärke, Häufigkeit), Primäre oder sekundäre Amenorrhoe, prämenstruelles Syndrom, Dysmenorrhoe, Fluor, Fluorgefühl, Pruritus genitalis, Pillenunverträglichkeit, rezidivierende Unterbauchschmerzen, Harninkontinenz, klimakterisches Syndrom, funktionelle Sexualstörungen. Die psychotherapeutische Behandlungsbedürftigkeit hängt vom Ausmaß der Belastung und dem individuellen Wunsch der Patientin ab. Die Zuordnung zu einer mutmaßlich psychosomatischen oder somatopsychischen Klassifikation ist für den hausärztlichen Bereich nicht sinnvoll. Da die weiterführende Beratung der Patientin auch vom frauenärztlichen Befund abhängt, ergibt sich eine Schnittstelle zur Gynäkologie, über die zweckmäßigerweise eine Zuweisung zur Psychotherapie erfolgen kann. Gynäkologisch-psychosomatische Krankheitsbilder mit kurzer bisheriger Krankheitsdauer lassen sich gut therapieren (psychodynamisch oder verhaltenstherapeutisch). Bei chronifizierten Krankheitsbildern ist der Behandlungserfolg vermindert. Hier sind Motivationsgespräche angezeigt: Verlassen der rein somatischen Ebene mit dem Drängen auf weitere frustrane somatische Diagnostik, Reduktion von Medikamentengebrauch, Einsicht in die psychosozialen Lebensumstände der Patientin vermitteln. Gegebenenfalls muss hier zu einer speziellen psychotherapeutischen Diagnostik und Behandlung geraten werden, insbesondere dann, wenn eine Komorbidität mit weiteren psychischen Erkrankungen vorliegt (z. B. Angst, Depressivität). Seite 28 KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Rückenschmerzen, Fibromyalgie Rückenschmerzen Hierbei handelt es sich um akute oder chronische Schmerzen, fakultativ mit Ausstrahlung ins Bein, die auf gestörten Funktionsbeziehungen zwischen Bandscheiben, Facettengelenken, Nervenwurzeln und der Muskulatur im Bereich der unteren Wirbelsäule beruhen. Psychosoziale Belastungsfaktoren spielen bei der Auslösung des akuten Kreuzschmerzes häufig eine Rolle und sind für die Chronifizierung des Verlaufs wesentlich. Die 12-Monats-Prävalenz für Rückenschmerzen beträgt über 50%, die Lebenszeitprävalenz 5080% [70]. Die spontane Heilungsrate akuter Rückenschmerzen beträgt, unabhängig von der angewandten Therapie, in den ersten 2 Wochen 70-80%, nach 3 Monaten über 90%. Die Chronifizierungsrate be-trägt für den akuten Rückenschmerz nach dem ersten Auftreten nur 5%, nach Wiederauftreten bereits über 20% [70]. Prognostisch ungünstig sind ein Rentenbegehren, Hoffnung auf eine Entschädigungszahlung sowie Depressivität [70]. Während die somatischen Prozesse durch Verschleiß der beteiligten Gelenke, Bänder und Muskeln erklärt sind, sind psychosomatische Zusammenhänge durch Fehlhaltung, Fehlregulation muskulärer Spannung und damit veränderten Bedingungen für degenerative Bandscheibenprozesse gegeben. Erlebte körperliche Schmerzen führen zu Schmerzangst und zum Vermeidungsverhalten von schmerzauslösenden Bewegungen mit der Folge von Inaktivität und Selbstwertverlust bis hin zu sozialer Isolation und Chronifizierung. Differentialdiagnostisch müssen Entzündungen (z. B. Diszitis, Spondylitis, Spondylarthritis), Tumore (z. B. Plasmozytom, Wirbelkörpermetastasen), Spondylolisthesis, gynäkologische Erkrankungen und eine somatische Ursache der Schmerzen ausgeschlossen werden (s. Hinweise für drohenden chronischen Verlauf bzw. auf komplizierte Rückenschmerzen, Hausärztliche Schmerz-Leitlinie [82]). Fibromyalgie Es handelt sich um ein Syndrom vielfältiger funktioneller Beschwerden mit polytopen Symptomen, meist auch psychischer Symptomatik und besonders im Vordergrund stehenden definierten druckschmerzhaften Körperstellen, so genannte »Tender points«. Der Symptomenkomplex Fibromyalgie umfasst: mehr als 3 Monate bestehende generalisierte Schmerzen des Bewegungssystems mit Druckschmerzhaftigkeit von mindestens 11 von 18 definierten Körperstellen (so genannte »Tender points«), depressive Verstimmungen und Ängste (depressive Störung oder Angststörung, insgesamt 60-78%), Parästhesien (ca. 60%) und Spannungskopfschmerzen (ca. 50%), chronische Müdigkeit (ca. 60%), funktionelle Unterbauchbeschwerden (ca. 3060%), funktionelle urogenitale Beschwerden (ca. 4060%), Restless-legs-Syndrom (30%), Schlafstörungen, besonders Störung des NonREM-Schlafes (90-100%), Multiple Chemikalienunverträglichkeiten (50%). Prävalenz der Fibromyalgie Gesamtbevölkerung: 1,9%-3%, in Hausarztpraxen: 6%, in rheumatologischen Einrichtungen bis 20%. Frauen sind 6-mal häufiger betroffen [70]. Prädisposition durch: familiären Alkoholmissbrauch (40%), Erfahrungen mit körperlicher Gewalt (32%), sexuellen Missbrauch (10%), psychische Belastungen in der Kindheit. Folge sind vermindertes Selbstwertgefühl und/oder unreife Konfliktbewältigungsstrategien [70]. Therapeutisch kann bei Nichtansprechen der orthopädischen Therapie die psychotherapeutische Mitbehandlung sinnvoll sein (siehe Hausärztliche Schmerz-Leitlinie [82]). Fallbeispiel: Schmerzen Frau N., 48 Jahre, von Beruf Kindergärtnerin, leidet seit einigen Wochen unter einem schwer definierbaren Schmerz im Bereich der linken Hüfte/Unterbauch. Multiple Untersuchungen inklusive CT und die Mitarbeit von Kollegen verschiedenster Fachrichtungen führen nicht weiter. Die Beschwerden chronifizieren über die Monate und Jahre und entwickeln sich zu Ganzkörperschmerzen, ständiger Müdigkeit und rascher Erschöpfbarkeit. Die Frau muss sich öfter erst eine Weile im Bett ausruhen, wenn sie ein Stockwerk erklommen hat. Die Patientin ist lange arbeitsunfähig und wird schließlich Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell auf Zeit berentet. In Zusammenarbeit mit dem Neurologen, Rheumatologen, Psychologen etc. wird die Krankheit als Fibromyalgie definiert. In der Rückschau ist von besonderer Bedeutung, dass am Beginn der Erkrankung ein außergewöhnlicher Kraftakt, nämlich der Bau des eigenen Hauses steht, das wenige Wochen nach Fertigstellung im Keller permanent unter Wasser steht, was als Katastrophe erlebt wird. Letztes Jahr gönnt sich die Familie nach langer Zeit erstmals wieder einen Urlaub, bei dem die Patientin die meiste Zeit komplett schmerzfrei ist und sogar Berge ohne die üblichen Symptome besteigen kann. Zu Hause sind alle Beschwerden sofort wieder präsent und gelegentlich nur mithilfe von Schmerzmitteln erträglich. Jetzt verkauft die Familie das Haus. In der neuen Wohnung kann die Patientin anstrengende Renovierungarbeiten ohne Schmerzen bewerkstelligen, abends zurück im alten Haus beginnt das Elend sofort von Neuem. Seite 29 Kommentar Die Belastungssituation (Hausbau, nach Fertigstellung Wasser im Keller) ist nachvollziehbar. Auffallend ist die Schmerzfreiheit in anderer Umgebung. Die Chronifizierung ist Ausdruck für fehlende Perspektive und von Hilflosigkeit. Die Patientin benötigt Hilfe, um mit dieser Situation umzugehen. Erklärungsversuch: Sie scheint in einem innerfamiliären psychosozialen Spannungsfeld zu leben, für das sie aus ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung die notwendige Anpassungsleistung nicht erbringen kann. Aus analytischer Sicht handelt es sich um eine Selbstwert- und Beziehungskonfliktstörung, die einer langfristigen tiefenpsychologischen Betreuung bedarf. Psychische Störung: Verhaltensstörungen und psychische Auffälligkeiten Konversionsstörungen (früher: »Hysterie«) Im Fach Psychiatrie ist die Konversionsstörung mit diversen Störungen von Motorik, Sensibilität und Sensorik häufig anzutreffen. Nicht selten chronifiziert sie mit erheblichen psychosomatischen Beschwerden. Die funktionellen Störungen der Motorik, Sensibilität und Sensorik sind sehr variabel. Einerseits können diese Störungen spontan verschwinden, andererseits können sie auch in einen chronischen Verlauf mit schwerer körperlicher Behinderung übergehen. Diagnostisch abzugrenzen sind Simulation und Aggravation sowie körperliche Erkrankungen, die mit entsprechenden Symptomen einhergehen. Zur Diagnose ist es erforderlich, dass ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Symptombeginn und einer psychosozialen Belastungssituation nachweisbar ist. Für die Konversionsstörung ist es typisch, dass die Art der Störung nicht den anatomischen und funktionalen Strukturen des Nervensystems folgt. Für die Symptomwahl und die Symptomausgestaltung können mitunter aus der biographischen Anamnese Hinweise und Zusammenhänge erkannt werden. Die Diagnose wird dadurch gestützt, dass Art und Schwere der Symptomatik nicht zu der funktionellen Beeinträchtigung passen, Ausfälle die neuroanatomischen Grenzen überschreiten, atypische Verläufe vorliegen, die Beschwerden durch Suggestion beeinflussbar sind. Konversionsstörungen treten bei Frauen dreimal häufiger auf als bei Männern. Der Beginn der Störung liegt häufig zwischen dem 15. und 25. sowie zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr, sie kommt auch bei Kindern vor. In der Allgemeinbevölkerung liegt die Prävalenz bei 0.5% [70]. Als Ausschlussdiagnosen einer Konversionsstörung gelten: bewusst beabsichtigte Täuschung (Simulation), selbstschädigendes Verhalten (artefizielle Störung). Als Komorbidität treten Depressivität und Angststörungen auf. Persönlichkeitsstörungen kommen in etwa 20% vor. Körperliche Erkrankungen kommen nicht häufiger als in der Normalbevölkerung vor [70]. Für die Ätiologie einer Konversionsstörung kommen folgende Faktoren in Betracht: Traumatische Kindheitserlebnisse (Misshandlung, Missbrauch), Seite 30 KVH • aktuell ambivalente Beziehung zu körperlich erkrankten Elternteilen, Probleme der sexuellen Identitätsfindung, Bahnung durch Vorschädigung im entsprechenden Organbereich, aktuelle psychosoziale Konflikte, Verlustreaktionen mit pathologischer Trauer, berufliche Überforderungssituationen, Partnerschaftskonflikte. Da Patienten mit Konversionsstörungen zunächst selbst von der organischen Natur ihrer Erkrankung überzeugt sind, lehnen sie häufig andere Erklärungen ab. Das Verständnis dieser Situation sollte im Mittelpunkt der hausärztlichen Bemühungen stehen, besonders dann, wenn psychosoziale Belastungssituationen mit dem Krankheitsbild verknüpft sind, wodurch die Einsichtsfähigkeit des Patienten oftmals begrenzt ist. Nr. 2 / 2009 kung unter Berücksichtigung des subjektiven Krankheitsverständnisses, Angebot regelmäßiger, kurzer Gesprächstermine (Kontrolle des Verlaufs), symptombezogene Behandlungen: (Krankengymnastik bei psychogenen Bewegungsstörungen, Ergotherapie bei psychogenen Sensibilitätsstörungen), supportive Beratungsgespräche zur Herausarbeitung der auslösenden psychosozialen Belastungssituation. Psychiatrische Diagnostik und Behandlung sind indiziert bei schwerer körperlicher Beeinträchtigung, fehlender Besserung innerhalb von 3 Monaten, Aufrechterhaltung des Krankheitsbildes durch Fortbestehen eines erheblichen psychosozialen Konfliktes sowie bei psychischer und somatischer Komorbidität. Wichtig sind bei der Therapie: Aufklärung und Information über die Erkran- Ess-Störungen: Anorexia nervosa, Bulimie Essstörungen haben unbehandelt schwerwiegende Folgen mit einer deutlich erhöhten Mortalität. Sie sind in der Regel chronifiziert und bedürfen einer verständigen hausärztlichen psychosomatischen und medizinischen Betreuung sowie häufig zusätzlich einer mitunter langdauernden psychologischen Behandlung. Man kann drei unterschiedliche Krankheitsbilder zusammenfassen [70]: Anorexia nervosa Bulimia nervosa Adipositas (einschl. sog. »Binge Eating«) Anorexia nervosa Jährliche Inzidenz ca. 0,5 bis 1,0 pro 100.000 Einwohner, Lebenszeitprävalenz ca. 0,5% bei Frauen, ca. 0,05% bei Männern. Erstmanifestation meist in der Adoleszenz, selten präpubertär oder nach dem 40. Lebensjahr. Verlauf meist subchronisch bis chronisch. Mit 5 bis 20% hohe Mortalität (häufigste Todesursache junger Frauen zwischen 15 und 24 Jahren!) Bei etwa 60 bis 70% langfristig günstiger Verlauf [27]. Die frühzeitige Erkennung und kompetente Behandlung ist einer der bedeutendsten Faktoren für eine günstige Prognose. Patienten melden sich meist mit unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Schwindel oder Amenorrhoe. Eine Gewichtsveränderung wird oftmals nicht erwähnt [72]. Die Anorexia ist durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert. Am häufigsten ist die Störung bei heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen [31]. Es liegt meist Unterernährung unterschiedlichen Schweregrades vor (BMI < 17,5 kg/qm), die sekundär zu endokrinen und metabolischen Veränderungen und zu körperlichen Funktionsstörungen führt. Zu den Symptomen gehören eingeschränkte Nahrungsauswahl, übertriebene körperliche Aktivitäten, selbstinduziertes Erbrechen, Abführen und der Gebrauch von Appetitzüglern und Diuretika [31]. Bei einem BMI von < 15 kg/qm [31] und/oder weiteren Störungen (plötzlicher Gewichtsverlust, Elektrolytstörungen, Infekte, Herz-Kreislaufkomplikationen, Synkopen, Suizidalität) ist wegen Lebensgefahr die stationäre Einweisung zu meist langdauernder Behandlung erforderlich, anschließend (wenn der BMI mindestens 15 kg/qm überschritten hat) sollte eine dauerhafte psychodynamische Einzeltherapie mit Aufbau von Beziehungssicherheit und konfliktorientierter Psychotherapie organisiert werden. Bulimia nervosa Ein Syndrom, das durch wiederholte Anfälle von Heißhunger und eine übertriebene Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpergewichts charakterisiert ist. Dies führt zu einem Verhaltensmuster Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell von Essanfällen und Erbrechen oder Gebrauch von Abführmitteln Häufig lässt sich in der Anamnese eine frühere Episode einer Anorexia nervosa mit einem Intervall von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren nachweisen [31]. Lebenszeitprävalenz bei Frauen ca. 0,5% bis 3%, bei Männern ca. 0,2%. Erstmanifestation meist in der Adoleszenz, selten präpubertär oder nach dem 40. Lebensjahr. Verlauf ist meist subchronisch bis chronisch. Prognose: Niedrige Mortalität. Bei etwa 70 bis 80% langfristig günstiger Verlauf [27]. Bei beiden (durchaus lebensbedrohlichen) Krankheitsbildern, die ineinander übergehen können, bestehen eine zwanghafte Sorge um Figur und Gewicht. Es treten häufig Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Suchtstörungen und Borderline-Störungen auf. Adipositas Adipositas (BMI >30 kg/qm) wird auf genetische Faktoren sowie auf falsche Lebensführung und Essgewohnheiten zurückgeführt. Bei den bekannten metabolischen und sonstigen (z. B. kardialen oder orthopädischen) Folgen der Übergewichtigkeit (bei einem BMI von > 35 kg/qm verdoppelt sich die Mortalität) finden sich bei Adipösen vermehrt Selbstwertdefizite, Störungen des Verhaltens und sozialer Rückzug, jedoch kann mit verhaltenstherapeutischem und pragmatischem Erlernen von adäquater Ernährung, Aktivierung und Stärkung des Selbstwertgefühls die Problematik entschärft werden. Ggf. hilft nur die AdipositasChirurgie [33]. Binge Eating Während die Binge-Eating-Störung in der Allgemeinbevölkerung mit einer Prävalenz von ein Prozent bis drei Prozent ähnlich häufig auftritt wie die Bulimia nervosa, ist sie in selektierten Stichproben von adipösen, unter ihrem Übergewicht leidenden und Hilfe suchenden Menschen mit circa 30% relativ häufig [59]. Mehr als ein Drittel aller Patienten mit Binge-Eating-Störung sind Männer [59]. Der Verlauf ist meist subchronisch bis chronisch. Prognose: Mit 5 bis 20% hohe Mortalität. Bei etwa 70 bis 80% langfristig günstiger Verlauf [27]. Die typischen »Fressanfälle« treten durchschnittlich an mindestens zwei Tagen in der Woche für sechs Monate auf. Sie gehen nicht mit dem regelmäßigen Einsatz unangemessener, gegenregulatorischer Maßnahmen einher und treten nicht ausschließlich im Verlauf einer Anorexia oder Bulimia Seite 31 nervosa auf [59]. Kriterien für die Binge-Eating-Störung nach DSM-IV (APA 1994) [59] Wiederholte Episoden von »Fressanfällen«. Ein »Fressanfall« ist gekennzeichnet durch: Essen einer Nahrungsmenge in einem abgrenzbaren Zeitraum, die definitiv größer ist als die meisten Menschen essen würden. Gefühl des Verlustes der Kontrolle über das Essen. Die »Fressanfälle« treten gemeinsam mit mindestens drei der folgenden Symptome auf: Wesentlich schneller zu essen als normal Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl Essen großer Mengen ohne körperliches Hungergefühl Allein essen, aus Verlegenheit über die Menge die man isst Deprimiertheit, Ekel- oder Schuldgefühle nach dem »Fressanfall« Es besteht ein deutlicher Leidensdruck wegen der »Fressanfälle«. Bei der »Binge-Eating«-Störung werden oftmals teilstationäre oder ambulante gruppenpsychotherapeutische Behandlungen erforderlich, um dauerhafte Verbesserungen zu bewirken. Eine Besserung psychischer Symptome wie auch der Ess-Störungssymptomatik zeigt sich nicht direkt an einer Gewichtsabnahme; in bestimmten Fällen kann auch eine Gewichtsstabilisierung ein Behandlungsziel darstellen. Gerade zu hohen Erwartungen im Hinblick auf eine Gewichtsreduktion dieser Patienten ist frühzeitig zu begegnen, um die Kaskade von Essanfall, Erleben eigener Insuffizienz, depressiver Stimmung und schließlich Selbstaufgabe frühzeitig unterbrechen zu können [59]. Fallbeispiel: Anorexie »Die 22-jährige Josefa K. ist magersüchtig. Der Vater steht in leitender Position beim Finanzamt und kann sich wenig kümmern. Die 48-jährige Mutter, Frau K., ist Lehrerin mit halbem Deputat. Mit im Haus lebt noch ihre 80-jährige Mutter. Nach mehreren Schlaganfällen infolge einer langjährigen Diabeteserkrankung ist sie motorisch und sprachlich beeinträchtigt. Ihr Zimmer, ihr Essen, ihre Wäsche müssen versorgt werden. Sie hat ihre Tochter schon zeitlebens »unter ihrer Fuchtel«. Sie behandelt sie immer noch wie ein kleines Kind. Dem Hausarzt ist diese Situation seit Jahren auch durch regelmäßige Hausbesuche vertraut. Er sieht wie die Situation unhaltbar Seite 32 KVH • aktuell geworden ist, spätestens seit Josefa anorektisch wurde. Frau K. hat Schlafstörungen und zeigt auch andere Erschöpfungssymptome. Der Vater ist unzufrieden, weil er zu kurz kommt, z. B. sind Reisen, Urlaube mit seiner Frau nicht mehr möglich. Josefa hat Schuldgefühle, dass sie vor allem ihrer Mutter weitere Sorgen bereitet, zugleich fühlt sie sich, trotz ihres Studiums, zu stark in die Pflege der Großmutter, die zudem noch an ihr herumkrittelt, eingebunden. Die Großmutter will am liebsten sterben, sie sei nur noch im Weg, keiner kümmere sich um sie. Nachdem der Hausarzt Frau K. wegen akuter Erschöpfung – sie ist im Unterricht heulend zusammengebrochen – krank schreiben musste, vereinbarte er ein Gespräch mit ihr und ihrem Mann. Hier wurde beschlossen, dass die beiden regelmäßig sich »etwas Gutes tun«, z. B. in die Sauna gehen, ein Restaurant besuchen, ins Kino gehen oder Sport treiben. Für einen längeren Urlaub wurde eine 14-tägige Kurzzeitpflege der Großmutter in einer akzeptablen Einrichtung vorgeschlagen. Josefa soll in der Zeit die Großmutter regelmäßig besuchen. Der ambulante Pflegedienst setzt in der Zeit aus, mit Josefa soll geklärt werden, dass sie die schon lange geplante Psychotherapie mit einem Nr. 2 / 2009 stationären Aufenthalt in einer Fachklinik in den Semesterferien beginnt. Danach ist geplant, dass sie in eine WG oder ein Studentenheim zieht. An ihrer Stelle soll ein »Omasitter« die gemeinsamen Abende der Eltern ermöglichen. Mit der Großmutter wird besprochen, dass sie sich eine Tagespflege in der Nähe anschaut, wo sie an den Vormittagen hingebracht werden könnte, an denen ihre Tochter in der Schule arbeitet« (zit. nach [44]). Kommentar: Der Hausarzt nimmt die ganze Familie in den Blick (systemischer Ansatz). Er versucht, die festgefahrenen Strukturen aufzuzeigen und bietet Entlastungen für den Alltag an (Tagespflege, Umzug, Freiräume und Mitteilungsmöglichkeiten schaffen). Darin eingebettet ist die Therapie der anorektischen Tochter. Es zeigt sich eine psychisch belastete Familie, in der alle Mitglieder ineffektiv mit ihren psychosozialen Problemen umgehen, Für jeden könnte bei gegebener Motivation zur Veränderung eine Psychotherapie hilfreich sein. Der Einstieg könnte durch eine Familienberatung erfolgen, ggf. nachfolgend mit Einzeltherapien. Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) Unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (post traumatic stress disorder = PTSD) (zitiert nach [54, 55]) versteht man ein Störungsbild, das sich nach massiv belastenden Lebenserfahrungen entwickelt und zu einer lang anhaltenden Beeinträchtigung führt, die sich in vier Symptomgruppen manifestiert: Intrusion, Vermeidung, Numbing und Hyperarousal (siehe Tabelle auf der folgenden Seite). Als Trauma gilt die Konfrontation mit einer lebensbedrohlichen Situation der eigenen oder anderer Personen. Dazu gehören neben Gewalt-, Katastrophenerlebnissen und Unfällen auch Krankheiten, beispielweise Herzinfarkt, Tumorleiden – und zwar bei sich oder nahen Angehörigen. Somit können Zeugen von schrecklichen Ereignissen oder Angehörige ebenso betroffen sein. Die Symptome sollen mindestens über einen Monat bestehen und können im Verlauf wechselhafte Ausprägung zeigen. Folgende Kriterien müssen für PTSD erfüllt sein: Trauma Vier Symptomgruppen (siehe Tabelle auf der folgenden Seite) Signifikante funktionelle Beeinträchtigung Dauer der Beschwerden: mind. ein Monat Bei PTSD finden sich eine hohe Komorbidität zu Depressionen, Angsterkrankungen und Substanzabhängigkeit [39, 54, 55]. Inzidenz von PTSD nach Trauma [nach 54, 55] Die folgenden Angaben zeigen, bei wie viel Prozent derer, die ein Trauma erlebt haben, eine PTSD auftrat (Inzidenz) Die Daten entstammen einer 1995 durchgeführten US-amerikanischen Patientenstudie (n=5877; Alter: 15-54 Lbj.) [73]: Traumatisches Erlebnis Vergewaltigung Krieg Misshandlungen in der Kindheit Vernachlässigung in der Kindheit Sexuelle Belästigung Bedrohung mit Waffen Körperliche Gewalt Unfälle Zeuge (Unfälle, Gewalt) Feuer-/Naturkatastrophen PTSD 55,5% 38,8% 35,4% 21,8% 19,3% 17,2% 11,5% 7,6% 7,0% 4,5% oder nahen Angehörigen. Somit können Zeugen wickelt und zu einer lang anhaltenden Beeinvon schrecklichen Ereignissen oder Angehörige trächtigung führt, die sich in vier Symptomgruppen ebenso betroffen sein. Die Symptome sollen minmanifestiert: Intrusion, Vermeidung, Numbing und Nr. 2 / 2009 Seite 33 KVH • aktuell destens über einen Monat bestehen und können Hyperarousal (s. Tabelle). im Verlauf wechselhafte Ausprägung zeigen. Vier Symptomgruppen der PTSD Intrusion Vermeidung Emotionale Unempfindlichkeit (»numbing«) Erhöhte Grundanspannung (»Hyperarousal«) Immer wiederkehrende Erinnerungen (Intrusion = eindringen) Alpträume »flash-back« Erlebnisse (schreckhafte Erinnerungen, Tagträume) psychischer Stress bei Konfrontation mit Hinweisreizen physiologische (vegetative) Reaktionen bei Konfrontation mit Hinweisreizen Vermeidung von Gedanken und Gefühlen im Zusammenhang mit dem Trauma Nachrichtensendungen und Tageszeitungen werden gemieden Versuch, das Geschehene zu vergessen Teilamnesie für den Vorfall/ die Vorfälle Emotionale Abstumpfung, Isolation Teilnahmslosigkeit, kein Mitgefühl mit anderen Sozialer Rückzug Beziehungsverlust, Gefühl nicht verstanden zu werden Verlust von Interessen Hypervigilanz Ein- und Durchschlafstörungen Konzentrationsstörungen Emotionale Labilität, Reizbarkeit, Wutausbrüche Gesteigerte Schreckhaftigkeit Wichtig ist, dass nicht jedes traumatische Erlebnis zur Ausbildung einer PTSD führt (s. o.). Eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung ist Grundvoraussetzung dafür, dass über die Traumata gesprochen werden kann. Da die Betroffenen häufig keinen Zusammenhang zwischen ihren Beschwerden und den meist schon länger zurückliegenden traumatischen Erfahrungen sehen, müssen Ärzte aktiv nachfragen. Durch Kenntnis des Krankheitsbildes und gezielte anamnestische Fragen lässt sich Hausärztliche Leitlinie »Psychosomatische Medizin« die Diagnose stellen. Fallbeispiel: PTSD nach Herzinfarkt [54, 55] »Ein heute 57-jähriger Mann erlitt während der Sommerferien ohne vorbestehende Symptomatik am Badestrand einen Myokardinfarkt. Mit dem eigenen Auto fuhr er gegen den Rat seiner Ehefrau ins nächste Krankenhaus. Bei der Aufnahme kam es zu einem vollständigen Herz-Kreislauf-Stillstand und erfolgreicher Reanimation. Nach Dilatationsbehandlung und einer dreimonatigen Rehaphase wurde der Patient angesichts einer fortbestehenden kardialen Motilitätsschwäche zu 50% arbeitsfähig geschrieben. Nach rund einem Jahr wurde die Stelle infolge Umstrukturierungen gekündigt. Trotz vielfältiger Bemühungen fand der Patient als Maschineninge- nieur keine Teilzeitstelle und ist seither arbeitslos. Er leidet seitdem unter einer erheblichen Selbstwertproblematik und einer dauernden Angst vor einem erneuten Myokardinfarkt. Neben hartnäckigen Schlafstörungen leidet er an Konzentrationsstörungen, rascher Ermüdbarkeit, depressiven Stimmungsschwankungen, Verlust der Libido, Reizbarkeit und Interessenverlust. Aus Angst meidet der Patient, der früher regelmäßig Sport betrieben hatte, jegliche körperliche Betätigung. 51 Version 1.01 I 29. April 2008 Die zeitweise Betreuung eines Schrebergartens führte zu einer sichtlichen Aufhellung des depressiven Befindens. Der Patient sah ein, dass er eigene Schritte unternehmen muss, soll sich sein Zustandsbild etwas bessern. Dies führte zu einer veränderten Einschätzung der zukünftigen Situation. Ob er eine Teilzeitstelle findet, entscheidet der Arbeitsmarkt, aus kardiologischer Sicht ist er zu 50% erwerbsfähig« (zit. nach [54, 55]). Fallbeispiel: Verkehrsunfall [54, 55] »Ein heute 60-jähriger Mann erlebte 1995 am Steuer seines Wagens einen Frontalzusammenstoß mit einem Personenwagen auf gerader Straße. Später wurde bekannt, dass der Fahrer des den Unfall verursachenden Wagens am selben Tag aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden ist. Seite 34 KVH • aktuell Vermutlich hatte er Selbstmord verübt. Initial fanden sich folgende Symptome: HWS-Distorsion, Schulterkontusion, Knieprellung Schwindel, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen Arbeitsunfähigkeit Depressive Verstimmung und zunehmender Tinnitus beidseits Die Beschwerden wurden multidisziplinär abgeklärt u. a. durch Orthopädie, HNO, Psychologie, Psychiatrie und Neurologie. Der ehemals erfolgreiche selbstständige Kleinunternehmer wurde AU geschrieben, eine Rehamaßnahme führte zu einer Verschlechterung. Die Konfrontation mit kranken Mitpatienten führte im Sinne eines psychogenen Hospitalismus zu einer zusätzlichen Desillusionierung. Im weiteren Verlauf zeigten sich Schlafstörungen, depressive Verstimmung, immer wiederkehrende »flash-backs« (ein auf ihn zurasendes Auto), multiple Körperschmerzen und ein hartnäckiger Tinnitus. Der Patient klagte über rasende Kopfschmerzen und hielt sich manchmal während der Konsultation verzweifelt die Ohren zu. Er litt unter Stimmungsschwankungen, mürrischer Reizbarkeit und Wutausbrüchen und zog sich sozial vollkommen zurück (ehemals kontaktfreudiger, unternehmungslustiger Mann). Die Ehe hielt dem Nr. 2 / 2009 allem nicht stand und wurde geschieden. Stark kränkte ihn das Gerichtsurteil, das ihm lediglich eine symbolische materielle Entschädigung zusprach. Der Richter verkündete lakonisch, dass Autofahren eben mit einem bestimmten Risiko verbunden sei. Der Patient erlebte dies subjektiv schlimmer als den ursprünglichen Unfall. Trotz intensiver Bemühungen in Zusammenarbeit mit der Berufsunfähigkeits-/Rentenversicherung besteht weiterhin eine Arbeitsunfähigkeit zu 100%, der Patient bezieht seit dem Unfall volle Rente. Der Patient besucht einmal monatlich den Hausarzt und äußert, wie wohl es ihm tut, sich hier aussprechen zu könnnen. Die antidepressive Medikation hat subjektiv keine Besserung ergeben, die Schlafstörungen und der Tinnitus zeigen sich therapieresistent« (zit. nach [54, 55]). Therapie Die PTSD zeigt eine hohe Spontanremission. Trotzdem empfiehlt sich eine frühzeitige Behandlung zur Verhinderung von Chronifizierung (siehe auch den Einsatz von Psychologen noch während Bergungsaktionen bei Naturkatastrophen). Die Behandlung besteht in einem multimodalen Zugang, vorzugsweise in einer Kombinationsbehandlung mit störungsspezifischer Psychotherapie und Pharmakotherapie. Mobbing »Mobbing ist gegeben, wenn ein Betroffener mindestens einmal in der Woche mindestens ein halbes Jahr lang attackiert wird – von einer oder von mehreren Personen.« (Definition nach Ley [86, 87]) . Beispiele zeigen, dass jeder von Mobbing betroffen sein kann, dabei sind die Grenzen zu Alltagskonflikten fließend [86, 87]. Mobbing bei Erwachsenen am Arbeitsplatz oder bei Jugendlichen in der Schule führt zwangsläufig beim Mobbing-Opfer zu mehr oder weniger ausgeprägten Beschwerden. Es bildet sich ein Vermeidungsverhalten mit Angst und/oder Depression. Im körperlichen Bereich können Schlafstörungen, zunehmende innere Unruhe und eine ganze Reihe körperlicher Symptome auftreten. Ein psychophysischer Erschöpfungszustand ergibt sich oft zwangsläufig. Das Leid kann bis zum Suizid führen. Die Persönlichkeitsstruktur des Mobbers zeigt häufig narzistische und sadomasochistische Züge. In seinem sozialen Umfeld trifft er häufig auf ein Opfer mit einer Persönlichkeitsstruktur, die von Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle, übertriebenem Harmonie-Bedürfnis, Rückzugsverhalten und Idealisierungsbedürfnis, aber auch von Abhängigkeiten gekennzeichnet ist. Derjenige. der »gemobbt« wird, zeigt ein Verhaltensmuster mit Aggressionshemmung, Neigung zur Unterwürfigkeit und der Unfähigkeit, bestimmt und ohne Schuldgefühle »nein« zu sagen (Tiefenpsychologisch ist ein Zusammenhang mit der IchEntwicklung im Alter um das zweite Lebensjahr sehr wahrscheinlich). Der Hausarzt schreibt den Patienten krank und überweist ihn zu einem Psychotherapeuten, der mit dem Patienten in konkreter Situtationsanalyse sinnvolle Verhaltensstrategien herausarbeitet. Ein Verhaltenstherapeut arbeitet mit konkreter Situationsanalyse und unterschiedlichen Aggressionskonzepten bzw. -strategien. Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Hinweise zu weiterführender Literatur [10, 86, 91, 97, 100, 101, 139, 144] Mögliche Diagnosen nach ICD-10 F68.8 Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Charakterstörung o. n. A.; Störung zwischenmenschlicher Beziehungen o. n. A. (z. B. Anankasmus). F60.7 Differentialdiagnostisch kommt auch die abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung in Betracht (überhöhtes Ich-Ideal). Merkmale dieser Persönlichkeitsstörung sind: asthenische Anteile, inadäquates Verhalten, Passivität und Selbstschädigung. F51.9 nicht organische Schlafstörung, nicht näher bezeichnete emotional bedingte Schlafstörung o. n. A. Anpassungsstörung (F43.2). Akute Belastungsreaktion (F43.0). Kontaktanlässe mit Bezug zum Berufsleben: Z56 (darf als alleinige Kodierung nur verwendet werden, wenn Leistungen abgerechnet werden, die nicht in einer Erkrankung begründet sind). Fallbeispiel: Mobbing 37-jährige Patientin, ein Sohn. 9/02 Scheidung. 8/03 lumbaler Bandscheibenvorfall, der operiert wird. Wenig später Insolvenz des mit großen persönlichen Anstrengungen und der finanziellen Hilfe der Eltern gebauten eigenen Geschäftes. Auftreten depressiver Verstimmungs- und Angstzustände. Unter Antidepressiva und psychotherapeutischer Behandlung kann im Frühjahr 2007 nach mehreren kleinen Jobs endlich wieder eine feste Stelle mit geregeltem Einkommen angetreten werden. 9/07 Seitenstrangangina. Trotz antibiotischer Therapie keine Besserung, sondern Auftreten einer Bronchopneumonie, die unter Behandlung nur langsam ausheilt. Dennoch weiterhin Klagen über allgemeine Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, innere Unruhe, Herzklopfen. Auf die Frage des Hausarztes, ob es denn sonst irgendwelche Probleme gäbe, bricht die Patientin in Tränen aus und schildert die Situation am neuen Arbeitsplatz: Zunächst sei alles gut gewesen, dann habe ihr Vorgesetzter sie sexuell bedrängt. Vielleicht habe sie ihn nicht energisch genug zurückgewiesen, jedenfalls lasse er nicht nach, sie zu bedrängen. Wie vom Hausarzt Seite 35 empfohlen, geht die Patientin schließlich zum Betriebsrat. Der Vorgesetzte der Patientin streitet vor dem Betriebsrat alle Vorwürfe ab und stellt sie als Lügnerin hin, die zudem fachlich unfähig sei. Der Wunsch auf Versetzung in eine andere Abteilung wird nicht erfüllt. Mit ihren Nerven am Ende wird die Patientin nun wegen Mobbings krankgeschrieben, eine arbeitsrechtliche Beratung empfohlen und erneuter Kontakt zu der sie 2003 behandelnden Psychotherapeutin hergestellt. Hinweise [19] Personen, die gemobbt werden / sich gemobbt fühlen, benötigen neben medizinischer und therapeutischer Hilfe auch eine Rechtsberatung (Mobbing ist strafbar; es kann zur Versetzung / Kündigung oder Schadensersatzzahlungen des Mobbers führen). Ausschlaggebend für den Erfolg einer Klage ist die Beweisbarkeit der Vorwürfe. Wichtig sind deshalb für den Gemobbten Zeugenaussagen, EMails (schriftliche Anweisungen) und Briefe. Es wird außerdem empfohlen, ein »Mobbing-Tagebuch« zu führen, das der eigenen Gedächtnisstütze (nicht als Beweismaterial) dient. Zur emotionalen Entlastung helfen Sport, Musik, Entspannung. Links/Kontakte Allgemeine Informationen, z. B. der Ärztekammer Nordrhein mit weiteren Kontaktmöglichkeiten und bundesweitem Überblick über Mobbing-Selbsthilfegruppen siehe untenstehenden Link 1. Empfehlenswert sind niederschwellige Beratungsangebote wie »Mobbingtelefone« (z. B. kirchliche Einrichtungen, Kommune, Gewerkschaften/Personalrat). Eine bundesweite Übersicht findet sich auf der Website der Universität Vechta (siehe untenstehenden Link 2.) Ein Ratgeber (»Hilfe gegen Mobbing am Arbeitsplatz«) von Agneta Bone und Johanna Rückert steht zum Download über das Internet zur Verfügung. (siehe untenstehenden Link 3.) Eine Broschüre zur psychischen Belastung und Beanspruchung im Berufsleben ist bei der Bundesanstalt für Arbeitssschutz und Arbeitsmedizin erhältlich (www.baua.de). 1: http://www.aekno.de/htmljava/frameset. asp?typ=c&seite=mobbingindex.htm 2: http://www.uni-vechte.de/verwaltung/personalrat/Arbeitsrecht/ Mobbing/mobbing.html 3: http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/ Themen/mobbing,did=239070.html Seite 36 KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Soziale Phobie Die 12-Monatsprävalenz für Angststörungen liegt in der Bevölkerung (18-65 Jahre) bei 14,2% [112]. Frauen sind ca. doppelt so häufig betroffen wie Männer. An erster Stelle stehen die akut oft weniger beeinträchtigenden spezifische Phobien. Stärker beeinträchtigend sind generalisierte, nicht näher bezeichnete Angststörungen und soziale Phobien. In den Hausarztpraxen stellt die generalisierte Angststörung mit 5,3% (Stichtagsprävalenz) die häufigste Angststörung dar. Angststörungen sind ein Risikofaktor für Depression, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit [112]. Die Soziale Phobie (zitiert nach [16]) ist durch eine Angst gekennzeichnet, von anderen Personen beobachtet oder negativ bewertet zu werden. Das Verhalten in vertrauter Umgebung ist ungestört, in fremder Umgebung treten typische, vegetative Angstsymtome wie Schwitzen, Zittern, Tachykardie auf. Die betroffenen Personen haben typische, negativ belastete Überzeugungen wie zum Beispiel: »Ich werde zittern/schwitzen, die Leute werden es sehen und sich über mich amüsieren« oder »ich werde bestimmt mitten im Satz hängenbleiben«. Es herrscht die Angst, sich zu blamieren. Das hieraus folgende Vermeidungsverhalten führt einerseits zur Chronifizierung, andererseits zum Rückzug und zur sozialen Isolation. Die private und berufliche Leistungsfähigkeit wird stark beeinträchtigt. Folgende auslösende Situationen sind typisch: Öffentliches Reden oder Essen Schreiben in der Öffentlichkeit Ansprechen von Fremden oder Autoritätspersonen oder Personen des anderen Geschlechts Beobachtet werden, z. B. bei einer Feier, einer Konferenz, einem Meeting Konfliktsituationen, z. B. Reklamationen Teilnahme am öffentlichen Verkehr Abzugrenzen sind normale Reaktionsmuster, wie z. B. das Lampenfieber des Schauspielers vor dem Auftritt oder die Unsicherheit, sich in einer fremden Kultur zu bewegen. Andererseits kann eine unbehandelte soziale Phobie zu zunehmendem Rückzug führen, der Schulbesuch wird vermieden, die Arbeit gekündigt, es kommt zum Rückzug aus dem sozialen Umfeld. Diese negative Spirale kann bis zum Suizid führen. Ursachen: Es gibt eine genetische sowie eine erzieherische Komponente, die stark mit der Psychopathologie des Elternhauses verknüpft und Folge eines abwertenden oder überbehüteten Er-ziehungsmusters sind. Weitere Faktoren sind sozia-le Unsicherheit und geringe soziale Kompetenz, wenn soziale Fertigkeiten im Kindergarten oder der Schule nicht ausreichend gelernt wurden. Es fehlen Verhaltensmuster und soziale Konzepte, sich in normalen und konflikthaften Situationen erfolgreich zu verhalten, etwa sich durchzusetzen. Fallbeispiel: Angst »Herr F. hat einen wichtigen Termin bei seinem Chef. Er ist nervös, will sich nicht blamieren. Er achtet besonders auf seinen Herzschlag und darauf, ob er errötet. Er befürchtet, zu versagen und sein Chef werde seine Angst bemerken. Diese Gedanken und Erwartungen machen ihm Angst. Die Angst verstärkt die vegetativen Symptome. Diese Reaktionen führen nun zum sichtbaren Schweißausbruch, und wenn er nun seinem Chef die nasse Hand gibt, scheinen sich alle seine Befürchtungen zu bestätigen, der Teufelskreis schließt sich. Solche Erfahrungen führen zu einem Vermeidungsverhalten, das seinerseits zur Aufrechterhaltung der sozialen Angststörung beiträgt« (zit. nach [16]). Diagnostik Für eine eindeutige Diagnose der sozialen Phobie müssen alle folgenden Kriterien erfüllt sein [32]: 1 Die psychischen, Verhaltens- oder vegetativen Symptome müssen primäre Manifestationen der Angst sein und nicht auf anderen Symptomen wie Wahn oder Zwangsgedanken beruhen. 2 Die Angst muss auf bestimmte soziale Situationen beschränkt sein oder darin überwiegen. 3 Wenn möglich, wird die phobische Situation vermieden. Für die Diagnostik werden verschiedene Checklisten, strukturierte standardisierte Interviews, Verhaltenstests, direkte Beobachtungen und Tagebuchaufzeichnungen eingesetzt (Hinweise hierzu im Anhang). Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung erspart eine lange Leidensgeschichte und zunehmende private und berufliche Beeinträchtigung. Medikamentöse Therapie [130] Antidepressiva (SSRI, SNRI, MAO-Hemmer), besonders bei mittelschweren bis schweren Formen. KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 Benzodiazepine: große Wirkung mit klaren Nachteilen wie Suchtentwicklung, Behinderung von psychotherapeutischem Lernen Betablocker: niedrig dosiert (besonders bei Prüfungsangst) Psychotherapie sowohl als Einzel- als auch als Gruppentherapie. In der Verhaltenstherapie Exposition in realen angstbesetzten Situationen en als e intenseiner ebettet. realen ucht siNähe, chädigt Übergrifod. SolVerarn übernd psy- Bewusstes Überprüfen der Reaktionen anderer Menschen Korrektur bisheriger kognitiver Schemata Erlernen, Situationen erfolgreich zu bewältigen Bei leichten Formen Psychotherapie, bei schweren Formen Psychotherapie in Kombination mit Medikamenten, insbesondere, wenn eine Depression als Komorbidität vorliegt [16]. Risikofaktoren und ihre psychosomatischen Ursachen Traumatische Kindheitserlebnisse In Folge traumatischer Kindheitserlebnisse können re psychosomatischen Ursachen können eigene ann ein Alkohoerhalten erhalten r unbenischer nungen Seite 37 beim Patienten Selbstwahrnehmung und eigene Gefühlsverarbeitung gestört werden. Dies kann ein Ì Traumatische Kindheitserlebnisse Auslöser für Risikoverhalten wie Rauchen, Alkoholismus, Drogenabusus, abnormes Essverhalten oder Promiskuität sein. Dieses Risikoverhalten kann verstanden werden als bewusste oder unbewusste Strategie zur Bewältigung chronischer Stresszustände mit körperlichen Spannungen [135]. Wie lässt sich das erklären? Die Bindungstheorie sieht den Menschen als Sozialwesen; als »Tragling« ist er durch eine intensive Mutter-Kind-Beziehung von Beginn seiner Existenz an wurde in eine festgestellt, soziale Beziehung eingebettet. In Studien dass bei »beschäSein weiteres Leben wird bestimmt vom realen digten Kindern«, auch auf Grund ihrer Lebensfrühkindlichen Beziehungserleben. Er braucht siweise, im weiteren Lebensverlauf Krankheit und chere, bergende, liebevolle Atmosphäre, Nähe, früher Tod signifikant häufiger auftreten. Die KorTreue, Loyalität, Urvertrauen. Er wird beschädigt relation zwischen aktuellem Lebensstil und Gedurch Verunsicherungen, Aggressionen, Übergrifsundheitsverhalten mit Morbidität und Mortalität ist in Studien belegt [43, 79, 119]. Maladaptives Verhalten-/ Reaktionsmuster Rauchen Essstörung Alkoholmissbrauch Depressive Reaktion Promiskuität Chronische, lebensverkürzende Erkrankungen chron. Lungenerkrankungen, Arteriosklerose, Karzinome, KHK Anorexie: Kachexie Adipositas: Hypertonie, Diabetes, KHK Leberschäden, zerebrale Schäden, soziale Folgen Suizid, Diabetes, KHK HIV-Infektion, Leberschäden Eine 1995 bis 1996 konsekutiv durchgeführte Untersuchung zu schädlichen Kindheitserlebnissen fe, Demütigungen, Beziehungsabbrüche, Tod. Solche Erfahrungen in einem Maß, das die Verarbeitungskompetenz des Kindes / Menschen überschreitet, führen häufig zu psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Maladaptives Verhalten oder maladaptive Reaktionsmuster können zu chronisch-letalen Erkrankungen im Erwachsenenalter führen. Dauerhafter Nikotinabusus als Mittel zur Affekt- und Stimmungsregulation kann z. B. Ursache von chronischen Gefäß- und Lungenerkrankungen und vorzeitigem Tod werden [135]. In Studien wurde festgestellt, dass bei »beschädigten Kindern«, auch auf Grund ihrer Lebensweise, im weiteren Lebensverlauf Krankheit und früher Tod signifikant häufiger auftreten. Die Korrelation zwischen aktuellem Lebensstil und Gesundheitsverhalten mit Morbidität und Mortalität ist in Studien belegt [43, 79, 119]. (Siehe Tabelle auf dieser Seite.) Eine 1995 bis 1996 konsekutiv durchgeführte Untersuchung zu schädlichen Kindheitserlebnissen und ungünstiger Haushalt- bzw Familiensituation (The Adverse Childhood Experiences, ACE Study) zeigte bei 9508 erwachsenen HMO-Mitgliedern der Kaiser Permanente’s San Diego Health Appraisal Clinic, dass rund 50% mindestens eine ACE-Kategorie bejahten. Zur Prävalenz schädlicher Kindheitserlebnisse (in USA) wurden angegeben [43, 135]: Psychische Gewalt 11% Körperliche Gewalt: 11% Sexueller Missbrauch: 22% Im Haushalt der Befragten der ACE-Studie Rehamaßnahmen des Risikoverhaltens erforder Alkohol- oder Drogenmissbrauch: 6% lich werden. 19% Psychiatrische Erkrankung Gewalt gegen die Mutter 13% Seite 38 2 / 2009 Auch im präventiven Bereich kann dieNr. Suche nach eines Familienmitglieds 3% KVH • aktuell Inhaftierung Wenn die Zahlen auch aus USA stammen, ist zeigten Familienmitglieder folgende Zeichen der davon auszugehen, dass es auch in Deutschland familiären Dysfunktion: ähnliche Probleme gibt. Alkoholoder Drogenmissbrauch: 6% Psychiatrische Erkrankung 19% Das sogenannte Risikoverhalten führt zu 13% einer Gewalt gegen die Mutter Vielzahl von häufigen und relevanten Erkran Inhaftierung eines Familienmitglieds 3% kungen. Das Risikoverhalten ist jedoch nur schwer Wenn die Zahlen aus weil den häufig USA stammen, ist therapierbar, nichtauch zuletzt, die psychodavon auszugehen, in Deutschland sozialen Ursachen dass nichtes auch ausreichend berückähnliche Probleme gibt. sichtigt werden. Bio-psycho-soziale Kausalkette [135] psychischen Wurzeln wegweisend werden. So können adäqute psychotherapeutische MaßnahDas so genannte Risikoverhalten führt zu einer Vielmen neben Bewegungstherapie, Ernährungsumzahl von häufigen und relevanten Erkrankungen. stellung, Raucherentwöhnung etc. in die therapierWege geDas Risikoverhalten ist jedoch nur schwer leitet werden, um die Erfolgsquote dieser Maßbar, nicht zuletzt, weil häufig die psychosozialen nahmen nicht zu verbessern. Ursachen ausreichend berücksichtigt werden (siehe Grafik). Betrachtet man die Häufigkeit der schädlichen kindlichen Erlebnisse, so sind diese Zahlen zunächst schwer vorstellbar. Bei der Häufigkeit des Risikoverhaltens in unserer Bevölkerung und der postulierten Mitverursachung durch kindheitliche Erlebnisse erscheinen sie jedoch in einem anderen Licht. Es sollte immer an diese psychosozialen Mitursachen gedacht werden, wenn Therapien bzw. Rehamaßnahmen des Risikoverhaltens erforderlich werden. Auch im präventiven Bereich kann die Suche nach psychischen Wurzeln wegweisend werden. So können adäquate psychotherapeutische Maßnahmen neben Bewegungstherapie, Ernährungsumstellung, Raucherentwöhnung etc. in die Wege geleitet werden, um die Erfolgsquote dieser Maßnahmen zu verbessern. 59 Suchtprobleme Hausärztliche Leitlinie Allgemeines »Psychosomatische Medizin« Drogen beeinflussen den Bewusstseinszustand und die Affektlage in unterschiedlicher Weise, manche Drogen können bei schädlichem Gebrauch Halluzinationen auslösen. Ein vielfältiges Bild neurologischer und psychischer Störungen kann die Diagnostik von unklaren Beschwerden kompliziert machen, insbesondere dann, wenn somatische Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Hochdruck, cerebrovaskuläre oder kardiale Krankheitsbilder, Infektionen, Traumen oder Hirnerkrankungen gleichzeitig vorliegen. Typischerweise fallen solche Patienten in der Hausarztpraxis zunächst nicht wegen ihrer Sucht auf, weil der ihnen selbst in der Regel bekannte Version 1.01 I 29. April 2008 schädliche Gebrauch vor der Umwelt verheimlicht wird. Erst, wenn Zwischenfälle mit unerklärlichen Traumen oder psychosoziale Probleme (Arbeitsplatzverlust, familiäre Konflikte, Unfallhäufigkeit, körperliche Folgeerscheinungen, Verhaltensstörungen mit betont forderndem Verhalten, Schlafstörungen mit etlichen unerklärlichen körperlichen Symptomen, besonders nicht anders erklärbare Schmerzphänomene) sich häufen, ist es an der Zeit, hellhörig zu sein und gezielt nach schädlichem Gebrauch und Abhängigkeiten von Substanzen (Alkohol, Nikotin, Koffein, Tabletten, Drogen) zu fahnden. Genussmittel Um die vielfältigen körperlichen Symptome bei schädlichem Alkoholgebrauch rechtzeitig zu erkennen, ist es sinnvoll, neben der Eigen- und Fremd-anamnese und den einschlägigen medizinischen Untersuchungen wie klinischer Status und Labor-untersuchungen mittels eines »strukturierten Interviews« (z. B. CAGE-Test, AUDIT, s. u.) den Betroffenen zu befragen. Sinnvolle Laboruntersuchungen sind u.a. Gamma-GT (bei 70-90% der Alkoholkranken erhöht – bei jüngeren Patienten herabgesetzte Sensivität), Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell Kleines Blutbild mit MCV (erhöht bei 50-90% der Alkoholkranken), ggf. CDT (Carbohydrate deficient transferrin – hohe Sensivität zur Erkennung einer Alkoholkrankheit, nicht geeignet zur Früherkennung von erhöhtem Alkoholgebrauch – nicht als Kassenleistung anerkannt). Ein sehr einfacher Test ist der CAGE-Test [41] mit seinen 4 Fragen: Hatten Sie schon das Gefühl, dass Sie Ihren Alkoholkonsum reduzieren sollten? (Cut down drinking) Hat es Sie schon aufgeregt, wenn andere Leute Ihr Trinkverhalten kritisieren? (Annoyance) Hatten Sie wegen Ihres Alkoholkonsums Gewissensbisse? (Guilty) Haben Sie morgens nach dem Erwachen schon als erstes Alkohol getrunken, um Ihre Nerven zu beruhigen oder den Kater loszuwerden? (Eye opener) Interpretation: Mindestens zwei positive Antworten bezeugen das wahrscheinliche Vorhandensein von Problemen, die im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum stehen. Die Wahrscheinlichkeit eines Alkoholmissbrauchs beträgt 62% bei einer positiven Antwort und 89% bei zwei positiven Antworten. Bei drei und vier positiven Antworten beträgt die Wahrscheinlichkeit des Bestehens einer Alkohol-Abhängigkeit 99%. Semistrukturierte Interviews können die Problematik einer Alkoholabhängigkeit detaillierter aufdecken wie z. B. der AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) mit 10 Fragen [126]. Definition der Alkoholkrankheit Die Alkoholkrankheit (ICD-10: F10.- Psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol) ist eine progressive Suchterkrankung, in deren Verlauf der Suchtmittelkonsum zum lebensbestimmenden Inhalt werden kann. Sie betrifft in Deutschland ebenso wie in vielen anderen Industrienationen mehr als 5% aller Bürger. Erkrankt sind zu etwa 70% Männer. Die Übergänge der verschiedenen Entwicklungsstufen sind dabei fließend. Typische Symptome sind: Konsumzwang, fortschreitender Kontrollverlust, Vernachlässigung früherer Interessen zugunsten des Trinkens, Leugnen des Suchtverhaltens, Entzugserscheinungen bei Konsumreduktion, Toleranzentwicklung (so genannte »Trinkfestigkeit«), es kommt dabei zu Persönlichkeitsveränderungen. Seite 39 Wichtig Problem offen ansprechen, der Betroffene muss sich zu seinem schädlichen Alkoholgebrauch bekennen. Nach einer stationären Entgiftung konsequent ambulant weiterbehandeln mit psychosozialer Betreuung (z. B. regelmäßige ärztliche Weiterbetreuung, regelmäßiger Kontakt zu psychosozialen Diensten, zu Abstinenzler-Gruppen), ihn nicht sich selbst überlassen. Das meist durch den Alkoholgebrauch beschädigte soziale Netz (Arbeitsplatzprobleme, Familien- und Partnerprobleme) mit Hilfe eines suchttherapeutischen und verhaltenstherapeutischen Ansatzes tragfähig machen. Oft ist der Hausarzt als alleiniger Ansprechpartner überfordert. Er sollte nach Offenlegung einer Alkoholabhängigkeit sehr konsequent ein abstinenzorientiertes Verhalten anstreben. Auch kleine Alkoholmengen (in Pralinen, in Soßen usw.) sollten vermieden werden. »Kontrolliertes Trinken« ist eine lllusion und führt nicht aus der Abhängigkeit. Der Patient verlangt oft mit vielen Tricks, dass der Arzt Ausnahmen vom strengen Abstinenzkonzept toleriert oder auch, dass der Arzt das Thema bagatellisiert und nicht ernst nimmt, was dem Patienten die Konfrontation mit dem eigenen Fehlverhalten erspart. Somit wird die Abhängigkeit aufrechterhalten, der Arzt wird – wie oft auch die Familie, die Arbeitskollegen – zum »Ko-Alkoholiker«, der das dauerhafte Fehlverhalten weiter ermöglicht. Cave: Der Arzt darf sich nicht zum Komplizen des Suchtkranken machen lassen! Leichtere Formen schädlichen Alkoholkonsums können durchaus im ärztlichen Gespräch anlässlich geklagter Beschwerden mit Erfolg bearbeitet werden. Wichtig ist dabei eine vertrauensvolle Beziehung zum Hausarzt, die es zulässt, dass dem Betroffenen schonungslos und mit aller Konsequenz die Entwicklung seiner körperlichen Abhängigkeit vermittelt wird und dass die notwendigen, meist unbeliebten Maßnahmen der vollständigen Abstinenz, der stationären Entgiftung und der anschliessenden Vermittlung an eine Suchthilfeeinrichtung zur psychosozialen Nachbetreuung, ggf. auch an eine Abstinenzler-Gruppe dann vom Arzt veranlasst werden. Materialien zur Alkoholkrankheit Unter http://www.alkohol-leitlinie.de befinden sich Materialien (z. B. Versorgungsleitlinie, Fortbildung) zum Thema alkoholbezogene Störungen. http://www.bzga.de (Bundeszentrale für Seite 40 KVH • aktuell Nr. 2 / 2009 gesundheitliche Aufklärung, BZgA, Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln, Tel 0221-8992-0, Fax 02218992-300), http://www.dhs.de (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Westenwall 4, 59065 Hamm), weitere Adressen unter www.alkoholratgeber.de/ Alkoholismus-Hilfs-Adressen. Ursache ist ein mangelndes Selbstwertgefühl des Betroffenen. Dies führt zum wiederholten Risikoverhalten aus ständigem ungestillten Hunger nach Anerkennung und Macht. Es bedarf Ich-stärkender Tätigkeiten z. B. Verantwortung für eine kleine Gruppe übernehmen, die mit sozialer Anerkennung verbunden sind, um zu gesunden. Alltägliches Risikoverhalten Neben den »Genussmitteln« gibt es noch weitere nicht minder riskante Verhaltensweisen. Gesucht werden »Gipfel-Erlebnisse« (peak-experiences – Maslow) z. B. Autorasen, Klettern ohne Seil. Sie tragen für denjenigen, der sie erlebt, ihren Sinn in sich selbst. Nikotinsucht, Kaffeemissbrauch Nikotinsucht (ICD10 F17,-) ist trotz aller Aufklärungskampagnen besonders bei jungen Frauen und Heranwachsenden ein erhebliches Gesundheitsproblem, das durchaus psychosomatische Probleme auslösen kann. Wie auch beim übermäßigen Koffeingenuss können Unruhe, Ängste und Herz-Kreislaufprobleme Krankheitssymptome auslösen, deren wahre Genese im suchtmäßigen Tabak-Gebrauch oder übermäßigem Kaffeegenuss liegen. Bei Jugendlichen dient riskantes Gesundheitsverhalten vor allem zur Lösung von Entwicklungsaufgaben (z. B. durch Zugang zur Peer-Group) und zum Stressabbau. Bei den meisten Jugendlichen nimmt diese Verhaltensweise mit dem Erwachsenwerden ab. Präventionsmaßnahmen setzen auf Förderung des Selbstvertrauens und der Gestaltung von sozialen Kontakten. Eine kleinere Gruppe von Jugendlichen, die oftmals bereits in der Kindheit Auffälligkeiten zeigte, weist jedoch auch als Erwachsene ein riskantes Gesundheitsverhalten auf, das hier als Ausdruck einer gestörten Persönlichkeitsentwicklung gesehen werden kann. Hier sind therapeutische Maßnahmen notwendig [102.] Extremsport kann als »moderner Initiationsritus der Jugend«, aber auch Vergewisserungsritual verunsicherter Erwachsener interpretiert werden. Hausärztliche Kurzinterventionen sind hilfreich [57] intensive ärztliche Beratungen verdoppeln die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Tabakabstinenz nach 1 Jahr Nikotinersatzprodukte und Antidepressiva erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Tabakabstinenz nach einem Jahr Materialien »Ja – ich werde rauchfrei« Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Ostmerheimerstr. 20, 51109 Köln, Tel. 0221-89920; [email protected], Rauchertelefon der Deutschen Krebshilfe 06221424200 montags bis freitags 14.00 bis 18.00 Uhr Tablettenabhängigkeit Die allgemeine Pillengläubigkeit führt dazu, dass der Patient eine große Zahl an frei verkäuflichen Medikamente und Substanzen, die Gesundheit versprechen, einnimmt und der Arzt zu viele Medikamente verschreibt. (low-dose-dependency), diese kann eine regelmäßige abendliche Entzugs-Unruhe und emotionale sowie kognitive Persönlichkeitsveränderungen mit Gedächtnisstörungen nach sich ziehen. Mögliche Hinweise für Hausarzt bzw. Nachfragen: Vermehrte Stürze, gehäufte oder unklare Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle und ungewöhnliche kognitive Fehlleistungen, »unerklärliche« Allgemeinbeschwerden, Verhaltensstörungen bis hin zu Depersonalisierungserscheinungen (besonders bei Benzodiazepingebrauch). Größere und häufigere Rezeptwünsche nach Benzodiazepinen (Abhängigkeit in Deutschland: ca. 5%, entsprechend 4. Mill.). Cave: Vorliegen einer Niedrigdosisabhängigkeit Frauen neigen vermehrt zu Tablettenmissbrauch, da die gewünschte psychische Veränderung durch Tabletten ihnen selbst offenbar unauffälliger erscheint, als beispielsweise eine Alkoholfahne am Arbeitsplatz. Bei fortgeschrittenem Suchtverhalten sinkt allerdings die Hemmschwelle und es beginnt oft eine polytoxikomane Phase von sich addierenden Wirkungen von Alkohol und Psychopharmaka, die oftmals schwer herauszufinden ist und auch Nr. 2 / 2009 KVH • aktuell nicht leicht zu therapieren ist. Der Hausarzt hat hier die Aufgabe, den Verlauf zu erkennen und einzuschreiten mit dem Versuch, die eigentliche Ursache für den Missbrauch aufzudecken. Auch hierbei kommt er mitunter um eine stationäre Entgiftung mit anschließender Rückfallprophylaxe nicht herum. Die Zahl der von suchtkranken Patienten gewünschten Medikamente ist groß: Opiate, Kodein (z. B. in Mischpräparaten, in Hustensäften, wird zu Morphin verstoffwechselt), Psychostimulantien (Methylphenidat, Amphetamin), Analgetika, Benzodiazepine (bevorzugt werden solche mit raschem Wirkungseintritt: z. B. Lorazepam, Alprazolam, Midazolam, Temazepam, oder mit langer Wirkdauer wie Diazepam, Nitrazepam, Flunitrazepam), Medikamente, die in Verbindung mit Alkohol zu einer Intoxikation führen: z. B. atropinartige Medikamente wie Biperiden, Anticholinergika, Barbiturate, Antihistaminika (z. B. Diphenhydramin, Promethazin), Appetithemmer mit stimulierenden Effekten, alkoholhaltige Zubereitungen. Benzodiazepine sollten möglichst nur kurzfristig (3 - 5 Tage) und in geringer Dosierung verordnet werden. Das Behandlungsziel (z. B. Überbrückung einer akuten reaktiven psychischen Erregungsphase) sollte mit dem Patienten klar abgesprochen werden. Es sollten Präparate mit mittlerer Wirkdauer ohne aktive Metaboliten (weil diese wiederum hypnotisch wirken können) verordnet werden wie beispielsweise Oxazepam, Lormetazepam, Temazepam. Die Bezodiazepin-Agonisten Zoleplan, Zolpidem, Zopiclon (so genannte »Z-Drugs«) haben keinen Vorteil gegenüber den klassischen Benzodiazepinen und können auch zur Abhängigkeit führen. Therapie bei Einnahme psychotroper Stoffe Therapeutisch kann bei jeder stofflichen Abhängigkeit nur ein schrittweises und ehrliches Abstinenzprogramm helfen. Dieses ist bei Konsumenten harter Drogen (Heroin, Kokain, Crack, Ecstasy, synthetische Drogen u. a.) und bei Polytoxikomanie (u. a. kombiniert mit Benzodiazepinen, Alkohol) in Seite 41 einer speziellen suchttherapeutisch ausgerichteten Praxis oder Einrichtung anzustreben. Nach Klärung der individuellen Suchtbedürfnisse und der psychosozialen Ursachen muss der Patient offen über seine Suchtkarriere und über seine Prognose aufgeklärt werden. Der Patient sollte gefragt werden, wie er weiter leben will. Es muss ein vertrauensvolles therapeutisches Bündnis mit dem Patienten geschlossen werden mit der Zusicherung, dass er beim anstehenden Entzug nicht alleine gelassen wird. In der Regel stationäre Entzugsbehandlung (so genannte »Entgiftung«). Danach (oft monatelange) psychosoziale Therapie mit Rehabilitationsmaßnahmen zur Festigung der Abstinenz (bei schweren Verläufen und bei Abhängigkeit von harten Drogen mehrmonatig stationär), anschließende jahrelange ambulante nachgehende psychosoziale und medizinische Nachbetreuung. Keinesfalls darf ein inzwischen abstinenter Patient aus anderen therapeutischen Gründen später ein suchterzeugendes Medikament (auch anderer chemischer Art, z. B. Benzodiazepine beim Alkoholiker) erhalten (z. B. alkoholische Lösungen beim Alkoholiker, kodeinhaltige Stoffe beim BtM-Süchtigen). Der Rückfall wäre programmiert. Der Arzt muss jederzeit mit einem Rückfall rechnen und darauf vorbereitet sein, dass sofort eine erneute Therapie notwendig werden kann. Der Arzt/Therapeut sollte sich im Klaren darüber sein, dass in den meisten Fällen Lügen und Täuschen zur Symptomatik von Abhängigkeit gehören und diese Verhaltensweisen nicht gegen ihn als Person gerichtet interpretieren. Bei Drogenenabhängigen treten verschiedene Probleme auf: Sie sind meist in schlechter körperlicher Verfassung oft mit Unterernährung, sehr häufig infiziert mit chronischer Hepatitis C und B, erkrankt an chronischen Krankheiten und Infektionen, (HIV-Infektionen, sekundären chron. Erkrankungen, Mykosen, Tuberkulose), betroffen von einer psychiatrischen Komorbidität, oft schon vom Kindesalter her, ohne jedes Selbstvertrauen, da Versprechen von ihnen niemals eingehalten werden können aufgrund der Sucht. Sie treten aber oft aggressiv fordernd auf, ohne feste soziale Bindungen, bis auf Gruppenbindung mit anderen Suchtkranken, minder qualifizierte Arbeitslose, da ein Seite 42 KVH • aktuell Suchtkranker nur in Ausnahmefällen eine über mehrere Stunden täglich gehende Arbeit ausführen kann, ohne Wohnung und feste Bezugspersonen. Medikamente zur Suchtbehandlung: Acamprostat (Campral®) zur Aufrechterhaltung der Abstinenz, Nr. 2 / 2009 Naltrexon (Nemexin®) zur Unterstützung der Therapie bei vormals Opiatabhängigen, Vareniclin (Champix®) und Bupropion (Zyban®) zur Raucherentwöhnung. Eher geringe Wirkung und teilweise problematische Nebenwirkungen lassen von der Einnahme abraten (ati 2007;38:25-7, 2004;35:33; 2000;31:14; 1996;11:114). Fehler und Gefahren im Umgang mit Suchtkranken Aus diesen Gründen muss bei diesen Drogenkranken mit den unterschiedlichsten psychosomatischen Fehlentwicklungen gerechnet werden. Helfen kann der Arzt dabei nur dann, wenn er primär – so fremd das auch klingen mag – ein beiderseitiges Vertrauen und eine gegenseitige menschliche Respektsphäre über einen längeren Zeitraum (manchmal über Jahre hinweg) aufbaut. Das geht im Besonderen dann, wenn dieser Arzt den Betroffenen in einem Methadonprogramm betreut und ihn somit einerseits streng nach festen Spielregeln überwacht und andererseits zur Hilfe und Empathie bereit ist, die sich in genügender Zeit für Untersuchungen und kritischen therapeutischen Gesprächen mit den Patienten ausdrücken kann. Folgendes gilt es zu vermeiden Verwechslung einer Suchtkrankheit mit einer Psychosomatose (z. B. »Montagskrankheiten« eines Alkoholikers mit psychosomatischen Beschwerden und Ängsten vor der Arbeit) – Abklärung durch CAGE-Test möglich (s. o.). Der Arzt (die Arzthelferin, Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen) dürfen nicht zum Komplizen (Ko-Alkoholiker) des Betroffenen werden (durch Vertuschen von Rückfällen, Solidarität der Umgebung bei Fehlleistungen des Suchtkranken, schützen des Suchtkranken vor Bloßstellung oder negativen Konsequenzen). Vermeiden von länger dauernden Medikationen mit Sedativa – besonders zu vermeiden sind Benzodiazepine bei Älteren (hierbei möglichst unter 1 Woche Therapiedauer bleiben und die Dosis halbieren, z. B. 5 mg Oxazepam/Nacht). Der Arzt darf sich nicht instrumentieren lassen zu falscher Komplizenschaft mit dem Suchtkranken. Er sollte, solange der Patient keine Anstrengungen unternimmt, seine Sucht zu bekämpfen, z. B. keine Wunschatteste für nicht gerechtfertigte Vorteile zur Beibehaltung der Sucht ausstellen, wie Arbeitsunfähigkeitsatteste, Freistellungsatteste usw. Auch ein falsch verstandenes Helfersyndrom des Arztes oder der Umgebung des Suchtkranken werden rasch von diesem ausgenützt und führen zum gegenteiligen Erfolg: die Sucht wird weiter gepflegt. Der Hausarzt sollte sich kenntnisreich über die psychischen und körperlichen Mechanismen der Sucht (»Schuld haben immer die Anderen, die Umstände usw.«) informieren und mit den suchtmachenden Medikamenten zurückhaltend und verantwortungsvoll umgehen. Obsolet: Flunitrazepam Es sollte ein verantwortungsvoller Arzt seine Grenzen kennen und auch das therapeutische Konzept eines suchtmedizinischen Kollegen auch dann nicht unterlaufen, wenn er den Fall nicht näher kennt (z. B. wenn ein lange bekannter Patient, dessen Sucht nur dem Suchtmediziner bekannt ist, um »seine Benzodiazepine« bittet). Auch Ärzte müssen von ihrem omnipotenten Therapieanspruch abrücken können, beispielsweise durch Weiter- und/oder Mitbehandlung durch psychosoziale Zentren (Drogenzentren, Psychotherapeuten). Die kompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Spezialisten ist gerade in der Suchtmedizin unerlässlich. Fortsetzung im nächsten Heft: Die therapeutischen Aspekte bei psychosomatischen Erkrankungen. Tischversion KVH • aktuell Seite 3 Palliativversorgung Informationsblatt für Angehörige Was tun, wenn die Medikamente nicht mehr geschluckt werden können? Diese Situation sollten Sie mit dem Hausarzt besprechen. Meist kann auf einen Teil der Medikamente verzichtet werden. Soll der Raum eher hell ausgeleuchtet oder abgedunkelt gehalten werden? Die Bedürfnisse des Patienten sind ausschlaggebend. Der Wunsch des Patienten nach »mehr Licht« kann Ausdruck für Angst sein. Kann der Patient verdursten? Fragen Sie den Patienten, ob er Durst hat. Falls ja, bieten Sie ihm Flüssigkeit an. Ist er nicht mehr in der Lage zu schlucken, sollte das Austrocknen des Mundes verhindert werden. Tragen Sie z. B. mit einem Wattetupfer Butter oder Sahne, auf Wunsch des Patienten auch Kaffee, Bier oder andere Getränke auf die Mundschleimhaut auf. Auch Eisstückchen können gelutscht werden (z. B. gefrorene Säfte, Fruchtstücke wie Ananas). Lippen eincremen nicht vergessen! Dürfen die Fenster oder Türen geöffnet sein? Das Öffnen von Fenstern oder Türen oder der Einsatz eines Ventilators wird von Patienten oftmals als angenehm empfunden. Verhungert der Patient? Für einen Sterbenden ist die Nahrungsaufnahme unbedeutend, er leidet nicht unter Hungergefühl. Woher kommt das Röcheln, was muss getan werden? Oft sammelt sich in der Sterbephase Sekret am Kehlkopf oder in den oberen Atemwegen. Durch das Atmen kommt es zu Schwingungen des Sekretes und damit zum »Röcheln«. Oftmals ist es für Sie als Angehörige schwierig, diese Geräusche auszuhalten. Erstickungsgefahr droht nicht. Ein Absaugen ist in der Regel nicht notwendig und nicht erfolgreich. Es ist für den Patienten belastender als das Röcheln selbst. Aktionismus durch Medikamentengabe (Schleimlöser) sind zu vermeiden, da sie dem Patienten keine Linderung bringen. Lagerungsversuche sind meist nicht hilfreich. Was hilft bei Unruhe des Patienten? Halten Sie die Hand des Sterbenden und sprechen Sie beruhigend auf ihn ein. Vielleicht möchte er noch Dinge besprechen oder regeln. Versuchen Sie herauszufinden, ob Schmerzen oder Angst bestehen. Falls ja, Bedarfsmedikation anwenden. Beim Diabetiker: Wie häufig soll der Blutdruck oder Blutzucker gemessen und wie die blutzuckersenkende Medikation angepasst werden? Es macht keinen Sinn, bei Sterbenden eine Blutdruckoder Blutzuckermessung durchzuführen mit dem Ziel, Blutdruck und Blutzucker optimal einzustellen. Medikamente oder Insulingaben können häufig reduziert oder sogar abgesetzt werden. Wie umfassend muss die Pflege/das Windelwechseln/Umbetten eines Sterbenden sein? Leitgedanke sollte sein, den Patienten nicht unnötig zu belasten. Deswegen sollte man den Wunsch des Patienten respektieren und die Körperpflege nicht erzwingen, sondern auf ein angemessenes Maß beschränken. Kann der Patient das Umfeld noch verstehen? Es muss davon ausgegangen werden, dass auch ein anscheinend teilnahmsloser Patient Ereignisse und Gespräche, insbesondere wenn sie sich an den Patienten richten, noch versteht, dass er Berührungen wahrnimmt und sich mit seiner Umwelt beschäftigt. Sprechen Sie möglichst in normaler Lautstärke; beziehen Sie den Patienten in die Gespräche ein, sprechen Sie nicht »über« ihn, spielen Sie ggf. beruhigende Musik, wenn er dies mag. Der sterbende Patient will meistens nicht alleingelassen werden! Geben Sie Zuwendung und Aufmerksamkeit. Korrespondenzadresse Ausführliche Leitlinie im Internet Hausärztliche Leitlinie PMV forschungsgruppe Fax: 0221-478-6766 Email: [email protected] http:\\www.pmvforschungsgruppe.de www.pmvforschungsgruppe.de > publikationen > leitlinien www.leitlinien.de/leitlinienanbieter/deutsch/pdf/ hessenpalliativ »Palliativversorgung« Tischversion: Teil 3 1.0 März 2009 XtraDoc Verlag Dr. Wiedemann, Pfingstbornstr. 38, 65207 Wiesbaden PVSt Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 68689 PH863453V Tischversion Tischversion Epidemiologische Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Herz-Kreislauferkrankungen und hohen Serumcholesterinwerten. Diese bzw. die Höhe Betreuung durch den Hausarzt der HDL- und LDL-Werte stellen jedoch nur einen von Die häusliche Versorgung wird heute in mehreren Risikofaktoren dar.Sterbender Deshalb empfiehlt sich für erster Linie bei vonVorliegen Hausärzten den Hausarzt einerzusammen Dyslipidämiemit die AngehöriEinteilung gen/Bekannten und anhand Pflegediensten geleistet. AlgoDer in eine Risikogruppe von systematischen Hausarzt sollte die in seiner Region bestehenden rythmen oder Scores (NCEP, PROCAM). Somit erfolgt eine Angebote wie Ambulante Hospizdienste (AHD; Abschätzung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse Hospizhelfer) und Ambulanter Palliativpflegedienst (10-Jahresrisiko) und darauf die Festlegung der Behand(APD; hauptamtliche Pflegekräfte, lungsstrategie mit dem speziell Patienten.qualifizierte Für die Risikoeinstufung 24h-Rufbereitschaft) kennen und mit ihnen zusamorientiert sich die Leitliniengruppe Hessen an der folgenden menarbeiten. Ziel (National der palliativmedizinischen BeEinteilung der Ein NCEP Cholesterol Education handlung ist es, die physische, psychische und soziale Program des National Heart, Lung, and Blood Institute, Situation der Patienten so zu erhalten, dass der Sterhttp://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm): bende in der von ihm gewünschten Umgebung verblei1. Hohes Risiko (10-Jahresrisiko über 20%): a) Bestehende ben kann. koronare Herzkrankheit (KHK), b) KHK-Äquivalente, c) Diabetes mellitus, d) 2 oder mehr Risikofaktoren**: Hospiz 2. Mäßig hohes Risiko (10-Jahresrisiko 10-20%): ≥2 RisikoEin Hospiz ist eine Pflegeeinrichtung, in der Schwerstfaktoren* bei errechnetem Risiko**. kranke in Erwartung des absehbaren Lebensendes be3. Moderates Risiko (10-Jahresrisiko < 10%): ≥2 Risikotreut werden. Die Patienten bleiben in der Regel bis aktoren* bei errechnetem Risiko**. zum Lebensende dort. 4. Niedriges Risiko: 0-1 Risikofaktor* *Risikofaktoren: Zigaretten rauchen, Hypertonie, niedriges Palliativstation unter 40mg/dl, familiäre Belastung mit HDL-Cholesterin Ziel ist es,KHK, krankheitsund therapiebedingte Beschwervorzeitiger Alter (Männer über 45 Jahre, Frauen über den, die unter ambulanten Bedingungen nichtScore be55 Jahre); **errechnetes Risiko: Bsp. mit PROCAM herrschbar zu lindern und wenn möglich, die (s. Rückseite) sind, oder elektronischem NCEP-Risikokalkulator Krankheits- Diabetiker und Betreuungssituation Betroffenen Anmerkung: ohne KHK oder der KHK-Äquivalente so zu stabilisieren, dass sie wieder in das häusliche und ohne zusätzliche Risikofaktoren profitieren bei einem LDL<115 mg/dL - laut der jetzigen Studienlage - nicht von Umfeld entlassen werden können. einer Therapie mit einem CSE-Hemmer. Fettstoffwechselstörung Dyslipidämie Palliativversorgung: 3 von diätetischen Empfehlungen fürTeil eine Einhaltung „Herzgesunde Ernährung“ Terminal- und Sterbephase Nur mäßiger Konsum von Alkohol und Vermeidung von Nikotin Terminalphase - Finalphase Die Palliativmedizin unterscheidet zwischen einer Indikationsstellung für eine medikamentöse Therapie Terminalphase, die sich über Wochen bis Monate erUmfassende, unmittelbare medikamentöse Behandlung strecken kann und durchRisiko eine(Gruppe zunehmende Beeinaller Patienten mit hohem 1: 10-Jahresträchtigung des Patienten (z. B. Symptomwechsel) risiko >20%) und Anstreben eines LDL von 100 mg/dl. gekennzeichnet ist, Therapie und derbei FinaloderderSterbephase. Medikamentöse Patienten Gruppe 2 Dieund Sterbephase umfasst die letztenunter Stunden (selten 3 nach individueller Entscheidung Berücksichtigung der Lipidwerte und nach Erprobung lebensstilTage) des Lebens. In jeder Phase ist konsequent Maßnahmen. aufändernder die bestmögliche Schmerztherapie zu achten. Für Patienten der Risikogruppe 4 (0-1 Risikofaktor) sind Mögliche klinische Zeichen: erschwertes Schlucken, lebensstilmodifizierende Maßnahmen im Allgemeinen Störung der Atmung (Cheyne-Stokes-Atmung, ausreichend. »Röcheln«), Arrhythmien, Blutdruckabfall bis zur Puls- Je nach Risikogruppe wird ein LDL von 100 mg/dL (Gruppe losigkeit, Anurie, Atonie von Blase und Darm, Er1), 130 mg/dL (Gruppe 2+3) bzw. 160 mg/dL (Gruppe 4) löschen des Muskeltonus und der Nervenreflexe, Beangestrebt. wusstseinsstörung, zunehmende »Facies hippocra- Arzneimittelauswahl: sollten Wirkstoffe eingesetzt tica«: fahlgraue Haut,Eskalter Schweiß auf der Stirn, werden, für die Endpunktstudien mit günstiger NNT und NNH spitze und blasse kühle Nase, zurückfallendes Kinn. vorliegen (Simvastatin, Pravastatin). Für Simvastatin Die Finalphase ist eine dynamische Situation, (20 in mg der und 40 Symptome mg) und Pravastatin (40und mg)bestehende ist eine Senkung sowohl neue auftreten Symptome der Gesamtmortalität als auch sein der kardiovaskulären verstärkt oder vermindert können. Dies Mortamacht lität belegt. Multimorbidität Multimedikation sollte Alle die häufig eineBei Anpassung der und Medikation notwendig. Indikation für eine medikamentöse lipidsenkende Therapie nicht benötigten Medikamente sollten abgesetzt und besonders streng gestellt werden. Symptome behandelt neu aufgetretene, belastende Merke: werden. Um in der Finalphase Einweisungen ins Bei medikamentöser Therapie: CK kontrollieren! Krankenhaus zu vermeiden, sollte für evtl. hinzu(Rhabdomyolyse möglich!) gezogene Notärzte eine Informationsmappe beim Keine Kombinationstherapie CSE-Hemmer Patienten vorhanden sein (Hinweise zur+ Fibrate/ Indikation, Makrolide/Azol-Antimykotika. Medikation, Arztbrief, Patientenverfügung, Vollmacht, Wechselwirkungen auch mit anderen Medikamenten Telefonnummern, Erreichbarkeit des Arztes). möglich! Therapieschritte nach “International Task Force for Bei et Makrolidtherapie CSE-Hemmer pausieren! Subkutane Medikation in Disease”: der Finalphase (mod. nach Bausewein al., 2005) Prevention of Coronary Heart Statine vor chirurgischen Eingriffen und bei akut auftreMedikament Einzeldosis Indikationen Bemerkungen Basis sind nichtmedikamentöse Maßnahmen, die auf eine tenden schweren Erkrankungen vorübergehend abMorphin1 des Lebensstils 2,5-10 zielen: mg Schmerzen, Luftnot Veränderung setzen! Auf Compliance achten, auf abendliche EinnahScopolamin 0,2-0,4 mg Schmerzen, Rasseln alternativ: Butylscopolamin Erhalten des normalen Körpergewichtes oder me des CSE-Hemmers hinweisen. Gewichtsreduktion 2,5-10 bei Übergewicht Midazolam mg Angst, terminale Agitierts.c. Gabe möglich, aber nicht zugelassen; Evidenzbasierte Patienteninformationen sind unter Steigerung der körperlichen Aktivität heit, Epileptische Anfälle alternativ: Diazepam Trpf. bzw. Supp. www.gesundheitsinformation.de abrufbar. Metoclopramid Haloperidol 1 10 mg 0,5-10 mg Übelkeit, Erbrechen Unruhe, Delirium, Übelkeit s.c. Gabe möglich, aber nicht zugelassen s.c. Gabe möglich, aber nicht zugelassen bei Patienten, die bereits längerfristig mit hohen Opioiddosen behandelt wurden, gegebenenfalls deutlich mehr