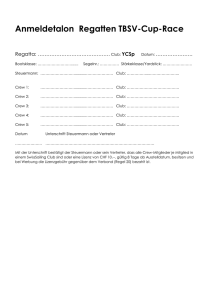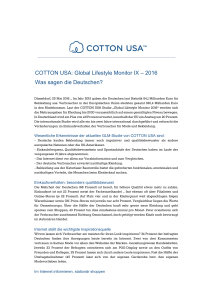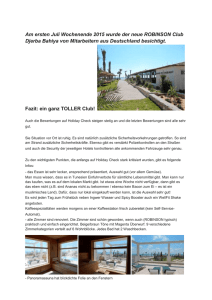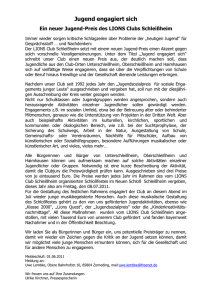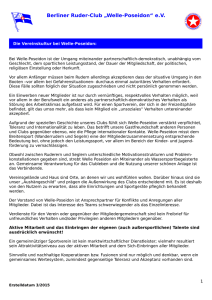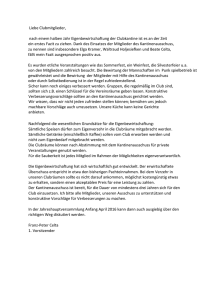Lesen Sie also bitte auch hier
Werbung

Die Qual der Wahl … Als ich gestern irgendwann um Mitternacht meinen virtuellen Schubkasten mit CDTipps für Weihnachten schloss, fiel mir sofort noch eine Reihe von Aufnahmen ein, die ich unbedingt hätte empfehlen sollen. Aufnahmen, die mich in irgendeiner Weise in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren begleitet haben. Zum Beispiel eine 2003 erschienene Dokumentation von Horst J. P. Bergmeier und Rainer E. Lotz über den Harlemer Cotton Club. Horst J. P. Bergmeier & Rainer E. Lotz: Live From The Cotton Club. Hambergen 2003: Bear Family Records (BCD 16340 BK). In den 1920er Jahren wurde New York für viele Jazzmusiker ein neuer Kristallisationspunkt. Weit verbreitet war der Slogan: „Wenn du’s in New York geschafft hast, dann schaffst du es überall.“ In New York gab es mehr Agenturen als in jeder anderen Stadt der USA, die wichtigsten Studios der großen Rundfunk- und Schallplattengesellschaften und zahlreiche Musikverlage, die zahllose Pianisten beschäftigten, um eingehende Musiktitel vorzuspielen. Darüber hinaus wurden saisonbedingt Bands für Tourneen zusammengestellt. Nicht vergessen sei das intensive New Yorker Nachtleben. Allerdings gelang es nur einem Teil der Musiker, die mit großen Hoffnungen in die Metropole geströmt waren, den Durchbruch zu schaffen oder auch nur eine bescheidene Arbeit zu finden. Über New York lässt sich nicht sprechen, ohne Harlem zu erwähnen. Harlem wurde bis etwa 1920 vorwiegend von Weißen bewohnt. Vor allem irische Einwanderer fanden hier einen ersten Wohnsitz. Während und nach dem Ersten Weltkrieg ließen sich allerdings zunehmend Schwarze in Harlem nieder. Sie stammten aus dem ländlichen Süden, wo sie ihre Arbeit verloren hatten. Nun hofften sie in der Millionenstadt auf eine Beschäftigung. Harlem war die einzige Gegend, in der sie sich eine Bleibe leisten konnten. Meist mussten sich mehrere Familien eine Behausung teilen. Innerhalb kurzer Zeit wurde Harlem zum ethnischen Ghetto und aufgrund der extrem schlechten Lebensbedingungen zum Slum. Dies war aber nur die eine Seite, die andere: In Harlem existierten in den 1920er und 1930er Jahren über 125 Vergnügungsstätten, darunter zehn Theater und jede Menge Clubs, Bars und Cafés. Einige wurden geradezu legendär: Connie’s Inn etwa oder – der Cotton Club. Sehr viel Weißes. Der Cotton Club wurde im Herbst 1923 eröffnet und wurde zum Anziehungspunkt für die Reichsten der Welt. Der New Yorker Oberbürgermeister gehörte ebenso dazu wie Öl- und Rinderbarone aus dem Süden, die Neureichen aus dem Norden, adlige Einwanderer aus Europa, Anwälte, Politiker, Größen der Finanzwelt, berühmte Sportler, Stars im Showgeschäft, Schriftsteller, Vertreter der Halbund Unterwelt. Wer in der Gesellschaft Rang und Namen hatte bzw. haben wollte, kam um sich zu zeigen. Manche Millionärshochzeit nahm hier ihren Anfang und nicht nur diese: Duke Ellington und Louis Armstrong lernten im Cotton Club ihre Frauen kennen. Selbstverständlich bekam man dort zur Zeit der Prohibition, des staatlichen Alkoholverbots, guten Whisky – zu entsprechend üppigen Preisen. Duke Ellington erinnert sich in seiner Autobiographie an die Marke „Chicken Cock“, die zur Tarnung in einer versteckt wurde. Als Höhepunkt des Clubbesuches galten die Revuen. Besondere Anziehungskraft fanden Nummern mit exotischem Flair, vor allem über das Leben der Schwarzen in Afrika, so wie es sich die Weißen vorstellten. Alle Klischees, die über die Schwarzen existierten (Schwarze seien primitiv und hemmungslos erotisch, so wie ihre Musik usw.), wurden inszeniert. Das Publikum ergötzte sich daran, spendete begeistert Beifall und steigerte anhand der fragwürdigen Afrika-Stücke seine Phantasievorstellungen. Schwarze hatten als Gäste keinen Zutritt zu dem Club. Sie durften nur als Personal dienen, etwa Kellner, und auf der Bühne stehen und für die Weißen spielen. Unter ihnen waren namhafte Jazzmusiker. Duke Ellington und Cab Callowy hatten mit ihren Orchestern zeitweise feste Engagements. Auch die Sängerin Ethel Waters und Louis Armstrong traten dort auf. Bis 1940 existierte der Club. Schon wieder schreibe ich etwas weißen Text weiß wie Schnee. Die Dokumentation von Horst J. P. Bergmeier und Rainer E. Lotz beruht „auf einer Original-RundfunkReportage, die in der Nacht vom 20. bis 21. April 1931 von einem deutschen Reporter vor Ort live aufgezeichnet wurde“. Mehr als sieben Jahrzehnte schlummerten die Aufnahmen „unerkannt im Archiv, bis sie von Michael Brooks, dem früheren Mitarbeiter von John Hammond entdeckt und identifiziert wurden“ (Zit. nach: http://bear-family.de/tabel1/neuheit/winter2003/bcd16340_d.html, eingesehen: 23.12.2007). Sie vermitteln einen klingenden Eindruck von Künstlern, die bislang auf keiner oder nur wenigen Schallplatten zu hören sind. Außerdem enthalten sie einen Versuch „aus dem Jahre 1929, die Live-Atmosphäre“ des Cotton Clubs „im Studio nachzustellen“. Die zwei CDs werden von einem großzügig illustrierten und ausgestatteten Buch begleitet. Die deutsche Übersetzung des Textes bietet das „bayerische jazzinstitut“ kostenlos zum Herunterladen an unter der Internet-Adresse: http://www.bayernjazz.de/publik/CottonClub/Cotton_Club_ deutsch.pdf. Der Cotton Club übrigens fand zahlreiche Nachahmer, schon ab 1927, und nicht nur in Amerika. So wurde 1929 ein Cotton Club in Paris eröffnet. Der legendäre Club spielt darüber hinaus in zahlreichen Erinnerungen und Biographien eine Rolle, allerdings wird er dort zumeist verklärt. 1984 wurde der Cotton Club sogar zu einem Spielfilm mit Richard Gere, der in mehreren Editionen als DVD angeboten wird. Weiß wie Schnee weiß wie Blut weiß Zu Hilfe! Zu Hilfe! sonst bin ich verloren. MOZART und die Geschwindigkeit Soeben habe ich mich verplaudert. Das geschieht mir häufiger, wenn ich meine, andere müssten unbedingt meine Gedanken teilen. Der längste Gang von einer Etage zur anderen Etage dauerte auf diese einmal anderthalb Stunden. Ich hatte mir einfach Zeit genommen für Treppenplaudereien, anderes interessierte mich in diesem Moment wenig. Die Gespräche und damit verbundene Anregungen waren mir wichtiger. Da kann ich auch gut verstehen, dass Helge Schneider vor einiger Zeit seine Uhr weggegeben hat (haben soll) und er sich ohne sie besser fühlt. „Weg mit aller Trägheit. Jede Minute Deines Lebens wende auf tätiges Vergnügen oder nützliche Verrichtungen … Jeder Augenblick kann zu irgendeinem Nutzen verwandt werden … Versäume niemals eine Minute in Müßiggang und Untätigkeit … Geschwindigkeit ist die Seele der Geschäfte …“ Maximen moderner Unternehmer aus unserer Zeit. Oder? Weit gefehlt. Es handelt sich um Lebensregeln, die Lord Chesterfield 1741/1754 in Briefen an seinen Sohn schrieb. Schon damals – vor mehr als zweihundertfünfzig Jahren – scheinen die Zeiten anzubrechen, in denen das „planetarische Subjekt der Mobilmachung“ entsteht, wie der Philosoph Peter Sloterdijk äußert, „der vor Fitneß zitternde, schmerzgehärtete, neusachliche Hochleistungstyp in seinem dezidierten Einsatz für das sich exaltierende, rüstende, nach vorn werfende (man sagt auch: in die Zukunft blickende) Aktionssystem (ob dieses Betrieb, Klasse, Volk, Nation, Block und Weltstaat heißt, ist gleichgültig)’.“ Die Musik blieb von dieser Entwicklung nicht unberührt. Sie wurde immer schneller gespielt. Bereits Mozart litt unter dem Geschwindigkeitsrausch der modernen Zivilisation. Im Januar 1778 beschwerte er sich über einen Interpreten, der seine Musik lediglich „herabgehudelt“ habe. Das „erste stuck gieng Prestißimo“, klagte er in einem Brief, „das Andante allegro und das Rondo wahrlich Prestißißimo“. Den „Baß spielte er meistens anders als er stund, und bisweilen machte er ganz eine andere Harmonie und auch Melodie“. Dies sei „auch nicht anders möglich, in der geschwindickeit“. Die „Augen können es nicht sehen, und die hände nicht greifen“. Solch „ein Prima vista spiellen, und scheissen“ sei bei ihm „einerley“. Viele Interpreten fühlen sich in ihrer Temposucht auf sicherem Boden, indem sie sich auf überlieferte Metronomzahlen aus der Klassik berufen. Doch schon im 19. Jahrhundert kamen Zweifel an den historischen Tempoangaben in Allegro- und Presto-Sätzen auf. Die Pianistin und Musikwissenschaftlerin Grete Wehmeyer hat sich dieser Problematik, die Musik und Gesellschaft gleichermaßen in den Sog der Wettbewerbsfähigkeit treibt, gewidmet und mehrere Beethoven-Werke, die unsere Hörgewohnheiten grundlegend erschüttern. Sie nimmt sich Zeit. Dabei entdeckt sie Feinheiten, die von Geschwindspielern achtlos übergangen werden. Die Musik wird nicht zum Thriller, der den Atem anhält, sondern zu verletzbaren sensiblen Ausdruckskunst. Nicht zufällig hat Grete Wehmeyer auch über Erik Satie geschrieben. Grete Wehmeyer: Zu Hilfe! Zu Hilfe! sonst bin ich verloren. MOZART und die Geschwindigkeit. Hamburg 1990: Kellner Grete Wehmeyer: prestißimo. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit in der Musik. Reinbek bei Hamburg 1993: Rowohlt Taschenbuch Verlag Beethoven: Sonate op. 53 – Andante favori – Sonate op. 57. Gespielt von Grete Wehmeyer. Tempo giusto Vol. II+III (OSA 11940.42.1-2) Mit Mozart wird man nie fertig. Seine Werke bieten immer wieder Überraschungen und regen zu Interpretationen außerhalb festgefügter Kategorien an. Zu den ganz besonderen CD-Produktionen zählen für mich Aufnahmen mit Bobby McFerrin und Chick Corea (Klavierkonzerte und Song for Amadeus; kann ich mehrmals nacheinander hören und dabei alles andere vergessen. Jedesmal erschließt sich mir Neues, und Mozart klingt so jung) und die Mozart in Egypt (vor allem CD 2). Wiederholt habe ich aus dieser CD mit konventionslosen kulturellen Brückenschlägen zu Vorlesungen und Seminaren vorgespielt. Die Reaktionen waren ähnlich wie auf manche HelgeSchneider-Titel: Die einen meinten, sie müssten sich langsam Sorgen um mich bereiten, die anderen stimmten mir zu: „Der beste Beitrag zum Mozart-Jahr!“ Zu Beginn empfehle ich, CD II Nr. 2 zu hören (einen bekannten Hit aus: Cosi fan tutte) und danach auf Nr. 13 derselben Scheibe vorzustellen: Layla Misriya (Eine kleine Nachtmusik). Gönnen Sie sich den Genuss, sich eine eigene Meinung zu bilden. Vielleicht essen Sie dazu eine Mozart-Gurke, die durch ihre einzigartige Mischung von Gewürzen erlesenster Auswahl Menschen unterschiedlichster Generationen zu verzaubern vermag. Weiß wie Schnee, Schnee. Keine Macht für Niemand Während ich mich in die orientalische Hörweise Mozarts einfühle, fällt mein Blick auf eine CD-Box, die ich mir vor anderthalb Jahren geleistet habe – für eine Veran- staltungsreihe „Grenzgänger“: eine Gesamteinspielung von „TON STEINE SCHERBEN“ (eine David Volksmund Produktion). Weiß ist die Welt weise weniger. Diese Zusammenstellung von mehreren Stunden Musik finde ich keineswegs nur für „Scherben-Fans“ interessant, sondern aufschlussreich für jeden, der Einblicke in die Nachkriegsentwicklung der Musik zu Zeiten des „Kalten Krieges“ erhalten möchte. Ein 72seitiges Begleitbuch liefert Hintergründe, Geschichten, Erinnerungen und jede Menge Bilder. Dazu empfehle ich schon gestern (Schubladen: GehoertesDez2007) kurz erwähnte Biografie über Rio Reiser, 2006 im Wilhelm Heyne Verlag München erschienen. „Als Rio Reiser am 20. August 1996 starb, verstummte eine Legende. Keiner sang mit so viel Überzeugung und Inbrunst gegen die herrschenden Verhältnisse an wie der Frontmann der Polit-Rock-Band Ton Steine Scherben, deren Songs ein Vierteljahrhundert lang als Soundtrack bei Hausbesetzungen dienten. Keiner erzählte in seinen Songs so eindringlich von Sehnsüchten und unglücklicher Liebe wie Rio Reiser, der nach der Auflösung der Band 1985 das Anarcho-Image der Scherben ablegte, eine viel versprechende SoloKarriere startete und unsterbliche Balladen wie ‚Junimond’ und ‚Halt dich an deiner Liebe fest’ sang.“ Mit diesen Worten lädt der Verlag zur Lektüre der „inoffiziellen“ Biographie des „Königs von Deutschland“ ein. Und er verspricht nicht zu viel: Autor Hallow Skai, der den Musiker ein Vierteljahrhundert publizistisch begleitet hat, hat mehr als die erste umfassende Biographie des „Revoluzzers, Rockers und Romantikers“ geschrieben. Das ständige Auf und Ab von Rio Reisers Entwicklung, seine Träume und Enttäuschungen, seine Situation als Schwuler im Musikbusiness, seine umstrittene PDS-Mitgliedschaft, seine Drogenprobleme und vieles mehr fügen sich zu einem bewegenden Bild einer Zeit, in der die Frage nach einem menschenwürdigen Leben keineswegs kleiner geworden ist. Weißer Text der sehr weise ist und vor allem weiße Farbe hat Hollow Skai: Das alles und noch viel mehr. Die inoffizielle Biografie des Königs von Deutschland. München 2006: Wilhelm Heyne Verlag Ton Steine Scherben – Gesamtwerk. David Volksmund Produktion Rio Reiser: Balladen. COL 483716 2 Dazu empfehle ich die DVD DVD etp 4001 5 Ton Steine Scherben. Land in Sicht. Chöre haben einen großen Teil meines Lebens bestimmt. Viele Jahre habe ich begeistert in Chören gesungen und manchmal auch erprobt, was es heißt, diesen hochverletzbaren Organismus zu leiten. Die Erlebnisse, die damit verbunden sind, möchte ich nicht missen. Schon vor etlichen Jahren fiel mir eine CD-Box in die Hände, die ich immer wieder empfehle, weil ich bislang nichts Vergleichbares entdeckt habe: Chöre der Welt. Stimmen! Stimmen! Der riesige Ruf heißt sie. Viele daran ist außergewöhnlich: die nicht alltägliche, magisch anziehende Gestaltung, der so persönlich geschriebene Begleittext und natürlich die Auswahl von Vokalmusik unterschiedlichster Kulturen und Jahrhunderte. Zwei Zitate von Joachim Ernst Berendt, dem Jazz-Experten, der die Titel ausgewählt und die Stücke so gefühlvoll kommentiert hat, möchte ich voranstellen: „Chöre widersetzen sich der Vereinzelung und Entfremdung. Sie halten nichts von der Einsamkeit – ja, selbst wenn sie sie besingen […] heben sie sie auf. Sie trösten den Einsamen: Du bist nicht allein. Wir teilen deinen Schmerz. Chöre, auch traurige sind trostreich. Sie sagen: Ja!“ „Chöre sind ein Gesellschaftsentwurf. Deshalb faszinieren sie. Sie realisieren, wonach Menschen seit Jahrtausenden suchen: die ideale menschliche Gemeinschaft – eine ‚Mini-Gesellschaft’ im Dienste der Harmonie – jedes Mitglied hörbar mit eigener Stimme durchaus auch der Disharmonie begegnend, nicht vor ihr zurückschreckend, sie artikulierend und in Harmonie verwandelnd, auf ihr bestehend – eine Gesellschaft, die vielfältig in Gruppen und Untergruppen gegliedert ist – vier-, sechs-, achtund noch mehr-stimmig […]. Wenn das Wort ‚Politik’ Sinn macht, dann ist dies auch ein politischer Entwurf. Daran zu erinnern in einer Zeit, in der die Mächtigen und Reichen der Welt die Solidarität der Menschen unserer Länder aufgekündigt haben, ist wichtig.“ Neben dem Om tibetischer Mönche und chassidischen Weisen, für Chor gesetzt, bietet eine der drei CDs einen Ausschnitt aus einem Gospel-Gottesdienst mit dem bekannten Reverend Samuel Kelsey (1906–1993) und seiner Gemeinde der Washingtoner Temple Church of God and Christ. Das ist keine liturgische Musik, die gebietet: Du darfst nicht. Das ist Musik, die ermuntert: Du darfst. Im wahrsten Sinne des Wortes findet Kommunikation statt, spontan reagierend, leidenschaftlich. Singen wird zugleich zur Körpersprache. Weiße Schrift gefällt mir immer wieder, denn sie ist weiß und oft weise. Ganz andere Ausdrucksweisen prägt György Ligetis Lux aeterna. Dem Titel folgend – ewiges Licht – entwickelt sich ein unendlicher Klangstrom, bestehend aus dicht strukturierten kanonischen Partien und „stationären“ Klängen. Ligeti vergleicht den musikalischen Prozesse mit einem „Bühnenbild, das zunächst deutlich zu sehen ist, in allen seinen Einzelheiten; dann steigt Nebel auf und die Konturen des Bildes verschwimmen, bis schließlich das Bild selbst unsichtbar geworden ist; darnach verflüchtigt sich der Nebel, es tauchen zuerst nur andeutungsweise neue Konturen auf, bis dann, mit dem völligen Verschwinden des Nebels, ein neues Bild sichtbar wird“. (Mir gefällt das Bild Ligetis: Endlich einmal ein Komponist, der seine Ideen plastisch vermitteln kann, ohne seine Gedanken in einen intellektuellen Elfenbeinturm einzusperren, zu dem nur wenigen Menschen ein Schlüssel zugestanden wird). Idealere Interpreten als den Rundfunkchor Stockholm unter Leitung von Eric Ericson lassen sich kaum vorstellen. Und dann die beiden Obertonchöre. Weiß sind alle meine Kleider, weiß ei gewiss. Überhaupt spielen Obertöne auf den CDs eine große Rolle. – Bei einigen Titel habe ich eine geteilte Meinung, so bei dem Ketjak, der wohl eher für Touristen gedacht ist, als dass er etwas über kulturelle Identitäten verrät. Aber dann erlebe ich auf den drei CDs wieder Aufnahmen, die ich immer wieder auflege. Dazu zählen die Produktionen des Frauenchores der Musikschule Gori (Georgien): ein klanglich so facettenreicher Chor!!! Unbeschreibbar. Zum einen singt er Veljo Tormis’ farbintensive Choralminiatur und ein folkloristisch inspirierter Chor von Otar Taktakishvili, bei dem die Damen – ganz dem Titel folgend – Das Blaue vom Himmel singen. Wieder nur weiß, wenn das einer lesen täte. Und dann Gesänge wie das Erntelied des Joza Vlahovic Chorus Zagreb und das Stück Umgebung von Jón Nordal, welches vermittelt, dass auch im Zeitalter wachsender Globalisierung Komponieren nicht von Lebensräumen zu trennen ist: Musik wird durch soziale Bindungen geprägt. Sie hängt ab von ethnischen Traditionen, menschlichen Mentalitäten, landschaftlichen Farben, klimatischen Voraussetzungen und der Sprache der Menschen. Und auch Tiere haben Stimmen, die Komponisten anregen. Die Wale zum Beispiel. Chöre der Welt. Stimmen! Stimmen! Der riesige Ruf. Hrsg. und kommentiert von Joachim-Ernst Berendt. Jaro Medien GmbH (JARO 4217/18/19) Veljo Tormis’ Choralminiatur hat mich so berührt, dass ich mir eine gesamte CD mit Werken des Komponisten besorgt habe: Diese CD enthält einen vierseitigen Einführungstext über Leben und Werk dieses 1930 geborenen estnischen Komponisten. Über zweihundert Chorwerke für unterschiedlichste Besetzungen und Schwierigkeitsgrade hat er geschaffen. Darüber hinaus umfasst sein Werkverzeichnis auch Kammer-, Schauspiel- und Filmmusik, eine Oper und viele Instrumentalstücke. Bis zur Zeit der Perestroika war Tormis zwar in Estland, dann in der gesamten Sowjetunion und in Osteuropa bekannt. „Die übrige Welt wusste allerdings nicht viel von seiner Existenz“, schreibt Mimi S. Daitz 1995. „Heutzutage werden seine Werke von den besten professionellen Chören Westeuropas, ja bis nach Nordamerika und Japan aufgeführt.“ An dieser Stelle wäre auch ein Hinweis angebracht auf die CD-Reihe Baltic Voices – eine Entdeckung!!! Auf CD 1 ist die Ersteinspielung (oder besser: Ersteinsingung) von Veljo Tormis’ Lettischen Bourdungesängen. Dort wird auch auf ein Buch der Musikwissenschaftlerin Mimi S. Daitz hingewiesen. Im Internet finde ich folgende Angabe: Mimi S. Daitz: The Life and Music of Veljo Tormis. Pendragon Press (ISBN 1576470091) T. S., 23.12.2007 In Kürze folgt noch eine dritte Datei mit Hinweisen auf CDs mit Musik von Yusef Lateef, Conlon Noncarrow und George Antheil, Franz Schubert, Tony Scott, Erwin Schulhoff, ODJB, Musik aus Korsika und Sardinien und Evelyn Glennie.