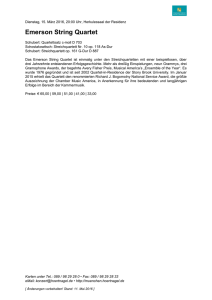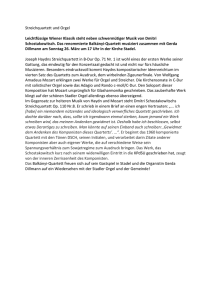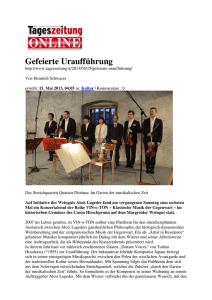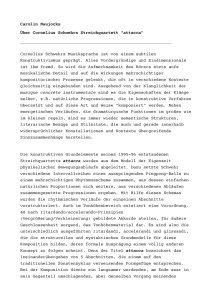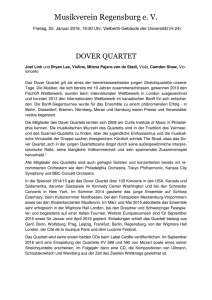Aus der Höhle des Löwen
Werbung
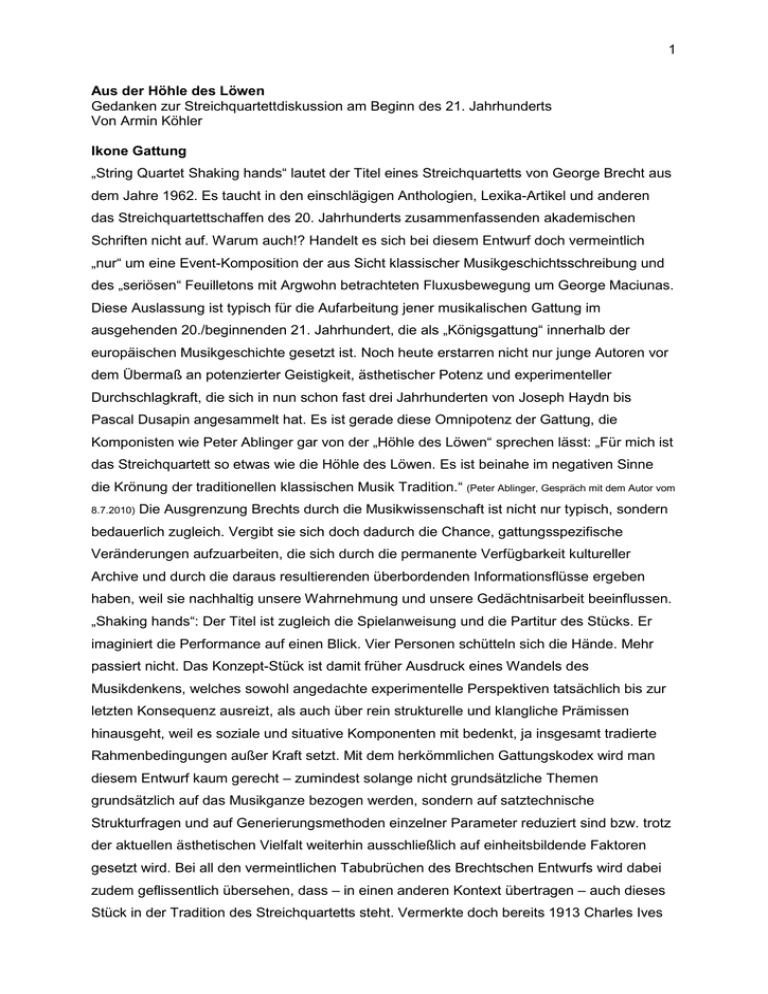
1 Aus der Höhle des Löwen Gedanken zur Streichquartettdiskussion am Beginn des 21. Jahrhunderts Von Armin Köhler Ikone Gattung „String Quartet Shaking hands“ lautet der Titel eines Streichquartetts von George Brecht aus dem Jahre 1962. Es taucht in den einschlägigen Anthologien, Lexika-Artikel und anderen das Streichquartettschaffen des 20. Jahrhunderts zusammenfassenden akademischen Schriften nicht auf. Warum auch!? Handelt es sich bei diesem Entwurf doch vermeintlich „nur“ um eine Event-Komposition der aus Sicht klassischer Musikgeschichtsschreibung und des „seriösen“ Feuilletons mit Argwohn betrachteten Fluxusbewegung um George Maciunas. Diese Auslassung ist typisch für die Aufarbeitung jener musikalischen Gattung im ausgehenden 20./beginnenden 21. Jahrhundert, die als „Königsgattung“ innerhalb der europäischen Musikgeschichte gesetzt ist. Noch heute erstarren nicht nur junge Autoren vor dem Übermaß an potenzierter Geistigkeit, ästhetischer Potenz und experimenteller Durchschlagkraft, die sich in nun schon fast drei Jahrhunderten von Joseph Haydn bis Pascal Dusapin angesammelt hat. Es ist gerade diese Omnipotenz der Gattung, die Komponisten wie Peter Ablinger gar von der „Höhle des Löwen“ sprechen lässt: „Für mich ist das Streichquartett so etwas wie die Höhle des Löwen. Es ist beinahe im negativen Sinne die Krönung der traditionellen klassischen Musik Tradition.“ (Peter Ablinger, Gespräch mit dem Autor vom 8.7.2010) Die Ausgrenzung Brechts durch die Musikwissenschaft ist nicht nur typisch, sondern bedauerlich zugleich. Vergibt sie sich doch dadurch die Chance, gattungsspezifische Veränderungen aufzuarbeiten, die sich durch die permanente Verfügbarkeit kultureller Archive und durch die daraus resultierenden überbordenden Informationsflüsse ergeben haben, weil sie nachhaltig unsere Wahrnehmung und unsere Gedächtnisarbeit beeinflussen. „Shaking hands“: Der Titel ist zugleich die Spielanweisung und die Partitur des Stücks. Er imaginiert die Performance auf einen Blick. Vier Personen schütteln sich die Hände. Mehr passiert nicht. Das Konzept-Stück ist damit früher Ausdruck eines Wandels des Musikdenkens, welches sowohl angedachte experimentelle Perspektiven tatsächlich bis zur letzten Konsequenz ausreizt, als auch über rein strukturelle und klangliche Prämissen hinausgeht, weil es soziale und situative Komponenten mit bedenkt, ja insgesamt tradierte Rahmenbedingungen außer Kraft setzt. Mit dem herkömmlichen Gattungskodex wird man diesem Entwurf kaum gerecht – zumindest solange nicht grundsätzliche Themen grundsätzlich auf das Musikganze bezogen werden, sondern auf satztechnische Strukturfragen und auf Generierungsmethoden einzelner Parameter reduziert sind bzw. trotz der aktuellen ästhetischen Vielfalt weiterhin ausschließlich auf einheitsbildende Faktoren gesetzt wird. Bei all den vermeintlichen Tabubrüchen des Brechtschen Entwurfs wird dabei zudem geflissentlich übersehen, dass – in einen anderen Kontext übertragen – auch dieses Stück in der Tradition des Streichquartetts steht. Vermerkte doch bereits 1913 Charles Ives 2 in seinem „Second String Quartet“, dass seine Komposition für vier Männer sei, „die sich unterhalten, diskutieren, streiten, kämpfen, Hände schütteln, schweigen und dann den Berg hinauf gehen, um das Firmament zu betrachten.“ (Jan Swafford, Charles Ives, A Life with Music, New York, 1996,S. 237) Händeschütteln in diesem Kontext der sozialen Relevanz des Streichquartetts als weiterführende Konsequenz des Gesprächstopos verstanden, verweist auf Johann Wolfgang von Goethes Setzung: „Man hört vier vernünftige Leute sich unter einander unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzugewinnen...“. Sie wirkt in der Sekundärliteratur und in unserem Bewusstsein bis heute als prägendes Gattungsmoment nach, was angesichts der Streichquartette von John Cage, Morton Feldman, Iannis Xenakis, Luigi Nono, Peter Ablinger oder Georg Friedrich Haas durchaus paradox anmuten mag. Abgesehen davon, dass diese Vorgehensweise die Idee ästhetischer Autonomie untergräbt, dürfte es nur schwer zu vermitteln sein, Streichquartett am Beginn des 21. Jahrhunderts als Analogie zur Konversation à la Schlegel, Schleiermacher oder Descartes einzugrenzen. Es sei denn, man agiert, wie zum Beispiel Enno Poppe in seinem Streichquartett, mit dem Prinzip der Negation der Negation: „Ich bin dazu gekommen, gerade dieses Goethewort offensiv zu benutzen. Das traditionelle Material als traditionelles Material traditionell zu benutzen, in einer Form, wo ich mir dann erhoffe, dass gerade dieser offensive Gebrauch in eine andere Qualität umkippen kann. Ich habe ein echtes Interesse daran, diesen traditionellen Ballast zu ertragen und nicht einfach wegzusehen, weil der Komplexitätsgehalt eines Stücks gerade daraus resultiert.“ (Enno Poppe, aus Diskussion „Streichquartett“, Darmstädter Ferienkurse 2004) Dahinter verbirgt sich freilich die Vorstellung, dass sich ein Streichquartett gattungsgeschichtlich strukturell, wenn schon nicht im Dialogprinzip, so doch zumindest in Kontrastbildungen entwickelt. Ohne Charaktere, ohne Kontraste wollen eine Reihe auch jüngerer Autoren – so Enno Poppe und Arnulf Herrmann – am Gattungsbegriff nicht festhalten. Jenes Werk, an dem sich die Gattungsdiskussion geradezu festgefressen hat, nämlich Luigi Nonos „Fragmente – Stille, An Diotima“, wäre dann kein Streichquartett, zumindest nicht im Sinne der Gattungstradition; ebenso wenig die überdimensionierten Quartette von Feldman und gleichwohl alle kompositorischen Entwürfe, die Musik als klangplastisches Phänomen betrachten. Hinter vorgehaltener Hand wird gar behauptet, dass junge Komponisten auf das Kulturgut Streichquartett schauen würden, ohne zu wissen, wie es eigentlich funktioniert. Das mag im Einzelfall nicht von der Hand zu weisen sein, kann aber gewiss nicht für alle jungen Autoren gelten. Überhaupt entspricht der Generationenkonflikt, wie er hier untergründig konstruiert wird, ohnehin nicht der Realität. Enno Poppe: „Im Grunde hängt an der Gattung immer auch die Sonatenform, das Zyklische, der hohe Anspruch. Die Begriffe sind da durchaus fließend. Das heißt, dass bestimmte Streichquartette, die nach 1950 komponiert wurden, gar nicht mehr der Gattung zugerechnet 3 werden können. Ich denke an das Helikopter-Streichquartett von Karlheinz Stockhausen oder die Feldman-Streichquartette, die ja quasi mit ihrer Uferlosigkeit und mit diesem naturhaften Strömen eigentlich entgegengesetzt etwas von dem ausmachen, was Streichquartett bis dahin bedeutet hat. Ganz klar ist es mir aber nicht, ob diese Entwürfe nun innerhalb oder außerhalb des Gattungsbegriffs stehen. Es ist aber auch von Vorteil, dass man dies ambivalent sehen kann. Ich glaube für die Komponisten von heute spielt die Idee der Gattung keine besondere Rolle mehr. Wir sind immer versucht, für jedes Werk eine eigene formale Lösung vorzulegen. Wenn wir mit individuellen Lösungen für jedes Werk arbeiten, ist das Wort Gattung überhaupt nicht mehr brauchbar.“ (Enno Poppe, Gespräch mit dem Autor vom 24.6.2010) Arnulf Herrmann begrenzt den Gattungsbegriff gar nur auf drei Komponisten: Mozart, Haydn und Beethoven. Der klassische Gattungsbegriff hat für ihn „natürlich ganz stark mit motivisch-thematischen Entwicklungen zu tun, sehr viel mit einer tonalen Disposition und natürlich mit einer Satzfolge, also mit einer Viersätzigkeit. Bei Schönberg, Webern, Bartók hat man wenigstens noch die thematische Arbeit, insgesamt gesehen fehlt dies aber komplett nach 1950.“ (Arnulf Herrmann, Gespräch mit dem Autor vom 25.6.2010) Es sind jedoch längst nicht nur die jüngeren Autoren, die sich für einen historisierenden Gattungsbegriff begeistern. Auch für James Dillon sind „das Dialogprinzip und der sprechende Charakter der Musik typische Merkmale von Streichquartett innerhalb der Konventionen. Zentrales Kriterium ist zudem die Tatsache“, so Dillon weiter, „dass alle Instrumente zur gleichen Instrumentenfamilie gehören und die spezielle Spielsituation, bei der die vier Spieler sich alle anschauen. Es gibt nur sehr wenige Kammermusikbeispiele, wo die Spieler diesen Grad von Intimität entwickeln. Es beginnt mit Haydn, wo die vier einzelnen Instrumente die ihr eigene Funktion verlieren. Dies ist der qualitative Beginn von Streichquartett als Konversation. Diese Homogenität fordert eine spezielle Form von Diskurs innerhalb dieser Instrumentengruppierung geradezu heraus. Das ist für mich die geläufigste Annäherung an die Gattung Streichquartett. Und vielleicht ist das, was ich ‚convention‘ nenne und Sie Gattung, genau diese Homogenität der Klangwelt, die Qualität von Klang als Konversation und die Intimität der Situation, die Streichquartett ausmacht.“ vom 16.7.2010) (James Dillon, Gespräch mit dem Autor Auch für Wolfgang Rihm ist „dialektische Polyphonie“ das entscheidende Merkmal. „Trotzdem“, so Rihm, „die Faszination, die dieses Ensemble mit sich bringt, liegt ja gerade darin, dass die Vielseitigkeit der Möglichkeiten innerhalb eines monochromen Ensembles gegeben ist. Das sind Stufungen in einer monochromen Grundfärbung, die bei keinem anderen Ensemble in dieser Weise zu finden sind.“ (Wolfgang Rihm, Gespräch mit dem Autor vom 28.6.2010) Anders Brian Ferneyhough, der in Donaueschingen, so wie James Dillon in diesem Jahr sein sechstes Streichquartett vorstellt. Er ist der Meinung, dass sich die Gattung – vornehmlich bei Komponisten, die sich mehrfach dem Streichquartett zugewandt haben – nicht aufgelöst hat. Als Begründung bemüht er die philosophischen Kategorien von 4 „Sublimität“ und „Plötzlichkeit“, die ihren Ausgangspunkt bei Kant und Hegel haben. „Das ist kein Akzidenz, weil Streichquartett so ein dunkel schimmerndes Anderes hat, was supportiv hinter dem Wirken der vier Leute, der vier agierenden Personen ‚sitzt‘, und überhaupt das in Frage stellt und beflügelt, was sie unternehmen. Es geht ja nicht mehr um vier vernünftige intelligente Männer. Es geht vielmehr überhaupt um die Begegnung und die Kreuzwege. Die guten, die wirklich frappierenden Streichquartette tragen eine Einmaligkeit in sich, die aber irgendwie einhergeht mit dem Gruppenbewusstsein. Ich bin daher nicht der Meinung, dass es sich bei Nono um kein Streichquartett handelt. Jene, die dies behaupten, sehen nur die Oberfläche. Dahinter stehen soziale Sujets, die tiefgreifender sind als bei anderen Gattungen.“ (Brian Ferneyhough, Gespräch mit dem Autor vom 26.7.2010) Überblickt man die Sekundärquellenlage der gattungsgeschichtlichen Diskussion im 20. Jahrhundert, gelangt man zu einem einheitlichen Bild. Dieses muss als akademisch, wenn nicht gar gelegentlich als sophistisch bezeichnet werden. Schon allein deshalb, weil dort der Gattungsbegriff als statisches Wesen, als ein festgeschriebenes Objekt gesehen wird und nie der Versuch unternommen wurde, nach elementaren, die Jahrhunderte übergreifenden, aber sich wandelnden Kriterien zu suchen. Auf diese Weise konditioniert, lassen sich freilich nur die beiden bereits angedeuteten Lösungen finden: Entweder man grenzt aus oder aber erklärt, wie Ludwig Finscher in „Musik in Geschichte und Gegenwart“, die Gattung habe sich im 20. Jahrhundert „weitgehend aufgelöst“. (Ludwig Finscher, Artikel „Streichquartett“ in MGG, Sachteil, Bd. 8, Kassel u.a.1998) Es muss einstweilen noch offen bleiben, ob – um mit Nicolaus A. Huber zu sprechen – am Beginn des 21. Jahrhunderts die „Frage nach der Gattung nicht schon die falsche Antwort“ ist (zitiert nach „Positionen“, 34, 1998, Seite 9) oder aber, ob es sinnvoller sein könnte, aus anderen Zusammenhängen heraus sowie in neue Kontexte setzend, nach den Elementarien, nach den Grundbausteinen von Streichquartett zu suchen. Vielleicht hilft es aber auch, einen Schritt zurückzutreten, um aus einer größeren Distanz auf das Phänomen Streichquartett zu schauen, so dass aus dieser Vogel-Perspektive ein ganz anderer Blick durch die sedimentierten Ablagerungen der Streichquartettgeschichte möglich wird, um auf diese Weise bei aller Wesensverschiedenheit der Komponisten, Stile und Anschauungen sowohl Trennendes als auch Bindendes zu finden. Allein die schiere Anzahl der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für das Arditti Quartet komponierten Streichquartette (das Arditti-Archiv in der Paul Sacher-Stiftung weist 3.000 Kompositionen aus) dürfte die Potenziale auf der Suche nach übergreifenden Kriterien aufzeigen. Ob man gar auf einen anderen Begriff, wie beispielsweise jenen des Formats, der aus der digitalen medienakzentuierten Welt stammt, ausweichen sollte, darf bezweifelt werden. Schließlich konstruiert auch er nur eine signifikante Gesamtheit, ohne hinter seinem medialen Deckmantel Distinktionsmerkmale hervor scheinen zu lassen. 5 Zoomen wir also heraus: Erst ein distanzierter Blick öffnet das Auge, um – das eingangs erwähnte Beispiel aufgreifend – die logische Konsequenz vom Händeschütteln eines George Brecht zum Gesprächstopos eines Haydn zu ziehen – oder aber (um ein zweites Beispiel zu nennen) blicken wir hinein, um in Haydns Streichquartett „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ – das einzige Streichquartett, das sieben nur langsame Sonatensätze aufweist – monistische Keimzellen eines späten Nonos zu finden. Vielleicht hilft als Ausgangspunkt für unsere Suche aber auch solch ein Gemeinplatz, der auf die Tatsache verweist, dass auf der einen Seite einzig die Künstler und ihr individuelles Tun die prägenden Keime des Kunstbegriffs sind, und dass auf der anderen Seite Gattungen ein Konstrukt, ein künstlich vom akademischen Überbau geschaffenes Phänomen sind, basierend auf dem eigentümlichen, geradezu manischen Bestreben des Menschen, alles klassifizieren und damit notwendiger Weise vereinheitlichen zu müssen. Ein Wesenszug, der im Zeitalter der alles normierenden Digitalisierung geradezu beängstigende Formen angenommen hat, indem die Idee des Archivs im Sinne von Lyotards „Postmodernem Wissen“ geradezu ins Unüberschaubare, nicht mehr zu Ordnende aufgehoben wird. Vor diesem Hintergrund habe ich für diesen Beitrag jene Komponisten zum Thema „Streichquartett“ befragt, die mir in den letzten Monaten mehr oder weniger zufällig begegneten. Von Malern und Ausmalern In diesem zuletzt genannten Zusammenhang stellen sowohl Walter Zimmermann als auch Wolfgang Rihm ausdrücklich die besondere Verantwortung der Komponisten heraus: „Sie sind die Motoren der Weiterentwicklung“ (Walter Zimmermann, Gespräch mit dem Autor vom 24.6.2010), bzw. „sie bestimmen das, was Gattung sein kann“. (Rihm, siehe oben) Für Walter Zimmermann lässt sich gar „überhaupt kein Modell“ ableiten, „außer dem der Erfindungskraft, und diese läuft ja nun ungebändigt weiter. Damit gehören die Feldman’schen Streichquartette und jenes von Nono auch dazu.“ Dieser Meinung ist auch James Dillon, der diese Frage mit der schlichten Begründung positiv beantwortet, „weil sie nun einmal für Streichquartett komponiert sind. Ich möchte sie daher als ein Beispiel für Streichquartett heranziehen, nicht aber als Modell.“ (Dillon, siehe oben). Die Komponisten sind die Wegbereiter der Weiterentwicklung, gewiss. Die Frage ist nur, wohin und unter welchen Rahmenbedingungen sich die Kräfte entfalten können bzw. die gesetzten Bedingungen unterlaufen werden. Genau diese Dialektik bestimmte die Arbeit Peter Ablingers an seinem Streichquartett für das diesjährige Festival mit dem Titel „Wachstum und Massenmord, für Titel, Streichquartett und Programmnote“. Gattung ist für ihn nicht nur einheitsstiftendes Moment eines akademischen Überbaus, sondern das 6 Material seines Streichquartetts selbst. Sein Ausgangspunkt ist dabei der ins gesellschaftliche Bewusstsein sedimentierte Gattungsbegriff. „Für mich“, so Ablinger, bedeutet Streichquartett „einfach diese vier Personen, die da so sitzen und spielen – natürlich mit den ganzen Topoi, mit den Klischees, den vier ‚intelligenten Männern, die miteinander diskutieren‘, mit dem Ikonenhaften und dem, was es an bürgerlicher Ästhetik repräsentiert, und all diese Dinge, die da so mitschwingen. Das alles gehört zur Gattung.“ (Peter Ablinger, Gespräch mit dem Autor vom 8.7.2010) Sein konzeptioneller Ansatz spannt in einem gewissen Sinne den Bogen zu dem eingangs erwähnten Quartett von George Brecht. Finden sich in jenem Konzeptstück vermeintliche Randerscheinungen um das Streichquartett wie „Shaking hands“, werden hier jene wie Titel und Programmnote in das Zentrum gerückt. „In meinem speziellen Ansatz“, so Peter Ablinger weiter, „gibt es noch etwas, was dann noch eine Etage höher geht in den Instanzen, das aber trotzdem noch nicht den Bezug zum Gattungsthema verliert, zu jenem Rahmen, der ein Gattungsdenken überhaupt erst ermöglicht: ich meine damit die gesamte klassische Neue-Musik-Tradition. Wenn ich ein Stück komponiere, handelt es sich nur sehr selten um eine freie Kombination von zufällig zusammentreffenden Instrumenten. Ich denke immer die gesamte Geschichte, diesen ‚höheren Rahmen‘ mit. Ich bin der Meinung, dass in einem ziemlich großen Teil dessen, was man so ‚Neue Musik‘ nennt, also gerade da, wo weiterhin mit den klassischen Instrumenten und den bürgerlichen Konzertformen gearbeitet wird, nicht nur die Verdrängung des Gattungsbegriffs vorherrscht, sondern überhaupt eine unglaubliche Historizität des ganzen Betriebs. Dieser Betrieb gibt sich ja das Adjektiv ‚neu‘. Wenn man sich aber ansieht, was da passiert, was die Komponisten tun: Papier, Fünfliniensystem, komplexe Notation, Arbeit für akademisch ausgebildete Virtuosen auf klassischen Instrumenten, und dann noch die bürgerlichen Konzertsäle, Intendanten, Konzertformen und Orchesterhierarchien – mithin die Beschränkung auf all die Bedingtheiten und die Intimität der Verhältnisse von Komponist/Notenschrift/Partitur/Interpret/Distribution – hinzuzieht, dann sieht man, dass das alles Formeln sind, die weit in das 18., ja in das 17. Jahrhundert zurückgreifen. Im Grunde tut diese Spezies von Komponist nichts anderes, als Beethoven auch schon getan hat. Letztendlich füllt der Komponist bereits vorhandene Formen aus. Sie haben, Herr Köhler, um ein Beispiel zu nennen, für Ihr Festival an eine ganze Reihe von Komponisten Streichquartette in Auftrag gegeben. Also schreiben alle Streichquartette, 15 bis 20 Minuten lang. Wenn einer daherkommt, mit einem Stück, das länger als eine Stunde ist, dann ist es eh schon ein Schock. Was tun Sie als Intendant? Nichts anderes, als die Komponisten aufzufordern, im Rahmen zu bleiben. Ich weiß, dass Sie es absichtlich tun und auch dialektisch tun und durchaus auch Komponisten herausfordern wollen, den Rahmen im Rahmen zu übertreten. Das ist schon alles in Ordnung, bleibt letztendlich aber folgenlos. Damit hat man weder das Notenpapier erfunden, noch die Instrumente, noch die Gattung, 7 noch den Zeitrahmen, noch die Konzertsituation, noch die Ausbildung der Interpreten. Es ist alles bereits da, es ist alles wie ein Malbuch. Alles ist vorgegeben. Und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich den Kopf grün anmale oder blau. Aber viel mehr ist da nicht drin. ‚Innenarchitektur‘– damit könnte man es noch vergleichen – irgendwie etwas geschmackvoll einrichten, aber ich weiß nicht, ob damit überhaupt noch Kunst möglich ist. Es ist ein Ausfüllen von etwas, was bereits da ist. Es ist eine kulturelle Handlung, zweifelsohne, aber keine Kunst.“ (Ablinger, siehe oben) Einer, der in der Genese seiner Arbeiten immer den „höheren Rahmen“, von dem Peter Ablinger spricht, radikal mit eindenkt, ist der ebenfalls aus Österreich stammende Autor Georg Nussbaumer. Seine Materialien sind nicht nur schlechthin die sedimentierten Gattungsfaktoren, sondern darüber hinaus alle Elemente, die im weitesten Sinne mit der Begrifflichkeit von Streichquartett in Verbindung gebracht werden können, um die gesellschaftlichen Hintergründe der Gattung Streichquartett zu reflektieren: „Begriffe sind ja nichts Abstraktes“, so Georg Nussbaumer, „sie kommen von irgendwo her. Beim Streichquartett beginnt es damit, dass Bäume abgesägt und gelagert werden: unglaubliche Zeiträume, Handwerkskunst und Subtilität in der Verarbeitung – das alles sind ja Faktoren, die schon längst da sind, bevor der erste Klang solch eines Streichquartetts erklingt. Diese sind für mich genau so wichtig wie für einen Architekten die Geologie des Untergrunds, auf den er sein Haus bauen will. Es gibt über siebzig verschiedene Begriffe, die im Zusammenhang mit Streichquartett zu sehen sind. Da zählen die Haare dazu, die Wirbel, der Hals, die Körperhaltung der Musiker, die Saiten, die aus Därmen gemacht werden und auch die weibliche Form der Instrumente, die durch den Rückenakt von Man Ray mit den fLöchern zu einer Ikone geworden ist. Wie assoziationsreich kann solch ein Detail sein, wenn man bedenkt, dass diese weiblichen Formen von Bogenhaaren bespielt werden, die nur von männlichen Tieren, also von Hengsten stammen! Zudem interessieren mich auch solche Details, dass zum Beispiel das Schaf, das die Saiten spendet, seine Organspende nicht überlebt, weil es den Darm ‚opfert‘, dass das Pferd aber – als angeseheneres Tier – überlebt, weil es nur die Schwanzhaare spenden muss. Ich gehe also von ganz elementaren Dingen aus, die bis in das Zwischenmenschliche, ja bis ins Sexuelle hineingehen. Es versteht sich von selbst, dass dann natürlich auch die Philosophie, die Literatur und die anderen Künste in meine Vorstellung von Streichquartett mit hineinspielen.“ (Georg Nussbaumer, Gespräch mit dem Autor vom 15.7.2010) Unabhängig voneinander ziehen Mathias Spahlinger und Peter Ablinger das zweite Streichquartett von Morton Feldman als Beispiel heran, um deutlich zu machen, dass dessen außergewöhnliche Länge von fünf Stunden ein nachdrücklicher Hinweis auf seine bewusste Absetzung vom Gattungsdenken sei. Mathias Spahlinger: „Das zweite Quartett von Feldman ist zugleich das längste in sich geschlossene Musikstück der Welt. Diese zeitliche 8 Ausdehnung ist Zeichen des Ausbruchs aus dem Gattungsdenken. Und genau das ist eine der spezifischen Eigenschaften von Neuer Musik. Ich pflege zu sagen, dass im 20. Jahrhundert das Verhältnis der Teile zum Ganzen sich prinzipiell verändert hat und dass die Kategorie Gattung etwas Übergeordnetes ist. Wenn sich das Verhältnis der Teile zum Ganzen auch im Gattungswesen geändert hat, dann ist der Begriff der Gattung insofern aufgehoben im doppelten Sinn, als heute von einem Komponisten unter anderem gefordert ist, dass jedes Stück, das er erfindet, die Musik neu erfindet – im Extremfall. Das ist der eigentliche Sinn. Natürlich findet das so nicht statt. Die Komponisten arbeiten nach wie vor in Serien oder schreiben für dieselbe Besetzung ein zweites Stück und Dinge dieser Art. Aber streng genommen ist es so, dass jeder Komponist mit jedem neuen Stück gefordert ist, die Musik neu zu erfinden, weil nicht definiert ist, was Musik ist. Und er muss sie neu definieren mit jedem Stück. Und das Schärfste dabei ist, dass alle kategorialen Begriffe einheitsbildend wirken. Also: Wenn das stimmt, dass jeder die Musik neu erfinden muss, dann bedeutet das aber auch, dass er nicht vereinheitlichende Ideen erfinden muss, die das ganze Ding zusammen halten, oder sich an vereinheitlichende Ideen anschließen darf wie dem der Gattung oder der stehenden Besetzung, sondern dass er, ich würde sagen eine veruneinheitlichende Idee ausdenken muss, die trotz allem, was immer in Musik eine Einheit herstellt, diese Einheit immer in sich reflektiert und auch in sich aufhebt und in seine Einzelheiten auseinander nimmt, damit man erkennen kann, aus welchen unterschiedlichen Partikeln diese Einheiten eigentlich bestehen. Der Sinn des analytischen Denkens ist ja nicht, alles zu zerstören und auseinander zu nehmen, sondern getrennt zu denken, was doch nicht zu trennen ist, um dadurch zu erkennen, was das Getrennte zusammen hält, das getrennt Gedachte vereinheitlicht. Und in diesem Sinne ist zum Gattungsbegriff, wie über alle anderen vereinheitlichenden Ideen, zu sagen: Wir sind in der absurden Situation (die jedes Lehrbuch ausschließt), mit jedem Stück eine neue Gattung erfinden zu müssen. Wer die Musik neu erfindet, erfindet auch die Gattung neu – was unter ordnungspolitischen oder ordnungskategorialen Bedingungen eine Absurdität ist. Wir müssen lauter individuelle Gebilde erfinden, die ihre eigene Gattung sind. Es gibt keine zwei Exemplare, die derselben Gattung angehören. Gattung und Individuum sind dasselbe. Das gibt es nirgends. Daran kann man erkennen, dass, wenn man ein Biologiebuch aufschlägt, solche vereinheitlichenden Gedanken wie Klasse, Art, Gattung willkürliche Erfindungen von Menschen sind. Wie alle Begriffe treffen sie im Kern immer etwas, während sie an den Rändern verwischen. Sie sind unmöglich zu Ende zu definieren, was eine Tautologie ist. Definieren heißt: zu Ende bringen. Also sie sind nicht zu Ende zu bringen, sondern es kommt darauf an, radikal zu denken. Es gilt innerhalb der kategorialen Zuordnungen, die Kategorien immer auch als abgeschafft oder als überflüssig oder als inexistent zu betrachten – auch 9 dann, wenn wir gar nicht anders können, als sie zu gebrauchen, denn wir gebrauchen ja verständliche Begriffe.“ (Mathias Spahlinger, Gespräch mit dem Autor vom 25.6.2010) „The medium is the message“ Die Absurdität der Gattungsdiskussion wird offenbar, wenn Bernhard Lang die geschichtsphilosophische Kategorie des Mediums einbringt. Er zitiert, „heute mehr denn je“, so Bernhard Lang, Marshal McLuhan: „‘The medium is the message.‘ Ich kann den Gattungsbegriff vergessen, wenn ich ihn durchs Medium ersetze. Ich kann sagen: ‚Ich habe in diesem Falle ein historisch definiertes Medium. Das geht vom Instrumentenbau bis zum Literatur- oder Gattungsbegriff des 18. Jahrhunderts. Noch heute wird doch immer wieder ein Besetzungsmuster akzeptiert, das es seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt. Da sehe ich schon das Zitieren einer Gattung; man könnte auch vom Sampling einer Gattung sprechen – aus einem Kontext heraus– und in neue Kontextualitäten hineingerückt. In dieser Hinsicht gibt es bei kaum einer anderen Gattung eine so intensive, historisch begründete Dialektik mit der Geschichte der Besetzung, mit der Geschichte der Instrumentalität und ihrer Spiegelung im Jetzt. Da ist nach wie vor eine unheimliche Reibungs-, aber auch Bewährungsfläche in dieser Nacktheit der Textur, die uns da gegenüber steht.“ (Bernhard Lang, Gespräch mit dem Autor vom 30.6.2010) Georg Nussbaumer bringt den Begriff des Archivs ins Spiel, wenn er den Gattungsbegriff mit einer Bibliothek vergleicht. „Nonos Streichquartett ist für mich kein Stück, das sich von Beethoven oder Brahms grundlegend unterscheidet. Hat doch Streichquartett für sich schon eine Form. Das ist wie ein Buch. Dieses schließt man und schiebt es wieder in ein Regal. Und dann stehen sie dort, die Bücher. Man erinnert sich: das eine war spannend, das andere weniger. Immer sind sie ganz verschieden in Form und Inhalt. Aber deren Wesen ist so stark, dass sich die Gesamtheit zu einem Archiv bindet. Überhaupt gefällt mir der Ausdruck ‚Wesen‘ sehr gut, weil ich das Streichquartett als solches wahrnehme – als so eine Art, eine Gruppe, ein Rudel von Instrumenten, und dann in zweiter Linie auch von Musikern. Auch als einen Organismus von verschiedenen Organen, der aus sich heraus funktioniert. Und gleichzeitig ist es wie die perspektivische Ansicht eines Instruments, das in verschiedenen Größen auftritt. Es zeigt sich von drei verschiedenen Seiten und in den ganzen Materialien und Bauteilen; man spricht ja auch von der ‚Seele‘ von Geigen, zum Beispiel; da ist ja auch sehr viel Organisches und Wesenhaftes zu finden.“ (Nussbaumer, siehe oben) Falls man nunmehr doch den Versuch unternehmen sollte, nach übergreifenden Bezugspunkten bzw. Distinktionsmerkmalen innerhalb des Streichquartettschaffens der letzten zweieinhalb Jahrhunderte zu suchen, dann dürften solche Faktoren am ehesten konsensfähig sein, die mit Schlagworten wie Wille zur Konzentration, Introspektion, Klarheit, Balance, Intimität, Skelettierung, Elitarismus, Privatheit, Reduktion, Mystik, Linearität und 10 Kontrapunktik umschrieben werden. Während Bernhard Lang beim Streichquartett von einer „irrationalen Maschinerie“ oder von Haydn bis Nono von einem „Transportmittel von mystischen Gedanken“ spricht, verweist Walter Zimmermann auf ein weiteres zentrales Phänomen: jenem der Balance, dem bei der Arbeit am Streichquartett besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Er bezeichnet das Streichquartett daher nicht von ungefähr als „Nukleus eines Apparats, der nach allen Seiten hin in Balance zu bringen oder aus dieser herauszubringen ist“. (Zimmermann, siehe oben) So wie Walter Zimmermann argumentieren auch Brian Ferneyhough und James Dillon mit dem Begriff der Balance. James Dillon: „Wir benutzen im Englischen das Wort ‚Gattung‘ auch als Synonym für das Wort ‚style‘. Dieser Bezug interessiert mich allerdings nicht. Wenn wir hingegen von Gattung im Sinne von Konventionen in Bezug auf eine spezielle Instrumentation sprechen, dann kann ich dem bis zu einem bestimmten Ausmaß zustimmen. Die Beziehung von Spieltechniken, Materialtypen, Balance oder Intonationen, das hat schon eher etwas mit Konventionen zu tun. Aber das Problem bei Konventionen ist häufig, dass sie Gedanken ersetzen. Von einer großen Anzahl neuer Quartette kann behauptet werden, dass ein Großteil ihres Materials unideomatisch ist, weil es in nicht notwendiger Weise der Akustik der Instrumente entspricht. Konventionen haben für mich ganz stark etwas mit Balance zu tun. Ein extremes Beispiel diesbezüglich ist das erste Streichquartett von Michael von Biel, ein verrücktes AvantgardeQuartett, bei dem Konventionen – oder nennen wir es Gattungsbezüge – überflüssig geworden sind. Auch einige Streichquartette von Helmut Lachenmann überbeanspruchen die Vorstellung von Konvention. Ich zögere, ihn als Beispiel heranzuziehen, weil ich weiß, wie höchst sensitiv Lachenmann mit dem Gattungsbegriff arbeitet. Aber vielleicht ist Gattung auch ein zu problematischer Begriff, weil er zu weit gefasst wird.“ (Dillon, siehe oben) Für Brian Ferneyhough ist die „gleichbleibende Spannung zwischen den vier gleichbleibenden Personen“ etwas wie eine Art Sprungbrett. „Es ist eine Art Hilfe, um weiter springen zu können, als man es bislang erreicht hat. Das ist das Besondere, was ich am Streichquartett schätze. Ich wundere mich selbst, was da so passiert – auch beim Schreiben meines Streichquartetts für Donaueschingen, wo es in der zweiten Geige plötzlich durch gleichbleibende Großterz-Flageoletts zu einem Formbruch kam, den ich so nicht erwartet hatte. Ich glaube, das ist die besondere Qualität von Streichquartett. Geschichte ist doch nicht da, dass man nur diese gleichen Formen der Gattung ausprägt, sondern vielmehr, dass die Unabhängigkeit, die verstärkte Autonomie der Gattung Möglichkeiten bietet, um über sich selbst zu springen. Und das ist immer so gewesen.“ (Ferneyhough, siehe oben) Das Nackende Herangezogen werden müssen für einen Katalog allgemeiner Kriterien für die Gattung Streichquartett neben den bereits genannten zudem gewiss auch die Faktoren 11 Vierstimmigkeit und Homogenität des Streichquartettsatzes, die wie eine „carte blanche“ die Grundlage für eine Versuchsanordung liefern, auf deren Basis überhaupt erst experimentiert werden kann. Ist diese sowohl neutrale als auch festgefügte Situation für eine ganze Reihe von Komponisten explizit die Voraussetzung für eine experimentelle Situation, schließt sie für Peter Ablinger experimentelles Tun aus. „Für mich“, so Ablinger, „ist das Streichquartett auf Grund seiner großen Tradition alles andere als ein Laboratorium, weil es als solches schon eine ganz spezielle Funktion hat. Es fordert einen speziellen Umgang damit heraus. Also: freies Komponieren von irgendwie ausgedachten Strukturen geht da nicht.“ (Ablinger, siehe oben) Er musste daher für sein Donaueschinger Streichquartett eine Lösung finden, „die eben diese Funktion auch thematisiert.“ Die bloße Perpetuierung der Tradition veranlasst Ablinger, das Bild vom unproduktiven „Ausmalen“ aufzugreifen, während Walter Zimmermann in der homogenen Voraussetzung des „passiven Klangkörpers“ den Vorteil sieht, dass der Komponist „Entscheidungen erst einmal abgenommen bekommt. Er hat sozusagen wie ein Zeichner ein Format vor sich, auf dem er zeichnet, er hat die Bleistifte, die Buntstifte, er kann andere Gouachen verwenden. Aber: auf diesem Blatt lässt sich keine Ölfarbe auftragen. In diesem Sinne ist damit schon definiert, was nicht geht. Die physische Materialität der Instrumente diktiert die Grenzen. Das bedeutet zugleich aber auch, dass der Einzelne viel mehr gefordert ist, weil er kein Material hat, hinter dem er sich verstecken kann. Das heißt, der individuelle Duktus der persönlichen Schrift des einzelnen Komponisten ist einfacher ablesbar.“ (Zimmermann, siehe oben) Auch Georg Nussbaumer bemüht das Bild vom Malen: „Ich vergleiche Komponieren für Streichquartett mit dem Malen mit einer warmen Farbe, wo nur die einzelnen Pinselstriche, Farbintensitäten, Geschwindigkeiten von einer einzigen Farbe, einen ganzen Kosmos eröffnen. Das Bild vom Pinsel ist für mich auch insofern logisch, weil sowohl der Pinsel mit Haaren agiert als auch die Streichinstrumente und weil beide über Bewegung funktionieren.“ (Nussbaumer, siehe oben) Wenn Arnulf Herrmann dagegen vom „Reagenzglas“ spricht, aus dem heraus der Satz sich entwickelt, dann denkt er auch in Richtung „Experiment: „Es gibt ja auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Einfachheit, weil ich auf bestimmte Mischungsverhältnisse überhaupt nicht achten muss. Ich habe als Komponist also erstmal eine neutrale Klangfolie. Die Vierstimmigkeit gilt als das dringend Notwendige, um eine Harmonie zu füllen. Dies ist der Laborsatz, gewissermaßen das musikalische Reagenzglas, innerhalb dessen man dann kompositorische Ideen entfalten kann.“ (Herrmann, siehe oben) So oder so: Seinen experimentellen Anspruch scheint das Streichquartett über die Jahrhunderte nicht eingebüßt zu haben. Schon Joseph Haydn mag bei seiner Arbeit in der Gattung insofern „Luft von anderen Planeten“ gefühlt haben, als er darauf verwies, dass er am meisten schockieren könne, wenn er für Streichquartett schreibe, und dass diese Form 12 ihn befähige, seine Phantasie freier laufen zu lassen als in anderen Formen. Georg Friedrich Haas erwähnt gar expressis verbis den Experimentalcharakter seiner Streichquartette, wenn er in einer Diskussionsrunde bei den Darmstädter Ferienkursen 2004 in die Diskussion einbringt: „Wenn ich an meine vier Streichquartette denke, dann gibt es da etwas, was bei allen gemeinsam ist, nämlich, dass ich das Streichquartett als Experimentalstudio benutze. Es beginnt mit dem Experiment der umgestimmten Saiten im ersten Streichquartett, geht weiter mit dem Experiment des Spielens innerhalb einer sehr langen Dauer bei vollkommener Dunkelheit, wo die Musiker sich nicht nur nicht sehen können, sondern nicht einmal sich atmen hören, weil sie weit von einander aufgestellt sind. Und es endet beim vierten Streichquartett mit dem ganz banalen Experiment (das freilich nur eines für mich ganz persönlich ist), dass ich innerhalb meines Schaffens das erste Mal mit Live-Elektronik arbeite.“ (Georg Friedrich Haas, aus Diskussion „Streichquartett“, Darmstädter Ferienkurse 2004) Bis heute lebt Streichquartett – im Vergleich mit anderen Gattungen – weniger von wechselnden Moden als vielmehr von Geschichte mit Vorlauf und Folgen. Und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Streichquartett: es war nie eine Kunstform, die sich je zum Affen ihrer Zeit machen ließ. Dabei gibt es so viele Formen, auch in der sogenannten E-Musik, die seit jeher nichts anderem als der Unterhaltung und der Pflege des schlechten Geschmacks dienten. Nicht so das Streichquartett. Wie die Bilder sich gleichen: Nicht nur die Metaphern vom Malen und der Balance wurden mehrfach beschworen, sondern auch das Bild der „Nacktheit“ des Materials. Wenn Walter Zimmermann darauf verweist, dass es beim Streichquartett kein Material gibt, „hinter dem man sich verstecken kann“, dann verweist er direkt auf Carl Maria von Weber, der mit Blick auf das Streichquartett davon sprach, dass „das rein Vierstimmige das Nackende in der Tonkunst ist.“ Adorno spricht in diesem Zusammenhang vom „Widerstand gegen das Expansive und Dekorative“, und Erik Satie nennt das Phänomen „Musique sans sauce“. Und Bernhard Lang geht noch einen Schritt weiter: „Da ist nach wie vor eine unheimliche Reibungsfläche, aber auch Bewährungsfläche in dieser Nacktheit der Textur, die uns da gegenüber steht. Ja, die Nacktheit geht über die Nacktheit hinaus. Sie geht über in das Skelett. Es ist eine Skelettierung eines Satzes. Sie kann natürlich auch aufgefangen werden, indem ich in einen Mikrokosmos gehe, indem ich plötzlich beginne, mit dem Mikroskop die Poren der Skelettknochen zu untersuchen und dort hinein fokussiere. Diese Assoziation habe ich, wenn ich den ‚Reigen seliger Geister‘ von Helmut Lachenmann höre, wo für mich ein Mikroskop so lange in ein Knochengerüst hinein zoomt, bis es wieder Landschaften vor sich sieht.“ (Lang, siehe oben) Die Formation, die intime Gruppe 13 Ein weiteres bestimmendes Merkmal von Streichquartett als Gattung ist die ausgeprägt soziale Konstituierung der strukturellen Setzung, der Formation und der Spielsituation. Es ist erstaunlich, dass dieser Aspekt in der aktuellen Gattungsdiskussion nur am Rande eine Rolle spielt. Erwähnt wurde ja bereits die spezielle Sitzordnung der Spieler, die, wie bei keinem anderen Kammermusikensemble, den Augenkontakt ermöglicht (besonders deutlich ausgeprägt durch den Pariser Quartett-Tisch um 1750). Aber auch die Sitzordnung der Zuhörer um die vier Spieler herum ist Teil des mikrosozialen Systems der Gattung Streichquartett. Sie zeugt von einer speziellen Konzentration und Intimität, die der Gattung auf allen Ebenen des Rezeptionsprozesses eigen ist. Das ist, um Bernhard Lang zu zitieren, „wenn man so will, sozusagen der Kreis um das Quadrat. Diese Quadratstruktur des Quartetts und die Kreisstruktur des Publikums bilden eine Einheit und thematisieren zudem Privatheit.“ (Lang, siehe oben) Anders als bei Orchestermusik, die sich in der Aufführungssituation über eine sich gegenseitig bedingende Doppelmasse Orchester/Publikum konstituiert, haben wir es beim Streichquartett mithin mit einer in sich geschlossenen Gruppe, einer Einheit von Spielern und Hörern zu tun, die sich in reinster Form freilich erst in der Hausmusik dilettierender Quartette zu erkennen gibt. Bei allen unterschiedlichen Bewertungen, in einem dürfte Übereinstimmung herrschen: Sozial-psychologische Aspekte scheinen im System Streichquartett eine weitaus wichtigere Rolle zu spielen als in anderen Systemen. Und auch aus dieser Perspektive betrachtet, wird es offenkundig, dass das eingangs erwähnte Streichquartett von George Brecht sehr wohl gattungsimmanent ist. Diese soziale Präsenz betrifft sowohl die Seite der musikalischen Struktursetzungen als auch die der Interpretationsebene, über die bislang noch nichts gesagt wurde. Streichquartett ist ja nicht nur eine Gattung, eine Besetzung, eine „irrationale Klangmaschinerie“, Streichquartett ist darüber hinaus auch eine Lebensform. Jeder, der sich jemals intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weiß um die Spezifika, die sich aus und in diesem Gebilde von vier gewissermaßen Tag und Nacht gemeinsam agierenden Menschen ergeben. Ein wesentliches Element ist zum Beispiel das sehr spezielle Verhältnis von Homogenität und Individualität, von Individuum und Gruppe. Bei keiner anderen Gattung, bei keinem anderen Ensemble ist die Grenze so fließend wie beim Streichquartett. Ist doch Streichquartett die Naht, die das Individuelle mit dem Gemeinsamen verbindet, wo Individualität ins Kollektiv übergeht. Man kann kaum treffendere Worte als Bernhard Lang finden, der im Streichquartett „vier Subjekte in höchster Eigenverantwortlichkeit“ sieht, „die dennoch sehr kantisch denken müssen, sozusagen aus der Vernunft heraus den gemeinsamen Nutzen definieren, das Tutti definieren, den Kern der Sache gemeinsam bestimmen.“ (Lang, siehe oben) Auf dieser Ebene bewegt sich auch Brian Ferneyhough, wenn er im Gegensatz zum Streichquartett das Streichtrio heranzieht. „Das Streichtrio kommt aus der 14 Suite, es kommt aus verschiedenen, eher steifen Barockkonstellationen. Und man sieht ja, dass die Geschichte des Streichtrios im 19. Jahrhundert fast nicht existiert und auch im 20. Jahrhundert kaum Früchte getragen hat.“ (Ferneyhough, siehe oben) Wo beginnt das gemeinsame Musizieren? Wie findet man die Balance zwischen emotionaler Nähe und kollegialer Distanz? Was passiert gruppendynamisch in einer Viererkonstellation? Das sind Fragen, die sich so nur in Bezug auf das Streichquartett stellen. Karl Josef Pazzini, der Ehemann der Impresaria Sonia Simmenauer, ein Psychoanalytiker, sprach davon, dass es sich beim Streichquartett um eine Dyade handeln würde, um eine Gruppe, in der besonders intensive emotionale Beziehungen herrschen. Deutlicher lässt sich die Besonderheit der Konstellation kaum ausdrücken. Dabei ist vorstellbar, dass das Verhältnis der beiden Violinisten im Ensemble dabei noch eine ganz spezielle Form dieser Dyade darstellt. Irvine Arditti äußert sich in dieser psychologischen Charakterisierung allerdings eher zurückhaltend: „Ich bin der Psychoanalytiker müde. Ich kann dieser Analyse nicht zustimmen. Man kann wirklich alles über alles sagen. Nein, ein Streichquartett ist eine Einheit, die gemeinsam funktioniert. Und sie kann nur funktionieren durch die Kumulation von vier individuellen Partnern.“ (Irvine Arditti, Gespräch mit dem Autor vom 20.7.2010) Soziologische und psychologische Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass gruppendynamisch die Viererkonstellation die schwierigsten Bedingungen aufweist. Entweder es kommt zu Paarbildungen oder aber einer aus der Gruppe wird durch die drei anderen ausgegrenzt. Je enger die Beziehung, desto explosiver ist sie. Ein charakteristisches Bild aus Sicht der Komponisten vermag Mathias Spahlinger zu liefern, dessen Vater professionell in einem Streichquartett mitwirkte: „Bei den Streichquartetten, die ich aus eigener Anschauung kennen gelernt habe, da brodelt es unter der Oberfläche. Deren Mitglieder reisen in getrennten Abteilen, in getrennten Zügen, der eine fliegt, der andere reist mit dem Auto und der nächste mit dem Fahrrad, um sich möglichst nur auf dem Podium zu begegnen“. (Spahlinger, siehe oben) Es versteht sich von selbst, dass es eine der besonderen Herausforderungen einer so eng miteinander agierenden Gruppe ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen Privatheit und beruflichem Tun, ob beim Reisen, Proben oder beim öffentlichen Spiel. Allerdings ist dies heutzutage laut Irvine Arditti längst nicht mehr solch ein immanentes Problem. Er bestätigt jedenfalls, dass heute auf Grund der neuen Verkehrsmittel und anderer technischer Errungenschaften längst nicht mehr eine solch andauernde Nähe aller Beteiligten vorherrscht, wie es noch zu Zeiten des LaSalle- oder des AmadeusQuartetts der Fall war. „Heute fliegen wir mit schnellen Flugzeugen, wodurch es möglich ist, dass wir beim Reisen längst nicht so viel gemeinschaftliche Zeit aufbringen müssen wie unsere damaligen Kollegen. Das Amadeus-Quartett verbrachte allein elf bis zwölf Wochen 15 on tour. Als ein solches Quartett früher in Amerika auf Achse war, konnte es nicht so schnell nach Australien kommen. Wir gehen jedes Jahr 3- bis 4-mal auf Tournee, aber keine Tournee dauert länger als zwei Wochen. Es ist für uns viel einfacher geworden. Wir können viel Zeit mit unseren Musikerkollegen verbringen und haben immer noch viel Zeit für unsere Familien und Freunde übrig.“ ( Arditti, siehe oben) Dennoch: gruppendynamisch ist die Viererkonstellation komplizierter als zum Beispiel ein Trio. Faszinierend ist, dass sich nach längerer Beschäftigung mit dem Thema endlich die Frage beantworten lässt: Was ist ein Streichquartett? Ein Streichquartett ist eine Unternehmensberatungsfirma! Sowohl das JACK Quartet als auch das Quatuor Diotima berichteten von Quartetten in den USA und in Frankreich, die seit vielen Jahrzehnten zusammenspielen, und sich auf Unternehmensberatung spezialisiert haben. Sie erklären ihren „Gesprächspartnern, wie man das Leben zu viert in allen seinen verschiedenen Aspekten organisieren, und vor allem, wie man die Probleme lösen kann, die sich unweigerlich bei einem Leben fast ohne Kontakt zur Außenwelt ergeben“. (Diotima, Interview mit dem Autor vom August 2010) Damit haben sie großen Erfolg! So ist es fast immer: „einer von den Vieren“, so Mathias Spahlinger , „außer der ersten Geige, fühlt sich eigentlich immer als ‚fünftes Rad‘ am Wagen und stört irgendwie die Gruppendynamik. Ich habe das Gefühl, da ist immer Uneinigkeit. In einer Arbeitsbeziehung ist eigentlich erst die Dreiergruppierung die erste, die richtig arbeitsfähig ist. Dort werden die unmittelbaren Beziehungen zweier Menschen dauernd gestört. Immer liegt darin die Aufforderung, sachlich zu werden und sich nicht an den Beziehungen aufzureiben. Das ist auch ein Grund, weshalb ich das Streichtrio für sehr interessant halte. Die Viererkonstellation ist das gestörte Dreiecksverhältnis. Dort kommen immer Unberechenbarkeiten mit hinein, die weder für die Arbeit gut sind, noch für das Verständnis untereinander.“ (Spahlinger, siehe oben) Dies entspricht durchaus auch der Erfahrung der Psychologie und der Soziologie, so der Architekt und Städteplaner Wolfgang Fiel, der bestätigt, dass die Dreierkonstellation in dem Sinne ideal sei, weil es immer ein ausgleichendes Moment gäbe. „Es gibt keine Pattsituation. Natürlich gibt es die Gefahr der Ausgrenzung auch in der Dreierkonstellation. Aber normalerweise ist es dort eher so, dass es wechselnde Mehrheiten gibt. Der Konsens migriert zwischen den Personen, deswegen ist das die ideale Konstellation. Bei Vieren kommt schon die Frage ins Visier, was das Ziel dieses Zusammenwirkens ist. Es könnte ja durchaus auch so sein, dass Gruppen mit dem Ziel zusammenkommen, um prozesshaft zu arbeiten und die Frage des gemeinsam definierten Ziels etwas an Schärfe verliert, das heißt nicht mehr unmittelbar im Mittelpunkt der Konstellation steht. Das erleichtert natürlich den Workflow, wenn man so will, weil durch die Weichheit der Zieldefinition dann auch der Druck nachlässt, sich in der Form beweisen zu müssen. Es geht ja nicht nur um das Herausfinden einer gegenseitigen Kompetenzlage, sondern auch um das Unterbeweisstellen, das Stärken 16 der eigenen Kompetenz in diesem gruppendynamischen Vorgang. Und je höher der Druck wird durch die Vorgabe der Zieldefinition, desto eher kann es zu diesen Pattsituationen kommen. Wobei dann die Frage sich stellt, wer der Vermittler in solch einer Lage ist. Bei Dreien ist es so, dass einer meist der Vermittler ist. Wer übernimmt also die als Leitfunktion zu definierende Rolle? Und wie gesagt, diese wechselt sehr gern im Dreierverhältnis. Im Viererverhältnis kann es sehr gut sein, dass sich diese zementiert und einer übrigbleibt, der sich konstant in dieser Rolle wiederfindet. In einer Fünferkonstellation übernimmt dann im Idealfall der Fünfte die Rolle, die in der Dreierkonstellation der Dritte übernommen hat. Hier kommt jedoch hinzu, dass fünf schon eine etwas kritischere Größenordnung ist, wo es schwierig sein kann, überhaupt zu Lösungen zu kommen. Aber es gibt im Idealfall auch wechselnde Mehrheiten. Fünf ist der fließende Übergang zur Massenbildung. Und von da geht es ganz schnell in Dimensionen, wo erkennbare Clusterbildungen von Meinungsführerschaft und gruppendynamischen Steuerungsorganen ablesbar werden. Größere Gruppen haben den Vorteil, dass auf Grund der schieren Anzahl der verbundenen Kompetenzen die Richtung, die dieser Vorgang einnimmt, schwerer vorhersehbar ist, dafür aber die schiere Wissensmenge vereint ist, was zu einem besseren Ergebnis führen wird. Wenn ich von Kompetenzen rede, rede ich nicht von handwerklichem Können, sondern davon – und das darf bei gruppendynamischen Prozessen nicht vergessen werden –, dass es um kommunikative Kompetenzen geht. Und das sind schon zwei wesentlich zu unterscheidende Ebenen im gruppendynamischen Vorgang. Es gibt einerseits die rein fachliche Kompetenz und andererseits die kommunikative Kompetenz. Diese ist im sozialen Bereich die klassisch definierte soziale Kompetenz, die jedoch nie demokratisch gleich gut ausgebildet ist. Die Crux bei dieser Konstellation ist, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass gleiche Kompetenzen auf fachlicher Ebene ein homogenes Gruppengefüge ergeben, wenn es darum geht, wirklich gemeinsam zu arbeiten.“ (Wolfgang Fiel, Gespräch mit dem Autor vom 21.7.2010) Irvine Arditti versteht seine Aufgabe als Primarius ganz in diesem von Wolfgang Fiel beschriebenen prozesshaften Sinne. Sein Tun sieht er in der Leitfunktion, einer Rolle, in der er sich aber auch konstant wiederfinden möchte. Irvine Arditti: „Meine Rolle als Primarius sehe ich darin, das Ganze zusammenzuhalten. Ich spiele eine übergeordnete Rolle, darf aber das ganze Geschehen nicht zu sehr dominieren. Der Erfolg eines großen Streichquartetts wird dadurch gesichert, dass man die Fähigkeit besitzt, aus den Kollegen etwas herauszukitzeln. Meiner Meinung nach kann das nur erreicht werden, wenn man keine erhebliche Machtrolle übernimmt. Es ist wie im echten Leben: man muss lernen, mit drei anderen Kollegen auszukommen. Man verbringt mehr Zeit mit den drei anderen Kollegen als mit seiner Frau oder anderen Freunden. Damit muss man sich abfinden. Die traditionelle Rolle des Primarius in der klassischen Musik ist die, dass man die Solomelodien zu spielen 17 hat. Früher hatte fast nur der Primarius die schwierigen Stellen. Heute schreiben Komponisten für alle vier Streicher sehr anspruchsvolle Musik. Meine spezifische Rolle ist die eines Entsandten. Es gibt einen fast religiösen Aspekt der Primarius-Rolle, obwohl ich kein religiöser Mensch bin. Ich glaube aber schon an Schicksal. Ich glaube, ich wurde auf die Erde geschickt, um das Arditti Quartet zu gründen. Mein Interesse für die neue Musik war kein Zufall. Als Kind habe ich sehr viel Stockhausen gehört. Auch Boulez und Xenakis. Vielleicht war es mein Schicksal, das Antlitz des Streichquartetts im 20. und 21. Jahrhundert grundsätzlich zu ändern. Meine Rolle als Primarius ist also ein kleines bisschen anders geworden. Ich will aber unserem Quartett nicht jedes neue Stück aufs Auge drücken. Das Repertoire ist lebendig; man muss es aber auch bändigen können. Als Primarius bin ich mehr der Philosoph. Ich werfe einen Blick in jede Partitur. Von meinen Kollegen erwarte ich, dass auch sie sich in Sachen Repertoire Gedanken machen und sich an unseren regen Diskussionen beteiligen. Zusammen schieben wir unser Quartett langsam voran und finden den richtigen Weg.“ (Arditti, siehe oben) Während Irvine Arditti in seinem Quartett eine führende Rolle mit eingeschränkter Dominanz spielt, gehen die beiden anderen nach Donaueschingen eingeladenen Streichquartette von einem demokratischen Grundmodell des gemeinsamen Agierens aus. Sowohl für das JACK Quartet als auch für Quatuor Diotima ist es selbstverständlich, dass keiner, auch nicht einer der beiden Geiger, die Rolle eines Primarius einnimmt. Christopher Otto vom JACK Quartet: „Es gibt zwei identische Instrumente. Aber die Priorität ist, Mitglied eines Quartetts zu sein. Die beiden Geiger müssen einen ausgeglichenen Klang bilden und die Beziehung zwischen uns ist vielleicht etwas heikler als die zwischen Bratsche und Cello. Die Instrumente, die die zwei tieferen Stimmen spielen, gehören natürlich zu einer ganz anderen Familie, zumindest was den Klang angeht. Am wichtigsten aber bleibt der Gesamtbogen, eine Art Dach, das sich über das gesamte Quartett erstreckt.“ (Christopher Otto, Gespräch mit dem Autor vom 26.7.2010) Und Ari Streisfeld: „Ich glaube, dass die Mentalität eines ersten Geigers die eines musikalischen Führers ist. Die Idee kommt mir aber sehr altmodisch vor. Wenn wir die renommierten Streichquartette betrachten, die am Anfang des 20. Jahrhunderts unterwegs waren, fällt auf, dass die Beziehungen innerhalb des Ensembles ganz anders sind als die, die wir heute zu pflegen wissen.“ (Ari Streisfeld, Gespräch mit dem Autor vom 26.7.2010) Homogenität versus Individualität Übereinstimmend bestätigten nahezu alle befragten Komponisten, dass sich soziopsychologische Momente wie selbstverständlich auch in der musikalischen Struktur widerspiegeln. Wenn, wie im Falle von Rebecca Saunders, eine Autorin bislang noch kein Streichquartett in Angriff genommen hat, dann genau aus dem Grund, weil bei ihrem Komponieren sozio-psychologische Aspekte keine Rolle spielen, weil die gesamte 18 musikalische Imaginationskraft ausschließlich auf den Klang ausgerichtet ist. Anders Bernhard Lang. Er erwähnt ausdrücklich, dass man beim Komponieren eines Streichquartetts sehr genau aufführungstechnisch mitdenken muss, „wie dieses Gespräch ausschauen wird. Da sind wir heute fast bei utopischen Ausmaßen angelangt. Das, was das Arditti Quartet heute spielen kann, grenzt schon ans Unerklärliche. Vom Soziologischen her untersucht, werden hier Prozesse dargestellt, ja inszeniert, von denen wir noch nicht wissen, wie sie funktionieren. Ich habe zum wiederholten Male beim Ensemblespiel selbst erlebt, dass es Synchronitäten gibt, die man nicht erklären kann, wie sie funktionieren. Das ist wie eine nichtinszenierte Absprache. Man sitzt neben einer Person, schaut sie nicht an, hört, was sie tut, und ist trotzdem zusammen. Da ist diese merkwürdige Alchemie, wenn man vier hervorragende Musiker und Musikerinnen zusammenspannt. Das Streichquartett ist ein merkwürdiges soziales Phänomen, das nur in einem Wachstumsprozess begriffen werden kann. Da sind vier Psychen, die unter Einsatz ihrer vollen Intellektualität zu einer Zelle zusammenwachsen. Hier entstehen Kommunikationskanäle, von denen wir in der Hirnforschung vielleicht in Zukunft erfahren werden, was da eigentlich passiert. Nur, ich muss es nochmals betonen: ich kann es nicht erklären; dieses nichtdirigierte Zusammenwirken ist ein Rätsel. Und da ist ja auch ein ganz großer Unterschied zum Orchester. Das Orchester, das den Feldwebel immer hat und auch braucht, die Masse, die auch im Negativaspekt zur Masse degradiert wird, diese ist im Streichquartett durch Selbstorganisation ersetzt. Diese macht das Wunder Streichquartett aus. Eine irrationale Maschinerie würde ich es nennen. Ein Zusammenwirken von Zahnrädern, die wir nicht sehen; etwas kaum Erklärbares. Das ist auch nicht mit dem ‚vernünftigen Gespräch‘ erklärbar; das geht über diese diskursive Gesprächskultur weit hinaus. Ich würde sagen, man könnte es mit einem Gespräch zwischen vier vernünftigen Menschen vergleichen, wo der wesentliche Text zwischen den Zeilen passiert oder nicht ausgesprochen wird.“ (Lang, siehe oben) Mathias Spahlinger verweist auf eine ähnliche Genealogie: „Und gleichzeitig wird in solchen Sondergattungen wie dem Streichquartett alles aufgehoben, was von vorher übrig geblieben ist und was ein kultivierter Mensch zu kennen hat: Kontrapunkt und Polyphonie. Und es kommen neue Dinge hinzu, nämlich die durchbrochene Arbeit, die, wenn man den Bogen bis in die Gegenwart spannt, sogar schon implizit die absolut durchbrochene Arbeit enthält, in der die Stimme als Person verschwindet. Also das Streichquartett ist gleichzeitig ein vierstimmiger Satz aus vier Personen, von denen jede gleichberechtigt Substantielles zu spielen hat; zudem kann es gleichzeitig auch ein Solist mit dem Begleitensemble sein. Das bürgerliche Subjekt, die Stimme als Person, setzt sich als Individualist durch und gleichzeitig als Hierarchie – Solo und Begleitung – und gleichzeitig als die eigene Auflösung, die da inhärent schon vorhanden ist: die Selbstauflösung des bürgerlichen Subjekts, das an seiner 19 Eigenanalyse sozusagen zugrunde geht und nicht nur die ganze Musik in lauter einzelne Partikel zerlegt oder in einzelne Stimmen, in einen Text, bei dem man von der Fraktur her unmöglich erkennen kann, wie viele da eigentlich spielen. Es kommt alles gleichzeitig vor: der Solist, die Hierarchie, die Gleichberechtigung, die Verantwortung eines jeden und die Selbstzerknirschung oder die Selbstanalyse, die bis zur Selbstaufhebung führt, sowie die demokratische Vorstellung, dass man auf keinen Einzelnen verzichten kann, dass nämlich jeder einzelne Ton oder jede einzelne Spielweise – man braucht nur an die seriellen Organisationsformen zu denken –, dass das, was eigentlich gebunden ist und nur in seinem Zusammenhang mit anderen wirklich ist, dass der einzelne Parameter, dass dieser ein eigenes Dasein und eine abgesonderte Freiheit gewinnt, all das ist im Quartett angelegt.“ (Spahlinger, siehe oben) Auch Wolfgang Rihm lässt sich vom Dualismus Homogenität/Individualität und dem Fließen der Grenzen zwischen diesen beiden Kategorien, das so nur im Streichquartett anzutreffen ist, begeistern. Im Trio sei dies längst nicht der Fall, und im Quintett findet sich bereits eine andere Konstellation. „Das Streichquartett ist noch ein Individuum, aber auch schon ein Ensemble. Es führt schon ein Gespräch, aber bleibt doch monologisch“, so Wolfgang Rihm und weiter: „Und das dürfte die Faszination darstellen, dass man als Komponist im Moment einen Monolog führt, während man zugleich vielstimmig agiert ... Selbstverständlich hat man im Streichquartett die Möglichkeit, mehrere Beziehungsmodelle durchzuspielen. Man kann zwei Zweierbeziehungen in Kontakt treten lassen und hat die Möglichkeit, sie permissiv zu gestalten, so dass die eine Bezogenheit plötzlich in die andere umkippt, so wie es im Leben auch manchmal ist. Man hat die Möglichkeiten des Einzelnen gegen das klangstärkere Kollektiv, man hat die Möglichkeit von Soli, die gegen- oder miteinander geführt werden und innerhalb des Vierersatzes bis hin zur achtstimmigen Immanation.“ (Rihm, siehe oben) Arnulf Herrmann verweist so wie Mathias Spahlinger auf die Idee von vier gleichberechtigten Stimmen, die es von Anfang an gab, aber erst im 20. Jahrhundert zur vollen Ausprägung kommen konnten. „Das ist die Utopie: Ich habe vier gleichwertige Stimmen, die sich gleichwertig zum Idealbild des harmonischen Satzes verbinden. Die Zahl vier hat ja unendlich viele Bedeutungen, die im Hintergrund immer mitschwingen. Auch das mächtige vier Leuten, die miteinander kommunizieren, vermittelt nicht den Eindruck, hier gäbe es eine führende Stimme. Gewiss, es gibt immer das Problem der zweiten Geige. Aber es ist ja so, dass die zweite Geige in den höheren Lagen als Verdichtungsinstrument nötig ist. Ich glaube, das ist der Ursprung dieser Idee gewesen. Es gibt mithin eine akustische Grundlage, die belegt, dass man die zweite Geigenstimme sehr gut einbauen kann in diesen Satz.“ (Herrmann, siehe oben) 20 Damit wären wir schließlich doch wieder beim Klang, der letztendlich die zentrale Entscheidungskategorie ist. Für Enno Poppe ist beim Komponieren zwar die Vorstellung von handelnden Personen wichtig, „letztendlich ist aber das, was ich hören möchte, entscheidend. Was mich an Streichinstrumenten am meisten interessiert, ist die Möglichkeit, den Ton zu bewegen, weil der Tonort nicht so fixiert ist wie bei anderen Instrumenten – denken wir an das Klavier oder die Holzbläser. Es gibt bei den Streichern zwischen dem festgegriffenen Ton und dem über das gesamte Griffbrett rutschenden Glissando, vom normalen Vibrato bis hin zum komisch eiernden Hin- und Herbewegen eine unfassbare Menge von Möglichkeiten, den Ton zu gestalten. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist die Zwischenstufe zum Beispiel zwischen zwei Tönen und einem Glissando oder zwischen einem Ton und einer Figur – mit Hilfe von einem Glissando kann das wirklich ineinander übergehen. Mit dem Streichinstrument können wir den Grundbaustein der Musik, den Ton, wie bei keinem anderen Instrument in den Fokus rücken.“ (Poppe, siehe oben) In diesem Sinne argumentierten im Grunde alle der befragten Komponisten. Genau das aber wurde im „Atelier Elektronik“ der diesjährigen Darmstädter Ferienkurse in der abschließenden Diskussionsrunde mit Nachdruck in Frage gestellt. Dort behauptete Orm Finnendahl mit Blick auf die Streichquartettkonzerte der Sommerkurse: „Die Konzerte mit dem Arditti Quartet kamen mir ein bisschen ‚oldschool-mäßig‘ vor...Ich habe das Gefühl, dass das (das Streichquartettspiel Anm. des Verf.) historische Aufführungspraxis ist. Ich kenne viele Ensemblekonzerte, wo ich dann denke, ‚mein Gott, das geht mich nichts mehr an‘. Das ist zwar sehr brillant gemacht, aber das ist nicht wirklich ein Diskurs, der mich wirklich noch interessiert ... Es kann ja auch sein, dass die Menschheit sagt: ‚Technologie ist sowieso alles Scheiße‘ und dass man dann Orchesterstücke schreibt. Aber ich habe das Gefühl, dass das ziemlich historisch ist, das ist alles ‚gegessen‘!“(Orm Finnendahl, Diskussionsrunde Darmstädter Ferienkurse 30.7.2010) Diese rührend bilderstürmende Naivität mag gerade angesichts der Tatsache, dass vor 60 Jahren kein geringerer als Karlheinz Stockhausen schon einmal das Ende der akustischen Instrumente heraufbeschwören wollte, belächelt werden. Wie die Realität heute aussieht, muss an dieser Stelle nicht beschrieben werden. Es liegt aber auf der Hand, dass die Gattung „Elektronische Musik“ und die „Königsgattung“ bürgerlicher Musik, das Streichquartett, wie zwei antipodische Pole in der aktuellen Musiklandschaft liegen. Auf der anderen Seite kann nicht übersehen werden, dass sich gegenwärtig eine neue Gattung konstituiert. Deren Instrumentenkombinationen leiten sich nicht mehr – wie bei Ensemblegründungen der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch üblich – aus der Frühzeit der musikalischen Moderne her, wie aus Arnold Schönbergs „Erste Kammersymphonie“ op. 9 oder aus Edgard Varése‘ „Octandre“, sondern basieren in unserer elektrifizierten und digitalisierten Welt auf einem Mix aus elektronischen Instrumenten, allen voran Sampler und Interfaces, akustischen Instrumenten, beherrscht von Klavier, 21 Schlagzeug und Saxophon sowie elektroakustischen Instrumenten wie E-Gitarren oder EGeigen, denen innerhalb dieser Instrumentenkombination eine Brückenfunktion zwischen den unterschiedlichen Medien zukommt. Also, die Konkurrenz wächst. Wir kommen dennoch nicht umhin zu fragen, welchen Stellenwert das Streichquartett zukünftig im Musikleben noch haben wird. Die dreitausend Quartette, die sich allein in der Bibliothek von Irvine Arditti befinden, scheinen, zumindest quantitativ, schon einmal eine deutliche Antwort zu geben. Zumindest für die aktuelle Situation. Sollte diese Kulmination etwa ein Zeichen sein, dass man gerade dabei ist, sich gemütlich einzurichten? Einrichten im Haus der europäischen Musik, das die Väter der Moderne ursprünglich grundsätzlich entrümpeln und auf diese Weise auf neue Füße stellen wollten? Diese Frage kann ein einzelner Jahrgang der Donaueschinger Musiktage gewiss nicht beantworten. Das Festival bietet auch in diesem Jahr einmal mehr als Podium aktuellen Musikdenkens eine Standortbestimmung mit Akzent auf dem Streichquartett. Es stellt auf diese Weise zuförderst Öffentlichkeit her. Zu diesem Zweck wurde unter dem Titel QUARDITTIADE eigens eine spezielle Aufführungssituation für den gesamten zweiten Festivaltag entworfen, bei der drei Streichquartettformationen neue Streichquartette von acht Komponisten aus sieben Nationen vorstellen. Mit dem Arditti Quartet aus London, Quatuor Diotima aus Paris und dem JACK Quartet aus New York wurden drei Streichquartette gewonnen, die drei Generationen und drei unterschiedliche Interpretationskulturen repräsentieren. Auch in den beiden Orchesterkonzerten finden sich dem Thema entsprechende Werke. Streichquartett und Orchester – Introversion und Extraversion, Intimität und Öffentlichkeit: Pascal Dusapin differenziert die beiden erst im 20. Jahrhundert sich annähernden, antipodischen Strategien in seiner Komposition neu aus. Auch Vinko Globokar besetzt in seiner Orchesterkomposition neben zwei Solisten vier solistische Streicher, jedoch nicht im Sinne eines Quartettsatzes, sondern als einen auf vier Spieler reduzierten Streichersatz. An Georg Nussbaumer erging der Auftrag, die Gattung Streichquartett klangkünstlerisch aufzuarbeiten. Eine Kulturpraxis des 19. Jahrhunderts aufgreifend, eröffnet er im Einrichtungshaus Häring mit seinem „Salon Q“ einen Raum mit Installationen und Situationen, die sich mit den Materialien, den Techniken, der Musik des Streichquartetts auseinandersetzen und sich während der gesamten Zeit des Festivals immer wieder zu Aufführungen von Quartetten verdichten.