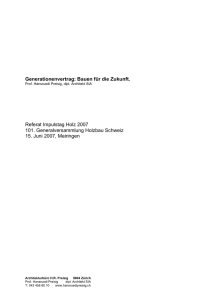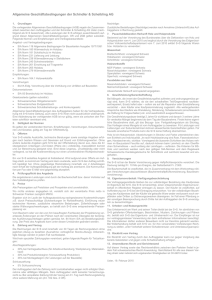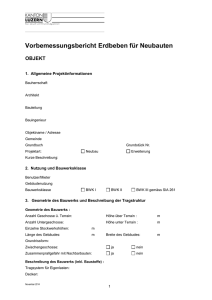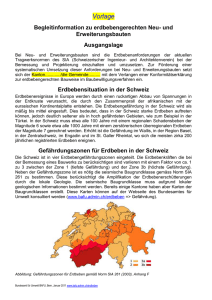Erneuerung - Bundesamt für Energie BFE
Werbung

Peter Schürch | Dieter Schnell Erneuerung Nachhaltiges Weiterbauen Inhalt Weiterbauen im 21. Jahrhundert 3 1. Ziele nachhaltigen Weiterbauens 11 2. Architektonische Wertschätzung 21 3. Analyse 25 4. Planungsprozesse, Strategie und Kommunikation 31 5. Ökonomische Nachhaltigkeit 35 6. Gebäudehülle 41 7. Schallschutz 59 8. Tragwerk 65 9. Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung 73 10. Sicherheit und Brandschutz 81 11. Energiekonzepte 85 12. Gebäudetechnik 93 13. Aussenraum 103 14. Beispiele 109 15. Anhang 139 Impressum Erneuerung – Nachhaltiges Weiter­ bauen Herausgeberin: Fachhochschule Nord­ west­schweiz, Institut Energie am Bau Autoren: Peter Schürch und Dieter Schnell mit Beiträgen von Aleksandar Backovic’, Alfred Breitschmid, Klaus Eichenberger, Urs-Thomas Gerber, Niklaus Hodel, Philippe Lustenberger, Hansruedi Meyer, Heinz Mutzner und Jürg Tschabold. Projektleitung: Fachhochschule Nord­ westschweiz; Institut für Energie am Bau, Muttenz; Armin Binz, Barbara Zehnder Lektorat und Seitenherstellung: Faktor Journalisten AG, Zürich; Othmar Humm, Christine Sidler Diese Publikation ist Teil der Fachbuchreihe «Nachhaltiges Bauen und Erneuern». Grundlage bilden die Zertifikatskurse des Masterstudienganges «Energie und Nach­ haltigkeit am Bau» (www.enbau.ch), ein Weiterbildungsangebot von fünf schwei­ zerischen Fachhochschulen. Die Publika­ tion wurde durch das Bundesamt für Ener­ gie BFE / EnergieSchweiz und die Konfe­ renz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) finanziert. Bezug: Als Download (kostenfrei) unter www.energiewissen.ch oder als Buch beim Faktor Verlag, [email protected] oder www.faktor.ch Oktober 2011. ISBN: 978-3-905711-13-4 Einleitung Weiterbauen im 21. Jahrhundert Dieter Schnell Peter Schürch Weiterbauen war bis zu Beginn des zwan­ zigsten Jahrhunderts eine oft benutzte und als selbstverständlich empfundene Möglichkeit, ein Gebäude zu erweitern oder den veränderten Bedürfnissen anzu­ passen. Zum einen erlaubten die ökono­ mischen Verhältnisse bei neuen Raumbe­ dürfnissen meist nicht den Abbruch und einen Neubau, sondern bloss die Erweite­ rung und Ergänzung, zum andern scheint aber auch das ganz bewusste und gezielte Weiterverwenden von überkommenen Bauten gepflegt worden zu sein. Der revo­ lutionäre Impetus der Modernen Architek­ tur, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden war, liess die Architek­ ten ein Weiterbauen als halbherzig und mutlos empfinden. In der Folge ging die alte Tradition des qualitätsvollen Weiter­ bauens verloren, die Architekten überlie­ ssen das Feld den Baumeistern und Bau­ zeichnern. So kommt es, dass eine Vorge­ hensweise, die einst selbstverständlich auch von namhaften Architekten prakti­ ziert worden ist, heute als anspruchsvolle Aufgabe neu entdeckt werden muss. Durch die Verknappung von wichtigen Ressourcen, durch den Klimawandel, durch gesellschaftliche Trends und neue gesetzliche Vorschriften, aber auch durch steigende Komfortansprüche sind Gebäu­ deeigentümer heute aufgefordert, ihre Bauten vorausschauend zu unterhalten und schrittweise und mit hohen qualitati­ ven Ansprüchen in die Zukunft zu führen. Weiterbauen, so verstanden, ist nicht mehr ein anspruchsloses, von Beginn weg auf fragwürdige Kompromisse angeleg­ tes, notdürftiges Zurechtbiegen eines in die Jahre gekommenen Gebäudes, son­ dern eine grosse Herausforderung, die vom Architekten erstens ein integrales Verständnis für das Bestehende, zweitens die virtuose Beherrschung der aktuellen Techniken und Vorgaben der Nachhaltig­ keit sowie drittens eine hohe Innovations­ bereitschaft abverlangt. Der hohe Grad an Innovation begründet sich erstens durch die sehr hohen Anforderungen an ein nachhaltiges Gebäude, zweitens durch die Einzigartigkeit jeder derartigen Auf­ gabe und drittens durch den hohen ästhe­ tischen Anspruch, dem jedes Konzept des Weiterbauens auch zu genügen hat. Die­ ser Anspruch begründet sich aus der Tat­ sache, dass Bauten, die als unattraktiv oder gar durch spätere Eingriffe beein­ trächtigt erscheinen, nicht nur eine ge­ ringe Wertschätzung geniessen, sondern auch viel rascher wieder als erneuerungs­ bedürftig betrachtet werden. Das Buch versucht einen umfassenden Blick auf das Thema; tagesaktuelle The­ men stehen nicht im Vordergrund. Es ist auch kein Rezeptbuch für den Umgang mit Vorschriften und Standards. Im Zent­ rum steht vielmehr der Blick auf grössere Zusammenhänge. Dazu gehören gleicher­ massen sozio-kulturelle als auch methodi­ sche, ökonomische, ökologische als auch technische und physikalische Fragen, die sowohl in der Ausgangssituation als auch für das geplante Konzept zu stellen sind. Das wichtigste methodische Grundprinzip ist die Teamarbeit. Diese wird nicht nur immer wieder postuliert und als erfolgver­ sprechende Vorgehensweise empfohlen, sondern selbstverständlich auch auf das Buch selber angewandt. Die Projektleiter und Hauptautoren unterrichten seit Jah­ ren gemeinsam Architekturstudierende an der Berner Fachhochschule in Burgdorf. «Gemeinsam» ist insofern wörtlich zu nehmen, als an dieser Schule sehr viel Un­ terricht im Team erteilt wird, was viele in­ terdisziplinäre Gespräche ermöglicht. Auch die meisten beigezogenen Autoren fachspezifischer Kapitel stammen aus dem Umfeld dieser Architekturausbil­ dungsstätte und gehören damit auch au­ sserhalb dieses Buchprojekts zum erwei­ terten Feld interdisziplinärer Zusammen­ arbeit. Für einige Kapitel zeichnen zudem mehrere Autoren, die, stets mit unter­ schiedlichem Fachhintergrund, in enger Zusammenarbeit den Text verfasst haben. 4 Weiterbauen im 21. Jahrhundert Der Aufbau des Buches dokumentiert zum einen das Anliegen, analytische, methodi­ sche und technische Elemente nebenein­ ander zu stellen und gleichgewichtig zu behandeln, zum andern sind die Themen in eine Reihenfolge gebracht, die in etwa die Reihenfolge der auftauchenden Fragen bei einem konkreten Projekt des Weiter­ bauens wiedergibt. Den Anfang machen die Analysen, es folgen die Methoden und danach die technisch-konstruktiven The­ men. Den Abschluss des Buches bilden acht Beispiele, die stellvertretend für häu­ fige Aufgaben stehen und – vielleicht ab­ gesehen von allfälligen kleinen Problemen, die überall auftreten – als positive und glückliche Lösungen bezeichnet werden können. Das Weiterbauen an bestehenden Bau­ werken verlangt mit den aktuellen Zielset­ zungen neue, umfassende Konzepte und angemessene Projekte. Konzepte sollen die nötige Offenheit und Flexibilität auf­ weisen, um zu ei­ nem späteren Zeit­ «Offensichtlich ist das Schlüssel­ punkt auf Verände­ problem der Menschheit in diesem rungen reagieren Jahrhundert, wie man die Lebens­ zu können. Heute qualität verbessern kann, ohne gleich­ sind eine präzise zeitig die Umwelt zu zerstören.» Analyse, eine Wert­ Edward O. Wilson, Biologe schätzung der Bau­ substanz, eine de­ taillierte Diagnose der Bauwerke mit Ein­ bezug der Umgebung und der Aussen­ raumgestaltung gefragt. Daraus sind die wirtschaftlich, gesellschaftlich, energe­ tisch, technisch und architektonisch rele­ vanten Aspekte herauszuarbeiten und neue ganzheitliche, langfristige, vielleicht auch radikale Lösungen zu entwickeln. Dazu sind schlüssige Konzepte – möglichst in Varianten – notwendig, welche die pro­ jektspezifischen Zielsetzungen erfüllen. Bauwerke sollen integral betrachtet, archi­ tektonisch qualitätsvoll und sensibel im Kontext zum Bestehenden, allenfalls durch Weiterentwicklung von traditionellen res­ pektive regionalen Bauweisen, aber immer unter Berücksichtigung gesellschaftlich re­ levanter Aspekte projektiert und realisiert werden. Dieser ganzheitliche Ansatz ver­ langt von Planenden, sich einzulassen auf zusätzliche Kriterien, neue Prozesse, spezi­ fische Rahmenbedingungen und an­ spruchsvolle Teamarbeit. Ein altes Gebäude ist bereits ein differen­ ziertes System, welches auf Veränderun­ gen hochsensibel reagiert. Entsprechend wichtig ist die adäquate, am bestehenden Objekt orientierte Denk- und Planungs­ weise. 5 Gebäudeerneuerung Lösungsstrategien Peter Schürch In erster Linie fordern wir gute, zeitgenös­ sische und qualitätsvolle Architektur, wel­ che städtebauliche, räumliche und archi­ tektonische Kriterien ebenso erfüllt wie die Postulate der Nachhaltigkeit. Die Empfeh­ lung SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau, ergänzt mit vergleichbaren Grundlagen der DGNB oder Leed, zusam­ men mit Zielsetzungen der Auftraggeber oder projektspezifischen Aufgabenstellun­ gen kann als Basis für eine Zieldefinition von Weiterbauprojekten dienen. Die Be­ achtung dieser Kriterien verhindert keines­ wegs «schlechte» Architektur, sondern sie trägt dazu bei, in der Analyse und im Pla­ nungsprozess angewendet, dass die Pro­ jekte in die Tiefe und Breite entwickelt werden und schärfer nachgedacht wird. Die Planenden sind gefordert, ihre Kreati­ vität und Sensibilität gegenüber dem Be­ stehenden einzubringen und aus der Fülle der Anforderungen ein kohärentes über­ zeugendes Projekt zu entwickeln. Das Projekt berücksichtigt zudem die be­ stehenden baulichen, örtlichen, funktio­ nalen und gesellschaftlichen Qualitäten oder Parameter. Architektur schaffen ist auch ein interdisziplinärer Prozess. Identifi­ kationsstiftende, architektonisch wertvolle Zeugnisse unserer Geschichte mit viel­ schichtigen räumlichen Qualitäten sind sorgfältigst umzunutzen. Wissen und Kompetenzen über energieeffiziente Ge­ bäude und Quartiere oder über Städtebau sind genauso einzubringen wie die Fähig­ keit, Mobilität effektiver und emissionsarm zu ermöglichen. Oft finden sich Zusatznut­ zen und Mehrwerte, die über die eigentli­ che Erfüllung der Aufgabe hinausgehen. Planerische Offenheit Konzepte sollen die nötige Offenheit und Flexibilität aufweisen, um permanent auf Veränderungen reagieren zu können. Da­ mit diese geforderten relevanten Leistun­ gen in einem vielleicht überbestimmten System auch in der alltäglichen Weiterbau­ aufgabe erbracht werden können, soll die­ ser gesamtheitlichen Planerkompetenz mehr Wert beigemessen werden. Es lassen sich kaum sämtli­ che Problemstellun­ «Das Weiterbauobjekt ist in erster gen in einem Pro­ Linie im lokalen Kontext zu betrach­ jekt umfassend lö­ ten; dieser Ansatz bewahrt vor sen – ein enormer Architekturmoden und unangemes­ Anspruch an heu­ senen Lösungen. Das Bauen im tige Architektur­ Kontext stellt sich innerhalb freiwilli­ schaffende. Viel­ ger Bindung an die bereits vor­ mehr gilt es, be­ handene Gegebenheit des Ortes wusst Prioritäten zu immer auch die Frage nach der setzen, Rahmenbe­ Ver­änderung sowie der Entwicklung dingungen zu klä­ neuer Bautypen. Topos und Typus ren und einen ge­ waren und sind noch immer die Ur­ wissen Mut zur Lü­ quellen der Architekturform.» cke zu haben. Gion Caminada Ein Projekt oder ein Konzept entwickelt sich aus den vorgege­ benen Zielen und architektonischen Über­ legungen: ]]Wie kann am Gebäude weitergebaut werden, ohne Wertvolles zu zerstören? ]]Alte Gebäude sind Teil unserer Ge­ schichte und Kultur und sollen nicht hinter Dämmschichten verschwinden. ]]Welche Konzepte und Konstruktionen bieten sich für die Gebäudehülle an? ]]Welche räumlichen Eingriffe sind ange­ messen? ]]Tragendes architektonisches Konzept, Idee? ]]Ist ein Ersatzneubau ein möglicher Lö­ sungsansatz? ]]Was sind Prioritäten des Auftraggebers? Eine genaue Analyse und Auswertung der Aufgabenstellung und der zur Verfügung stehenden Ressourcen, eine langfristige Betrachtungsweise sowie die Abschätzung von Chancen und Risiken führen zu klaren Entscheidungsgrundlagen. Heute sind öko­nomische, zukunftsfähige, energieeffi­ ziente und auch ästhetisch überzeugende Weiterbaulösungen gefragt. Empfehlens­ wert sind gut verortete und durchdachte Gesamtkonzepte mit langfristigen Zielset­ zungen, welche modular umgesetzt wer­ den können. 6 Weiterbauen im 21. Jahrhundert Abbildung 1: Die fünf aufgeführten Varianten unter­ scheiden sich in der Eingriffstiefe, von links nach rechts nimmt das Volumen der Massnahmen natürgemäss zu. Varianten des Weiterbauens 1. Pinselrenovation und Mängelbehe­ bung: Tiefe Baukosten, dadurch kurze Amortisationszeiten. Keine Werterhal­ tung, keine langfristige Perspektive. Ge­ samtkonzept nicht notwendig. Aufwand der einzelnen Massnahmen stark be­ schränken. Fazit: Nur sinnvoll, wenn spä­ tere Nutzung unklar. Kurzfristige Lösung nicht ökonomisch, nicht nachhaltig! 2. In Etappen modernisieren: Relativ hohe Baukosten verteilen sich auf die Etappen während mehreren Jahren (bis zu 25 Jahren); Konzept der Modernisierung muss sich auf alle Etappen beziehen. Ein­ zelne Etappen nicht isoliert planen. Die beiden Varianten «in Etappen» und «Ge­ samt» sind in den einzelnen Massnahmen gleichwertig – es gibt keine Alternative zum guten professionellen Bauen. 3. Gesamtmodernisierung: Teure, aber langfristig günstigere Variante, da lange Amortisationszeiten möglich sind. Ge­ samtkonzept Bedingung: Unterstützung durch Architekten und Technikplaner. Die beiden Varianten «in Etappen» und «Ge­ Sanierung: fünf Varianten Entscheid fürs Weiterbauen Analyse Baurechtliches Potenzial Beurteilung Bausubstanz Immaterielle Werte Nutzungspotenzial Wirtschaftliches Potenzial Gebäudetechnik Innenraum 4. Projektspezifische Lösung 5. Ersatzneubau Zielsetzungen Nutzung zukunfts­ fähig Architektonische Idee, Angemessenheit Gebäudehülle Variantenstudien 1. Pinselrenovation 2. In Etappen modernisieren 3. Gesamtmoderni­ sierung Entscheid nachhaltige Kriterien SIA 112/1 Projektierung und Realisierung Erfolgskontrolle 7 Gebäudeerneuerung samt» sind in den einzelnen Massnahmen gleichwertig – es gibt keine Alternative zum guten professionellen Bauen. 4. Projektspezifische Lösung: Transfor­ mation, Anbau, Teilumbau, Modernisie­ rung, etc. Es gilt, ein schlüssiges pro­ jektspezifisches Gesamtkonzept zu entwi­ ckeln, welches aus einer Mischung von verschiedenen Massnahmen besteht. 5. Ersatzneubau: Die Lage auf dem Woh­ nungsmarkt ist langfristig schwer einzu­ schätzen. Die Gesellschaft verändert sich und damit die Ansprüche an den Wohn­ raum. Heute brauchen weniger Leute mehr Wohnfläche und diese soll vielseitig und flexibel genutzt werden können. Wenn der Grundriss eines Ein- oder Mehr­ familienhauses nicht mehr zeitgemäss ist, die Bausubstanz sowie die Anlagen sanie­ rungsbedürftig sind und auch der Schall­ schutz ungenügend ist, macht es Sinn, über einen Neubau nachzudenken. Ein Neubau bietet mehr Spielraum: Einer­ seits kann die Ausnutzung erhöht werden, was zu besseren Erträgen führt. Anderer­ seits schafft man mit modernem Wohn­ raum neue Nachfrage. Dadurch kann ein Quartier aufgewertet und die Siedlungs­ entwicklung positiv beeinflusst werden. Ein Neubau kann auch aus architektoni­ scher Sicht ein Gewinn sein. Welches Weiterbauprojekt? Unterschiedliche Lösungsstrategien als Chance: Die Erarbeitung von unterschied­ lichen Projektansätzen verlangt Rechen­ schaft über kurz-, mittel- und langfristig erforderliche Massnahmen. Dabei gilt es, die Zielsetzungen, die Rahmenbedingun­ gen, die Qualitäten und allfällige Mehr­ werte zu bewerten und zu analysieren. ]]Beizug von Fachleuten ]]Variantenstudien ]]Architektonische Qualität, Atmosphäre, Dichte ]]Machbarkeitsstudien mit Kosten- und Er­ tragsschätzungen ]]Ökonomische Risiken mit einer seriösen Kostenerfassung abschätzen ]]Langfristig tiefer Energieverbrauch, um weitestgehend unabhängig von den Preis­ schwankungen der Energieträger zu sein. ]]Nutzung erneuerbarer Energien ]]Beitrag zur Biodiversität ]]Schlüssiges Wassermanagement (Nut­ zung von Grauwasser, Schmutzwasser, Re­ genwasser) ]]Qualitätsvoller Aussenraum Sonnenkollektoren Photovoltaik Sonnenkollektoren Photovoltaik Sonnenkollektoren Photovoltaik W rmebr cke Photovoltaik Sonnenkollektoren DG OG D mmperimeter OG D mmperimeter Sonnenkollektoren Photovoltaik W rmebr cke DG EG W rmebr cke EG UG UG Sonnenkollektoren Photovoltaik Sonnenkollektoren Photovoltaik Photovoltaik Sonnenkollektoren DG OG EG Dämmperimeter D mmperimeter OG EG UG UG Abbildung 2: Beispiel für ein Vari­ antenstudium. 8 Weiterbauen im 21. Jahrhundert Mögliche Lösungsansätze beschränken sich zukünftig nicht ausschliesslich auf das einzelne Bauwerk, sondern beziehen sich übergreifend auf ein Quartier, eine Sied­ lung oder gar auf eine Region. Dabei sind auch radikale Lösungen anzudenken, die vielleicht von einer starken Peripherie und impulsgebenden Zentren ausgehen, die eine Schweiz der Regionen und damit ihre vielfältige und reiche Baukultur erhält. Den weiter gebauten Werken sollte man anse­ hen, dass umsichtige Personen am Werk waren, die das Vorgefundene behutsam und respektvoll in die Zukunft überführen. Praxisrelevantes: Frühzeitige Kontakt­ aufnahme mit Unternehmern und ande­ ren Fachleuten, um die Bausubstanz zu analysieren, lohnt sich. Unternehmerwis­ sen ist gefragt und soll auch angemessen entschädigt werden. Es gilt, den Prozess und die Rahmenbedin­ gungen immer wieder klug zu hinterfra­ gen: ]]Macht sich langfristiges Denken bezahlt? ]]Die Energiekosten in den nächsten Jahr­ zehnten im Griff? ]]Kann der gewählte Baustoff einfach er­ setzt oder repariert werden? ]]Der Schnittstellenproblematik ist bei Um­ bauten grosse Aufmerksamkeit zu schen­ ken. ]]Bilden die Unterhaltskosten ein Risiko? ]]Höhere Wohnqualität bei gleichzeitig ge­ ringeren CO2-Emissionen? ]]Authentisches Wohnen? ]]Das Gebäude, das Quartier, die Stadt als Kraftwerk – autonom und postfossil? ]]Nachhaltig geplant und qualitätsvolle, gelungene Weiterbauobjekte? ]]Gebäude produzieren die nötige Mobili­ tätsenergie für die Bewohner gleich mit? ]]Integrative Solarpanels als Ausrüstung von Bauten? Ausführungsphase, Realisierung: Diese Phase erfordert grosse Sorgfalt aller Betei­ ligten, gilt es doch, auf die vorhandenen Baukonstruktionen Rücksicht zu nehmen, auf bauliche Überraschungen angemessen zu reagieren sowie im Projektablauf rasch und umsichtig Entscheide zu fällen. Kommunikation: Um die Ziele des zu­ kunftsfähigen Weiterbauens zu erreichen, ist der Kommunikation grosse Beachtung zu schenken. Alle am Prozess Beteiligten, Auftrageber, Planende und Denkmalpfle­ ger, Bauingenieure und Unternehmer soll­ ten den Dialog über die Aufgabenstellung und die Lösungen führen und auch kont­ roverse Diskussionen austragen. Heute fi­ nanzieren, planen und bauen wir die Ge­ bäude, auch für das «postfossile» Zeital­ ter. Langfristige Betrachtungsweisen führen zum Erfolg Bei Investitionen für Sanierungen handelt es sich um Investitionen in die Zukunft. Diese sollen intensiv und transparent dis­ kutiert werden. Erfolgreiche Weiterbau­ planungen sind komplexe Prozesse, bei denen zu Beginn sehr wichtige Entschei­ dungen getroffen und Rahmenbedingun­ gen vereinbart werden. Eine genaue Ana­ lyse und Auswertung der Aufgabenstel­ lung und der zur Verfügung stehenden Ressourcen, eine langfristige Betrach­ tungsweise sowie die Definition der Chan­ cen und Risiken führen zu klaren Entschei­ dungsgrundlagen. Heute sind innovative, kreative gesamt­ heitliche und ästhetisch überzeugende Weiterbau- und Sanierungsstrategien ge­ fragt, um dies zu erreichen sind alle Betei­ ligten in der Bauplanung aufgerufen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Empfehlenswert sind überzeugende Ge­ samtkonzepte, welche verortet und durch­ dacht sind, langfristige Zielsetzungen auf­ weisen und modular umgesetzt werden können. Wichtig ist, die aufgeführten As­ pekte, Kriterien und Systemgrenzen konti­ nuierlich zu hinterfragen und immer wie­ der neu zu schärfen. Die Erarbeitung von unterschiedlichen Projektansätzen ver­ langt Rechenschaft über kurz-, mittel- und langfristig erforderliche Massnahmen. Gebäude als System Alte Gebäude sind hochdifferenzierte Sys­ teme, welche auf Veränderungen sensibel reagieren. Es gilt vieles im Blick zu behal­ ten, gut zu analysieren und Entscheide auf transparenten Kriterien nachhaltigen Bau­ Abbildung 3: Erneuerung der Siedlung Heuried in Zürich von Adrian Streich. (Foto: Roger Frei) 9 Gebäudeerneuerung 10 Weiterbauen im 21. Jahrhundert ens zu begründen. Nachhaltigkeit in der Architektur soll nicht länger eine leere Worthülse bleiben, sondern als ein wichti­ ger Bestandteil der Planungsmethoden konkret umgesetzt werden. Energieeffizi­ enz steht heute im Fokus aller Bauprojekte und ist eine Zielsetzung des ressourcenbe­ wussten Bauens, jedoch wäre es ein gro­ sses Versäumnis, sich ausschliesslich auf diesen Aspekt zu konzentrieren. Architek­ tonische Qualitäten «Die entwerfenden Architekten, die sollen keineswegs sich dem Projektieren im Bestand dem Wärmedämm­ verschreiben, sollten nicht grundsätz­ wahn geopfert wer­lich andere Aufgaben übernehmen den, auf der ande­ als bei einem Neubau. Die Beurteilung ren Seite soll eine des Bestehenden, das Erkennen von vertiefte Auseinan­ wirtschaftlichen, ökologischen und ar­ dersetzung mit dem chitektonisch vertretbaren Verände­ Thema Energieeffi­ rungsmöglichkeiten, die Kenntnis über zienz und Behag­ das Alterungsverhalten von Bautei­ lichkeit Dämmstra­ len, Neugier und Freude am bereits Getegien und kluge bauten wird wichtig. Gesucht sind Energiekonzepte deshalb entwerfende Architektinnen, ein­schliessen. die autonom und flexibel in der Lage Das Wissen und die sind, Erneuerungskonzepte zu entwiKompetenzen über ckeln und die Ergebnisse den Bestel­ energieeffiziente lern erfolgreich zu kommunizieren. Die­Gebäude, Quartiere se Arbeit kann in einem kleinen Team oder Städtebau – in dem ein Generalist eine zentrale sind genauso vor­ Rolle spielt – erfolgreich abgewickelt handen wie die Fä­ werden.» higkeit, die Mobili­ Jürg Gredig, Martin Halter, Urs Hettich, tät effektiver und Niklaus Kohler emissionsarm zu er­ möglichen. Heute finanzieren, planen und bauen wir die Ge­ bäude für das «nachfossile» Zeitalter. Denn die grossen Zeiträume, die für un­ sere gebaute Umwelt üblicherweise gel­ ten, erlauben kein Zuwarten. Ökonomie Rückkoppelung durch Kostenerfassung und ein Überprüfen der Angemessenheit gehört zum nachhaltigen Bauen. Damit diese geforderten relevanten Leistungen in einem – vielleicht überbestimmten – Sys­ tem auch in der alltäglichen Weiterbau­ aufgabe (lowend segement) erbracht wer­ den, soll dieser gesamtheitlichen Planer­ kompetenz mehr Wert beigemessen wer­ den. Leistung soll ihren Preis haben dürfen. Kulturelle Leistung und ästhetische Qualität Das Dazwischen und Undefinierte, das Un­ bewusste und Wahrgenommene gibt der Architektur ihren Gehalt. Letztlich sollen auch Weiterbauprojekte mit einer hohen gestalterischen Qualität überzeugen. Um dies zu erreichen, ist eine bessere Kommu­ nikation unter all den am Bauprozess Be­ teiligten und eine konkrete, forschere Um­ setzung des vorhandenen Know-hows über energieeffizientes Bauen – ohne Ab­ striche bei der architektonischen Qualität – zu wünschen. Mögliche Lösungsansätze beschränken sich nicht ausschliesslich auf das einzelne Bauwerk, sondern betreffen ein Quartier oder eine Siedlung, mitunter eine ganze Region. Dabei sind auch radi­ kale Lösungen anzudenken, die vielleicht von einer starken Peripherie und impulsge­ benden Zentren ausgehen, die eine Schweiz der Regionen entstehen lassen, welche unsere bauliche Verortung stärkt, Innovationen aufnimmt und sensibler mit der Ressource Raum umgeht. Anstelle von Konkurrenz unter den Gemeinden um Steuergelder – koste es, was es wolle – braucht es eine tragfähige und konstruk­ tive Kooperation. Unsere überbordende Mobilität und der damit verbundene Land­ verschleiss kann nur durch eine Raumpla­ nung gestoppt werden, welche Einzelinte­ ressen vor dem Blick fürs Gesamte zurück­ nimmt. Konzepte sollen die nötige Offen­ heit und Flexibilität aufweisen, um perma­ nent auf Veränderungen reagieren zu können. Kapitel 1 Ziele nachhaltigen Weiterbauens Alfred Breit­ schmid Dieter Schnell Peter Schürch Unter «Weiterbauen» wird ein evolutionä­ rer Entwurfsansatz verstanden, bei dem das Vorhandene den Ausgangspunkt bil­ det. Das Ziel ist eine Gebäudetransforma­ tion zu neuem, zukunftsgerichtetem Ge­ brauch, die ihre Entstehung aus dem Be­ stehenden weder leugnet noch inszeniert, sondern als Faktum akzeptiert. «Weiter­ bauen» so verstanden, meint eine Archi­ tektur, die sich nicht in radikalen und kom­ promisslosen Lösungen gefällt, sondern eine kontinuierliche, mitunter auch un­ spektakuläre Transformation unserer ge­ bauten Umwelt anstrebt. Das hoch ge­ steckte Ziel muss dabei sein, den Baube­ stand so zu verbessern, dass er unter Wah­ rung seiner wertvollen Eigenschaften den neuen Bedürfnissen adäquat angepasst und den aktuellen ökologischen, ökono­ mischen und sozialen Herausforderungen gewachsen ist. Feinfühliges Erkennen und Weiterentwickeln des Bestehenden ist da­ bei die eigentliche Herausforderung. Zwi­ schen den beiden Polen Totalabbruch und Konservierung des Bestehenden liegen un­ endlich viele Abstufungen und damit Handlungsmöglichkeiten. Die beiden Pole werden hier keineswegs gewertet: Sowohl der Abbruch als auch die Konservierung können je nach Situation genauso sinnvoll sein wie alle erdenklichen Stufen dazwi­ schen. Es gibt kein für jeden Einzelfall rich­ tiges, es gibt nur ein der jeweiligen Situa­ tion angemessenes Weiterbauen. Die Ziele nachhaltigen Weiterbauens wer­ den in enger Anlehnung an die Empfeh­ lung SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen – Hochbau» definiert. In leichter Abwei­ chung von der Vorlage sind die drei Berei­ che «Gesellschaft», «Wirtschaft» und «Umwelt» in je vier Handlungsfelder un­ terteilt, womit eine Tabelle mit zwölf Un­ terteilungen entsteht (Tabelle 1). Primär für den Neubau entwickelt, eröffnen sich Abbildung 4: Das Objekt aus der Beundenfeldstrasse in Bern von Corne­ lius Morscher Archi­ tekten Bern. (Foto: Dominique Uldry) 12 Ziele nachhaltigen Weiterbauens unter dem Gesichtspunkt des Weiterbau­ ens gewisse Akzentverschiebungen, die hier zur Sprache kommen. Gesellschaft Gemeinschaft: Altbauten sind oder wa­ ren bereits Teil eines sozialen Gefüges; Menschen wohnten oder arbeiteten bis unmittelbar vor dem Umbau hier. Die Be­ wohner des Quartiers kennen das Ge­ bäude und verbinden mit ihm gewisse Be­ deutungen und Stimmungen. Dies alles gilt es zunächst wahrzunehmen, um be­ wusst und gezielt darauf zu reagieren. Ein Umbau ist immer auch für die Nachbarn ein emotionales Ereignis. Gute Kommuni­ kation und Partizipation schaffen die nö­ tige Akzeptanz. Gestaltung: Altbauten sind Teil des Orts-, Quartiers- und Strassenbildes. Ihre Ästhe­ tik stammt aus anderer Zeit und strahlt eine entsprechende Atmosphäre aus. Ge­ nauso wie eine Modeberaterin das Alter, die Haar- und Augenfarbe, die Figur und den Stil der zu beratenden Person berück­ sichtigen muss, um ein gutes Resultat zu Abbildung 5: Saniertes Einfamili­ enhaus in Zolli­ kofen von Halle 58 Architekten, Bern. (Foto: Christine Blaser) Bereich Handlungsfeld Kriterien Gesellschaft (sozial) Gemeinschaft Integration, Durchmischung, soziale Kontakte, Solidarität, Ge­ rechtigkeit, Partizipation Gestaltung Räumliche Identität, Wiedererkennung, individuelle Gestaltung Nutzung und Er­ schliessung Grundversorgung, Nutzungsmix, öffentlicher Verkehr, Zugänglich­ keit, Nutzbarkeit Wohlbefinden und Gesundheit Sicherheit, Licht, Raumluft, Strahlung, sommerlicher Wärme­ schutz, Lärm, Erschütterung Gebäudesubstanz Standort, Gebäudestruktur, Ausbau, Flexibilität neue und beste­ hende Bausubstanz*, Weiterbauen* Anlagekosten Lebenszykluskosten, Investitionen, Finanzierung, externe Kosten, Rückbau Betriebs- und Unter­ haltskosten Betrieb und Instandhaltung, Vermarktung, Umnutzungsinvestitio­ nen* Wertschöpfung und Immobilienmarkt* Mehrwert für Gebäude*, Quartier und Siedlung*, Erträge*, Abschöpfung von Förderbeiträgen* Baustoffe Rohstoffe, Verfügbarkeit, Umweltbelastung, Schadstoffe, Rückbau Betriebsenergie Wärme (Kälte) für Raumklima, Wärme für Warmwasser, Elektrizität, Deckung Energiebedarf Boden und Land­ schaft Grundstückfläche, Freianlagen, Aussenraumgestaltung Infrastruktur Mobilität, Abfälle aus Betrieb und Nutzung, Wasser Wirtschaft (ökonomisch) Tabelle 1: Nachhaltigkeit mit drei Bereichen und zwölf Handlungsfel­ dern sowie bewer­ tungsrelevanten Kriterien (Quelle: SIA 112/1). * nicht Teil der SIA 112/1, Ergänzung der Autoren erzielen, muss der Architekt auf die bereits vorhandene Ästhetik eines Altbaus einge­ hen. Einem in die Jahre gekommenen Ge­ bäude die «eigene» Ästhetik aufzuzwin­ gen ist genauso unpassend, wie einer hochbetagten Dame hautenge Stöckel­ stiefel zu empfehlen. Beim Weiterbauen geht es vielmehr darum, die vorhandenen Qualitäten zu stärken, im Nebeneinander von Alt und Neu eine interessante Harmo­ nie zu erreichen, die das Alte weder be­ drängt oder gar zerstört noch inszeniert und vorführt, sondern als immer schon Vorhandenes wie selbstverständlich ak­ zeptiert. Nutzung und Erschliessung: Altbauten eröffnen nicht nur zahlreiche Möglichkei­ ten neuer Nutzungen, sie schränken auch ein. Nicht jeder Altbau eignet sich für jede Neunutzung. Womöglich widersetzen sich auch der Standort, das Quartier oder die Erschliessungssituation gewissen Nut­ zungsabsichten. Sehr häufig kommt es vor, dass einem Altbau zu viel Nutzraum abgerungen werden soll (mehrstöckige Unterkellerungen, Dachausbauten usw.). Umwelt (ökologisch) 13 Gebäudeerneuerung 14 Ziele nachhaltigen Weiterbauens Altbauten haben nicht nur ein Nutzungs­ potenzial, sie konfrontieren uns auch mit den Lebensgewohnheiten älterer Genera­ tionen: In den vergangenen vierzig Jahren hat sich in der Schweiz der Flächenbedarf an Wohnraum pro Person nahezu verdop­ pelt. Dass diese Entwicklung einer ökologi­ schen Nachhaltigkeit widerspricht, ver­ steht sich von selbst. Es wäre wünschens­ wert, wenn uns Altbauten lehrten, auf gewisse Maximalforderungen zu verzich­ ten. Weiterbauen-Projekte gelingen dann am besten, wenn die neue Nutzung mög­ lichst zwanglos in die alte Situation einge­ fügt werden kann. Wohlbefinden und Gesundheit: Alte Bauten und Räume strahlen eine beson­ dere Atmosphäre aus, die von vielen Men­ schen als angenehm empfunden wird. Diese Atmosphäre gilt es als Qualität zu stärken. Bei Wohnbauten ist es heute üb­ lich, Trennwände zu entfernen, um grosse, als zeitgemäss empfundene Raumeinhei­ ten zu schaffen. Mit Sicherheit wird dabei die alte Raumatmosphäre zerstört, ohne dass in jedem Fall etwas Gleichwertiges entsteht. In Bezug auf die Gesundheit ha­ ben Altbauten den Vorteil, dass allfällige Lösungsmittel und andere Giftstoffe längst verdampft und verschwunden sind. Prob­ lematisch sind jedoch Asbest, Feuchtigkeit und Schimmel. Für alle drei braucht es frühzeitig Sanierungskonzepte. Wirtschaft Gebäudesubstanz: Nachhaltiges Weiter­ bauen führt Altbauten insofern in eine wirtschaftlich sichere Zukunft, als das Ge­ bäude für längere Zeit den Anforderungen wieder gewachsen ist. Wichtig ist, dass in der Projektierung bereits die nächsten Er­ neuerungen mit bedacht werden. Der Ein­ bau reversibler Elemente, leicht auswech­ selbarer Verschleissteile oder anpassungs­ fähiger Oberflächen wird für längere Zeit einen tiefen und damit kostenintensiven Eingriff vermeiden helfen. Anlagekosten: Bei der Sanierung eines Altbaus sind die voraussichtlichen Erstel­ lungs- und auch die Lebenszykluskosten bis auf Einzelteile genau zu berechnen, da gewisse Massnahmen, die womöglich gar nicht zwingend notwendig sind, sehr hohe Kosten verursachen können. So sind bei­ spielsweise Dachausbauten in der Regel sehr teuer und stehen für sich berechnet in keinem sinnvollen Verhältnis zur Nutzbar­ keit oder zum zu erwartenden Mietertrag. Möglichst exakte Kostenprognosen erlau­ ben in der Planung, statt einer Maximie­ rungs- eine Optimierungsstrategie einzu­ schlagen, was im Resultat sowohl baulich als auch finanziell grosse Unterschiede zei­ tigen kann. Betriebs- und Unterhaltskosten: Histori­ sche Baumaterialien sind relativ unter­ haltsintensiv. Je früher ein Schaden ent­ deckt und behoben werden kann, desto geringer ist der Schaden und somit die Re­ paraturkosten. Eine Optimierung der Be­ triebs- und Unterhaltskosten beinhaltet deshalb ein sorgfältiges Unterhaltskon­ zept. Wertschöpfung und Immobilienmarkt: Die atmosphärischen Qualitäten eines Alt­ baus sind durchaus auch von ökonomi­ scher Relevanz. Historisches Cachet ist ein nicht vermehrbares Gut und geniesst da­ her auf dem Markt einen ideellen Wert. Wenn es gelingt, einem historischen Ge­ bäude seine Einzigartigkeit zu wahren, so werden sich auch Liebhaber finden, die ei­ nen Aufpreis zu zahlen bereit sind. Wie der Antiquitätenhandel als auch die immer zahlreicheren Flohmärkte und SecondHand-Börsen beweisen, ist das Interesse an alten Gütern seit Jahrzehnten stark stei­ gend und es gibt keine Hinweise darauf, dass der Trend demnächst rückläufig sein könnte. Umwelt Baustoffe: Altbauten haben Systemcha­ rakter, das heisst, die Baustoffe sind genau aufeinander bezogen und ergänzen sich in ihren Eigenschaften zumeist optimal. Bei der Wahl von neuen Baustoffen ist dem­ nach vom Vorhandenen auszugehen. Da­ bei ist zu beachten, dass die neuen Stoffe die alten weder schädigen (Beton entzieht beispielsweise altem Kalkmörtel verschie­ dene Salze und zerstört ihn damit länger­ fristig) noch einer Mehrbelastung ausset­ zen (Gewicht, Feuchtigkeitshaushalt usw.). 15 Gebäudeerneuerung Gemeinschaft ft ha lsc sel Ge we lt Infrastruktur Boden, Natur Landschaft Um Gestaltung 2 4 6 Nutzung, Erschliessung 8 10 Betriebsenergie Wohlbefinden, Gesundheit Baustoffe Wertschöpfung, Immobilienmarkt* Gebäude- und Bausubstanz Betriebs- und Unterhaltskosten Anlagekosten Wirtschaft Boden, Natur Landschaft Gestaltung 2 4 6 8 Nutzung, Erschliessung 10 Betriebsenergie aft h lsc sel Um Gemeinschaft Ge we lt Infrastruktur Wohlbefinden, Gesundheit Baustoffe Wertschöpfung, Immobilienmarkt* Gebäude- und Bausubstanz Betriebs- und Unterhaltskosten Anlagekosten Wirtschaft Abbildung 6: Die einfache Nachhaltigkeits­ rosette mit den drei Bereichen «Gesell­ schaft», «Wirtschaft», «Umwelt» und je­ weils vier Handlungsfeldern. Die Punktvergabe (Minimum 0, Maximum 10 Punkte) erfolgt aufgrund der Einschät­ zungen von konkreten Kriterien (Tabelle 1). Damit eine anspruchsvolle Umsetzung von Zielen der Nachhaltigkeit gelingt, müs­ sen in allen drei Bereichen gute Resultate erzielt werden. Bei der Unterschreitung der Qualitätsgrenze Nachhaltigkeit (4 Punkte) besteht Handlungsbedarf. In Er­ gänzung der Empfehlungen von SIA 112/1 wurden zwölf Handlungsfelder (je 4 pro Bereich) mit entsprechenden Kriterien fest­ gelegt (Tabelle 1). Dabei wurden neu das Handlungsfeld «Wertschöpfung und Im­ mobilienmarkt» im Bereich Wirtschaft ein­ geführt und neue Kriterien für die Berück­ sichtigung von Themen im Weiterbauen und in der Erneuerung bestimmt. * nicht Teil der SIA 112/1, Ergänzung der Autoren (Quelle: SIA112/1, mit ergänzten Kriterien). Abbildung 7: Die doppelte Nachhaltigkeits­ rosette für die Beurteilung eines Projektes vor und nach dem Eingriff. Basierend auf der Ausgangssituation (gelbe Fläche) wer­ den Verbesserungen (grüne Fläche) oder Verschlechterungen (rote Fläche) ausge­ wiesen. * nicht Teil der SIA 112/1, Ergänzung der Autoren (Quelle: SIA112/1, mit ergänzten Kriterien) Gesellschaft ]]Gemeinschaft ]]Gestaltung ]]Nutzung, Erschliessung ]]Wohlbefinden, Gesundheit Wirtschaft ]]Gebäude- und Bausubstanz ]]Anlagekosten ]]Betriebs- und Unterhaltskosten ]]Wertschöpfung, Immobilienmarkt Umwelt ]]Baustoffe ]]Betriebsenergie ]]Boden, Natur, Landschaft ]]Infrastruktur 16 Ziele nachhaltigen Weiterbauens Da das Langzeitverhalten neuester Bau­ stoffe meist wenig bekannt ist, kann als Faustregel gelten, dass im Zweifelsfall die traditionellen Materialien den neuesten Produkten vorzuziehen sind. Betriebsenergie: Die Optimierung von Haustechnikanlagen und damit der Be­ triebsenergie kann beim Altbau nicht nach denselben Standards erfolgen wie beim Neubau. Grosse Auswirkungen auf die Be­ triebsenergie haben die stets steigenden Komfortansprüche an Innenräume. Wäh­ rend bei einem Neubau in der Regel sämt­ liche Räume auf denselben technischen Stand gebracht werden, ist diese Gleich­ behandlung beim Altbau keineswegs zwingend. Vielmehr kann ein sehr diffe­ renziertes Ausbaukonzept, bei dem nicht alle Räume gleich warm beheizt, nicht alle belüftet oder gekühlt werden, die Betrieb­ senergie massiv reduzieren. Altbauten wurden nicht im Hinblick auf die heutigen technischen Möglichkeiten gebaut. Zu hohe Dämmwerte können beispielsweise den Feuchtigkeitshaushalt eines Altbaus vollständig verändern und dabei grosse Probleme bis hin zu Fäulnis an Holzteilen und Schimmelbildungen verursachen. Boden und Landschaft: Altbauten haben bereits eine Umgebungsgestaltung. Auch hier gilt der Grundsatz, dass das Vorhan­ dene als Ausgangspunkt der Planungs­ überlegungen zu betrachten ist. Im Ideal­ fall geht das bereits Vorhandene gestärkt aus der Umgestaltung hervor. Im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung des Bodens ist grundsätzlich bei Altbausanierungen eine Mehrnutzung zu begrüssen. Dabei sollte diese höhere Nutzung das Gebäude nicht überfordern, sondern im Zweifelsfall durch einen An- oder Zubau umgesetzt werden. Der Aussenraum verliert bei der Verdichtung an Boden, kann aber bei sorgfältiger Gestaltung an Qualität gewin­ nen. Infrastruktur: Wie bereits unter Punkt «Nutzung und Erschliessung» aufgeführt, so sind auch Infrastrukturfragen bereits bei der Wahl der neuen Nutzung in Be­ tracht zu ziehen. Gerade Fragen der Mobi­ lität können wesentliche Argumente für oder gegen eine Neunutzung darstellen. Die Nachhaltigkeitsrosette Damit eine ganzheitliche, nachhaltige Ar­ chitektur gelingt, müssen in allen Berei­ chen der Gesellschaft (sozial), der Wirt­ schaft (ökonomisch) und der Umwelt (ökologisch) gute Umsetzungen erzielt werden. Mit der an der Berner Fachhoch­ schule entwickelten Nachhaltigkeitsro­ sette können diese bewertet, grafisch dar­ gestellt und diskutiert werden (Abbildung 6). Für jedes Handlungsfeld erfolgt eine subjektive Bewertung von 0 (Minimum) bis 10 Punkten (Maximum) auf der Basis der aufgeführten Kriterien. Damit die kon­ krete qualitative oder quantitative Bewer­ tung nachvollziehbar ist, muss die Ein­ schätzung der einzelnen Kriterien begrün­ det werden. Dies ist mit einem Würdi­ gungstext oder mit einer entsprechenden Tabelle möglich. Ein nachhaltiges Projekt wird mit einer ausgeglichenen Nachhaltig­ keitsrosette in einem Zwölfeck grafisch ausgewiesen. Die Nachhaltigkeitsrosette ist kein objektives Labelinstrument, son­ dern ein didaktisches Instrument für die Darstellung der Selbsteinschätzung von Anstrengungen in der Umsetzung der nachhaltigen Aspekte eines geplanten oder ausgeführten Projektes. Mit zuneh­ mendem Wissen über die einzelnen Krite­ rien gelingt eine sinnvolle Diskussion zur Optimierung einer ganzheitlichen, nach­ haltigen Architektur und Siedlungsent­ wicklung. Die Nachhaltigkeitsrosette kann auch eingesetzt werden für die Diskussion und die Abwägung von verschiedenen Va­ rianten desselben Projektes. Die doppelte Nachhaltigkeitsrosette Für die Beurteilung und die Diskussion ei­ ner Erneuerung im Weiterbauen kann die doppelte Nachhaltigkeitsrosette einge­ setzt werden (Abbildung 7), mit der Wür­ digung des Projektes vor und nach dem Eingriff. Es ist klar, dass mit dem Projekt­ vorschlag eine Verbesserung der beste­ henden Situation angestrebt werden muss, was in der doppelten Nachhaltig­ keitsrosette sichtbar wird. 17 Gebäudeerneuerung Philippe Lustenberger Nachhaltigkeit ist bewertbar Nachfolgend werden einzelne Beispiele aufgeführt, welche Handlungsfelder die Nachhaltigkeit einer Immobilie beeinflusst und wie die Kriterien dargestellt werden können. Diese Handlungsfelder bilden auch eine Basis zur Bewertung der Nach­ haltigkeit, wie dies im Kapitel 1 «Ziele nachhaltigen Weiterbauens» erläutert wird. Unter anderem werden die Hand­ lungsfelder in der Norm SIA 112/1, Nach­ haltiges Bauen – Hochbau, beschrieben. Die Handlungsfelder der Nachhaltigkeit, wie sie im Kapitel 1 dargestellt werden, haben gegenüber der SIA 112/1 Ergän­ zungen erfahren. Eine gesamtheitliche Be­ trachtung der Nachhaltigkeit ist in der Pla­ nung, in der Erstellung und im Betrieb ei­ ner Immobilie absolute Pflicht. Beispiel 1: Bereich Gesellschaft, Hand­lungsfeld Nutzung, Erschliessung, Kriterium Grundversorgung, am Beispiel des Wohnflächenbedarfs, des demografischen Wandels und der zukünftigen Bevölkerungszunahme in der Schweiz. Bezüge bestehen unter anderem zu fol­ genden Kapitel: ]]Kapitel 4 «Planungsprozesse, Strategie und Kommunikation» ]]Kapitel 5 «Ökonomische Nachhaltigkeit» ]]Kapitel 7 «Schallschutz» Gemäss dem Bundesamt für Raument­ wicklung (ARE) stieg der Wohnflächenbe­ darf in den letzten Jahrzenten kontinuier­ lich an. Lag der Wohnflächenbedarf im Jahre 1980 bei 34 m2 pro Person, ist dieser auf 48 m2 pro Person im Jahre 2007 ge­ stiegen. Die Prognosen des ARE gehen da­ von aus, dass im Jahr 2030 ein Wohnflä­ chenbedarf von 55 m2 pro Person besteht. Das Bundesamt für Statistik prognostiziert, dass die Bevölkerung in der Schweiz von rund 7,8 Mio. Einwohner Im Jahr 2010 auf 8,8 Mio. Einwohner im Jahr 2035 anstei­ gen wird. Das entspricht einer Zunahme von 12,5 %. Werden die einzelnen Teil­ räume betrachtet, steigen die Bevölke­ rungszahlen unterschiedlich: am stärksten betroffen werden demnach die Kantone Waadt, Freiburg, Aargau, Genf, Obwal­ den, Luzern, Thurgau und Zürich sein, in welchen die Bevölkerung um 15 bis 25 Prozent zunimmt. Werden die sich verän­ dernden Qualitätsansprüche aufgrund des demografischen Wandels (Altersaufbau, Steigerung des Wohlstandes, vermehrt Einzelhaushalte, usw.) berücksichtigt, ist zu erwarten, dass sich die Ansprüche ans Wohnen und an die Raumplanung weiter wandeln werden. Zuwachs in % 40 35 Wohnfläche pro Person + 34% Siedlungsfläche + 25% Bevölkerung + 18% 30 25 20 15 10 5 0 1983 1995 Jahr 2007 Abbildung 8: Vergleich Wachs­ tum von Bevölke­ rung, Siedlungsflä­ che und Wohnflä­ che pro Person in Prozent. (Quelle: ARE, 2011) 18 Ziele nachhaltigen Weiterbauens Abbildung 9: Lebensdauer und Systemtrennung des Primärsystems Abbildung 10: Lebensdauer und Systemtrennung des Sekundärsystems F unktions tüchtigkeit Abbildung 11: Lebensdauer und Systemtrennung des Tertiärsystems Beispiel 2: Bereich Wirtschaft, Handlungsfeld Gebäude-Bausubstanz, Kriterium Gebäudestruktur am Beispiel der Systemtrennung des Kantons Bern. Bezüge bestehen unter anderem zu fol­ genden Kapitel: ]]Kapitel 8 «Tragwerk» ]]Kapitel 9 «Altlasten, Bauschadstoffe und Materialkonzepte» Systemstufendefinition: «Bauteiltren­ nung» definiert die Trennung von Bauele­ menten unterschiedlicher Lebens- und Nutzungsdauer. Allzu oft werden kurzle­ bige Bauelemente fest mit langlebigen Erstellung Betrieb 1 2 0 20 Erneuerung verbunden, so dass die Lebensdauer des Ganzen auf die kurzlebigen Teile reduziert wird (z. B. einbetonierte Leitungen). Das Ziel muss sein, Bauteile von unterschiedli­ cher technischer und betrieblicher Funkti­ onstüchtigkeit in der Planung und Realisie­ rung konsequent voneinander zu trennen. Der Austausch einzelner Komponenten kann erfolgen, ohne dass funktionstüch­ tige Teile zerstört werden müssen. Dies si­ chert den Gebrauchswert für die Zukunft. Die Bauteiltrennung erfolgt in den drei Systemstufen Primär-, Sekundär- und Terti­ ärsystem. Betrieb 3 40 Abbruch 5 Phasen 4 60 80 F unktions tüchtigkeit Jahre Erstellung Betrieb 1 2 0 20 Erneuerung Betrieb 3 40 Abbruch 5 Phasen 4 60 80 F unktions tüchtigkeit Jahre Erstellung Betrieb 1 2 0 20 Erneuerung Betrieb 3 40 Abbruch 5 Phasen 4 60 80 Jahre 19 Gebäudeerneuerung Primärsystem Das Primärsystem ist eine langfristige In­ vestition (50 bis 100 Jahre) und versteht sich als unveränderbarer Rahmen des Se­ kundärsystems. Es umfasst im Wesentli­ chen: ]]die Tragkonstruktion (horizontales und vertikales Raster) ]]die Gebäudehülle (Fassade und Dach) ]]die äussere Erschliessung (Arealerschlie­ ssung) ]]die innere Erschliessung (Haupterschlie­ ssung horizontal und vertikal) ]]die Grundstruktur der Haustechnik (Kon­ zept der technischen Erschliessung hori­ zontal und vertikal, Standort der Technik­ räume) Sekundärsystem Das Sekundärsystem stellt eine mittelfris­ tige Investition (15 bis 50 Jahre) dar und sollte über einen hohen Variabilitätsgrad verfügen. Es ist anpassbar und enthält in erster Linie die Elemente: ]]Innenausbau (Wände, Böden, Decken) ]]haustechnische Installationen ]]Beleuchtung, Sicherheitsinstallationen, Kommunikationsmittel Tertiärsystem Das Tertiärsystem ist eine kurzfristige In­ vestition (5 bis 15 Jahre) und ohne grö­ ssere bauliche Massnahmen veränderbar. Zum Tertiärsystem zählen vor allem: ]]die Einrichtung und das Mobiliar ]]die Apparate (inklusive ihrer Anschlüsse ab dem Sekundärsystem) ]]die EDV-Verkabelung Beispiel 3: Bereich Umwelt, Handlungsfeld Baustoffe, Kriterium Umweltbelastung, am Beispiel der Ökobilanz Bezüge bestehen unter anderem zu fol­ gen­den Kapitel: ]]Kapitel 5 «Ökonomische Nachhaltigkeit» ]]Kapitel 9 «Altlasten, Bauschadstoffe und Materialkonzepte» ]]Kapitel 11 «Energiekonzepte» ]]Kapitel 12 «Gebäudetechnik» Ökobilanzdaten basieren auf branchenbe­ zogenen Stoff- und Energieflüssen, wel­ che bezüglich ihrer Umweltrelevanz be­ wertet werden. In der Empfehlung des KBOB (Koordinationskonferenz der Bauund Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) erfolgt die Gesamtbewertung mit der Methode der ökologischen Knapp­ heit und wird in Umweltbelastungspunk­ ten (UBP) ausgedrückt [KBOB/ IPB, 2009]. Die Methode erlaubt eine Abwägung zwi­ schen: ]]einerseits einem Vergleich zwischen un­ terschiedlichen Konstruktionsarten sowie ]]andererseits einem Vergleich von Ab­ bruch oder Erhalt von bestehender Bau­ substanz und damit bereits eingebundener oder neuer Umweltbelastung. Wird die Berechnungsmethode der Um­ weltbelastungspunkte als Entscheidungs­ grundlage zwischen Abbruch oder Erhalt bestehender Bausubstanz angewandt, muss auch der Effizienzgewinn zwischen alter und neuer Baustruktur berücksichtigt werden, welche sich positiv oder negativ auf die Betriebskosten in der Nutzungs­ phase der Immobilie auswirken. Quellen ]]AGG Bern, Richtlinien Systemtrennung, 2009: Richtlinie Systemtrennung, Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, 2009 ]]AGG Bern, Broschüre Systemtrennung, 2006: Broschüre Systemtrennung, Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, 2006 ]]ARE, 2011: Bundesamt für Raument­ wicklung, Wohnflächenbedarf, Stand vom 13. April 2011, www.are.admin.ch/doku­ mentation/01378/04315/index.html ]]BfS, 2011: Bundesamt für Statistik, Zu­ künftige Bevölkerungsentwicklung, Stand vom 13. April 2011, www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/de/index/themen/01/03.html ]]KBOB/ IPB, 2009: Empfehlung, Ökobi­ lanzdaten im Baubereich, 2009/1, KBOB/ IPB, Stand Januar 2011, www.bbl.admin. ch/kbob/00493/00495/index.html ]]SIA 112/1, 2005: Nachhaltiges Bauen – Hochbau, Ergänzungen zum Leistungsmo­ dell 112, SIA Zürich, 2005 ]]Merkblatt SIA 2040: Effizienzpfad Ener­ gie, Zürich, 2011 Kapitel 2 Architektonische Wertschätzung Dieter Schnell Historische Bauten bereichern unser Le­ bensumfeld. Vor dem Reichtum gewach­ sener Siedlungen mit ihrer Vielfalt an Strukturen, Formen, Materialien und Far­ ben, mit ihren Brüchen und Zäsuren muss jede Neubausiedlung zurückstehen. Versu­ chen Architekten ihre Neubauten ähnlich abwechslungsreich zu gestalten, wirken die Resultate stets unecht, der Reichtum aufgesetzt und erzwungen. Das Geheim­ nis liegt darin, dass der Reichtum histori­ scher Strukturen von den Erbauern nicht beabsichtigt worden ist. Vielmehr ist er «durch die Hintertür» in das Ensemble ge­ kommen. Zum einen ist er eine Folge des Alters, der Patina und der leicht verwitter­ ten Farben und Materialien, zum zweiten beruht er auf dem zufälligen Nebeneinan­ der unterschiedlichster Objekte und drit­ tens erkennen wir in den Formen etwas Aussergewöhnliches, weil längst Vergan­ genes und nicht mehr unmittelbar Ver­ ständliches. Denkmalpflege und Heimatschutz Die von der französischen Revolution aus­ gelösten politisch-gesellschaftlichen Um­ wälzungen in Europa brachten es mit sich, dass der Schutz und die Pflege historisch bedeutender Bauten zunehmend als Staatsaufgabe betrachtet wurden. Die Re­ gierungen erklärten die Erhaltung von Denkmälern zu einem öffentlichen Inter­ esse; erste Schutzgesetze entstanden. Aus einer engagiert geführten Diskussion um Werthaltungen und Vorgehensweisen in der Restaurierung und Konservierung von Gebäuden entwickelte sich in den vergan­ genen 200 Jahren die heute für gültig er­ achtete Denkmaltheorie. Auf internatio­ naler Ebene ist diese Theorie in den Char­ ten der ICOMOS, allen voran der Charta von Venedig (1964), niedergelegt. Mittlerweile verfügen viele kantonale Denkmalämter über flächendeckende In­ ventare. Darin verzeichnet sind die «schüt­ zenswerten» Objekte. Ihre Zahl steigt sel­ Abbildung 12: Die Mensa der Kan­ tonsschule Wettin­ gen. 22 Architektonische Wertschätzung ten über 5 Prozent des gesamten Gebäu­ debestandes. In der Regel schreibt das kantonale Denkmalpflegegesetz vor, dass die im Inventar aufgeführten Gebäude bei Um- und Anbauvorhaben zwingend durch eine Fachperson der Denkmalpflege be­ gleitet werden müssen. Gemäss den Char­ ten der ICOMOS und den Leitsätzen der Eidgenössischen Kommission für Denk­ malpflege, EKD, wird diese Fachperson die Authentizität des Objekts zu erhalten su­ chen, indem sie erstens die materielle Substanz und zweitens die ästhetische Wirkung des Objekts nach Möglichkeit schont und vor grösseren Veränderungen oder Verlusten bewahrt. Bei aufwendigen Konservierungsarbeiten können die Mehr­ aufwände mit Subventionen teilweise ab­ gegolten werden. Der Volksmund verwechselt oft «Denk­ malpflege» und «Heimatschutz». Wäh­ rend das Denkmalpflegeamt eine kanto­ nale Behörde ist, die das Denkmalpflege­ gesetz umsetzt, ist der 1905 gegründete «Schweizer Heimatschutz» ein Verein, be­ stehend aus Interessierten, mit zahlreichen Sektionen, neudeutsch gesprochen eine Non-Governmental Organization. Der «Heimatschutz» wirkt insofern auf das Bauwesen ein, als seine Bauberater bei umstrittenen Projekten das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen. In den aller­ meisten Fällen wird dabei eine gütliche Ei­ nigung erzielt. Dank dem Verbandsbe­ schwerderecht kann der «Heimatschutz» aber auch Gesetzesverstösse, die von den Baubehörden nicht geahndet worden sind, vor ein Gericht zwingen. Dabei be­ ruft er sich oft auf das «Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz» von 1966 oder auf das «Bundesgesetz über die Raumplanung» von 1979. Weiterbauen am Gebäudebestand Die Denkmalpflege kann sich nur um ei­ nen sehr geringen Teil der historischen Bauten kümmern. Die allermeisten Altbau­ ten sind durch das Denkmalpflegegesetz also nicht tangiert. Trotzdem sollten sie nicht das Opfer unsorgfältiger und grob­ schlächtiger Erneuerungspraktiken wer­ den. Selbst wenn ein Altbau laut Inventar kein schützenswertes Denkmal ist, sind Um- und Anbauwillige aufgefordert, wohlüberlegt und erst nach gründlichen Analysen zu handeln. Da Bauen immer sehr teuer war, kann davon ausgegangen werden, dass zumindest die Bauherrschaft und wohl auch die Architekturschaffen­ den jedes Gebäudes zur Erbauungszeit fest davon überzeugt waren, das Opti­ mum aus dem investierten Kapital zu ho­ len. Ausgangspunkt jedes noch so unbe­ deutend erscheinenden Bauwerks war und ist eine rationale Absicht, ein Zweck und ein Ziel. Bei anspruchsvolleren Gebäu­ den kommen ein architektonisches und ein gestalterisches Konzept sowie zahlrei­ che andere Planungsabsichten hinzu, die das gedanklich-intellektuelle Fundament des Bauwerks sind. Professionelles «Wei­ terbauen» oder «Umnutzen» erfordert vom Planenden eine genaue Kenntnis die­ ses ursprünglichen gedanklich-intellektu­ ellen Fundaments. Dabei geht es nicht da­ rum, diese ehemaligen Absichten und Zwecke auch in der Gegenwart weiter zu verfolgen, sondern darum, das ursprüngli­ che Gebäude als Ganzes zu verstehen, um adäquat darauf reagieren zu können. Vielen Objekten sind drei Gefahren ge­ meinsam, die es zu überwinden gilt. 1. Die Gefahr der räumlichen Überforderung Aus Gründen der Baukostenoptimierung, der Verdichtung und Nutzungserweite­ rung wird oft versucht, dem Altbau mehr Nutzraum abzutrotzen. Dies geschieht meist im Dachraum, gelegentlich auch durch Anbauten. Im Dachraum ist stets die Belichtung ein Problem. Der übliche Weg, dieses Problem zu lösen, sind Dachflä­ chenfenster oder Lukarnen. In allzu grosser Zahl ausgeführt, überfordern jedoch beide den Altbau und lassen ihn wie gestopft aussehen. Der Altbau verliert mit der ehe­ mals ruhigen Dachfläche auch seine Na­ türlichkeit und wirkt wie ein zu kurz ge­ schnittenes Kleid: kleinlich und beengend. Bei Anbauten ist die Abhängigkeit von Altund Neubau genau zu definieren: Sowohl eine Unter- als auch eine Nebenordnung des Neubaus ist je nach Situation vertret­ Abbildung 13: Das Objekt aus der Beundenfeldstrasse in Bern von Corne­ lius Morscher Archi­ tekten Bern. (Foto: Dominique Uldry) 23 Gebäudeerneuerung 24 Architektonische Wertschätzung bar, sollte aber entsprechend gestalterisch ausformuliert werden. In den meisten Fäl­ len dürfte eine Überordnung des Neubaus missraten, da der Altbau ursprünglich nicht auf eine Unterordnung hin konzi­ piert worden ist und also von der neuen Situation erdrückt oder wie niedliches Bei­ werk wirken wird. Ein weiteres Thema räumlicher Überforderung ist das Ausbre­ chen von Trennwänden, um grosszügige Wohnzimmer oder die heute beliebte Ver­ bindung von Küche und Wohnraum zu ermöglichen. Oftmals wird damit die Raumstimmung in einem Altbau zerstört, ohne sie durch etwas Gleichwertiges zu ersetzen. 2. Die Gefahr der technischen Überforderung Die Gebäudetechnik hat sich in den letz­ ten Jahren vervielfacht. Da Gebäude in früherer Zeit noch weit einfacher betrie­ ben worden sind, entsteht heute stets der Wunsch nach Auf- und Nachrüstungen. Diese sind jedoch sowohl finanziell als auch technisch stets viel aufwendiger als der Einbau von Haustechnik in einen Neu­ bau. Aber selbst wenn sie technisch und ästhetisch einwandfrei gelöst sind, bedeu­ ten sie eine gewisse unschöne Verein­ nahme von alten Materialien und Struktu­ ren. Anzustreben sind Lösungen, bei de­ nen nicht alle Räume auf denselben tech­ nischen Stand angehoben und die tech­ nisch anspruchsvollsten Räume in einen Neubau verlegt werden. Solche individua­ lisierten Lösungen bedingen allerdings, dass nicht primär vorgegebene Werte als vielmehr das sinnvollerweise Machbare angestrebt werden. 3. Die Gefahr der Unangemessenheit Der gestalterische Aufwand und ornamen­ tale Schmuck, aber auch die Wahl der Ma­ terialien und ihre Bearbeitung waren bei einem historischen Gebäude stets abge­ stimmt auf die soziale Stellung der Bewoh­ nerschaft oder der zu beherbergenden In­ stitution. Was sich für den Adel gebührte – z. B. gehauener Bauschmuck oder ver­ goldete Schmiedeeisen – galt an einem Pfarrhaus als unpassend und an einem Ar­ beiterhaus erst recht. Diese soziale Rang­ ordnung gilt es beim «Weiterbauen» zu erkennen und angemessen darauf zu re­ agieren. Die Wahl der Formen, Materialien und Bearbeitungstechniken unterliegt so­ mit nicht nur dem persönlichen Ge­ schmack der Bauherrschaft oder Architek­ ten, sondern muss mit dem Bestehenden korrespondieren und zusammen mit die­ sem ein überzeugendes Ganzes ergeben. Form, Material- und Farbkonzepte der Er­ weiterung oder des Eingriffs haben vom Bestehenden auszugehen. Die Ästhetik des Altbaus korrigieren und verbessern zu wollen, dürfte in den meisten Fällen zum Gegenteil führen, vielmehr müssen seine bereits vorhandenen Qualitäten gestärkt aus dem Umbau hervorgehen. Das Weiterbauen am Gebäudebestand birgt Gefahren. Die wichtigsten: 1. Die Gefahr der räumlichen Über­ forderung 2. Die Gefahr der technischen Über­ forderung 3. Die Gefahr der Unangemessenheit Kapitel 3 Analyse Dieter Schnell Peter Schürch Verstehen der Architektur (1) Die ersten Analysen münden in eine um­ fassende Interpretation der Architektur. Hier geht es erstens darum, die ursprüng­ lichen Absichten und Ziele zu erkennen, um den rationalen Kern des Gebäudes zu erfassen. Da jedes Gebäude zur Bauzeit von den Auftraggebern und Planenden als die mit den vorhandenen Mitteln best­ mögliche Lösung einer anstehenden Bau­ aufgabe betrachtet worden ist, haben wir, die wir in diese sorgfältig geplante Struk­ tur eingreifen wollen, zuerst deren Logik zu verstehen. Zweitens geht es hier um Wertungen: Die städtebaulichen, histori­ schen, ästhetischen, räumlichen und ma­ teriellen Qualitäten des Objekts, sind zu benennen, zu beschreiben und zu charak­ terisieren. Dabei geht es jedoch nicht allein um «harte» Fakten, sondern genauso um Raumstimmungen, Atmosphären und emotionale Wertungen, kurz um architek­ tonische Qualitäten. Für die spätere Pro­ jektentwicklung zentral sind nicht nur die Kenntnis der Qualitäten, sondern auch de­ ren konstituierenden Faktoren. Warum ist der Vorgarten von besonderer Qualität? Was muss zwingend erhalten bleiben oder gar gestärkt werden, damit diese Qualität auch nach der Umgestaltung noch vor­ handen ist? Welche relevanten Qualitäten haben Raumfolgen, Raumgrössen und Raumeinteilung. Welche Elemente sind für die Atmosphäre bestimmend? Welchen Einfluss auf die Raumstimmung haben die Farben oder der Lichteinfall? Einmal er­ kannte und genau beschriebene Qualitä­ ten haben eine viel grössere Chance, ge­ stärkt aus einem Umbau hervorzugehen. Die Logik des Ursprünglichen (1.1) Am Anfang der Analysearbeit steht die historische Aufarbeitung des bestehenden Gebäudes. Dabei geht es zunächst darum, herauszufinden, wann, von wem und zu welchem Zweck das Gebäude errichtet worden ist. Weiter ist von Interesse, den historischen Gebäudetypus in seinen cha­ rakteristischen Eigenschaften zu erkennen und das Objekt architekturhistorisch ein­ zuordnen: Handelt es sich um einen rei­ nen, um einen häufigen oder vielmehr um einen seltenen, gar einmaligen Typ? Ist das Objekt architekturhistorisch bedeutsam und wenn ja, weshalb? Sodann ist die städtebauliche Einbettung, der Bezug des Gebäudes zu seinen ehe­ maligen Nachbarbauten intensiv zu studie­ ren und auf die unterschiedlichen Abstu­ fungen von Unter-, Neben- oder Überord­ nung zu befragen. Dabei geht es auch um die Stellung des Baukörpers zur Strasse, um Fragen der Erschliessung, um die Be­ deutung des Vorgartens, des Gartens oder des Hofes. Unerlässlich für eine angemes­ sene Interpretation des Vorhandenen sind Aussagen über die gesellschaftlich-soziale Stellung des Gebäudes: Welchen Rang hatte es, welchem Anspruch hatte es zu genügen? Woran lässt sich dieser An­ spruch erkennen? Wie ist das Gebäude orientiert (Sonneneinstrahlung)? Wie ist die Fassadengestaltung? Die Logik der späteren Veränderungen (1.2) Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Ver­ änderungen, die ein Gebäude im Lauf der Zeit erfahren hat. Dabei sind spätere Hin­ zufügungen nicht zwingend als den ur­ sprünglichen Elementen unterlegen zu be­ werten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass jede einzelne Massnahme zu ihrer Zeit als sinnvoll und als der Problemstel­ lung adäquat betrachtet worden ist. Von Bedeutung sind jedoch nicht allein die Ver­ änderungen am Gebäude, sondern auch diejenigen in seiner unmittelbaren Umge­ bung. Wie hat sich der städtebauliche Kontext gewandelt, hat das Gebäude sel­ ber einen Bedeutungswandel erfahren, sind ehemals wichtige Bezüge, beispiels­ weise zum Nachbargebäude, zum Garten, zum Ökonomiegebäude, zum Hof, usw. verloren gegangen? In diesem Punkt ist es wichtig, jede einzelne Veränderung wohl­ 26 Analyse überlegt zu werten. Spätere Eingriffe kön­ nen als eine Bereicherung oder aber als eine Verunklärung verstanden werden, ein kontinuierliches Weiterbauen oder einen Schlusspunkt bedeuten. Sie können später in der Konzeptphase Hinweise auf eine mögliche Entwicklungsstrategie, den Weg in eine bereits vorgegebene Richtung auf­ zeigen, oder aber auch den Wunsch nach einer Rückführung eines ehemals beson­ ders qualitätsvollen Elements wach rufen. Das intensive Studium aller bis zur Gegen­ wart gemachten Veränderungen hat einen weiteren Vorteil: Man versteht sein eige­ nes Eingreifen als ein Glied in einer Kette, die mit dem aktuellen Eingriff nur an ein vorläufiges Ende kommt. Eine langfristige Betrachtung und Reflexion des Projektes über die nächsten 40 Jahre ist zentral. Räumliche und ästhetische Qualitäten (1.3) Die räumlichen und ästhetischen Qualitä­ ten eines Gebäudes sind schwer in Worte zu fassen. Gerade deshalb sind sie durch gezielte Fragen einzukreisen. Die Grund­ frage richtet sich dabei stets nach der Er­ kennbarkeit eines Gestaltungswillens. Wenn ja, woran ist er zu erkennen? Wie deutlich ist das Konzept (noch) lesbar? Wie überzeugend ist es? Diese Grundfrage ist sodann durch gezielte, auf die jeweili­ gen Räume abgestimmte Zusatzfragen zu erweitern. Zunächst zum Aussenraum: Wie verhält es sich mit den Wertigkeiten des Aussenrau­ mes? Gibt es halböffentliche oder private Aussenräume? Wie sind diese von der Strasse oder von Nachbarbauten abge­ setzt? Wie sind Grenzen formuliert? Wie ist die Erschliessung gelöst? Auf die Innenräume bezogen ergeben sich etwa die folgenden Fragen: Wie ist der Eingang gestaltet? Wie ist die innere Er­ schliessung organisiert? Welchen Gesetz­ mässigkeiten folgt die Anordnung der In­ nenräume? Was sind die Raumfolgen und Raumtypologien? Welche hierarchischen Beziehungen unter den Räumen sind er­ kennbar? Welche Orientierung haben die einzelnen Räume? Was lässt sich über den Bezug zum Aussenraum sagen? Wie sind Küchen, Bäder und Nebenräume konzi­ piert? Sind die Räume unterschiedlich auf­ wendig ausgestaltet? Sind dekorative Ele­ mente wie Tapeten, Täfer, Stuckdecken, Parkette, usw. vorhanden? Ist ein umfas­ sendes Material- oder Farbkonzept er­ kennbar? Wie erfolgt die natürliche Be­ leuchtung im Innern? Strukturelle und materielle Qualitäten (1.4) Zu einer eingehenden Analyse der Archi­ tektur eines Gebäudes gehört auch das feinfühlige Befragen der Strukturen und der Materialien. Gebäudestrukturen und die Fassade charakterisieren ein Gebäude durch ihren Rhythmus, durch die Fenstera­ nordnung und damit die natürliche Be­ leuchtung sowie durch die Anordnung der Erschiessungskerne. Materialien und vor allem deren sichtbare Oberflächen sind ganz zentrale Faktoren für die Gebäudeund Raumstimmung. Hinter einem Materi­ aleinsatz stehen nicht nur technisch-stati­ sche Überlegungen, sondern auch ökono­ mische, ästhetische oder semantische Ab­ sichten, diese sind zu erkennen und in ei­ ner umfassenden Interpretation zu be­ rücksichtigen. In diesem Zusammenhang wichtig ist auch das Erkennen von regio­ nalen Bautraditionen bezüglich Material­ einsatz, Verarbeitungs- und Fügungstech­ nik. Welche Innenraumqualitäten beein­ drucken (Intimität, Materialisierung, etc)? Wie wirkt die Befensterung (Ausrichtung, Grössen, Lage, Unterteilung)? Interessant ist zudem die mögliche Speichermasse der Gebäudestrukturen. Dem Gebäude als funktionierendem Sys­ tem gilt es gerecht zu werden und die Ei­ genheiten zu erkennen. Auslegeordnung (2) Die gesammelten Fakten sind als Aus­ gangspunkt eines sorgfältigen Konzepts zu betrachten. Ertüchtigungen wie bei­ spielsweise die Erhöhung der Tragfähigkeit sind durchaus machbar, müssen aber möglichst früh als Aufgabe erkannt wer­ den. Hier geht es um eine umfassende Auslegeordnung des Vorhandenen. So­ wohl der gesetzliche als auch der räumli­ 27 Gebäudeerneuerung 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Thema Zu beachten Verstehen der Architektur Die Logik des Ursprüngli­ ]]Historische Aufarbeitung: Architekt, Bauherr, Funktion des Gebäudes chen ]]Gebäudetypus, charakteristische Eigenschaften, Konzept, tragende Idee, immaterielle Qualitäten ]]Städtebauliche Situation: Nachbarbauten zur Bauzeit, Stellung zur Strasse, Kontext, Orientierung ]]Erschliessung des Hauses, Vorgartesn, Garten, Hof ]]Anspruch des Gebäudes, sozialer Rang ]]Fassade Logik der späteren Ver­ ]]Chronologie der Veränderungen, Wertigkeiten änderungen ]]Veränderungen der Umgebung, verschwundene wichtige Bezüge Räumliche und ästheti­ ]]Rekonstruktion des Gestaltungskonzepts sche Qualitäten ]]Wertigkeiten des Aussenraumes, Bezug zwischen innen und aussen ]]Raumaufteilung: Erschliessung, Raumbezüge, Raumhierarchien, Raum­ folgen ]]Ausstattungen: Materialien, Farben, Tapeten, Täfer, Stuck, Boden­ beläge, usw. ]]Raumstimmungen, Belichtung, Lichtführung Strukturelle, materielle ]]Gebäudestruktur: Raster, Symmetrien, Rhythmen und konstruktive Quali­ ]]Materialien, Konstruktion: ökonomische, ästhetische, semantische täten Absichten Auslegeordnung Baugesetzliche Vorgaben ]]Baugesetz, Bauordnung, Bauzone, übergreifende Planungsabsichten ]]Diverse Inventare: Denkmalpflege, ISOS, historische Verkehrswege, BNL (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) ]]Brandschutz, Energiegesetze Das Raumangebot ]]Zusammenstellen aller Nutzflächen unter Angabe der idealen ]]Nutzung: beheizte Räume, Spezialräume (Bad, Küche), unbeheizte Räume wie Keller, Estrich, Lagerräume, temperierte Zwischenzonen ]]Genaue Angabe und Charakterisierung der Erschliessungs- und Steig­ zonen ]]Liste der Aussenräume nach ihrer Wertigkeit Der materielle Bestand ]]Konstruktion: Struktur, Auseinanderhalten der Tragsysteme, Beurtei­ lung ihrer Tragfähigkeit, regionale Eigenheiten ]]Gebäudehülle ]]Materialien und ihre Fügungen, Detaillierung, Zustandsbeschreibun­ gen unter Angabe noch vorhandener Leistungsfähigkeit (defekt bis neuwertig) ]]Erste Sondierung von Ertüchtigungsmöglichkeiten ]]Schadensbilder, Defekte und deren Interpretation ]]Verstehen des Gebäudes als System Die energetische Qualität ]]Energieträger (Öl, Gas, Holz, etc.) Energieverbrauch ]]Gebäudehülle; neuralgische Punkte: Fenster, Dach und Dachansatz, Keller ]]Gebäudehülle; neuralgische Punkte: Fenster, Dach und Dachansatz, Keller ]]Leistungsfähigkeit der Haustechnikapparate Einkreisen des Potenzials ]]Auflisten des Potenzials und der Problempunkte ]]Betrachtung des Altbaus als eines Systems – Erhaltungszustand, notwendige Ertüchtigungsmassnahmen Tabelle 2: Checkliste 28 Analyse che, materielle und technische Rahmen müssen benannt, die vorhandenen Quali­ täten und Schwächen wahrgenommen werden. Dabei geht es bei den Materialien und den technischen Einrichtungen auch um die noch zu erwartende Rest-Lebens­ dauer oder um die Möglichkeiten zu deren Instandstellung. Bei einem Weiterbauen sollten immer auch die Schaffung mögli­ cher Mehrwerte in die Auslegeordnung einbezogen werden. Baugesetzliche Vorgaben (2.1) Zu den ersten Abklärungen gehört selbst­ verständlich das Erfassen des vom Bauge­ setz und von der Bauverordnung vorgege­ benen Rahmens. Nebst den quantifizierba­ ren Vorschriften wie maximale Geschoss­ zahl, höchstmögliche Ausnutzungsziffer, maximale Dimensionen oder minimale Ab­ stände, hat man sich ebenso intensiv mit den «weichen» Faktoren wie Gestaltungs­ vorschriften, Erhaltungsabsichten (z. B. Kernzonen), in übergreifenden Studien niedergelegte Planungsabsichten oder den vorhandenen Interpretationen von Inven­ taren zu befassen (z. B. Inventar der Kanto­ nalen Denkmalpflege, ISOS – Inventar der Schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, Bundesinventar der Historischen Verkehrs­ wege der Schweiz, BNL – Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung). Dazu kommen einschränkende Vorgaben des Brand­ schutzes, der Energiegesetze und weitere projektspezifische Auflagen. Das Raumangebot (2.2.) Jedes Gebäude bietet nutzbaren Raum an. Die Lage der Erschliessungen und Steigzo­ nen sowie die vorhandene Raumauftei­ lung beinhalten ein Nutzungspotenzial, erschweren aber gleichzeitig eine völlig andere Raumorganisation. Je genauer zu einem späteren Zeitpunkt der Planung das zukünftige Raumprogramm mit dem vor­ handenen Raumangebot in Übereinstim­ mung gebracht werden kann, desto weni­ ger tiefgreifende Massnahmen werden notwendig sein, um das Gebäude den neuen Erfordernissen anzupassen. Es ist wichtig, dass das vorhandene Raumange­ bot, zunächst ohne auf eine spätere Nut­ zung zu schielen, aufgelistet wird, damit das spätere Hinterfragen der neuen Nut­ zungszuweisungen nicht vorbelastet ist. Dabei sind nicht nur die beheizten Haupträume sowie Bad und Küche, tem­ perierte Vor- oder Zwischenzonen, son­ dern auch die unbeheizten Keller-, Estrichoder Lagerräume in ihren Dimensionen und Qualitäten aufzunehmen. Gleiches gilt auch für die Aussenräume: Balkone, Terrassen, Lauben, private Gartenräume, Vorgartenräume für Erschliessung, Parkie­ rung, usw. Der materielle Bestand (2.3) Je besser die Konstruktionen und die Ma­ terialien eines Altbaus bekannt sind und auf ihre Trag- und sonstige Leistungsfähig­ keit sowie die noch zu erwartende Lebens­ dauer untersucht sind, desto genauer las­ sen sich das Potenzial, die Möglichkeiten, Gefahren und Risiken eines Eingriffs ab­ schätzen und desto präziser kann das Pro­ jekt von Beginn weg auf das Objekt zuge­ schnitten werden. Aus einer gründlichen Materialienanalyse muss das Verständnis des statischen Konzepts der tragenden und nichttragenden Elemente, der Schal­ leigenschaften und entsprechenden Er­ tüchtigungsmöglichkeiten der Balkenla­ gen, der Eigenschaften des Dachstuhls in Bezug auf energetische Massnahmen usw. hervorgehen. Die Materialien sind nicht nur für sich allein, sondern auch in ihren gegenseitigen Verbindungen und Fügun­ gen zu betrachten. Zudem sind Zustands­ beschreibungen vorzunehmen, die von defekt bis neuwertig reichen, die zukünf­ tige Verwendungsmöglichkeit eines Bau­ teils abschätzen und zu werten. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Schadensbildern, geben diese doch Aufschluss über Prob­ lemzonen und allfällige Material- oder Konstruktionsmängel. Der energetische Zustand (2.4) Der Energieverbrauch ist der einzige Be­ reich, in dem ein Altbau nach der Restau­ rierung und dem Umbau zwingend mehr leisten muss als vorher. Da aus ästheti­ schen, konstruktiven oder finanziellen Abbildung 14: Mehrfamilienhaus an der Segantini­ strasse in Zürich von Kämpfen für Archi­ tektur, Zürich 29 Gebäudeerneuerung 30 Analyse Gründen Neubaulösungen nicht ohne in­ dividuelle Anpassungen auf Altbauten übertragbar sind, ist die genaue Kenntnis aller Konstruktionsarten der verwendeten Materialien ebenso von zentraler Bedeu­ tung wie deren Erhaltungszustand. Mass­ geschneiderte Lösungen können nur da gelingen, wo präzise Kenntnisse des Vor­ handenen erarbeitet worden sind. Neural­ gische Punkte wie Estrich und Dach, der Übergang von der Wand zum Dach, die Wärmegrenze zwischen beheiztem Erdge­ schoss und unbeheiztem Keller sind genau zu studieren und zu untersuchen. Oft wer­ den Fenster als neuralgische Punkte be­ trachtet und schon von Beginn weg deren Ersatz für unabdingbar erklärt. Da Fenster gleichzeitig die ästhetische Wirkung eines Altbaus wesentlich mitbestimmen, ist im Interesse eines authentischen Erschei­ nungsbildes der Ersatz oft problematisch. Allfällige Restaurierungsmöglichkeiten sind einzig durch präzise Funktionsstudien aller vorhandenen Fenster zu erarbeiten. Der Erhaltungszustand der Fenster kann je nach ihrem Standort sehr unterschiedlich sein. Während an exponierten Lagen das Schadensbild recht ernüchternd ausfallen kann, sind an geschützten Lagen oft noch sehr gut erhaltene Fenster vorhanden. Eine seriöse Gebäudeanalyse untersucht deshalb einzelne Bauteile und jedes ein­ zelne Fenster. Die Bauelemente sind detail­ liert zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Exponiertheit (Nordfassade, Wetterseite usw.) zu dokumentieren. Nicht allein die Möglichkeiten der Wärmedämmung, auch die Sparmöglichkeiten bei der Wärmeer­ zeugung sind genau zu untersuchen. Vor­ handene Installationen sind auf ihre zu­ künftige Leistungsfähigkeit zu prüfen und gleichzeitig die am Ort vorhandenen Res­ sourcen abzuklären. Einkreisen des Potenzials (3) Zuerst ist festzuhalten, dass die einge­ hende Betrachtung eines Gebäudes als ein System aufeinander bezogener und abge­ stimmter Teile und Elemente selbstver­ ständlich auch auf Altbauten anzuwenden ist. Im Gegensatz zum Neubau hat das sys­ temische Zusammenwirken aller Teile und Elemente eines Altbaus seine Funktions­ tüchtigkeit bereits viele Jahrzehnte unter Beweis gestellt. Für die spätere Zielformu­ lierung ist es wichtig, den Systemcharakter eines Altbaus möglichst umfassend zu er­ kennen. Stärken wie auch Schwächen sind aufzulisten und zu benennen. Ein Altbau hat aber auch seine Problempunkte, die technischer, materieller, räumlicher oder auch ästhetischer Natur sein können. Diese Problempunkte, ob immer schon vorhanden oder erst mit der Zeit entstan­ den, gilt es aufzuzeigen. Die Grenzen der Belastbarkeit, des Leistungsvermögens und der Nutzung sind abzustecken. Mög­ lichst genaue Aussagen über notwendige Verbesserungen, Verstärkungen oder Er­ gänzungen sind hier zu treffen. Altlasten und die daraus resultierenden Sanierungs­ pflichten sind zu benennen. Aufgrund der zahlreichen, untereinander in direkter oder indirekter Beziehung stehenden Faktoren erfolgt die Formulierung des Potenzials – langsam vorantastend und immer wieder auf die verschiedenen Aspekte zurückgrei­ fend. Hier geht es noch nicht um die For­ mulierung eines Ziels, um das Festlegen des einzuschlagenden Wegs, sondern ein­ zig und allein um ein Aufzeigen der Mög­ lichkeiten, Grenzen, Rahmenbedingungen und Spielräumen. Dabei ist nicht schwarzweiss zu argumentieren, sondern mit wohlabgewogenen Wertungen auch alle Zwischenstufen aufzuzeigen. Dieses Vor­ gehen schafft verlässliche Grundlagen, welche den Planenden in der kreativen Phase der Entwicklung von Lösungsstrate­ gien, von Konzepten oder der Projektstu­ dien unterstützen. Kapitel 4 Planungsprozesse, Strategie und Kommunikation Philippe Lustenberger Bezüglich des «Weiterbauens» stellen die zu entwickelnde Liegenschaft, die Ansprü­ che des Immobilienbesitzers sowie die ex­ ternen Ansprüche hohe Anforderungen an die Planungs- und Erstellungsprozesse. Insbesondere die Klärung der Immobilien­ strategie und Gestaltung der Teampro­ zesse und damit auch der Kommunikation innerhalb der Prozesse stellen wichtige Elemente im «Weiterbauen» dar. Demnach muss in erster Linie geklärt wer­ den, was der Immobilienbesitzer für grundsätzliche Strategien verfolgt, bei­ spielsweise: ]]Bildet die Immobilie im Falle eines Kleinst­ portfolios einen Teil seiner persönlichen Altersvorsorgung? ]]Hat der Immobilienbesitzer einer grösse­ ren Wohnüberbauung das Ziel, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen? ]]Sind hohe Renditeaussichten durch die Kapitalanlage Immobilie die Grundlage der Investition? ]]Sind kurzfristige oder eher langfristige, nachhaltige Zielsetzungen wichtig? Denn im Falle eines unprofessionellen In­ vestors, was insbesondere bei Kleinstport­ foliobesitzern und Einzelimmobilienbesit­ zern häufig vorkommt, ist er auf die Kom­ petenz und die Fähigkeiten von Beratern und Planern angewiesen, die Investitions­ absichten und deren Konsequenzen rich­ tig einschätzen können. Die konkrete Ver­ bindung der Ausgangslage mit den Poten­ zialen der Immobilie, des Standortes und des Immobilienmarktes bildet dabei die Grundlage zur Strategiedefinition. Dabei bilden die Kommunikationsfähigkeiten beider Seiten eine vertrauensbildende Grundlage, um das Investitionsvorhaben erfolgreich umsetzen zu können. Die Planungs- und Erstellungsprozesse sind in den Normen des SIA (insbesondere in der SIA 112, Leistungsmodell) ausrei­ chend beschrieben und finden landesweit Diese Ausgangslage zu benennen, bedarf einer Sensibilisierung des Immobilienbesit­ zers. Welche Gefahren und Chancen mit der Strategie verbunden sind, z. B. dass die zu erwartenden Mieterträge die Investition nicht abdecken und damit die Wertent­ wicklung der Immobilie negativ beeinflus­ sen. Dies muss vor der eigentlichen Bau­ planung und der Realisierung geklärt wer­ den. Das bedeutet auch, dass der als «In­ vestor» auftretende Immobilienbesitzer seine Verantwortung bezüglich der Strate­ gie-, Planungs- und Erstellungsprozesse erkennen und wahrnehmen muss! Strategische Vorleistung Strategieprozess Strategische Planung Vorstudie Planungsprozesse Unternehmensstrategie Immobilienportfoliostrategie Objektstrategie Planung und Erstellung nach SIA 112 Projektierung Ausschreibung Abbildung 16: Gesamtschau über den Strategiepro­ zess, den Planungs­ prozess, den Erstel­ lungsprozess und die Nutzung. Die drei letztgenannten entsprechen dem Phasenmodell nach SIA 112, wobei die Phase «Strategische Planung» lediglich die «Bedürfnisfor­ mulierung» auf der Stufe der konkreten Umsetzung sowie die «Lösungsstrate­ gie» abdeckt, über­ geordnete Aus­ gangslagen werden nicht eingebunden. (Quelle: nach SIA 112) Realisierung Erstellungsprozesse Phasenmodell nach SIA 112 Abbildung 15: Darstellung des hie­ rarchischen Aufbaus von «Unterneh­ mensstrategie», «Immobilienportfo­ liostrategie», «Ob­ jektstrategie», «Pla­ nung und Umset­ zung» nach SIA 112 und deren logi­ schen Verknüpfung. (Quelle: SIA 112; IPB/KBOB) Betrieb Nutzung 32 Planungsprozesse, Strategie und Kommunikation hohe Akzeptanz bei Planern, Bauunter­ nehmungen und bei Bauherrschaften. Da­ her wird an dieser Stelle auf eine ausführ­ liche Auseinandersetzung mit den Pla­ nungs- und Erstellungsprozessen verzich­ tet. Jedoch werden die der SIA vorgelager­ ten Strategieprozesse etwas tiefer analy­ siert und daraus Auswirkungen in die Zu­ sammenarbeitsformen der Folgeprozesse erläutert. Zusammenarbeitsformen Im Strategieprozess wird die Immobilie, insbesondere deren Standort und der Im­ mobilienmarkt, analysiert und bewertet sowie der gesellschaftlichen Entwicklung gegenübergestellt. Aus diesen Erkenntnis­ sen können Szenarien im Sinne der Zu­ kunftsplanung entwickelt und die zu defi­ nierende Strategie damit überprüft wer­ den. Strategische Vorleistungen Zur Erreichung der Strategiedefinition müssen Berater und Planer auf die Bedürf­ nisse des Investors gezielt eingehen und die Möglichkeiten und Potenziale seitens der Immobilie gegenüberstellen. Dabei spielt der Immobilienmarkt ebenso eine bedeutende Rolle wie der Standort der Im­ mobilie. Dies folgt aus der marktwirt­ schaftlichen Betrachtung der Immobilie: Sie bindet das eingesetzte Kapital über eine lange Zeit (Nutzungszeiten von 50 bis 80 Jahren sind bei tragenden Bauteilen üblich) und ist dabei fest mit dem Bau­ grund verbunden, also immobil. An der Strategieerstellung sind abhängig der Konstellation des Investors und der Aufgabenstellung unterschiedliche Rollen denkbar, wobei es möglich ist, dass meh­ rere Rollen auf eine Person anfallen: ]]Die Bauherrschaft löst das Investitions­ vorhaben aus und hat Ansprüche an das erwartete Resultat. ]]Der Moderator führt den Strategiepro­ zess und kontrolliert die Zielerreichung des Resultates. ]]Der Investor übernimmt die Immobilie nach deren Erstellung. Zu unterscheiden sind die institutionellen Investoren (Immo­ bilienfonds, Versicherungen, Pensionskas­ Auftrag Bauherr, Investor Entschädigungsforderung (Honorar) Kapital Kapitalgeber Moderator Moderator Zusammenarbeit Berater Zusammenarbeit Investitionsvorhaben Abbildung 17: Beziehungsnetz im Investitionsvorha­ ben und rechtliche Beziehung der Be­ teiligten. Der Strang links zeigt die Zusammenar­ beit im Vertragsmo­ dell «Auftrag» ge­ mäss Art. 394 OR, rechts sind Kredit­ vergabe, Mietver­ trag (Art. 253 OR) und einseitige An­ sprüche z. B. der öf­ fentlichen Hand durch die «Inaus­ sichtstellung» der Baubewilligung dargestellt. Zinsansprüche Mietvertrag Nutzer Leistungsanspruch an Immobilie Planer Einseitige Ansprüche (ohne Rechtsverhältnis) Beratung und Empfehlung Immobilie Übernimmt die Immobilie Weitere Beteiligte (z.B. öffentliche Hand) Bauherr, Investor 33 Gebäudeerneuerung sen, etc.) und die privaten Investoren. Der Investor kann gleichzeitig auch Bauherr­ schaft sein. ]]Der Kapitalgeber unterstützt den Inves­ tor in der Bereitstellung des Investitionska­ pitals und erwartet dafür eine entspre­ chende Entschädigung. Sein Vertrauen in das Investitionsvorhaben wird in der Höhe der Kapitalverzinsung (Risikoeinschätzung) ausgedrückt, das er von der Bauherrschaft respektive vom Investor erwartet. ]]Der Berater interpretiert die anfallenden Entscheidungsgrundlagen, bewertet diese und gibt dem Investor eine Empfehlung ab. Dabei untersucht er die Auswirkungen, die ein Entscheid zur Folge hat. ]]Der Planer bewertet den Zustand und zeigt Entwicklungspotenziale auf. ]]Die Nutzerschaft bringt ihre Ansprüche an das Objekt ein und erklärt ihre Bereit­ schaft zur Nutzung der Immobilie. ]]Die Grundstückeigentümer überlassen das entsprechende Grundstück zum Kauf oder zur Pacht für eine bestimmte Laufzeit (Vergabe im Baurecht). ]]Weitere Beteiligte sind denkbar. Darun­ ter fallen beispielsweise die öffentliche Hand mit Einschätzungen zur möglichen Baubewilligung und einspracheberechtigte Anstösser. Rechtliche Betrachtung Die Beteiligten eines Strategieprozesses haben eine unterschiedliche rechtliche Po­ sition. Moderator, Berater und Planer sind als Auftragnehmer nach Art. 394 OR zu verstehen. Die Bauherrschaft und die Nut­ zerschaft vereinbaren ein Mietverhältnis nach Art. 253 OR, wobei der Vertragsbe­ ginn des Mietverhältnisses nicht mit dem Strategieprozess verknüpft ist, sondern erst nach der Erstellung beginnen kann. Weitere Beteiligte können einseitig ihre Ansprüche an das Vorhaben einbringen, dies ohne ein Rechtsverhältnis mit der Bauherrschaft respektive dem Investor ein­ zugehen. Einseitig deshalb, weil die Bau­ herrschaft oder der Investor den Anforde­ rungen in der Regel keine Gegenforderun­ gen stellen kann. Als Beispiel sind hier die formellen Anforderungen an die Baube­ willigung erwähnt. Im Gegensatz zum Strategieprozess werden im Planungspro­ zess neben dem Auftrag auch Werkver­ träge nach Art. 363 OR vergeben, im Er­ stellungsprozess sind es fast ausschliesslich Werkverträge. In der Betriebsphase sind es typischerweise Mietverträge. Auswirkungen auf die Folgeprozesse Was im Strategieprozess durchaus Kreati­ vität in der Prozessgestaltung bedarf, schränkt die Gestaltung der Planungs- und Erstellungsprozesse wesentlich ein. Aus der Wahl der Abwicklungsform, der Ent­ scheidung zwischen Einzelleistungsträger, Generalplaner, Generalunternehmer oder Totalunternehmer, entwickelt sich die Kommunikationsform in der Umsetzung des Investitionsvorhabens. Daher ist es wichtig, antizipieren zu können, welche Kommunikationsform im jeweiligen Teil­ prozess die richtige ist. Grundlagen dazu sind die konkrete Ziel- und Leistungsver­ einbarung, die auf unterschiedlicher Ebene durchgeführt werden muss. Quellen ]]IPB/KBOB: Nachhaltiges Immobilienma­ nagement. Die Risiken von morgen sind die Chancen von heute. Eine Anleitung zum Handeln, Bern 2010. Zu finden unter: www.bbl.admin.ch/kbob/00509/00511/ 02471/index.html ]]Schulte, K.-W.: Handbuch ImmobilienPro­jektentwicklung, 2. Auflage, Rudolf Mül­ler Verlag, Köln 2002 ]]Ordnung SIA 112, 2001, Leistungsmo­ dell, SIA, Zürich 2001 Kapitel 5 Ökonomische Nachhaltigkeit Klaus Eichen­ berger Heinz Mutzner Einflüsse Markt Grundsätzlich wird in den Strategien der Unternehmung respektive der Eigentü­ merschaft und in der Objektstrategie fest­ gelegt, welche Nachhaltigkeitsziele die Immobilie zu erreichen hat. Eine Immobilie ist dann nachhaltig, wenn sie über die ganze Lebensdauer betrachtet einen Nut­ zen sowie Mittel für Unterhalt und Erneu­ erung generiert und einen Beitrag zur Qualität des Umfeldes leistet. Die Mess­ grösse für den Nutzen ist je nach Betrach­ tungsweise unterschiedlich. Der Nutzen kann zum Beispiel auf den sozialen Aus­ tausch, das Quartier, den öffentlichen Raum, den Umgang mit Ressourcen, kul­ turelle und gesellschaftliche Werte, den Mietertrag etc. bezogen werden. Alle diese Einflussgrössen (Themen nach der Richtlinie SIA 112/1) tragen zum Nutzen oder der Attraktivität einer Immobilie bei und daraus resultiert die Bereitschaft, für die Nutzung der Immobilie – beeinflusst durch Angebot und Nachfrage im Markt – zu bezahlen. Dadurch können Erträge erwirtschaftet werden, die zusammen mit den Anlage-, Betriebs- und Unterhaltskos­ ten die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie ergeben. Die monetär messbaren Erträge hängen fast ausschliesslich von Einflüssen ab, die sich nicht unmittelbar in Zahlen ausdrücken lassen. Die ökonomische Nachhaltigkeit von Wohn- und Betriebsimmobilien ist aus der Sicht eines Eigentümers einer Betriebsoder Mietimmobilie über Mieterträge und Kosten quantifizierbar. Die Benutzer der Immobilie, auch die Eigentümer als Selbst­ nutzer, können dagegen den Nutzen nur indirekt monetär ausdrücken. Ihr Nutzen besteht neben ökonomischen aus gesell­ schaftlichen und kulturellen Komponen­ ten, die nicht direkt mit Geldbeträgen quantifizierbar sind, aber über die Attrak­ tivität der Immobilie und die Zahlungsbe­ reitschaft der Nutzer im Rahmen des Marktes die erzielbaren Preise und Mieter­ träge von Immobilien beeinflussen. Im Immobilienmarkt spielen das Angebot und die Nachfrage nach Grundstücken und Gebäuden und deren Nutzung (Eigen­ nutzung, Drittnutzung und Fremdvermie­ tung) zusammen. Der Eigentümer der Immobilie will über deren Lebenszyklus eine angemessene Rendite oder einen möglichst hohen Bei­ trag an die Unternehmensziele erreichen. Der Nachfrager seinerseits ist bereit, das Angebot zu kaufen respektive zu mieten, wenn dieses seinen erwarteten Nutzen be­ friedigt. Den Nutzen wird der Mieter u. a. mit seinem Gesamtaufwand für die Miete, d. h. der warmen Miete einerseits, der Ma­ kro- und Mikrolage und den zugehörigen zusätzlichen Kosten z. B. für Mobilität an­ dererseits vergleichen. Auch die externen Effekte aus öffentlichen Gütern (Zugang zu Parks und Freiflächen, Infrastruktur, Nachbarschaft, Aussicht etc.) spielen eine zentrale Rolle. Studien [1] zu Anlageimmo­ bilien belegen zudem, dass zunehmend Gruppen von Mietern und Käufern entste­ hen, die aus gesellschaftlicher Verantwor­ tung nachhaltige und besonders umwelt­ freundliche oder auf gesundes Wohnen ausgerichtete Immobilien bewohnen oder besitzen wollen. Der Nachfrager wird das Angebot nach verschiedenen Kriterien be­ werten und wenn diese Bewertung positiv ausfällt, die Immobilie in eine Auswahl ein­ beziehen. Der Nachfrager setzt also eine Art privates Ratingsystem ein. Für den Immobilienbesitzer von Anlageim­ mobilien bedeutet nachhaltiges Handeln, über einen grossen Zeitraum des Lebens­ zyklus der Immobilie Prognosen über die künftige Nachfrage und die erforderlichen Investitionen (Instandhaltung, Erneue­ rung) zu erstellen, um der künftigen Nach­ frage gerecht zu werden. Dabei muss er auch das Umfeld, die Konkurrenz, die Ent­ wicklung des Quartiers beachten. Es kann nachhaltig sein, auf eine Investition zu ver­ zichten, wenn die Umgebung Wertsteige­ rungen nicht zulässt. Die Investitionen 36 Ökonomische Nachhaltigkeit müssen über einen geeigneten Zeitraum systematisch geplant werden, damit die Immobilie zum richtigen Zeitpunkt markt­ gerecht ist und langfristig den erwarteten Nutzen bringt. Auch die Entwicklung von Baustandards muss beachtet werden. Wer im Jahr 2011 ein Gebäude entlang der aktuellen Vorga­ ben für den Energieverbrauch plant, wird voraussichtlich über den grössten Teil von dessen Lebenszyklus eine veraltete Immo­ bilie haben, wenn ab 2020 das Fast-Null­ energiehaus [2] der relevante Standard wird. Varianten und Szenarien Bei jedem Projekt, insbesondere beim meist sehr anspruchsvollen Weiterbauen, lohnt es sich, mehrere konkret vorstellbare Varianten zu entwickeln, um alle sinnvoll erscheinenden Lösungsmöglichkeiten be­ urteilen zu können. Für eine bestehende Nutzung, Erschliessung Gestaltung Gemeinschaft Wohlbefinden, Gesundheit Gebäudesubstanz Immobilienmarkt Attraktivität Erträge Baustoffe Anlagekosten Betriebsenergie Betriebsund Unterhaltskosten Boden, Landschaft Infrastruktur Abbildung 18: Einflussgrössen auf monetäre Faktoren Wirtschaftlichkeit 37 Gebäudeerneuerung Wohnimmobilie beispielsweise die Varian­ ten «sanieren» und «laufender Unter­ halt». Bereits diese an sich einfachen Vari­ anten sind nicht leicht gegeneinander ab­ zuwägen, weil zur Beurteilung der ökono­ mischen Nachhaltigkeit einer Immobilie lange Zeiträume betrachtet werden müs­ sen und darum viele Annahmen über zu­ künftige Marktverhältnisse in die Betrach­ tungen einfliessen, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Deshalb empfiehlt es sich, mit Szenarien zu arbeiten, die einen geeig­ net langen Zeitraum umfassen. In den Sze­ narien müssen Einflussgrössen wie Verän­ derungen von gesellschaftlichen Ansprü­ chen, steigende Energiepreise, klimatische Veränderungen, Kaufkraft der Marktteil­ nehmenden, etc. abgeschätzt werden [3]. Dieses Vorgehen wird im Folgenden an ei­ nem einfachen Beispiel veranschaulicht. Für eine im Jahr 1972 erstellte Wohnung sollen die erzielbaren Mieterträge für die Varianten «saniert» und «unsaniert» ab­ geschätzt werden. Die beiden Varianten sind in Tabelle 3 charakterisiert. Es wird an­ genommen, die unsanierte Wohnung könne bei den gegebenen Marktverhält­ nissen für 2200 Fr. pro Monat vermietet werden, die sanierte für 2500 Fr. Demnach muss der Vermieter bei steigenden Ener­ giekosten die kalte Miete senken, damit die Summe aus kalter Miete und Energie­ kosten nicht steigt. Da die Entwicklung der Energiepreise unbekannt ist, sollte mit vier verschiedenen Szenarien für deren jährli­ che Zunahme: 4 %, 5 %, 6 % und 7 % ge­ rechnet werden. Daraus ergibt sich die folgende Entwicklung der marktgerechten Kaltmieten (Abbildung 19). Die erzielbaren Kaltmieten der nicht sa­ nierten Wohnung sind tiefer (was mögli­ cherweise durch die nicht eingesetzten Sanierungskosten wettgemacht wird) und vor allem ist ihre Streuung, also die Prog­ noseunsicherheit, wesentlich grösser als bei der sanierten Wohnung. Der Entscheid gegen eine Sanierung führt also zu einem wesentlich höheren Risiko (Unsicherheit). In der Praxis müssen selbstverständlich umfassendere Szenarien mit allen relevan­ ten Einflussgrössen, insbesondere das Mietrecht, untersucht werden. Lebenszyklus Immobilien bestehen normalerweise lange Zeit, fünfzig und mehr Jahre. Dabei altern sie technisch und auch in Bezug auf Nut­ zeranforderungen (funktionale und soziale Alterung), was bedeutet, dass sich die Marktpositionierung der Immobilie ver­ schlechtert. Die technische Alterung ver­ läuft, bezogen auf die gesamte Immobilie und die einzelnen Bauteile, in unterschied­ lichen Zeiträumen. Dabei spielt die Struk­ tur des Gebäudes eine grosse Rolle. Sind die Strukturen klar in primäre, sekundäre und tertiäre Systeme getrennt oder lässt sich bei einer Erneuerung diese Trennung herbeiführen, so sind die Kosten für Unter­ halt [4] und Veränderung günstiger. Beschreibung unsaniert saniert Einheit Energiekennzahl 110 50 kWh/m2 a Energiepreis im Jahr 2011 0,1 0,1 Fr./kWh Energiekosten im Jahr 2011 = Energiekennzahl mal Energiepreis 11,0 5,0 Fr./m2 a Kaltmiete im Jahr 2011 200 230 Fr./m2 a warme Miete im Jahr 2011 = Kaltmiete und Energiekosten 211 235 Fr./m2 a Wohnfläche 120 120 m2 Kaltmiete im Jahr 2011 = Wohnfläche mal Kalt­ 2000 miete pro m2 und Jahr, geteilt durch 12 2300 Fr./Monat Warme Miete im Jahr 2011 = Wohnfläche mal Warme Miete pro m2 und Jahr, geteilt durch 12 2110 2350 Fr./Monat Zahlungsbereitschaft für die Bruttomiete 2200 2500 Fr./Monat Tabelle 3: Darstellung Mieter­ träge «saniert» und «unsaniert». 38 Ökonomische Nachhaltigkeit Schwie­riger ist, die funktionale und soziale Alterung zu beschreiben, weil dafür die zu erwartenden ökonomischen, gesellschaft­ lichen und ökologischen Veränderungen berücksichtigt werden müssen. Dazu be­ stehen mindestens für Wohnungen Instru­ mente [5, 6], die jedoch mit der künftigen Nachfrage (den Szenarien) abgestimmt werden müssen. Auf jeden Fall hat eine Immobilie, die verschiedene Nutzungen ermöglicht, ein höheres Potenzial, nach­ haltig Nutzen zu erzeugen als eine, die auf nur eine Nutzung zugeschnitten ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dadurch die Erstvermietung erschwert werden kann, weil kein zielgruppenspezifisches Produkt angeboten wird. Durch regelmässige Instandhaltung res­ pektive Erneuerung wird der Wert der Im­ mobilie über den Lebenszyklus erhalten oder sogar gesteigert. Die Massnahmen haben in geeigneten Abständen systema­ tisch geplant zu erfolgen, bis schliesslich das Bauwerk das Ende seines Lebenszyklus erreicht und rückgebaut wird. Der Lebens­ zyklus der Immobilie umfasst die Prozesse von der ersten Investitionsabsicht, über die Planung, die Erstellung, die Instandhal­ tung, die Erneuerung und den Betrieb bis schliesslich zum Rückbau des Bauwerkes. Zwischen dem Lebenszyklus der Immobi­ lie, den Investitionsmassnahmen und ihrer nachhaltigen Markttauglichkeit besteht also ein zwingender Zusammenhang. Discounted-Cash-FlowMethode Die Discounted Cash Flow Methode dient zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen. Ausgehend von der Unter­ nehmensbewertung, bei der die DCF-Me­ thode seit Jahrzehnten angewandt wird, wurde sie zunehmend auch für die Immo­ bilienbewertung eingesetzt und ist seit ei­ nigen Jahren der Standard [7]. Die Me­ thode wird in SIA 480 «Wirtschaftlich­ keitsrechnung für Investitionen im Hoch­ bau», Norm und Leitfaden, ausführlich erläutert. Discounted Cash Flow heisst auf deutsch «abgezinster Einnahmenüberschuss». In der DCF-Methode werden auf einen ge­ wählten Betrachtungszeitpunkt hin alle zukünftigen, diskontierten jährlichen Net­ toerträge in einer Kennzahl, dem Kapital­ wert, aufsummiert. Eine Investition oder ein Projekt ist dann wirtschaftlich, wenn der Kapitalwert mindestens null ist. Wich­ tig und für Investoren gelegentlich bitter Erzielbare Kaltmiete (Fr. pro Monat) 2500 saniert 4% 5% 6% 7% unsaniert 4% 5% 6% 7% 2000 1500 1000 500 Abbildung 19: Darstellung Kalt­ miete bei steigen­ den Energiepreisen – 2010 2015 2020 2025 Jahr 2030 2035 39 Gebäudeerneuerung – «wir haben doch so viel investiert» – ist, dass die Methode ausschliesslich zukünf­ tige Ertragsüberschüsse berücksichtigt. In­ vestitionen in der Vergangenheit werden in der Berechnung nicht berücksichtigt, deren Folgekosten und Folgeerträge dage­ gen schon; es wird einzig auf den zukünf­ tigen Nutzen abgestellt. Eine Investition, die voraussichtlich keinen Nutzen generie­ ren wird, ist demnach wertlos. Teuerung Die Wirtschaftlichkeitsberechnung dient meistens dem Variantenvergleich. Dieser wird leichter interpretierbar, wenn mit heutigen Preisen gerechnet wird. Davon ausgenommen sind nach SIA 480 Kosten­ elemente, deren Teuerung von der gene­ rellen Teuerung signifikant abweicht, bei­ spielsweise die Energiekosten. Betrachtungszeitraum Für alle Überlegungen zur ökonomischen Nachhaltigkeit einer Immobilie spielt der Betrachtungszeitraum eine wesentliche Rolle. Für eine umfassende Lebenszyklus­ betrachtung sollte die erste grosszyklische Erneuerung abgeschlossen sein, d. h. der Betrachtungszeitraum sollte mindestens 50 Jahre betragen. Voraussetzung dafür ist die Planung der Instandhaltungs- und Erneuerungszyklen, was wiederum dazu führt, dass man sich mit der Lebensdauer der Bestandteile einer Immobilie, d. h. mit der technischen Nachhaltigkeit eines Ob­ jekts, befassen muss. Ausgehend von der Definition der Nach­ haltigkeit der UNO hat der Betrachtungs­ zeitraum ausreichend lang zu sein, um die Interessen der nächsten Generation mit einzubeziehen. Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeitsdefinition ist die Gestal­ tungsfreiheit der zukünftigen Generatio­ nen. Übertragen auf Immobilien bedeutet das, dass wir flexibel nutzbare, leicht rück­ baubare Bauten erstellen sollten. Quellen ]][1] Fondsmedia: Marktstudie Green Buil­ ding: Immobilienökonomie der Zukunft oder kurzlebiger Ökotrend? April 2010 ]][2] EU-Richtlinie (2010/C 123 E/04) zur Ge­samt­energiebilanz von Gebäuden, Mai 2010 ]][3] Steigende respektive erhöhte Ener­ giekosten dürfen im Rahmen des Miet­ rechts auf die Mieter überwälzt werden. ]][4] Begrifflichkeit gemäss Norm SIA 469 Erhaltung von Bauwerken, 1997 ]][5] www.bwo.admin.ch/wbs ]][6] Berner Fachhochschule: Forschungs­ projekt «Wohnqualität und Siedlungs­ struktur» ]][7] RICS, Swiss Valuation Standards, 2007 Kapitel 6 Gebäudehülle Niklaus Hodel Tabelle 4: Anforderungen an den Heizwärmebe­ darf Abbildung 20: Thermografieauf­ nahme: Beispiel ei­ ner guten und einer schlechten (keiner) Dämmung Die Gebäudehülle und deren wichtigsten Bauteile – die Aussenwand, die Fenster, das Dach, die Decken und Böden – müssen neben Architektur und Statik hohe bau­ physikalische Anforderungen bezüglich Wärme, Kälte, Feuchte, Schall und Brand erfüllen. Die Gebäudehülle ist im Zusam­ menspiel mit der Haustechnik der absolut entscheidende Faktor bezüglich des Wär­ mehaushaltes eines Gebäudesystems. Aus diesem Grund ist Qh (Heizwärmebedarf) respektive der gesetzliche Grenzwert Qh,li in MJ/m2 a die zentrale Grösse. Es gelten folgende Primäranforderungen (Tabelle 4). Vor allem bei Altbauten ist der Energiever­ lust über die Bauteile (Transmissionswär­ meverlust) von entscheidender Bedeu­ tung. Mit einer optimal gedämmten Ge­ bäudehülle kann mehr als 50 % der Be­ triebsenergie eingespart werden. Zusätz­ lich spielt auch die thermische Trägheit (Masse) eine bis heute noch etwas unter­ schätzte Rolle bezüglich des Energiehaus­ haltes. Die Transmissionswärmeverluste und die sich ergebenden Oberflächentem­ peraturen lassen sich mit Infrarotaufnah­ men visualisieren. Die Aufnahmen ermög­ lichen Vergleiche, Wärmeverluste werden dadurch nicht quantifiziert. In diesem Kontext spielen Wärmedämm­ stoffe eine ganz zentrale Rolle. Es existiert auf dem Markt eine Vielzahl von bereits älteren, bewährten und zum Teil ganz neu entwickelten organischen und anorgani­ schen Dämmstoffen. Die wichtigste Kenn­ grösse für einen Dämmstoff ist die Wär­ meleitfähigkeit λ in W/m K. Ergänzend dazu werden aber auch andere Aspekte wichtig wie die graue Energie, die Eignung für den Rückbau und das Recycling sowie weitere ökologische Kriterien (www.ecobau.ch). Gebäudehüllen sind aber nicht nur Energieverlustfaktoren, sondern je nach Ausrichtung und Umgebung lässt sich Energie gewinnen, einerseits passiv durch die Fenster in den Innenraum, ande­ rerseits durch aktive solare Systeme auf Dächern oder an Wänden. Anforderungen an den Neubau Umbau Heizwärmebedarf 1,25 Qh,li Gesetzliche Anforderungen 1,0 Qh,li Minergie 0,9 Qh,li keine 0,8 Qh,li Minergie-P 0,6 Qh,li Anmerkung: Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Bauten (Aufstockungen, Anbauten, etc.) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass höchstens 80 % des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneu­ erbaren Energien gedeckt werden. Davon sind Erweiterungen von bestehenden Bauten befreit, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2 beträgt oder maximal 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als 1000 m2 beträgt. Quelle: Mustervorschriften der Kantone 2008; sie gelten in den meisten Kantonen. Exkurs: Der Heizwärmebedarf, definiert durch die Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», quantifiziert den Wärmebedarf für ein Gebäude bei definierten Standardbedin­ gungen auf der Stufe Nutzenergie. Die Effizienz der Wärmeer­ zeugung ist damit nicht beschrieben, weil der Heizwärmebe­ darf an der Schnittstelle zwischen Gebäude und Wärmeerzeu­ gung erhoben wird. 42 Gebäudehülle Energievorschriften Um 1960: In einzelnen kantonalen Bauge­ setzen wird ein ausreichender Wärme­ schutz von U=1,0 W/m2 K für Aussen­ wandkonstruktionen gefordert. Um 1975: In Folge der Erdölkrise (1973), Minimalvorschriften für mittlere U-Werte, gepaart mit Mindestvorschriften für Ein­ zelbauteile gemäss Empfehlung SIA 180/1 «Winterlicher Wärmeschutz». In dieser Zeit beginnt die industrielle Grossproduk­ tion von Wärmedämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle, Polystyrole). Um 1990: Festlegen von Grenz- und Ziel­ werten für den Jahresverbrauch pro m2 Energiebezugsfläche (EBF) bei Standard­ nutzungen für ein Gebäude gemäss Emp­ fehlung SIA 380/1. Ab 2009: Mustervorschriften der Kantone (MuKEn) und damit viele kantonale Ener­ giegesetze und Energieverordnungen be­ ziehen sich hinsichtlich der Grenz- und Zielwerte und der Art der Verfahren auf die SIA Norm 380/1 «Thermische Energie im Hochbau». Ab 2020: Im EU-Raum ist der Standard Fast-Nullenergiehaus Pflicht. Bei bestehenden Bauten wird zwischen zwei Arten von Vorgaben unterschieden: Für Anbauten, Aufstockungen und neu­ Energiekennzahl Wärme in kWh/m2a 220 Wirkung der Erneuerungen 1990 bis 2005 200 180 Stand 1990 160 140 Reduktionspotenzial bei bestehenden Wohnbauten für Minergie-P 120 nach 95 91 bis 95 1986 bis 1990 1981 bis 1985 1976 bis 1980 1971 bis 1975 1961 bis 1970 40 1946 bis 1960 60 vor 1920 80 1920 bis 1945 Stand 2005 100 20 Minergie-PStandard 0 Abbildung 22: SIA Effizienzpfad Energie 6000 Watt/Person Heute 2000 Watt/Person Ziel SIA Effizienzpfad Wohnen Baumaterial Mobilität Büro Schulen z.B. Industrie, Landwirtschaft, Freizeit Raumklima Warmwasser Licht und Apparate 3 Zielgruppen Abbildung 21: Energiebedarf des Gebäudebestandes und das entspre­ chende Optimie­ rungspotenzial bei­ spielhaft für den Kanton Zürich. Quelle: AWEL 5 Themenbereiche 3 Nutzungen Energiebezugsfläche 78 Mio. m2 Massnahmen für Politiker+ Behörden Investoren Planende 43 Gebäudeerneuerung Wärmeleitfähigkeit von Wärmedämmstoffen λ [W/mK] Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk ohne Füllung (0,08 bis 0,12) 0,100 0,095 Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk mit Füllung (0,06 bis 0,09) 0,090 0,065 0,060 0,055 0,050 Schaumglas (Platten) Zellulose (Platten) Zellulose (lose) 0,045 Kork Steinwolle (Platten, Glaswolle Matten, (Platten, Rollen) Matten, Rollen) λD Wärmedämmputz Polystyrol Polystyrol expandiert EPS extrudiert XPS (15 bis 40 kg/m2) (Zellinhalt Luft) 0,040 Polyurethan PUR 0,035 (Zellinhalt Pentan, diffusionsoffen) 0,030 0,025 Polyurethan PUR (Zellinhalt Pentan, diffusionsdicht) λD EPS grau λD Phenolharz Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) bei «Ausfall» (ohne Vakuum) 0,020 0,015 λD Aspen Aerogel 0,010 λD VIP (dWD bis 25 mm) λD VIP (dWD ab 30 mm) 0,005 0 HLWD SIA 279: Bemessungswert λ für nicht überwachte Produkte SIA 279: Nennwert λD für überwachte Produkte (schlechtester Wert) SIA 279: Nennwert λD für überwachte Produkte (bester Wert) Bauteil gegen Bau­ teil Opake Bauteile (Dach, Decke) (Wand, Boden) Opake Bauteile mit Flächenheizungen Fenster, Fenstertüren Fenster mit direkt vorgelagerten Heiz­ körpern Türen Tore (Türen grösser als 6 m2) Storenkasten Abbildung 23: Für Wärmedämm­ stoffe sind die Kennwerte aus Norm SIA 279 bzw. aus Merkblatt SIA 2001 zu berücksich­ tigen. Produkte mit einem λ-Wert von unter 0,030 gehö­ ren zu den Hoch­ leistungswärme­ dämmstoffen (HLWD). In der Norm SIA 279 (2010) werden neu auch Mauerwerks­ produkte dekla­ riert. Tabelle 5: Grenz- und Ziel­ werte für flächen­ bezogene Wärme­ durchgangskoeffizi­ enten bei 20 °C Raumtemperatur für vom Umbau oder von der Um­ nutzung betroffene Bauteile. Grenzwerte Uli in W/m2 K Aussenklima oder Unbeheizte Räume weniger als 2 m im oder mehr als 2 m Erdreich im Erdreich Zielwerte Uta in W/m2 K Aussenklima oder Unbeheizte Räume weniger als 2 m im oder mehr als 2 m Erdreich im Erdreich 0,25 0,25 0,25 0,28 0,30 0,28 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 1,3 1,6 0,90 1,1 1,0 1,3 0,80 1,0 1,3 1,7 1,6 2,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,50 0,50 0,30 0,30 44 Gebäudehülle bauartige Umbauten gelten die Neubau­ anforderungen. Für Umbauten und Um­ nutzungen gelten die Anforderungen für den Umbau. Diesbezüglich gibt die SIA 380/1 Grenzwerte der System-Anforde­ rung (entsprechend 125 % der Anforde­ rungen für Neubauten) wie auch Einzel­ bauteil- Anforderungen vor. Ein Zwang für wärmetechnische Sanierungen besteht in der Schweiz nicht. Sofern aber Massnah­ men an der Bauhülle getroffen werden, sind diese gesetzeskonform zu realisieren. Entscheidend ist die Eingriffstiefe der Massnahmen. Anwendbar sind bei erheb­ lichen Eingriffen die Umbauvorschriften. Veränderungsstrategien Abbildung 24: Durchschnittliche Wärmeverluste ei­ nes Mehrfamilien­ hauses aus den 60er-Jahren mit ei­ nem Verbrauch von 20 l Öl pro m2. Für jedes Gebäude sowie dessen Bauteile sind ganz unterschiedliche Verbesserungs­ strategien möglich. Renovation: Massnahmen zur Bewah­ rung des Soll-Zustandes oder Verbesse­ rung des Ist-Zustandes Sanierung: Massnahmen zur Verbesse­ rung des Bauzustandes bzw. zur Errei­ chung des Soll-Zustandes (z. B. Wärmeund Schallschutz). Je nach Vorgabe des Soll-Zustandes verändert sich die Eingriffs­ tiefe (z. B. Sanierung nach Vorschrift oder nach Minergie, Minergie-P, Passivhaus etc.) Erneuerung: Bauteile können als Gesam­ tes erneuert werden, so dass diese den Warmwasser 10% Heizung Außenwand 13% 20% 17% 8% Dach Fenster 5% Keller 27% Lüftung aktuellen technischen und bauphysikali­ schen Anforderungen entsprechen. Transformation: Ein Bauteil übernimmt neue Aufgaben infolge Umnutzung, Er­ weiterung oder Transformation (z. B. Da­ chausbau, Anbau, Umbau, etc.). Ersatz: Bauteile oder das Gebäude selbst werden vollständig rückgebaut und durch andere, neue Bauteile ersetzt. Es gibt grundsätzlich drei wesentliche Schritte zur energetischen Ertüchtigung eines Gebäudes. Die Reihenfolge ent­ spricht den Prioritäten. Minimierung der Verluste: gute Dämm­ werte für Aussenbauteile von U unter 0,20 W/m2 K anstreben, Wärmebrücken redu­ zieren respektive vermeiden, luftdichte Gebäudehüllen anstreben, Komfortlüf­ tung mit Wärmerückgewinnung einbauen. Maximierung der Gewinne: Fenster res­ pektive Gläser mit hohem g-Wert und tie­ fem U-Wert vorsehen; Fensterflächen ge­ gen Süd, Südost und Südwest möglichst maximieren und nicht verschatten; interne Speichermasse erhöht den Solargewinn. Energie möglichst erneuerbar und effi­ zient gewinnen und nutzen: Den Rest­ bedarf an Wärme für Heizen und Warm­ wasser möglichst mit erneuerbaren Ener­ gien decken. Die dafür notwendigen Haustechniksysteme sollten dem Bedarf und dem Gebäude angepasst sein und eine effiziente Energieproduktion ermögli­ chen (Energieträger, Wärmeerzeugung, Verteilsystem, Lüftungsanlage). Fassaden Vor 1920: Die Bautechnik war vor 1920 häufig gekennzeichnet durch eine histori­ sierende Formensprache, es wurden zahl­ reiche Verzierungen aus verschiedenen vorhergehenden Architekturepochen ver­ wendet. Handwerkliche Qualität und ho­ her personeller Aufwand waren notwen­ dig. Die Grundmauern der Gebäude wur­ den mit einem einschaligen Mauerwerk erstellt. Diese Häuser sind heute oft ge­ schützt, so dass energietechnische Mass­ nahmen sehr schwierig zu realisieren sind. Bis ca. 1960: Homogene und aus wenigen Schichten aufgebaute Mauerwerke mit UWert um 1,2 W/m2 K. 45 Gebäudeerneuerung Um 1970/80: Mehrschichtige (mit mini­ maler Wärmedämmung) und homogene Mauerwerke aus verschiedensten Materia­ lien mit U-Werten von 0,4 bis 0,8 W/m2 K. Ab 1990: Entwicklung von hochdämmen­ den Aussenwandsystemen mit U unter 0,20 W/m2 K. Massnahmen: Bei Häusern aus den Grün­ derjahren und auch bei etwas jüngeren Bauten sind z. B. die Gewände der Fenster und Türen aus Naturstein und nicht selten schön verziert. Eine aussen liegende Däm­ mung scheint aus architektonischen und denkmalpflegerischen Gründen kaum möglich. Vielfach ist auch eine innen lie­ gende Wärmedämmung nicht möglich, so dass bei solchen Häusern an der Aussen­ wand nur dünne Dämmputzschichten ein­ gesetzt werden können – und auch dies nur unter Umständen. Die bauphysikalisch und energetisch sinn­ vollste Sanierung ist eine möglichst vollflä­ chige Aussenwärmedämmung. Die ther­ misch aktive und erwünschte Masse bleibt im Haus (innerhalb des Dämmperimeters), U-Werte mit λ = 0,038 W/mK d = 15 cm; U = 0,20 – 0,23 W/m2 K d = 20 cm, U = 0,17 – 0,20 W/m2 K d = 25 cm; U = 0,13 – 0,15 W/m2 K 6 54 3 2 1 Konstruktionsaufbau 1 Innenputz (bestehend) Konstruktionshinweise ]] Das innere, tragende Mauerwerk kann aus Backstein-, Bruchsteinmauerwerk oder Be­ tonschale bestehen. ]] Materialien: Mineralwollplatten (Steinwolle und Glaswolle) 2 Mauerwerk bestehend (variabel) 3 Wärmedämmschicht (variabel) 4 Fassadenunterkonstruktion/ Hinterlüftung 5 Fassadenverkleidung/Wetterschutz/Solaranlage Abbildung 25: Aussendämmung hinterlüftet 6 wärmegedämmte Konsole oder Holzunter­ konstruktion U-Werte mit λ = 0,06 W/mK d = 3 cm; U = 1,1 – 1,4 W/m2 K d = 5 cm; U = 1,0 – 1,2 W/m2 K d = 10 cm; U = 0,6 – 0,8 W/m2 K 5 43 2 1 Konstruktionsaufbau 1 Innenputz (bestehend) 2 Mauerwerk bestehend (variabel) 3 Haftbrücke 4 Wärmedämmputz (verschiedene Produkte) 5 Deckputzbeschichtungssystem Konstruktionshinweise ]] Das innere, tragende Mauerwerk kann aus Backstein-, Bruchsteinmauerwerk oder Be­ tonschale bestehen. ]] Der Dämmputz wird üblicherweise in Stär­ ken von 2 cm bis 8 cm aufgetragen, für die Anwendung sind die entsprechenden Pro­ dukteangaben massgebend. ]] Dämmputze können in variablen Stärken appliziert (Fenstergewände, Fensterleibun­ gen, Fassade) und sie können auch innen oder als Kombination zu einer Innen- oder Aussendämmung appliziert werden. Abbildung 26: Dämmputz aussen/ innen 46 Gebäudehülle das Kondensationsrisiko in der Konstruk­ tion wird minimiert und die Wärmebrü­ cken werden eliminiert oder mindestens reduziert. Zusätzlich besteht die Möglich­ keit, bei genügend dicker Dämmung ge­ wisse Haustechniksysteme wie z. B. Lüf­ tung, Sanitär und Elektro in dieser Däm­ mung zu führen. Natürlich darf es sich nur um Teile handeln wie Rohre, Leitungen, Kabel, etc., bewegte Komponenten wie Klappen, Ventile, Regler irgendwelcher Art, etc., müssen zugänglich bleiben. Varianten von Fassadenerneuerungen Möglich sind Kompaktfassaden, besser je­ doch sind hinterlüftete Systeme mit Mine­ ralwolle und entsprechendem Witterungs­ schutz. Dieser Witterungsschutz kann mit dünnen Fotovoltaik-Elementen gewähr­ leistet wer­den. ]]Wo nur wenig Aufbaustärke möglich ist und ein muraler Charakter erhalten wer­ den soll, kann sich ein Wärmedämmputz sehr gut eignen. Er kann je nach Produkt bis zu einer Schichtdicke von ca. 8 cm auf­ getragen werden. U-Werte mit λ = 0,008 W/m K d = 2 cm; U = 0,20 – 0,40 W/m2 K d = 4 cm; U = 0,15 – 0,20 W/m2 K d = 6 cm; U = 0,10 – 0,15 W/m2 K 6 543 2 1 Konstruktionsaufbau 1 Innenputz (bestehend) 2 Mauerwerk bestehend (variabel) 3 Dampfbremse (je nach Aufbau) 4 VIP-Panel 10 mm bis 30 mm* 5 zusätzliche Wärmedämmung 6 Aussenputzsystem Abbildung 27: VIP-Dämmung au­ ssen * nur wenn kein anderes Material möglich Konstruktionshinweise ]] Eine sorgfältige Planung und auch Verar­ beitung ist unabdingbar. ]] Platten können nicht zugeschnitten wer­ den, Restflächen mit herkömmlicher Wärme­ dämmung verlegen. ]] VIP-Dämmung in Kombination mit her­ kömmlichen Systemen oder Mineralwolle kombinieren ]] Hauptanwendungsbereich im Bau sind die Terrassendämmungen bei Attikawohnungen (Neubau). ]] Hersteller-Anwendungen speziell beach­ ten, weil für Fassaden erst Spezialfälle und Prototypen vorhanden. U-Werte mit λ = 0,04 W/m K d = 5 cm; U = 0,60 – 0,80 W/m2 K d = 10 cm; U = 0,30 – 0,40 W/m2 K d = 15 cm; U = 0,20 – 0,25 W/m2 K 5 4 3 21 Konstruktionsaufbau 1 Innenputz, Verkleidung 2 Dampfbremse (abgestimmt auf Dämmung) 3 Wärmedämmung 4 Mauerwerk (bestehend) Abbildung 28: Innendämmung 5 Aussenputz (bestehend) Konstruktionshinweise ]] Durch die Innendämmung entstehen Wär­ mebrücken an Decken, Wänden und Sockel. ]] Bei einer Innendämmung muss die Dampf­ diffusion zwingend überprüft werden, mit Dampfbremse oder dampfbremsenden Ma­ terialien (Schaumglas) arbeiten. ]] Anschlüsse, Fugen und Übergänge müssen dicht ausgebildet werden. ]] Es kann auch mit Dämmputzen gearbeitet werden, evtl. in Kombination mit reduzierter Aussendämmung. 47 Gebäudeerneuerung θi = +20°C U = 0,095 W/m2K θi = +20 °C U = 0,098 W/m2K Ψ = 0,059 W/mK Ψ = 0,004 W/mK Ug = 0,50 W/m2K θe = –10°C θi = +20 °C θe = –10 °C 15 17 θi = +20 °C 19 19 12 Ψ = 0,383 W/mK 19 12 12 Ψ = 0,127 W/mK θk = +12 °C θk = +12 °C 11 –9 9 –9 –9 –9 –8 10 –8 9 –7 –7 –6 –6 –5 –5 9 –4 –4 10 11 –3 –3 –2 –2 –1 –1 10 11 0 0 1 1 2 3 4 5 Transmissionswärmeverluste Aussenwand (Brüstung/Sturz) Fenster Wärmebrücken: Fenstereinbau Deckenauflager/Sturz Sockel Total 6 7 8 [W/m] 7,9 34,6 9 [%] 12,2 53,4 9,0 13,9 1,8 2,8 11,5 17,7 64,8 100,0 2 3 4 5 6 Transmissionswärmeverluste Aussenwand Wärmebrücken: Deckenauflager Sockel Total 7 8 9 [W/m] 14,0 [%] 78,2 0,1 3,8 17,9 0,6 21,2 100,0 Abbildung 29: Für Sanierungen im Minergie-P-Stan­ dard ist die Aussen­ wärmedämmung (verputzt oder mit hinterlüfteter Be­ kleidung) wohl die effektivste Möglich­ keit. Gegenüber dem Ist-Zustand kann der Wärme­ verlust um 76,7 % auf 64,8 W/m redu­ ziert werden (Fassa­ denschnitt mit Fens­ ter) bzw. um 89,6 % auf 17,9 W/m (Fas­ sadenschnitt ohne Fenster). Der Wär­ mebrückeneinfluss ist mit 21,8 % bis 34,4 % gross, wobei primär der Sockel und der Fensterein­ bau relevant sind. (Quelle: Marco Ra­ gonesi/Faktor Ver­ lag) 48 Gebäudehülle Abbildung 30: Zugegeben, im Kontext Minergie-P wird wohl niemand ernsthaft in Erwä­ gung ziehen, ein Gebäude mittels In­ nenwärmedäm­ mung (z. B. mit VIPPanels wie in die­ sem Beispiel) zu sa­ nieren. Durch den Wärmebrückenein­ fluss (Sockel, De­ ckenauflager, Sturz) von 62,3 % bis 73,4 % hält sich der Erfolg in Grenzen. Beim Fassaden­ schnitt mit Fenster kann der Wärme­ verlust um 60 % auf 111,2 W/m redu­ ziert werden und beim Schnitt ohne Fenster um 69,3 % auf 52,7 W/m. Trotz analoger Bauteil­ kennwerte ist der Wärmeverlust ge­ genüber der aussen wärmegedämmten Gebäudehülle um 71,6 % bis 194,4 % grösser. (Quelle: Marco Ragonesi/ Faktor Verlag) θi = +20 °C U = 0,096 W/m2K 1315 17 θi = +20 °C U = 0,098 W/m2K 15 17 19 Ψ = 1,283 W/mK 19 Ψ = 0,648 W/mK Ug = 0,50 W/m2K θe = –10 °C θi = +20 °C θe = –10 °C 11 15 17 18 θi = +20 °C 19 1315 17 18 19 12 12 2 Ψ = 0,727 W/mK Ψ = 0,645 W/mK θk = +12 °C 5 3 –7 –9 –8 –7 –9 4 –8 –7 –9 5 –9 5 –8 6 –8 6 –7 –7 7 –6 7 –6 –5 θk = +12 °C –5 8 –4 –3 8 –4 9 10 11 9 –3 –2 –2 –1 –1 0 0 1 2 3 4 5 6 Transmissionswärmeverluste Aussenwand (Brüstung/Sturz) Fenster Wärmebrücken: Fenstereinbau Deckenauflager/Sturz Sockel Total 7 8 [W/m] 7,3 34,6 9,0 38,5 21,8 111,2 9 1 2 3 4 5 6 [%] Transmissionswärmeverluste 6,6 Aussenwand 31,1 Wärmebrücken: Deckenauflager 8,1 Sockel 34,6 Total 19,6 100,0 10 7 11 8 9 [W/m] 14,0 [%] 26,6 19,4 19,3 52,7 36,8 36,6 100,0 49 Gebäudeerneuerung ]]Für die nachträgliche Aussendämmung noch wenig erprobt sind Anwendungen von Hochleistungswärmedämmstoffen (VIP) aus teilevakuiertem Dämmmaterial oder aus Aerogel. ]]Vielfach bieten Innendämmungen eine Alternative. Diese bergen aber gewisse Ri­ siken. Durch eine Innendämmung wird die innere Masse abgekoppelt und die Hüllen­ konstruktion wird in den Kaltbereich ver­ schoben. Es entsteht eine Vielzahl von Wärmebrücken, z. B. bei Wand- und De­ ckenanschlüssen, bei Fensterleibungen, bei durchgehenden Balkonplatten. Das Scha­ densrisiko steigt infolge der tieferen Ober­ flächentemperaturen (erhöhte Feuchtig­ keit, Oberflächenkondensat) und bei un­ dichten Anschlüssen kann es innerhalb des Bauteils zu Feuchteschäden kommen. Oft kann eine Kombination aus Innen- und Aussendämmung zu einem bauphysika­ lisch und energetisch guten Resultat füh­ ren. 2-fach-Verglasung Hoher Durchlass von Tageslicht (80%) Solare Energiegewinne Wärmedämmbeschichtung Wärmereflexion Die technischen Daten Element- Ug-Wert nach g-Wert nach Lichttrans- Lichtreflexion dicke EN 673 (W/m2K) EN 410 (%) mission (%) (%) 24 1,0 Abbildung 31: Glastypen (Glas Troesch) Abbildung 32: Vakuum-Glas 80 13 3-fach-Verglasung Hoher Durchlass von Tageslicht (74%) Solare Energiegewinne Wärmedämmbeschichtungen Fenster Bestand: Der Gebäudebestand verfügt grösstenteils über Isolationsverglasungen (IV) unterschiedlicher Qualität und sicher­ lich haben diverse alte Häuser noch eine Doppelverglasung. Die Einfachverglasung dürfte bis auf ganz wenige Ausnahmen verschwunden sein. Einzelne Bürohäuser sind noch mit Spezialgläsern ausgerüstet (Einfärbungen, bronzierte und beschich­ tete Gläser, etc.). Zudem wird es noch eine ganze Menge von Gebäuden geben (Schu­ len, Bürobauten, Museen, etc.), die zwar Isolier-Verglasungen einer frühen Genera­ tion haben, aber noch thermisch unge­ trennte (Alu-) Fensterprofile, die sehr gosse Wärmebrücken darstellen. Massnahmen: Verglasungen haben in den letzten 20 Jahren technologisch sehr grosse Fortschritte gemacht. Spezielle Gasfüllungen wie Argon oder Krypton und vor allem die Infrarot-Beschichtungen (IR) und die 3-fach-IV-Gläser mit zwei IR-Be­ schichtungen haben die Verglasung revo­ lutioniert. Die ersten IV-Gläser mit Alumi­ nium Glasrandverbund und Luftfüllung weisen U-Werte von über 2,5 W/m2 K auf. Die neuen Gasfüllungen und vor allen die 60 Gasfüllgrad: 90% Argon Wärmereflexion Die technischen Daten Element- Ug-Wert nach g-Wert nach Lichttrans- Lichtreflexion (%) dicke EN 673 (W/m2K) EN 410 (%) mission (%) 40 1,0 64 74 20 36 0,8 60 73 19 40 0,7 60 73 19 Gasfüllgrad: 90% Argon U-Wert: 0,5 W/m2 K Wärmestrom Stütze evakuierter SZR ca. 0,7 mm gasdichter Randverbund Funktionsschicht Glas: Standard 4 mm 50 Gebäudehülle Abbildung 33: Denkmalschutzsa­ nierung eines ein­ fachverglasten Fensters durch Auf­ doppelung von au­ ssen mit einem zu­ sätzlichen Rahmen/ Glas (wärmeschutz­ beschichtet). Abbildung 34: Sanierung eines doppeltverglasten Fensters durch Um­ bau auf Wärme­ schutzverglasung. Bei den Abstandhal­ tern ist darauf zu achten, dass sie aus schlecht wärmelei­ tendem Material bestehen (z. B. Kunststoff). Abbildung 35: Kastenfenster mit Winterfenster (au­ ssen) und Sommer­ fenster (innen). IR-Beschichtungen führen zu Werten von 1,1 bis 1,4 W/m2 K. Neue 3-fach-IV-Vergla­ sungen mit 2 IR-Beschichtungen weisen Werte von 0,5 W W/m2 K auf. Die neuste Vakuum-Technologie wird Verglasungen hervorbringen, die bei weniger Glasschich­ ten noch einmal wesentliche Verbesserun­ gen ermöglichen. Die Fensterrahmen haben ebenfalls eine wesentliche Entwicklung hinter sich, aber nicht ganz in dem Masse wie die Vergla­ sungen. Gute Rahmen weisen heute UWerte von unter 1,4 W/m2 auf. Mit Spezi­ alrahmen können heute Fensterkonstruk­ tionen (Windows) von Uw unter 1,0 W/ m2 K mit Ug = 0,6 W/m2 K (Glas) hergestellt werden. Die nicht immer einfachste, aber wir­ kungsvollste Massnahme ist der vollstän­ dige Fensterersatz. Bei Fenstern wird mit einer wirtschaftlichen Lebensdauer von 25 Jahren gerechnet. In Häusern mit Jahr­ gang 1980 und älter dürfen mit gutem Gewissen die Fenster gewechselt und mit neuen, technisch wesentlich verbesserten Konstruktionen ersetzt werden. Ein Fens­ terersatz kann zu Energieeinsparungen von bis zu 30 % führen. Es sei jedoch dar­ auf hingewiesen, dass der Einsatz von hochdämmenden und vor allem dichten Fenstern ein verändertes Nutzerverhalten bedingt. Der Luftaustausch und die Ent­ sorgung von übermässiger Luftfeuchte sind in einem undichten Gebäude gesi­ chert. Im sanierten Haus müssen die Nut­ zer für diesen Luftaustausch sorgen, so­ fern keine Lüftungsanlage installiert ist. Bei geschützten Gebäuden kann ein Ersatz der Verglasung die Energieverluste min­ dern und die Behaglichkeit verbessern. Bei geschützten und noch intakten DoppelVerglasungen kann eine Sanierung und Dichtung, eine Aufdoppelung in Form ei­ nes Kastenfensters oder die Reaktivierung des Vorfensters zum Ziel führen. Dabei ist klar festzulegen, wo die Dämm- und vor allem die Dichtungsebene durchlaufen sol­ len, um Kondensat zu vermeiden. Thermi­ sche Schwachpunkte bei der Erneuerung von Fenstern sind häufig die Storenkästen. Verbesserungsmassnahmen sind technisch schwierig und entsprechend aufwendig. vor Sanierung nach Sanierung vor Sanierung nach Sanierung 51 Gebäudeerneuerung Fenster restaurieren Fenster sind die Augen eines Hauses, kommentiert der Heimatschutz Basel sei­ nen Vorschlag, alte Fenster – statt gänz­ lich zu ersetzen – behutsam nachzurüs­ ten. Tatsächlich wirken stämmige Rah­ men von neuen Fenstern in fein geglie­ derten Fassaden älterer Bauten häufig wie eine Faust aufs Auge. Besonders deutlich wird ein derartiger gestalteri­ scher Missgriff bei Jugendstil- und Grün­ derjahrhäusern. Auf der anderen Seite sind sowohl das Komfortmanko als auch der Energieverbrauch dieser Altbaufens­ ter enorm. In der Regel sind sie als Kas­ tenfenster konzipiert mit einem Vorfens­ ter, auch als Winterfenster bezeichnet, und einem inneren Sommerfenster. Der Wärmedurchgang ist vier- bis fünfmal grösser als bei einem heute üblichen, dreifach verglasten Neubaufenster. Na­ heliegend erscheint die Lösung, das in­ nere Fenster durch ein neues Produkt mit Isolierverglasung zu ersetzen. Der Eingriff lässt sich durch das Vorfenster kaschie­ ren. Weil diese vorgehängten Fenster als Ergänzung zum Hauptfenster weder Wärmeschutz noch Schallschutz bieten, besteht die Gefahr, dass sie mit der Zeit offen bleiben oder gar im Keller ver­ schwinden. Die Kampagne des Heimatschutzes zielt auf eine Nachrüstung der bestehenden Fenster in geschützten oder aus architek­ tonischen Gründen geeigneten Häusern. Im Vordergrund stehen zwei Massnah­ men, nämlich der Einbau eines beschich­ teten Glases und einer Falzdichtung in den alten Fensterrahmen. Wie Berech­ nungen eines Bauphysikers zeigen, würde der Wärmeverlust der Fenster auf­ grund der Nachrüstung auf die Hälfte sinken. Auf ein Einfamilienhaus bezogen, resultierte eine Sparquote von etwa 350 Liter Heizöl pro Jahr, was rund zehn Pro­ zent der gesamten Heizwärmeverluste ausmache. (Auf die Fenster entfällt unge­ fähr ein Fünftel dieser Verluste.) Häufig kommt der Einbau von Isolierverglasun­ gen aufgrund ihres Gewichtes nicht in Frage. Die Rahmen würden das noch aushalten, meint Paul Dilitz vom Heimat­ schutz Basel, aber nicht die Scharniere. Dieses Problem stelle sich mit der Mon­ tage eines Einfachglases kaum. Durch die Beschichtung der äusseren Glasfläche verbessert sich der Wärmeschutz im Ver­ gleich zu einem unbeschichteten Glas um 30 Prozent. Mit einem zweiten gleichwertigen Glas im Vorfenster stei­ gert sich der Effekt noch deutlich. Eine derartige Duplizierung der Massnahme ist beim Einbau von Dichtungen sozusa­ gen verboten. Denn die Dichtung im äu­ sseren Vorfenster würde einen geschlos­ senen Luftraum zwischen den Fenstern erzwingen, der sich abkühle und dadurch Kondenswasser ausscheide. Beschlagene Fensterscheiben während der Heizperi­ ode wären die Folge. Die Gummidich­ tung im inneren Sommerfenster redu­ ziert gemäss den bauphysikalischen Be­ rechnungen den Luftaustausch um rund 80 Prozent. Mit fachgerecht eingebauten Falzdichtungen würden die Anforderun­ gen an neue Fenster erreicht, begründen die Bauphysiker diese Massnahme. Die grosse Luftmenge, die durch unsanierte Fenster abströmt, hängt auch mit den durch die Kleinteiligkeit der Flügel und Oberlichter bedingten grossen Fugenlän­ gen zusammen. Für ein zwei Quadratme­ ter grosses Fenster braucht es typischer­ weise zwölf Meter Gummidichtung. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Ertüchti­ gung von historischen Fenstern keines­ wegs eine Billiglösung ist. In den meisten Fällen dürfte der komplette Ersatz des Altfensters durch ein neues Normfenster sogar kostengünstiger sein. Neue Wär­ meschutzfenster bringen auch einen hö­ heren Komfort und einen tieferen Ener­ gieverbrauch. Mitunter sind diese Argu­ mente allerdings nachrangig. Vor allem bei Baudenkmälern und architektonisch respektive historisch wertvollen Gebäu­ den ist der sorgfältige Umgang mit der Bausubstanz von grosser kultureller Be­ deutung. 52 Gebäudehülle U-Werte Gläser Rahmenkonstruktionen 2-fach IV, Ug = 1,1–1,4 W/m2 K (je nach Fül­ Holz-Rahmen Uf = 1,2–1,6 W/m K 2 Holz-Metall-Rahmen Uf = 1,3 –1,6 W/m K 2 Kunststoff-Rahmen Uf = 1,3 –1,6 W/m2 K Metallrahmen Uf = 1,5 –1,9 W/m2 K lung) 3-fach IV, Ug = 0,4 – 0,7 W/m2 K (je nach Fül­ lung) 4-fach IV, Ug < 0,40 W/m2 K (je nach Füllung) Vakuum-Glas 2-fach Ug < 0,5 W/m2 K Konstruktionshinweise ]] Der Glasrandverbund von Aluminium (ψ = 0,07 W/m K ), Edelstahl (ψ = 0,05 W/m K) oder Kunststoff (ψ = 0,03 W/m K) muss in Berechnung einbezogen werden. ]] Eine Zentrale Grösse neben dem U-Wert spielt der g-Wert (Energiedurchlassgrad) für die passiven Solargewinne in der Heizperi­ ode. ]] Je nach Glas, Rahmenwerten und Rah­ menanteilen kann dies Fenster U-Werte erge­ ben von 0,8 –1,3 W/m2 K (müssen speziell berechnet werden). ]] Wärmebrücken, verursacht durch die Fens­ terleibungen müssen speziell berechnet und mit einbezogen werden. Abbildung 36: Fenster, Gläser 8 6 U-Werte mit λ = 0,034 W/m K 7 5 43 21 Konstruktionsaufbau 1 Innenverkleidung 2 Installationshohlraum 3 Dampfbremse 4 Überdämmung 4 cm bis 6 cm 5 Sparrenvolldämmung 6 Unterdach bestehend (diffusionsoffen) 7 Konterlattung, Unterlüftung bestehend 8 Lattung, Eindeckung bestehend, evtl. Solaranlage Abbildung 37: Steildach d = 15 cm; U = 0,20 – 0,23 W/m2 K d = 20 cm; U = 0,15 – 0,18 W/m2 K d = 25 cm; U = 0,10 – 0,13 W/m2 K 4 Überdämmung 4 – 6 cm Konstruktionshinweise ]] Bei vorhandenem Unterdach und intakter Dacheindeckung kann der Aufbau von innen erfolgen, Überprüfung der Dampfdiffusion erforderlich. ]] Wenn kein Unterdach vorhanden ist und der Eingriff nur von innen passieren kann, entstehen entsprechende Risiken bezüglich Funktionstüchtigkeit der Wärmedämmung und des von innen angebrachten Unterda­ ches (dieses Vorgehen ist nicht zu empfeh­ len). ]] Die Überdämmung innen verbessert den Dämmwert und reduziert die Wärmebrücken. ]] Für die innere Verkleidung möglichst schwere Materialien wählen (z. B. Gips), som­ merlicher Wärmeschutz. ]] Wenn das Dach neu ganz gemacht wird, können die Aufbauten gemäss Neubau er­ stellt werden. 53 Gebäudeerneuerung Bei vielen Projekten steht eine zweite Glas­ fassade als Teil einer Doppelfassade zur Diskussion. Voraussetzung für eine kom­ fortable Nutzung im Sommer – und Ener­ giegewinn im Winter – sind Öffnungen in der äusseren Hülle. Eine solche flexible, mechanisch gesteuerte Zweitehaut-Fas­ sade ist sehr aufwendig und wird im Sanie­ rungsbereich wenig angewendet. Steildach Bestand: In alten städtischen Häusern mit Mansardendach befinden sich sehr oft ein­ zelne schlecht gedämmte, qualitativ min­ derwertige Kleinwohnungen im Dachge­ schoss. In anderen Bauten sind die Dach­ räume als Kalträume konzipiert, da sie vorwiegend als Lager- und Stauraum ver­ wendet werden. Diese Dächer verfügen sehr oft über keine Unterdachkonstruktio­ nen. Zum Teil werden diese Dachräume ausgebaut und die Dächer als Kaltdach ausgebildet und minimal gedämmt U = 0,5 bis 1,0 W/m2 K. Trotz dieser Dämmung besteht sowohl im Winter als auch im Sommer ein Behaglichkeitsdefizit, so dass diese Räume nur teilzeitlich benutzt wer­ den können. Massnahmen Die sicherste und einfachste Erneuerungs­ variante ist der Neuaufbau des Daches. Es kann eine Kalt- oder Warmdachkonstruk­ tion gewählt werden, mit Dämmung zwi­ schen oder auf den Sparren. Schwieriger wird es, wenn entweder nur von innen oder nur von aussen gearbeitet werden kann. Nur von aussen möglich: Die eventuell notwendige Luftdichtigkeitsschicht verle­ gen, die Wärmedämmung von aussen zwi­ schen oder auf die Sparren einbringen und darauf die Unterdachkonstruktion auf­ bauen (bei Warmdach Bauphysik überprü­ fen), Konterlattung, Dachlattung und Dacheindeckung bilden den Abschluss. Bei einer solchen Konstruktion können Holzfa­ ser-Dämmstoffe zur Anwendung kommen. Nur von innen möglich: Wenn bereits ein Unterdach vorhanden ist, muss ledig­ lich noch die Bauphysik bezüglich Dampf­ diffusion, d. h. die Dichtigkeit des Unterda­ ches überprüft werden. Dabei geht es um eine raumseitig wirksame Luftdichtigkeits­ schicht (Folie). Ansonsten kann die Spar­ renlage ausgedämmt werden mit eventu­ eller Zusatzdämmung raumseitig über die ganze Fläche (Wärmebrücken) des Da­ ches. Wesentlich aufwendiger wird es, wenn ein Raum mit ungedämmtem Estrichdach (ohne Unterdach) zu einem Wohn- oder Arbeitsraum umgenutzt werden soll. Ein Unterdach von innen zwischen die Sparren anzubringen, ist sehr aufwendig und mit entsprechenden Rest-Risiken verbunden, da die Anschlüsse und die Ableitung des möglicherweise anfallenden Wassers meis­ tens nicht absolut zuverlässig gelöst wer­ den können. Es wird empfohlen, mindes­ tens eine feuchteadaptive Dampfbremse respektive Luftdichtigkeitsschicht einzufü­ gen, um bei eindringendem Wasser eine Austrocknung der Dämmung und der Holzkonstruktion zu ermöglichen. Grundsätzlich ist bei Dachausbauten auf Grund des sommerlichen und des winterli­ chen Wärmeschutzes eine möglichst schwere Dämmung (z. B. Steinwolle, Holz­ faser-Dämmung) zu wählen. Zusätzlich sind möglichst massige Innenverkleidun­ gen wie Gipsplatten für den Innenausbau vorzusehen, um eine Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung im Bauteilver­ halten zu erwirken. Wenn Dächer neu auf­ gebaut werden, ist der Einsatz von integ­ rierten Solaranlagen besonders nahelie­ gend, beispielsweise thermische Sonnen­ kollektoren oder Photovoltaik-Elemente. Flachdach Bei den Flachdachkonstruktionen sind vier Typen zu unterscheiden. Konventionelles Flachdach: Die einzel­ nen Schichten sind lose übereinander ver­ legt. Für ein solches Warmdach eignen sich die meisten Dämmstoffe und Wasser­ abdichtungsbahnen. Verbunddach oder Kompaktdach: Alle Schichten (ausser Schutz- respektive Nutz­ schicht) sind vollflächig miteinander und mit der Unterlage verbunden. Solche Dä­ cher bestehen fast ausschliesslich aus Schaumglasdämmung. 54 Gebäudehülle Umkehrdach: Die Wassersperrschicht liegt unterhalb der Wärmedämmung ge­ schützt vor Hitze, Kälte und UV-Strahlun­ gen. Als Wärmedämmung kommen nur feuchteunempfindliche Materialien zur Anwendung. Dieser Dachtyp muss zwin­ gend ein Gefälle von mindestens 1,5 % aufweisen und bei der Wärmedämm­ schicht muss mit einem Zuschlag von 10 % bis 20 % gerechnet werden (Energiever­ lust durch Meteorwasserabfluss). Hinterlüftetes Kaltdach: Das Dachsys­ tem besteht aus einer raumabschliessen­ den und luftdichten Innenschale, einer Aussenschale mit Abdichtung und einem dazwischenliegenden belüfteten Raum. Im Abdichtungen Um 1960: Durchbruch der Flachdachkon­ struktionen in Europa. Parallel dazu verlief die Entwicklung von Dachabdichtungs­ bahnen. Anfang der 1950er Jahre kam zu dem bis dahin üblichen Bitumen als dich­ tendes Medium zwischen Trägerlagen die PIB (Polyisobutylen-) Dachbahn auf den Markt. In der Folge verbreitete sich das An­ gebot an Abdichtungsmaterialien. (Elasto­ mer, Kunststoffe). Ende der 1970er Jahre 6 5 U-Werte mit λ = 0,034 W/m K 4 d = 25 cm; U = 0,12 – 0,14 W/m2 K 3 d = 30 cm; U = 0,10 – 0,12 W/m2 K 2 1 Konstruktionsaufbau 1 Innenputz 2 Stahlbeton, Tragkonstruktion 3 Dampfbremse 4 Wärmedämmschicht variabel 5 Wasserabdichtung 6 Schutz und Nutzschichten variabel Abbildung 38: Flachdach konventionell 4 3 2 1 Konstruktionsaufbau 1 bestehendes Flachdach 2 zusätzliche Wärmedämmung variabel 3 Wasserabdichtung 4 Schutz und Nutzschichten variabel Abbildung 39: Doppeldach Flachdachbereich sind somit grundsätzlich alle herkömmlichen Wärmedämmstoffe im Einsatz, also Mineralfaserdämmstoffe und Schaumglas. d = 20 cm; U = 0,15 – 0,18 W/m2 K Konstruktionshinweise ]] Das Warmdach ist die am weitesten ver­ breitete Konstruktionsart für Neubauten wie auch für Erneuerungen. Als weitere Flachda­ chaufbauten für Sanierungen und Neubau­ ten sind das Kompaktdach und das Umkehr­ dach verbreitet. ]] Betreffend die konstruktiven Randbedin­ gungen ist die SIA Norm 271 massgebend. ]] Für die meisten Nutzungen ist ein Gefälle erforderlich. Das notwendige Gefälle ist in der Unterkonstruktion oder in der Wärme­ dämmschicht zu gewährleisten. U-Werte mit λ = 0,036 W/m K dtot = 20 cm; U = 0,17 – 0,20 W/m2 K dtot = 25 cm; U = 0,14 – 0,16 W/m2 K dtot = 30 cm; U = 0,12 – 0,14 W/m2 K Konstruktionshinweise ]] Das Doppeldach eignet sich vor allem zur Erneuerung der Abdichtung mit gleichzeiti­ ger Verbesserung der Wärmedämmung. ]] Die alte Abdichtung kann entfernt oder belassen werden (bauphysikalische Beurtei­ lung erforderlich). ]] Für ein Doppeldach sind grundsätzlich alle Materialien, die für Flachdächer eingesetzt werden geeignet. Die Verträglichkeiten von alt zu neu müssen abgeklärt werden. 55 Gebäudeerneuerung wurden die ersten Dachflächen mit Flüs­ sigkunststoffen abgedichtet. Sie kommen überwiegend bei Flachdächern zum Ein­ satz, bei denen Bahnen nur sehr aufwen­ dig zu verlegen sind (viele Durchbrüche, komplizierte Dachformen, etc.). Massnahmen: Die bestehenden älteren Flachdächer lassen sich drei Zustandskate­ gorien zuordnen. Entsprechend fallen die zu treffenden Massnahmen aus. Altes Flachdach: Das Dach ist über 25 Jahre alt, die Wassersperrschicht noch dicht, die Wärmedämmung erfüllt ent­ sprechend dem Alter keine Minimalanfor­ derungen mehr. Ein Flachdach, das schad­ los über 25 Jahre dicht und dämmend war, hat seine technische Lebensdauer erreicht. Das Flachdach kann rückgebaut und mit einem neuen System wieder aufgebaut werden. Es lässt sich jedoch als Doppel­ dach erneuern oder ergänzen. Dabei wird auf das bestehende Dach eine neue Wär­ medämmung mit neuer Wassersperr­ schicht verlegt. Die alte bestehende Ab­ dichtung kann in diesem Fall entweder entfernt oder belassen werden (Dampfdif­ fusion überprüfen). Undichte Wassersperrschicht: Die Was­ sertrennschicht ist leck, die Wärmedäm­ mung ist feucht oder durchnässt, sie ver­ liert den Wärmedämmeffekt und es ent­ stehen Schäden infolge der Feuchtigkeit und des Wassers. In diesem Fall ist die Sachlage klar. Die Undichtigkeiten müssen eruiert, das nasse Dämmmaterial ersetzt und die Dachhaut geflickt werden. Je nach Schadensbild müssen grössere Flächen 6 5 4 3 2 1 oder sogar das ganze Flachdach ersetzt werden. Ungenügende Wärmedämmung: Das Dach hat die technische Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren noch nicht erreicht, aber eine energetische Gesamtsanierung steht an. Diese wärmetechnische Verbesserung könnte auch als Doppeldach mit Zusatz­ dämmung ausgeführt werden. Diese mehrschichtigen Aufbauten müssen bau­ physikalisch bezüglich der Dampfdiffusion überprüft werden. Grundsätzlich muss gelten: Der Wärmedurchlasswiderstand der Gesamtkonstruktion soll von der war­ men zur kalten Seite hin zunehmen und der Wasserdampfdiffusionswiderstand soll von der warmen zur kalten Seite hin ab­ nehmen. Estrichboden In vielen älteren Häusern werden die Dach­ räume ausgebaut und somit muss das Dach gedämmt werden. Es gibt aber auch zahlreiche Gebäude, bei denen die Dach­ räume weiterhin als Lagerraum und Estrich dienen. Diese Estrichboden-Konstruktio­ nen bestehen oft aus einer Holzbalkende­ cke mit Schiebboden und von unten auf­ gebrachte Gipsplatten. In neueren Häu­ sern (ab 1970/80) sind in der Regel Beton­ decken eingebaut. Massnahmen: Grundsätzlich könnte die Dachkonstruktion gedämmt werden und es entsteht ein unbeheizter Raum inner­ halb des Dämmperimeters. Diese Mass­ nahme ist sicher aufwendiger als die Däm­ mung des Estrichbodens, lässt sich aber U-Werte mit λ = 0,040 W/m K dtot = 16 cm; U = 0,25 – 0,30 W/m2 K dtot = 20 cm; U = 0,20 – 0,25 W/m2 K dtot = 25 cm; U = 0,15 – 0,20 W/m2 K Konstruktionshinweise Konstruktionsaufbau ]] Die Wärmedämmung in der Balkenlage 1 Gipsdecke bestehend kann eingeblasen werden (Zelluloseflocken), 2 Schiebboden bestehend ohne den Bretterboden zu entfernen. 3 Balkenlage mit Dämmung (neu) ]] Ein Aufbau auf dem Bretterboden mit 4 Bretterboden bestehend Wärmedämmung und Gehbelag kann den 5 evtl. Luftdichtung, Dampfbremse Wärme- und Schallschutz zusätzlich verbes­ 6 zusätzlicher Wärme- und Schallschutz (neu) sern helfen. Abbildung 40: Estrichboden 56 Gebäudehülle mit einer gleichzeitig erforderlichen Dach­ sanierung kombinieren. Die einfachere und im Normalfall auch günstigere Lösung ist die Dämmung des Estrichbodens. Auf die Betondecke wird eine Wärmedäm­ mung mit Gehbelag verlegt. Mit dieser Va­ riante geht etwas Raumhöhe verloren und die Konstruktion ist baupysikalisch unpro­ blematisch (Dämmung auf Kaltseite, dich­ ter Beton). Bei der Holzbalken-Konstruk­ tion kann ebenfalls eine Dämmung auf der bestehenden Konstruktion verlegt wer­ den. Es ist jedoch je nach Gehbelag zu prü­ fen, ob zuerst eine Luftdichtigkeitsschicht respektive Dampfbremse auf den beste­ henden Boden verlegt werden muss. Eine elegante Lösung besteht im Ausblasen der Balkenzwischenräume mit Zelluloseflo­ cken. Es entsteht kein Raumverlust und auch kein bauphysikalisches Problem. Kellerdecke Kellerdecken bestehen aus Hourdis-De­ cken, Betondecken oder aus Holzbalken­ decken. Massnahmen: Bei allen Konstruktionen ist eine Dämmung von unten an die Decke energetisch wirksam und bauphysikalisch unproblematisch. Diese Massnahme redu­ ziert nicht nur den Energieverlust, sondern es wird zusätzlich die Oberflächentempe­ ratur des Fussbodens erhöht, was sich po­ sitiv auf die Behaglichkeit auswirkt. Diese Massnahme wäre eigentlich sehr ökono­ misch, aber nicht immer einfach realisier­ bar. Unterhalb dieser Decken sind vielfach verschiedene Medien geführt (Heizungs­ rohre, Wasserleitungen, Stark- und Schwachstromleitungen, Verteildosen, Lampen, etc), was das Verlegen von Plat­ ten wesentlich erschwert. Auch hier gilt, dass keine wartungsbedürftigen Haus­ technikkomponenten dauerhaft abge­ deckt werden dürfen. Wände, Böden gegen Erdreich Ursprünglich als Lager- oder Technikräume genutzte Kellergeschosse müssen bei einer Umnutzung in Büros, Wohnräume oder beheizte Bastelräume mit einer Wärme­ dämmung nachgerüstet werden. Dabei sind im Bestand zwei verschiedene Situati­ onen anzutreffen: Ist das Kellergeschoss mit Sickerleitung und feuchtesperrenden Schichten am Boden und an der Wand ver­ sehen oder sind die Bodenplatte und das Bruchsteinmauerwerk direkt mit dem feuchten Erdreich in Berührung, so dass Feuchtigkeit kapillar durch die Boden- res­ pektive Wandkonstruktion ins Innere transportiert werden kann? Sehr komplex sind Lösungen für Gebäude im Grundwas­ ser; diese Fälle werden in diesem Buch nicht behandelt. Eine bessere Dämmung des Daches und der Kellerdecken eignet sich in den allermeisten Fällen gut für die Umset­ zung einer Kompensationsstrategie. Das bedeutet, dass in vertikalen Flä­ chen, speziell in der Fassade, nur ge­ ringe Dämmstärken notwendig sind. U-Werte mit λ = 0,038 W/m K dtot = 10 cm; U = 0,30 – 0,35 W/m2 K dtot = 15 cm; U = 0,20 – 0,25 W/m2 K 1 2 3 4 dtot = 20 cm; U = 0,15 – 0,20 W/m2 K Konstruktionshinweise Abbildung 41: Kellerdecke, Decke über UG Konstruktionsaufbau ]] Die Platten sind mechanisch zu befestigen. 1 Bodenkonstruktion bestehend ]] Trotz Aussparungen wegen bestehenden 2 Wärmedämmung (neu) Leitungen ist die Massnahme energetisch wie 3 Deckschicht (neu) bauphysikalisch interressant (Fussbodentem­ 4 Haustechnikinstallationen (bestehend) peratur). ]] Gewisse Leitungen müssen umgelegt, an­ dere abgedeckt werden. 57 Gebäudeerneuerung Massnahmen an einem Haus mit Si­ ckerleitung und Feuchteschutz an Wänden: Bodenaufbau mit Feuchte­ schutz gegen kapillares Wasser versehen, im Bereich der Fundationen je nach Scha­ densbild und Situation mit Horizontalsper­ ren (chemisch, Injektionen) oder eventuell mechanisch (Bleche) vorsehen. Es gibt auch entsprechende elektrophysikalische Verfahren zu Bekämpfung der Mauer­ feuchtigkeit. Bei trockengelegter Mauerund Bodenkonstruktion kann dann die er­ forderliche Dämmung aufgebracht wer­ den. Boden und Mauerwerk im feuchten Erdreich: In einer solchen Situation muss von Fall zu Fall entschieden werden. Die beste Lösung wäre eine nachträgliche Ab­ grabung des Hauses und ein Verlegen der notwendigen Sickerleitungen in Kombina­ tion mit dem Aufbringen der notwendigen feuchtesperrenden Schichten. Dabei bie­ ten sich mehrere Varianten an: ]]Keine Massnahmen, Istzustand belassen ]]Sanierputz anbringen ]]Neue Wand ausserhalb der bestehenden Konstruktion mit Wärmedämmung und Feuchteschutz ]]Ausgraben des Hauses mit entsprechen­ den Schutzmassnahmen ]]Alle Lösungen sind nicht nur kostspielig, sondern teilweise mit bauphysikalischen Risiken verbunden. U-Werte mit λ = 0,038 W/m K d = 10 cm; U = 0,30 – 0,35 W/m2 K d = 15 cm, U = 0,20 – 0,25 W/m2 K d = 20 cm; U = 0,15 – 0,20 W/m2 K 6 54 3 2 1 Konstruktionsaufbau 1 mechanische Schutzschicht 2 Innendämmung (variabel) evtl. Dampf­ bremse 3 Mauerwerk bestehend 4 Feuchtigkeitssperre 5 Sickerpackung 6 Erdreich Abbildung 42: Wand gegen Erd­ reich Konstruktionshinweise ]] Wenn aussen eine Feuchtigkeitssperr­ schicht mit Sickerpackung und Sickerleitung vorhanden ist, ist die wärmetechnische Ver­ besserung mit einer Innendämmung möglich. ]] Die Dampfdiffusion ist vor allem dort zu prüfen, wo das Untergeschoss aus dem Erd­ reich gegen Aussenklima reicht. ]] An Decken- und Wandanschlüssen entste­ hen Wärmebrücken, die beurteilt werden müssen. ]] Im Bereich Fundament ist je nach Situation eine Horizontalsperre (mechanisch oder che­ misch) vorzusehen. ]] Bei Aussenwänden und Böden, die über keine Sickerleitung verfügen und direkt im feuchten Erdreich liegen oder stehen, kön­ nen keine generell gültigen Aufbauten defi­ niert werden. Diese komplexe Situation ist von Fall zu Fall zu beurteilen und entspre­ chende Massnahmen zu treffen wie Sanier­ putz, Ausgrabung mit Sickerpackung, Innen­ dämmung, zusätzliche Wandkonstruktion auf Innenseite, etc. Kapitel 7 Schallschutz Niklaus Hodel Abbildung 43: Übersicht verschie­ dener Schallpegel Schallpegel Ausgangslage Ein grosser Teil der schweizerischen Bevöl­ kerung ist heute übermässigen Lärmim­ missionen von Strasse, Eisenbahn, Flugver­ kehr, Industrie etc. ausgesetzt. Gemäss Untersuchungen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu, Lärmbelastung in der Schweiz) sind es heute über 1 Mio. Ein­ wohner, die zu hohen Lärmpegeln ausge­ setzt sind. Zusätzlich hat eine repräsenta­ tive Umfrage des Bundesamtes für Woh­ nungswesen unter professionellen und privaten Bauträgern ergeben, dass ein gu­ Schallquelle Schalldruck 170 dB Sturmgewehr 160 dB Pistole 9 mm 150 dB 1 000 000 000 μPa (1 kPa) Bolzensetzgerät 140 dB Jetprüfstand 130 dB 100 000 000 μPa (100 Pa) Schmerzschwelle 120 dB Bohrjumbo 110 dB 10 000 000 μPa (10 Pa) Presslufthammer 100 dB Diskothek 90 dB 1 000 000 μPa (1 Pa) Montageband 80 dB Strassenverkehr 70 dB 100 000 μPa (100 mPa) Unterhaltung 60 dB Büro 50 dB 10 000 μPa (10 mPa) Wohnzimmer 40 dB Leseraum 30 dB 1000 μPa (1 mPa) Schlafzimmer 20 dB Radiostudio 100 μPa 10 dB Hörschwelle 0 dB 20 μPa ter Schallschutz zwischen den Wohnungs­ einheiten einer der wichtigsten Kriterien im Wohnungsbau ist. Entsprechend soll dem Themenbereich der Bauakustik mit dem Schutz vor Aussen- und Innenlärm auch beim Sanieren, Erneuern und Weiter­ bauen Rechnung getragen werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wer­ den im Wesentlichen durch die Eidgenös­ sische Lärmschutz-Verordnung (LSV) und durch die SIA Norm 181 «Schallschutz im Hochbau» gegeben. Rechtslage und Vorschriften Die erste schweizerische Richtlinie zum baulichen Schallschutz erschien im Jahre 1970 als Empfehlung SIA 181. Ab 1976 ersetzte die Norm SIA 181 «Schallschutz im Wohnungsbau» die vorherige Empfeh­ lung. Im Jahr 1988 traten neben der Eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung auch die neue Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau» in Kraft. Diese Norm hat Ge­ setzescharakter, da sie Bestandteil der LSV und diese wiederum auf der Umwelt­ schutzgesetzgebung (USG) basiert. Die LSV regelt vor allem: ]]die Ausscheidung und Erschliessung von Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. ]]die Erteilung von Baubewilligungen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen in lärmbelasteten Gebieten. ]]den Schallschutz gegen Aussen- und In­ nenlärm an neuen und bestehenden Ge­ bäuden mit lärmempfindlichen Räumen. ]]die Ermittlung von Aussenlärmimmissio­ nen und ihre Beurteilung anhand von Be­ lastungsgrenzwerten. Die heute gültige SIA Norm 181, Ausgabe 2006, wurde erweitert und aktuellen ENund ISO-Normen angepasst, sie regelt: ]]den baulichen Schutz gegenüber exter­ nen und internen Lärmquellen, bezogen auf Nutzungseinheiten in Neu- und Um­ bauten. ]]die schalltechnischen Eigenschaften von Bauten, Bauteilen und Anlagen der Haus­ technik. 60 Schallschutz ]]den Schallschutz innerhalb Nutzungsein­ heiten als Empfehlungen. ]]die Raumakustik von Unterrichtsräumen und Sporthallen. Aussenlärm Im Wesentlichen geht es um zwei Vor­ schriften, die in der LSV geregelt sind. Art. 31. Baubewilligungen in lärmbe­ lasteten Gebieten: Vorgegebene Immis­ sionsgrenzwerte müssen in der Mitte des offenen Fensters (Lüftungszustand) einge­ halten werden. Eine Komfortlüftungsan­ lage gilt im Regelfall nicht als Lärmschutz­ massnahme gemäss LSV Art. 31. Art. 32. Anforderungen an Schutz ge­ gen Schall von aussen: Die geschlossene Hülle muss die Mindestanforderungen der SIA Norm 181 einhalten. Die Anforderun­ gen gelten auch für Aussen- und Trenn­ bauteile, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden. Sie sind abhängig vom Aussenpegel und der Lärmempfindlich­ keit. Das schwächste Bauteil der Gebäude­ hülle ist massgebend. Dies ist meistens das Fenster oder die Schrägdachkonstruktion. Bei erheblichen Lärmbelastungen kom­ men Schallschutzfenster zum Einsatz mit Gläsern mit einem Bauschalldämmmass Rw über 35 dB. Die üblichen 3-fach-Isolierver­ glasungen bieten in lärmigen Gebieten trotz der drei Gläser oft keinen genügen­ den Schutz. Luftschall Luftschallübertragung: Übertragung von Luftschall von einem Raum zum ande­ ren durch Trennbauteile (Wand, Decke, Fenster usw.), durch Öffnungen, Spalten oder über Nebenwege. Die Anforderungs­ werte Di sind abhängig von der Lärmbelas­ tung und von der Lärmempfindlichkeit. Diese Werte (Mindestanforderungen) gel­ ten vor allem für Neubauten, sie gelten aber genauso für Umnutzungen, Erweite­ rungen und Umbauten mit grossen Ein­ griffstiefen. Für die erhöhten Anforderun­ gen gelten die um 3 dB erhöhten Werte gegenüber den Angaben der Tabelle 6. Bei bestehenden Häusern bieten vor allem dünne, einschalige Backstein- oder Beton­ wände bezüglich Luftschallübertragungen Probleme, die durch entsprechende Vor­ satzschalen behoben werden können. Das wesentlich grössere Problempotenzial diesbezüglich weisen jedoch die Holzbal­ Belastungsgrenzwerte nach Lärmschutzverordnung (LSV) Planungswert Empfindlichkeitsstufe ES I (Erholungszonen) ES II (Wohnzonen) ES III (Mischzonen) ES IV (Industriezonen) Schallquellen Aussenlärm (z. B. Verkehr) Luftschall Tag 50 dB 55 dB 60 dB 65 dB Nacht 40 dB 45 dB 50 dB 55 dB Nachbarliche Wohngeräusche Luftschall Bauteile und Anlagen ]]Wohnungstrenn­ ]]Fenster wände ]]Aussenwände ]]Wohnungsdecken ]]Dach ]]Wohnungstüren ]]Haustüren ]]Storenkästen Schallschutzmassnahmen Luftschalldämmung Luftschalldämmung Immissionsgrenzwert Tag Nacht 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 65 dB 55 dB 70 dB 60 dB Nachbarliche Wohngeräusche Trittschall Alarmwert Tag 65 dB 70 dB 70 dB 75 dB Nacht 60 dB 65 dB 65 dB 70 dB Anlagegeräusche (Haustechnik) Körperschall und Luftschall Tabelle 6: Belastungsgrenz­ werte gemäss LSV Tabelle 7: Lärmprobleme und Schallschutzaufga­ ben Eigengeräusche (raumintern) Luftschall ]]Wohnungstrenn­ ]]Sanitär- und Heiz­ decken anlagen ]]Balkone ]]Leitungen ]]Begehbare Dächer ]]Apparate, Maschi­ nen ]]Treppenhaus ]]Hallen, Gänge ]]Bäder ]]Spezialräume Trittschalldämmung Reduktion der Halligkeit Luft- und Körper­ schalldämmung 61 Gebäudeerneuerung kendecken mit Schiebboden und Gipsde­ cke auf. Die Schüttung oder die Verfüllung der Hohlräume mit Mineralwolle oder Zel­ luloseflocken bringt wegen der fehlenden Masse nicht die geforderte Wirkung. Eine zusätzliche Gipsdecke an Schwinghängern oder ein schwimmender Unterlagsboden oder allenfalls beide Massnahmen sind notwendig, um den Schallschutz zu bie­ ten. Vielfach mangelt es aber an der dafür notwendigen Raumhöhe oder es stehen architektonische und denkmalpflegerische Aspekte im Wege. Mitunter sind auch die Kosten zu hoch. Abbildung 44: Möglicher Aufbau von Holzbalkende­ cken Bodenbelag schwimmender Unterlagsboden mit Bodenheizregister Trittschall- und Wärmedämmung Lastverteilpatte, bestehende Unterkonstruktion Dämmung, Schüttung, Leichtbeton Schiebboden bestehend Gipsdecke bestehend Mineralwolle, Hohlraumdämpfung abgehängte Gipsdecke neu an Federbügeln Trittschall Trittschallübertragung: Die Übertragung von Trittschall von einer begehbaren Kon­ struktion als Körperschall in andere Räume und mit Abstrahlung und Wahrnehmung als Luftschall im belasteten Raum. Die An­ forderungswerte L‘ sind abhängig von der Lärmbelastung und von der Lärmempfind­ lichkeit. Diese Werte (Mindestanforderun­ gen) gelten vor allem für Neubauten, bei Umbauten gelten um 2 dB erhöhte (redu­ zierte) Limiten. Für die erhöhten Anforde­ rungen gelten die um 3 dB verringerten (strengeren) Werte gegenüber den Werten der Tabelle 9. Die grössten Probleme bieten bei beste­ henden Bauten die Betondecken ohne schwimmende Unterlagsböden oder aber eben auch die Holzbalkendecken wie schon beim Luftschall. Bei Häusern mit Be­ tondecken der 60-er und 70-er Jahre wurde der ganzflächige Teppichbelag oft als ein Bestandteil der Bodenkonstruktion mit einbezogen. Bei einem Ersatz des Bo­ denbelages mit z. B. Parkettbelag können grössere, unerwünschte Trittschallübertra­ Grad der Störung durch Aussenlärm Lärmbelastung Lage des Empfangsortes Beurteilungsperiode Beurteilungspegel Lärmempfindlichkeit gering mittel hoch klein bis mässig erheblich bis sehr stark abseits von Verkehrsträgern, keine stören­ im Nahbereich von Verkehrsträgern oder den Betriebe störenden Betrieben Tag Nacht Tag Nacht L r ≤ 52 dB L r > 60 dB L r > 52 dB L r ≤ 60 dB Anforderungswerte De in dB (Standard-Schallpegeldifferenz) 29 dB/22 dB L r – 35 dB/ – 38 dB L r – 27 dB/ – 30 dB 34 dB/27 dB L r – 30 dB/ – 33 dB L r – 22 dB/ – 25 dB 39 dB/32 dB L r – 25 dB/ – 28 dB L r – 17 dB/ – 20 dB Lärmbelastung klein mässig stark Lärmige Nutzung: Nutzung normal: Wohn-, Schlafraum, Hobby­raum, Ver­ sammlungsraum, Küche, Bad, WC, Schulzimmer, Hei­ Korridor, Aufzugs­ zung, Garage, Res­ schacht, Treppen­ taurant ohne Be­ haus, Büroraum, Konferenzraum, La­ schallung, Verkaufs­ raum mit Beschal­ bor, Verkaufsraum lung ohne Beschallung Lärmempfindlichkeit Schutz gegen Luft-Schall von innen: Anforderungswerte Di gering 45 dB/42 dB 50 dB/47 dB 55 dB/52 dB mittel 50 dB/47 dB 55 dB/52 dB 60 dB/57 dB hoch 55 dB/52 dB 60 dB/57 dB 65 dB/62 dB Beispiele für emissi­ onsseitige Raumart und Nutzung (Sen­ deraum) Geräuscharme Nut­ zung: Lese-, Warte­ raum, Patienten-, Sanitäts­zimmer, Ar­ chiv Tabelle 8: Erhöhte und Min­ destanforderung (fett) an den Schutz gegen Luftschall von aussen (SIA 181). sehr stark Lärmintensive Nut­ zung: Gewerbebe­ trieb, Werkstatt, Musikübungsraum, Turnhalle, Restau­ rant mit Beschal­ lung und dazuge­ hörende Er­schliessungsräume 60 dB/57 dB 65 dB/62 dB 70 dB/67 dB Tabelle 9: Erhöhte und Min­ destanforderung (fett) an den Schutz gegen Luftschall von innen (SIA 181). 62 Schallschutz gungen entstehen. Bei Holzbalkendecken verbessern schwimmende Unterlagsböden die Situation. Bei diesen Böden können bei einer entsprechenden Gesamtsanierung gleichzeitig Bodenheizregister eingebaut werden. Dies empfiehlt sich, wenn eine fossile Heizung durch eine Niedertempera­ turheizung (Wärmepumpe) ersetzt wird. Massnahmen von unten, wie z. B. eine he­ runter gehängte Gipsdecke an Federbü­ geln, können eine spürbare, wenn auch nicht so effiziente Verbesserung wie der Unterlagsboden bringen. Haustechnik Tabelle 10: Mindestanforderun­ gen an den Schutz gegen Geräusche haustechnischer An­ lagen (SIA 181) Körperschallübetragung: Geräusche, welche innerhalb oder ausserhalb eines Gebäudes durch Schwingungsvorgänge entstehen, ausschliesslich als Körperschall übertragen und im Inneren als Luftschall gehört werden. Die Anforderungswerte sind in Einzelgeräusche und Dauerge­ räusche differenziert. Für die erhöhten An­ forderungen gelten die um 3 dB verringer­ ten Werte. Die Hauptlärmquellen sind in Küchen, Ba­ dezimmern und im Keller (Haustechnikins­ tallationen wie Lüftung, Ölbrenner, Wär­ mepumpen, etc.). Oft geben auch Auf­ Emissionsseitige Geräuschart im Senderaum züge zu Klagen Anlass. Die effizientesten Massnahmen sind Abfedern, Abkoppeln und elastische Lagerungen; Maschinen und Haustechnikanlagen mit Schwin­ gungsdämpfer versehen; Leitungen elas­ tisch befestigen; Sanitärinstallationen mit entsprechenden Schallschutzsets montie­ ren; Badewannen, Duschtassen auf schwimmenden Unterlagsboden stellen; Küchenabdeckungen elastisch von der Wand trennen; etc. Raumakustik Raumakustik: Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Hörsamkeit von Sprache oder Musik in Räumen und mit dem akusti­ schen Design von Räumen beschäftigt. Das massgebende Spektrum erstreckt sich von 100 Hz bis 5000 Hz. Der ordentliche Betrieb von Unterrichtsräumen und Sport­ hallen setzt ein Mindestmass an Sprach­ verständlichkeit bzw. an Hörsamkeit vor­ aus. Zur entsprechenden raumakustischen Konditionierung müssen die Nachhallzei­ ten in diesen Räumen bestimmte Randbe­ dingungen erfüllen. Diese Vorgaben gemäss SIA 181 sind für Neubauten, Umbauten und Sanierungen gleichermassen anzuwenden. Es bedeutet, Einzelgeräusche Funktions­ Benutzungs­ geräusche geräusche Dauergeräusche Funktions- oder Benutzungs­ geräusche Tabelle 11: Erhöhte und Min­ destanforderung (fett) an den Schutz gegen Trittschall (SIA 181) Lärm­empfindlichkeit gering 38 dB(A) mittel 33 dB(A) hoch 28 dB(A) Anforderungswerte LH 43 dB(A) 33 dB(A) 38 dB(A) 28 dB(A) 33 dB(A) 25 dB(A) Lärmbelastung klein stark Beispiele für emissions­seitige Raumart und Nutzung (Sende­ raum) Archiv, Warte-, Lese­ Wohn-, Schlafraum, raum Küche, Bad, WC, Büro, Heiz- und Kli­ maraum, Korridor, Treppe, Lauben­ gang, Passage, Ter­ rasse, Einstellgarage Lärmempfindlichkeit gering 60 dB/63 dB mittel 55 dB/58 dB hoch 50 dB/53 dB mässig sehr stark Die in der Stufe Restaurant, Saal, «stark» festgehalte­ Schulzimmer, Kin­ nen Nutzungen, derkrippe, Kinder­ wenn diese auch in garten, Turnhalle, der Nacht von 19.00 Werkstatt, Musik­ Uhr bis 07.00 Uhr übungsraum und zugehörige Erschlie­ vorkommen. ssungsräume Schutz gegen Trittschall: Anforderungswerte L’ 55 dB/58 dB 50 dB/53 dB 45 dB/48 dB 50 dB/53 dB 45 dB/48 dB 40 dB/43 dB 45 dB/48 dB 40 dB/43 dB 35 dB/38 dB 63 Gebäudeerneuerung dass Unterrichtsräume gezielt mit absor­ bierenden (schallschluckenden) Materia­ lien auf den dafür geeigneten Flächen aus­ gerüstet werden. Nachhallzeit für Unterrichtsräume: Tsoll = – 0,17 + 0,32 lg (V/V0) ner und als mögliche Grundlage für ent­ sprechende vertragliche Vereinbarungen werden aber auch Empfehlungen für den Schallschutz zwischen den Räumen inner­ halb der gleichen Nutzungseinheit defi­ niert (SIA 181, Anhang G). Schallschutz innerhalb Nutzungseinheiten Die Norm SIA 181 regelt ausschliesslich den Schallschutz zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten. Als Hilfe für den Pla­ T/Tsoll Abbildung 45: Anzustrebender Be­ reich der Nachhall­ zeit für Unterrichts­ räume (SIA 181) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 100 1000 Frequenz (Hz) Nutzung Raum 1 * Raum 2 ** 10000 Tabelle 12: Empfehlungen für Trennbauteile in­ nerhalb einer Nut­ zugseinheit: Luft­ schalldämmung Di bzw. bewerteter Norm-Trittschallpe­ gel L‘ in dB (SIA 181, Anhang G) Empfehlung Luftschall Empfehlung Trittschall Stufe 1 Stufe 2 Stufe 1 Stufe 2 Wohnen Schlafen Schlafen 40 45 55 50 Schlafen Wohnen 40 45 55 50 Schlafen Nasszelle 40 45 55 50 Büro Büro Büro 35 40 60 55 Büro Sitzung 40 45 60 55 Büro Direktion 45 50 60 55 Korridor Büro 30 35 60 55 Korridor Direktion 35 40 60 55 Sitzung Sitzung 40 45 60 55 Schule Klasse Klasse 45 50 60 55 Korridor Klasse 35 40 60 55 Musikzimmer Klasse 55 60 50 45 Musikzimmer Musikzimmer 55 60 50 45 Werken Klasse 50 55 50 45 Hotel Zimmer Zimmer 50 55 55 50 Korridor Zimmer 40 45 55 50 Altersheim, Zimmer Zimmer 50 55 55 50 Spital Korridor Zimmer 30 35 55 50 * Empfehlungen für Räume ohne Einfluss der Türen und offener Treppen (Messung mit Vorsatzschalen) ** Räume, zwischen denen keine Sprachverständlichkeit gegeben sein darf (z. B. Praxis, Sozialamt). Kapitel 8 Tragwerk Hansruedi Meyer Abbildung 46: Kantonales Zeug­ haus Zug, Baugrube für die Anbauten. Die Anbauten kön­ nen wegen der vor­ stehenden Aussen­ wand nicht unmit­ telbar an das beste­ hende Gebäude an­ geschlossen wer­ den. Anbauen Tragwerke von Anbauten unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Tragkonstruk­ tionen eines Neubaus. Die besonderen Themen liegen im konstruktiven Bereich und im Bauablauf. Trennfuge zwischen bestehendem Ge­ bäude und Anbau: Nach den Konstrukti­ onsregeln ist ein Anbau vom bestehenden Gebäude zu trennen. Trennfugen können zwar Probleme lösen aber auch neue schaffen. So ist insbesondere die Frage von Setzungen gut abzuklären, damit nicht Ni­ veaudifferenzen zwischen alt und neu ent­ stehen. Gebäudetrennfugen beginnen in der Regel oberhalb der Fundation und werden konsequent durchgezogen, ein­ schliesslich Fassaden- und Dachanschlüsse. Besondere Beachtung muss der Abdich­ tung der Fugen eingeräumt werden. Fu­ genverdornungen zum bestehenden Ge­ bäude können, um Setzungsdifferenzen zu verhindern, zweckmässig sein. Erfor­ derlich werden sie, wenn keine vertikalen Tragelemente beim Übergang zum Anbau erwünscht sind und die Decken direkt am bestehenden Gebäude aufgelagert wer­ den. Anbauen von Untergeschossen an nicht unterkellerte Gebäude: Wird ein Untergeschoss direkt an ein bestehendes, nicht unterkellertes Gebäude angeschlos­ sen, muss, falls nicht aus Plänen ersicht­ lich, die Fundation des bestehenden Ge­ bäudes sondiert werden. Die Fundation ragt oft über die Gebäudeaussenwand hi­ naus. Hier gilt es abzuklären, wie weit die bestehende Fundation angepasst und ob ein allfälliger Fundamentvorsprung weg­ genommen werden kann. In jedem Fall ist die Fundation des bestehenden Gebäudes z. B. mittels Unterfangungen bis auf das Niveau der Fundation des Anbaus zu füh­ ren. Nicht unterkellerte Anbauten: Bei nicht unterkellerten Anbauten ist die Fundation bis auf das gewachsene Terrain zu führen oder falls möglich mittels Konsolen an das bestehende Gebäude zu verankern. Abbildung 47: Kantonales Zeug­ haus Zug, Betonar­ beiten für die An­ bauten. 66 Tragwerk Abbildung 48 (oben): Bibliothek am Guisanplatz, Bern. Quer­ schnitt mit neuer Unterkellerung für die Gebäudetechnik und mit neuem Anbau für ein Archiv. Abbildung 49 (Mitte): Bibliothek am Guisanplatz, Bern. Unterfan­ gung bestehende Fassade für neues unterirdisches Archiv. Abbildung 50 (unten links): Schloss Hofwil Münchenbuchsee, er­ baut 1784. Unterfangung Fassade. Abbildung 51 (unten rechts): Schloss Hofwil Münchenbuchsee. An­ bau unterirdische Einstellhalle. 67 Gebäudeerneuerung Aufstocken Mit dem Aufstocken eines Gebäudes müs­ sen zusätzliche Lasten über die Tragstruk­ tur des bestehenden Gebäudes in den Baugrund abgeleitet werden. Abzuklären ist, ob die vorhandenen vertikalen Tragele­ mente, Wände und Stützen sowie die Fun­ dation in der Lage sind, diese Zusatzlasten abzutragen und ob die Zusatzlasten sicher in den Baugrund abgeleitet werden kön­ nen. Falls nicht, muss geprüft werden, ob die Tragelemente verstärkt und die Funda­ tion entsprechend angepasst werden kön­ nen. Aufstockungen ohne Verstärkung der bestehenden Tragstruktur sind nur bei re­ lativ geringen Zusatzlasten möglich, d. h. eine Aufstockung ist vorzugsweise in einer Leichtkonstruktion, Holz oder Stahl zu pla­ nen. Für die Aufstockung sollte wenn immer möglich die bestehende vertikale Tragstruktur übernommen werden. Die Dach­ decke ist meist nicht in der Lage, Stützenoder Wandlasten über Biegung abzutra­ gen. Falls die Tragstruktur nicht übernom­ men werden kann, können die Lasten der Aufstockung mit einer Hilfskonstruktion, z. B. mit Überzügen auf der Dachdecke, auf die bestehenden vertikalen Tragele­ mente umgeleitet werden. Der damit ent­ stehende Zwischenraum kann dann auch für die Leitungsführung der Gebäudetech­ nik genutzt werden. Wände und Stützen können noch relativ einfach verstärkt werden, nicht aber die Fundation. Eine Vergrösserung von Einzelund Streifenfundamenten ist schwierig wegen der Zugänglichkeit und meist mit grossem Aufwand verbunden. Häufig wer­ den daher für die Einleitung der Lasten in den Boden Mikropfähle eingesetzt. Diese Kleinbohrpfähle können auch innerhalb eines bestehenden Gebäudes ausgeführt werden. Da bei einer Aufstockung die Dachdecke mindestens bei den Lastabtra­ gungspunkten freigelegt werden muss, wird in den meisten Fällen ein Notdach er­ forderlich. Abbildung 52 (oben): Altersheim Lyss-Busswil. Fassade mit neuem Dachgeschoss. Abbildung 53 (links): Altersheim Lyss-Busswil. Längs­ überzüge in Beton auf der Dachdecke zum Abtragen der neuen Lasten auf die darunter liegen­ den Stützen. Abbildung 54 (rechts): Altersheim Lyss-Busswil. Zwi­ schenraum für Lei­ tungsführungen zwischen der frühe­ ren Dachdecke und dem neuen Boden der Aufstockung. 68 Tragwerk Unterkellern Abbildung 55: Goldener Adler Ge­ rechtigkeitsgasse 7, Bern. Querschnitt mit neuer Unterkel­ lerung. Abbildung 56: Goldener Adler Ge­ rechtigkeitsgasse 7, Bern. Unterfangung mit auf die Stand­ festigkeit des Bo­ dens abgestimmten Betonieretappen. Die Spriesskränze sind provisorisch. Eine nachträgliche Unterkellerung eines Gebäudes ist immer aufwendig. Aushub und Rohbauarbeiten müssen ohne grö­ ssere Öffnung im Gebäude mit Kleingerä­ ten oder von Hand ausgeführt werden. Die vertikalen Tragelemente müssen bis auf das neue Fundationsniveau geführt wer­ den. Zwei Vorgehen stehen im Vorder­ grund: Verlängern der Tragelemente mit­ tels etappenweisem Unterfangen oder Abfangen der Tragelemente mit Mikro­ pfählen. Beim Unterfangen muss die Etap­ pengrösse auf das bestehende Tragsystem und die Standfestigkeit des Bodens beim Ausheben abgestimmt werden. Mikro­ pfähle werden vom bestehenden Niveau aus versetzt und der Boden um die Mikro­ pfähle herum nachträglich ausgehoben. Das Risiko, dass Setzungen und damit Risse im Bauwerk entstehen, ist beim Un­ terfangen wesentlich grösser als beim Ein­ satz von Mikropfählen. Die bestehende Bodenplatte muss bei ei­ ner Unterkellerung rückgebaut und neu als Decke ausgebildet werden. Wird die bestehende Tragstruktur auf Mikropfählen gesichert, müssen die Stützen und Wände nicht zwingend von oben übernommen werden. Sie können auch nachträglich auf die neue Decke abgestellt werden. Die De­ cke wird dann zu einer sogenannten Ab­ fangdecke. Unterkellerungen von denkmalgeschütz­ ten Gebäuden: Auch wenn es die techni­ schen Möglichkeiten und das Knowhow der Baufachleute zulassen, auch bei histo­ rischen Bauten zusätzliche Unterkellerun­ gen ausführen zu können, haben die Denkmalpflege-Fachstellen grundsätzliche Bedenken dazu und lehnen Unterkellerun­ gen ab. Eine ausführliche Begründung gibt das Grundsatzpapier der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, EKD, «Unterirdische Bauten im historischen Be­ reich», 30. Januar 2001. 3 2 1 69 Gebäudeerneuerung Abbildung 57 (oben): Unterkellerung mit Mikropfählen. Biblio­ thek am Guisanplatz, Bern: Grundriss Untergeschoss mit neuer Un­ terkellerung bestehendes Gebäude für die Gebäudetechnik und mit neuem Anbau für ein Archiv (Querschnitt dazu siehe Abbil­ dung 48). Abbildung 58 (Mitte): Bibliothek am Guisanplatz, Bern. Tragstruk­ tur des ehemaligen Lagergebäudes vor dem Umbau. Abbildung 59 (unten links): Bibliothek am Guisanplatz, Bern. Ab­ fangung der Stützen im Erdgeschoss mit je 4 Mikropfählen. Die Verbände dienen zur Aussteifung der dünnen Mikropfähle. Abbildung 60 (unten rechts): Bibliothek am Guisanplatz, Bern. Ganze innere Tragstruktur während des Aushubs auf Mikropfäh­ len. 70 Tragwerk Umbauen Beim Umbauen sind Eingriffe in die Tragstruktur massvoll zu halten. Sie sind nur dort gerechtfertigt, wo Funktionsab­ läufe verbessert und wo mit den Eingriffen möglichst flexible Strukturen erreicht wer­ den, die nicht ausschliesslich auf das heute gültige Raumprogramm abgestimmt sind. Gebäudebestimmende Elemente sollten respektiert werden. Dies gilt auch für Massnahmen, die infolge neuer Gebäude­ technik erforderlich werden. Anforderun­ gen und Ansprüche sollten immer im Kon­ text berücksichtigt und wirtschaftlich opti­ miert werden. Häufige Eingriffe sind Wandausbrüche, die je nach Tragsystem der Decken meist durch Unterzüge ersetzt werden müssen. Bal­ ken- oder Stahlträgerdecken brauchen im­ mer ein Linienauflager. Bei Betondecken kann bei nicht zu grossen Wandausbrü­ chen anstelle eines Unterzugs auch eine Klebewehrung die Öffnung überbrücken. Steht über der ausgebrochenen Wand im Geschoss darüber eine weitere Wand, sind die Auswirkungen der Verformungen zu beachten. Ein Unterzug oder ein Wechsel mittels Klebebewehrung ist immer wei­ cher als die frühere Wand. Bei Ausbrüchen von Tragelementen sind die erforderlichen Massnahmen während des Bauablaufs, insbesondere die provisorischen Spriessun­ gen, sorgfältig zu planen. Ebenso häufig gilt es, die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Decken zu beurteilen. Wird an der Deckenkons­ truktion und dem Bodenaufbau nichts ver­ ändert und bleibt die Nutzung die gleiche, ist eine Überprüfung grundsätzlich nur nö­ tig, wenn grosse Verformungen sichtbar sind, die Decke bei kleiner Anregung schwingt oder wenn der Zustand schlecht ist. Werden bei Holzbalkendecken oder dünnen Betondecken beispielsweise aus akustischen Gründen schwerere Boden­ aufbauten eingebaut, müssen die Decken statisch geprüft werden. Häufig sind Ver­ stärkungen notwendig, die dann auch Ein­ griffe in die bestehende Deckenkonstruk­ tion zur Folge haben. Abbildung 61: Umbau Muesmattstrasse 37, Bern. Sicherung der Wand im 1. Obergeschoss während des Wandausbruchs im Erdge­ schoss. Abbildung 62: Umbau Muesmattstrasse 37, Bern. Wandausbruch und Einbau Stahlunterzug. 71 Gebäudeerneuerung Abbildung 63 (links oben): Parlamentsgebäude Bern, Querschnitt mit Teilprojekten des Umbaus. Grün = Erneuerung Kuppelhalle. Rosa = Umnutzung 3. Obergeschoss. Blau = Erneuerung National­ ratssaal. Rot = Instandsetzen Gebäudehülle. Gelb = Neuer Besu­ chereingang Abbildung 64 (links unten): Parlamentsgebäude Bern. Rückbau unter dem Nationalratssaal für den neuen Besuchereingang. Trä­ ger für die provisorische Sicherung des Nationalratssaal. Abbildung 65 (rechts oben): Schloss Hofwil Münchenbuchsee. De­ ckenverstärkung mit Renoantik, Holz-Restaurationstechnik. Abbildung 66 (rechts unten): Dermatologie Inselspital Bern. Ver­ stärkung der Holzbalkendecke mit Holz-Beton-Verbund. 72 Tragwerk Bestehende Bauten – neue Normen Beurteilung der Tragsicherheit: Der Be­ standesschutz erlischt, wenn eine Nut­ zungsänderung geplant ist (z. B. durch Umnutzung von Büros in Versammlungs­ räume), wenn Eingriffe ins vorhandene Tragwerk erforderlich sind (z. B. Entfernen von Tragelementen oder Durchbrüche für neue Leitungsführungen), wenn zusätzli­ che Lasten abzutragen sind (z. B. infolge einer Aufstockung oder Einbau eines Zwi­ schengeschosses), oder wenn offensichtli­ che Schäden Zweifel an der Tragsicherheit eines Bauteils begründen (z. B. infolge un­ terlassener Instandsetzung). Bei der An­ wendung der überwiegend für Neubauten konzipierten Normen stösst man bei vielen typischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem «Bauen im Bestand» auf Schwie­ rigkeiten. Mit der 1994 in Kraft getretenen SIA-Richtlinie 462 «Beurteilung der Tragsi­ cherheit bestehender Bauwerke» wurden erstmals Grundsätze zu diesem Thema festgehalten. Die Beurteilung der Ge­ brauchstauglichkeit von Bauwerken ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Diese Fragen sind in der Regel in Absprache mit dem Eigentümer bzw. Betreiber des Bau­ werks zu regeln. Somit steht fest, dass nur die Tragsicherheit den jeweiligen Normen entsprechen muss. Weiter sind in dieser Richtlinie Begriffe wie Restnutzungsdauer, akzeptierbare Risiken, Mängel, usw. defi­ niert, welche alle in diesem Zusammen­ hang eine wesentliche Rolle spielen. Erdbebensicherheit: Bestehende Bauten sollten bezüglich ihrer Erdbebensicherheit überprüft und wenn nötig ertüchtigt wer­ den. Dies erfolgt am besten bei einer Sa­ nierung oder bei einem Umbau. Die Bau­ werke müssen für die an ihrem Standort massgebende Gefährdung (Erdbeben­ zone, Baugrundklasse) und entsprechend ihrer Bedeutung (Bauwerksklasse) geplant bzw. überprüft werden. Häufige Mängel bei bestehenden Bauten sind fehlende aussteifende Elemente (Wände) sowie Holzbalkendecken mit ungenügender Scheibenwirkung und ungenügender Ver­ ankerung mit der Fassade. Vor 1970 war in den SIA-Normen noch gar kein Erdbe­ benartikel vorhanden. Durch die Anwen­ dung der heute gültigen SIA-Norm 261 (Einwirkungen auf Tragwerke, Ausgabe 2003) ergeben sich für bestehende Bauten aber zu grosse Horizontalkräfte. Mit dem SIA-Merkblatt 2018 (Ausgabe 2004) kann ein sogenannter Erfüllungsfaktor berech­ net werden. Dieser gibt an, in welchem Mass ein bestehendes Tragwerk die rech­ nerischen Anforderungen von Neubauten erfüllt. Unter Berücksichtigung der Bau­ werksklasse und der Restnutzungsdauer ergibt sich dann der effektive Erfüllungs­ faktor. Erreicht dieser einen bestimmten Wert, müssen keine Erdbebensicherungs­ massnahmen vorgesehen werden. Um die Erdbebenertüchtigungsmassnahmen be­ züglich Kosten-Nutzen-Effizienz beurteilen zu können, werden die geplanten Investi­ tionen auf ihre Verhältnismässigkeit und ihre Zumutbarkeit untersucht. Der Bund setzt für Ertüchtigungsmassnahmen bei eigenen Objekten ca. 2 % der Umbaukos­ ten ein. Abbildung 67: Gebäude mit wei­ chem Erdgeschoss. Abbildung 68: Hörsaalgebäude HPH der ETH Zürich. Detail Stahlrohr­ fachwerk. Kapitel 9 Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung Urs-Thomas Gerber Wie wir natürliche Ressourcen verwenden, hat Einfluss auf unsere Gesundheit, unsere Sicherheit, aber auch auf die Schönheit unserer näheren Umgebung und der Welt. Dazu gehört auch der Umgang mit ver­ bauten Materialien. Spricht man beim Rückbau von Abfällen, so ist auch klar, dass man diese entsorgen muss. Sieht man die Baumaterialien von rückgebauten Ge­ bäuden jedoch nicht als Abfälle, sondern als potenzielle Sekundärrohstoffe, so wird der Fokus nicht mehr auf die Entsorgung gelegt, sondern auf das Wiederverwenden respektive das Recycling. Bevor man aber beim Bestand an den Aus­ bau von verbauten Baumaterialien denkt respektive an das Einbauen von neuen Werkstoffen, gilt es zu analysieren, ob sich auf dem Grundstück Altlasten befinden oder im Gebäude Bauschadstoffe verbaut wurden. Erst nach diesen Abklärungen kann ein Rückbau- und Entsorgungskon­ zept erarbeitet werden und anschliessend ein Materialkonzept für das Weiterbauen am Bestand. Altlasten Nach der Altlasten-Verordnung (AltlV) sind Altlasten mit Abfällen belastete Standorte, für die nachgewiesen ist, dass sie zu schäd­ lichen oder lästigen Einwirkungen führen oder bei denen die konkrete Gefahr be­ steht, dass solche Einwirkungen entste­ hen. Altlasten sind also sanierungsbedürf­ tige belastete Standorte (Art. 2 Abs. 2 und 3 AltlV). Daneben gibt es noch belastete Standorte, die lediglich der Überwachung bedürfen und solche, bei denen aufgrund Wichtige Fragen beim Weiterbauen ]]Gibt es Altlasten auf dem Grund­ stück? ]]Gibt es Bauschadstoffe im bestehen­ den Gebäude? ]]Können verbaute Materialien wieder eingesetzt werden? ]]Welche Forderungen sollen die neuen Materialien erfüllen? der geringen Belastung weder eine Über­ wachung noch eine Sanierung erforderlich sind. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung der Begriffe Altlasten und Abfälle. Auch das Wort Abfall ist ein definierter Begriff. Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen In­ teresse geboten ist (Art. 7 Abs. 6 USG). Eine belastete Bausubstanz (durch Gebäu­ deschadstoffe wie z. B. Asbest) oder ein belasteter Aushub werden nach Abfall­ recht beurteilt und nicht nach Altlasten­ recht. Vorgehen bei einer Altlastenuntersuchung Der Umgang mit Altlasten ist in der Altlas­ tenverordnung geregelt. So gibt es zum Beispiel verschiedene Altlastenarten: ]]Ablagerungsstandorte (z. B. Gemeinde­ deponie von Haushaltskehricht) ]]Betriebsstandorte (z. B. unbefestigter Platz einer Autogarage) ]]Unfallstandorte ]]Schiessanlagen (nach AltlV Betriebs­ standorte) Die Altlasten-Verordnung verpflichtet die Kantone dazu, einen Kataster der belaste­ ten Standorte (KbS) zu erstellen und zu führen. Vor der Aufnahme eines Standor­ tes in den KbS informiert der Kanton die Eigentümerschaft. Diese erhält die Gele­ genheit, vorgängig der Aufnahme Stel­ lung zu nehmen oder weitere Abklärun­ gen zu treffen. Der KbS ist ein dynamisches Arbeitsinstru­ ment. Ergibt eine Untersuchung das Resul­ tat, dass ein Standort nicht belastet ist, oder wird ein belasteter Standort saniert, wird er aus dem Kataster gestrichen. Um­ gekehrt können nicht im KbS aufgeführte Grundstücke durch neue Untersuchungen oder Erkenntnisse auch in den Kataster aufgenommen werden. Die Abbildung 69 zeigt einen Ausschnitt von belasteten Standorten im Kanton Bern. Je nach Altlast-Art, haben die Flä­ 74 Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung chen eine andere Farbe. Auf vielen Websi­ tes können auch weitere wichtige Informa­ tionen für Bauprojekte abgefragt werden. Die Kartensammlungen enthalten z. B. In­ formationen zu Radonkonzentrationen, Erdwärmesonden, Standorten von Sende­ anlagen (Mobilfunk, Rundfunk), usw. Links zu geeigneten Websites www.giszh.zh.ch www.be.ch/geoportal www.geo-bs.ch/stadtplan.cfm www.ag.ch/geoportal/de/pub Schritte einer altlastenrechtlichen Beurteilung Als erstes kann im jeweiligen Kataster (oft direkt übers Internet) nachgeschaut wer­ den, ob das vorliegende Grundstück als belasteter Standort eingetragen ist. Sollte dies der Fall sein, kann eine auf Altlasten­ untersuchungen spezialisierte Firma mit der Abklärung beauftragt werden. Es kann auch sein, dass der Standort nach AltlV Art. 5 Abs. 4 untersuchungsbedürftig ein­ Historische und technische Untersuchung ]]Mit der historischen Untersuchung wird die Geschichte des Standortes, welcher aufgrund seiner Nutzung mit Abfäl­ len bzw. mit Schadstoffen belastet sein könnte, aufgearbeitet. Sie bildet die Grundlage für den Entscheid über den Bedarf von weiteren Untersuchungen sowie deren Art und Umfang. In der Regel wird als Bestandteil der historischen Untersu­ chung ein Pflichtenheft für die technische Untersuchung aus­ gearbeitet. Dieses definiert Gegenstand, Umfang und die vor­ gesehenen Methoden der technischen Untersuchung und muss der zuständigen Behörde zur Stellungnahme unterbrei­ tet werden. Damit wird einerseits ein zielgerichteter und effizi­ enter Einsatz der meist kostenintensiven technischen Untersu­ chungsmassnahmen, andererseits aber auch ein frühzeitiger Dialog aller Beteiligten sichergestellt. ]]Mit der technischen Untersuchung werden die vom Standort ausgehenden Einwirkungen auf die Schutzgüter bzw. die konkrete Gefahr von solchen Einwirkungen abge­ klärt. Es müssen diejenigen Angaben ermittelt werden, die zur Beurteilung einer allfälligen Überwachungs- bzw. Sanierungs­ bedürftigkeit eines Standortes notwendig sind. Quelle: Historische und technische Untersuchung von belaste­ ten Standorten – Amt für Gewässerschutz und Abfallwirt­ schaft des Kantons Bern (GSA – neu AWA Amt für Wasser und Abfall) 2007. Abbildung 69: Ausschnitt aus dem Geoportal des Kan­ tons Bern im Regis­ ter «Belastete Standorte». Tabelle 13: Vorgehen bei Alt­ lasten je nach Fra­ gestellung in Bezug auf den Standort und eine zukünf­ tige Nutzung. Absicht Standortinhaber A B C Fall 1 Belastet, keine Untersu­ chung Keine Untersuchung Fall 2a Fall 2b Belastet, Untersuchung Belastet, Untersuchung nicht prioritär prioritär Bisherige Nutzung, kein Aufwand Untersuchung bei Untersuchung innerhalb Zustandsänderung 3 Jahre Zustandsänderung (Überbauung, Ver­ Programm für Einschätzung Mindestprogramm zur Klärung des Überwachungskauf, Vererbung, Bilanzwert) Entsorgung, Minderwert respektive des Sanierungsbedarfs Löschung Standort aus KbS, Erstat­ Programm zur Klärung belastet respektive unbelastet tung Untersuchungskosten 75 Gebäudeerneuerung gestuft ist, und dass bereits eine soge­ nannte Voruntersuchung stattgefunden hat. Da die AltlV für diese Pflicht jedoch eine «angemessene Frist» einräumt, ist dies noch nicht bei allen untersuchungsbe­ dürftigen Standorten erfolgt. Vereinfacht kann festgehalten werden, dass je nach Fragestellung in Bezug auf den Standort und in Bezug auf eine zukünftige Nutzung sich verschiedene Vorgehen ergeben (Ta­ belle 13). Je nach Absicht der Eigentümer­ schaft erfolgt ein spezifisches Untersu­ chungsprogramm – in der Regel in Zusam­ menarbeit mit einem Altlastenspezialisten. Beispiel: Ein Industriestandort wird auf­ grund der behördlichen Abklärungen in den KbS aufgenommen. Zudem wird der Standort als untersuchungsbedürftig ein­ gestuft. Es muss nun somit innert ange­ messener Frist eine Voruntersuchung durchgeführt werden. In der Regel besteht diese aus einer historischen und einer technischen Untersuchung. Falls die Vor­ untersuchungen ergeben, dass ein Stand­ ort unbelastet ist, wird er im Kataster ge­ löscht. Wenn ein Standort sanierungsbedürftig, also eine Altlast im eigentlichen Sinne ist, sind mit einer Detailuntersuchung genaue Kenntnisse über Art und Ausmass der Be­ lastung sowie über deren mögliche Aus­ wirkungen zu erbringen, damit die Dring­ lichkeit der Sanierung, sowie die allgemei­ nen Sanierungsziele festgelegt werden können. Letztlich bilden diese Untersu­ chungen auch die detailliertere Grundlage für die Abschätzung der Kosten, respek­ tive der Kostenträger. Das vom Sanierungspflichtigen zu erar­ beitende Sanierungsprojekt definiert die zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen (öko­logisch sinnvoll, technisch realisierbar und finanziell tragbar). Die Sanierung er­ folgt dann unter Berücksichtigung der gel­ tenden Normen, Gesetze, Richtlinien und Merkblätter, wie zum Beispiel der techni­ schen Verordnung über Abfälle (TVA), der Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von mineralischem Aus­ hub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie), der Norm SIA 430, etc. Links www.bafu.admin.ch/altlasten Bauschadstoffe Bisher wurde erläutert, wie das Vorgehen ist, wenn ein möglicher belasteter Stand­ ort vorliegt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass sich in der bestehenden Gebäudesubstanz, welche teilweise oder ganz rückgebaut werden soll, sogenannte Bauschadstoffe befinden. Dazu zählen As­ best, PAK, PCB, Schwermetalle, Holz­ schutzmittel, etc. Bedürfnisabklärung Bedürfnisse, welche Schadstoffe, weitere Ziele festlegen Schadstoffabklärung Schadstoffabklärungen (oder Screening) Bericht (Untersuchungsresultate, Dringlichkeit etc.) Entsorgungskonzept Ensorgungskonzept erstellen (Schnittstellen, Konzept, Ausmass, Kosten) Ausschreibung Ausführungsplanung Ausschreibung, Vergabeantrag (Allgemeine Bedingungen, Zuschlagskriterien, Leistungsverzeichnis) Ausführungsplanung (Sanierungskonzept Unternehmer, Freigabe durch SUVA) Ausführung Sanierung (Installationen, Zonen, Sanierung, evtl. Fachbauleitung) Abschluss Werkabnahme, Dokumentation (Schlussprotokoll, Raumluftmessung, Dokumentation) Abbildung 70: Ablauf einer Schad­ stoffuntersuchung und Schadstoffsa­ nierung. 76 Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung Relevante Schadstoffe ]]Asbest ]]PCB: Polychlorierte Biphenyle ]]PAK: Polyzyklische aromatische Kohlen­ wasserstoffe ]]Schwermetalle ]]PCP: Pentachlorphenol ]]Künstliche Mineralfasern Seit dem 1. Januar 1991 ist es verboten, asbesthaltige Produkte im Hochbau zu verwenden (SR 814.81). Trotzdem finden sich heute in fast jedem Umbau- oder Rückbauobjekt Schadstoffe wie z. B. As­ best; insbesondere in Liegenschaften wel­ che vor 1991 erstellt wurden. Eine Abklä­ rung auf Schadstoffe in der Gebäudesubs­ tanz sollte somit rechtzeitig vor jedem Umbau- oder Rückbauvorhaben erfolgen. Es ist aus diesem Grund wichtig, für die Schadstoff Asbest Tabelle 14: Anwendungsge­ biete von Bauschad­ stoffen. Schadstoffuntersuchung festzulegen, wel­ che Schadstoffe in der Gebäudeuntersu­ chung berücksichtigt werden sollen. Die rechtliche Situation ist dabei je nach Schadstoff sehr unterschiedlich geregelt. So gibt es für Asbest und PCB klare Vorga­ ben und Richtlinien, bei andern Schadstof­ fen ist die rechtliche Situation hinsichtlich einer Sanierung in der Schweiz jedoch nicht klar geregelt. Als Beispiel seien hier künstliche Mineralfasern genannt. Um sicherzustellen, dass zu Beginn die wichtigsten Zielgrössen fixiert werden und der Ablauf rechtlich und fachlich korrekt durchgeführt wird, lohnt es sich, einen Spezialisten beizuziehen. Die Suva führt auf ihrer Homepage eine Liste mit Firmen, welche Schadstoffuntersuchungen, insbe­ sondere für Asbest, durchführen. Verwendung, weitere Hinweise In Hunderten von verschiedenen Produkten wie Z.B: ]]Asbestzementprodukte wie Wellplatten, Fassadenschiefer, Gartenpro­ dukten, Rohr- und Lüftungsleitungen, usw. ]]Boden- und Wandbeläge, Unterlagsböden, Mörtel ]]Mörtel bei Rohrisolationen und Plattenbelägen ]]Fensterkitt ]]Leichtbauplatten, Karton und Pappen ]]Flachdachfolien ]]Akustikdecken ]]usw. PCB ]]Dichtungsfugen bei Betonkonstruktionen ]]Elektrische Bestandteile (Kondensatoren) ]]Farbanstriche ]]Weichmacher in Isoliermittel, Ölen und Kunststoffen PAK PAK kommen in Gebäuden hauptsächlich in teerhaltigen Baustoffen und in pechbasierten Farben und Klebstoffen vor. Teer wurde im Ver­ bund mit Dachpappen, Kork von Leitungen oder Holzbalken verwendet. Schwer­ Unter Schwermetallen versteht man hauptsächlich die Erscheinungsfor­ metalle men von folgenden Metallen: ]]Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Chrom (Cr), u. a. Diese Metalle haben im Bau verschiedene Anwendungen erfahren: ]]in Farben ]]in Schutzstoffen (Lacke, Biozide, u. a.) ]]in elektrischen Anlagen PCP ]]Bis zirka 1989 angewendet (Verbot PCP) ]]Vorsicht bei Dachausbauten oder Holzpavillons (z. B. Kindergärten) ]]Typische Produkte waren u. a. «Xylamon», «Xyladecor» und «Aidol» ]]Nachfragen beim Besitzer, ob Holzschutzmittel eingesetzt wurden ]]Bei Unsicherheiten Analyse auf Pentachlorphenol und Lindan Künstliche Insbesondere die alten Mineralfasern seien hier erwähnt (geringere Mineral­ Biolöslichkeit bis zirka 1994). Bei Arbeiten mit Mineralfaserdämmungen fasern sollte mindestens eine Schutzmaske FFP3 getragen werden. Die Liste ist nicht vollständig. 77 Gebäudeerneuerung Weiterführende Links www.suvapro.ch Branchen-/Fachthe­ men Asbest www.bag.admin.ch www.bafu.admin.ch www.forum-asbest.ch Materialkonzepte Die beste Ökobilanz weist Materialien auf, die gar nicht zum Einsatz kommen. Das heisst, ein Materialkonzept beginnt mit der Überlegung, was braucht es über­ haupt – oder anders gefragt – wie muss ich bauen, damit ich etwas nicht benötige oder nur in geringen Mengen. Die zweite Frage lautet, gibt es die Möglichkeit, Ma­ terialien einzusetzen, welche bereits als Baumaterialien im Einsatz waren. In erster Line wären dies im Gebäude bereits ver­ baute Materialien wie z. B. ein alter Par­ kettboden. Es könnten aber auch Materia­ lien sein, die anderswo im Einsatz standen und dort nicht mehr gebraucht werden. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass die neuen Ma­ terialien möglichst nachhaltig sind. Nur soviel wie nötig Kompakte Baukörper besitzen weniger Fläche gegen aussen als zergliederte – bei gleichem Volumen. Somit kann bei einer kompakten Bauweise auch Fassadenmate­ rial und Dämmung und dadurch Geld ge­ spart werden. Auch der Betrieb ist später günstiger, was doppelt Kosten spart. Aber auch bei Decken oder Innenwänden kön­ nen Bauteilschichten und somit graue Energie gespart werden. Es sollte darum gehen, die Wünsche der Nutzer und die technischen Anforderungen wie z. B. Ausgangslage Kompakte Bauform Brand- oder Schallschutz mit möglicht we­ nig Material zu erfüllen. Material in einem Kreislauf führen Insbesondere die nicht erneuerbaren Ma­ terialien sollten in einem Kreislauf geführt werden, damit sie auch für künftige Gene­ rationen zur Verfügung stehen. Wird der Rückbau geordnet vollzogen (SIA 430) und die Materialien sortenrein getrennt, so steht einem erneuten Einsatz nichts mehr im Weg. Dabei sollte als erstes eine Wiederverwendung geprüft werden. Das bedeutet, dass Baumaterialien ohne Ver­ änderung ihrer stofflichen Zusammenset­ zung wieder eingebaut und dabei dem gleichen Verwendungszweck zugeführt werden. Das könnte zum Beispiel altes holzschutzmittelfreies Konstruktionsholz oder ein alter Parkettboden sein. Die nächste Stufe ist die Weiterverwendung. Auch hier gibt es keine stoffliche Verände­ rung der Zusammensetzung; der Verwen­ dungszweck ist aber ein anderer. Eine Wei­ terverwendung ist zum Beispiel bei Ziegel­ steinen möglich, die als Gehwegplatten einsetzbar sind oder bei alten Holzboden­ belägen oder Wandvertäfelungen, die als Unterdach oder Blindboden Verwendung finden. Ist dieses Potenzial genutzt, so be­ steht eine weitere Möglichkeit in der Wie­ derverwertung. Dabei wird das Material nach einer physikalischen oder chemi­ schen Aufbereitung wieder derselben Pro­ duktgruppe zugeführt. Alteisen oder RCBeton gehören zu dieser Art von Material­ recycling. Die letzte Möglichkeit ist die Weiterverwertung. Dabei werden ge­ brauchte Baumaterialien nach einer physi­ kalischen oder chemischen Aufbereitung Weiterbauen Variante A Weiterbauen Variante B A/V-Verhältnis verbessert A/V-Verhältnis verschlechtert Abbildung 71: Kompaktes Weiter­ bauen. 78 Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung einer anderen Produktgruppe zugeführt. Glaswolle ist ein derartiges Produkt, wel­ ches aus Altglas hergestellt wurde, aber auch Gipsfaserplatten, welche unter ande­ rem aus Altpapier hergestellt werden. Neue nachhaltige Materialien Viele verwendete Materialien sind neu. Hier ist die graue Energie respektive der Primärenergiegehalt ein Kriterium. Wer­ den zwei Bodenbeläge miteinander vergli­ chen, ist es aber wichtig, die relevante Be­ zugsgrösse beizuziehen (z. B. kg/m2). Es gibt aber weitere Kriterien, die auch zu einer nachhaltigen Materialisierung gehö­ ren und die man nicht mit MJ oder kWh ausdrücken kann. Zu qualitativen Kriterien gehören Aspekte wie Verfügbarkeit der Rohstoffe, Schadstoffemissionen inner­ halb des Lebenszyklusses, Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Unterhaltsfreundlich­ keit und Verwertbarkeit. Auch Aspekte wie regionale Verankerung und Wert­ schöpfungsketten sind wichtige Kenngrö­ ssen. Weiterführende Links www.ecobau.ch www.nachhaltigesbauen.de Abbildung 72: Verwertungsstufen von Baustoffen Systemtrennung Die Idee, ein Gebäude flexibel zu bauen, damit es auch zukünftigen Anforderungen gerecht wird, ist als zentraler Punkt des ökologischen Bauens zu sehen. Mit Flexibi­ lität ist gemeint, dass sich ein Gebäude an neue Anforderungen wie grössere Räume oder grössere Nutzungseinheiten anpas­ sen lässt, aber auch, dass die Möglichkeit besteht, einem Gebäude eine komplett neue Nutzung zuzuweisen. Heute werden oft Gebäude nach 30 bis 40 Jahren abge­ rissen, weil es zu aufwendig wäre, die neuen Nutzungsanforderungen durch bauliche Massnahmen im bestehenden Gebäude wieder herzustellen. Diese Nutzungsflexibilität spielt bei Bauten der öffentlichen Hand wohl noch eine grö­ ssere Rolle als bei Wohnbauten. Aus diesem Grund hat das Amt für Grund­ stücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) eine zukunftsgerichtete Planungs­ methode – die Systemtrennung – einge­ führt. Durch ihre konsequente Anwen­ dung bei allen Bauvorhaben soll durch geringe Mehrinvestitionen bei der Planung und der Erstellung von Gebäuden eine langfristige Nutzung möglich sein. Einfa­ che Austauschbarkeit von Bauteilen und möglichst grosse Nutzungsflexibilität sind dabei die beiden Hauptziele dieser Me­ thode. 1. Wiederverwendung • Keine stoffliche Veränderung, gleicher Verwendungszweck • z.B. Alter Parkettboden wiederverwenden 2. Weiterverwendung • Keine stoffliche Veränderung, anderer Verwendungszweck • z.B. Gehweg im Garten aus alten Ziegelsteinen 3. Wiederverwertung • Nach physikalischer oder chemischer Aufbereitung gleicher Verwendungszweck • z.B. Recycling Beton aus Betongranulat (RC Beton B) 4. Weiterverwertung • Nach physikalischer oder chemischer Aufbereitung anderer Verwendungszweck • z.B. aus Altglas Glaswolldämmstoffmatten herstellen 79 Gebäudeerneuerung Bauteiltrennung und Flexibilität Mit der Bauteiltrennung soll sichergestellt werden, dass Bauelemente mit unter­ schiedlicher Lebens- und Nutzungsdauer nicht untrennbar miteinander verbunden werden. Die drei Stufen Primär-, Sekundärund Tertiärsystem helfen dabei, die Nut­ zungsdauer von Bauteilen und Bauele­ menten übergeordnet zu betrachten. Zur Systemtrennung sollten beispielsweise Leitungen und Lüftungskanäle nicht ein­ gelegt werden (Abbildung 73), da ihre Le­ bens- respektive Nutzungsdauer wohl viel kürzer sein wird als die der Decke. Mit Fle­ xibilität wird die Möglichkeit umschrieben, ein Gebäude zukünftigen Nutzungsent­ wicklungen und Umnutzungen anzupas­ sen. Dabei werden Nutzlasten, Raster, Spannweiten, Raumhöhen, Reserven, Auf­ stockungs- oder Anbaumöglichkeiten und weitere Parameter definiert. Da Gebäude oft nur für eine geplante Nut­ zung konzipiert werden, entstehen bei ei­ ner Umnutzung grosse Kosten, weil die Gebäudestruktur zu stark auf die Erstnut­ zung ausgerichtet wurde. ohne Systemtrennung Bauteiltrennung Prinzipien der Systemtrennung Flexibilität Abbildung 73: Die beiden Prinzi­ pien «Bauteiltren­ nung» und «Flexibi­ lität». Systemstufe Bestandteile Lebens- respektive Nutzungsdauer Primärsystem (weitestgehend unveränderbar) ]]Tragstruktur ]]Gebäudehülle ]]Erschliessung 50 bis 100 Jahre (langfristige Investition) Sekundärsystem (anpassbar) ]]Innenwände, Decken, Böden ]]Innenausbau ]]Installationen 15 bis 50 Jahre (mittelfristige Investition) Tertiärsystem (veränderbar) ]]Mobiliar ]]Apparate ]]Technik 5 bis 15 Jahre (kurzfristige Investition) Abbildung 74: Die drei Systemstu­ fen Primär-, Sekun­ där- und Tertiärsys­ tem der Systemtren­ nung. 80 Altlasten, Bauschadstoffe, Materialkonzepte, Systemtrennung Dieser Problematik soll bei Neubauten und Erneuerungen durch einen definierten Spielraum für die Zukunft entgegenge­ wirkt werden. Dies soll unter anderem mit folgenden Massnahmen erfolgen: ]]genügend grosse Gebäuderaster ]]entsprechende Gebäudetiefen ]]genügend grosse Geschosshöhen ]]Anpassungen der Nutzlasten ]]allenfalls Verstärkung der Fundation ]]Reserve bei der Erschliessung Mit der Berücksichtigung dieser Punkte auf mögliche zukünftige Nutzungen ent­ stehen mit geringfügigen Zusatzaufwen­ dungen entscheidende Mehrwerte. Es gilt jeweils abzuschätzen, wie realistisch eine mögliche Veränderung ist und wie auf­ wendig ein nachträgliches Nachrüsten wäre. Es braucht somit ein sorgfältiges Ab­ wägen, welche Vorkehrungen bereits bei der Erstellung sinnvoll sind. Die Systemtrennung ist ein wichtiges Hilfs­ mittel, um die Lebenszykluskosten von Ge­ bäuden möglichst tief zu halten. Weiterführende Links www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/or­ ganisation/agg/mandate/systemtrennung. html Kapitel 10 Sicherheit und Brandschutz Jürg Tschabold Umnutzungen, Erneuerungen und Ände­ rungen an der Struktur erfordern eine Überprüfung der gesamten Sicherheit in einem Gebäude. Die zu erreichenden Schutzziele der Eigentümer und Benutzer erfordern ein umfassendes, der Bausubs­ tanz angepasstes Sicherheits- und Brand­ schutzkonzept. Aktuelle Vorschriften und Normen sind zu berücksichtigen. Ein Ge­ bäude soll nach einem Umbau und mit neuer Nutzung den Sicherheitsstandard eines Neubaus erreichen. Die gesetzlichen Vorgaben erlauben dabei eine Berücksich­ tigung der Verhältnismässigkeit. Behörden dürfen nur Massnahmen fordern, die sich aus den Vorschriften ergeben. Das Einhal­ ten der Vorschriften und Normen garan­ tiert jedoch nicht die Einhaltung betriebli­ cher Schutzziele oder weiterer Anforde­ rungen. Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen können den Grundriss, die Gestaltung und die Konstruktion beeinflussen. Beispiels­ weise können Fluchtwege die bisherige oder geplante Raumorganisation modifi­ zieren. Sie müssen deshalb bereits von Be­ ginn weg eingeplant werden. Der frühzei­ tige Kontakt zu Fachspezialisten und Be­ hörden lohnt sich. Sicherheits- und Schutzziele Damit die Sicherheit den Erwartungen und Anforderungen einer Bauherrschaft ge­ recht wird, sind mit dieser und mit den Ri­ sikoträgern (z. B. Versicherungen und Be­ hörden) zusammen die akzeptierbaren Ri­ siken und die im Ereignisfall zu erreichen­ den Schutzziele qualitativ und quantitativ festzulegen z.B: ]]Personensicherheit (vom Gesetz gefor­ dert) ]]Akzeptierbare Gebäudeschäden ]]Verfügbarkeit von Gebäude und Anla­ gen (akzeptierbarer Betriebsunterbruch) ]]Zulässiges Ausmass von Sachschäden Werden die Schutzziele der Bauherrschaft eingehalten, sind erfahrungsgemäss die Vorschriften weitgehend erfüllt. Bei grossen Gefahren und Risiken fordern Ver­ sicherungen möglicherweise besondere Massnahmen zu deren Minderung. Vorschriften Minimale Anforderungen ergeben sich aus Gesetzen und Normen. Die Behörden kön­ nen Ausnahmen zustimmen. Zu beachten sind: ]]Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt ]]Arbeitsgesetz mit den Verordnungen 3 + 4 und Richtlinien von EKAS und Suva ]]Brandschutzvorschriften (Brandschutz­ norm und Richtlinien der VKF) ]]Auflagen, z. B. von Feuerwehr und Ret­ tungsdiensten ]]Eventuell Forderungen und Empfehlun­ gen von Versicherungen. Abweichungen von der Brandschutznorm und anderen Vorschriften sind möglich, wenn mit einem Brandschutzkonzept eine ausreichende Sicherheit nachgewiesen werden kann. Brandschutzkonzept Ein Brandschutzkonzept besteht aus aufei­ nander abgestimmten Massnahmen aus baulichem, technischem und organisatori­ schem Brandschutz. Das Brandschutzkon­ zept ist auf Plänen und mit einem Bericht zu dokumentieren. Baulicher Brandschutz Tragwerk: Das Tragwerk muss einen ent­ sprechend der Brandlast genügenden Feu­ erwiderstand erreichen. Es darf im Brand­ fall während einer definierten Zeit nicht kollabieren. Das Versagen eines Bauteils darf nicht zum Einsturz eines ganzen Ge­ bäudes führen. Ein ungenügender Feuer­ widerstand kann in der Regel mit techni­ schem Brandschutz (Sprinkler) kompen­ siert werden. Fluchtwege: Anzahl und Anordnung der Fluchtwege haben grossen Einfluss auf die Gestaltung von Bauten. Sie können nicht durch Ersatzmassnahmen kompensiert 82 Sicherheit und Brandschutz werden. Türen in Fluchtwegen müssen im­ mer in Fluchtrichtung öffnend und immer ohne Hilfsmittel begehbar sein. Brandunterteilung, Brandabschnitte: Die Unterteilung eines Gebäudes in Brandabschnitte bezweckt die Begren­ zung eines Brandereignisses. Die nötigen Anforderungen ergeben sich aus Grösse und Nutzung. Sie können mit dem techni­ schen Brandschutz beeinflusst werden. Zu trennen sind üblicherweise: ]]Geschosse ]]Nutzungen mit unterschiedlicher Brand­ gefahr ]]Vertikalverbindungen wie Treppen, Lift­ schächte, Installationskanäle und Schächte ]]Technikräume ]]In Wohngebäuden Wohnungen Brandabschnitte erfüllen ihre Funktion nur, wenn deren Trennung baulich vollständig umgesetzt ist, das heisst, wenn keine Lü­ cken vorhanden sind. Abbildung 75: Treppenhaus mit Brandschutzvergla­ sung im Bundes­ haus Bern. (Vetro­ tech St. Gobain) Abbildung 76: Angrenzende Räume, durch Brandschutzvergla­ sungen getrennt. (Vetrotech St. Gobain) Abbildung 77: Korrekt in die De­ cke eingemauerte Brandschutzklappe. Wände und Decken: Brandabschnitts­ bildende Bauteile sind: ]]Brandmauern zur Trennung zusammen gebauter Gebäude (REI 180) ]]Brandwände zur Unterteilung innerhalb von Geschossen (EI 30 – EI 90) ]]z. B. Mauerwerk, Beton, Gipsplatten über 5 cm ]]Betondecken, Eisenüberdeckung über 2 cm ]]Verglasungen mit zugelassenen Syste­ men Brandabschlüsse: Öffnungen und Durch­ brüche in Brandwänden und Decken müs­ sen mit Abschlüssen ausgerüstet sein, die den Brandbelastungen standhalten. ]]Durchgänge für Personen und Waren er­ fordern Brandschutztüren und Brand­ schutztore. ]]Durchbrüche, z. B. für Leitungen erfor­ dern Abschottungen. ]]Für Lüftungskanäle sind Brandschutz­ klappen einzubauen. ]]Für Transportanlagen sind meist spezielle Abschlüsse erforderlich. 83 Gebäudeerneuerung Technischer Brandschutz Der technische Brandschutz umfasst Nor­ malmassnahmen (Löschgeräte) und Son­ dermassnahmen (Brandmelde- und Lösch­ anlagen, Brandfallsteuerungen, Entrau­ chungsanlagen). Mit Brandschutzanlagen, insbesondere mit Sprinkleranlagen kön­ nen in einem Brandschutzkonzept teil­ weise Erleichterungen bei baulichen Mass­ nahmen erreicht oder Schwachstellen kompensiert werden, z. B. reduzierte An­ forderungen an das Tragwerk oder gerin­ gere Anforderungen an Brandabschnitte (E-Glas statt EI-Glas). Sie ermöglichen grö­ ssere Flexibilität und Brandabschnitte. Blitzschutz: Dieser ist für bestimmte Ge­ bäude und Nutzungen vorgeschrieben. Der äussere Blitzschutz besteht aus Fangleiter (-netz), den Ableitungen und der Erdung, die meist als Ringleitung oder Fundamenterdung ausgeführt ist. Zudem ist je nach Nutzung möglicherweise ein in­ nerer Blitzschutz mit Potenzialausgleich und Überspannungsschutz erforderlich. teme (z. B. Beschallungsanlagen) sind fall­ weise vorzusehen. Sprachdurchsagen sind besser als der Alarmton einer Sirene. Organisation: Die Personen- und Be­ triebssicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn eine zweckmässige Organi­ sation vorhanden ist: ]]Verantwortliche sind bezeichnet und ausgebildet (Sicherheitsbeauftragte). ]]Das Personal ist instruiert, Übungen wer­ den durchgeführt. ]]Kontrollen und Unterhalt werden regel­ mässig durchgeführt. Abbildung 78: Darstellung Flucht­ weglängen nach VKF-Verordnung 4 ArG. 35 m Organisatorische Massnahmen Ertüchtigung bestehender Konstruktio­ nen, Beispiel Balkendecke auf REI 30 ver­ stärkt. Aufbau nach Sanierung, von oben nach unten: ]]Bodenbelag ]]Trennschicht ]]Unterlagsboden (z. B. Anhydrit oder Zement) ]]Trennschicht oder Isolation ]]Balkenlage ]]Füllung oder Isolation ]]Schiebeboden ]]Deckenverkleidung EI 30 Die Voraussetzung für die Sanierung ist eine statisch genügende Decke. m 0m 5 50 m 50 m (45m) 5m Alarmierung: Keine spezifischen Vor­ schriften bestehen in Bezug auf die Alar­ mierung für eine Evakuation. Wesentlich für die Personenrettung ist, dass eine nö­ tige Evakuation möglichst frühzeitig aus­ gelöst werden kann. Entsprechende Sys­ 35 35 m Quelle: Elascon 84 Sicherheit und Brandschutz Einbruchschutz: Im Gegensatz zum Brandschutz gibt es kaum behördliche Vorschriften zum Schutz vor Einbrüchen und Diebstahl. Für die Anforderungen an den Einbruchschutz existieren unterschied­ liche Einbruchschutzklassen gemäss EN 1627. Bauteile der entsprechenden Anfor­ derungsklasse haben einen amtlichen Ein­ bruchversuch zu bestehen (Tabelle 15). Wichtig ist eine einheitliche Schutzklasse für den gesamten zu schützenden Perime­ ter. Schutzklasse Widerstandszeit Tätertyp, Vorgehensweise (Modus operandi) WK 1 keine manuelle Prüfung Grundschutz gegen Aufbruch­ versuche mit körperlicher Ge­ walt WK 2 3 Minuten Gelegenheitstäter, einfache Werkzeuge (Schraubendreher, Zange) WK 3 5 Minuten Täter, zusätzlich mit zweitem Schraubendreher und Kuhfuss WK 4 10 Minuten erfahrene Täter, zusätzlich Sä­ gewerkzeuge und Schlagwerk­ zeuge WK 5 15 Minuten zusätzlich Elektrowerkzeuge WK 6 20 Minuten erfahrene Täter, zusätzlich leis­ tungsfähige Elektrowerkzeuge Tabelle 15: Schutzklassen bei Massnahmen gegen Einbruch. Kapitel 11 Energiekonzepte Jean-Marc Chuard Abbildung 79: Bestimmende Para­ meter, die ein Ener­ giekonzept kenn­ zeichnen. In diesem Beispiel liegt das Schwergewicht bei der Wirtschaftlich­ keit energetischer Massnahmen, ohne dass ökologische Aspekte speziell ge­ wichtet werden. Hülle und Technik – ein System Unsere Gesetzgebung, Normen und Stan­ dards sind in den letzten Jahren bewusst so aufgebaut worden, dass zwingend eine vernetzte Projektentwicklung erfolgen muss. Das Entwickeln fortschrittlicher Ge­ bäudekonzepte, in welchen ein sparsamer, umweltschonender Umgang mit unseren Ressourcen im Vordergrund steht, ist ohne vernetzte Bearbeitung des Gebäudes – der Gebäudehülle und der Gebäudetechnik – nicht machbar. Bei jedem Gebäude beein­ flussen sich die Ausrichtung und das Grundkonzept des Gebäudes gegenseitig in sehr entscheidendem Masse. Die sinn­ volle Lösung dieses Problems ist in der Pra­ xis ein Iterationsprozess, der in einem frü­ Energie Ökonomie Ökologie hen Projektstadium einsetzen muss. Alle Disziplinen wie Architektur, Bauphysik und Gebäudetechnik sind hier gefordert, sich auf das gemeinsame Ziel hin gegenseitig abzustimmen und ein optimales Konzept gemeinsam zu entwickeln. Wie gut ist ein Energiekonzept? Die Güte eines Energiekonzepts lässt sich mit folgenden Parametern kennzeichnen (Abbildung 79): ]]Energie: Grundsätzlich ist zwischen der für Nachweise relevante Nutzenergie (z. B. Heizwärmebedarf nach SIA 380/1) und der angelieferten Energiemenge (Endenergie) zu unterscheiden. Einerseits bestimmen die Bauqualität, das Gebäudekonzept und die Benutzer den Grundbedarf des Gebäudes erheblich. Andererseits kann mit geeigne­ ter Gebäudetechnik die Wärmeenergie auf effiziente Weise bereitgestellt und ein Teil der im Gebäude anfallenden Abwärme zu­ rückgewonnen und wieder verwendet werden. Schliesslich ist auch die Eigenpro­ duktion von Strom respektive von Wärme eine Möglichkeit zur positiven Beeinflus­ sung der Energiebilanz, z. B. durch den Ein­ satz entsprechender Kollektoren (Abbil­ EF,El 4 QiP EF,El Qg Qi QiEl 3 EF,hww WRG Qs Qug Qtot Qh 1 QT Qhww Qww Qr 1 2 3 4 QL QV 2 Systemgrenze Heizwärmebedarf Systemgrenze Wärmebedarf für Warmwasser Systemgrenze Heiz- und Warmwassersystem Systemgrenze Gebäude Abbildung 80: Darstellung der Energiebilanz eines nicht klimatisierten Gebäudes. Rot: Positiv beein­ flussbare Gesamtbi­ lanz durch das Ener­ giekonzept und durch geeignet aus­ gelegter Gebäude­ technik und durch Eigenproduktion. Blau: Positiv beein­ flussbare Gesamtbi­ lanz durch das Ener­ giekonzept bzw. durch den Baukör­ per sowie durch die Einzelbauteile und die Bauhülle. (Quelle: SIA 380/1) Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung und Be­ triebseinrichtungen EF,hww Endenergiebedarf für Heizung und Warm­ wasser (nach Energieträger) Qg Wärmegewinne Qh Heizwärmebedarf Qhww Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser Qi interne Wärmegewinne QiEl interne Wärmegewinne Elektrizität QiP interne Wärmegewinne Personen QL Wärmeverluste des Heiz- und Warmwasser­ systems (Erzeugungs-, Speicher- und Verteil­ verluste) Qr durch das Heiz- und Warmwassersystem ge­ wonnene Umweltwärme Qs solare Wärmegewinne QT Transmissionswärmeverlust Qtot Gesamtwärmeverlust Qug genutzte Wärmegewinne QV Lüftungswärmeverluste Qww Gesamtwärmeverlust WRG Wärmerückgewinnung 86 Energiekonzepte Tabelle 16: Ausschnitt aus der KBOB-Empfehlung für Bauherren, Pro­ jektleiter und Pla­ ner. Übersicht zur Definition der Be­ griffe Gesamtbe­ wertung und Teil­ bewertung der Pri­ märenergie und der Treibhausgasemissi­ onen mit der Me­ thode der ökologi­ schen Knappheit (UBP). (Quelle: KBOB, Ökobilanzen im Baubereich, März 2010) dung 80). Zur Beurteilung wird der Ener­ giebedarf eines Gebäudes in der Regel auf einen spezifischen Wert wie z. B. der Ener­ giekennzahl in MJ/m2 a umgerechnet. Da­ mit kann der Energiebedarf von Gebäuden untereinander verglichen und beurteilt werden. ]]Die Ökologie wird anhand von Ökobi­ lanzen qualitativ und quantitativ bewertet (Tabelle 16). ]]Ökonomie: Ein gutes Energiekonzept muss auch ökonomischen Grundsätzen genügen. Einerseits gilt es, die Investitions­ kosten für das Bauprojekt zu ermitteln. An­ dererseits sind die anfallenden Betriebs-, Unterhalts- und Erneuerungskosten über eine lange Zeitdauer als wirtschaftliche In­ dikatoren von Interesse (z. B. Lebenszyklus­ kosten, d. h. ökonomische Betrachtung der Gesamtkosten eines Gebäudes, einer An­ lage oder einer baulich-technischen Mass­ nahme über deren Lebensdauer). Mit dem Ermitteln dieser Indikatoren können auch Entscheidungsgrundlagen zu Systemvari­ anten in einem Energiekonzept geschaffen werden. Das Ermitteln dieser drei Parameter zur Be­ urteilung der Güte eines Energiekonzepts kann aufwendig sein. Dabei wird schnell klar, dass nicht jeder Parameter einzeln maximiert werden kann, da sie sich gegen­ seitig stark beeinflussen. Ein gutes Ener­ giekonzept wird somit ein ausgewogenes, auf die Bedürfnisse der Bauherrschaft aus­ gerichtetes Optimum zwischen den drei Betrachtungsebenen anstreben. Ökobilanzdaten im Baubereich, KBOB/eco-bau/IPB 2009/1, Stand März 2010 Gesamtbewertung UBP Teilbewertung Primärenergie nicht erneuerbar (graue Energie) Die nicht erneuerbare Primär­ Die UBP 2006 quantifizieren die Die gesamte Primärenergie Umweltbelastungen durch die quantifiziert zusätzlich zur nicht energie quantifiziert den kumu­ lierten Energieaufwand der fos­ erneuerbaren Primärenergie Nutzung von Energieressour­ silen und nuklearen Energieträ­ cen, von Land und Süsswasser, den kumulierten Energieauf­ wand an erneuerbaren Energie­ ger sowie Holz aus Kahlschlag durch Emissionen in Luft, Ge­ von Primärwäldern. trägern. wässern und Boden sowie durch die Beseitigung von Ab­ Die erneuerbaren Energieträger umfassen Wasserkraft, Holz/ fällen. Biomasse (ohne Kahlschlag von Primärwäldern), Sonnen-, Wind-, geothermische und Um­ gebungsenergie. Die Umweltauswirkungen der Mit dieser Kenngrösse wird die Mit dieser Kenngrösse wird die Teilbewertungen sind in der dem Gebäude zugeführte Ener­ Bezugsgrösse gemäss Merk­ Gesamtbewertung UBP enthal­ giemenge (Endenergie) gemäss blatt SIA 2032 «Graue Energie von Gebäuden» bewertet. ten. Merkblatt SIA 2031 «Energie­ ausweis für Gebäude» bewer­ tet. Treibhausgasemissionen Gesamt Die Beurteilung mit der Me­ thode der ökologischen Knapp­ heit (UBP) zeigt ein vollständi­ ges Bild der Umweltauswirkun­ gen auf und basiert auf der Schweizerischen Umweltpolitik. Die Treibhausgasemissionen quantifizieren die kumulierten Wirkungen verschiedener Treib­ hausgase, bezogen auf die Leit­ substanz CO2. Mit dieser Kenngrösse werden die dem Gebäude zugeführte Energiemenge gemäss Merk­ blatt SIA 2031 «Energieausweis für Gebäude» sowie die Be­ zugsgrösse gemäss Merkblatt SIA 2032 «Graue Energie von Gebäuden» bewertet. Die Treibhausgasemissionen Die graue Energie ist ein im sind ein Kennwert für die Kli­ Baubereich etablierter Kenn­ wert. Die Instrumente des Ver­ maerwärmung. Nicht gleichzu­ setzen mit dem standortgebun­ eins eco-bau (eco-devis, BKPdenen CO2-Ausstoss, welcher Merkblätter) stützen sich für eine gesamtheitliche Beurtei­ Gegenstand von Zielvereinba­ lung neben zusätzlichen ökolo­ rungen mit dem Bund im Rah­ gischen Merkmalen auf diese men des CO2-Gesetzes ist. Teilbewertung ab. 87 Gebäudeerneuerung NEIN Gewichtete EnergieKennzahl in kWh/m2 Primäranforderung Grenzwert SIA 380/1 Elektrizität 8% Aussenwände 25% Warmwasser 9% Estrichboden, Dach 17% Fenster 13% Undichtigkeiten, Lüften 10% Boden 9% MODERNISIERUNG ANFORDERUNG 60 Beispiel Umsetzung Heizungsverluste 9% MODERNISIERUNG Energieeffizienz ist das Ziel Der Minergie-Standard ist ein freiwilliger Baustandard, der den rationellen Energie­ einsatz und die Nutzung erneuerbarer Energien zum Ziel hat. Das Einhalten des Standards kann die Bauherrschaft zertifi­ zieren lassen. Die folgenden Anforderun­ gen müssen eingehalten werden: ]]Primäranforderung an die Gebäudehülle – entfällt bei Erneuerungen! ]]Ganzjährig kontrollierbarer Luftwechsel Abbildung 82: Unterschiede in den Anforderungen nach Minergie und Minergie-P. Wertungsfaktoren der Zukunft Der CO2-Ausstoss bzw. die CO2-Bilanz ei­ ner Anlage, eines Gebäudes oder eines ganzen Areals ist im Prinzip eine Teilbe­ wertung der ökologischen Güte eines Konzepts, welche die Treibhausgasemissi­ onen als Massstab nimmt (Tabelle 16). Seit der Umweltkonferenz in Kyoto ist die Re­ duktion des CO2-Ausstosses das internati­ onal vereinbarte Mass, auf das die Politik die Umweltbelastung durch Treibhausgase reduzieren will. In der Schweiz ist der CO2Ausstoss seit 2010 mit einer Abgabe von 36 Fr. pro Tonne CO2 belegt (Stand 1. Ja­ nuar 2010). Damit will die Landesregie­ rung den CO2-Ausstoss bis 2020 landes­ weit um 20 % reduzieren. Der Vorteil die­ ser Betrachtungsebene ist, dass die CO2Gesamtbilanz eines Gebäudes, einer An­ lage oder z. B. eines ganzen Areals immer die Wirkungsfelder aller eingesetzten Energieträger einschliesst und somit den Handlungsspielraum des Planers nicht ein­ grenzt, ihn aber gleichzeitig dazu zwingt, stets eine Gesamtbetrachtung der Situa­ tion vorzunehmen. Abbildung 81: Bei einem typischen Einfamilienhaus ha­ ben die einzelnen Nutzungen und Bauteile den aufge­ führten Anteil am Gesamtenergiever­ brauch. Multipli­ ziert man die abso­ luten Zahlen für den Jahresver­ brauch dieser An­ teile mit den Fakto­ ren der Treibhaus­ gasemissionen der entsprechenden Energieträger ge­ mäss Tabelle 19, so erhält man die CO2Gesamtbilanz des Gebäudes. 30 80% JA Sommerl. Wärmeschutz JA NEIN Nachweis Luftdichtheit JA JA Kontrollierte Lüftung JA NEIN Strombedarf Hilfsgeräte JA NEIN Nachweis Beleuchtung NEIN NEIN Haushaltgeräte A-Klasse JA NEIN Nachweis Graue Energie NEIN 20-25 Wärmedämmung in cm 20-35 2-IV 3-IV Fenster-Verglasung 3-IV JA Erneuerbare Energien JA NEIN Nieder-Temperatur Wärmeverteilung JA Beispiel Umsetzung GÄNGIGE PRAXIS Vergleich gültig für Modernisierungen Gebäudekategorie II Wohnen Einfamilienhaus Grafik: Minergie® 2011 88 Energiekonzepte ]]Minergie-Grenzwert (gewichtete Ener­ giekennzahl) ]]Nachweis über den thermischen Kom­ fort im Sommer ]]Zusatzanforderungen, je nach Gebäude­ kategorie, betreffend Beleuchtung, ge­ werbliche Kälte und Wärmeerzeugung ]]Mehrkosten gegenüber konventionellen Vergleichsobjekten höchstens 10 %. Im Minergie-Standard wird das Ziel als Grenzwert im Endenergieverbrauch defi­ niert. Wichtig ist, dass auch hier das ganze Gebäude als integrales System betrachtet wird: die Gebäudehülle und die Gebäude­ technik. In Minergie-Gebäuden mit mini­ malem Heizenergieverbrauch spielt der Energieträger für die Heizung eine unter­ geordnete Rolle. Der Aufwand für die Wassererwärmung dagegen wird in der Energiebilanz verhältnismässig wichtig. Lösungen mit erneuerbaren Energien (z. B. Sonnenkollektoren) bieten sich hier an. Der Minergie-Standard gilt als allgemein anerkannter Baustandard. Es ist aber zu beachten, dass für Erneuerungen von Bau­ ten neben dem Basis-Standard der Miner­ gie-P-Standard, der Minergie-Eco-Stan­ dard und der Minergie-P-Eco-Standard gelten. Gegenüber dem Minergie-Stan­ dard bedingt der Minergie-P-Standard we­ sentlich schärfere Grenzwerte und schreibt zwingende Massnahmen in der Gebäude­ technik vor (Abbildung 82). Minergie-Eco ist eine Ergänzung zum Basis- und zum PStandard. Während Merkmale wie Kom­ fort und Energieeffizienz Minergie-Gebäu­ den eigen sind, erfüllen zertifizierte Bau­ ten nach Minergie-Eco zudem Anforde­ rungen einer gesunden und ökologischen Bauweise (Abbildung 83). Das breite Wis­ sen, die bewährten Planungswerkzeuge und nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Programm Eco-Bau bilden die Grundlage. Differenzieren mit Gebäudekategorien Die Vorgaben der entsprechenden SIANormen wie auch der Minergie-Standards beziehen sich auf zwölf verschiedene Ge­ bäudekategorien (Tabelle 17). Diese Eintei­ lung, differenziert nach Neubau und Er­ neuerung, ermöglicht es, Grenzwerte fest­ zulegen, welche die Eigenheiten der jewei­ ligen Kategorien in realistischer Weise be­ rücksichtigen. MINERGIE-ECO® Abbildung 83: Minergie-Eco ist eine Erweiterung des Basisstandards Minergie um ge­ sundheitliche und bauökologische Kri­ terien. Geringe Umweltbelastung Mehr Lebensqualität MINERGIE® Komfort Hohe thermische Behaglichkeit Sommerlicher Wärmeschutz Systematische Lufterneuerung ECO Gesundheit Optimale Tageslichtverhältnisse Geringe Lärmimmissionen Geringe Belastung mit Schadstoffen, Keimen und Strahlung Tageslicht Schallschutz Innenraumklima Energieeffizienz Gesamter Energieverbrauch liegt ca. 20% und Fossiler Energieverbrauch liegt ca. 50% unter dem durchschnittlichen Stand der Technik Bauökologie Hohe Nutzungsdauer, Nutzungsflexibilität, Rückbaufähigkeit Einsatz von Recyclingbaustoffen, gelabelte Produkte, Bodenschutz Tiefe Graue Energie der Summe aller verwendeten Baustoffe Gebäudekonzept Materialien und Bauprozesse Graue Energie Baustoffe 89 Gebäudeerneuerung Anforderungen für Bauten vor 2000 Kategorie Gewichtete Energiekennzahl Primäranforderung Lüftungsanlage Zusatzanforderungen I Wohnen MFH 60 kWh/m2 RH, WW, El.Lüft.* keine vorausgesetzt Keine Anforderungen Empfehlung für Haus­ haltgeräte: Energie-Etikette Klasse A II Wohnen EFH 60 kWh/m2 RH, WW, El.Lüft.* keine vorausgesetzt Keine Anforderungen Empfehlung für Haus­ haltgeräte: Energie-Etikette Klasse A III Verwaltung 55 kWh/m2 RH, WW, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 IV Schulen 55 kWh/m2 RH, WW, El. Lüft.* keine vorausgesetzt Beleuchtung nach SIA 380/4 V Verkauf 55 kWh/m2 RH, WW, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 Gewerbliche Kälte VI Restaurants 65 kWh/m2 RH, El. Lüft.* keine vorausgesetzt Beleuchtung nach SIA 380/4 WW: 20 % des Bedarfs mit erneuerbarer Energie VII Versammlungs­ lokale 60 kWh/m2 RH, WW, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 VIII Spitäler 85 kWh/m2 RH, WW, El. Lüft.* keine vorausgesetzt Beleuchtung nach SIA 380/4 Gewerbliche Kälte IX Industrie 40 kWh/m2 RH, WW, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 X Lager 35 kWh/m2 RH, WW, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 XI Sportbauten 40 kWh/m2 RH, (El. Lüft.)* keine empfohlen Beleuchtung nach SIA 380/4 WW: 20 % des Bedarfs mit erneuerbarer Energie XII Hallenbäder Kein Minergie-Grenz­ wert Qh ≤ 100 % Qh,li vorausgesetzt Beleuchtung nach SIA 380/4 WW: 20% des Bedarfs mit erneuerbarer Energie Optimierter Badeprozess Je nach Gebäudekategorie sind im Minergie-Grenzwert enthalten: RH = Raumheizung WW = Warmwasser El. Lüft. = Elektrizität für mechanische Lüftung (El. Lüft.) = Eine Lüftungsanlage ist für diese Gebäudekategorie nicht vorausgesetzt, sondern lediglich emp­ fohlen. Der Minergie-Grenzwert bleibt gleicht, ob mit oder ohne Lüftungsanlage. *Im Minergie-Grenzwert ist auch der Energieaufwand für eine allfällige Raumklimatisierung (Kühlung, Beund Entfeuchtung) enthalten. Tabelle 17: Einteilung der Ge­ bäudekategorie nach SIA 380/1 so­ wie Anforderungen nach Minergie-Stan­ dard für bestehen­de Bauten. Eine analoge Tabelle ist für Neubauten ver­ fügbar. 90 Energiekonzepte Energiekonzept: Vorgehen und Grundsätze 1 Zielsetzung formulieren 2 Bedarf ermitteln 3 Passive Elemente nutzen 4 Basisvariante als Vergleichsvariante 5 Niedriger Technisierungsgrad, einfache Gebäudetechnik 6 Abwärmenutzung 7 Konzept zielorientiert entwickeln Für das Entwickeln eines umfassenden Energiekonzepts wird ein Zusammenwir­ ken aller Beteiligten in mindestens sieben Schritten empfohlen: 1. Zielsetzung formulieren: Bevor mit der Entwicklung des Energiekonzepts be­ gonnen wird, muss festgelegt werden, welche Ziele mit dem Energiekonzept er­ reicht werden sollen. Bei der Erneuerung eines Gebäudes kennt die Bauherrschaft in der Regel die Eigenheiten ihres Gebäudes. Daher soll ihre Absicht und ihr Ziel bezüg­ lich Energie, Ökologie und Ökonomie defi­ niert werden. Daraus ist eine Zielsetzung zu formulieren und zu vereinbaren. Die Zielsetzung soll grundsätzlich lösungsneu­ tral sein und das zu erreichende Ziel ist möglichst genau und überprüfbar zu um­ schreiben. Weiter soll die Zielsetzung dem Planungsteam innerhalb der gesetzten Grenzen grösstmöglichen Handlungsspiel­ raum lassen und den Einbezug unkonven­ tioneller, innovativer Lösungen ermögli­ chen. 2. Bedarf ermitteln: Nebst der Zielformu­ lierung muss für ein Energiekonzept im Detail festgelegt werden, welchen Bedürf­ nissen das Gebäude bzw. einzelne Räume im Betrieb genügen müssen. Es sind die Raumtemperaturen im Winter und im Sommer, die Temperaturvariabilität, allfäl­ lige Anforderungen an Feuchtigkeit und Belüftung, der Umgang mit internen ther­ mischen Lasten, die Versorgung mit Spezi­ almedien, die erforderliche elektrische Ver­ sorgung, die Anforderungen an die Tages­ lichtnutzung und die künstliche Beleuch­ tung, etc., festzulegen. Je nach Gebäudekategorie wird schnell klar, dass nicht die Wärme im Winter das zentrale Problem darstellt, sondern die er­ forderliche Kühlung der Räume im Som­ mer. Die Erkenntnisse aus der Bedarfser­ mittlung haben einen entscheidenden Einfluss auf den ganzen Prozess der Ent­ wicklung des Energiekonzepts. 3. Passive Elemente nutzen: Der Einfluss der passiven Elemente auf die späteren Be­ triebseigenschaften eines Gebäudes kann in energetischer, ökologischer und ökono­ mischer Hinsicht erheblich sein. Die Nut­ zung aller passiven Möglichkeiten in und an einem Gebäude steht daher am Anfang aller Überlegungen. Sehr bald wird sich dabei vermutlich zeigen, dass die Vernet­ zung der passiven Einzelmassnahmen ein Zusammenwirken der verschiedenen Pla­ ner bedingt. Oft findet dabei für die Kon­ zept- und Projektentwicklung ein iterativer Prozess zwischen Gestaltung und Ausrich­ tung des Baukörpers, der Eigenschaften der Gebäudehülle, der Materialwahl und der Systemwahl in der Gebäudetechnik statt. Die energetisch, ökologisch und ökonomisch optimierte oder maximierte Nutzung der passiven Elemente ist in der Regel wenig spektakulär, weil damit die Gestaltung des Gebäudes und der Bau­ hülle gewissen Grundsätzen folgen muss und der Technisierungsgrad im Gebäude reduziert werden kann. Wichtig ist, dass auch dieser Prozess und dieses Ziel mit der Bauherrschaft vorab besprochen und prä­ zis geregelt wird. 4. Basisvariante als Vergleichsvariante: Das Planungsteam wird sich bei der Ent­ wicklung eines Energiekonzepts recht bald vor die Aufgabe gestellt sehen, Varianten­ entscheide zu empfehlen oder zu begrün­ den. Aufgabe ist dabei, den energetischen, ökologischen und ökonomischen Zielerrei­ chungsgrad aufzuzeigen und mit einer Ba­ sisvariante zu vergleichen. Sehr oft wird dabei gewünscht, diese Basisvariante im Sinne einer konventionellen Standardvari­ ante zu definieren. Bei einer Erneuerung 91 Gebäudeerneuerung wird z. B. oft ein 1:1-Ersatz oder eine her­ kömmliche Ölheizung als Basisvariante ge­ wählt. In jedem Fall ist es empfehlenswert, gleich zu Beginn der Planung die Basisvari­ ante grob zu definieren und die Eckpara­ meter mit dem Projektfortschritt nachzu­ führen. Die damit stets verfügbare Ver­ gleichsmöglichkeit erleichtert den laufen­ den Entscheidungsprozess. 5. Niedriger Technisierungsgrad, einfa­ che Gebäudetechnik: Ein hoher Techni­ sierungsgrad in einem Gebäude ist nicht zwingend ein Ausweis für ein gutes, opti­ miertes Energiekonzept. Gewiss gibt es Gebäude, die aufgrund der Anforderun­ gen der Benutzer einen hohen Technisie­ rungsgrad sowie komplexe, stark ver­ netzte Gebäudetechnik-Systeme erfor­ dern. Leider trifft man immer wieder Lö­ sungen an, die unnötigerweise viel Technik beinhalten. Beispielsweise durch eine we­ nig sinnvolle Kombination sich gegenseitig konkurrenzierender Systeme oder durch eine undurchsichtige Automatisierung mehrerer Anlagenfunktionen, die damit nicht mehr einzeln kontrollierbar sind. Ein gutes Konzept zeichnet sich auch dadurch aus, dass die definierten Ziele mit einem möglichst einfachen, gut verständlichen und damit auch bedienungsfreundlichen Technikkonzept erreicht und in Betrieb ge­ halten werden können. In einer umfassen­ den Bewertung der Lebenszykluskosten dürften einfache Konzepte mit wenig Technik in der Regel sehr gut abschneiden. 6. Abwärmenutzung: In jedem Gebäude entstehen überschüssige Abwärme, Feuchtigkeit und Kälte. Deren Nutzung ist eine einfache Möglichkeit, die Gesamtbi­ lanz des Gebäudes positiv zu beeinflussen. Allerdings sind ihr physikalische Grenzen gesetzt: Die anfallende Energiemenge und das Temperaturniveau sollen möglichst gleich oder grösser respektive höher sein, als am Wiederverwendungspunkt von der Anlage abgenommen werden kann. Ist z. B. das Temperaturniveau der Abwärme­ energie zu tief, muss es mit einer Wärme­ pumpe auf das höhere Temperaturniveau des Verbrauchers transformiert werden, was die Effizienz der Abwärmenutzung aus energetischer und ökonomischer Sicht reduziert. Es gilt also, die Rückgewinnung bzw. die Direktnutzung der anfallenden Abwärme, Kälte und Feuchtigkeit bedarfs­ gerecht zu optimieren. Ein Maximieren dieser Nutzung ist in der Regel wirtschaft­ lich nicht vertretbar. 7. Konzept zielorientiert entwickeln: Sind die ersten Ideen zum Energiekonzept im Planungsteam bzw. zwischen Archi­ tekt, Bauphysiker und Gebäudetechniker abgesprochen und liegen erste Entwürfe des architektonischen Konzepts vor, kön­ nen die ersten Parameter zur Auslegung der erforderlichen Gebäudetechnik ermit­ telt werden. Daraus lassen sich die ersten Überlegungen bezüglich der Erzeugung und Aufbereitung sowie der Verteilung und Abgabe der benötigten Medien im Gebäude ableiten. Sinnvoll ist es, in dieser Phase in Konzeptvarianten zu denken, wo­ bei die Basisvariante (siehe Schritt 4) nicht vergessen werden soll. Bereits in diesem frühen Planungsstadium ist es notwendig, die sich aus den Kon­ zeptgedanken für die verschiedenen Vari­ anten ergebende Gesamtbilanz des Ge­ bäudes bezüglich Energie Ökologie und Ökonomie soweit möglich zu ermitteln. Diese Daten sind mit der Zielsetzung (siehe Schritt 1) zu vergleichen. Varianten, wel­ che das vorgegebene Ziel nicht erfüllen, sollen überarbeitet oder ausgeschieden werden. Mit zunehmender Konkretisie­ rung des Projekts wird auch die Gesamtbi­ lanz des Gebäudes präziser. Massnahmen zur Verbesserung des Zielerreichungsgra­ des können zunehmend genauer definiert und evaluiert werden. Vergleichsparame­ ter, die sich zur Entscheidungsfindung eig­ nen: ]]Zielerreichungsgrad aus energetischer, ökologischer und ökonomischer Sicht ]]Spezifische Kennzahlen zum Vergleich mit der Basisvariante, mit anderen Objek­ ten sowie mit Standards respektive Erfah­ rungszahlen 92 Energiekonzepte Trends und Tools Kennzahlen Kennzahlen sind im Prinzip verdichtete In­ formationen über quantifizierbare betrieb­ liche Zustände. Sie stellen eine einfache Möglichkeit zur Vorgabe, Kontrolle oder zum Vergleich von Ergebnissen dar. Die für Energiekonzepte interessanten Kennzah­ len sind Verbrauchsdaten, Emissionswerte oder Kosten, bezogen auf eine Basisgrösse (also z. B. kWh/m2 a, CO2/MWh, Fr./to CO2, etc.). Die wohl bekanntesten Kennzahlen im Energiebereich sind die Grenz- und Ziel­ werte, die als Grundlage zur Beurteilung eines Gebäudes oder von Bauteilen (nach SIA 380/1 oder Minergie) im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung der Baubewilli­ gung oder zur Zertifizierung des MinergieLabels nachgewiesen werden müssen. Die Energiekennzahl quantifiziert die energeti­ sche Qualität eines Gebäudes und lässt Vergleiche mit anderen Gebäuden gleicher Kategorie zu. Hier wird die gesamte, dem Gebäude während einem Jahr zugeführte Primärenergie, bezogen auf seine Energie­ bezugsfläche (nach SIA 416/1), ausgewie­ sen. In einem Variantenvergleich wird viel­ fach die Gesamtbilanz der zugeführten Primär- oder Endenergie, der CO2-Emis­ sion und der Jahresbetriebskosten oder der Lebenszykluskosten errechnet und ver­ glichen. Wird eine Basisvariante als Refe­ renz einbezogen, lässt sich der ökonomi­ sche Nutzen der Mehraufwendungen ei­ ner Variante in aussagekräftiger Art wie z. B. in Fr./MWh oder Fr./to CO2-Einspa­ rung pro Jahr oder über eine Zeitdauer von z. B. 25 Jahren darstellen. Softwaretools, Berechnungshilfen ]]www.bfe.admin.ch/energie: Bundes­ amt für Energie, Energie Schweiz ]]www.minergie.ch: Verein Minergie ]]www.endk.ch Fachleute Hilfs­ mittel: Konferenz Kantonaler Energiedi­ rektoren ]]www.novatlantis.ch: Nachhaltiges Bauen im ETH-Bereich ]]www.380-4.ch: SIA-Empfehlung SIA 380/4 Normen, Standards Normen und Standards sind wichtige Ar­ beitsmittel zur Entwicklung eines bau- und haustechnischen Konzepts. Es gibt heute eine ganze Reihe von Normen und Stan­ dards, die allgemeine Gültigkeit haben und teilweise Eingang in Gesetze und Ver­ ordnungen gefunden haben. ]]www.webnorm.ch: Plattform des SIA für das ganze SIA-Normenwerk, die SIADokumentationen sowie europäische Nor­ men. Einfache Suchfunktionen über Stich­ worte dienen der Selektion. ]]www.minergie.ch: Verein Minergie mit den Anforderungen zu den Standards, mit Anwendungshilfen und Nachweisformula­ ren. ]]www.endk.ch: Konferenz Kantonaler Energiedirektoren mit Unterlagen zum Energienachweis, mit Vollzugshilfen, mit Mustervorschriften der Kantone (MuKEn) und weiteren Hilfsmitteln. ]]www.kbob.ch: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öf­ fentlichen Bauherren, KBOB, mit Empfeh­ lungen für die Gebäudetechnik im Allge­ meinen sowie speziell für nachhaltiges Bauen. Kapitel 12 Gebäudetechnik Jean-Marc Chuard Eigenschaften und Eignung der Systeme Energieträger Von Interesse im Baubereich ist die Frage, welche Energieträger am Standort verfüg­ bar sind und welche dieser Energieträger zur Erreichung der energetischen, ökologi­ schen und ökonomischen Zielsetzung ein­ gesetzt werden können. Die Verfügbarkeit vor Ort ist frühzeitig und im umfassenden Sinne zu prüfen: Es ist nicht nur eine Frage, ob ein bestimmter Energieträger am Stand­ ort vorhanden ist oder zugeführt werden kann, sondern auch, ob dieser Energieträ­ ger aus bestimmten Gründen am Standort nicht eingesetzt werden darf oder kann (z. B. ist eine Grundwassernutzung zu Heizoder Kühlzwecken in Grundwasserschutz­ zonen nicht erlaubt). Die für übliche Bau­ ten verfügbaren Energieträger unterschei­ den sich durch ihren Primärenergieanteil, ihre Belastung der Umwelt bei der Verbren­ nung (d. h. bei der chemischen Umwand­ lung) insbesondere mit Schadstoffen und Treibhausgasen. Zudem weisen die Brenn­ stoffe die Eigenschaft auf, dass sie nicht, wie die anderen Energieträger, leitungsge­ bunden sind, sondern Lagerraum vor Ort benötigen (Ausnahme: Erdgas). Die Di­ mension dieses Lagers ergibt sich aus dem spezifischen Energieinhalt und dem Ver­ Tabelle 18: Häufige Heizsys­ teme von Wohn­ bauten Bestehende Heizung Einzelofen-Heizung (Gas, Öl, Holz) Ölheizkessel Gasheizkessel Elektroheizung Auswahl, Dimensionierung, Installation + Betriebsoptimierung der neuen Wärmeerzeugung gemäss den Dimensionierungsrichtlinien «Leistungsgarantie» des Bundesamts für Energie (www.leistungsgarantie.ch) Modulierender + kondensierender Heizkessel Heizöl Erdgas ]]Heizöl ist kein nachhaltiger Wärme­ träger. ]]Keine Reserven bei der Berechnung der Leistung vorsehen. ]]Sonnenkollektoren zur Wassererwär­ mung einsetzen. ]]Um die Kondensationswärme des Heizkessels voll zu nutzen, empfiehlt es sich, die erzeugte Wärme in den Rücklauf der Heizung einzuspeisen (so­ genannte «Rücklaufhochhaltung»). ]]In der Regel keine oder nur geringe Anpassungen in der Heizverteilung notwendig. ]]Grossflächige, gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlage planen. Wärmepumpe Erdsonde Pelletskessel Aussenluft ]]Wegen der hohen Heiztemperatur (Vorlauftemperatur) bei ungedämmten oder gering gedämmten Bauten wei­ sen Wärmepumpen schlechte Nut­ zungsgrade aus. ]]Für erneuerte Bauten den Einsatz von zweistufigen Wärmepumpen («Sa­ nierungspumpen») vorsehen. ]]Erdsonden eignen sich als Wärme­ quelle besser als Aussenluft. ]]Elektroheizregister sind für den regu­ lären Betrieb von neuen und sanierten Wohnbauten nicht mehr zulässig. ]]Grossflächige, gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlage planen. ]]Trockenes Brennstofflager (Silo) Be­ dingung ]]In der Regel keine oder nur geringe Anpassungen in der Heizverteilung notwendig. ]]Möglichkeit der Anlieferung von Pel­ lets prüfen. ]]Sofern eine Sonnenkollektoranlage für die Wassererwärmung installiert wird, lässt sich der Pelletskessel in den Sommermonaten ausschalten. ]]Grossflächige, gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlage planen. Falls Wärmedämmmassnahmen realisiert werden, können die bestehenden Radiatoren mit tieferer Heiztemperatur betrieben werden (z. B. statt 70 °C lediglich 50 °C). 94 Gebäudetechnik Ökobilanzdaten im Baubereich, KBOB/eco-bau/IPB 2009/1, Stand Januar 2011 Energie Bezug UBP Primärenergie TreibhausgasGrösse Einheit gesamt nicht erneuerbar emissionen – MJ MJ kg Brennstoffe1 Heizöl EL Endenergie MJ 44,4 1,24 1,23 0,0827 Erdgas Endenergie MJ 31,5 1,12 1,11 0,0658 Stückholz Endenergie MJ 27,6 1,06 0,0523 0,00354 Holzschnitzel Endenergie MJ 27,1 1,14 0,0636 0,00308 Pellets Endenergie MJ 27,8 1,22 0,210 0,0102 Biogas Endenergie MJ 33,2 0,403 0,369 0,0455 Fernwärme Heizzentrale Öl Endenergie MJ 66,0 1,69 1,68 0,112 Heizzentrale Gas Endenergie MJ 42,9 1,56 1,55 0,0869 Heizzentrale Holz Endenergie MJ 29,7 1,66 0,102 0,0132 Heizzentrale EWP Abwasser (JAZ 3,4) Endenergie MJ 46,2 1,91 0,885 0,0206 Heizzentrale EWP Grundwasser (JAZ 3,4) Endenergie MJ 40,7 1,04 0,897 0,0153 Heizzentrale EWP Erdsonde (JAZ 3,9) Endenergie MJ 51,9 2,01 1,00 0,0225 Kehrichtverbrennung Endenergie MJ 2,35 0,0582 0,0506 0,000957 Blockheizkraftwerk Biogas Endenergie MJ 19,0 0,252 0,228 0,0252 Fernwärme mit Nutzung Kehrichtwärme Endenergie MJ 24,2 0,814 0,804 0,0454 Nutzwärme 47,5 1,31 1,30 0,0886 Heizkessel Heizöl EL Nutzwärme2 MJ 34,8 1,22 1,22 0,0719 Heizkessel Erdgas Nutzwärme2 MJ 44,8 1,69 0,0928 0,00617 Heizkessel Stückholz Nutzwärme2 MJ 2 MJ 38,1 1,56 0,0984 0,00565 Heizkessel Holzschnitzel Nutzwärme 36,6 1,57 0,277 0,0140 Heizkessel Pellets Nutzwärme2 MJ 37,5 0,452 0,414 0,0508 Heizkessel Biogas Nutzwärme2 MJ Nutzwärme am Standort erzeugt, inkl. erneuerbare Energien3 Elektrowärmepumpe Luft / Wasser (JAZ 2,8) Nutzwärme2 MJ 49,9 1,74 0,950 0,0227 2 MJ 36,6 1,55 0,695 0,0164 Elektrowärmepumpe Erdsonden (JAZ 3,9) Nutzwärme 41,3 1,62 0,795 0,0179 Elektrowärmepumpe Grundwasser (JAZ 3,4) Nutzwärme2 MJ 28,7 1,62 0,295 0,0120 Flachkollektor Warmwasser EFH Nutzwärme2 MJ 25,1 1,85 0,241 0,0112 Flachkollektor Raumheizung + Warmwasser EFH Nutzwärme2 MJ Elektrizität vom Netz Atomkraftwerk Endenergie MJ 153 4,07 4,07 0,00451 Erdgaskombikraftwerk GuD Endenergie MJ 73,8 2,34 2,33 0,135 Kehrichtverbrennung Endenergie MJ 13,8 0,0230 0,0195 0,00211 Blockheizkraftwerk Gas Endenergie MJ 111 3,29 3,28 0,205 Blockheizkraftwerk Biogas Endenergie MJ 105 1,08 0,983 0,135 Photovoltaik Endenergie MJ 50,7 1,66 0,393 0,0257 Windkraft Endenergie MJ 24,4 1,32 0,101 0,00755 Wasserkraft Endenergie MJ 17,2 1,22 0,0348 0,00351 Pumpspeicherung Endenergie MJ 177 4,41 3,81 0,0611 CH-Produktionsmix Endenergie MJ 75,7 2,41 1,76 0,00830 CH-Verbrauchermix Endenergie MJ 125 3,05 2,63 0,0413 UCTE-Mix Endenergie MJ 177 3,54 3,32 0,165 Elektrizität am Standort erzeugt, inkl. erneuerbare Energien3 Photovoltaik Endenergie MJ 32,9 1,46 0,334 0,0211 Windkraft Endenergie MJ 9,43 1,16 0,0730 0,00485 Biogas Endenergie MJ 81,0 0,937 0,857 0,118 1 2 3 oberer Heizwert, inkl. Verteilverluste (Wärme am Ausgang Wärmeerzeuger), regionale Sicht 2000-Watt-Gesellschaft 95 Gebäudeerneuerung brauchsprofil, welches das Gebäude nach der Erneuerung aufweist. KBOB veröffentlicht auf ihrer Plattform Ökobilanzdaten im Baubereich. Die Detail­ liste (Excel) enthält die relevanten Eckda­ ten für jeden Energieträger (Tabelle 19). Die aufgeführte Gesamtbewertung in Um­ welt-Belastungs-Punkten (UBP) quantifi­ ziert die Umweltbelastung durch die Nut­ zung von Energieressourcen. Mit den UBPFaktoren lassen sich aufgrund des effekti­ ven oder prognostizierten Energiever­ brauchs eines Gebäudes schnell und ein­ fach globale Vergleichszahlen zur Beurtei­ lung der ökologischen Gesamtbilanz, z. B. von Wärmeerzeugervarianten, ermitteln. Die aufgeführte Teilbewertung der Treibh­ ausgasemissionen quantifizieren die ku­ mulierten Wirkungen verschiedener Treib­ hausgase, bezogen auf die Leitsubstanz CO2 (daher spricht man von der CO2-Ge­ samtbilanz eines Gebäudes oder eines Areals). Die Treibhausgasemissionen sind ein Kennwert für die Klimaerwärmung. Tabelle 19: UBP-Faktoren sowie Faktoren für die Treibhausgasemissi­ onen im Bereich Energiesysteme. Erzeugersysteme mit fossilen Energieträgern Fossile Energieträger haben aus ökologi­ scher Sicht den Nachteil, dass sie die CO2Gesamtbilanz des Gebäudes stark belas­ ten. Bei Zielsetzungen zu einer grossen Reduktion der CO2-Emissionen scheiden daher die meisten Varianten mit fossilen Energieträgern frühzeitig aus. Dafür ha­ ben diese Varianten den Vorteil, dass eine bewährte, kostengünstige, gut etablierte und leicht zu beherrschende Technik zur Anwendung kommt. Zudem funktioniert aus Sicht des Betreibers die Versorgung mit fossilen Brennstoffen problemlos. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aller­ dings, dass die Versorgungskette dieser Energieträger empfindlich gestört werden kann. Zudem sind die Preise dieser Ener­ gieträger weltweit starken Schwankungen unterworfen. Erzeugersysteme mit fossilen Energieträgern eignen sich daher eher für Konzepte, in welchen: ]]der ökonomische Aspekt im Vorder­ grund steht und den ökologischen Krite­ rien bewusst keine grosse Bedeutung zu­ geschrieben wird. ]]erneuerbare Energieträger am Standort nicht oder in nicht ausreichender Menge verfügbar sind. In letzterem Fall ist eine Kombination fossiler Energieträger mit er­ neuerbarer Energie anzustreben. ]]Randbedingungen bestehen, die die Nutzung vorhandener, erneuerbarer Ener­ gieträger verunmöglichen oder nur teil­ weise zulassen. In letzterem Fall ist eine Kombination fossiler Energieträger mit er­ neuerbarer Energie anzustreben. ]]eine Basisvariante als Vergleichsvariante zur Entscheidungsfindung in der Entwick­ lung eines Energiekonzepts benötigt wird. Erprobte Erzeugersysteme Erprobte Erzeugersysteme mit erneuerba­ ren Energieträgern können drei Gruppen zugeordnet werden: ]]Brennstoffe, welche aus erneuerbaren Energien hergestellt wurden bzw. einen definierten Anteil an erneuerbaren Ener­ gien enthalten ]]Fernwärme ]]Nutzwärme, am Gebäudestandort aus erneuerbaren Quellen erzeugt ]]Elektrizität vom Netz, welche aus erneu­ erbaren Energien hergestellt wurde bzw. einen definierten Anteil an erneuerbaren Energien enthalten ]]Elektrizität, am Gebäudestandort aus er­ neuerbaren Quellen erzeugt Brennstoffe, welche aus erneuerbaren Energien hergestellt wurden bzw. einen definierten Anteil an erneuerbaren Ener­ gien enthalten, sind bekannt unter der Be­ zeichnung Bio-Diesel, Bio-Gas und Holz. Bio-Diesel ist ein Brennstoff auf pflanzli­ cher Basis. Er wird mehrheitlich als Treib­ stoff für Fahrzeuge eingesetzt. In einigen Grossanlagen wird Bio-Diesel zur Erzeu­ gung von Wärme eingesetzt. Eine Nut­ zung von Bio-Diesel in grossem Massstab ist heute umstritten, da damit auch wert­ volle Anbauflächen belegt werden, was zu einer unerwünschten Verteuerung bzw. Verknappung von Agrarprodukten führt. Konzepte mit Bio-Diesel dürften daher eher eine seltene Ausnahme bilden. Biogas: Hingegen ist die Nutzung von Bio­ gas eine Möglichkeit mit einigem Poten­ zial. Die Erzeugung von Biogas ist heute 96 Gebäudetechnik Abbildung 84: Linke Seite: Wärme­ leistung Q, elektri­ sche Leistungsauf­ nahme P und Leis­ tungszahl COP einer Sole-Wasser-Wär­ mepumpe in Ab­ hängigkeit der Sole­ temperatur bei 35 °C bzw. 50 °C Vorlauf. Rechte Seite: Die­ selbe Darstellung bei einer Soletem­ peratur von 0 °C bzw. 10 °C. Die Jah­ resarbeitszahl JAZ ist ähnlich definiert wie die Leistungs­ zahl mit dem Unter­ schied, dass mit Energien gerechnet wird. Die JAZ ist das Verhältnis der übers Jahr abgegebenen Wärmemenge zur aufgenommenen Energie für den Be­ trieb der Wärme­ pumpe und der zu­ gehörigen Hilfsan­ triebe. möglich und erprobt, wird aber nicht in grossen Mengen angeboten. Meist wer­ den Genossenschaften oder ähnliche Or­ ganisationen gegründet, welche ein regio­ nales Potenzial in einer zu erstellenden Biogas-Anlage nutzen wollen. Solches Gas wird dann teilweise direkt genutzt oder ins Erdgasnetz eingespiesen. Holz ist ein weit verbreiteter erneuerbarer Brennstoff, der heute in der Regel in Form von Grünschnitzeln oder Pellets genutzt wird. Da er meist aus lokaler Produktion stammt, fällt seine CO2-Gesamtbilanz sehr positiv aus. Allerdings gelten heute für Neuanlagen über 70 kW Leistung Fein­ staubgrenzwerte von 150 mg/Nm3 (Anla­ gen über 1MW: 20 mg/Nm3). Ab dem 1. Januar 2012 sind diese Werte selektiv ver­ schärft: 70 kW bis 500 kW höchstens 50 mg/Nm3, 500 kW bis 1000 kW höchstens 20 mg/Nm3. Diese Vorgaben der Luftrein­ halteverordnung bedingen vielfach den Einbau von entsprechenden Filtersystemen in die Rauchgasableitung. Bestehende An­ lagen müssen innerhalb von 10 Jahren so nachgerüstet werden, damit auch sie diese Grenzwerte einhalten. Weiter gilt zu be­ achten, dass der Energieinhalt und die Feuchtigkeit von Holzschnitzeln und Pel­ lets normiert und in verschiedenen Quali­ tätsklassen angeboten werden. Eine auto­ matische Holzfeuerung bedingt immer den Einbau eines Silos, in welchem der Brennstoff gelagert und dem Holzkessel zugeführt wird. Die gewünschte Autono­ Wärmeleistung (Q), el. Leistungsaufnahme (P) und COP in Abhängigkeit der Soletemperatur 20 Q W35 Q W50 18 mie bestimmt das erforderliche Speicher­ volumen, welches im Vergleich zu Heizöl deutlich grösser ausfällt. Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Asche aus einer Holzfeuerung fachgerecht entsorgt wer­ den muss. Bei grösseren Anlagen ist somit dem Aschen-Handling ebenfalls Beach­ tung zu schenken. Fernwärme ist in ihrer Qualität durch ihre Quellen sowie durch die Temperatur be­ stimmt. In vielen Städten steht Fernwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen zur Ver­ fügung. Andere Fernheizungsnetze wer­ den aus Holz, mit Abwärme, mit Wärme aus Wärmepumpen oder aus fossilen Heiz­ kesseln alimentiert. Darunter hat es Fern­ wärmenetze, die Wärme aus Wärmekraft­ kopplungsanlagen verteilen. Häufig han­ delt es sich um einen Mix von Wärmeener­ gie. In jedem Fall sollte somit geklärt wer­ den, welche Qualität der Fernwärmeliefe­ rant in seinem Angebot sicherstellt. Kon­ zepte, in welchen Fernwärme eingesetzt wird, weisen in der Regel einen niedrigen Technisierungsgrad in der Heizzentrale am Gebäudestandort auf. Da eine Vielzahl von Gebäuden mit dem Fernwärmenetz versorgt wird, ist in der Regel eine gute Versorgungssicherheit sichergestellt. Fern­ wärme eignet sich daher als mögliche Va­ riante in einem Anlagenkonzept. Mit Sonnenkollektoren oder Wärme­ pumpen – oder mit Kombination dieser Systeme – lässt sich Nutzwärme aus erneu­ erbaren Quellen erzeugen. Wärmepum­ Wärmeleistung (Q), el. Leistungsaufnahme (P) und COP in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur 18 16 Q B0 16 14 14 12 12 10 10 8 8 P W35 6 P W50 COP W35 COP W50 4 2 0 -5 0 5 Sole in °C 10 15 Q B10 6 4 P B0 P B10 COP B0 COP B10 2 0 35 40 55 45 50 Vorlauftemperatur in °C 60 97 Gebäudeerneuerung pen werden mit Strom und – seltener – mit Gas angetrieben. Ihre Effizienz ist abhän­ gig von der Güte des Aggregates und von der Eignung der Wärmequelle (Abwärme, Solarwärme, Erdwärme, Aussenluft, Grundwasser). Zur Beurteilung einer Wär­ mepumpe ist die Jahresarbeitszahl (JAZ) besser geeignet als der Wirkungsgrad in einem Betriebspunkt (im Fachjargon auch als COP, Coefficient of performance, be­ zeichnet). Naturgemäss ergeben Wärme­ quellen mit hohen Temperaturen sehr viel höhere Wärmeerträge respektive ist für eine definierte Wärmeproduktion weniger Elektrizität notwendig. Viele Wärmequel­ len sind grossen jahreszeitlichen Schwan­ kungen unterworfen, beispielsweise Au­ ssenluft. Die JAZ gibt das Verhältnis an von elektrischer Energie für den Antrieb zur Wärmeproduktion der Wärmepumpe. Ty­ pische Jahresarbeitszahlen von Wärme­ pumpen liegen zwischen 3,0 und 4,5. Die von den Herstellern publizierten COPWerte werden unter Laborbedingungen erhoben und sagen wenig aus über die ef­ fektive Effizienz im Betrieb. In der JAZ sind auch der Elektrizitätsverbrauch der Hilfs­ aggregate enthalten, also der Pumpen und Ventilatoren, soweit notwendig. Eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,0 erzeugt – bezogen auf die Aufnahme elektrischer Energie – die drei­ fache Wärmeenergie. Bei der Stromerzeu­ gung und Stromübertragung beträgt der Gesamtwirkungsgrad etwa 30 %. Das 23 h 21 h 22 h 20 h 17 h 18 h 19 h 16 h 15 h 14 h 13 h 12 h 11 h 10 h 09 h 08 h 05 h 06 h 07 h 04 h 03 h 02 h 00 h 85 ° Höhe 01 h Höhe liegt einerseits am Wirkungsgrad des Kraftwerks und andererseits an den Lei­ tungsverlusten auf dem Weg zum Endver­ braucher. Bei einem Wirkungsgrad von 30 % benötigt man 3,3 Teile Primärenergie um 1,0 Teil Strom zu erzeugen. Wärme­ pumpen mit JAZ kleiner 3,3 verbrauchen in einer Gesamtbetrachtung mehr Energie als eine direkte Beheizung über einen Heizkessel. Die Rechnung präsentiert sich anders, wenn Strom aus erneuerbaren Quellen zum Einsatz kommt. Für den Einsatz von Solarkollektoren soll vorab die Eignung der verfügbaren Fläche geprüft werden, auf welcher die Kollekto­ ren installiert werden, insbesondere hin­ sichtlich: ]]Ausrichtung der Kollektorfläche (ca. Süd-Ost bis Süd-West) ]]Neigung der Kollektorfläche (ca. 25° bis 40°) ]]Beschattungsdiagramm (freier Horizont) am Aufstellungsort (Tagesgang der Sonne im Sommer, in der Überganszeit und im Winter) ]]Eigenbeschattung im Kollektorfeld durch die Kollektorflächen (Aufstellungsdichte und Neigung) im Jahresgang Eignen sich die Flächen, ist als nächstes die Dimensionierung der Anlage abzuklären. Wichtig ist auch hier, auf welchem Tempe­ raturniveau die Wärmeproduktion im Kol­ lektorfeld stattfinden soll. Dies wird durch das Wärmeerzeugersystem bestimmt, in welches die Kollektoranlage eingebunden Abbildung 85: Aufnahme des Son­ nenganges bzw. der Beschattung am Standort der Solar­ anlage mit Darstel­ lung des resultie­ renden Tagesgan­ ges im September (links) sowie des Jahresverlaufs des Sonnenganges (rechts). jeweils am 21. Tag im Monat 85 ° 75 ° 75 ° 65 ° 65 ° 55 ° 55 ° 45 ° 45 ° 35 ° 35 ° 25 ° 25 ° 15 ° 15 ° Juni Juli / Mai August / April September / März Oktober / Februar 5° -5 ° 0 ° November / Januar Dezember 5° 45 ° 90 ° E 135 ° 180 ° S Azimut 225 ° 270 ° W 315 ° 360 ° -5 ° 0 ° 45 ° 90 ° E 135 ° 180 ° S 225 ° Azimut 270 ° W 315 ° 360 ° 98 Gebäudetechnik Abbildung 86: Übliche Lösungen für die Produktion und die Einspeisung des solar erzeugten Stromes.(Quelle: Swissolar) wird. Je höher die mittlere Betriebstempe­ ratur der Kollektoren ist (Mittelwert zwi­ schen Vor- und Rücklauftemperatur am Kollektor), desto tiefer ist der Kollektorwir­ kungsgrad. Für Temperaturen über ca. 50° bis 60°C werden in der Regel Vakuumröh­ ren Kollektoren eingesetzt, darunter sind Flachkollektoren üblich. Kollektoren wer­ den in der Regel als Ergänzung einer kon­ ventionellen Wärmeproduktion bzw. aus­ schliesslich zur Erwärmung des Warmwas­ sers eingesetzt. Sonnenkollektoren produ­ zieren im Sommer die grösste Menge an Wärmeenergie, während im tiefen Winter naturgemäss nur wenig Wärmeenergie anfällt. Es gilt somit aus ökonomischer Sicht das Kollektorfeld so auszulegen, dass im Sommer nicht zuviel Überschusswärme produziert wird. Ein solarer Deckungsgrad von ca. 40% bis 50% (Anteil am Jahres­ energiebedarf z. B. für die Wassererwär­ mung) hat sich in der Praxis als ausgewo­ gener Richtwert für die ersten Planungs­ schritte in einem Energiekonzept erwie­ sen. Elektrizität aus erneuerbaren Quellen wird von den meisten Elektrizitätswerken angeboten. Beliebt sind auch Mischfor­ men, bei denen nur ein Teil erneuerbar ist. Das Angebot ist sehr vielfältig und erlaubt, differenziert Strom aus gewissen Produkti­ onstechniken aus- oder einzuschliessen. Es sind heute Angebote für bestimmte zerti­ fizierte Öko-Stromarten auf dem Markt (z. B. Nature Made Star). Heute kann somit ein Gebäude ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energien, wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft betrieben werden. Der Entscheid zum Einsatz solcher Strom­ arten sollte ausschliesslich dem Betreiber eines Gebäudes überlassen werden. Zwar beeinflusst er mit seinem Entscheid die CO2-Gesamtbilanz des Gebäudes in er­ heblichem Masse, doch wird auch die öko­ nomische Seite des Betriebs massgebend belastet. Wenn bei Projektbeginn mit der Bauherrschaft eine Vereinbarung getrof­ fen wird, welche energetischen und öko­ logischen Ziele mit dem Erneuerungspro­ jekt erreicht werden sollen, so ist der Zu­ . Solarstrom wird ausschliesslich ins. Netz eingespiesen 1 Wechselrichter DC/AC 2 Einspeisungs-Stromzähler odule Solarm Solarmodule 3 Verbrauchszähler Solarstrom für den Eigengebrauch, sen. gespie Überschuss wird ins Netz eingespiesen etz ein N s in rd 1 Wechselrichter DC/AC 2 Stromzähler 3 Überschuss r Solarmodule odule Solarm 1 1 3 1 3 630 630 2 2 2 18 2 18 3 3 1 4 122 4 12 2 99 Gebäudeerneuerung kauf von Öko-Strom ausschliesslich ein Beitrag der Bauherrschaft. Die Planenden müssen das Gebäude und einzelne Sys­ teme optimieren, um die Zielvereinbarung zu erfüllen. Mit anderen Worten: ÖkoStrom (wie auch Biogas) sind wichtige ökologische Beiträge, welche die CO2-Ge­ samtbilanz eines Gebäudes stark beein­ flussen, es sind aber keine Massnahmen zur Reduktion des Nutzenergiebedarfs oder zur Erhöhung der Energieeffizienz der Systeme. Für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) muss zuerst die Eignung der verfügbaren Aufstellungsfläche geprüft werden, ana­ log der Solarkollektoren. Zu beachten ist, dass, im Gegensatz zu den thermischen Kollektoren, eine kleine Beschattung ein­ zelner PV-Zellen die ganze in Serie geschal­ tete Kette der einzelnen PV-Zellen unter­ bricht, was den solaren Ertrag der Anlage entsprechend reduziert. Steht die Eignung der Aufstellungsfläche fest, ist die Ausle­ gung der PV-Anlage primär eine Frage des ökologischen Beitrags im Rahmen ökono­ Versorgung mischer Grenzen. Hier ist zu beachten, dass das Erstellen und Betreiben von PVAnlagen einerseits durch Förderbeiträge und andererseits durch interessante Rück­ speisetarife durch Elektrizitätswerke geför­ dert wird. Da PV-Zellen nur eine kleine Gleichspannung produzieren, muss die gewonnene elektrische Energie in netz­ konforme Wechselspannung umgewan­ delt werden. Diese Umformer werden meist in der Nähe der PV-Felder installiert. Da das Umformen immer mit Verlusten verbunden ist, muss immer der Gesamt­ wirkungsgrad einer PV-Anlage, d. h. im­ mer inklusive der zugehörigen Umformer, als Mass für eine Bewertung gelten. Blockheizkraftwerke (BHKW) bestehen in der Regel aus einem (Bio-) Gas-Motor, welcher einen Generator zur Erzeugung elektrischer Energie antreibt. Die Abwärme des Motors bzw. der Abgase wird zurück­ gewonnen und steht zur Nutzung in Wär­ meverteilsystemen zur Verfügung. Es hat sich gezeigt, dass BHKW so auszulegen sind, dass der produzierte Strom und die Technik Gebäude Abbildung 87: Beispiel einer global und lösungsneutral definierten Zielset­ zung als Vorgabe für ein Planungsteam, welches die Wärme- und Kälte­ versorgung eines Areals erneuern soll. Benutzer Primärenergie Endenergie Nutzenergie Ziele 70% CO2 bis 2030 (Basis 1990) Erneuerbare Energie für Strom und Spitze Wärme Absenkpfad 2010 bis 2030 Ersatz Heizzentrale und Kältezentrale bis 2012 Optimierung Betrieb und Netze Arealversorgung Externe Energiebereitstellung möglich (PV, Kompogas, Altholz, etc.) Abwärmenutzung Prozessenergie Rahmenbedingungen Anregung Fortlaufende bauliche Massnahmen Beispiel einer lösungsneutralen Zielsetzung für die Erneuerung einer Areal-Energieversorgung Studie Potenzial Stromsparen Energielenkungsmassnahmen Transparenz Verbrauch 100 Gebäudetechnik Abbildung 88: Prinzipielle Darstel­ lung der Wärmege­ winnungssysteme mit Erdwärme. Die Lösungen mit Syste­ men der tiefen Aquifere und sehr tiefer Geothermie sind eher für Anla­ genleistungen über 10 MW Leistung ge­ eignet. Abwärme möglichst vollständig während mindestens 4000 Jahresbetriebsstunden genutzt werden kann. BHKW werden da­ her in der Regel eher zur Deckung einer Bandlast, d. h. nicht zur Deckung des Ge­ samtbedarfs eines grösseren Gebäudes, eingesetzt. Mit diesen Randbedingungen kann die Gesamtbilanz eines Gebäudes mit einem BHKW positiv beeinflusst wer­ den. Mit Brennstoffzellen wird Wasserstoff in Strom, Wärme, Sauerstoff und Wasser umgewandelt, ohne dass Stickoxyde ent­ stehen. Die Anwendung dieser Technolo­ gie im haustechnischen Umfeld ist bislang noch nicht über Kleinserien hinausgekom­ men. Ziel ist, eine langlebige Brennstoff­ zelle herzustellen, in welcher Erd- oder Biogas als Energieträger eingesetzt wer­ den können. Erste Projekte mit einem Seri­ enprodukt mit grösserer Leistung (250 kWel) sind in der Schweiz in Planung (z. B. Klärgasverbrennung in der Kläranlage Dübendorf mit MTU CFC Hotmodul). Grundwasserwärmenutzung Lockergestein über Sedimentschichten Kristallines Grundgebirge Erdwärmesonde Wärme aus tiefem Grundwasser Wärme und Strom aus sehr tiefer Geothermie 101 Gebäudeerneuerung Systemwahl: Vorgehen Zielorientierte Systemwahl und Systemgestaltung: Die Systematik zu einer zielorientierten Systemwahl und System­ gestaltung geht von einer möglichst ge­ samtheitlichen Betrachtung der Zusam­ menhänge aus. Das Vorgehen in neun Punkten. Vorgehen 1 Randbedingungen 2 Spielraus aus Sicht Zielvorgaben 3 Wirkung der Systemvarianten am Ziel 4 Kennzahlen als Entscheidungshilfe 5 Das System Gebäude – die Unbekannte 6 Der vergessene Aufwand – Einregulierung, Abstimmung, Optimierung 7 Anlagenverhalten aufzeichnen 8 Sommer und Winter – zwei getrennte Phasen 9 Regelmässiger Vergleich Soll-Ist 1. Randbedingungen Es gibt für jedes Gebäude eine Vielzahl von Randbedingungen und Sachzwängen, die den Freiheitsgrad in der Systemwahl einschränken wie z. B.: ]]Behördliche Auflagen, Baureglemente, etc. ]]Nicht verfügbare Infrastruktur wie Fern­ heiz- oder Gasnetz ]]Kein Grundwasser vorhanden oder nicht nutzbar (Schutzzonen) ]]Einspracherisiken im Umfeld Es gilt somit möglichst realistisch einzu­ schätzen, was am Standort des Gebäudes in der Systemwahl ausgeschlossen werden muss. Weiter sollte überlegt werden, bei welchen Systemvarianten Projektrisiken entstehen könnten, in denen aufgrund von Eventual-Randbedingungen eine Vari­ ante nicht oder nicht in der gewünschten Form realisiert werden kann. 2. Spielraum aus Sicht Zielvorgaben Ein präzis formuliertes Ziel wird in der Re­ gel dem Planungsteam auch in der Sys­ temwahl einen möglichst grossen Spiel­ raum offen lassen. Allerdings wird die der Zielvorgabe zugrundeliegende Strategie für die Systemwahl eine klare Richtung weisen. Wird zum Beispiel ein CO2-Grenz­ wert vorgegeben, so muss in der System­ wahl geprüft werden, mit welchen Sys­ temvarianten dieser Grenzwert eingehal­ ten werden kann. 3. Wirkung der Systemvarianten am Ziel Sind die in Frage kommenden Systemvari­ anten definiert, so empfiehlt es sich, eine Berechnungstabelle aufzustellen, mit wel­ cher die Gesamtbilanz des Gebäudes, d. h. unter Einbezug aller Systeme, berechnet werden kann. Die Parameter der Varianten sollen dabei als Variable einzeln eingege­ ben werden können. Damit lässt sich be­ reits bei der Systemwahl abschätzen, wie sich die Systemvarianten im Gesamtsystem des Gebäudes auswirken und welche Ge­ samtbilanz daraus resultiert. 4. Kennzahlen als Entscheidungshilfe Zur Auswahl einer Systemvariante sind Kennzahlen eine besondere Hilfe. Sie be­ ziehen sich entweder auf eine Gesamtbi­ lanz oder auf einzelne Kriterien. Üblich sind Kennzahlen wie Energiekennzahl (MJ/ m2 a), CO2-Gesamtbilanz (Tonne CO2/a), Jahresbetriebskosten (Fr./m2 a EBF), Kosten pro Tonne eingespartem CO2 über die Le­ bensdauer oder einer definierten Betrach­ tungsperiode z. B. gemäss Zielsetzung für das Projekt (Fr./t CO2). 5. Das System Gebäude – die Unbekannte Auch bei einer detailliert erstellten und nachgeführten Gesamtbilanz eines Ge­ bäudes wird sich nach Betriebsaufnahme zeigen, dass die ersten Erfahrungswerte deutlich von den Planungswerten abwei­ chen können. Diesen Abweichungen ist im Rahmen der Projektfertigstellung nachzu­ gehen, um deren Ursachen zu finden. Da­ her müssen in der Anfangsphase die Sys­ teme überwacht und den Beobachtungen entsprechend optimiert werden. Bald wird sich zeigen, dass das Gebäude spezifische Eigenheiten aufweist, welche sich in seiner Energiesignatur niederschlagen. Es wird 102 Gebäudetechnik aber auch klar, dass der Benutzer des Ge­ bäudes einen wesentlichen Einfluss auf den Betrieb der Anlagen und letztendlich auf den Energieverbrauch hat. Wesentlich ist, durch Feinregulierung und punktuelle Korrekturen einen bedarfsgerechten und optimierten Betrieb zu erreichen. 6. Der vergessene Aufwand – Einregulierung, Abstimmung, Optimierung In haustechnischen Anlagen – speziell aber bei grossen und komplexen Systemen – wird die Bedeutung der Einregulierung, Abstimmung und Optimierung oft unter­ schätzt. Häufig ist die Konsequenz daraus, dass nur noch knappe Geldmittel für einen grossen Aufwand zur Verfügung stehen. Die Einregulierung, Abstimmung und Op­ timierung einer Anlage ist aber ebenso wichtig wie die Entwicklung des geeigne­ ten Installationskonzepts. Es gilt somit, von Anfang an für diese Abschlussphase entsprechende Zeit und Geldmittel einzu­ planen. Es lohnt sich, der Bauherrschaft die Bedeutung dieser Phase zu erklären und mit ihr das Ziel und die Umsetzung im Detail zu regeln. 7. Anlagenverhalten aufzeichnen Grundlage für jede Beurteilung der Be­ triebspunkte, der Steuerung und des Re­ gelverhaltens sind Messungen und Auf­ zeichnungen. In grösseren Anlagen steht dazu meist eine MSR-Anlage zur Verfü­ gung (MSR: Messen, Steuern, Regeln). Wird die Phase der Einregulierung, Ab­ stimmung und Optimierung frühzeitig ein­ geplant, so kann bei der Auslegung der Anlage diesem Aspekt von Anfang an Rechnung getragen werden. Das Mess­ konzept wird sich somit zielgerichtet erge­ ben. Es gilt dann, die Umsetzung der Sys­ tematik der Aufzeichnung von Anfang an aktiv zu überwachen und die Ergebnisse den zuständigen Fachleuten zur Auswer­ tung und Umsetzung zur Verfügung zu stellen. 8. Sommer und Winter – zwei getrennte Phasen Sommer und Winter sind zwei getrennte Phasen, die unterschiedliche Anforderun­ gen stellen und die Systeme unterschied­ lich beanspruchen. Sowohl die Einregulie­ rung als auch die Abstimmung und Opti­ mierung kann daher oft nur in zwei Pha­ sen vorgenommen werden. Knifflig sind aber nicht der tiefe Winter und der Hoch­ sommer, sondern die jeweiligen Über­ gänge im Frühjahr und im Herbst. Gerade aus Sicht der Gesamtbilanz des Gebäudes spielen diese Aspekte eine sehr grosse Rolle. Die Planung der Einregulierung, Ab­ stimmung und Optimierung sollte daher immer alle vier Jahreszeiten einbeziehen. 9. Regelmässiger Vergleich Soll-Ist Zur Beurteilung eines Energiekonzepts bzw. einer Haustechnik wird der Planer wie auch die Bauherrschaft durch einen Vergleich der erhobenen Ist-Werte mit den Soll-Werten gemäss der vorgegebenen Zielsetzung vornehmen. Eine geeignete Darstellung mit entsprechenden Kennzah­ len respektive Grafiken wird die Regel sein. Die Frage ist somit, in welchem Intervall dieser Vergleich erfolgen soll. Empfohlen ist, nach der Inbetriebnahme monatlich bis einmal pro Quartal eine Bilanz zu ziehen. Mit der Zeit kann allenfalls eine Halbjah­ resbilanz genügen. Kapitel 13 Aussenraum Maurus Schifferli Veränderte Wahrnehmung der Landschaft Reine Naturlandschaft existiert heute in Mitteleuropa so nicht mehr. Als geistiges Konstrukt ist Landschaft heute als Kultur­ landschaft zu begreifen, da sämtliche Ge­ biete in irgendeiner Form im Laufe der Geschichte durch den Menschen beein­ flusst wurden. Die landwirtschaftliche Struktur ist dabei Ausdruck der unter­ schiedlichen menschlichen Aktivitäten im Zusammenspiel mit den natürlichen Fakto­ ren. Stadt kann in diesem Sinne auch als Kulturlandschaft interpretiert werden. Hybridisierung Der Kontrast zwischen Stadt und Land­ schaft löst sich zusehends auf. Landschaft und Stadt werden eins und stellen gegen­ seitig Anforderungen. Es entsteht ein wechselseitiges Verhältnis von Durchdrin­ gung und Abhängigkeit, in der eindeutige Definitionen zu Gunsten von Mehrfachco­ dierungen und Hybridbildungen verloren gehen. Nicht die Stadt dehnt sich in den Landschaftsraum aus, sondern die Stadt entsteht neu – durch Stadt. Landschaft wird weder als Kontrast zur Architektur, noch als überkommenes Vorbild verstan­ den, sondern als ein elementarer Bestand­ teil einer hybriden Grundstruktur, deren endgültige Gestalt sich erst nach den Pha­ sen aktiver Nutzung und Aneignung her­ ausbilden wird. Die Stadt als Landschaft, als Infrastruktur und als Architektur zu entwerfen, deren Kriterium auf mentaler Ebene die Zurückgewinnung der Langfris­ tigkeit in der Konstruktion von Stadt und Landschaft ist, ist Thema der künftigen Entwicklungen. Boden und Wasser Unser marktwirtschaftliches System be­ dingt ein Wachstum und somit eine Zu­ nahme des Bodenverbrauchs. Boden wird auch künftig immer weiter überbaut. Man kann keine Nachhaltigkeitsstrategie vor­ schlagen, die ein Nullwachstum des Bo­ denverbrauchs vorsieht. Künftig muss es aber Ziel sein, den Bodenverbrauch zu re­ gulieren, respektive das Wachstum des Verbrauchs zu reduzieren. Dies bedingt ein massvolles Wachstum der inneren Verdich­ tung in den Städten. Die Grenzen entlang der Stadtränder sind präzise zu definieren, so dass ein Wachstum des Stadtkörpers nach innen angeregt wird. Insbesondere eignen sich Industrie- und Gewerbeareale zur Umnutzung mit hoher Dichte. In erster Linie sollte kein zusätzlicher Bodenver­ brauch unterstützt werden, wie es heute mit der Subventionierung bestimmter er­ neuerbarer Energien gerade für individuel­ les Wohnen der Fall ist. Tendenziell geraten mit der Zunahme des Bodenverbrauchs die Gärten und Parkan­ lagen in den Städten unter Druck, die nebst dem Wert als ökologische Nischen auch einen hohen kulturellen und sozialen Wert haben, der meist über Jahrzehnte ge­ wachsen ist. Ähnlich verhält es sich mit der Bausubstanz, die insbesondere vor 1920 von hoher handwerklicher Fertigkeit und grosser Stilvielfalt ist und deshalb heute einen beinahe unbezahlbaren Wert dar­ stellt. Künftig wird immer weniger unbe­ bauter Boden zur Verfügung stehen. Ste­ tig steigen mit dem Einhergehen des Bo­ denverbrauchs auch die Ansprüche an die Grünflächen. Diese zu erhalten, zu entwi­ ckeln und auf die unterschiedlichsten Be­ dürfnisse präzise abzustimmen, erfordert ein hohes Mass an technischem Wissen, damit gerade die Ressourcen Boden und Wasser und somit unsere Grünflächen langfristig gesichert werden können. Zivilisation des Ortes Mit der Ausdehnung der Stadt und dem sukzessiven Verlust zusammenhängender Naturlandschaften verliert die Zivilisation des Ortes im herkömmlichen Sinn zuneh­ mend an Bedeutung. Die Schaffung iden­ titätsstiftender Räume in der heterogenen Stadtlandschaft wird dadurch zentrales gesellschaftliches Anliegen. Die zuneh­ 104 Aussenraum mende Gleichzeitigkeit von Raum und Zeit führt zur Dekontextualisierung des Be­ griffs der Natur. Es besteht die Möglich­ keit, Natur zu manipulieren, zu transfor­ mieren und an jeglichem Ort zu reprodu­ zieren. Die Reproduktion ermöglicht es unter anderem, dass Natur und Vegetation an Autonomie gewinnen. In letzter Konse­ quenz führt diese Autonomie auch zur In­ fragestellung der Horizontalität von Vege­ tation und somit von Landschaft. Vegeta­ tion wird zu einem «Material», das dekon­ textualisiert und in verfremdeter Weise in der (Landschafts-)Architektur eingesetzt wird. Wichtigste Aufgabengebiete Das Erarbeiten von übergeordneten Stra­ tegien, Konzepten und Projekten zu terri­ torialen städtebaulichen und landschaftli­ chen Fragen wird für künftige Entwicklun­ gen von zentraler Bedeutung sein, damit die wichtigsten Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft auch künftig in ausrei­ chendem Masse und in hoher Qualität zu Verfügung stehen und genutzt werden können. Hierbei eröffnen sich Themenfel­ der zur Ausarbeitung von nachhaltigen Handlungsstrategien als Basis für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der stetig fortschreitenden Zivilisierung unserer Welt: ]]Wertvolle Böden, die zu erhalten sind ]]Sanierung kontaminierter Böden ]]Systemlösungen im Zusammenhang mit der Rückführung, der Retention, der Zwi­ schenspeicherung und der Nutzung von Regenwasser (Dach-, Platzwasser und Si­ ckerwasser) ]]Schutz und Entwicklung von wichtigen vegetabilen Strukturen ]]Entwickeln von standortgerechten vege­ tabilen Strukturelementen ]]Sichern und Schaffen von qualitätvollen Habitaten für Flora und Fauna im Sinn der Förderung einer hohen Diversität ]]Das Schaffen und Entwickeln von identi­ tätsstiftenden Sozialräumen als Basis für das gesellschaftliche Zusammenleben un­ ter Einbezug der Aspekte der Sicherheit (Sichtbezüge, Beleuchtung) und der Behin­ dertentauglichkeit 105 Gebäudeerneuerung Neubau Schulanlage Leutschenbach, Zürich Das ehemalige Industriequartier Saatlen in Schwamendingen gehört zu den am stärksten wachsenden Quartieren der Stadt Zürich. Das Schulhaus bildet den Ab­ schluss der Überbauung Andreaspark. Das innovative und radikale Schulhausprojekt von Christian Kerez zieht sämtliche Nut­ zungen in einem gewaltigen Volumen zu­ sammen und packt die Sporthallen aufs Dach. Raum für eine weitläufige Parkan­ lage entsteht. Dank der kompakten Bau­ weise des Schulhauses wird die überbaute Fläche auf ein Minimum reduziert und trotz der knappen Platzverhältnisse eine grosszügige Parkanlage sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Quartierbewohner geschaffen. Bauherrschaft: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich Architekt: Christian Kerez, Zürich Landschaftsarchitekten: 4d AG, Bern Wettbewerb: 2003 Planung und Realisierung: 2004 bis 2010 Abbildung 89: Entwicklungsleitbild Nutzungskonzept (Jauch + Zumsteg, Zürich) Abbildung 90: Schule im Park (Milo Keller, Paris) 106 Aussenraum Kanalpromenade, Interlaken (ehemaliges Schlachthausareal) Das gesamte Areal ist mit einer Tiefgarage komplett unterbaut. Aufgabe war es, das anfallende Regenwasser vollumfänglich auf der Parzelle zur Versickerung zu brin­ gen und nicht in die Kanalisation oder ei­ nen Vorfluter zu leiten. Das Dachwasser wird in einer extensiv begrünten Dach­ schicht zwischengespeichert, bevor es dif­ fus über einen Dücker in ein Retentionsfil­ terbecken geleitet wird und zur erneuten Zwischenspeicherung gelangt. Speziali­ sierte Pflanzen, unter anderem Binsen (Juncus) und Pfeifengräser (Molinia), die ebenfalls extreme Trockenheit ertragen, verdunsten sukzessive das anfallende Re­ genwasser. Abbildung 91: Retentionfilterbe­ cken (Foto: Milo Keller, Paris) Abbildung 92: Typenschnitt (Plan: 4d AG) Bauherrschaft: Baugesellschaft Kanalpro­ menade, Interlaken Architekten: L2A Lengacher Althaus AG Landschaftsarchitekten: 4d AG, Bern Wettbewerb: 2001 Planung und Realisierung: 2001 bis 2004 107 Gebäudeerneuerung Bahnhofplatz, Büren an der Aare Ausgangspunkt der Projektidee ist die Ent­ wicklung eines kosteneffizienten Projektes sowohl in der Erstellung als auch im Be­ trieb. So wird alles Dach- und Platzwasser trotz teilweise kontaminiertem Unter­ grund gefasst und linear zur Versickerung gebracht. Retentionsmulden, bepflanzt mit Pfeifengras (Molinia) und Stecklingen aus Silberweiden (Salix), verdunsten einen grossen Anteil des anfallenden Oberflä­ chenwassers. Die Restwassermengen wer­ den in diesen Streifen gereinigt und versi­ ckern örtlich diffus. Die Silberweiden werden mit Hilfe des Vor­ ziehgerüstes zu grünen Lauben gezogen und beschatten künftig auch im Sinn einer Komfortsteigerung die parkierten Autos. Bauherrschaften: SBB AG, Einwohnerge­ meinde Büren an der Aare Architekten: L2A Lengacher Althaus AG Landschaftsarchitekten: 4d AG, Bern Wettbewerb: 2006 Planung und Realisierung: 2006 bis 2009 Abbildung 93: Retentionstreifen (Foto: Alexander Gempeler, Bern) Abbildung 94: Typenschnitt (Plan: 4d AG) Kapitel 14 Beispiele Aleksandar Backovic’ Mehrfamilienhaus Basel Moderne Standards Chalet Troistorrents Ein Vierteljahrtausend Geschichte Internat Disentis Neue Architektur, alte Tradition Scheune in Villars-sous-Yens Die Rückkehr eines alten Bekannten Siedlung Stadtrain Winterthur Ein Musterbeispiel des Neuen Bauens Hochstudhaus Wabern Aus tiefer Verbundenheit Primarschule Monte Carasso Eine Affäre, die nicht endet Haus Matten in Ballenberg Ein grosses Ausstellungsobjekt 110 Beispiele Mehrfamilienhaus Basel Moderne Standards Architektur war immer schon mehr als Äs­ thetik. Heute stellen sich zudem neue An­ forderungen an den Architekten, insbe­ sondere bezüglich Umweltverträglichkeit des Gebäudes. In dieser Hinsicht stellt der Minergie-P-Standard eine hohe Messlatte. Dieser Herausforderung wollte sich die Bauherrschaft des Mehrfamilienhauses an der Güterstrasse 83 in Basel stellen. Eine Sanierung der anderen Art Das in Bahnhofsnähe gelegene, an einer viel befahrenen Strasse liegende Mehrfa­ milienhaus wurde 1954 von Marcus Die­ ner gebaut. Das Haus ist Teil einer typi­ schen Blockrandbebauung. Um die einfa­ che Grundstruktur des zentralen Erschlie­ ssungskerns mit Treppenhaus, Lift und Reduit waren über die vier Obergeschosse 16 gleichwertige Zweizimmerwohnungen verteilt (d. h. je vier Wohnungen pro Stock­ werk). Dazu befanden sich im Erdgeschoss noch zwei Dreizimmerwohnungen sowie fünf Mansardenzimmer im Dachgeschoss. Um das Jahr 2000 befand sich das Ge­ bäude in einem desolaten Zustand, so­ wohl die Grundrisse als auch der Innen­ ausbau waren nicht mehr zeitgemäss. Doch alles war nicht schlecht, denn seine Lage zwischen zwei Nachbarsgebäuden machte das Bauwerk ideal für eine Auf­ wertung auf den Minergie-P-Standard, so zumindest die Ansicht des Baubüros «in­ situ», das nach einer Besichtigung auch die Eigentümerschaft für dieses Ziel ge­ winnen konnte. 2006 begannen die Arbei­ ten. Neben technischen Hürden waren es auch rechtliche Schwierigkeiten, die von den Architekten kreative Lösungen abver­ langten. Die strassen- und hofseitigen Bal­ kone, die sowohl energietechnisch unzu­ länglich als auch dem Strassenlärm und Staub ausgesetzt waren, wurden vollstän­ dig eingehaust. Dies führte zu einer Erhö­ hung der Bruttogeschossfläche und ver­ besserte das Gebäude auch bezüglich dem gewünschten Standard. Auf der Strassen­ seite erhielt das Mehrfamilienhaus da­ durch ein kompaktes öffentliches Gesicht. Um nicht gänzlich auf Balkone zu verzich­ ten, wurden auf der Hofseite neue und grössere Balkone vorgehängt. Dazu musste allerdings das Nachbarsgrundstück hinzugekauft werden. Wände, Böden und Kellerdecke wurden gedämmt, alte Fens­ ter durch neue, dreifach verglaste ersetzt. Dies hat nebst der Energieeffizienz den zu­ sätzlichen Vorteil, dass die Wohnungen besser gegen Strassenlärm geschützt sind. Eine neue Komfortlüftung sorgt für einen systematischen Luftwechsel. Das Miner­ gie-P-Label verlangt nach Haushaltsgerä­ ten, die der Energieeffizienzklasse A ent­ sprechen. Für den Tank der nicht mehr gebrauchten Ölheizung fanden die Archi­ tekten eine intelligente Verwendung: Das in ihm gespeicherte Regenwasser wird für die WC-Spülung, das Wäschewaschen oder die Gartenbewässerung genutzt. Nebst all diesen technischen Verbesserun­ gen erfuhr das Mehrfamilienhaus aber vor allem eine atmosphärische Erneuerung. Die frühere monotone Aufteilung der Wohnungen wurde aufgebrochen. Im Erd­ geschoss befindet sich nun ein Gemein­ schaftsbüro, das erste Obergeschoss wurde zu einer Wohnung für Wohnge­ meinschaften umfunktioniert, was in An­ betracht der Bahnhofsnähe des Gebäudes das Appartement für Studenten und Pend­ ler attraktiv macht. Im dritten und vierten Obergeschoss sind Vierzimmerwohnun­ gen und im Dachgeschoss zwei Maisonet­ tewohnungen enthalten. Durch diese Er­ weiterung des Angebots ergibt sich eine Durchmischung, die eine soziale Interak­ tion fördert. Das von den Architekten «ThermoHaus» genannte Projekt stellt eine andere Art der Sanierung dar. Diese beginnt nicht mit der Ästhetik des Gebäu­ des, sondern mit seiner Funktionalität. Dies bedeutet aber keineswegs, dass nicht auch Form und Atmosphäre verbessert werden, wie das Mehrfamilienhaus an der Güterstrasse beweist. 111 Gebäudeerneuerung Abbildung 95: Das Mehrfamilien­ haus im GundeliQuartier in Basel – jetzt im Standard Minergie-P. (Foto: insitu) 112 Beispiele VIP-Dämmung Innendämmung VIP-Dämmung Abbildung 96: Schnitt durchs Mehrfamili­ enhaus an der Güterstrasse, Basel. Abbildung 97: Grundriss Normalgeschoss mit dem Modus der Wärmedämmung. (Pläne: insitu) 113 Gebäudeerneuerung Chalet Troistorrents Ein Vierteljahrtausend Geschichte Auf einer kleinen Anhöhe gegenüber den Dents du Midi steht seit 1739 an wunder­ bar sonniger Lage das beschauliche Cha­ let Nemeth. Mehr als 250 Jahre hat das Bergbauernhaus Hitze, Wind, Regen und Schnee getrotzt – eine Geschichte, die sich an den dunkelbraunen, abgenutzten, hölzernen Oberflächen des Gebäudes ab­ lesen lässt. Vor seinem Umbau vor weni­ gen Jahren wurde das Chalet über Gene­ rationen von den Bergbauern als Winter­ sitz genutzt. Wie zu seiner Erbauungszeit üblich, besteht es aus den am Ort vorhan­ denen Baumaterialien. Das Alltagsleben spielte sich vorwiegend im Erdgeschoss ab. Auf der talgerichteten Seite befanden sich in der Mitte die Küche, durch die das Haus betreten wurde, und an ihren Seiten die Stube und die Kammern. Im hinteren Teil liegt der Stall. Der gemauerte, in die Bergwand eingelassene Unterbau des Ge­ bäudes diente als Vorratskammer. Im Obergeschoss schliesslich war der Heubo­ den. Ein Spiel zweier Welten Um die Jahrtausendwende erwarb die Fa­ milie Nemeth das Chalet. Zwei Jahre lang bewohnte sie das alte Haus und hatte so­ mit Gelegenheit, die authentischen Wohnverhältnisse früherer Zeiten haut­ nah zu erleben. Bald aber hatten sie den Wunsch, das Bauwerk zu erneuern. Es sollte heutigen Bedürfnissen entsprechen, gleichzeitig aber auch in jedem Raum die alte Konstruktion erfahrbar bleiben. Die Eigenart des Hauses und die noch brauch­ baren Materialien sollten so weit als mög­ lich bewahrt werden. Mit dieser Forde­ rung wandten sie sich an die Architekten Geneviève Bonnard und Denis Woeffray aus Monthey. Die Lösung der Walliser Ar­ chitekten ist äusserst erfindungsreich und – pfiffig. Die Hülle des alten Bauwerks lie­ ssen sie unangetastet und kreierten inner­ halb ihrer Grenzen ein neues Haus. Eine innere Membran erkundet auf raffinierte Weise die Dimensionen des Chalets, tastet diese ab und durchbricht sie gelegentlich – ein Spiel mit Distanzen, mit Raum und Leerraum entfaltet sich. Der neue Körper, ein Einfamilienhaus mit sieben Zimmern, besteht wie das alte Chalet aus Holz, setzt sich jedoch durch die hellere Farbe von diesem ab. Die Nutzung des Tageslichts wurde optimiert, ohne die alte Hülle auf­ schneiden zu müssen. Neu betritt man das Haus nicht durch die Küche, sondern an der Ostseite, durch die einstige Stalltüre. Der Besucher befindet sich nach Eintritt in einem Zwischenraum, einem Durchgang zwischen alter Hülle und neuem Kern, in dem man das Wechselspiel von Alt und Neu erfasst. Die Linien des inneren Hauses sind klar und gerade, die Oberflächen flach – es ist ein neuzeitlicher Gebäude­ entwurf, der durch seine Disposition fast schon futuristisch anmutet. Auch die Vor­ zone zu den Zimmern im Obergeschoss zeigt dieses Spiel zwischen Alt und Neu: Der Besucher soll bewusst von einer Welt in eine andere übertreten, soll sich der Grenzen bewusst werden. Im Kontrast beider ineinander verwobener Bauten kommt der Charakter jedes einzelnen weit stärker zur Geltung. Die Räume im Erdgeschoss haben die Architekten belas­ sen und saniert. Auf dem einstigen Heu­ boden haben sie drei neue Schlafzimmer eingebaut. Die ausserhalb des ursprüngli­ chen Wohnbereiches situierten beiden Bä­ der wurden innen mit grünem Kautschuk ausgekleidet. Das sich auf der Oberfläche brechende Sonnenlicht erzeugt im Zusam­ menspiel mit dem warmen Charakter des Holzes eine verträumte Stimmung. Aus der Badezelle im Erdgeschoss bietet sich durch ein raumhohes Fenster ein pracht­ voller Blick auf die umliegende Natur. Aus Respekt vor der Geschichte des Gebäudes und den Wünschen der Bauherren stellten die Architekten die Erhaltung der Authen­ tizität des Chalets über alles. Abgesehen von zwei Lichtschächten, die zusätzliches Tageslicht ins Kernhaus bringen, wurde am Bestehenden nichts verändert: Fenster und Dachziegel wurden nicht ersetzt, die Aus­senwände nicht ausgebessert. Sogar Löcher und Spalten in der alten Fassade hat man belassen. Die Spuren der Zeit sind nicht verwischt, die Geschichte des Cha­ lets ist lesbar geblieben. 114 Beispiele 5m 5m Abbildung 98: (oben links): Ansicht Südfassade Abbildung 99: (oben rechts): Schnitt Abbildung 100: (Mitte): Grundriss Untergeschoss Abbildung 101: (unten): Grundriss Obergeschoss 5m 115 Gebäudeerneuerung Abbildung 102: Alte und neue Hülle – von einer Welt in eine andere über­ treten. Abbildung 103: Lichtspiel im Zwei­ schalenhaus. Abbildung 104: Situation (alle Fotos und Pläne: Geneviève Bonnard und Denis Woeffray) 10m 116 Beispiele Internat Disentis Neue Architektur, alte Tradition Die Strassen im Zentrum von Disentis sind eng. Die Durchgangsroute nach Chur war immer schon von grosser Bedeutung und so reihen sich die wichtigen und folglich hohen Gebäude des Ortes entlang der Strasse, so eng, dass es keinen Platz für eine so neuzeitliche Einrichtung wie das Trottoir gibt. Das Gefühl der Enge wird noch verstärkt durch das über dem Dorf thronende Benediktinerkloster, das älteste der Schweiz – eine über tausendjährige In­ stitution. Doch an einer Stelle weitet sich die Strasse und der Passant sieht sich mit einem kleinen Vorplatz konfrontiert. Dies ist der Vorplatz des Mädcheninternats «Unterhaus». Als das ursprüngliche, 1860 gebaute «Unterhaus» in die Jahre kam und abgerissen werden musste, da besan­ nen sich verschiedene Gruppierungen auf die jahrhundertealte pädagogische Tradi­ tion der Klosterschule, welche heute so­ wohl Gymnasium der Region Surselva als auch überregionale Internatsschule ist, und veranstalteten auf der Suche nach ei­ nem Ersatzgebäude einen geladenen Wettbewerb. Der siegreiche Entwurf stammt vom bekannten Bündner Archi­ tekten und ETH-Professor Gion Caminada. Ein Spiel der Paradoxien Caminadas «Unterhaus» fügt sich über­ gangslos ins Dorfbild ein. Nie würde ein Ortsfremder annehmen können, dass je etwas anderes an dieser Stelle stand, denn Materialität und Dimensionierung heben sich nicht von den Nachbarsgebäuden ab. Die älteren Ortsansässigen wissen aller­ dings, dass das frühere Bauwerk der Stra­ sse weniger Raum gab. Caminada hat den Neubau bewusst einige Meter von der Strasse zurück versetzt, in den steinernen Hang integriert. Das «Unterhaus» erhielt dadurch einen einladenden, aber auch in­ timen Vorplatz und steht nun etwas ver­ deckt. Doch gerade dadurch fällt es wie­ der auf. Das verdeckt-auffällige Objekt besticht durch die kubusartige Form, die bis auf das sehr flache Zeltdach von präzi­ sen waagrechten und senkrechten Linien beherrscht wird. Zum grössten Teil aus Be­ ton gefertigt, strahlt es eine selbstbe­ wusste Ruhe und Beständigkeit aus und gleicht sich so dem Charakter des Klosters oberhalb des Gebäudes an. Auch mit der Fensteranordnung seines Entwurfes zitiert Caminada die Architektur des Klosters und macht auf elegante Weise klar, dass diese zwei Gebäude zueinander gehören. Der Architekt verfolgte mit seinem Konzept des Internats das Ziel, zweckmässige und raumorientierte, aber auch behagliche Räumlichkeiten für die 14- bis 18-jährigen Mädchen und jungen Frauen zu schaffen, welche die Klosterschule besuchen. Das «Unterhaus» sollte den Schülerinnen nicht nur Schlafplatz sein, sondern vielmehr Hei­ mat. Das Gebäude spricht aus diesem Grund auch die Elemente Selbstständig­ keit und Gemeinschaft stark an. Abzule­ sen ist dies vor allem an den 31 Zimmern des Bauwerkes, die zwar alle eine beinahe quadratische Form aufweisen, sich aber in der nach Vorgaben und Entwürfen von Caminada arrangierten Möblierung unter­ scheiden. Dank seiner Lage im Hang ist jedes der vier Obergeschosse über einen individuellen Eingang zugänglich. Jedes Stockwerk bekommt dadurch eine Auto­ nomie. Kollegialität kommt in den Gemeinschafts­ räumen zum Ausdruck, die sich auf jedem Geschoss befinden. Dieser Raum dient nicht nur als Begegnungsort, in ihm wird auch das zentrale Element von Caminadas Entwurf am deutlichsten erfahrbar: der Betonkern. Denn während aussen klare Li­ nien und reduzierte Formen dominieren, so hat der Architekt im Inneren des Bau­ werkes einen komplexen Kern versteckt, der aus «Disentiser Braunbeton» wie Ca­ minada ihn nennt, gegossen ist. Dieser Kern ist mit Hohlräumen und schrägen Li­ nien durchzogen und verleiht dem Ge­ bäudeinneren Dynamik und Bewegung, weist in verschiedene Richtungen, bietet aber auch gleichzeitig höhlenartige, ge­ mütliche Rückzugsnischen. Mit seiner Ar­ chitektur schafft es Gion Caminada, viele Gegensätze zusammenzubringen. 117 Gebäudeerneuerung Abbildung 105: Das Mädcheninternat «Unterhaus» in Disentis von Gion Caminada. (Foto: Lucia Degonda) Abbildung 106: Situation (Plan: Gion Caminada) 118 Beispiele Briefkasten Abbildung 107: Schnitt Mädchenin­ ternat Disentis. Abbildung 108: Grundriss DW (Pläne: Gion Caminada) 119 Gebäudeerneuerung Scheune in Villars-sous-Yens Die Rückkehr eines alten Bekannten Holz «arbeitet» heisst es im Volksmund. Der etwas aufwendigere Unterhalt dieses Materials führte seit längerer Zeit dazu, dass Holz beim Bau von Gebäuden bei Seite geschoben wurde und an seiner statt angeblich problemlose Werkstoffe wie Stahl oder Beton Verwendung fanden. Da­ bei hat aber neben dem Stein vor allem das Holz die Schweizer Architektur über ihre gesamte Geschichte hindurch ge­ prägt. Dabei ist Holz als erneuerbarer Roh­ stoff reichlich vorhanden. Die Verwendung dieses Materials stellt im Bauwesen eine produktive und überaus umweltfreundli­ che Lösung dar. Aus diesem Grund ist es erfreulich zu sehen, dass eine neue Gene­ ration von Architekten diesen Rohstoff für sich entdeckt hat und ihm eine Präsenz in der zeitgenössischen Architektur bietet. Ein Anschauungsbeispiel dazu stellt der Umbau der Scheune in Villars-sous-Yens dar. Eine konstruktive Zweckentfremdung Im Zentrum des kleinen Waadtländer Ört­ chens Villars-sous-Yens stand bis 2009 eine grosszügig dimensionierte alte Scheune. Heute ist dies kaum noch zu er­ kennen. Unter der Federführung des Ar­ chitekten Ivo Frei machte das Bauwerk eine tiefgreifende innere Transformation durch und bietet nun auf drei Geschossen jeweils eine Familienwohnung an. Dabei zeigt sich in der Vorgabe an den Architek­ ten, die bestehende Grundstruktur des Objektes zu erhalten, dass gerade Hinder­ nisse zu grossen kreativen Leistungen bei­ tragen können. Die drei komfortablen Wohnungen schliessen einen zentralen Er­ schliessungskern ein. Gedämmte Aussen­ wände, Komfortlüftung, natürliche Lüf­ tung im Sommer sowie eine Anlage zur Regenwassernutzung (WC-Spülung) sind die Stichworte dazu. Die Erneuerung kam auch in ökonomischer Hinsicht äusserst günstig zu Stande, da dazu nicht ein kom­ pletter Gebäudeneubau, sondern bloss ein Umbau notwendig war. Was die Wohnun­ gen in Villars-sous-Yens aber auszeichnet, ist die Behaglichkeit, die sie vermitteln. Diese ist zuallererst dem Material zu ver­ danken, welches das Gebäude dominiert. Das ist natürlich ein Vermächtnis der eins­ tigen Scheune. Die hellbraunen Holzlatten der Fassaden verleihen dem Objekt eine wunderbare Wärme und Natürlichkeit und binden es umstandslos in seine ländliche Umgebung ein. Dabei wurden die Latten sehr variabel angeordnet: Mal liegen sie horizontal, mal vertikal, mal steht eine quadratische Fläche vor. Dies verleiht den Wänden eine ausgesprochen kurzweilige Textur. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die Verglasung. Um genügend na­ türliche Beleuchtung – und in dieser Hin­ sicht auch eine Art Autonomie – für jedes Geschoss zu ermöglichen, gestaltete der Architekt grosszügige, teilweise geschoss­ hohe Glaswände und Fenster auf allen Sei­ ten und Stockwerken des Gebäudes. Viele dieser Fenster werden von den gleichen Holzlatten gedeckt, wie sie auf der Fas­ sade zu finden sind. Jene über der Vergla­ sung sind aber drehbar, wodurch sich nicht nur der Lichteinfall regulieren lässt, son­ dern auch ein wunderbares Spiel zwischen Glas und Holz entsteht. Und dies ist das eigentliche Highlight des Gebäudes, das vormals eine plumpe, alte Scheune war. Das Zusammenspiel zwischen Holz und Glas verleiht dem Bauwerk eine wunder­ bare Leichtigkeit und Transparenz, das enorme Volumen erscheint leicht, scheint zu schweben. 120 Beispiele Abbildung 109: Drei Familienwoh­ nungen in einer ehemaligen Scheune. Abbildung 110: Situation 121 Gebäudeerneuerung +5.35 +2.55 Abbildung 111: Schnitt, parallel zum Giebel. Abbildung 112: Schnitt, parallel zum Ort. Abbildung 113: Grundriss 1. Ober­ geschoss. (Foto und Pläne: Atelier niv-o, Ivo Frei) 122 Beispiele Siedlung Stadtrain Winterthur Ein Musterbeispiel des Neuen Bauens Die florierende Industrie Winterthurs zog auch nach dem Ersten Weltkrieg zahlrei­ che Arbeiter in die Stadt. So beauftragte die im Jahr 1923 gegründete Heimstätten­ genossenschaft Winterthur (HGW) den Architekten Adolf Kellermüller, im Stadtrainquartier eine neue Siedlung mit preis­ günstigen Unterkünften zu erstellen. Kel­ lermüller, der nach seiner Architekturaus­ bildung mehrere Jahre in Ostpreussen ge­ arbeitet hatte, brachte von dort die Idee des Vierfach- oder Kreuzreihenhauses mit. Die Vorteile dieses Typs liegen klar auf der Hand: Die effektive und unkomplizierte Form erlaubt kompakte Gebäude, das Ma­ terial ist auf ein Minimum reduziert, was sich positiv auf die Baukosten auswirkt. Erst 1928 begann die Realisierung des Pro­ jektes; sie dauerte bis 1943. Sieben Zeilen von Kreuzreihenhäusern, Wand an Wand und Rücken an Rücken zusammengebaut, bildeten den Kern des Entwurfs. Diese von Ost nach West orientierten, mit vorgela­ gerten Gärten und kleinen Balkonen aus­ gestatteten Häuser stellten 124 Vierzim­ merwohnungen zur Verfügung. Die mit dieser Bauart verbundenen Beleuchtungsund Belüftungsprobleme löste der Archi­ tekt mittels der in der Flachdachkonstruk­ tion eingebauten doppelten Oblichter. Die restlichen der insgesamt 277 von der HGW geforderten Wohneinheiten finden sich in einer viergeschossigen nördlichen Randbe­ bauung, einem zweigeschossigen südli­ chen Gebäude sowie mehreren zusam­ mengebauten Mehrfamilienhäusern. Die Strassen zwischen den Blöcken bekamen die Namen Quitten-, Pfirsich-, Aprikosen-, Birnen-, Apfel- und Kirschenweg, was der Siedlung den Spottnamen «BirchermüesliQuartier» einbrachte. Mit seinem klaren Konzept und der schnörkellosen For­ mensprache schuf Kellermüller ein frühes Werk einer typisch schweizerischen Spiel­ art der Moderne. Er selber fühlte sich nicht als Vorkämpfer des Neuen Bauens und be­ zeichnete seine Architekturauffassung gerne als «Bauen der neuen Sachlichkeit». Die Sanierung 2006 bis 2009 Die HGW entschied sich für eine Sanie­ rung und schrieb 2005 einen Wettbewerb unter sechs ausgesuchten Architekturbü­ ros aus. Gefordert waren nicht nur konst­ ruktive und energetische Massnahmen sondern ebenso eine Erneuerung der Sani­ tärbereiche sowie eine Erweiterung der Wohnfläche. 2008 konnte die Sanierung des Quartiers nach dem Konzept der Wett­ bewerbssieger Knapkiewicz & Fickert be­ gonnen werden. Der erste Eingriff betraf den Abbruch der Mehrfamilienhäuser im westlichen Teil der Siedlung. Ihr desolater Zustand hat nur noch diese Möglichkeit offen gelassen. Ein Ersatzneubau hat zu­ dem den Vorteil, dass die an dieser Stelle realisierte Einstellhalle den Bedarf des ge­ samten Quartiers zu decken vermag. Das Kernstück der Sanierung sind die 18 Kreuzreihenhäuser, bei denen nebst der Verbesserung des Wohnkomforts vor al­ lem die Erweiterung der Wohnfläche im Vordergrund stand. Auf einer Grundfläche von 53 m2 waren im Erdgeschoss das Wohnzimmer, die Küche und das Bad mit Waschküche zusammengedrängt und im Obergeschoss gab es drei Schlafzimmer und ein WC. Zudem war der Keller nur über die Küche zugänglich. Die Architek­ ten fügten jeder Einheit im vorgelagerten Garten eine schmale, auf der Garten­ grenze stehende, eternitverkleidete Holz­ konstruktion an. Diese armartigen Seiten­ flügel, welche die Wohnblöcke aus der Luft als zwei grosse Tausendfüssler er­ scheinen lassen, schaffen 25 m2 zusätzli­ che Wohnfläche. Daraus entsteht zudem ein geschützter Hof. Die weichen und war­ men Materialien Holz und Glas des An­ baus verleihen dem massiven Bestand eine gewisse Leichtigkeit, vermögen aber auch, das in die Jahre gekommene Bauwerk mit neuzeitlichen ästhetischen Vorstellungen zu verbinden. Die kräftigen und klaren Li­ nien des Anbaus sorgen dafür, dass eine Homogenität zwischen dem Ursprüngli­ chen und dem Neuen entsteht. Der An­ strich der Häuserwände in Fruchtfarben ist schliesslich mehr als bloss moderne Farb­ gebung – es ist eine charmante Hommage an den Spitznamen der Siedlung. 123 Gebäudeerneuerung Abbildung 114: Altbestand und Er­ weiterung bilden einen geschützten Hof. (Foto: Heinz Unger) 124 Beispiele 125 Gebäudeerneuerung Abbildung 115: Der Anbau schafft 25 m2 zusätzlichen Wohn­ raum. (Foto: Heinz Unger) 126 Beispiele Mieterinformation 03.09.2008 REIHENEINFAMILIENHÄUSER, ETAPPE B Dachneigung 2° SE ETAPPE A 20214625 (452.621M.ü.M) E INS TE LLHALLE ZIMMER 14.3m2 ZIMMER 12.0m2 20214582 (452.912M.ü.M) B AUL WOHNEN/ESS EN 29.9m2 0 Schrank neu TALACKERSTRAS ISS NN HA JO E SS A TR DU/WC 5.0m2 ENTREÉ 6.2m2 KÜCHE 8.9m2 INIE ETAPPE B 2 S ITZPL 452.6 2.4 1 452.5 452.6 6 ATZ ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 E KÜCH 8.7m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 1 S ITZPL % > N ESSE 2 18.8m 1 452.5 452.6 S ITZPL EROB GARD 6.4m2 BAD/W 5.5m2 % > C E 453.0 N r. EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 17.4m 0 C BAD/W 5.5m2 3.5 % > EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 11.7m C E KÜCH 8.7m2 452.5 ESSE 2 17.4m N ESSE 2 18.8m 452.6 S ITZPL S ITZPL EROB GARD 6.4m2 P F IR 2 N r. < 1.6 7 452.5 BAD/W 5.5m2 E 453.0 ER ZIMM 2 14.3m 1 HW EG N r. < 9 N ESSE 2 18.8m S ITZPL 452.6 452.6 < SE < 1.5 452.5 S ITZPL 452.6 C DU/W 3.9m2 % ESSE 2 18.8m 452.5 S ITZPL 452.6 ATZ C DU/W 3.9m2 452.6 S ITZPL 452.5 B AU IE LW TA SE N AS SE OG S ITZPL 452.6 DIELE m2 4.7 ATZ C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 1 % 2 3 5m N TREPPENHAU 2 r Abbildung 118: Grundriss Obergeschoss Normhaus 1 2 3 4 5m N B A G a l i p - Ve r t e i l e KÜCHE 8.9m2 Abbildung 116: Schnitt durch ein Norm­ haus der Siedlung Stadtrain in Winterthur. Abbildung 117: Grundriss Erdgeschoss Normhaus OBERGESCHOSS NORMHAUS Kirschenweg 3-17 5.5 Zi-Wohnung, 106.5m2 6.2m2 ENTREÉ WOHNEN/ESS EN 29.9m2 0 ZIMMER 12.0m2 IE (Pläne: Knapkiewicz & Fickert) ZIMMER 14.3m2 ZIMMER 12.0m2 IE Abbildung 119: Situation ENTREÉ 6.2m2 KÜCHE 8.9m2 ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 20215321 (451.773M.ü.M) 4 DU/WC 5.0m2 r 1 UMGEBUNGSPLAN 1 WOHNEN/ESS EN 29.9m2 0 452.5 ATZ UG LIN ER ZIMM 2 14.3m 20214630 (452.312M.ü.M) 6 EG B AU ERDGESCHOSS NORMHAUS Kirschenweg 3-17 5.5 Zi-Wohnung, 106.5m2 LIN C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 % > 3 R ST DIELEm2 4.7 ER ZIMM 2 14.3m 18 1.6 DIELEm2 4.7 6 LIFT SB E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m N ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 19 6 ATZ 1 % EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m 3 1 ATZ 6 DIELEm2 4.7 452.6 S ITZPL 452.5 452.5 S ITZPL 452.6 ATZ C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 1 EN WOHN 2 15.0m < 1.5 E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m 6 N r. DIELEm2 4.7 6 % N r. 19 86 EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m E KÜCH 8.7m2 N r. DIELEm2 4.7 452.6 S ITZPL 17 < 1.5 6 N r. DIELEm2 4.7 6 EN WOHN 2 15.0m % > 1 < 4.0 N ESSE 2 18.8m N r. 452.5 1 ATZ N E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m 452.6 ATZ 1 16 1.6 EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 20210164 (452.138M.ü.M) 452.5 S ITZPL % 6 ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 452.5 16 EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m N r. DIELEm2 4.7 6 ATZ 1 17 % DIELE m2 4.7 452.6 S ITZPL < 3.5 < 2.5 6 ER ZIMM 2 14.3m N ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 N r. 14 1 N r. C DU/W 3.9m2 EN WOHN 2 15.0m % > 1 % ATZ C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m ATZ DIELE m2 4.7 452.6 S ITZPL 452.5 452.6 DIELEm2 4.7 6 ATZ 1 14 3.2 EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m EN WOHN 2 15.0m 15 N r. 452.5 S ITZPL % 6 ER ZIMM 2 14.3m N ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 TALACKERSTRAS JO C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 452.5 < 3.2 N r. E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m N r. DIELEm2 4.7 6 ATZ 15 12 EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m N ESSE 2 18.8m ATZ DIELEm2 4.7 452.6 S ITZPL 1 452.6 S ITZPL N r. B A 1 DIELEm2 4.7 EN WOHN 2 15.0m % > 1 < 2.0 S ITZPL N ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m 452.5 452.6 C DU/W 3.9m2 N ESSE 2 18.8m 452.5 zum ATZ DIELEm2 4.7 E KÜCH 8.7m2 12 1.6 EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 Gefälle 6 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m ATZ N ESSE 2 18.8m 1.5 % 452.5 S ITZPL DIELEm2 4.7 6 ATZ 1 6 ER ZIMM 2 14.3m DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 452.5 N r. E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m 452.6 S ITZPL 11 N r. im % EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m % > N r. C DU/W 3.9m2 1 11 2.4 1 DIELEm2 4.7 DIELE m2 4.7 6 ATZ 1.5 % N r. C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m N ESSE 2 18.8m C 452.5 DIELE m2 4.7 6 ATZ 1 % > 10 N r. 452.5 < 3.5 DIELEm2 4.7 452.6 S ITZPL 452.5 2 Unterlagsboden 1 ATZ 6 ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 2.0 EN WOHN 2 15.0m N ESSE 2 18.8m 452.6 S ITZPL 452.5 S ITZPL 452.6 ATZ E KÜCH 8.7m2 E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m 10 N r. EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 EN WOHN 2 15.0m 9 N r. B A % ATZ C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 0 ER ZIMM 2 11.7m C C DU/W 3.9m2 % S IC REIHENEINFAMILIENHÄUSER, ETAPPE B DIELEm2 4.7 6 ATZ < 3.5 1 6 N 1 E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m DIELEm2 4.7 6 ATZ 1 N % S ITZPL 452.6 % > G BAD/W 5.5m2 8 N r. E ER ZIMM 2 11.7m 452.5 452.5 DIELE m2 4.7 452.6 S ITZPL 7 N r. WE < 1.5 E 453.0 EN WOHN 2 15.0m % > 1.5 S ITZPL EROB GARD 6.4m2 EROB GARD 0 6.4m2 ATZ 1 N ESSE 2 18.8m E KÜCH 8.7m2 6 1.5 1 HE N 453.0 S ITZPL 452.5 452.5 ATZ SC N ESSE 2 17.4m E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m 5 N r. C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m 1 E KÜCH 8.7m2 % > 0 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m Unterlagsboden im Gefälle zum 8 N r. EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 N ESSE 2 18.8m ER ZIMM 2 11.7m DIELEm2 4.7 6 ATZ 1 452.5 DIELEm2 4.7 6 K IR 1.5 452.5 452.6 ATZ ATZ E KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m 3 N r. 5 N r. 1 4.0 N ESSE 2 17.4m % 6 DIELEm2 4.7 EN WOHN 2 15.0m S ITZPL < 3.5 1 ATZ G N r. 4 EN WOHN 2 15.0m 452.5 S ITZPL 452.6 E KÜCH 8.7m2 6 6 N r. E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m TE NWE IE C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m QUIT LIN ATZ 1 N ESSE 2 18.8m N r. DIELEm2 4.7 452.5 % > ATZ DIELEm2 4.7 S ITZPL B AU 1.5 2 S ITZPL 3 N r. EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m G a l i p - Ve r t e i l e % 1 DIELEm2 4.7 6 TAL AC K E R S TR AS S E N ESSE 2 18.8m 452.5 DIELEm2 4.7 452.6 B A < 2.4 KÜCH 8.7m2 EN WOHN 2 15.0m EN EN 2 WOHN WOHN 2 15.8m 2 15.0m BF FF 17.0m E KÜCH 8.7m2 ER N ESSE 2 18.8m E 1 ATZ 6 SA UG SS 452.5 S ITZPL 452.6 TREPPENHAU 2 N r. E KÜCH 8.7m2 RA E KÜCH 8.7m2 N ESSE 2 18.8m LIFT EG EN WOHN 2 15.0m ST EN WOHN 2 15.0m ER ZIMM 2 14.3m C DU/W 3.9m2 C DU/W 3.9m2 ER ZIMM 2 14.3m N ESSE 2 18.8m NHÄ NG R E IHE AU WO HNU R ANB UND ZIM ME UM- 4 1/2 x 18 NIS DIELE m2 4.7 6 ATZ 1 % > % 2 452.5 < 2.8 r 3.4 4 N r. B A 1 N r. IE l G a l i p - Ve r t e i l e LIN r mobi E US N HA 452.6 S ITZPL B AU tände Velos lätze 6P KÜCHE 8.9m2 EN WOHN 2 15.0m ETAPPE C OG ATZ 6 ENTREÉ 6.2m2 E S ITZPL 452.6 DIELEm2 4.7 DU/WC 5.0m2 SS B A WOHNEN/ESS EN 29.9m2 RA zum 0 ST Gefälle ZIMMER 14.3m2 N ESSE 2 18.8m N ESSE 2 18.8m G EN 1 im DU/WC 5.0m2 KÜCH 8.7m2 ER % 1 TE NWE IES LW TA 452.5 QUIT US NHÄ R E IHEHNU NG AU ANB ME R WO ZIM UND UM- 4 1/2 x 18 E KÜCH 8.7m2 < 1.5 Unterlagsboden E 20215323 (453.079M.ü.M) 2 N r. EN EN 2 WOHN WOHN 2 15.8m 15.0m 2 BF FF 17.0m B A B A G a l i p - Ve r t e i l e r Unterlagsboden im Gefälle zum SE ZIMMER 12.0m2 AS ZIMMER 14.3m2 S TR ÄTZE NIS V E L O PA R K P L AN B AULINIE J OH TA LW IE S EN ST RA SS E 127 Gebäudeerneuerung Hochstudhaus Wabern Aus tiefer Verbundenheit An der Gurtenstrasse 137 im Gurtendörfli bei Wabern liegt, in einem sanften Hügel eingebettet und von Bäumen umgeben, ein über 400-jähriges Hochstudhaus. Trotz dieser langen Bestandsdauer wurde das Bauwerk nur zweimal weiterverkauft – lange Vererbungsketten sind Beweis dafür, welchen Stellenwert das Gebäude für die jeweiligen Besitzer hatte. Die derzeitige Ei­ gentümerin des Hochstudhauses, die Fa­ milie Suter-Dörig, zeigt dieselbe Verbun­ denheit mit dem Bauwerk und engagier­ ten den Architekten Philippe Urech, um das Haus feinfühlig zu sanieren, zu restau­ rieren und auszubauen. Respekt vor dem Alter Der Bautypus des im Jahre 1598 fertigge­ stellten Gebäudes war zu seiner Zeit ein in der Gegend weit verbreitetes Bauwerk. Al­ lerdings waren zwei oder vier der namens­ gebenden Hochstüde, die das Walmdach tragen, die Norm. Das Haus an der Gur­ tenstrasse 137 hingegen verfügt über sechs Hochstüde. Im Laufe seiner langen Geschichte erfuhr das Haus mehrere Um­ bauten, davon drei grössere. Diese hatten nicht nur erheblichen Einfluss auf die Sta­ tik des Objekts (das Tragwerk wurde mit zusätzlichen Trägern ergänzt, zwei Gewöl­ bekeller errichtet, dann zwei Hochstüde entfernt), sondern veränderten auch das Cachet des Hauses, indem diese teilweise groben Eingriffe mit wenig Rücksicht auf die originalen Elemente des Gebäudes re­ alisiert wurden. Gerade die Wertschätzung der Geschichte war es, was die Familie Suter-Dörig motivierte, einen Umbau des Hauses unter strengen Auflagen zu erwä­ gen. Die Statik war dem Gebäude ange­ messen; andere Elemente waren aber in einem leidvollen Zustand. Wegen einer fehlenden, grundlegenden Sanierung litt die Massivholzkonstruktion an Durchzug und Feuchtigkeit. Und die Einbettung in den Hang, einst zum Schutz vor Witterung gedacht, sorgte nun dafür, dass sich Re­ genwasser auf der Rückseite des Gebäu­ des ins Sandsteinmauerwerk ergoss und diesem zusetzte. Minimale Eingriffe, maximale Wirkung Von aussen betrachtet sind Spuren von Philippe Urechs Eingriff nicht zu erkennen. Selbst im Gebäudeinneren wird man kaum etwas mitbekommen. Denn der Umbau des Architekten betrifft nur den bereits ausgebauten Wohnteil im Erd- und Ober­ geschoss. Ökonomieteil und Dachraum (flächenmässig also etwa dreiviertel des Gebäudes) blieben dagegen beinahe un­ angetastet. Dabei wurden Fenster ersetzt, Böden im Erdgeschoss ausgewechselt, der Energieverbrauch des Hochstudhauses so weit heutigen Ansprüchen angenähert, wie die alte Bausubstanz es erlaubte. Dazu wurde die Statik an mehreren Stellen ver­ bessert und der Einfall des Tageslichts durch Glasziegel im Dach und Oblichter optimiert. Neue Entwässerungsrinnen an der Rückseite des Gebäudes sorgen nun dafür, dass das Feuchtigkeitsproblem auf ein Minimum reduziert ist. Der ästhetische Aspekt des Umbaus hält sich strikt an die Anforderungen der Bauherrschaft, das Gebäude nicht bloss so zu belassen, wie es sich darstellt, sondern dieses auch mög­ lichst original wiederherzustellen. Den grössten Eingriff und das Herzstück des Projektes stellt jedoch die Gestaltung des Wohnteils im Erd- und Obergeschoss dar. Hier wurden die Trennwände neu ange­ ordnet und die Decke des Obergeschosses mit Hilfe einer Erneuerung der Statik ange­ hoben. Besonders hervorzuheben ist die vollständig neue, nun zweistöckige hallen­ artige Küche mit ihrer beinahe wand­ grossen Verglasung. Der Architekt entwi­ ckelte ein interessantes Spiel aus Alt und Neu. Ersatzelemente wurden nur dort an­ gebracht, wo es unbedingt notwendig war und so stehen vielerorts Bruchstücke von Neu und Alt nebeneinander: Von der Zeit gezeichnete, knorrige, dunkle Balken und Möbel durchbrechen moderne, glatt polierte Holzwände. Für sich betrachtet einzelne Fragmente, zusammengenom­ men ein Haus – ein Hochstudhaus. 128 Beispiele Abbildung 120: Die zweistöckige, hallenartige Küche mit ihrer grossfor­ matigen Vergla­ sung. (Foto: Alexan­ der Gempeler) 129 Gebäudeerneuerung + ca . 4 .85 tennbühne + 4 .58 + 2 .28 OG heubühne / tenn ± 0 .00 gang alle masse sind am bau durch den unternehmer zu kontrollieren, unstimmigkeiten sind vor baubeginn mit dem architekten/bauleitung abzusprechen alle masse sind rohmasse sämtliche masse müssen auf bestehende fluchten (angaben gemäss bauleitung) überprüft werden sämtliche werkstattpläne müssen vor ausführungsbeginn durch den architekten genehmigt werden tür- bzw. fensterhöhen beziehen sich ab OK fertigem boden bzw. schwelle resp. OK fensterbank bis UK rohem sturz spitz- bzw. schlitzarbeiten dürfen nur mit genehmigung der bauleitung ausgeführt werden ingenieur statik ingenieur hlkk ingenieur sanitär ingenieur bauphysik landschaftsarchitekt : : : : : backstein stahl mst. 1:1 feuerfeste steine kalksandsteine typ .............. abbruch zementsteine mörtel gips verputz metall dichtungsmasse beton armiert / unarmiert holz massiv stahl (geschnitten) glas betonwerkstein kunststein vollholz brettschichtholz daemmstoffe kunststoffe sichtbeton holzwerkstoffe sperrschichten naturstein allgemein bestehend neu planjournal gezeichnet planänderung visum Abbildung 121: Querschnitt durch das 400 Jahre alte Hochstudhaus grundeigentümer : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern bauherrschaft : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern : philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47, 3097 liebefeld grundeigentümer Abbildung 122: Längsschnitt architekt architekt korridor N Abbildung 123: Grundriss Erdgeschoss E 03-05 umbau bauernhaus suter/dörig, gurtendörfli plannr. plangrösse 84/60 datum rev. 24.04.2007/pu revisionsplan (Pläne: Philippe Urech) längsschnitt c - c und querschnitt philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47 3097 liebefeld 1 : 50 tel 031 972 00 68 fax 031 972 00 69 mail [email protected] . bzw ingenieur statik ingenieur hlkk ingenieur sanitär ingenieur bauphysik landschaftsarchitekt : : : : : backstein stahl mst. 1:1 feuerfeste steine kalksandsteine typ .............. abbruch zementsteine mörtel gips verputz metall dichtungsmasse beton armiert / unarmiert holz massiv stahl (geschnitten) glas betonwerkstein kunststein vollholz brettschichtholz daemmstoffe kunststoffe sichtbeton holzwerkstoffe sperrschichten naturstein allgemein bestehend neu planjournal gezeichnet planänderung visum + ca. 4. .85 4 .85 tennbühne + ca tennbühne grundeigentümer : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern bauherrschaft : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern : philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47, 3097 liebefeld grundeigentümer korridor architekt + .28zimmer zimmer 2 + 22.28 2 architekt 03-05 umbau bauernhaus suter/dörig, gurtendörfli + .02stube stube + 00.02 querschnitt revisionsplan längs- und querschnitt philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47 3097 liebefeld N E ± .00küche küche ± 00.00 plannr. plangrösse 84/60 datum rev. 24.04.2007/pu 1 : 50 tel 031 972 00 68 fax 031 972 00 69 mail [email protected] alle masse sind am bau durch den unternehmer zu kontrollieren, unstimmigkeiten sind vor baubeginn mit dem architekten/b alle masse sind rohmasse sämtliche masse müssen auf bestehende fluchten (angaben gemäss bauleitung) überprüft werden sämtliche werkstattpläne müssen vor ausführungsbeginn durch den architekten genehmigt werden tür- bzw. fensterhöhen beziehen sich ab OK fertigem boden bzw. schwelle resp. OK fensterbank bis UK rohem sturz spitz- bzw. schlitzarbeiten dürfen nur mit genehmigung der bauleitung ausgeführt werden ingenieur statik ingenieur hlkk ingenieur sanitär ingenieur bauphysik landschaftsarchitekt : : : : : backstein stahl mst. 1:1 feuerfeste steine kalksandsteine typ .............. abbruch zementsteine mörtel gips verputz metall beton armiert / unarmiert holz massiv stahl (geschnitten) betonwerkstein kunststein vollholz brettschichtholz daemmstoffe sichtbeton holzwerkstoffe sperrschichten bestehend neu planjournal gezeichnet planänderung grundeigentümer : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern bauherrschaft : ruth dörig, beat suter, freudenreichstrasse 16, 3047 bremgarten b. bern : philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47, 3097 liebefeld grundeigentümer architekt architekt E 03-05 umbau bauernhaus suter/dörig, gurtendörfli revisionsplan N grundriss erdgeschoss philippe urech dipl. architekt eth/sia waldeggstrasse 47 3097 liebefeld plannr. plangrösse 90/60 datum rev. 24.04. 1 : 50 tel 031 972 00 68 fax 031 972 00 69 mail p.urech 130 Beispiele Primarschule, Monte Carasso Eine Affäre, die nicht endet Luigi Snozzi, einer der bekanntesten zeit­ genössischen Schweizer Architekten, be­ gann seine Arbeiten für das kleine Tessiner Dorf Monte Carasso vor knapp vier Jahr­ zehnten mit dem Wohnhausprojekt «Ver­ demonte». Im Zuge einer grundlegenden und mutigen Neuordnung der Infrastruk­ tur der Siedlung wandte sich die Gemeinde an Snozzi. Das Augustinerinnenkloster im Zentrum des Ortes sollte neuer Sitz der Grundschule werden. Ebenso benötigte Monte Carasso einen Gemeindeplatz. Dies waren allerdings nur zwei der vielen Mass­ nahmen des Grossprojektes, durch die das Dorf eine neue Identität erlangte. Die Umgestaltung des Klosters zeigt viele Parallelen zur Reorganisation des Dorfes selbst. So war der L-förmige Baukomplex in seiner Architektur zersplittert und un­ einheitlich. Snozzi nivellierte wo nötig, er­ setzte wo erforderlich, restaurierte wo er­ wünscht und reduzierte aufs Wesentliche. Er hob das Dach des Klosters auf eine ein­ heitliche Linie. Dabei setzte er auf den westlichen Flügel, in Anlehnung an sein früheres Aussehen, ein Walmdach, wäh­ rend im nördlichen Flügel fünf zweistö­ ckige Schulzimmer unter einem halben Tonnendach ihren Platz finden. Dazu ver­ einheitlichte Snozzi die Fassaden mittels Fensteranordnung, Farbe und durch Freile­ gung der zuvor stellenweise zugemauer­ ten Rundbögen, wodurch das Kloster auf seiner Hofseite einen eleganten durchge­ henden Säulengang erhielt. Schliesslich putzte der Architekt das Gelände um das Kloster heraus, definierte innerhalb seiner Flügel eine rechteckige Fläche, sodass die heutige Primarschule eine klare, leicht er­ kennbare Form hat und nun den Dorfplatz abgrenzt. Dieser wird überdies an der süd­ östlichen Seite durch die Kirche geschlos­ sen, welche in nächster Nähe zum Kloster steht. 2009 wurde Snozzi von der Gemeinde Monte Carasso gebeten, das Schulhaus zu erweitern. Da an der ausgesuchten Stelle keine historische Bausubstanz bestand, konnte Snozzi neu bauen. Für den Anbau der zwei neuen Schulzimmer wurde Sicht­ beton verwendet. Der Architekt führte die von ihm einst definierten horizontalen Li­ nien konsequent weiter, wodurch die neuen Seitenflügel mit einfachen Mitteln in das Vorhandene integriert werden. Eine pfiffige Lösung stellt die Formgebung des Anbaudaches dar. Diese weist den glei­ chen Schnitt auf wie die Dächer der fünf Klassenzimmer des Ostflügels, allerdings um ein Geschoss nach unten versetzt. Da­ durch «reimt» sich die neue Konstruktion auf die vorherige. In der Architektur ist der Umgang mit Bestehendem immer eine Gratwanderung zwischen dem Respekt vor der Geschichte und der Notwendigkeit zur Veränderung. Mit seiner Arbeit am Kloster von Monte Carasso zeigt Luigi Snozzi, wie dieser Balanceakt möglich ist. Abbildung 124: Das Dach des neus­ ten Anbaus aus Sichtbeton weist den gleichen Schnitt auf wie die Dächer der fünf Klassenzimmer des Ostflügels, aller­ dings um ein Ge­ schoss nach unten versetzt. Abbildung 125: Innenansicht der beiden neuen Schulzimmer. 131 Gebäudeerneuerung 132 Beispiele Abbildung 126: Der Anbau aus Sichtbeton bildet mit dem Bestand eine Einheit. 133 Gebäudeerneuerung 134 Beispiele +9.20 +9.20 +7.84 +5.15 +5.05 +2.57 +1.07 0.49 +0.03 0.56 0.41 0.29 0.15 ±0.00 0.12 -0.06 -0.13 0.17 -0.49 4.18 +9.20 9.20 7.84 5.15 5.15 7.84 6.28 4.43 7.84 +9.20 9.20 1.36 +9.20 0.35 9.20 5.15 4.99 9.20 4.77 2.57 4.77 2.57 2.02 2.02 0.55 cappella 0.56 0.56 +0.34 2.51 1.20 +0.00 +0.00 -0.12 0.41 0.17 +0.00 5 -0.49 3.59 -0.49 -3.40 RD NO A Abbildung 127: Längsschnitt und drei Querschnitte durch den Anbau von 2009. Abbildung 128: Grundriss der An­ lage. B B C C D D E E A Fotos und Pläne: Luigi Snozzi 135 Gebäudeerneuerung Haus Matten in Ballenberg Ein grosses Ausstellungsobjekt Das Freilichtmuseum Ballenberg stellt sich die Aufgabe, schweizerische Bau-, Archi­ tektur- und Kulturgeschichte zu würdigen. Unter den über hundert traditionellen Bauten der verschiedensten Epochen be­ findet sich eines, welches sich nicht an die Vergangenheit, sondern an die Zukunft richtet – das Haus Matten. Dieser Ende des 16. Jahrhunderts erbaute klassische Ber­ ner Oberländer Blockbau auf gemauertem Kellersockel gelangte 1977 in den Besitz des Museums, wo es seither steht. Um 2000 erhielt das Gebäude eine neue Funk­ tion. Im Rahmen des von der Schweizer Kulturstiftung «Pro Helvetia» getragenen Projektes «Tradition und Innovation» sollte am Beispiel des Hauses Matten aufgezeigt werden, dass in die Jahre gekommene Ar­ chitektur nicht modernen Bauten weichen muss, um Menschen zeitgemässe Wohn­ qualität zu bieten. Durch einen wohlüber­ legten Umbau können auch alte Gebäude heutige Anforderungen erfüllen. Das Konzept sollte gemäss Vorgaben der Bauherrschaft die originale Bausubstanz des Strickbaus so weit als möglich unange­ tastet belassen und gleichzeitig heutige Anforderungen an den Wohnkomfort er­ füllen. Zudem sollten die technischen Ein­ griffe und das Endergebnis aus ökologi­ scher Sicht vorbildhaft sein. Das Budget orientierte sich an einer Musterfamilie mit Durchschnittseinkommen. Der Architekt Patrick Thurston begann seine Arbeit mit einer eingehenden Analyse der vorhande­ nen Situation. Daraus ergab sich nicht nur ein tieferes Verständnis für die Kunstfertig­ keit des Objektes, das eine kraftvolle Form, harmonisch proportionierte Räume und eine beeindruckende, zweistöckige Rauch­ küche aufwies. 2007 wurde der Umbau vollzogen. Der Blockbau wurde innenseitig beinahe vollständig mit 10 cm dicken Tan­ nenbalken ausgekleidet. Dieser im Strick­ muster des Hauses gehaltene Überzug verleiht den Innenräumen elegante, ge­ rade Linien und helle Oberflächen. An manchen Stellen ist diese Verkleidung auf­ gelöst und lenkt den Blick auf die originale Bausubstanz darunter. Das ursprüngliche Haus wirkt wie ein Gemälde an der Wand der neuen Hülle. Obwohl durch diesen Eingriff Wohnfläche und etwas von der ursprünglichen Atmo­ sphäre verloren gegangen ist, so hat er doch den Vorteil, dass das Haus nun her­ vorragend gedämmt ist. Dadurch wurde eine raffinierte Lösung für die Heizung möglich: Unter der eisernen Hülle des his­ torischen Trittofens wurde ein Absorber eingebaut. Dadurch dient der Ofen als Ganzhausheizung. Ein neuer Anbau an der Giebelseite des Hauses erweitert das Raumangebot. Neu sind auch die Nasszel­ len. Die Decken des Obergeschosses, die zuvor zu niedrig (182 cm) waren, stossen nun als schwach geneigte Giebel in den Dachraum vor. Das Haus Matten steht als zeitgemässe Wohnung im Freilichtmu­ seum Ballenberg für alle Interessierte zur Besichtigung offen. Der Umbauprozess ist dargestellt und zeigt auf, dass ein histo­ risch wertvolles Gebäude mit vertretbarem Aufwand zu erneuern ist und ein sowohl architektonisch als auch kulturhistorisch lohnendes Resultat erreichbar ist. 136 Beispiele Abbildung 129: Das Ausstellungsob­ jekt mit dem giebel­ seitigen, neuen An­ bau. Abbildung 130: Situation 1031 Z (Foto und Plan: Patrick Thurston) 137 Gebäudeerneuerung Schemagrundriss Untergeschoss 1:100 Schemagrundriss Erdgeschoss 1:100 Abbildung 131: Grundriss Untergeschoss Abbildung 132: Grundriss Erdgeschoss Abbildung 133: Grundriss Obergeschoss (Pläne: Patrick Thurston) Schemagrundriss Obergeschoss 1:100 139 Gebäudeerneuerung Kapitel 15 Anhang Quellen ]]Minergie-P. Von Marco Ragonesi, UrsPeter Menti, Adrian Tschui, Benno Zurfluh. Das Haus der 2000-Watt-Gesellschaft. 3. Auflage. Zürich, Faktor Verlag 2010 ]]Aus Bauschäden lernen. Von Jürgen Blaich. Zürich, HEV 2008 ]]Im Detail: Gebäudehüllen. Von Christian Schittich (Hrsg.). 2. erweiterte Auflage. München, Detail 2006 ]]Clima Skin. Von Gerhard Hausladen, Mi­ chael de Saldanha, Petra Liedl. München, Callwey Verlag 2006 ]]Clima Design. Von Gerhard Hausladen, Michael de Saldanha, Petra Liedl, Christina Sager. München, Callwey Verlag 2004 Weiterführende Information Allgemeine Literatur ]]Atlas Sanierung. Von Georg Giebeler, Harald Krause, Rainer Fisch. Instandhal­ tung, Umbau, Ergänzung. München, De­ tail 2008 ]]Energie Atlas – Nachhaltige Architektur. Von Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Tho­ mas Stark, Martin Zeumer. München, De­ tail 2007 ]]Im Detail: Bauen im Bestand. Von Chris­ tian Schittich (Hrsg.). Innovative Konzepte für neue Nutzungen. München, Detail 2003 ]]Element 29. Wärmeschutz im Hochbau. Von Thomas Frank, Jutta Glanzmann, Bruno Keller, Andreas Queis­ser, Marco Ra­ gonesi. Zürich, Faktor Verlag 2010 ]]Element 30. Schallschutz im Hochbau. Von Jutta Glanzmann, Walter Lips, Rolf Meier, Werner Stalder. Zürich, Faktor Ver­ lag 2011 ]]Energetische Sanierung von Altbauten. Von Josef Maier. Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag 2009 Normen und Regelwerke ]]Norm SIA 180, Ausgabe 1999. Wärmeund Feuchteschutz im Hochbau ]]Norm SIA 232, Ausgabe 2000. Geneigte Dächer ]]Norm SIA 233, Ausgabe 2000. Beklei­ dete Aussenwände ]]Norm SIA 235, Ausgabe 1997. Dachde­ ckerarbeiten: Geneigte Dächer und beklei­ dete Aussenwände ]]Norm SIA 243, Ausgabe 2008. Verputzte Aussenwärmedämmung ]]Norm SIA 271, Ausgabe 2007. Abdich­ tungen von Hochbauten ]]Norm SIA 279, Ausgabe 2004. Wärme­ dämmstoffe ]]Norm SIA 331, Ausgabe 2008. Fenster und Fenstertüren ]]Norm SIA 380/1, Ausgabe 2009. Thermi­ sche Energie im Hochbau ]]Norm SIA 381.10, Ausgabe 2000. Bau­ stoffe und -produkte – Wärme- und feuch­ teschutztechnische Eigenschaften ]]Norm SIA 382/1, Ausgabe 2007. Lüf­ tungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen ]]Norm SIA 382/2, Ausgabe 2011. Klimati­ sierte Gebäude – Leistungs- und Energie­ bedarf ]]Merkblatt SIA 2001, Ausgabe 2009. Wärmedämmstoffe – Deklarierte Werte der Wärmeleitfähigkeit und weitere Anga­ ben für bauphysikalische Berechnungen ]]Merkblatt SIA 2021, Ausgabe 2002. Ge­ bäude mit hohem Glasanteil – Behaglich­ keit und Energieeffizienz ]]Merkblatt SIA 2028, Ausgabe 2010. Kli­ madaten für Bauphysik, Energie- und Ge­ bäudetechnik ]]Merkblatt SIA 2032, Ausgabe 2010. Graue Energie von Gebäuden ]]Merkblatt SIA 2040: Effizienzpfad Ener­ gie, 2011 ]]Dokumentation zu SIA 2040, 2011 Internet www.baufachinformation.de www.detail.de www.endk.ch www.faktor.ch www.sia.ch www.vdf.ethz.ch 140 Anhang Schlagwortverzeichnis Symbole 2-fach-Verglasung 49 3-fach-Verglasung 49 A Abdichtungen 54 Abwärmenutzung 100 Alarmwert 60 Altlasten 73 Altlastenuntersuchung 73 Analyse 25 Anlagekosten 14 Arbeitsgesetz 81 Argon 49 Asbest 76 Ästhetische Qualität 10, 26 Aufstocken 67 Aussendämmung hinterlüftet 45 Aussenlärm 60 Aussenraum 103 B Baubewilligung 32 Baugesetzliche Vorgaben 28 Bauherrschaft 32 Bauökologische Kriterien 88 Baurechtliches Potenzial 6 Baustoffe 14 Bauteiltrennung 79 Begegnungsort 116 Behindertentauglichkeit 104 Bergbauernhaus 113 Betriebsenergie 16 Betriebskosten 14 Beurteilung Bausubstanz 6 Bio-Diesel 95 Biogas 94 Blei 76 Blockheizkraftwerk 99 Blockheizkraftwerk Biogas 94 Blockheizkraftwerk Gas 94 BNL 28 Boden 16, 103 Brandabschlüsse 82 Brandschutz 81 Brandschutzkonzept 81 Brandschutznorm 81 Brandschutzvorschriften 81 C Cadmium 76 Chalet 113 Chrom 76 Coefficient of performance (COP) 97 D Dacheindeckung 53 Dachlattung 53 Dämmperimeter 55 Dämmputz aussen 45 Dampfbremse 57 Dampfdiffusion 57 Denkmalpflege 21 Discounted Cash Flow 38 Doppelte Nachhaltigkeitsrosette 16 Doppelverglasung 49 E Einbruchschutz 84 Einfachverglasung 49 Einregulierung 102 Einzelofen-Heizung 93 Elastomer 54 Elektroheizung 93 Elektrowärmepumpe 94 Energiekonzepte 85 Energieträger 93 Erdgas 93, 94 Ersatzneubau 7 Erschliessung 12 Erweiterungen 41 Estrichboden 55 F Fassaden 44 Fenster 49 Fernwärme 95 Feuchteschutz 57 Feuchtigkeitssperre 57 Flachdach 53 Flachkollektor 94 Flexibilität 79 Fossile Energieträger 95 Fundament 57 G Gasheizkessel 93 141 Gebäudeerneuerung Gebäudesubstanz 14 Gemeinschaft 12 Gesamtbewertung 86 Gesamtmodernisierung 6 Gestaltung 12 Gesundheit 14 Graue Energie 86 H Haustechnik 62 Heimatschutz 21 Heizöl 93, 94 Hinterlüftetes Kaltdach 54 Hochstudhaus 127 Holz 96 Holzkonstruktion 53 Holzschnitzel 94 I ICOMOS 21 Immissionsgrenzwert 60 Immobilienmarkt 14 Immobilienportfoliostrategie 31 Infrarot-Beschichtungen 49 Infrastruktur 16 Innendämmung 57 Investor 32 ISOS 28 J Jahresarbeitszahl (JAZ) 97 K Kaltmiete 37 Kapitalwert 38 Kastenfenster 50 Kaufkraft 37 Kehrichtverbrennung 94 Kellerdecke 56 Kollektorfläche 97 Kommunikation 8, 31 Kompaktdach 53 Kondensierender Heizkessel 93 Konterlattung 53 Krypton 49 Kulturelle Leistung 10 Kunststoffe 54 L Landschaft 16 Landschaftsarchitektur 104 Lärmschutz-Verordnung 59 Lebensdauer 18 Lebenszyklus 37 Lebenszykluskosten 12 Luftdichtigkeitsschicht 53 Luftschall 60 M Mängelbehebung 6 Mansardendach 53 Mietvertrag 32 Mineralfasern 76 Minergie 41 Minergie-Eco 88 Minergie-P 41, 111 Modulierender Heizkessel 93 Mustervorschriften der Kantone 41 N Nachhallzeit 63 Nachhaltigkeitsrosette 15 Neubauten 41 Norm SIA 112/1 17 Nutzung 12 O Ökobilanz 19 Ökobilanzdaten 94 Ökologie 86 Ökonomie 10, 86 Ölheizkessel 93 Optimierung 102 P Pellets 94 Pelletskessel 93 Photovoltaik 94 Photovoltaikanlage 99 Pinselrenovation 6 Planungsprozess 31 Planungswert 60 Polychlorierte Biphenyle 76 Potenzial 30 Primärenergie 86 Primärenergiefaktoren 94 142 Anhang Primärsystem 18, 19 Unterrichtsräume 63 Q Quecksilber 76 V Vegetation 104 Verbunddach 53 Verglasungen 49 VKF-Verordnung 83 R Raumakustik 62 Raumangebot 28 Räumliche Überforderung 22 Regenwasser 104 Retentionfilterbecken 106 S Schadstoffe 73 Schallschutz 59 Scheune 119 Schwermetalle 76 Sekundärsystem 18, 19 SIA Effizienzpfad Energie 42 Sicherheit 81 Sichtbezüge 104 Sickerleitung 57 Sickerpackung 57 Sickerwasser 104 Solarer Deckungsgrad 98 Solarstrom 98 Sonnenkollektoren 96 Steildach 53 Strategie 31 Stückholz 94 Systemtrennung 73, 78 T Technischer Brandschutz 83 Technische Überforderung 24 Technisierungsgrad 90 Tertiärsystem 18, 19 Tragwerk 65 Transformation 44 Treibhausgasemissionen 86, 95 Trennfuge 65 U UBP 86 UBP-Faktoren 95 Umbauen 70 Umkehrdach 54 Umweltschutzgesetzgebung 59 Unangemessenheit 24 Unterfangung 66 Unterhaltskosten 14 Unterkellerung 66 W Warmdach 53 Wärmepumpe 93 Wärmepumpen 96 Wasser 103 Wassersperrschicht 55 Wertschöpfung 14 Windkraft 94 Wohlbefinden 14 Z Zulässiger Wärmebedarf 41 ISBN: 978-3-905711-13-4