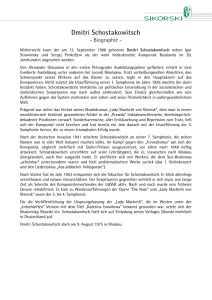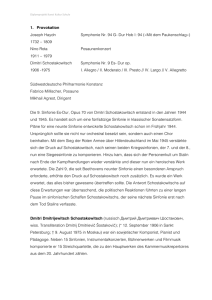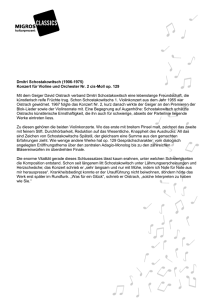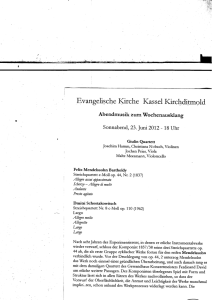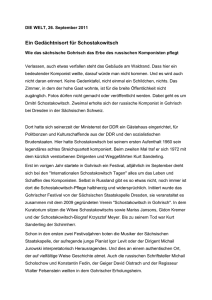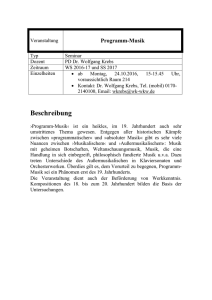wagner oquin maazel schostakowitsch
Werbung

WAGNER Vorspiel zu »Tannhäuser« OQUIN »Echoes of a Solitary Voice« MAAZEL »The Giving Tree« SCHOSTAKOWITSCH 5. Symphonie PAYARE, Dirigent HELL, Violoncello TURBAN MAAZEL, Sprecherin Mittwoch 23_11_2016 20 Uhr Freitag 25_11_2016 20 Uhr Das perfekte Weihnachtsgeschenk: das Familien-Abo der Münchner Philharmoniker Sonntag, 26_02_2017 11 Uhr Faschingskonzert mit Werken von Franz Schubert, Camille Saint-Saëns, Johann Strauß (Sohn) und Fritz Kreisler mit ZUBIN MEHTA und JULIAN RACHLIN Samstag, 27_05_2017 19 Uhr TSCHAIKOWSKY: 1. Klavierkonzert BERLIOZ: »Symphonie fantastique« Sonntag, 30_04_2017 11 Uhr BEETHOVEN: Violinkonzert DVOŘÁK: 9. Symphonie »Aus der Neuen Welt« Sonntag, 25_06_2017 11 Uhr BEETHOVEN: »Leonoren«Ouvertüre Nr. 3 SCHUMANN: Klavierkonzert BRAHMS: 2. Symphonie MAXIM VENGEROV, Dirigent und Violine SEMYON BYCHKOV, Dirigent JEAN-YVES THIBAUDET, Klavier KRZYSZTOF URBAŃSKI, Dirigent PIOTR ANDERSZEWSKI, Klavier Erwachsene zahlen für alle vier Konzerte 50 €, Kinder bis 14 Jahre 10 € (inkl. Gebühren). Buchbar ab 15_11_2016 ausschließlich im 4er-Abo bei der KlassikLine 089 54 81 81 400 und an den München Ticket-eigenen Vorverkaufsstellen. Nur solange der Vorrat reicht! Das Angebot gilt für höchstens 2 Erwachsene und maximal 5 Kinder pro KartenkäuferIn. Die Karten des Familien-Abos sind vom Termin- und Platztausch ausgeschlossen und können nicht zurückgegeben werden. RICHARD WAGNER Ouvertüre zu »Tannhäuser« (Dresdner Fassung) WAYNE OQUIN »Echoes of a Solitary Voice« LORIN MAAZEL »The Giving Tree« (Der gebende Baum) für Orchester, obligates Violoncello und Erzähler op. 15 DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47 1. Moderato 2. Allegretto 3. Largo 4. Finale: Allegro non troppo RAFAEL PAYARE, Dirigent MICHAEL HELL, Violoncello DIETLINDE TURBAN MAAZEL, Sprecherin 119. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Askese und Ekstase JÖRG HANDSTEIN RICHARD WAGNER (1813–1883) Geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig. 1860/61 entscheidend um: Die erste Szene wurde dabei zu einem großen Ballett ausgebaut, für das sich später die (nicht von Wagner stammende) Bezeichnung »Bacchanal« einbürgerte (Beendigung der Partiturreinschrift am 28. Januar 1861). Darüber hinaus hatte Wagner die Idee, die Ouvertüre zu kürzen und nahtlos in das Ballett übergehen zu lassen. Doch die Pariser Oper bestand auf der inzwischen auch in Frankreich sehr beliebten (vollständigen) Ouvertüre, und so konnte Wagner seinen dramaturgisch motivierten Einfall erst bei einer späteren Aufführung in Wien (1875) realisieren. ENTSTEHUNG URAUFFÜHRUNG Eine Oper über den legendären Minnesänger »Tannhäuser« plante Wagner bereits in Paris 1841. Bald nach seiner Rückkehr nach Deutschland, im Sommer 1842, entstanden der erste Librettoentwurf und frühe Skizzen, darunter der auch in der Ouvertüre anklingende Pilgerchor. Die Arbeit an der Partitur konnte Wagner allerdings erst knappe drei Jahre später beenden (am 13. April 1845). Für eine Aufführung an der Pariser Oper arbeitete er sie Erstfassung der Oper: Am 19. Oktober 1845 in Dresden im Königlich Sächsischen Hoftheater (Dirigent: Richard Wagner; R egie: Wilhelm Fischer; Bühnenbild: ­ Édouard-Désiré- Joseph Despléchin). Zweit­fassung der Oper: Am 13. März 1861 in Paris im Théâtre Impérial de l’Opéra / Salle de la rue Le Peletier (Dirigent: Pierre-­ Louis Dietsch; Regie: Richard Wagner; ­Choreographie: Lucien Petipa; Bühnenbild: Édouard-Désiré-Joseph Despléchin). Ouvertüre aus der Handlung in drei Aufzügen »Tannhäuser« (Dresdner Fassung) LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Richard Wagner: »Tannhäuser« 3 Ernst Benedikt Kietz: Richard Wagner (März 1850) Richard Wagner: »Tannhäuser« 4 SKANDAL MIT BREITENWIRKUNG Die Bühne bietet ein friedliches Bild: Ein junger Hirte hat sich vor einem idyllischen Tal zur Ruhe gesetzt und entlockt seiner Schalmei eine sanfte, naturhafte Weise. Im Publikum aber ziehen einige Herren in Glacéhandschuhen Trillerpfeifen hervor und entfachen einen wüsten Lärm. Es sind Mitglieder des erlesenen und tonangebenden Jockey-Clubs. Immer wieder erhebt sich das Geschrei und Gepfeife, die Oper muss mehrfach unterbrochen werden. Während der nächsten zwei Vorstellungen kommt es noch schlimmer; von der Musik ist kaum mehr was zu hören, Damen fallen in Ohnmacht, Herren prügeln sich oder fordern sich zum Duell. Die Pariser Premiere des »Tannhäuser« hat einen beispiellosen Skandal entfacht. Eigentlich wollte Wagner mit dieser Aufführung sein Prestige stärken und damit die Voraussetzung schaffen, endlich den »Tristan« auf die Bühne zu bringen. Nun aber blieb ihm nur der Rückzug nach Deutschland. Immerhin: Dieser »Tannhäuser« hinterließ einen bleibenden Eindruck, der Wagners Sache keineswegs schaden sollte. An der Pariser Oper herrschte im 19. Jahrhundert ein seltsames Gesetz: In jedem aufzuführenden Werk musste ein ausgedehntes Ballett getanzt werden, und selbst dessen Platzierung war vorgeschrieben: im zweiten Akt. Denn erst kurz zuvor pflegten die distinguierten Stammgäste ihr Dîner zu verlassen und zur Oper zu erscheinen. Aber das Ballett durften sie unter keinen Umständen verpassen, denn dem Auftritt der reizenden Ballerinen galt ihr Hauptinteresse, nicht der Musik und nicht der Handlung. Wagner hatte zwar das Ballett nicht verweigert, es aber in den ersten Akt gleich nach der Ouvertüre ver- pflanzt. Und so verschafften sich die Mitglieder des Jockey-Clubs ein Ersatzvergnügen und pfiffen. AUF DEM WEG INS MITTELALTER Schon einmal, in den Jahren 1839 bis 1842, hatte Wagner vergeblich versucht, die Kulturmetropole Paris zu erobern. Noch in der französischen Tradition der Grand Opéra komponierte er den »Rienzi« und hoffte, diesen auch an dem glorreichen Institut unterzubringen. Aber nur »Der fliegende Holländer« fand an der Opéra Interesse, allerdings auch nur der Text­ entwurf, den Wagner für 500 Francs verkaufte. Ein gewisser Pierre-Louis Dietsch – jener Kapellmeister, der später den Pariser Skandal-»Tannhäuser« dirigieren sollte – hat ihn dann vertont. Diese und ähnliche Erfahrungen brachten Wagner hellsichtige Aufschlüsse über die ökonomisch zweckorientierte »Kunstindustrie« – was seine ästhetisch und politisch neuartige Konzeption des Musiktheaters wesentlich prägen sollte. Doch sie brachten ihn auch ans Hungertuch, und er musste sich zunächst einmal an musikalisch »niedere« Lohnarbeit verdingen. Das Gefühl der Entfremdung weckte eine starke Sehnsucht nach der Heimat. Wagner begann sich für das deutsche Mittelalter zu begeistern – nicht für das historisch reale, sondern für jene ferne mythische Welt, wie sie sich die Romantiker erschlossen hatten. »In dieser Stimmung fiel mir das deutsche Volksbuch vom Tannhäuser in die Hände; diese wunderbare Gestalt der Volksdichtung ergriff mich sogleich auf das Heftigste: sie konnte dies aber auch erst jetzt.« Im Laufe des Jahres 1841 orientierte sich Wagner wieder in Richtung Deutschland. Er entwarf einen deutschen Text zum Richard Wagner: »Tannhäuser« 5 »Fliegenden Holländer«, und es gelang ihm, die Dresdner Hofoper für den »Rienzi« zu gewinnen. Im April 1842 machten sich die Wagners auf den Weg – über den Rhein, das sagenumwobene Sinnbild der deutschen Romantik, und vorbei an der Wartburg, dem Schauplatz seiner nächsten Oper. ZWEIMAL DIE LIEBE... Die Landschaften inspirierten Wagner, der über eine starke visuelle Phantasie verfügte, und die Idee des »Tannhäuser« nahm schon auf der Reise Gestalt an. Den Stoff hatte er aus zahlreichen literarischen Quellen geschöpft, Sagen, Gedichten, romantischen Erzählungen. Dabei interessierte ihn besonders die Verknüpfung zweier Sagenkreise: Die Legende des bei Venus wohnenden Minnesängers Tannhäuser und die Geschichte vom »Sängerkrieg auf der Wartburg«. Genau in die Schnittfläche dieser beiden Sagenkreise platzierte Wagner den tragischen Konflikt – und »Tannhäuser« wurde zum Drama. Möglich wurde dieser Geniestreich durch das Einfügen der Elisabeth als Gegenfigur zur Venus. Der Protagonist steht nun zwischen zwei Frauen, die zwei völlig verschiedene Formen der Liebe verkörpern: Venus die unverstellte Sinnenlust, die Triebkraft sexuellen Begehrens, Elisabeth eine geistige, geläuterte, ja asketische Liebe, die mit ethischen und religiösen Werten verbunden ist. Innerhalb des Dramas stehen nur diese Extreme zur Disposition. Eine Vermittlung kann es nicht geben. Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die alle dem Minne-Ideal huldigen, ist Tannhäuser von beiden Formen durchdrungen und steht damit zwischen zwei unvereinbaren Welten: der heidnisch-mythischen und der christlich-­ sittlichen. In gewissem Sinn ist er wie der »Fliegende Holländer« heimatlos und erlösungsbedürftig. Auch Reue und Mitleid spielen eine wesentliche Rolle. Damit flossen in die Figur des Tannhäuser mehrere von Wagners Grundideen ein. Und so konnte er trotz seiner vielen Quellen behaupten: »Diese Gestalt entsprang aus meinem Innern.« PILGER UND BACCHANTEN Anfang 1843 wurde Wagner in Dresden zum »Königlich Sächsischen Hofkapellmeister« ernannt und hatte einstweilen Anderes zu tun. Nur im Urlaub konnte er sich dem »Tannhäuser« widmen, so dass die Partitur erst im April 1845 fertig wurde. Im Gegensatz zum konventionelleren »Rienzi« hatte die neue Oper keinen großen Erfolg. Vielleicht waren die Sänger überfordert, vielleicht auch das Publikum. Aber seit sie Franz Liszt 1849 in Weimar auf die Bühne gebracht hatte, zogen viele Opernhäuser nach und verhalfen Wagner allmählich zu steigender Popularität. Auch die Ouvertüre gewann rasch an Beliebtheit – Wagner und Liszt setzten sie auch im Konzertsaal gerne auf das Programm. Von Beethovens dritter »Leonoren«-Ouvertüre hatte Wagner geschwärmt, das Werk sei »nicht mehr eine Ouvertüre, sondern das gewaltigste Drama selbst«. Dramatisch im eigentlichen Sinn ist die seine nicht, aber sie deutet bereits den Konflikt der folgenden Handlung an: Die unversöhnlichen Welten stehen sich in plakativen Kontrasten gegenüber: die christlich-­asketische mit dem weihevollen Pilger­chor, der als Hauptthema erklingt, und die heidnisch-­wollüstige mit den erregten ­Motiven des entfesselten »Bacchanals«. Zwei verschiedene Arten von Musik charakterisieren die konträren Sphären: Der Pilger­ Richard Wagner: »Tannhäuser« 6 chor schreitet in klaren Harmonien voran, in fest gefügter Tonalität, in glatt und ­flächig aufgetragenen Farben – wobei sein Thema bedauerlicherweise »von einer scheußlich jaulenden Streicherfigur beherrscht« werde, so der boshafte Hector Berlioz, die sich »mit einer für den Zuhörer erschreckenden Beharrlichkeit« wiederhole. Im Gegensatz zu dieser eher einförmigen Musik ist die der Bacchanten faszinierend wechselhaft. Flirrende Triller, verminderte Akkorde und chromatische Linien versetzen sie in unruhige Bewegung – ein gleißendes, sinnenverwirrendes Farbenspiel, ein flackerndes, züngelndes Feuer aus Klang. Es ist interessant, dass diese neuartigen, »modernistischen« Klänge, die in der Oper für die unterliegende Welt der Antike stehen, in der Musik­ geschichte später den Sieg davontragen werden. Richard Wagner: »Tannhäuser« 7 Lorin Maazels »Vermächtnis« MARTIN DEMMLER LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN WAYNE OQUIN (geboren 1977) »Echoes of a Solitary Voice« Geboren am 9. Dezember 1977 in Houston / Texas. ENTSTEHUNG Wayne Oquins Orchesterstück »Echoes of a Solitary Voice« entstand 2015 und basiert auf einem Fragment Lorin Maazels. Kurz vor seinem Tod im Juli 2014 hatte Maazel an einem Werk gearbeitet, das für den Malko-Dirigentenwettbewerb in Kopenhagen vorgesehen war. Er konnte die Arbeit nicht mehr vollenden. Seine Frau Dietlinde Turban Maazel bat daraufhin den amerikanischen Komponisten Wayne Oquin, das Manuskript der Fragment gebliebenen Partitur zu studieren und das Werk nach Möglichkeit zu vervollständigen. URAUFFÜHRUNG Am 30. April 2015 in Kopenhagen / Dänemark im Rahmen des Nikolaj-MalkoWettbewerbs für junge Dirigenten (Danish National Symphony Orchestra unter Leitung von David Nieman). Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 8 SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNG Es ist keine leicht Aufgabe, das Werk eines anderen Komponisten weiterzuführen und zu vollenden. Soll man sich den stilistischen Vorgaben der Vorlage anpassen ? Oder die eigene musikalische Sprache mit der des Komponistenkollegen unter einen Hut zu bringen versuchen ? Vielleicht auch die vorhandenen Skizzen lediglich als Ausgangsmaterial benutzen, um etwas ganz Neues zu kreieren ? Vor dieser schwierigen Entscheidung stand der amerikanische Komponist Wayne Oquin, als die Witwe des Dirigenten und Komponisten Lorin Maazel ihn bat, das letzte Werk ihres Mannes, an dem er bis kurz vor seinem Tod im Juli 2014 gearbeitet hatte, zu vollenden. Dass sie sich ausgerechnet an Oquin wandte, war kein Zufall, denn seit Langem stand er in engem Kontakt mit der Familie Maazel. AUSZEICHNUNGEN FÜR CHOR- UND BLÄSERMUSIK Geboren 1977 in Houston / Texas, studierte Oquin zunächst an der Texas State University und später an der renommierten Juilliard School of Music in New York, wo Milton Babbitt und Samuel Adler zu seinen Lehrern zählten. Seit 1996 hat er mehr als 30 Orchester-, Chor- und Kammermusikwerke vorgelegt, darunter Arbeiten für die King’s Singers, die Juilliard Symphony oder die New York Concert Singers. Zu seinen meistgespielten Kompositionen gehört das Chorstück »O Magnus Mysterium«, aber auch seine Arbeiten für Blasorchester erfreuen sich großer Beliebtheit. So erlebte sein Stück »Tower Ascending«, geschrieben für den Neubau auf Ground Zero, bereits mehr als 100 Aufführungen. Für seine Zusammenarbeit mit der Air Force Band wurde er mit der prestigeträchtigen Commander’s Medal of Excellence ausgezeichnet. UNLÖSBARE AUFGABE ? Geplant war das neue Orchesterwerk Maazels für den renommierten Malko-Dirigentenwettbewerb in Kopenhagen. Doch der Komponist konnte nur 16 Seiten der Partitur vollenden – das Werk blieb Fragment. Nachdem seine Witwe Dietlinde Turban Maazel das Fragment studiert hatte, bat sie Oquin, die Skizzen in ein eigenes Werk einzubeziehen, was dieser zunächst für eine fast unlösbare Aufgabe hielt. »Dieses Fragment zu komplettieren«, so Oquin, »wie Maazel es getan hätte, war für mich unmöglich. Ich entschied mich dafür, nicht weiter die unendlichen Möglichkeiten auszuloten, die er hätte wählen können. Stattdessen untersuchte ich sorgfältig, was er bereits komponiert hatte. Ich begann nicht bei einer einzelnen Skizze, um mich dann vorwärts zu tasten, sondern versuchte, die musikalische Essenz dieser unfertigen Skizzen auszuloten. Dabei bezog ich auch die gedankliche Welt früherer, abgeschlossener Werke Maazels mit ein: Seine Oper ›1984‹, seine symphonischen Arbeiten wie die ›Music for Violin and Orchestra‹, die ›Music for Cello and Orchestra‹, ›Farewells‹ oder ›The Giving Tree‹. Obwohl es sich bei ›Echoes of a Solitary Voice‹ um mein eigenes Werk handelt, sind die Spuren der ­Werke Maazels überall präsent«. SYMPHONIE IM MINI-FORMAT Das etwa acht Minuten lange Orchesterstück »Echoes of a Solitary Voice« besteht aus vier Teilen, wobei einem Abschnitt in raschem Tempo jeweils ein langsamer Teil folgt. Insgesamt ergibt sich so eine fast symphonische Anlage im Mini-Format. Das Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 9 Wayne Oquin Werk beginnt mit mächtigen, aufwärts führenden Gesten, die durch den Einsatz eines großen Schlagzeugapparates unterstützt werden. Es folgen kurze Blechbläserfiguren, aufgegriffen und fortgeführt von den Streichern. Eine markante Rhythmik und eine fast durchgängige Bewegung bestimmen diesen ersten Abschnitt. Nachtstückartig, sehr elegisch und stimmungsvoll kommt der zweite Teil daher. Das Tempo wird deutlich zurückgenommen, ­ melodiöse Elemente prägen diese getragene Passage. Der dritte Abschnitt erinnert an ein klassisches Scherzo. Streicherfigurationen, unterstützt vom Schlagzeug steigern sich bis zu einem Höhepunkt, mit dem gleichzeitig der vierte Teil beginnt. Wie schwebend und in sich kreisend erscheint hier der musikalische Satz. Mit kurzen M ­ elodiefragmenten in Violine, Klarinette, Flöte und Fagott, die langsam ­verklingen, endet das kurze Stück. Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 10 Eine Alternative zu »Peter und der Wolf« ? MARTIN DEMMLER LORIN MAAZEL (1930–2014) »The Giving Tree« (Der gebende Baum) für Orchester, obligates Violoncello und Erzähler op. 15 komponisten, Drehbuchautors, Dichters und Karikaturisten Shel Silverstein (1930– 1999). Dessen gleichnamiges, 1964 erstmals erschienenes illustriertes Buch avancierte schon bald zu einer der beliebtesten Kindergeschichten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zählt vor allem in den Vereinigten Staaten noch heute zu den meist gelesenen Kinderbuchklassikern. ENTSTEHUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 6. März 1930 in Neuilly-­surSeine (Île-de-France / Frankreich); gestorben am 13. Juli 2014 in Castleton (Virginia / USA). TEXTVORLAGE »The Giving Tree« basiert auf einem Text des amerikanischen Songwriters, Film­ Lorin Maazel komponierte »The Giving Tree« zu Beginn des Jahres 1998 als sein Opus 15. Neben dem Orchester sieht die Partitur einen Sprecherpart sowie ein ­obligates Solo-Violoncello vor. URAUFFÜHRUNG Am Ostermontag, dem 13. April 1998, in München in den Fernsehstudios des Bayerischen Rundfunks im Rahmen der Sendung »Tausendund...« (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Lorin Maazel; Solocellistin: Han-Na Chang; Sprecherin: Dietlinde Turban Maazel). Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 11 DIRIGENT UND KOMPONIST Lorin Maazel war ohne Zweifel einer der begnadetsten Orchesterleiter des 20. Jahrhunderts. Doch er teilte das Schicksal zahlreicher Dirigenten, die Musik nicht nur aufführten, sondern auch selbst schrieben. Als Komponisten wurden sie nur am Rande zur Kenntnis genommen. Das ging Hans von Bülow so, Wilhelm Furtwängler, André Previn und eben auch Lorin Maazel. Bei ihm kam noch erschwerend hinzu, dass er erst relativ spät zu komponieren begann. Doch die wenigen Orchesterstücke, seine Oper »1984« nach George Orwell ­s owie die narrativen Kindergeschichten »The Giving Tree« oder »The Empty Pot« werden bleiben, selbst wenn die Musik­ geschichte ihn vor allem als genialen ­Orchesterleiter verbuchen wird. WELTWEITE ERFOLGE Lorin Maazel, 1930 als Amerikaner in Frankreich geboren, begann bereits im ­Alter von fünf Jahren mit dem Violinspiel, zwei Jahre später erhielt er ersten Dirigier­ unterricht. Als musikalisches Wunder­kind war er bereits als 15-Jähriger am Pult aller großen Orchester in den USA gestanden. Am Ende seiner Dirigenten­karriere hatte er mehr als 150 Orchester in über fünftausend Opern- und Konzert­ aufführungen weltweit geleitet, wozu sich noch über dreihundert, mehrfach international preisgekrönte Einspielungen gesellen – kaum ein Dirigent war so emsig und engagiert wie Lorin Maazel. Ob als Künstlerischer Leiter der Deutschen Oper Berlin oder der Wiener Staatsoper und nicht ­zuletzt als Chefdirigent der Münchner ­Philharmoniker gegen Ende seines Lebens – er hat es stets verstanden, die Klang­körper, mit denen er musizierte, zu Höchstleistungen anzuspornen. Er war auch der erste Amerikaner, der in Bayreuth dirigierte und der Erste, der mit den New Yorker Philharmonikern in Nordkorea auftrat. KOMPOSITORISCHER »SPÄTZÜNDER« Als Komponist tat sich Maazel zunächst deutlich schwerer. Mit einer langjährigen Schreibhemmung gegenüber den großen Meistern erklärte er selbst später sein langjähriges Schweigen. Erst der Cellist Mstislav Rostropowitsch ermunterte ihn Ende der 1980er Jahre zu eigenen Werken. Aufsehen als Komponist erregte Maazel dann mit drei großformatigen konzertanten Orchesterwerken für Violoncello, Flöte und Violine, die 1998 in München ihre Uraufführung erlebten. Er versah sie mit den Opuszahlen 10 bis 12. Über die Werke, die zu den Opuszahlen 1 bis 9 gehörten, schwieg sich der Musiker in späteren ­Jahren aus. DIE GESCHICHTE VOM GEBEN UND NEHMEN Neben der Orchestermusik entwickelte Maazel eine besondere Vorliebe für erzählende, musikdramatische Werke. »The G iving Tree« für Orchester, obligates ­ Violon­cello und Sprecher op. 15 entstand im gleichen Jahr wie die drei konzertanten Orchesterwerke, 1998. Maazel selbst bezeichnete diese Komposition »als sehr zarte Geschichte über die Gleichgültigkeit zwischen den Menschen«. Diese Parabel über Geben und Nehmen zwischen einem Baum und einem kleinen Jungen war für ihn Sinnbild der Welt von heute: »Manche ­Menschen sind einfach unfähig zur Empa- Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 12 thie. Das ist letztendlich die Geschichte von dem Baum, der immer nur gab und dem Menschen, der immer nur nahm. Und das ist typisch für die Welt, in der wir leben, die Nutzer und die Benutzten.« Daher ist die Komposition für Maazel nicht nur ein Werk für das junge Publikum, auch wenn die Geschichte des Autors Shel Silverstein als Kinderbuch konzipiert war. In einer Programmheftnotiz erläuterte der Komponist, es sei auch »ein Versuch, das Repertoire der narrativen Musik zu bereichern, so dass nicht immer nur Prokofjews ›Peter und der Wolf‹ auf den Konzertprogrammen zu finden ist.« Lorin Maazel (2012) Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 13 Aus der ursprünglichen Idee, ein leichtes Stück für Kinder zu schreiben, sei schließlich doch wieder ein »tragisches« Werk entstanden, so Maazel. Verstanden wissen will er die Geschichte als Warnung vor dem Verlust jeglicher Empathie: »Als Kind denkt er nur an das, was er braucht. Immer. Er ist noch ganz unschuldig. Aber auch später sagt er nie ›Dankeschön‹ und nimmt alles, was er bekommen kann. Und am Ende seines Lebens versteht er es immer noch nicht und setzt sich hin auf den Rest seines Opfers.« DER JUNGE UND DER BAUM Die Rollenverteilung in diesem Werk ist eigentlich einfach. Der inneren Stimme des Jungen entspricht das obligate Violoncello, dessen zunehmend dunkler und melancholischer Ton den Altersfortschritt des Protagonisten spiegelt. Der Baum wird als weiblich definiert und so auch zu einer Art Mutter, die gibt, ohne eine Gegenleistung einzufordern. Im Orchesterapparat von »The Giving Tree« ist eine Reihe ungewöhnlicher Schlaginstrumente vorgesehen, wie eine Windmaschine, eine Lotusflöte oder eine Ocean Drum, die sich hervorragend zur Illustration der Szenerie eignen. ILLUSTRATION UND REFLEXION Maazel nutzt in diesem Werk alle Möglichkeiten der musikalischen Darstellung. Er illustriert, wie gleich zu Beginn, wenn Windmaschine und auffahrende Figuren in Flöten und Violinen das Rascheln der Blätter im Wind nachahmen, während die Lotusflöte Vogelrufe imitiert. Er zeichnet den Text nach, greift Schlüsselworte auf und spiegelt den gesamten Kosmos menschlicher Gefühle, ob Freude, wie beim ersten Auftritt des Jungen, oder melan- cholische Trauer, wie in der Passage, in der der erste Schatten auf die Beziehung zwischen Knaben und Baum fällt, weil der Junge Geld fordert. Hier sind es Englisch Horn und Fagott, mit deren Hilfe Maazel die Gefühle des Baumes schildert, der seine Äpfel gibt, um den Wunsch des Jungen zu erfüllen. GEFÜHLVOLLE KLANGBILDER Das Ausdrucksspektrum, mit dem der Komponist hier arbeitet, kennt viele Nuancen, Maazel findet für alle Gefühlsbereiche entsprechende Klangbilder. Wenn etwa der Baum vor Wiedersehensfreude fast in Sprachlosigkeit erstarrt, reduziert er den musikalischen Satz auf wenige Akzente von Schlagzeug und gedämpften Posaunen, und gerade in der Reduktion wirkt der Satz an dieser Stelle besonders eindringlich. Und wenn der Junge sich gegen Ende der Geschichte aus dem Stamm des Baumes ein Boot gebaut hat und damit davon segelt, illustriert Maazel dies mit den Klängen der Ocean Drum und ausdrucksvollen Glissandi in den Hörnern sowie einer rhythmisch höchst komplexen Passage, die jedes ­Metrum aufhebt und so grenzenlose Weite suggeriert. Einer der musikalischen Höhepunkte ist sicher der »Nostalgico« überschriebene Abschnitt, wenn der Junge sich auf den letzten verbliebenen Stumpf des Baumes setzt, um, nun selbst ein alter Mann, auszuruhen. Direkt anschließend bricht sich die Freude des Baums ein letztes Mal Bahn, bevor das Werk durchaus optimistisch, aber auch nachdenklich im Pianissimo endet. Wayne Oquin: »Echoes of a Solitary Voice« 14 Notizen zur Entstehung von »The Giving Tree« DIETLINDE TURBAN MAAZEL Vor nunmehr 23 Jahren kamen eine Handvoll entschlossener Eltern auf mich zu, mit der Idee, auf unserer Farm in Castleton, Virginia, ein »Family Learning Center« zu gründen, als Reaktion auf die radikalen Streichungen von Kunst und Musik in den öffentlichen Schulen der USA. Bald schien sich unser Traum zu erfüllen... An die vierzig Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren (meine eigenen Kinder eingeschlossen) und deren (hauptsächlich mittellose) Eltern reichten sich die Hände unter unserer 300 Jahre alten Buche – entschlossen, diesen Kindern eine von Kunst und Musik erfüllte Schulzeit zu bieten, inspiriert von den Ideen Rudolf Steiners, inmitten der milden, harmonischen Landschaft Virginias. Vier Jahre später hatten wir eine alte Hühnerfarm, die einst 15.000 Hühner beherbergte, und von der jeden Morgen Last­ wagen voller Eier nach Washington transportiert worden waren, in ein Theater umgewandelt, das sich in seiner Schönheit, wenn auch nicht Größe, mit dem englischen Globe Theatre messen kann. Nie werde ich den Anblick der vielen Kinder vergessen, die mit großen Augen vom Balkon hängend am 21. Juni 1997 ihr erstes klassisches Konzert erlebten – ein Tschaikowsky Trio mit Lorin Maazel, Mstislav Rostropowitsch und Yefim Bronfman ! Am Tag darauf bat mich eine »Kommission« dieser Kinder, ein Musikprogramm zu etablieren. Wir mieteten Instrumente aller Art und starteten gleichzeitig ein Theater-­ Programm. Shel Silverstein’s Geschichte »The Giving Tree« war das erste Theaterstück, das wir mit improvisierter Musik und unseren kleinen Akteuren aufführten. Mein Schwiegervater, Schauspieler und Sänger – damals 94 Jahre alt – war unser Erzähler. Von dieser Produktion fühlte sich Maestro Maazel angeregt, eine Komposi­ tion zu schreiben für großes Orchester, Violoncello Solo (der »kleine Junge«) und Sprecher. Sie wurde am 13. April 1998 in München im Rahmen unseres Osterkonzerts »Tausendund... live aus dem Prinzregenten­ theater« uraufgeführt. Diese liebenswürdige, doch tiefgründig meta­phorische Geschichte eines »Jungen«, der seinen »Freund Baum« ausnutzt bis zu dessen völliger Selbstaufgabe, hat mehr denn je an Bedeutung gewonnen und meinen Mann zu weiteren Kompositionen für Notizen zu »The Giving Tree« 15 Orchester und Sprecher angeregt, wie z. B. »The Empty Pot« (»Der leere Topf«) – eine weise chinesische Parabel. Jeremy Irons hob dieses Stück als Sprecher in ­London aus der Taufe. Ironischerweise bekamen wir von unserer Gemeinde in Virginia keine dauerhafte ­Lizenz für die angedachte Schule, aber der Geist der ganzheitlichen Bildung und der Passion für Musik und Theater hat unser Castleton nie verlassen: Die kleine »Dorfschule« verwandelte sich in das »Castleton Festival«, das wir im Sommer 2009 gründeten – eine Kombination von Musikfestspielen und Sommerakademie für junge Künstler, eine Art »Mekka« für die Stars von morgen. Notizen zu »The Giving Tree« 16 Selbstbehauptung oder Kniefall vor der Macht ? MARCUS IMBSWEILER DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH (1906–1975) Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47 1. Moderato 2. Allegretto 3. Largo 4. Finale: Allegro non troppo ENTSTEHUNG Unter dem Eindruck des vernichtenden »Prawda«-Artikels über seine Oper »Lady Macbeth von Mzensk« (»Chaos statt Musik«) zog Schostakowitsch seine nicht minder »modernistische« 4. Symphonie aus Angst vor weiteren »Maßnahmen« der sow­ jetischen Kulturbürokratie zurück und ließ sie über Jahrzehnte in der Schublade ruhen. Die folgende, vom 18. April bis 20. Juli 1937 in Leningrad komponierte 5. Symphonie war zu seiner »Rehabilitierung« vor dem Politbüro gedacht, wozu sie Schostakowitsch höchst selbstironisch als »die praktische schöpferische Antwort eines sowjetischen Künstlers auf eine berechtigte Kritik« ausgab. LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN URAUFFÜHRUNG Geboren am 12. (25.) September 1906 in St. Petersburg; gestorben am 9. August 1975 in Kunzewo, einem vornehmen Vorort von Moskau, wo auch schon Josef Stalin 1953 in seiner Datscha gestorben war... Am 21. November 1937 in Leningrad im Großen Saal der Leningrader Philharmonie anlässlich des 20. Jahrestags der Oktoberrevolution (Leningrader Philharmoniker unter Leitung von Jewgenij Mrawinskij). Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 17 Schostakowitsch in den frühen 1930er Jahren Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 18 STAATSKUNST ODER VIRTUOSES MASKENSPIEL ? Dmitrij Schostakowitsch galt lange Zeit als linientreuer sowjetischer Vorzeigekomponist, der sich mit dem politischem System seiner Heimat identifizierte, nicht anders als auf amerikanischer Seite ein Aaron ­Copland oder Samuel Barber. Die schein­ bare Beflissenheit, mit der sich seine textgebundenen Kantaten und Symphonien in den Dienst des Regimes stellten, erschwerte naheliegenderweise ihre Aufnahme im Westen. Neben enthusiastischer Parteinahme durch namhafte Dirigenten wie ­A rturo Toscanini, Bruno Walter und Otto Klemperer blieben weithin Bedenken gegenüber Kompositionen, die sich stark an offizielle Vorgaben anlehnten. Je deutlicher Schostakowitschs Werke gesellschaftliche Realität transportierten oder gar abbildeten, desto zwiespältiger reagierte man außerhalb des kommunistischen Einflussbereichs. Ironischerweise kehrte sich bei einer Symphonie, der »Siebten«, das Verhältnis um: 1942 im belagerten Leningrad entstanden und unter atemberaubenden Umständen uraufgeführt, wurde sie in den USA als antifaschistische Hymne populär. In Zeiten des gemeinsamen Kampfes gegen Hitler begrüßte man eine solche künstlerische »Stellungnahme«, während die Vorbehalte insgesamt blieben: Bis heute haftet den Symphonien Schostakowitschs der Verdacht des Tendenziösen an, des Zweckgebundenen und damit Zweitrangigen. Staatskunst, so der Vorwurf, ist minderwertige Kunst. Diese Einschätzung Schostakowitschs und seiner Werke musste spätestens 1979 revidiert werden, als Solomon Volkow unter dem Titel »Zeugenaussage« Erinnerungen des Komponisten veröffentlichte. Deren unerwartete Radikalität rückte die Person Schostakowitschs in ein neues Licht. Aus dem unreflektierenden Vertreter einer staatsbestimmten Ästhetik wurde ein auto­ nomer Künstler, der zeitlebens virtuos mit Masken spielte; ein stets gefährdeter, zur Konformität verdammter Opponent. Mehr noch: ein Mensch, dessen Widerstand – und spätestens hier wird es spannend – Eingang in seine Kompositionen fand. Zahl­ reichen Werken, wenn nicht allen, ist ein verborgener Hintersinn, ein Subtext eingeschrieben, der von der offiziellen Fassade verdeckt wird. Die Echtheit dieser Memoiren war und blieb umstritten – mit gutem Grund; schließlich mangelte es der »Zeugen­ aussage« an weiteren Zeugen. Seither aber bestätigten weitere Veröffentlichungen, in der Hauptsache Briefeditionen und Biographien, Volkows Befund: dass der »wahre«, der künstlerisch autonome Schostakowitsch gezwungen war, sich hinter einem sorgsam gewählten Schutzwall zu verbergen. AM ANFANG ALLER DINGE: DIE HOFFNUNG Dabei hatte alles vielversprechend be­ gonnen. Der junge Komponist, seit seiner ­ingeniösen 1. Symphonie schlagartig eine Berühmtheit, wurde von offizieller Seite zu weiteren Werken ermuntert. Wie viele euro­ päische Intellektuelle der Zwanziger Jahre empfand sich Schostakowitsch nicht als weltabgewandter, einsiedlerischer Artist, sondern als Staatsbürger, der mit seiner Tätigkeit zum Wohl aller beiträgt. Und tatsächlich schien Lenins Regime eine Zeitlang progressive Tendenzen zu begünstigen oder wenigstens zu dulden. Das änderte sich tiefgreifend unter der totalitären Herrschaft Stalins, der sämtliche Lebensbereiche unter seine Kontrolle zu bringen versuchte. Die Kunstsparten inklusive: Um Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 19 sie zu reglementieren, bedurfte es einer staatlichen Vorgabe, einer von oben verordneten ästhetischen Richtschnur. Sowjetische Kunst, d. h. offiziell geförderte, verbreitete und allein zugelassene Kunst folgte unter Stalin dem Ideal des »Sozialistischen Realismus«, einem ebenso schwammigen wie langlebigen Schlagwort, das bis zum Zusammenbruch des Kommunismus Konjunktur hatte. Für Schostakowitsch und seine Kollegen war der Schriftstellerkongress des Jahres 1934 von Bedeutung: Dort wurde der ­Sozialistische Realismus proklamiert und alles Kunststreben, das sich ihm verweigerte, als »Formalismus« verdammt. So lächerlich aus heutiger Sicht diese Etikettierungen scheinen, konnten sie dennoch über berufliche Schicksale, sogar über ­L eben und Tod entscheiden. Ihre Inhalte, nämlich was ein Kunstwerk jeweils zu ­einem realistischen bzw. formalistischen mache, mochten wechseln, das Ergebnis blieb das gleiche: Förderung, auch finan­ zielle, auf der einen Seite, Bloßstellung, Anprangerung der »Missbildungen«, Berufsverbot bis hin zu Verfolgung und Haft auf der anderen. Dabei verweist das unangenehme Wort von den Missbildungen eines Werks auf die Parallelen zur »Entarteten Kunst« der Nationalsozialisten; dass beide Diktatoren, Hitler wie Stalin, Volkes Führer­ schaft auch in ästhetischer Hinsicht für sich reklamierten, passt zu ihrem totali­ tären Staatsverständnis nur allzu gut. STAATSDIKTATUR UND MUSIK Schostakowitsch war noch keine dreißig, als das Regime unmissverständlich Gefolgschaft einklagte. Man muss davon ausgehen, dass er seither bis zu seinem Tode nie mehr »frei« komponiert hat, d. h. keine Musik mehr schrieb, ohne deren konkrete Aufführungsumstände – die Reaktion des Publikums, der Offiziellen, der Kritiker usw. – mitzubedenken und in seine Partituren einfließen zu lassen. Markanteste Daten staatlicher Repressionen zu Leb­ zeiten Schostakowitschs sind die Jahre 1936/37 mit ihren brutalen Schauprozessen, 1948 mit der Neuorganisation des totalitären Staates nach dem Weltkrieg und 1952/53, als der Stalinkult schwindel­ erregende Ausmaße einnahm. 1948 wurde der verheerende Vorwurf des Formalismus wiederbelebt und gegen Chatschaturjan, Prokofjew, Mjaskowskij, Schebalin gewendet; mithin gegen die komplette kompositorische Elite des Landes einschließlich Schostakowitsch, der sämtliche Lehrämter verlor und sich jahrelang mit Arbeiten für den Film über Wasser halten musste. Kaum weniger beschämend muten die Maßnahmen des Jahres 1952 an, als man Künstler aller Sparten zur Lektüre von Stalin-Texten (»Das Typische im künstlerischen Schaffen«) verdammte. Solche Begebenheiten werfen ein bezeichnendes Licht auf die Situation der Intellektuellen im Sowjetstaat. Die Kontrolle durch das Regime reichte im Einzelfall bis hinein ins Privateste; Kritik äußerte der einzelne nur gegenüber engsten Vertrauten und vorzugsweise mündlich. In welcher Gefahr Schostakowitsch selbst schwebte, ist bislang nicht zu entscheiden. Fest steht aller­ dings, dass einige seiner Bekannten und Künstlerkollegen ihre Unbotmäßigkeit mit dem Leben bezahlten. Der bekannteste Fall ist der des Regisseurs Wsewolod Meyerhold, der 1937 verhaftet wurde und im ­G efängnis unter ungeklärten Umständen starb; seine Frau wurde ermordet. Und 1953 saß Schostakowitschs Komponistenfreund Mieczyslaw Wainberg in Haft, dessen Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 20 Schwiegervater vom Geheimdienst liquidiert worden war; nur dem Tauwetter nach Stalins Tod verdankte Wainberg seine Entlassung. TAKTIEREN, NICHTS ALS TAKTIEREN Um einem solchen Schicksal zu entgehen, verlegte sich Schostakowitsch wie viele Künstler, die im grellen Licht der Öffentlichkeit standen, aufs Taktieren. Im Umgang mit seinen engsten Vertrauten, kaum einer Handvoll Personen, bediente er sich einer Art Geheimsprache, in der immer wiederkehrende Formeln, standardisierte Kommentare einen Code für Eingeweihte bildeten. Wenn er an seinen Sekretär und lebenslangen Freund Isaak Glikman schrieb, es gehe ihm äußerst »gut«, wirklich »beneidenswert«, geradezu »hervorragend«, so war dies ein sicheres Anzeichen für anhaltende Depressionen. Sang er brieflich das Loblied auf den Genossen S talin und gebrauchte dazu die vorge­ stanzten Formulierungen der offiziellen Parteipropaganda, handelte es sich um hilflosen Sarkasmus. Ein Neujahrsgruß an Isaak Glikman zeigt, welch bitterer Ton dabei mitunter angeschlagen wurde. »Mein teurer Freund«, schreibt Schostakowitsch am 31. Dezember 1943, und man beachte, dass alle Briefe dieser Zeit durch die Hände der Kriegszensur gingen, »danke, dass Du mich nicht vergisst. Jetzt ist der letzte Tag des Jahres 1943, 16 Uhr. Draußen tobt ein Schneesturm. Das Jahr 1944 bricht an. Ein Jahr des Glücks, ein Jahr der Freude und ein Jahr des Sieges. Dieses Jahr wird uns viel Gutes bringen. Die freiheitsliebenden ­Völker werden nun endlich das Joch des Hitler-Faschismus abwerfen, und Friede wird in aller Welt herrschen, und wir wer- den unter der Sonne von Stalins Verfassung ein neues, friedliches Leben führen.« MUSIK MIT DOPPELTEM BODEN Ein seltsam emotionsloser Ton, in dem hier von einer besseren Zukunft unter Hammer und Sichel gesprochen wird. Dass es sich bei der stereotypen Aufzählung zu erwartender Glücksmomente um die Stimmungslage totaler Desillusion handelt, bestätigt Glikman in seinen Anmerkungen. Die B efreiung vom Nationalsozialismus hat ­ Schostakowitsch, dies braucht nicht betont zu werden, herbeigesehnt; aber dass alle Opfer der russischen Bevölkerung dem Tyrannen Stalin zugute kommen sollten, verbitterte ihn zutiefst. Das Licht am Ende des Weges: Es ist die »Sonne von Stalins Verfassung« (eine kanonisierte Formel aus den Vorkriegsjahren), die genau das ­G egenteil erwarten lässt, nämlich totale Finsternis, Rückkehr zu alten Verhältnissen. »Wie Du mir doch fehlst«, beendet Schostakowitsch seinen Brief, »um mich gemeinsam mit Dir über die ruhmreichen Siege der Roten Armee mit ihrem großen Feldherrn an der Spitze, dem Genossen Stalin, zu freuen« – eine Wendung, die den Adressaten an beider Privatvergnügen erinnert, sich über Reden und Proklamationen führender Parteipolitiker lustig zu machen. Diese Taktik der Verstellung, der Aushub eines doppelten Bodens, blieb nicht auf briefliche Äußerungen beschränkt. Auch seinen Kompositionen, so bestätigt Glikman, schrieb Schostakowitsch immer wieder solche Subtexte ein. Und damit sind wir bei der 5. Symphonie. Betrachten wir die Entstehungsumstände etwas genauer: Nach frühen Reglementierungen während der Kulturrevolution von 1929, die er unbeschadet überstanden hatte, war Schosta- Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 21 Isaak Glikman und Dmitrij Schostakowitsch in Komarowo (1953) Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 22 kowitschs Rang als führender Jungkomponist gefestigt. Seine zweite Oper »Lady Macbeth von Mzensk« wurde in Moskau und Leningrad mit sensationellem Erfolg gespielt (190 Aufführungen), die 1. Symphonie und das 1. Klavierkonzert genossen internationale Anerkennung. Sicher konnte man Schostakowitsch nicht als populären Künstler bezeichnen – immerhin bediente er sich einer progressiven, an Mahler und Strawinsky orientierten Musiksprache –, aber man verstand seine Kompositionen als Ergebnis der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zeitfragen, und er selbst sah sicher bis in die 30er Jahre hinein keine Veranlassung, von diesem Engagement abzurücken. »CHAOS STATT MUSIK« Am 28. Januar 1936, mitten in der Arbeit an seiner 4. Symphonie, erschien in der Prawda unter dem Titel »Chaos statt Musik« ein Artikel, der mit Schostakowitsch und speziell mit seiner erfolgreichen Oper abrechnete; Initiator der Attacke war möglicherweise Stalin selbst. Ein zweiter Artikel wenige Tage später nahm sich die Ballettmusik vor und schlug in die gleiche Bresche: Schostakowitsch komponiere »disharmonisch, chaotisch, kleinbürgerlich, vulgär«, somit nicht mehr stellvertretend für die sozialistische Gemeinschaft. Flugs wurde die »Lady Macbeth« vom Spielplan abgesetzt; Schostakowitsch galt von einem Tag auf den anderen als Volksfeind. »Ich hatte entsetzliche Angst«, gestand er rückblickend Volkow, nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um das seiner Verwandten. Zu allem Überfluss b eschäftigte er sich gerade mit einer ­ ­Symphonie, die den eingeschlagenen experimentellen Weg fortsetzte und in dieser prekären Situation dem Regime neue Argumente liefern musste. Auf Druck von oben zog Schostakowitsch die »Vierte« während der Proben zurück; erst 25 Jahre später wurde sie uraufgeführt. ERZWUNGENES JUBELN: DIE 5. SYMPHONIE Im folgenden Jahr entstand die 5. Symphonie d-Moll, die als erster größerer Beitrag nach dem »Prawda«-Angriff mit Spannung aufgenommen wurde. Wie würde Schostakowitsch die Kritik verarbeitet haben ? Würde er sich einer verständlicheren Sprache bedienen und wieder enger an die Tradition anknüpfen ? In der Tat: Das Werk, zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution aus der Taufe gehoben, bereitete den Hörern offenbar wenig Schwierigkeiten. Zeitzeugen berichten übereinstimmend von enthusiastischem Beifall; im 3. Satz sollen viele Zuhörer geweint haben. Der Dirigent der Uraufführung, Jewgenij Mawrinskij, hob am Ende in einer theatralischen Geste die Partitur über seinen Kopf, um zu zeigen, wem der Applaus gebühre, und in einer späteren Aufführung betraten Arbeiter die Bühne, um eine begeisterte Grußbotschaft an den Komponisten zu richten. Schostakowitsch war mit einem Schlag rehabilitiert. Doch es gab auch Andeutungen des Zweifels. Manche Kritiker zeigten sich von der Triumphgeste des Finales nicht überzeugt, hielten sie für aufgesetzt oder gar erzwungen. Und trafen damit, wenn man Volkow glauben darf, ins Schwarze. »Es gab nichts zum Jubeln«, soll Schostakowitsch erklärt haben. »Was in der ›Fünften‹ vorgeht, sollte meiner Meinung nach jedem klar sein. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen – so, als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu: ›Jubeln sollt ihr, Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 23 jubeln sollt ihr !‹« Wenn dies zutrifft, dann ergibt sich für den heutigen Hörer die spannende Aufgabe, dieser zusätzlichen Bedeutungsebene nachzuspüren: hinter der Fassade einen verborgenen Text zu entziffern, der von den Zwangsmaßnahmen stalinistischer Willkür erzählt. Allerdings sollte man sich der Schwierigkeiten dieses Unterfangens bewusst sein: Im begriffs­ losen Kosmos Musik nähern sich Jubel und erpresster Jubel bis zur Ununterscheidbarkeit an. Satz) zur Apotheose (4. Satz). Schostakowitsch bezeichnete rückblickend seine Symphonie als »schöpferische Antwort auf eine berechtigte Kritik«; ihr Programm kreise um das »Werden einer Persönlichkeit, die durch Prüfungen gegangen ist«. Aber noch diese scheinbar systemkonformen Verlautbarungen bieten unterschiedlichsten Auslegungen Raum. Wie lautet Schostakowitschs »schöpferische Antwort« ? Wohin führt die Entwicklung der Persönlichkeit ? Folgt man der Auffassung sowjetischer Interpreten, so führt die Entwicklung der »Fünften« von anfänglichen Konflikten (1. Satz) über folkloristische Einsprengsel (2. Satz) und besinnliche Momente (3. 1. SATZ: KONFLIKTPOTENTIALE Der 1. Satz bedient sich dreier Themen: eines kanonisch geführten Mottos mit scharfen Doppelpunktierungen, das nach Schostakowitsch mit seiner Frau Nina und seinem Freund Iwan Sollertinski (1932) Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 24 und nach zur Begleitung absinkt; eines ausgedehnten Klagegesangs in den Violinen als Hauptthema; sowie eines Seitenthemas, das sich in großen Tonsprüngen über einem pochenden anapästischen Rhythmus erhebt. Die Durchführung fungiert ganz klassisch als Konfliktfeld dieser Themen, bis sich mit dem Repriseneintritt die angestaute Spannung im Unisono löst – eine sehr traditionelle Satzgestaltung, die den Erwartungen des Publikums zweifellos entgegenkam. Zu beachten ist jedoch auch: erstens die extremen klanglichen Gegensätze, die jedes »klassische« Maß sprengen (betrifft die Lautstärke ebenso wie die Farbigkeit der Klänge); zweitens das Verlöschen des Satzes in einer Art von klanglicher Gegenwelt (Solo-Violine mit Celesta, Harfen und fernen Trompetenrufen); und drittens die brutale Militarisierung des Klagegesangs in der Durchführung durch Trommelsignale und primitiv-ungeschlachten Blechbläsersatz. Unklassisch ist hier sicher die Funktion der Reprise: nicht als Restitution, als Durchsetzung des Anfänglichen, sondern eher (wie bei Schubert) als lastende Erinnerung, als Entwurf einer gefährdeten Gegenwelt. 2. SATZ: OPERETTENTRAVESTIEN Auch das Scherzo bietet zunächst keine Verständnisschwierigkeiten. Burschikose Ländlerthemen umrahmen ein schlichtes Trio, eröffnet von der Solo-Violine, und irgendwann intonieren die Hörner frech die Paraphrase eines Operettenliedes (»Im Weißen Rössl am Wolfgangsee...«). Aber wieder steht eine zweite Ebene quer zur ersten: Die Satztechnik wirkt an vielen Stellen nicht bloß einfach, sondern plump; Instrumente spielen in »falscher« Lage, einzelne Viervierteltakte fungieren als Stolpersteine. Der klangliche Aufwand steht in keinem Verhältnis zur dürftigen motivischen Substanz, und allein das solistische Auftreten von Kontrafagott und schriller Es-Klarinette sollte aufhorchen lassen. Überdies stellt sich wieder die Assoziation Kasernenhof (oder Zirkus !) ein, wenn die kleine Trommel unpassenderweise das »Weiße Rössl«-­ Thema untermalt. Ein »Reigen schwungvoller Tanzmusik«, die »freudigen Seiten des Lebens«, wie die offizielle Kritik meinte ? Eher eine zwielichtige Illumination des ­Folkloristischen, das beständig ins Triviale, gar Rohe, Brutale zu kippen droht. 3. SATZ: TRAUERGESTEN Der 3. Satz – zumindest hierüber herrscht Einigkeit – bedient sich einer weitgehend unverstellten Diktion: einer sehr subjektiven »Seelensprache«, was nichts anderes heißt, als dass der Hörer die in kammermusikalischer Durchsichtigkeit erklingenden melodischen Gesten als Gesten von Trauer, Sehnsucht und Klage begreift. Bezeichnenderweise schweigt das Blech, das Streichorchester ist achtfach geteilt. ­Parallel zum 1. Satz steigert sich auch hier die Konfrontation der beiden Haupt­themen, die ihren bittend-tröstenden Charakter verlieren, zu einem tumultartigen Höhepunkt, der wie ein Aufschrei, eine jähe Anklage wirkt. Und wieder sinkt am Ende alles in sich zusammen, bleibt der sphärische Klang der Celesta und der beiden Harfen als Botschaft einer fernen, unerreichbaren Gegen­ welt übrig. Den resignativen Zug des Largo ausblendend, entdeckte die Sowjetkritik in ihm die besonnene »Haltung des bedenkenden Menschen«; Schostakowitsch merkte ironisch an, die Blechbläser müssten schweigen, um Kraft für das Finale zu sam- Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 25 meln. Als Indiz für die wahre Bedeutung und den Gehalt des Largo dürfte sein Erklingen während der Gedenkfeiern für den Regisseur Meyerhold im Jahre 1974 gelten. 4. SATZ: PSEUDOSIEGE Mit dem Konzept des sozialistischen Realismus stimmten die Grübeleien, die ungelösten Konflikte der ersten drei Sätze durchaus überein, sofern nur das Finale eine Wendung zum Positiven präsentierte. Immer wieder, anlässlich der 7., 8., 9. und 13. Symphonie, warf man Schostakowitsch mangelnden Optimismus seiner Schlusssätze vor – und unterstellte ihm damit ­Defätismus und Abweichlertum. Der große Erfolg der »Fünften« gründet wohl hauptsächlich in der totalen Erfüllung dieser Erwartungen. Einer wiederum oberfläch­ lichen Erfüllung, ist allerdings hinzuzufügen. Die Posaunenrufe zu Beginn machen, indem sie die Seufzermotive des Largo umkehren, unmissverständlich klar, dass nun die Klage auf den Kopf gestellt, von der Innen- zur Außenansicht gewechselt wird. »Entschlossenheit« las der regimetreue Kritiker in diesem Anfang und empfand ein zweites hymnisches Dur-Thema als »Bild des optimistischen Menschen«. Seltsam bloß, wie martialisch roh der Beginn instru­ mentiert ist (Blech unisono über Paukenschlägen); dass das Orchester dieses ­Thema deformiert und beschleunigt, bis pure ­B ewegungsenergie übrigbleibt; dass der Hymnus (Trompete) sich über eine gehetzte, atemlose Begleitung erhebt; und dass die Höhepunkte der Entwicklung stets von Schlagwerk und Blechbläsern beherrscht werden, während Holz und Streicher in Repetitionen oder Trillerbewegungen erstarren. Die Emphase ist unüberhörbar – aber sie wirkt gebremst, gefesselt. Nach einer langen Ruhephase mit solistischen Einwürfen führt niemand anderer als die kleine ­Trommel das Geschehen ins richtige Gleis zurück. Das Hauptthema wird in einem schier endlosen Crescendo zur Apotheose gesteigert, natürlich in D-Dur und natürlich als Blechbläserhymne, zu der die restlichen Instrumente bloß Staffage abgeben: durch ein stupides Einhämmern der Grundtonart, mit dem 250 Mal hintereinander erklingenden Ton a. Ein absurdes Zuviel; nicht anders als die sich emporschraubende, zum Zerreißen überdrehte Trompetenfanfare oder der Lärm des Schlagwerks (Triangelwirbel, Pauken). Ist dieser schleppend laute, gehemmte, schrille, archaisierte Schluss eine Apotheose ? Vermutlich trifft man die Doppelbödigkeit der Komposition am ehesten, wenn man sie als exakten Ausdruck von Schostakowitschs kompositorischem Dilemma begreift. Den politischen Druck, ein massenwirksames, an bestimmten Normen orientiertes Opus abzuliefern, gestaltet sie musikalisch nach – und indem ihr dies meisterhaft gelingt, bewahrt sie ihren Schöpfer vor dem Gesichtsverlust. Bleibt als letztes Rätsel die Borniertheit der Diktatoren: Ist den Sowjets dieses Spiel auf zwei Ebenen tatsächlich entgangen ? Haben sie im Finale nur den Optimismus gehört, nicht aber das Ächzen des Geknebelten ? Volkow zufolge äußerte sich der Komponist eindeutig. Das Finale, kommentierte er, »ist doch keine Apotheose. Man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht zu hören.« Dmitrij Schostakowitsch: 5. Symphonie 26 Rafael Payare DIRIGENT Der 1980 in Venezuela geborene Dirigent war zunächst Teilnehmer des inzwischen welt­ berühmten musikalischen Jugendförderung-­ Programms »El Sistema«, wo er Horn studierte und anschließend als Hornist im Simón Bolívar Orchester tätig war. 2004 begann Rafael Payare sein Dirigierstudium bei »El Sistema«-Gründer José Antonio Abreu und dirigierte in der Folge alle größeren Orchester Venezuelas, darunter das Simón Bolívar Orchester auf seiner Kanada-­ Tournee 2009. 2012 erreichte den jungen Venezolaner die Einladung Daniel Baren- boims, als Assistent an der Neuproduktion von Richard Wagners »Siegfried« an der Berliner Staatsoper mitzuwirken. Nachdem er im selben Jahr den Nikolaj-Malko-Dirigierwettbewerb in Kopenhagen gewonnen hatte, wurde Rafael Payare umgehend von seinem Mentor Lorin Maazel als Gastdirigent zu dessen Castleton Festival in Virginia / USA eingeladen. 2015 wurde er dort als Nachfolger Maazels zum »Principal Conductor« ernannt. Eine enge Freundschaft verbindet ihn auch mit Krzysztof Penderecki, der ihn neben ­Valery Gergiev und Leonard Slatkin dazu einlud, das Festkonzert zu seinem 80. Geburtstag in Warschau zu dirigieren. Seit 2014 ist Rafael Payare Chefdirigent des nordirischen Ulster Symphony Orchestra und gab im Januar 2015 sein Debüt bei den Wiener Philharmonikern mit drei Konzerten, für die ursprünglich noch Lorin Maazel als Dirigent vorgesehen war. Als einer der begehrtesten Nachwuchs-Dirigenten weltweit debütierte Rafael Payare bereits beim London und dem Chicago Symphony Orchestra sowie den Philharmonic Orchestras von Rotterdam, Los Angeles, Göteborg und Stockholm. Weitere Einladungen erfolgten vom City of Birmingham Symphony, dem Philharmonia Orches­ tra London, dem Orchestre de la Suisse ­Romande, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France und dem NHK Symphony Orchestra. Die Künstler 27 Dietlinde Turban Maazel Michael Hell SPRECHERIN VIOLONCELLO Dietlinde Turban Maazel machte mit neunzehn Jahren als Gretchen in Michael Degens »Faust«-Inszenierung am Münchner Residenztheater auf sich aufmerksam. Danach folgten neben dem Theater zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. 1982 erhielt sie den Bad Hersfeld-Preis als beste Darstellerin (Desdemona in »Othello«) und wurde 1983 mit dem Bambi als Fernsehdarstellerin des ­Jahres ausgezeichnet. In »Mussolini and I« (»Ich und der Duce«) spielte sie an der Seite von Anthony Hopkins. Zusammen mit ihrem Mann, dem Dirigenten Lorin Maazel, gründete sie 2009 auf ihrem Landgut in Virginia das Castleton Festival, eine Kombination von Musikfestspielen und Sommerakademie für junge Künstler. Dietlinde Turban Maazel lebt in New York, ist als Regisseurin tätig, hat eine Professur für Schauspiel an der Rutgers University und hält Kurse für Liedinterpretation und Darstellung (International Vocal Arts Institute) in den USA und Kanada. Michael Hell wurde als Sohn einer Musikerfamilie in Wien geboren und spielte bereits mit 16 Jahren in der Wiener Staatsoper und bei den Wiener Philharmonikern. Seit 1981 ist er Konzertmeister der Violoncelli bei den Münchner Philharmonikern. Als Solist, Kammermusiker und Lehrer konzertierte er auf allen Kontinenten und nahm CDs, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen auf. 2002 begann Michael Hell als Lehrer am Tiroler Landeskonservatorium zu unterrichten und wurde im April 2008 vom österreichischen Bundespräsidenten zum Professor ernannt. Michael Hell spielt auf einem Meisterinstrument von Januarius Gagliano aus dem Jahre 1736. Die Künstler 28 Münchner Klangbilder DIE KONZERTPLAKATE DER SPIELZEIT 2016/17 KLASSISCHER UNGEHORSAM »Was würden Sie tun, wenn Sie einen Diktator als Auftraggeber hätten? Wahrscheinlich das, wozu Sie gezwungen werden. So ging es Dmitrij Schostakowitsch: Er musste für Josef Stalin eine Siegeshymne komponieren, die Stalins Regime und die Rote Armee verherrlicht. Entstanden ist die 5. Symphonie. Besonders der Marsch am Ende des Stücks gefiel Stalin. Er ließ ihn auf Militärparaden ertönen, wenn Panzer rollten und Soldaten im Stechschritt marschierten. Auf meinem Plakat feiere ich gemeinsam mit Schostakowitsch Stalins Untergang. Es regnet Konfetti. Verkleidete, bunte Gestalten tanzen jubelnd um einen Panzer, der aus dem Kanonenrohr Konfetti spuckt. Hören Sie doch mal selbst in die 5. Symphonie hinein, hören Sie Stalins Untergang am Ende?« (Tamara Napowanez, 2016) DIE KÜNSTLERIN Tamara Napowanez ist Junior Art Director bei der Heye GmbH in München. Während Stalin seine Hymne genoss, sprach die Musik eine andere Sprache zum Volk. Wer sie verstand, hörte einen Aufschrei nach Individualität, Freiheit und Gerechtigkeit. Denn Schostakowitsch war ungehorsam und tat nicht das, was man ihm befohlen hatte – er versteckte eine geheime Botschaft in seiner Komposition: für ihn war die 5. Symphonie keine Sieges-, sondern eine Todeshymne auf den Stalinismus. Das behaupteten zumindest Schostakowitschs Freunde und Kenner seiner Musik. Tamara Napowanez 29 Freitag 09_12_2016 20 Uhr b Samstag 10_12_2016 19 Uhr d Sonntag 11_12_2016 11 Uhr m Sonntag 18_12_2016 11 Uhr 3. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz »FRÜH ÜBT SICH« DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 107 PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKY »Manfred«, Symphonie h-Moll op. 58 in vier Bildern nach Byron SEMYON BYCHKOV Dirigent GAUTIER CAPUÇON Violoncello Mittwoch 14_12_2016 20 Uhr f Donnerstag 15_12_2016 20 Uhr g4 Freitag * 16_12_2016 20 Uhr c FRANZ SCHUBERT Sonata (Sonatensatz) für Klavier, Violine und Violoncello B-Dur D 28 LUDWIG VAN BEETHOVEN Klaviertrio Es-Dur op. 1 Nr. 1 PABLO QUASS »Schwebende Fäden« für Violine, Violoncello und Klavier CLAUDE DEBUSSY Klaviertrio G-Dur VERDANDI-TRIO: IIONA CUDEK Violine ELKE FUNK-HOEVER Violoncello MIRJAM VON KIRSCHTEN Klavier RICHARD STRAUSS »Also sprach Zarathustra« op. 30 ANTON BRUCKNER Symphonie Nr. 9 d-Moll VALERY GERGIEV Dirigent Vorschau 30 Die Münchner Philharmoniker 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz Vladimir Tolpygo Georg Pfirsch 2. VIOLINEN Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Schmitz Ana Vladanovic-Lebedinski Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich Asami Yamada BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler VIOLONCELLI Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth Das Orchester 31 KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich Zeller FLÖTEN Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte POSAUNEN OBOEN PAUKEN Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE Dany Bonvin, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach Michael Leopold HARFE Teresa Zimmermann, Solo CHEFDIRIGENT Valery Gergiev Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott EHRENDIRIGENT HÖRNER INTENDANT Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Paul Müller Zubin Mehta ORCHESTERVORSTAND Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 32 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Lektorat: Christine Möller Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting Jörg Handstein, Martin Demmler und Marcus Imbsweiler schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler verfasste die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommen­ tare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographien: nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Abbildung zu Richard Wagner: Martin GregorDellin, Richard Wagner – Eine Biographie in Bildern, München 1982. Abbildung zu Wayne Oquin: ohne credit, dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt von Wayne Oquin. Abbildung zu Lorin Maazel: wild­ undleise.de. Abbildungen zu Dmitrij Schostakowitsch: Jürgen Fromme (Hrsg.), Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit – Mensch und Werk (Ausstellungskatalog), Duisburg 1984; Krzystof Meyer, Dmitri Schostakowitsch – Sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Mainz 1998. Künstlerphotographien: Henry Fair (Payare), wildundleise.de (Hell), ohne credit (Turban Maazel). Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt Impressum Die ersten Veröffentlichungen unseres neuen MPHIL Labels Valery Gergiev dirigiert Bruckner 4 & Mahler 2 zusammen mit den Münchner Philharmonikern mphil.de ’16 ’17 DAS ORCHESTER DER STADT