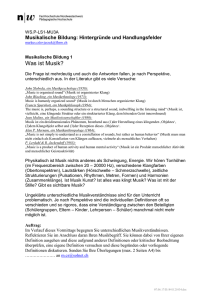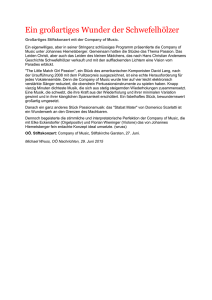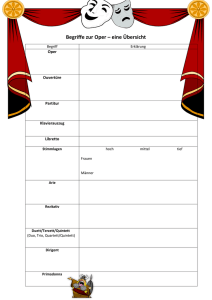Geschichte und Gesellschaft, 2012, 38. Jahrgang, Heft 1
Werbung

Redaktionsanschrift Geschichte und Gesellschaft, Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin, FB Geschichts- und Kulturwissenschaften, Friedrich-Meinecke-Institut, Koserstr. 20, D-14195 Berlin E-Mail: [email protected] (verantw. i. S. des niedersächs. Pressegesetzes) Olga Sparschuh, M.A., und Anna Barbara Sum, M.A. (Redaktionsass.): [email protected] Anfragen und Manuskriptangebote schicken Sie bitte an diese Adresse, möglichst per E-Mail. – Die Rücksendung oder Besprechung unverlangt eingesandter Bücher kann nicht gewährleistet werden. Geschichte und Gesellschaft (Zitierweise GG) erscheint viermal jährlich. Bestellung durch jede Buchhandlung oder beim Verlag. Preis dieses Jahrgangs im Abonnement € 71,- / 73,- (A) / sFr 94,90; Inst.-Preis € 142,- / 146,- (A) / sFr 185,-; für persönliche Mitglieder des Verbandes der Historiker Deutschlands (bei Direktbezug vom Verlag) € 59,- / 60,70 (A) / sFr 78,90; Einzelheft € 20,45 / 21,10 (A) / sFr 29,50, jeweils zzgl. Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten. – Abbestellungen können nur zum Ende eines Jahrgangs erfolgen und müssen dem Verlag bis zum 1.10. vorliegen. – Jetzt auch Online: www.v-r.de Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstr. 13, D-37073 Göttingen. Anzeigenverkauf: Anja Kütemeyer E-Mail: [email protected] (für Bestellungen und Abonnementverwaltung) Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. © 2012 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen Printed in Germany Satz: www.composingandprint.de Druck- und Bindearbeit: q Hubert & Co, GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Breite 6, D-37079 Göttingen. 1 Beilage: Vandenhoeck & Ruprecht. ipabo_66.249.66.96 Geschichte und Gesellschaft Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft Herausgegeben von Werner Abelshauser / Jens Beckert / Christoph Conrad / Sebastian Conrad / Ulrike Freitag / Ute Frevert / Wolfgang Hardtwig / Wolfgang Kaschuba / Simone Lässig / Paul Nolte / Jürgen Osterhammel / Margrit Pernau / Sven Reichardt / Rudolf Schlögl / Manfred G. Schmidt / Martin Schulze Wessel / Hans-Peter Ullmann Geschäftsführend Christoph Conrad / Ute Frevert / Paul Nolte Vandenhoeck & Ruprecht ipabo_66.249.66.96 Geschichte und Gesellschaft 38. Jahrgang 2012 / Heft 1 Herausgeber dieses Heftes: Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Geschichtswissenschaft und Musik Historical Science and Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jan-Friedrich Missfelder Period Ear. Perspektiven einer Klanggeschichte der Neuzeit Period Ear. Prospects of a Modern Sound History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sven Oliver Müller Die Politik des Schweigens. Veränderungen im Publikumsverhalten in der Mitte des 19. Jahrhunderts The Politics of Silence. Changes in Audience Behaviour in the Middle of the 19th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jürgen Osterhammel Globale Horizonte europäischer Kunstmusik, 1860 – 1930 Classical Music in a Global Context, 1860 - 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Sarah Zalfen Zeitmaschine Oper. Die Macht des historischen Erbes der Oper am Ende des 20. Jahrhunderts Timemachine Opera. The Power of the Operatic Heritage at the End of the Twentieth Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Diskussionsforum David Kuchenbuch „Eine Welt“. Globales Interdependenzbewusstsein und die Moralisierung des Alltags in den 1970er und 1980er Jahren “One World”. Discourses on Global Interdependency and the Moralisation of Everyday Life in the 1970s and 1980s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik von Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Warum sollten sich Historikerinnen und Historiker mit Musik beschäftigen? Öffnet das der Geschichtswissenschaft neue thematische Perspektiven und erschließt es ungewöhnliche Fragestellungen? In den Kulturwissenschaften wird alle Jahre wieder ein neuer „turn“ verkündet. Auf den linguistic turn folgte ein iconic turn oder visual turn. Ist es an der Zeit, einen acoustic turn oder musical turn auszurufen?1 Die folgenden vier Aufsätze vermeiden einen solch ehrgeizigen Anspruch. Sie sollen einen weiteren Beitrag dazu leisten, das Thema Musik aus einer Nische heraus und dichter an die Interessen einer „allgemeinen“ Geschichtswissenschaft heran zu führen.2 Weder eine „alte“ noch eine „neue“ Kulturgeschichte haben die Geschichtswissenschaft, jedenfalls vor etwa 1990, dazu verleiten können, sich eingehend mit Musik zu beschäftigen. Sogar die Bürgertumsforschung hatte Musik weniger stark beachtet, als dies aus der Perspektive der historischen Subjekte zu erwarten gewesen wäre.3 Auch der in zahlreichen Situationen öffentlich 1 Das ist das Schlagwort des gleichnamigen Sammelbandes von Petra Meyer (Hg.), Acoustic Turn, München 2008. Ähnliche Argumente finden sich bei Victoria Johnson, Introduction: Opera and the Academic Turns, in: dies. u. a. (Hg.), Opera and Society in Italy and France from Monteverdi to Bourdieu, Cambridge 2007, S. 1 – 26; Horst W. Opaschowski, Die kulturelle Spaltung der Gesellschaft. Die Schere zwischen Besuchern und Nichtbesuchern öffnet sich weiter, in: Bernd Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik, Bd. 5, Essen 2005, S. 211 – 215. Vgl. dagegen die kritischen Bemerkungen über die fehlende methodische Reichweite dieses Konzeptes bei Sven Oliver Müller, Analysing Musical Culture in Nineteenth-Century Europe. Towards a Musical Turn? in: European Review of History 17. 2010, S. 833 – 857; sowie die Überlegungen von Alexa Geisthövel, Auf der Tonspur. Musik als zeitgeschichtliche Quelle, in: Martin Baumeister u. a. (Hg.), Die Kunst der Geschichte. Historiographie, Ästhetik, Erzählung, Göttingen 2009, S. 157 – 168; Irmelin Schwalb, Tönende Zeitzeugen? Geschichte als Musik, in: Otto Borst (Hg.), Geschichte als Musik, Tübingen 1999, S. 10 – 31. Eine vorzügliche Analyse zum Stand der Forschung in der Geschichtswissenschaft liefert Daniel Morat, Zur Geschichte des Hörens. Ein Forschungsbericht, in: AfS 51. 2011, S. 695 – 716. 2 Den bisherigen Höhepunkt einer solchen Annäherung markieren die Kapitel über Musik in Thomas Nipperdeys Geschichte des 19. Jahrhunderts: ders., Deutsche Geschichte 1800 – 1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1983, S. 547 – 551; ders., Deutsche Geschichte 1866 – 1918, Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, S. 741 – 752. 3 Musikkompetenz wurde durch Gastbeiträge von Musikwissenschaftlern einbezogen, vgl. etwa Carl Dahlhaus, Das deutsche Bildungsbürgertum und die Musik, in: Reinhart Koselleck (Hg.), Bildungsbürgertum im neunzehnten Jahrhundert, Bd. 2: Bildungsgüter und Bildungswissen, Stuttgart 1990, S. 220 – 236. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 5 – 20 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X ISSN 0340-613X (E-Journal) 6 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel verbindende Charakter von Musik hat sie lange Zeit nicht als Kraft von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung für die Forschung attraktiv gemacht. Eine solche sozialintegrative Wirkung ist allen Künsten eigen; im Falle von Musik und Musiktheater ist sie besonders stark ausgeprägt.4 In den vergangenen zwanzig Jahren haben einige Historiker Versuche unternommen, die Musik mit der Geschichte zu verbinden, sie als Teil einer Geschichte von Gesellschaften zu begreifen. Der Pionier einer Sozialgeschichte der Musik im Europa des 19. Jahrhunderts war der kalifornische Historiker William Weber. In einer immer noch konkurrenzlosen Arbeit untersuchte er die musikalischen Institutionen und das Konzertpublikum in London, Paris und Wien in den 1830er und 1840er Jahren.5 Neuere Arbeiten zur historischen Dimension des Musiklebens, wie etwa die Monographien von Celia Applegate, Jennifer Hall-Witt und Christophe Charle, behandeln die Sinnlichkeit musikalischer Aufführungen und nationalistische und kulturelle Praktiken der Rezeption.6 Methodisch anregend bleiben ebenfalls die Studien Ute Daniels über das Hoftheater im 19. Jahrhundert und Anselm Gerhards über das Musiktheater in Paris – allesamt Arbeiten, die das wechselseitige Desinteresse 4 Dieser Zusammenhang wird z. B. deutlich bei Robert M. Isherwood, Music in the Service of the King. France in the Seventeenth Century, Ithaca, NY 1973; Peter Schleuning, Der Bürger erhebt sich. Geschichte der deutschen Musik im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2000; Rudolf Braun u. David Guggerli, Macht des Tanzes – Tanz der Mächtigen. Hoffeste und Herrschaftszeremoniell, 1550 – 1914, München 1993; Reinhard Kannonier, Zeitwenden und Stilwenden. Entwicklung der europäischen Kunstmusik, Wien 1984. 5 Vgl. William Weber, Music and the Middle Class. Social Structure of Concert Life in London, Paris and Vienna, London 20042 ; ders., The Great Transformation of Musical Taste. Concert Programming from Haydn to Brahms, Cambridge 2008. Richtungsweisend wurden auch: Simon McVeigh, Concert Life in London from Mozart to Haydn, Cambridge 1993; Tia DeNora, Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792 – 1803, Berkeley, CA 1995; James H. Johnson, Listening in Paris, Berkeley, CA 1995. 6 Vgl. Celia Applegate, Bach in Berlin. Nation and Culture in Mendelssohn’s Revival of the St. Matthew Passion, Ithaca, NY 2005; Christophe Charle, Thtres en capitales. Naissance de la socit du spectacle Paris, Berlin, Londres et Vienne 1860 – 1914, Paris 2008; Jennifer Hall-Witt, Fashionable Acts. Opera and Elite Culture in London, 1780 – 1880, Durham, NH 2007; David Gramit, Cultivating Music. The Aspirations, Interests, and Limits of German Musical Culture, 1770-1848, Berkeley, CA 2002; Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa, 1815 – 1914, Wien 2006; ferner die Beiträge in Johnson u. a., Opera; Hans-Erich Bödeker u. a. (Hg.), Le concert et son public. Mutations de la vie musicale en Europe de 1780 1914: France, Allemagne, Angleterre, Paris 2002; Christina Bashford u. Leanne Langley (Hg.), Music and British Culture, 1785 – 1914. Essays in Honour of Cyril Ehrlich, Oxford 2000; Müller, Analysing Musical Culture. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 7 von Geschichts- und Musikwissenschaft überwunden haben.7 Dennoch kann eine solche Konvergenz der Fächer mehrere Hindernisse nicht verdecken. Eine erste Schwierigkeit für die Geschichtswissenschaft besteht im Umgang mit der Forschungsleistung der Musikwissenschaft. Auch wenn Historiker vielfach die Theorieangebote aus der Literaturwissenschaft aufmerksam betrachtet und manchmal dankbar angenommen haben, so haben sie umgekehrt Fächergrenzen taktvoll beachtet und sich selten direkt zur Literatur geäußert. Noch größer ist die Zurückhaltung, in Konkurrenz zur Musikwissenschaft zu treten. Die technischen Hürden sind in diesem Falle höher als bei Literatur und Kunst. Über ein Gemälde oder ein Gebäude kann auch der Laie mit einer gewissen Zuversicht sprechen; der iconic turn in den Kulturwissenschaften hat dieses Selbstbewusstsein gestärkt. Wenn es nicht gerade um Spezialprobleme der Metrik geht, sind auch die Analysemethoden der Literaturwissenschaft kein Buch mit sieben Siegeln. Der werkanalytische Zugang zur Musik verlangt hingegen – auch als Voraussetzung ästhetischen Urteilens – Notenkenntnis und ein Wissen um die Grammatik und Semantik der musikalischen Sprache, das heißt um die Kunstfertigkeiten des Tonsetzens, das neben Arithmetik, Geometrie und Astronomie zum Quadrivium des exakten Wissens gehörte. Auch heute noch folgen viele Musikwissenschaftler der Tradition ihrer Wissenschaft als Philologie und immanente Werkanalyse, als am reinen Notentext orientierter Disziplin. Niemand kann der Musikwissenschaft ihre disziplinäre Hoheit streitig machen.8 7 Vgl. Ute Daniel, Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 1995; Anselm Gerhard, The Urbanization of Opera. Music Theatre in Paris in the Nineteenth Century, Chicago 1998; sowie Ruth Bereson, The Operatic State. Cultural Policy and the Opera House, London 2002; Mary Hunter, The Culture of Opera Buffa in Mozart’s Vienna. A Poetics of Entertainment, Princeton, NJ 1999; Walter Frisch, German Modernism. Music and the Arts, Berkeley, CA 2005; Michael Walter, „Die Oper ist ein Irrenhaus“. Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1997; Stephen C. Meyer, Carl Maria von Weber and the Search for a German Opera, Bloomington, IN 2003; Philipp Ther, Einleitung. Das Musiktheater als Zugang zu einer Gesellschafts- und Kulturgeschichte Europas, in: Sven Oliver Müller u. a. (Hg.), Die Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien 2010, S. 9 – 24. 8 Abweichungen von dieser Ausrichtung sind etwa die Arbeiten von Sieghart Döhring u. Sabine Henze-Döhring, Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert, Laaber 1997; Konrad Küster, Das Konzert, Form und Forum der Virtuosität, Kassel 1993; Walter Salmen, Das Konzert. Eine Kulturgeschichte, München 1988; Hanns-Werner Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform, 2 Bde., Wilhelmshaven 1983; Michael Forsyth, Bauwerke für Musik. Konzertsäle und Opernhäuser. Musik und Zubehör vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 1992; Udo Bermbach u. Wulf Konold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1992. 8 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Andererseits haben aber die Musik- und Theaterwissenschaften nur wenig Gewicht auf die Rezeption von Musik und ihre sozialen und politischen Implikationen gelegt. Die methodische und empirische Abgrenzung der Musik- und der Geschichtswissenschaft hat die Erkenntnismöglichkeiten beider Disziplinen beschränkt.9 Die Musikwissenschaft hat sich lange Zeit für wenig mehr als die Werke selbst, bestenfalls noch für die Biografien ihrer Urheber interessiert. Die soziale Rahmung der Produktion und des Konsums von Musik wurde nur am Rande beachtet; deren politische Funktionalisierung und ihr medialer Charakter sind nur peripher in ihren Gesichtskreis getreten. Probleme der Aufführung und interpretierenden Umsetzung des Notentextes in Klang galten bis zur Wiederentdeckung älterer Musizierpraktiken im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als wissenschaftlich wenig bedeutsam, als Stoff für das Feuilleton. Musikgeschichte war (und ist vielfach noch) Stilgeschichte. Eine Einbettung von Musik in soziale und ideologische Zeitkontexte, wie sie heute der amerikanische Musikwissenschaftler Richard Taruskin vertritt, ist ein relativ neuer Ansatz, und es ist kein Zufall, dass eine umfassende Darstellung der Rolle von Musik in der europäischen Kultur der letzten Jahrhunderte von einem Fachhistoriker, dem englischen Frühneuzeitler Tim Blanning, vorgelegt wurde.10 Viele der genannten Fragen hat die Musikwissenschaft einer später entstandenen Nachbardisziplin, der Musiksoziologie, überlassen. Diese jedoch ist dem allgemeinen Trend der Soziologie gefolgt und hat sich von historischen Fragestellungen, wie sie etwa bei Adorno noch wichtig waren,11 zugunsten empirischer Untersuchungen über gegenwärtiges Musikverhalten entfernt.12 Daher bleibt neben Musikwissenschaft und Musiksoziologie Raum für eine von Historikerinnen und Historikern mit den Instrumenten der kritischen Quellenanalyse betriebene Kultur- und Sozialgeschichte der Musik und des Musikalischen. Eine zweite Schwierigkeit und Herausforderung liegt in der Trennung zwischen ernster (E-) und unterhaltender (U-)Musik. Selbstverständlich gab es auch in früheren Jahrhunderten einen Unterschied zwischen der Musikausübung von Laien und der Praxis musikalischer Fachleute, zwischen dem 9 Dieses Problem diskutiert zuletzt Johnson, Introduction, S. 1 – 26. Vgl. Trevor Herbert, Social History and Music History, in: ders. u. a. (Hg.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York 2003, S. 146 – 156; Leo Treitler, History and Music, in: Ralph Cohen u. Michael S. Roth (Hg.), History and…: Histories within the Human Sciences, Charlottesville, VA 1995, S. 209 – 230. 10 Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, 5 Bde., Oxford 2005; Tim Blanning, The Triumph of Music. The Rise of Composers, Musicians and Their Art, Cambridge, MA 2008. 11 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Reinbek 1968. 12 Helga de la Motte-Haber (Hg.), Musiksoziologie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, Bd. 4), Laaber 2007. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 9 Gesang in der Dorfschenke, der musikalischen Liturgie in der Kirche und der Festmusik bei Hofe. Aber Joseph Haydn oder Gioacchino Rossini hätten sich gewundert, wenn man ihnen gesagt hätte, ihre Musik sei „ernst“. Die E/UDichotomie ist historisch entstanden, ein Nebenprodukt von Vermarktungsstrategien im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Musik. Sie ist kontingent, künstlich und durch zahlreiche Misch- und Übergangsphänomene in hohem Maße relativiert, allerdings soziologisch und sozialgeschichtlich nicht ganz willkürlich. Das Publikum von Techno-Konzerten und das von Liederabenden dürfte sich nur wenig überschneiden; Freunde von Musicals wird man selten bei Avantgarde-Aufführungen antreffen und umgekehrt. Diese Segregierung des Musikgeschmacks ist eine musiksoziologische Tatsache. Auch historisch ist mit einer außerordentlichen Breite des Spektrums zu rechnen, ästhetisch ebenso wie sozial. Durch technische Medien ist Musik im 20. Jahrhundert auch für diejenigen erreichbar geworden, denen sie nach den strengen Maßstäben musikalischer Kunstausübung oder den Standards gebildeter Wertschätzung verschlossen gewesen wäre. Musik, ob nun „ernst“ oder „populär“, ist Medienkunst für die breite Bevölkerung geworden. Kurzum: Musik ist mit großem Abstand die sozialste aller Künste, daher auch ein ideales Feld für die Verschwisterung von Sozial- und Kulturgeschichte. Ein drittes Problem, das Historikerinnen und Historiker vor musikalischen Themen zurückschrecken lässt, ergibt sich aus der Art der vorhandenen Quellen. Zumindest Neuzeithistoriker – bei früheren, quellenärmeren Epochen verhält es sich anders – sind daran gewöhnt, über ihre Quellen den direkten Zugang zum Denken und zu den Handlungsmotivationen historischer Akteure zu finden. Bei jeder Form der Geschichte ästhetischer Gegenstände und ihrer gesellschaftlichen Verwendung ist ein solch unmittelbarer Zugriff schwierig, nirgendwo mehr als bei der Musik. Der Vorgang des Komponierens ist uns unzugänglich, sein Ergebnis, das Werk, nur mit den Mitteln der Musikwissenschaft zu erschließen. Vor der Epoche der technischen Schallaufzeichnungen fehlt die Evidenz musikalischer Realisierung: Wir wissen nicht, wie die hochgerühmten Castrati der Barockzeit gesungen und wie Wolfgang Amadeus Mozart oder Frdric Chopin Klavier gespielt haben. Auch Publikumsreaktionen sind aus den Quellen oft nur vermittelt rekonstruierbar. Man kennt die Kommentare einzelner professioneller Kritiker, aber nur in seltenen Fällen die spontanen Reaktionen von Opern- oder Konzertbesuchern. Pausengespräche werden bis heute selten abgehört und mitgeschnitten. Die Herausforderungen an das methodische Geschick, circumstantial evidence zu nutzen, sind daher enorm. Erst durch Tageszeitungen und Musikzeitschriften bildeten sich in den großen Städten Netzwerke kultureller Kommunikation, Orte, an denen über Interes- 10 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel sen und Geschmäcker diskutiert werden konnte.13 Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bewertete die Presse nicht nur die musikalischen Werke und die Qualität der Aufführungen, sondern enthielt auch umfangreiche Informationen über die Veranstalter, die Künstler und das Verhalten des Publikums. Viele ästhetische Blätter wurden allmählich durch Tageszeitungen ersetzt, die Musikrezensionen nunmehr als Teil einer themenübergreifenden Berichterstattung genutzt. Journalisten lösten schreibende Kenner und Ästheten ab.14 Diese Professionalisierung ist gerade im Aufstieg der seit den 1840er Jahren nach Londoner Vorbild aufkommenden Bildberichterstattung zu beobachten. Die wachsende Vermittlung musikalischer Nachrichten zwischen 1820 und 1870 gelang durch die Tagespresse, die Kulturzeitschriften und die Fachorgane. Journalisten verwandelten ihre musikalischen Erlebnisse in eine wortreiche, aber geregelte Sprache. Diese Möglichkeiten des Schreibens müssen ausgelotet, und es muss nach den Begriffen, Sprachbildern und musikalischen Kategorien in publizistischen Texten gefragt werden.15 In aller Regel wird Musik für ein Publikum aufgeführt und in der Gruppe rezipiert. Elias Canetti hat sie in „Masse und Macht“ als ein Phänomen teils orgiastischer, teils gebändigter Massen beschrieben.16 Noch mehr als die anderen Künste kann Musik mobilisierend wirken. Sie hat Revolutionen begleitet, Massenaufmärsche getaktet und politische Großkundgebungen emotionalisiert. Nationalhymnen appellieren an Sentiments und Identitätsgefühle; kein Fußballländerspiel und keine olympische Siegerehrung kommen ohne sie aus. Jahrhundertelang synchronisierte Militärmusik den Marsch13 Vgl. Derek B. Scott, Sounds of the Metropolis. The Nineteenth-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris and Vienna, Oxford 2008; Applegate, Bach, S. 80 – 104; Jürgen Rehm, Zur Musikrezeption im vormärzlichen Berlin. Die Präsentation bürgerlichen Selbstverständnisses und biedermeierlicher Kunstanschauung in den Musikkritiken Ludwig Rellstabs, Hildesheim 1983, S. 17 – 37, und zur britischen Presse Dennis Griffiths (Hg.), The Encyclopedia of the British Press, 1422 – 1992, London 1992, bes. S. 24 – 46. 14 Vgl. Sandra McColl, Music Criticism in Vienna, 1896 – 1897. Critically Moving Forms, Oxford 1996; Peter Borchardt, Die Wiener Theaterzeitschriften des Vormärz, Wien 1961; Ellen Riggert, Die Zeitschrift „London und Paris“ als Quelle englischer Zeitverhältnisse um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. London im Spiegel ausländischer Berichterstattung, Göttingen 1934; insges. Jörg Requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und Entwicklung des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 1995, S. 373 – 392. 15 Vgl. zum Stellenwert der Sprache im Kontext der Rezeption Leon Botstein, Listening through Reading. Musical Literacy and the Concert Audience, in: 19th Century Music 16. 1992, S. 129 – 145; ders., Toward a History of Listening, in: Musical Quarterly 82. 1998, S. 427 – 431; Wolfgang Gratzer, Motive einer Geschichte des Musikhörens, in: ders. (Hg.), Perspektive einer Geschichte abendländischen Musikhörens, Laaber 1997, S. 9 – 31. 16 Elias Canetti, Masse und Macht, Hamburg 1960. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 11 schritt und erschreckte den Gegner. Heute werden Soldaten zwar nicht mehr „mit klingendem Spiel“ in den Krieg geschickt, doch nach wie vor begleitet die Musik den Krieg, zuletzt etwa als bei „sonic warfare“ oder musikalischer Folter Geräusche und Musik als hochtechnisierte Waffen eingesetzt wurden.17 Die Gestaltung des Musiklebens ist stets ein Verhandlungsprozess zwischen den Interessen verschiedener Produzenten und Konsumenten, der Ein- und Ausgrenzungen sichtbar macht. Dadurch erhält die Untersuchung musikalischer Aufführungen eine zentrale Bedeutung. Die tatsächliche Anwesenheit in einem Konzert, aber auch die Vorstellung, beim Anhören einer Festspielaufführung im Radio Teil einer anonymen ästhetischen Gemeinschaft zu werden, vereinen Subjekte zum wirklichen oder imaginären Kollektiv.18 Durch musikalische Aufführungen können sich Kommunikationsgemeinschaften herausbilden.19 Musikliebhaber nutzten ihre Kunstmusik, um sich gegen vermeintlich Fremdes abzugrenzen. Regelmäßig begannen Journalisten, Schriftsteller, Wissenschaftler, aber eben auch das breitere Publikum, die Vorherrschaft angeblich eigener Traditionen zu fordern. Es ist fragwürdig, die Geschichte der Beziehungen der Musikfreunde innerhalb einer Gesellschaft und zwischen Staaten und Kulturen entlang der vermeintlich getrennten Achsen „Transfer“ und „Konflikt“ zu schreiben. Konvergenz und Divergenz können kaum als Antipoden in der Musikgeschichte verstanden werden. Vielmehr ermöglichten auch Konflikte und Konkurrenz die musikalische Kommunikation.20 17 Vgl. etwa Morag J. Grant, Serial Music, Serial Aesthetics. Compositional Theory in Postwar Europe, Cambridge 2001. 18 Vgl. zum Zusammenspiel von Werk und Aufführung, Praxis und Distinktion die Überlegungen von Andreas Gebesmair, Grundzüge einer Soziologie des Musikgeschmacks, Wiesbaden 2001, S. 15 – 18; Gratzer, Motive, S. 9 – 31; Katherine Ellis, The Structures of Musical Life, in: Jim Samson (Hg.), The Cambridge History of NineteenthCentury Music, Cambridge 2002, S. 343 – 370. 19 Hilfreich sind die Argumente von Christophe Charle, Opera and France, 1870 – 1914. Between Nationalism and Foreign Imports, in: Johnson u. a., Opera, S. 243 – 266; Johann Hüttner, Vorstadttheater am Weg zur Unterhaltungsindustrie. Produktions- und Konsumverhalten im Umgang mit dem Fremden, in: Hans-Peter Bayerdörfer u. Eckhart Hellmuth (Hg.), Exotica. Inszenierung und Konsum des Fremden im 19. Jahrhundert, Münster 2003, S. 81 – 102. 20 Vgl. dazu Ther, In der Mitte der Gesellschaft, S. 395 – 421; Sven Oliver Müller, „A Musical Clash of Civilisations“? Musical Transfers and Rivalries in the 20th Century, in: Dominik Geppert u. Robert Gerwarth (Hg.), Wilhelmine Germany and Edwardian Britain. Essays on Cultural Affinity, Oxford 2008, S. 305 – 329; ders., Einleitung, Musik als nationale und transnationale Praxis im 19. Jahrhundert, in: JMEH 5. 2007, S. 22 – 38. Dieses Konzept einer gleichsam „musikalischen Europäisierung“ ist auch das Thema des Forschungsprojektes am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz: „Europe and Beyond. Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740 – 1960“. 12 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Bei näherer Betrachtung stellt sich das scheinbare Spannungsverhältnis zwischen Abgrenzung und Angleichung als Resultat vielschichtiger kommunikativer Prozesse im Zeitalter einer neuen Politisierung und Medialisierung heraus. Oft mochten die Musikliebhaber verschiedener Bands, die Besucher der Konzerte in verschiedenen Ländern einander kaum, nicht obwohl, sondern weil sie mit den Werken der Anderen in Kontakt kamen. Der optimistische pädagogische Glaube, dass gegenseitiges Kennenlernen, dass Austausch und Transfer gleichsam notwendig kulturelle Harmonie und Verständnis innerhalb und zwischen den europäischen Gesellschaften stiftet, wird gerade durch die Rezeption von Musik widerlegt.21 Reaktionen auf Musik sind eingebettet in gesellschaftliche Praktiken und Institutionen, sie werden erlernt und tradiert. Die öffentliche Darstellung im Musikleben verlangt den Erwerb komplizierter und aufs Feinste abgestimmter Verhaltensmuster : von der Auswahl der Aufführung bis zur Wahl der eigenen Abendgarderobe, von der Bewegung im Auditorium bis zur Kontrolle des Körpers. Die Disziplinierungsmacht nonverbaler Umgangsformen überlagert oft den sprachlichen Anstandskanon – Selbstzwänge und Fremdzwänge sind zu beobachten. Der gesellschaftliche Kontext und die Organisation der Spielstätten machen die Künstler und das Publikum oft zu Gefangenen der musikalischen Aufführungen. Durch ihr Wissen über die Musik, über Komponisten, Stile, Sänger und Dirigenten erkennen die Eingeweihten, wer zu ihnen gehört und wer nicht. Denn wer die kulturellen Regeln nicht beherrscht, wird durch sie ausgeschlossen.22 Kurz: Die musikalische Praxis ist eine Ressource, um soziale, politische und wirtschaftliche Positionen zu erreichen. Da das Erlebnis von Musik nicht allein von der Komposition und den Künstlern abhängt, sondern auch durch die Anteilnahme an musikalischen Aufführungen sozial vorgeprägt ist, ist es wichtig, das Spannungsfeld zwischen 21 Anregend ist die detaillierte, wenn auch methodisch ergänzungsbedürftige Studie von Gundula Kreuzer, Verdi and the Germans. From Unification to the Third Reich, Cambridge 2010, bes. S. 1 – 14; sowie zum deutsch-amerikanischen Transfer der innovative Ansatz von Jessica C. E. Gienow-Hecht, Sound Diplomacy. Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850 – 1920, Chicago 2009, und die Argumente von Christophe Charle, Opera and France, 1870 – 1914. Between Nationalism and Foreign Imports, in: Johnson u. a., Opera, S. 243 – 266; Hüttner, Vorstadttheater. 22 Folgt man Pierre Bourdieus Habituskonzept, wirkt keine Praxis stärker klassifizierend, das heißt, die Verhaltensmuster und den Geschmack einer sozialen Gruppe ausdrückend und prägend, als der öffentliche Musikkonsum. Vgl. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt 19979, bes. S. 277 – 286 u. S. 355 – 399; sowie zur Bestimmung der soziologische Reichweite Gebesmair, Grundzüge, S. 47 – 75; Jane F. Fulcher, Symbolic Domination and Contestation in French Music. Shifting the Paradigm from Adorno the Bourdieu, in: Johnson u. a., Opera, S. 312 – 329. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 13 der Organisation, der Vorführung, dem Erwartungshorizont des Publikums und seinen Reaktionen zu vermessen. Dem radikalen Konstruktivismus von Ola Stockfelt muss man nicht widerspruchslos folgen: „The listener, and only the listener, is the composer of the music.“23 Dennoch scheint klar, dass musikalische Bedeutung niemals ein allein werkimmanentes Phänomen darstellt. Sie besteht nicht unverrückbar, sondern wird immer auch von den Hörern selbst erzeugt.24 Das dabei hervortretende Problem besteht darin, zu klären, ob es die Musik selbst oder eher ihr Kontext ist, welche das Musikleben prägen. Damit ist die Unterscheidung zwischen Komposition und Rezeption im Begriff, ihre Substanz zu verlieren. Mit guten Gründen diskutieren Musikwissenschaftler die Frage, ob aus dieser Konsequenz eine Auflösung des Werkbegriffs folgen könnte. Allerdings würde man sich durch einen konsequenten Wechsel vom Werkbegriff zum Aufführungsbegriff neue hermeneutische Schwierigkeiten einhandeln.25 23 Ola Stockfelt, zitiert nach Ruth Finnegan, Music, Experience, and the Anthropology of Emotion, in: Martin Clayton u. a. (Hg.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York 2003, S. 181 – 192, Zitat S. 184. Vgl. Nicholas Cook, Music as Performance, in: ebd., S. 204 – 214. 24 Eine stärkere Konzentration auf Rezeptionsanalysen forderten bereits vor zwanzig Jahren Hermann Danuser u. Friedhelm Krummacher (Hg.), Rezeptionsästhetik und Rezeptionsgeschichte in der Musikwissenschaft, Laaber 1991. Trotz der Belebung dieser Forschungsrichtung konstatierten führende Vertreter der Musik- und Kulturwissenschaften nach wie vor große Lücken in diesem Bereich. Vgl. etwa die Beiträge in: Archiv für Musikwissenschaft 57. 2000; Wolfgang Kemp (Hg.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992; Susan Bennett, Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception, London 1990; die wichtigen Aufsätze von Jerrold Levinson, Performative vs. Critical Interpretation in Music, in: Michael Krautz (Hg.), The Interpretation of Music, Oxford 1993, S. 34 – 60; Martyn Thompson, Reception Theory and the Interpretation of Historical Meaning, in: History and Theory 32. 1993, S. 248 – 272. Wegweisend in den Musikwissenschaften waren in jüngster Zeit vor allem die Forschungen zur Bach-Rezeption in dem vierbändigen Werk von Michael Heinemann u. Hans-Joachim Hinrichsen (Hg.), Bach und die Nachwelt, 4 Bde., Laaber 1997 - 2004; dies. (Hg.), Johann Sebastian Bach und die Gegenwart. Beiträge zur Bach-Rezeption, 1945 – 2005, Köln 2007; vgl. auch Kreuzer, Verdi. 25 Vgl. etwa Hans-Joachim Hinrichsen, Musikwissenschaft und musikalisches Kunstwerk. Zum schwierigen Gegenstand der Musikgeschichtsschreibung, in: Laurenz Lütteken (Hg.), Musikwissenschaft. Eine Positionsbestimmung, Kassel 2007, S. 67 – 87; ders., Musikwissenschaft. Musik – Interpretation – Wissenschaft, in: Archiv für Musikwissenschaft 57. 2000, S. 78 – 90; Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Köln 1977, bes. S. 16 f.; ders., Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980; Gerhard Brunner u. Sarah Zalfen, Werktreue. Was ist Werk, was Treue? Dokumentation eines Symposiums des Master of Executive Arts Administration der Universität Zürich, Wien 2011; James Buhler u. Daniel K. L. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning, in: 19th Century Music 26. 2002, S. 184 – 191, und die Überlegungen von Christian Kaden, 14 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Dass es die Musiker selbst sind, die zwischen dem Kunstwerk und seiner Wahrnehmung vermitteln, verdeutlicht im Unterschied zur bildenden Kunst und Literatur den kommunikativen Charakter der Musik. Beispielweise wird ersichtlich, dass sich im ästhetischen Diskurs die Idee eines Werkes im Sinne des abgeschlossenen, erschaffenen Kunstwerkes erst relativ spät, zwischen 1600 und 1800, etabliert hat. Dieses Konzept setzte sich im 19. Jahrhundert derart erfolgreich durch, dass bis in die Gegenwart hinein die Musik die einzige Kunst zu sein scheint, deren Stücke noch immer durch die Bezeichnungen „Opus“ geordnet werden. Ideengeschichtliche und wissenschaftshistorische Zugänge ließen sich mithin durch sozialgeschichtliche Perspektiven ergänzen. Sichtbar würden so die kulturellen, ökonomischen und sozialen Abhängigkeiten zwischen Komponisten, Musikern, Auftraggebern und Verlegern.26 Die Veranstalter und das Publikum erwarteten nicht nur musikalische Leistungen, auch die Künstler orientierten sich oft an den ästhetischen Erwartungen, um finanzielle Erfolge zu erzielen. Durch den Blick auf die Biographien bestimmter Künstlern könnten etwa die Einkünfte eines Orchestermusikers mit seinem Status in einem bürgerlichen Verein verglichen werden. Die Analyse musikalischer Schöpfungen und die Rolle ihrer Vermittler erleichtern es, die Praxis musikalischer Kommunikation zu beschreiben. „Es geht nie darum, dass der auf der Bühne den da unten gut unterhält. Musik funktioniert nur in einer gemeinsamen Kommunikation.“27 Der Pianist Maurizio Pollini benennt damit akkurat das Thema dieses Heftes. Die Beiträge versuchen die Polarität zwischen Kunst und Gesellschaft zu relativieren. Hier interessieren in erster Linie die gegenseitige Beobachtung der Musikliebhaber, der Austausch zwischen Musikern und Publikum und schließlich die öffentliche Reichweite dieser musikalischen Beziehungen. Musikalische Aufführungen sind als Akte sozialer Ordnung wichtig und werden analysiert, weil sie die Ausbildung und die Abgrenzung von Gruppen ermöglichen. Die Entscheidung von Gruppen, Musik in ihrer spezifischen Weise zu rezipieren, eröffnet einen normativen Rahmen und erlaubt die Entwicklung verbindlicher gesellschaftDas Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann, Kassel 2004; Helga de la Motte-Haber u. Hans Neuhoff, Vorwort, in: dies. (Hg.), Musiksoziologie, Laaber 2007, S. 9 – 17; Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2004, S. 42 – 57; schließlich die grundlegenden Befunde von Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt 1963. 26 Vgl. Schleuning, Der Bürger erhebt sich; Hansjakob Ziemer, Die Moderne Hören. Das Konzert als urbanes Forum, 1890 – 1940, Frankfurt 2008; Jutta Toelle, Oper als Geschäft. Impresari an italienischen Opernhäusern, 1860 – 1900, Kassel 2007; Dana Gooley, The Virtuoso Liszt, Cambridge 2004; DeNora, Beethoven; Elisabeth Eleonore Bauer, Wie Beethoven auf den Sockel kam. Die Entstehung eines musikalischen Mythos, Stuttgart 1992; Baumeister u. a., Die Kunst der Geschichte. 27 Das ist ein Zitat aus der CD-Reihe der Wochenzeitung Die Zeit: Die Zeit Klassik Edition, Bd. 13: Maurizio Pollini, Hamburg 2005. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 15 licher Formen.28 Um den Stellenwert des Musiklebens in Kulturen und Gesellschaften zu zeigen, ist ein Perspektivwechsel nötig. Die Aneignung der Musik ist nicht als ein peripheres Phänomen, sondern als eine gesellschaftlich relevante Entwicklung zu begreifen. Das Heft behandelt Praktiken der Kommunikation im Musikleben. Das Publikum des Musiklebens lässt sich als Teilsegment der Gesellschaft begreifen, in dem sich Fremde, Bekannte und Freunde begegnen und verbunden werden. Die Kontexte, in denen die Hörer und Opernbesucher, die Fans und Leser der Zeitungen handeln und fühlen, werden kommunikativ strukturiert. Das Musikleben ist ein verbindender Faktor innerhalb der Gesellschaft, ein kommunikativ entstehender Zusammenhang zwischen Subjekten, Gruppen und Institutionen. Künstler, Veranstalter und die Musikindustrie haben auch dadurch Erfolg. Die Geltung musikalischer Kommunikationspraktiken führt durch die ökonomisch, sozial und politisch ungleiche Verteilung zu immer neuen oder zumindest festeren Grenzziehungen in einer Gesellschaft.29 Die Rezeption von Musik lässt sich als eine Form der Kommunikation untersuchen. Musikalische Aufführungen schaffen nie isolierte, aber vielfältig kombinierte Reize, die genau deshalb so nachhaltig wirken. Es ist schwierig für die Mehrzahl des Publikums, die Struktur und das differenzierte Regelwerk einer Komposition zu entschlüsseln und mit den Mitteln der Alltagssprache zu beschreiben. Auch deshalb bedürfen die Musikfreunde einander und eignen sich diese Kunstform als Mitglieder einer Gemeinschaft an. Denn viele Stücke zwingen zu einer öffentlichen Rezeption, zum Austausch und zum wechselseitigen Lernprozess zwischen Managern, Künstlern, Publikum und Presse.30 Geschmäcker und Genres werden im Musikleben sozial angewandt, genutzt und verhandelt. Jeder sozial erworbene Rang setzt eine erfolgreiche Kommunikation voraus. Dieser ist eng verbunden mit den im Musikleben bestehenden 28 Vgl. Johnson, Listening, S. 28 – 34 u. S. 281 – 285; Hans Neuhoff, Die Konzertpublika der deutschen Gegenwartskultur. Empirische Publikumsforschung in der Musiksoziologie, in: Motte-Haber u. Neuhoff, Musiksoziologie, S. 473 – 509; Derek B. Scott, Music and Social Class, in: Samson, Cambridge History of Nineteenth-Century Music, S. 544 – 567; Richard Münch, Die soziologische Perspektive. Allgemeine Soziologie – Kultursoziologie – Musiksoziologie, in: Motte-Haber u. Neuhoff, Musiksoziologie, S. 33 – 59, hier S. 46 – 53. 29 Vgl. Hubert Knoblauch, Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte, Berlin 1995, S. 1 – 20; Zofia Lissa, Zur Theorie der musikalischen Rezeption, in: Helmut Rösing (Hg.), Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft, Darmstadt 1983, S. 361 – 376; vgl. Tim C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture. Old Regime Europe, 1660 – 1789, Oxford 2002, bes. S. 106 – 161. 30 Vgl. dazu die Beiträge in Dorothy Miell u. a. (Hg.), Musical Communication, Oxford 2007; den Ansatz von Knoblauch, Kommunikationskultur, S. 46 – 56 und passim; sowie Habbo Knoch u. Daniel Morat (Hg.), Kommunikation als Beobachtung. Medienwandel und Gesellschaftsbilder, München 2003. 16 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Präferenzen und Wissensbeständen. Wirkungsmächtig werden Kleidungsmode und Langeweile, Körperlichkeit und Askese, Rossini und Karajan. Zur Kommunikation dienen auch Ausdrucks- und Nachahmungsbewegungen, Begrüßungen, Gesten der Ehrerbietung und des Missfallens. Diese Handlungsweisen im Publikum sind auf Reaktionen, auf Antwort der Anderen im Saal oder in den Medien angelegt; ein Hörer kommuniziert nur, wenn er davon ausgeht, dass er von den anderen verstanden und akzeptiert wird. Die verschiedenen Handlungsoptionen gleichen sich so aneinander an, weil sie zueinander im kommunikativen Verhältnis stehen und durch dieses aufeinander abgestimmt werden.31 Die Frage ist, ob der Umgang mit Musik die Verständigung zwischen Gruppen und Individuen erleichterte oder erschwerte. Entstand durch die Musikkultur ein neuer Kommunikationsraum? Was gelang durch die musikalisch motivierte Kommunikation, was sich etwa durch die gesprochene Sprache oder durch Bilder nicht oder anders vollzog? Eröffneten musikalische Aufführungen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen Kommunikationschancen, die politische, soziale und wirtschaftliche Themen zu verhandeln erlaubten? Nach dem heutigen Kenntnisstand ist noch unklar, ob durch musikalische Aufführungen neue gesellschaftliche Gruppen entstanden oder ob umgekehrt bereits bestehende Gruppen sich musikalischer Verständigung bedienten. Vieles spricht dafür, dass die Praktiken musikalischer Aufführungen die öffentliche Kommunikation strukturierten und sich oft neue Beziehungen in der Gesellschaft bildeten. Die Begegnungen der Musikfreunde in den Spielstätten vollzogen genau die Welt, die sie zeigten: Eine durch musikalische Auseinandersetzung entstehende Gemeinschaft. Die Aufführungen der Musik bildeten ein Element der Verständigung, um das sich allmählich festere Formen kristallisierten.32 Wo aber wären Orte der Musik in einem allgemeineren Geschichtsverständnis zu finden? Auf einige aussichtsreiche Perspektiven aus den Bereichen der Politikgeschichte, der Kulturgeschichte, der Sozial- und der Emotionsgeschichte sei hingewiesen. Am unmittelbarsten anschlussfähig ist möglicherweise die Kulturgeschichte des Politischen, die das Symbolische und Performative politischen Handelns in den Vordergrund rückt. In dem Maße, in dem 31 Vgl. Alfred Schütz, Das Problem der Relevanz, Frankfurt 1976; Ute Frevert, Politische Kommunikation und ihre Medien, in: dies. u. Wolfgang Braungart (Hg.), Sprachen des Politischen. Medien und Medialität in der Geschichte, Göttingen 2004, S. 7 – 19. 32 Vielleicht lässt sich dieser Prozess als die Herausbildung einer Kommunikationsgemeinschaft begreifen, als Ergebnis eines gemeinsamen Wissens über Mittel und Praktiken der Verständigung. Vgl. dazu die Beiträge in Müller u. a., Die Oper im Wandel der Gesellschaft. Beachtenswert sind aber ebenso die skeptischen Überlegungen von Knoblauch, Kommunikationskultur, S. 58 f. u. S. 314 f.; sowie die Überlegungen in Christoph Gusy u. Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Inklusion und Partizipation. Politische Kommunikation im historischen Wandel, Frankfurt 2005. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 17 Politikgeschichte ihren Schwerpunkt von Entscheidungen auf Repräsentationen verlagert, kann sie den planvollen öffentlichen Einsatz von Musik in ihren Horizont einbeziehen. Dies reicht von der Festkultur an frühneuzeitlichen Fürstenhöfen, bei der Musik nicht bloß eine Zutat war, sondern das mehr oder weniger ritualisierte Geschehen mit höherer – auch religiöser – Bedeutung versah, über die pompösen Staatsbegräbnisse und nationalpolitisch motivierten Musikfeste des 19. Jahrhunderts bis zu den musikalischen Inszenierungen in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Noch die Frage der Europa-Hymne – man einigte sich schließlich auf die Freudenmelodie („Freude, schöner Götterfunken“) aus dem vierten Satz von Ludwig van Beethovens Neunter Symphonie – war ein brisanter Streitpunkt. Musik muss allerdings nicht unbedingt ein Instrument obrigkeitlicher Steuerung sein. Sie kann auch als Kristallisationskern oppositioneller, ja, subversiver Gemeinschaftsbildung dienen. Der offiziellen Kultur wird dann eine counter-culture entgegengesetzt. Der frühe Jazz und die Popmusik in der Studentenrevolte spielten eine solche Rolle ebenso wie die Arbeitergesangsbewegung, die sich übrigens auch Elemente der Elitenkultur aneignete, etwa Musik des als menschheitlicher Humanist verstandenen Komponisten Ludwig van Beethoven.33 Dass Musik weithin eine öffentlich vollzogene kulturelle Praxis ist, verleiht ihr zwangsläufig eine ökonomische Dimension. Fürstliche, kirchliche und bürgerliche Mäzene ließen sich Musik viel Geld kosten. Dort, wo es diese Art von offizieller Patronage nicht gab (etwa in den USA), haben bis zum heutigen Tage private Sponsoren eine analoge Aufgabe übernommen. In Europa gab es bereits im 17. und 18. Jahrhundert eine kommunale, von Höfen unabhängige Musikpflege. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde daraus Kulturpolitik auf den unterschiedlichen Ebenen von Staatlichkeit. Vor allem Gründung, Bau und Betrieb von Konzerthäusern und Opernhäusern verlangten den Einsatz staatlicher Mittel. In demokratischen politischen Systemen ist die Subventionierung einer offensichtlichen Minderheitskultur aus Steuergeldern eine immer wieder umkämpfte und rechenschaftsbedürftige Entscheidung. Sozialgeschichtlich interessiert die Frage nach der ästhetischen Bildung kollektiver Identitäten und der Verwendung von Musik als Statusmarker und Distinktionskriterium. Aus Pierre Bourdieus Untersuchungen über Akkumulation und Einsatz kulturellen Kapitals im Frankreich der jüngsten Vergangenheit34 ist zu lernen, dass nicht nur das deutsche Bildungsbürgertum des 33 Vgl. Philip V. Bohlman. The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History, Santa Barbara, CA 2004; Sarah Zalfen, Staats-Opern? Der Wandel von Staatlichkeit und die Opernkrisen in Berlin, London und Paris am Ende des 20. Jahrhunderts, Wien 2011; Esteban Buch, Beethovens Neunte. Eine Biographie, München 2000; sowie die Beiträge in Sven Oliver Müller u. Jutta Toelle (Hg.), Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Wien 2008. 34 Bourdieu, Unterschiede; ders., Über Ursprung und Entwicklung der Arten der Musikliebhaber, in: ders., Soziologische Fragen, Frankfurt 1993, S. 147 – 152. 18 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel 19. Jahrhunderts seine Überlegenheitsansprüche vor sich selbst und anderen Teilen der Gesellschaft durch musikalische Kennerschaft und die Förderung von Institutionen des musikalischen Lebens unter Beweis zu stellen suchte. Musikkonsum, ob nun im regelmäßigen Konzertbesuch oder in der Anhäufung einer zur Schau gestellten Plattensammlung vollzogen, wird zum Element sozialer Selbstentwürfe. Musikpräferenzen sind oft ein Bekenntnis, das sich mit Inklusion und Exklusion verbindet. Auch die Richtungskämpfe innerhalb des klassischen Bildungsbürgertums, etwa pro und contra Richard Wagner und der Musik der „Neudeutschen“, sind Beispiele dafür. Musik kann ebenso integrieren wie spalten. Sie erfüllt damit eine Rolle, die derjenigen von Religion in manchem ähnelt. Ein für die Geschichtswissenschaft vielversprechender Ansatz ist ein Blick auf eine Geschichte der Emotionen im Musikleben.35 Auf Affekte und Gefühle verweisen Forscher regelmäßig, meistens aber ohne diese zu erklären oder zu kontextualisieren. Notwendig wäre dieser Ansatz allein schon deshalb, weil Emotionen als öffentliche Form der Kommunikation wirken. Denn durch gemeinsam ausgeprägte und ausgelebte Praktiken im Zusammenhang mit Musik erlernten Gruppen emotionale Bindungen. Emotionen sind dabei weniger momentane Affekte als vielmehr langfristige Verhaltensmuster, die sozialem Wandel unterworfen sind. Die gleichen Musikstücke können in unterschiedlichen Kontexten häufig andere Emotionen auslösen. Musik erlaubt die Entschlüsselung emotionaler Zustände, deren Mitteilung durch Sprache vergleichsweise schwerer zu leisten ist. Musikalisch motivierte Emotionen erleichtern es, intensiver zu kommunizieren. Musikalische Praktiken könnten als eine Geschichte erfolgter und erfolgreicher Kommunikation erforscht werden. Die Beiträge dieses Heftes verweisen lediglich auf einige der genannten Perspektiven. Die einzelnen Aufsätze fragen nach der Bedeutung, den Akteuren und der Kommunikation in ausgewählten Themenfeldern. Der Fokus richtet sich nicht allein auf die Darstellung des breiten Handlungsrepertoires einzelner Personen oder Institutionen, sondern primär auf eine zusammenhängende Analyse der einzelnen Akteure. Gesellschaftliche Paradigmen und gruppenspezifische Praktiken sollen entschlüsselt werden. Drei der vier Aufsätze im Schwerpunktteil dieses Hefts beleuchten Aspekte der „ernsten“ Musik in räumlich wie zeitlich unterschiedlichen sozialen settings. Die folgenden Bemerkungen beschränken sich daher auf dieses immer noch sehr umfangreiche Themenfeld. 35 Vgl. zum analytischen Potential von Emotionen in der musikalischen Praxis; Tia DeNora, Aesthetic Agency and Musical Practice. New Directions in the Sociology of Music and Emotion, in: Patrik N. Juslin u. John A. Sloboda (Hg.), Music and Emotion. Theory and Research, Oxford 2001, S. 161 – 180; Nicholas Cook u. Nicola Dibbden, Musicological Approaches to Emotion, in: ebd., S. 45 – 70; Patrik N. Juslin u. John A. Sloboda, in: ebd., S. 453 – 462; Malcom Budd, Music and the Emotions. The Philosophical Theories, London 1992. ipabo_66.249.66.96 Geschichtswissenschaft und Musik 19 Die europäische Kunstmusik, als „klassische“ oder „ernste“ Musik eine Erscheinung der Neuzeit und im 20. Jahrhundert von zunehmender Musealisierung betroffen, kann nicht nur in einem Kontinuum zur populären Musik gesehen werden, sondern auch in noch größeren Zusammenhängen. Zum einen ist dies „Weltmusik“, also die Musik prinzipiell aller Zivilisationen, wie sie seit der Zeit um 1900 von der neuen europäisch-nordamerikanischen Wissenschaft der Musikethnologie beziehungsweise Ethnomusikologie, verstanden als eine interkulturell vergleichende Musikwissenschaft, gesammelt und studiert wurde; heute macht sie einen Bereich der musikalischen Kulturindustrie aus. Der Beitrag von Jürgen Osterhammel skizziert diesen „globalen“ Kontext der europäischen Musikgeschichte während der langen Jahrhundertwende um 1900. Musik jeglicher Art ist domestiziertes Geräusch, das heißt ein Spezialfall innerhalb einer umfassenden Geschichte von Tönen, Krach und Klang, mithin von akustischer Sinnlichkeit. Kommunikation spielt sich so gut wie nie in klangneutralen Zusammenhängen ab; auch Sprache ist Klang. Eine sehr weit gefasste Problemformulierung erleichtert und bereichert indes nicht immer die Untersuchung spezifischer historischer Fragestellungen. Wer sich für das Verhalten des Publikums in italienischen Opernhäusern der Belcanto-Epoche interessiert, muss sich nicht unbedingt um eine allgemeine Geräuschgeschichte der Neuzeit kümmern. Hier sind feine Abstufungen und Vermittlungen unerlässlich, eine Aufgabe, die sich Jan-Friedrich Missfelder in seinem Beitrag stellt. Das Publikum im Musikleben ist ein bekanntes Phänomen, aber eine wissenschaftlich nur wenig erforschte Kategorie. Doch gerade der Umgang des Publikums mit musikalischen Aufführungen macht die Bedeutung der Musik in der Gesellschaft greifbar. Die öffentliche Rezeption der Musik verlangt den Erwerb komplizierter und aufs Feinste abgestimmter Verhaltensmuster. Das Publikum schuf ein Abhängigkeits- und Beobachtungsgeflecht, innerhalb dessen es dann angreifbar wurde, wenn bestimmte Hörer „unschön“ agierten, die erwarteten Konventionen repräsentativer Kommunikation übertraten. Sven Oliver Müller untersucht in seinem Beitrag die kulturelle und politische Konkurrenz zwischen Bürgertum und Adel in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Musik und Musikrezeption zu historisieren, bedeutet nach den Prozessen und Strukturen zu fragen, welche den Transfer der Musik durch die Zeit ermöglichen – oder auch verhindern. Dabei entwickelte sich eine Vielfalt von Finanzierungsformen und administrativen Apparaten, von Bauwerken und Repertoires, von Rezeptions- und Repräsentationsritualen, und es entstand die das Musikleben bis in die Gegenwart prägende Spannung zwischen kulturellem Erbe und zeitgenössischer Legitimation. Am Beispiel der Oper untersucht der Beitrag von Sarah Zalfen diese Phänomene als eine Form der Institutionalisierung von Musik. 20 Sven Oliver Müller und Jürgen Osterhammel Vieles spricht für die Überlegung, dass die Wirkung der Musik weniger aus ihrer objektiv bestimmbaren Qualität resultiert als vielmehr aus der interpretierenden Bestimmung durch die situative Auswahl, die Geltung der Institutionen und das Verhalten der Zuhörer. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Werk und Wirkung könnte vermeiden, Musik einseitig als kulturell autonomes Phänomen zu begreifen und die gesellschaftliche Dimension von Kunstwerken zu ignorieren. Die vorliegenden Beiträge stellen einen Versuch dar, Perspektiven aufzuzeigen, wie durch die Beschäftigung mit der Musik wichtige Einsichten gewonnen werden können. Die Entschlüsselung der musikalischen Kommunikation ermöglicht zugleich Einblicke in die Anordnung der Gesellschaft. Dr. Sven Oliver Müller, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-14195 Berlin E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Jürgen Osterhammel, Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Postfach 6, D-78457 Konstanz E-Mail: [email protected] ipabo_66.249.66.96 Period Ear Perspektiven einer Klanggeschichte der Neuzeit von Jan-Friedrich Missfelder* Abstract: This article advocates that we should understand the sound history as a new way of investigating general history. It focuses upon auditory perception and the political economy of sound utterances, and therefore identifies sound production as an indicator of the valid political and social order. As such, the sound history unearths the specific acoustemology of a given historical society, the way in which people make sense of their world via sounds and their understanding of sound. Die Stimme macht Lärm, die Dinge ebenfalls.1 Michel Serres Turn! Turn! Turn! (To Everything there is a Season)2 The Byrds Das Klio blind sei, wird niemand mehr behaupten können. Die Geschichtswissenschaft hat ihre „historischen Augen“ in den letzten Jahren geschärft und Bilder und visuelle Medien aller Art als Quellen und Erkenntnismittel zu nutzen gelernt.3 Deren heuristischer Wert steigt dabei insbesondere in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte immer weiter. Bilder werden nicht mehr nur als Speichermedium vergangener Wirklichkeiten aufgefasst, sondern zunehmend auch als spezifische Produzenten historischen Wissens analysiert.4 Die methodische und theoretische Bewegungsrichtung der Geschichtswissenschaft scheint damit, wie in anderen Kulturwissenschaften auch, durch den je nach Akzentuierung unterschiedlich gelagerten iconic, pictorial oder * Für sachkundige Lektüre und konstruktive Hinweise danke ich Daniel Morat. 1 Michael Serres, Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische, Frankfurt 1998, S. 157. 2 The Byrds, Turn! Turn! Turn!, CBS 1897, November 1965. 3 Vgl. nur Gerhard Paul, Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006; Bernd Roeck, Das historische Auge. Kunstwerke als Zeugen ihrer Zeit von der Renaissance zur Revolution, Göttingen 2004; ders., Visual turn? Kulturgeschichte und die Bilder, in: GG 29. 2003, S. 294 – 315 sowie zusammenfassend Habbo Knoch, Renaissance der Bildanalyse in der neuen Kulturgeschichte, in: Historisches Forum 5. 2005, http://edoc.huberlin.de/e_histfor/5/PHP/Beitraege_5 – 2005.php#393. 4 Vgl. z. B. Julia Voss, Darwins Bilder. Ansichten der Evolutionstheorie, 1837 – 1874, Frankfurt 2007. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 21 – 47 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X 22 Jan-Friedrich Missfelder visual turn vorgegeben.5 Kaum ist die eine Wende jedoch vollzogen, kündigen sich neue Drehungen an. Vom jeweiligen emotional, medial oder gar historic turn wird erwartet, dass er die Aufmerksamkeit der Kulturwissenschaften wieder neu ausrichtet.6 Unter diesen verschiedenen turns firmieren seit kurzem auch ein acoustic,7 sonic8 oder auditory turn.9 Was hat es damit auf sich? Klänge, Musik und akustische Wahrnehmung standen lange Zeit eher am Rande der kulturwissenschaftlichen Forschungsagenda – von der Musikwissenschaft im engeren Sinne einmal abgesehen, die sich aber in ihrer traditionellen Form ebenfalls eher der textuellen Basis der Musik in Form von Notenschrift als dem Klangereignis selbst zuwandte.10 Dies sei, so die Propagandistinnen und Propagandisten des acoustic, sonic, auditory turn, nun im Begriff, sich zu ändern. Hatte der amerikanische Phänomenologe Don Ihde schon 1976 der Philosophie einen auditory turn verordnet,11 so scheint die Wende zum Klang nun auch andere Disziplinen zu betreffen. Literatur- und Medienwissenschaften, (Kultur-)Anthropologie und nicht zuletzt die Musikwissenschaft selbst widmen dem Klang, dem akustischen Ereignis und der Hörwahrnehmung seit einiger Zeit größere Aufmerksamkeit.12 Der kanadische 5 Vgl. zur Differenzierung und Wissenschaftsgeschichte der verschiedenen turns instruktiv Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek 2006, S. 329 – 380. 6 Vgl. ebd., S. 381 f. 7 Vgl. Petra Maria Meyer (Hg.), Acoustic Turn, München 2008. 8 Vgl. Jim Drobnick, Listening Awry, in: ders. (Hg.), Aural Cultures, Toronto 2004, S. 9 – 18, hier S. 10. 9 Vgl. die von Veit Erlmann im Oktober 2009 organisierte Konferenz „Thinking Hearing. The Auditory Turn in the Humanities“, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=11961&sort=datum&order=down&search=erlmann. 10 Vgl. zu diesem Problem erhellend Nicholas Cook, Between Process and Product. Music and/as Performance, in: Music Theory Online 7. 2001, http://www.mtosmt.org/issues/ mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook_frames.html; eine frühe Ausnahme bildet allerdings Christopher Small, Musicking. The Meanings of Performing and Listening, Hanover, NH 1998. Die Anzahl der klangorientierten Studien im Bereich der Sozialgeschichte der Musik nimmt allerdings zu. Vgl. z. B. jüngst Christopher Marsh, Music and Society in Early Modern England, Cambridge 2010. 11 Vgl. Don Ihde, Listening and Voice. Phenomenologies of Sound, Albany, NY 20072 ; auch Wolfgang Welsch, Auf dem Weg zu einer Kultur des Hörens? [1993], in: Reader Neues Funkkolleg. Der Aufstand des Ohrs – Die neue Lust am Hören, Göttingen 2006, S. 29 – 46; zu Ihde auch Daniel Schmicking, Hören und Klang. Empirisch phänomenologische Untersuchungen, Freiburg 2003, bes. S. 57 – 67; vgl. jetzt auch Jean-Luc Nancy, Zum Gehör, Zürich 2010. 12 Vgl. als Auswahl an einschlägigen Sammelbänden und Literaturberichten nur Michael Bull u. Les Back (Hg.), The Auditory Culture Reader, Oxford 2003; Nora M. Alter u. Lutz Koepenick (Hg.), Sound Matters. Essays on the Acoustics of Modern German Culture, ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 23 Theoretiker Jim Drobnick legitimiert seinen Ruf nach einem sonic turn unter anderem durch die „emergence of a critical mass of sound-inflected theory and art“.13 Gilt dies auch für die Geschichtswissenschaft? Sind Historikerinnen und Historiker gehalten, den nächsten turn zu vollziehen und sich vom Sehen aufs Hören umzustellen? Die Diagnose einer amerikanischen Historikerin, dass „auditory history entered the discipline with a vengeance“14 mag – zumindest für den deutschsprachigen Raum – weit übertrieben sein.15 In Bezug auf die angloamerikanische Forschung sieht die Lage etwas besser aus, finden sich hier doch einige, durchaus disparate Studien und Ansätze aus dem Bereich der Hör- und Klanggeschichte.16 Diese verbindet aber weder ein gemeinsamer 13 14 15 16 New York 2004; Veit Erlmann (Hg.), Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening, and Modernity, Oxford 2005; Harro Segeberg u. Frank Schätzlein (Hg.), Sound. Zur Technologie und Ästhetik des Akustischen in den Medien, Marburg 2005; Doris Kolesch u. Sybille Krämer (Hg.), Stimme. Annäherung an ein Phänomen, Frankfurt 2006; David W. Samuels u. a., Soundscapes. Toward a Sounded Anthropology, in: Annual Review of Anthropology 39. 2010, S. 329 – 345. Drobnick, Listening Awry, S. 10. Sophia Rosenfeld, On Being Heard. A Case für Paying Attention to the Historical Ear, in: American Historical Review 116. 2011, S. 316 – 334, hier S. 317. Vgl. jetzt aber Daniel Morat u. a. (Hg.), Politik und Kultur des Klangs im 20. Jahrhundert, Zeithistorische Forschungen 8. 2011; Alexa Geisthövel, Auf der Tonspur. Musik als zeitgeschichtliche Quelle, in: Martin Baumeister u. a. (Hg.), Die Kunst der Geschichte. Historiographie, Ästhetik, Erzählung, Göttingen 2009, S. 157 – 168 sowie schon früh Thomas Lindenberger, Vergangenes Hören und Sehen. Zeitgeschichte und ihre Herausforderung durch die audiovisuellen Medien, in: Zeithistorische Forschungen 1. 2004, S. 72 – 85. Vgl. v. a. Veit Erlmann, Reason and Resonance. A History of Modern Aurality, New York 2010; Karin Bijsterveld, Mechanical Sound. Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century, Cambridge, MA 2008; Ros Bandt u. a. (Hg.), Hearing Places. Sound, Place, Time and Culture, Newcastle upon Tyne 2007; Richard Cullen Rath, How Early America Sounded, Ithaca, NY 2003; Jonathan Sterne, The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham, NC 2003; David Garrioch, Sounds of the City. The Soundscape of Early Modern European Towns, in: Urban History 30. 2003, S. 5 – 25; Emily Thompson, The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900 – 1933, Cambridge, MA 2002; Mark M. Smith, Listening to Nineteenth-Century America, Chapel Hill, NC 2001; Leigh Eric Schmidt, Hearing Things. Religion, Illusion and the American Enlightenment, Cambridge, MA 2000; Jean-Pierre Gutton, Bruits et sons dans notre histoire, Paris 2000; Bruce R. Smith, The Acoustic World of Early Modern England. Attending to the O-Factor, Chicago 1999; vgl. auch die Literaturberichte von Daniel Morat, Sound Studies – Sound Histories. Zur Frage nach dem Klang in der Geschichtswissenschaft und der Geschichte in der Klangwissenschaft, in: kunsttexte.de/Auditive Perspektiven 4. 2010, http://edoc.huberlin.de/kunsttexte/2010 – 4/morat-daniel-3/PDF/morat.pdf sowie ders., Zur Geschichte des Hörens. Ein Forschungsbericht, in: Archiv für Sozialgeschichte 51. 2011, S. 695 – 716; Jürgen Müller, „The Sound of Silence“. Von der Unhörbarkeit der 24 Jan-Friedrich Missfelder theoretischer Horizont noch eine wirkliche Debatte über ihre Gegenstände und Methoden – was ein bekanntes Problem relativ junger Forschungsfelder sein mag. In jedem Fall ist die Forschungssituation zugleich prekär und unübersichtlich. Während manche der bestehenden klanggeschichtlichen Arbeiten eher impressionistisch sowie methodisch und theoretisch eher unterreflektiert daherkommen,17 finden sich gerade auf dem boomenden Feld der nicht (nur) historisch arbeitenden Sound Studies ebenso vielfältige wie vage Theorieangebote, die einer Evaluation für den geschichtswissenschaftlichen Zweck bedürfen.18 Im Folgenden soll skizziert werden, wie eine historische Wissenschaft des Akustischen aussehen könnte. Dabei wird die These vertreten, dass Klanggeschichte einen eigenständigen Beitrag zur Erkenntnis der allgemeinen Geschichte zu leisten vermag, der sich nicht in der Thematisierung eines bislang unterhistorisierten menschlichen Sinnes erschöpft. Um dies zu verdeutlichen, soll in einem ersten Schritt gezeigt werden, dass Klanggeschichte als spezifische Form von Sinnesgeschichte verstanden werden muss, welche der fundamentalen Konstitution aller historischen Wirklichkeit durch das menschliche Sensorium Rechnung trägt. Das bedeutet, dass Klanggeschichte nur als Hörgeschichte sinnvoll konzeptionalisiert werden kann. Aus dieser Ausrichtung ergibt sich eine Reihe von methodischen Problemen, die in einem zweiten Schritt diskutiert werden. Schließlich soll am Beispiel der akustischen Produktion sozialer und politischer Ordnungen vorgeführt werden, welche neuartigen Erkenntnisse sich aus einer konsequent klanggeschichtlichen Perspektive auf klassische Felder der Geschichtsschreibung ergeben. Vergangenheit zur Geschichte des Hörens, in: HZ 292. 2011, S. 1 – 29; Rosenfeld, On Being Heard, S. 317 – 326; Michele Hilmes, Is There a Field Called Sound Culture Studies? And Does it Matter?, in: America Quarterly 57. 2005, S. 249 – 259 sowie Mark M. Smith (Hg.), Hearing History. A Reader, Athens, GA 2004. 17 Vgl. z. B. Sieglinde Geisel, Nur im Weltall ist es wirklich still. Vom Lärm und der Sehnsucht nach Stille, Köln 2010; dagegen aber Smith, Listening to Nineteenth-Century America, bes. S. 261 – 270 und Schmidt, Hearing Things, bes. S. 1 – 37. 18 Einen Überblick bietet Sabine Sanio, Aspekte einer Theorie der auditiven Kultur. Ästhetische Praxis zwischen Kunst und Wissenschaft, in: kunsttexte.de/Auditive Perspektiven 4. 2010, http://www.kunsttexte.de/index.php?id=711&idartikel=37461& ausgabe=37455&zu=907&L=0; vgl. auch Holger Schulze (Hg.), Sound Studies. Traditionen, Methoden, Desiderate. Eine Einführung, Bielefeld 2008; Holger Schulze u. Christoph Wulf (Hg.), Klanganthropologie, Paragrana 16. 2007. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 25 I. Klio von Sinnen Um die mögliche Reich- und Tragweite einer klangorientierten Geschichtswissenschaft umreißen zu können, ist es hilfreich, noch einmal einen Blick auf Struktur und Selbstanspruch des vorgängigen iconic turn zu werfen. Beide, iconic und sonic turn, lassen sich nämlich als Varianten einer allgemeinen Hinwendung zu den Sinnen als Grundierung kulturwissenschaftlicher Erkenntnis verstehen. Dass dies nicht nur die Ebene des Gegenstands betrifft, sondern die epistemologische Struktur der Erkenntnis selbst, lässt sich bereits am Beispiel des iconic turn aufzeigen. Mit diesem ist erheblich mehr verbunden als die verstärkte Berücksichtigung visuellen Materials in der historischen Quellenkunde. Als der amerikanische Literatur- und Bildtheoretiker W. J. T. Mitchell 1992 den pictorial turn ausrief, reagierte er damit auf ein Unbehagen am in den Kultur- und Geisteswissenschaften vorherrschenden textuellen Paradigma, installiert durch den vorherigen, den linguistic turn. Für ihn lag im pictorial turn die Chance einer „postlinguistic, postsemiotic rediscovery of the picture as a complex interplay between visuality, apparatus, institutions, discourse, bodies, and figurality“.19 Mit dieser Perspektive stieß er auf weitreichende Zustimmung. Gängige Formeln von der Kultur als Text, vom endlosen Spiel der Zeichen oder von der Lesbarkeit der Welt erschienen immer weniger überzeugend. Es gebe, so zum Beispiel der Basler Bildwissenschaftler Gottfried Boehm, jenseits der Sprache „gewaltige Räume von Sinn, ungeahnte Räume der Visualität, des Klanges [sic!], der Geste, der Mimik und der Bewegung“,20 die sich nicht als Texte verstehen und analysieren ließen, sondern einer eigenen Logik gehorchten. Horst Bredekamp schließlich rief zur „methodischen Schärfung der bildlichen Analysemittel auf jedwedem Feld und in jeglichem Medium“21 auf und formulierte damit den Anspruch der neu konstituierten Bildwissenschaft auf den Status einer Leitwissenschaft weit über die engere Disziplin der Kunstgeschichte hinaus. Die Rede von einer „ikonische[n] Episteme“,22 die aus der dem Text als Paradigma verpflichteten Hermeneutik herausführe und vielmehr einer „Logik des Zeigens“ folge, zeugt von einer grundlegenden Verschiebung in der kulturwissenschaftlichen Theorietektonik. Worin genau die Folgen für jene Disziplinen bestehen, die 19 William J. T. Mitchell, The Pictorial Turn [1992], in: ders., Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1994, S. 11 – 34, hier S. 16. 20 Gottfried Boehm, Jenseits der Sprache. Anmerkungen zur Logik der Bilder, in: Christa Maar u. Hubert Burda (Hg.), Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder, Köln 2004, S. 29 – 43, hier S. 43. 21 Horst Bredekamp, Drehmomente. Merkmale und Ansprüche des iconic turn, in: ebd., S. 15 – 26, hier S. 16. 22 Gottfried Boehm, Das Paradigma „Bild“. Die Tragweite der ikonischen Episteme, in: Hans Belting (Hg.), Bilderfragen. Die Bildwissenschaft im Aufbruch, München 2007, S. 77 – 82, hier S. 78 und öfter. 26 Jan-Friedrich Missfelder sich nicht primär oder nicht ausschließlich der Analyse von Bildern widmen, bleibt dabei aber meist eher vage. Insbesondere in der Geschichtswissenschaft ist alles andere als deutlich, wie ein Versuch „nicht nur […] Bilder zu verstehen, sondern die Welt durch Bilder zu verstehen“23 konkret aussehen soll. Jenseits der Frage der konkreten Umsetzung des Leitwissenschaftsanspruchs im iconic turn fällt aber vor allem auf, dass dieser eine klare Hierarchie in das menschliche Sensorium einführt. Die Betonung des Gesichtssinns gegenüber den anderen Sinnen für die Erkenntnis der Welt sei, so die Annahme des iconic turn, der spät- beziehungsweise postmodernen Situation einzig angemessen.24 In dem man den Blick auf Visualität richtet, reagiert man auf eine vielfach beklagte „Bilderflut“ und versucht, diese „begrifflich zu dämmen“ und die Bildanalyse damit „in das Zentrum einer kritischen Philosophie der Gegenwart“ zu rücken.25 Insbesondere im verstärkten Auftreten rein technisch generierter Bilder in Kunst, Medien und Wissenschaften zeige sich die „Dämmerung einer alten Welt“26 der Korrespondenz zwischen Bild und Realem.27 Damit fielen klassische Fragen nach Abbildcharakter oder Repräsentation hinweg zugunsten einer reinen Präsenz des Visuellen, das seinerseits Realitäten erst generiert. Die spezifische historische Situation der Gegenwart, so wird hier suggeriert, erzwinge geradezu die Privilegierung eines Sinnes als ein wissenschaftliches Paradigma. Vor diesem Hintergrund ist es nur verständlich, wenn auch der acoustic turn nicht antritt, das Visuelle als Leitkategorie der Kulturwissenschaften zu bestreiten oder gar zu beerben. Vielmehr nutzen seine Vertreter eingestandenermaßen den „Diskurseffekt der Aufmerksamkeitserzeugung“,28 der im Slogan vom turn liegt, um das Augenmerk auf akustische Phänomene innerhalb der Kultur zu lenken, die einem allzu souveränen Blick auf das rein Visuelle zu entgehen drohten. Worum es 23 Bachmann-Medick, Cultural Turns, S. 349, Hervorhebung im Original. 24 Vgl. zur spezifisch modernen Vorgeschichte dieser Hierarchisierung anregend David M. Levin (Hg.), Modernity and the Hegemony of Vision, Berkeley, CA 1993. 25 Bredekamp, Drehmomente, S. 20. Vgl. auch Mitchell, Pictorial Turn, S. 16: „Most important, it is the realization that while the problem of pictorial representation has always been with us, it presses us inescapably now, and with unprecedented force, on every level of culture, from the most refined philosophical speculations to the most vulgar productions of mass media.“ 26 Boehm, Paradigma „Bild“, S. 77. 27 Vgl. hierzu auch Friedrich Kittler, Schrift und Zahl. Die Geschichte des errechneten Bildes, in: Maar u. Burda, Iconic Turn, S. 186 – 203. 28 Petra Maria Meyer, Vorwort, in: dies. (Hg.), Acoustic Turn, S. 13 – 31, hier S. 18. Meyer behauptet etwas unklar, dass den anderen „proklamierten turns (vom ,linguistic turn‘ über den ,semiotic turn‘, den ,iconic turn‘ und ,performative turn‘ zum ,medial turn‘) immer schon ein acoustic turn innewohnt“, S. 13. Es gehe daher darum, „diese zu ergänzen und zu neuen Reflexionen heraus[zu]fordern“, S. 16. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 27 geht, ist also keine Umkehrung von Sinneshierarchien, sondern allenfalls die Erhöhung der Komplexität in einer auf vornehmlich einen Sinn ausgerichteten Wissenschaftskultur. Die Gegenwart bleibt dabei primär visuell strukturiert, ein acoustic turn ist zunächst nicht viel mehr als eine Pirouette innerhalb der ikonischen Episteme moderner Kultur. Dieser Konstellation liegt, wiewohl uneingestanden und implizit, eine eigene historische These zugrunde. Die Meistererzählung von der in der Moderne einsetzenden Dominanz des Visuellen als dem Medium der Vernunft und der Wahrheitsproduktion (Hans Blumenberg),29 aber auch spezifisch moderner Überwachungstechnologien (Michel Foucault)30 bei gleichzeitiger Marginalisierung der anderen Sinne schreibt sich bis in die Gegenwart und in deren Epistemologie fort.31 Diese These lässt sich ihrerseits historisieren. Die Sinne und das Sinnieren über die Sinne, das macht die turn-Diskussion deutlich, haben beide Anteil an der jeweiligen historischen Situation, in der sie stehen. Sie lassen sich nicht ablösen von ihrer sozialen, kulturellen und politischen Umgebung, sondern bilden diese als je spezifische, historisch variable Konfiguration der Sinne ab. Es erscheint demnach als eine ureigene Aufgabe der Geschichtswissenschaft, den scheinbar natürlich gegebenen Sinnesapparat als soziales und kulturelles Phänomen zu historisieren.32 Ebenso wie jegliche Erfahrung nur eine sinnlich vermittelte ist, ist jegliche Geschichte demnach in gewisser Weise Sinnesgeschichte. Versteht man den iconic turn metonymisch als eine Wende vom (textuellen) Sinn zu den Sinnen in den Kulturwissenschaften, so ließe sich seiner Opposition gegen den linguistic turn eine Variante von dessen Credo 29 Vgl. Hans Blumberg, Licht als Metapher der Wahrheit. Im Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung, in: ders., Ästhetische metaphorologische Schriften, Frankfurt 2001, S. 139 – 171. 30 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt 1976; ders., Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, Frankfurt 1973. 31 Vgl. paradigmatisch Marshall McLuhan, Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Düsseldorf 1968; ders. u. Edmund Carpenter, Acoustic Space, in: dies. (Hg.), Explorations in Communication, Boston 1960, S. 65 – 70; vgl. zu McLuhans Medientheorie des Akustischen auch Nils Röller, Marshall McLuhan und Vilm Flusser zur Tragödie des Hörens, in: Hans-Peter Schwarz (Hg.), Aufträge. Zweites Zürcher Jahrbuch der Künste 2005, Zürich 2006; auch Walter J. Ong, Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen 1987; als Kritik an dieser „great divide theory“ Mark M. Smith, Sensing the Past. Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, Berkeley, CA 2007, bes. S. 8 – 13. 32 Vgl. als knappe Einführung Wolfram Aichinger, Sinne und Sinneserfahrung in der Geschichte. Forschungsfragen und Forschungsansätze, in: ders. u. a. (Hg.), Sinne und Erfahrung in der Geschichte, Innsbruck 2003, S. 9 – 28; Smith, Sensing the Past, sowie die Beiträge in David Howes (Hg.), Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, Oxford 2005. 28 Jan-Friedrich Missfelder abgewinnen: „Il n’y a pas d’hors sens.“ In dieser Perspektive ergibt dann auch der hypertrophe Umfassendheitsanspruch des iconic turn neuen, anderen Sinn. Sinnesgeschichte erscheint so nicht als eine weitere „BindestrichGeschichte“ (Ute Daniel) neben Politik-, Sozial-, Geschlechter- oder Tiergeschichte, sondern als ein neuer „habit“ der Analyse jeglichen Gebietes der Geschichte in jeglichem Quellenmedium: „an embedded way of remaining vigilant about and sensitive to the full sensory texture of the past“.33 Sinnesgeschichte hat in diesem Sinne keinen prinzipiell abgegrenzten Gegenstand, sondern stellt eine Art und Weise dar, das Ganze der Geschichte neu, von der sinnlichen Konstituierung der Wirklichkeit her zu fassen. Ebenso entspricht einer Sinnesgeschichte als „habit“ keine privilegierte Quellengattung. Es gilt vielmehr, das gesamte Spektrum historischen Materials auf die Thematisierung von Sinnen und sinnlicher Wahrnehmung hin neu zu lesen. Hier sind ganz unterschiedliche Zugriffe denkbar. So schreibt Alain Corbin, der Hauptvertreter neuerer französischer Sinnesgeschichte in der Tradition der Annales, seine fulminante Wahrnehmungsgeschichte „ländlicher Gefühlskultur“ am Beispiel französischer Glockenkonflikte des 19. Jahrhunderts auf der Basis normativer Quellen, Bürgereingaben und Verwaltungsakten.34 Mark M. Smiths Klanggeschichte des Amerikanischen Bürgerkriegs und seiner Vorgeschichte stützt sich dagegen stark auf Selbstzeugnisse, Reiseberichte und Presseartikel.35 Beiden gemeinsam ist methodisch nur der neue Zugriff auf bekanntes Material. Die „masses dormantes“36 an sinnesgeschichtlichen Quellen stellen also kein unentdecktes historiographisches Neuland dar und führen auf kein gänzlich neues Feld der Geschichtswissenschaft. Vielmehr ermöglicht der „habit“ der Sinnesgeschichte einen anderen Blick auf vertrautes Gelände und eröffnet gerade dadurch neue Fragestellungen.37 Die historiographischen Traditionen einer solchen Sinnesgeschichte sind ehrwürdig, haben aber noch kaum eine eigentliche Forschungsrichtung innerhalb des Faches begründen können. Neben obligaten Referenzen auf Karl 33 Smith, Sensing the Past, S. 5; vgl. auch ders., Producing Sense, Consuming Sense, Making Sense. Perils and Prospects for Sensory History, in: Journal of Social History 40. 2007, S. 841 – 858; Daniel Morat, Sinne, in: Anne Kwaschik u. Mario Wimmer (Hg.), Von der Arbeit des Historikers. Ein Wörterbuch zur Theorie und Praxis des Historikers, Bielefeld 2010, S. 183 – 186. 34 Vgl. Alain Corbin, Die Sprache der Glocken. Ländliche Gefühlskultur und symbolische Ordnung im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Frankfurt 1994. 35 Vgl. Smith, Listening to Nineteenth-Century America. 36 Alain Corbin, Historien du sensible. Entretiens avec Gilles Heur, Paris 2000, S. 107. 37 Vgl. auch Richard Cullen Raths Erfahrungen einer Relektüre bekannten Materials: „When I started working with some of the primary sources Hall and Thomas used, I noticed that where the two historians usually referred to beliefs about lightning, the sources spoke of thunder.“ Ders., Hearing American History, in: Journal of American History 95. 2008, S. 417 – 431, hier S. 417. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 29 Marx38 und Georg Simmel39 könnten vor allem prominente Vertreter der Annales-Schule Inspiration liefern. Das Interesse an der kulturellen Formung der Sinne begleitet alle Generationen der Annales zumindest untergründig. Dabei variiert der Kontext ihrer Thematisierung ganz erheblich. So diagnostizierte Lucien Febvre eine seiner Ansicht nach „außerordentliche Empfänglichkeit [des vormodernen Menschen, J.-F.M.] für alle Außenreize“ zunächst in einem Aufriss zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychologie,40 arbeitete diese These dann aber in seiner Studie über das „Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert“ zu einem zentralen Bestandteil seiner Analyse des vormodernen „geistigen Rüstzeugs“ (outillage mental) aus.41 Febvre erkennt im 16. Jahrhundert eine fremde Sinnenwelt nicht nur hinsichtlich der sinnlich wahrnehmbaren Umwelt, sondern konstatiert auch einen anderen Modus der Wahrnehmung. Für Febvre geht die verstärkte Reizbarkeit seiner Kronzeugen Rabelais und Ronsard einher mit einer Periode „besonders ausgeprägter Affektivität“,42 beide fügen sich zu einer erhöhten „Spannung des Lebens“ (Johan Huizinga),43 gegenüber der die anästhesierte Moderne schal, blechern und bleich daherkommt.44 Diesen romantisierend-kulturkritischen Impetus teilt Febvre auch mit Robert Mandrou, der eine Annales-Generation später für die Vormoderne immer noch eine „prdominance de l’affectif sur l’intelligence“45 konstatiert. Febvre und Mandrou schreiben die Erzählung 38 Vgl. seine vielfach zitierte Bemerkung in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ von 1844: „Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte.“ Zitiert in Marx-Engels-Studienausgabe, hg. v. Iring Fetscher, Bd. 2: Politische Ökonomie, Frankfurt 1990, S. 38 – 128, hier S. 103. 39 Vgl. Georg Simmel, Exkurs über die Soziologie der Sinne, in: ders., Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, hg. v. Otthein Rammstedt (= Georg Simmel Gesamtausgabe, Bd. 11), Frankfurt 1992, S. 722 – 742. 40 Lucien Febvre, Geschichte und Psychologie [1938], in: ders., Das Gewissen des Historikers, Berlin 1988, S. 79 – 90, hier S. 86. 41 Vgl. Lucien Febvre, Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert. Die Religion des Rabelais, Stuttgart 2002 [1942], S. 372 – 382, Zitat S. 313. 42 Lucien Febvre, Sensibilität und Geschichte [1941], in: ders., Gewissen, S. 91 – 107, hier S. 98. 43 Vgl. Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters, Stuttgart 197511, S. 2. 44 Eine solche Perspektive findet sich in Ansätzen auch noch (oder wieder?) in aktueller sinnes- und klanggeschichtlicher Literatur. Vgl. z. B. David Wickberg, What is the History of Sensibilities? On Cultural Histories Old and New, in: American Historical Review 112. 2007, S. 661 – 684; Rath, How Early America Sounded, S. IX: „Sound was more important to early Americans than it is to you.“ S. 9: „These were worlds much more alive with sound than our own, worlds not yet disenchanted, worlds perhaps even chanted into being.“ Vgl. als Hintergrund auch Wolfgang Welsch, Ästhetik und Anästhetik, in: ders., Ästhetisches Denken, Stuttgart 19985, S. 9 – 40. 45 Robert Mandrou, Introduction la France moderne, 1500 – 1640. Essai de psychologie historique [1961], Paris 1998, S. 89. 30 Jan-Friedrich Missfelder eines rationalen und daher visuell strukturierten gegenüber einem affektiven und daher auf Gehör und die Nahsinne ausgerichteten Zeitalter in einem durchaus anregenden Kurzschluss von Sinnes- und Emotionsgeschichte fort. Die Vormoderne erscheint dabei als ein „temps qui prfre couter“,46 in der aber auch Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn eine viel vitalere Rolle spielen als in der tendenziell einsinnig visuellen Moderne. Geändert habe sich dies erst mit dem Siegeszug des Buchdrucks, der Informationsgewinnung und -übermittlung durch individuelle und stille Lektüre. Restbestände dieser Meistererzählung finden sich auch noch bei Alain Corbin. Seine Studien zur Geschichte des Geruchs im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und zur akustischen Kommunikationskultur der Glocken im ländlichen Frankreich des 19. Jahrhunderts skizzieren ebenfalls eine verlorene Welt synästhetischer Komplexität, gehen aber in methodischer wie materieller Hinsicht weit über die Vorarbeiten Febvres und Mandrous hinaus.47 Hatten diese vor allem literarische Quellen als Zeugnisse historischer Sinneszustände herangezogen und die damit verbundenen quellenkritischen Schieflagen kaum thematisiert, so taucht Corbin tief in die lokalen Archive hinab und zieht verstärkt Selbstzeugnisse heran. Sinnesgeschichte besteht für Corbin gleichwohl weiterhin in der Erforschung „unterschiedlicher Wahrnehmungs- und Affektsysteme“ sowie des historischen Gebrauchs der Sinne, der aber weiterhin im Rahmen einer „Sinneshierarchie“ geschieht.48 Sinnesgeschichte la franÅaise lässt sich also charakterisieren als Thematisierung von historischen Verschiebungen im System der Sinne, als Beschreibung wechselnder Hierarchien und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Sensibilitäten. Spuren solcher Verschiebungen fanden Febvre und Mandrou noch in mehr oder weniger expliziten Thematisierungen des sensorischen Systems in Literatur und Ideengeschichte, während Corbin eine anthropologische Wende vollzieht und das historische Material gegen den Strich auf eher implizite Strukturierungen der Sinne hin liest. Gemeinsam ist allen aber eine historische Großthese, welche die Modernisierung als Ersetzung des Gehörs durch das Gesicht als Leitsinn begreift und mit dem Siegeszug der Visualität eine tendenzielle Verarmung der anderen Sinne diagnostiziert.49 Der Betonung von wechseln46 Mandrou, Introduction la France moderne, S. 76. 47 Vgl. Alain Corbin, Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs [1982], Berlin 1984; ders., Sprache der Glocken. 48 Alain Corbin, Zur Geschichte und Anthropologie der Sinneswahrnehmung [1991], in: Christoph Conrad u. Martina Kessel (Hg.), Kultur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung, Stuttgart 1998, S. 121 – 140, hier S. 128 bzw. S. 132. Vgl. zu Corbins Methode auch Sima Godfrey, Alain Corbin. Making Sense of French History, in: French Historical Studies 25. 2002, S. 381 – 398. 49 Vgl. aber zur Kritik an Corbin am Beispiel seiner These einer desodorierten Moderne Annick Le Gurer, Le dcin de l’olfactif, mythe ou ralit?, in: Anthropologie et Socits 14. 1990, S. 25 – 44. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 31 den Sinneshierarchien entspricht dabei eine relativ breite ideengeschichtliche Strömung innerhalb der Sinnesgeschichte, die sich vor allem der Reflexion auf das System der Sinne, ihr Zusammenspiel und ihre Funktionen in Philosophie, Theologie, Musik und Medizin widmet.50 Die hier skizzierten großen Erzählungen entlang eines SinneshierarchieParadigmas verschränken also zwei verschiedene Prozesse zu einer komplexen sinnesgeschichtliche Modernisierungstheorie: die great divide51 zwischen einer auditiven Vormoderne und der modernen Visualität und die Verarmung eines tendenziell synästhetischen Weltverhältnisses zur modernen MonoSinnlichkeit. So wünschenswert ein systemischer Ansatz bleibt, der nicht nur einen Sinn in den Blick nimmt, sondern seine historische Wandlung im Verhältnis zum gesamten Sensorium analysiert, so problematisch bleibt doch die Verknüpfung der Historisierung von Hierarchien mit damit verbundenen Modernisierungsvorstellungen. Das zeigt sich sogar noch bei Ansätzen, die sich explizit gegen die These der great divide wenden. So argumentiert zum Beispiel Mark M. Smith gegen die Logik eines Nullsummenspiels in der Sinnesgeschichte, nach der die scheinbare Aufwertung eines Sinnes (meist des Gesichtssinnes) notwendig mit der Verarmung eines anderen einhergehen müsse. Statt dessen plädiert er für ein dynamisches Modell von „intersensoriality“, um zu zeigen, dass „the other senses not only remained important [but] became critical to modernity“.52 Dabei bleibt er aber einem modernisierungstheoretischen Modell verpflichtet und kann nur immer wieder von neuem zeigen, dass nicht nur Visualität, sondern auch Gehör, Geschmack, Geruch und Tastsinn ihren Ort in der Moderne finden.53 Das ist zunächst 50 Vgl. vor allem Robert Jütte, Geschichte der Sinne. Von der Antike bis zum Cyberspace, München 2000, der vor allem eine „Geschichte der sinnlichen Wertordnungen gegenwärtiger und vergangener Kulturen sowie der sich verändernden Hierarchie der Sinnesvorstellungen und der Sinnesgebräuche“ (S. 22) im Sinn hat. Vgl. weiter Richard Newhauser u. Corine Schleif (Hg.), The Senses in Medieval and Renaissance Intellectual History, The Senses and Society 5. 2010; Stephen G. Nichols u. a. (Hg.), Rethinking the Medieval Senses. Heritage, Fascinations, Frames, Baltimore 2008; Christopher M. Woolgar, The Senses in Late Medieval England, New Haven, CT 2006; Anthony Synnott, Puzzling over the Senses. From Plato to Marx, in: David Howes (Hg.), The Varieties of Sensory Experience, Toronto 1991, S. 61 – 76; zum Gehör v. a. Charles Burnett u. a. (Hg.), The Second Sense. Studies in Hearing and Musical Judgement from Antiquity to the Seventeenth Century, London 1991. 51 Smith, Sensing the Past, S. 8. 52 Vgl. ebd., bes. S. 125 – 128, Zitat S. 128. 53 Vgl. nur als Zusammenstellung: „[S]ound increasingly mediated and helped inform ideas about class, identity, and nationalism, especially, in the nineteenth century.“, ebd., S. 48; „Modernity was deeply indebted to smell and olfaction.“, ebd., S. 65; „The sense of taste, in fact, received something of a boost from modernity and continued to inform some of its fundamental categories, nationalism especially.“, ebd., S. 85; „[T]ouching 32 Jan-Friedrich Missfelder einmal durchaus sehr verdienstvoll, erhöht es doch die Komplexität des gezeichneten Bildes enorm und verabschiedet die ganz und gar unhistorische Obsession, ganze Epochen auf sensorische Dominanzen und die damit verbundenen Grundannahmen über deren Charakter hin prüfen zu müssen. Um es noch einmal am gängigen Gegenüber von visueller Moderne und einer Vormoderne, „qui prfre couter“, zu wiederholen: Klassische Attribute der Moderne – Distanzierung, Rationalisierung, Säkularisierung, Objektivierung, etc. – werden dem Visuellen zugeschrieben, gegen welches das Auditive als Medium der Nähe, der Wärme und des Heiligen profiliert wird.54 Explizit modernekritische Theorieentwürfe von Heidegger über Horkheimer bis Derrida setzen daher auch vielfach mit einer Kritik der objektivierenden – im Sinne von verdinglichenden – Funktion des Blicks an.55 Die Identifikation von Visualität mit Distanz und Zeitlichkeit sowie Auralität mit Präsenz suggeriert dabei eine Ahistorizität von Klang und akustischer Wahrnehmung, die sich ihrer Historisierung immer schon zu entziehen scheinen. Es ist diese „audiovisual litany“,56 zu deren Überwindung eine Sinnesgeschichte (nicht nur) der Neuzeit einen systematischen Beitrag leisten kann. Der kanadische Medienwissenschaftler Jonathan Sterne folgert aus seiner eigenen Polemik gegen die „audio-visuelle Litanei“ ähnlich wie Mark M. Smith, dass auch eine Klanggeschichte einen legitimen Ort in der Geschichte der Moderne beziehungsweise im Prozess der Modernisierung beanspruchen kann. Sein eigener Beitrag, eine Studie zur Kulturgeschichte der Klangreproduktion im 19. und 20. Jahrhundert, „explores the ways in which the history of sound contributes and develops from the ,maelstrom‘ of modern life“.57 Es folgen die klassischen Charakteristika der Moderne vom Kapitalismus über Bürokratisierung zur Fortschrittsgläubigkeit. So legitim diese Geschichte auch ist und so viele neue und überraschende Einsichten sie auch birgt, so problematisch erscheint doch die Idee des Beitrags („contribution“) zu einer eigentlich schon bekannten Geschichte. So konzipiert, läuft Klanggeschichte Gefahr, durch die – man verzeihe das schiefe Bild – Brille des Klangs all das noch einmal zu bestätigen, was man ohnehin schon über die Moderne und ihr Anderes weiß. Zugleich verpasst sie die weiterführende Frage, ob gängige Periodisierungen, die traditionell aus Politik-, Wirtschafts- oder Sozialgeschichte stammen, sinnesgeschichtlich überhaupt eine Bedeutung haben oder ob nicht mit gänzlich anderen Rhythmen, Phänomenen langer Dauer oder epistemischen Brüchen 54 55 56 57 was inextricable to the elaboration of a post-Renaissance and post-Enlightenment world.“, ebd., S. 99. Vgl. exemplarisch und für viele Ong, Oralität, und (durchaus kritisch) Welsch, Kultur des Hörens. Vgl. Martin Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley, CA 1993. Sterne, Audible Past, S. 14. Ebd., S. 9. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 33 zu rechnen ist.58 Es käme also auf den Versuch einer Klanggeschichte an, die nicht nur eine bis dato vernachlässigte Dimension menschlicher Erfahrung historisiert und der Geschichtswissenschaft zuallererst einmal erschließt, sondern entscheidend neue, nur über die Aufmerksamkeit auf Klänge zugängliche Aspekte entdeckt. Andernfalls verbleibt sie im Stadium der hinzugefügten Komplementärgeschichte.59 II. Klang- und Hörkulturen Das Grundproblem jeder nicht-komplementären Klanggeschichte vor dem Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit – aber letztlich auch danach – ist so trivial wie folgenreich: ihr Gegenstand ist verklungen. Im Unterschied zur inzwischen fest etablierten Analyse visueller Kulturen sieht sich die Geschichte des Klangs mit der nicht überwindbaren Schwierigkeit konfrontiert, dass ihr Objekt vielfach nicht mehr in der zumindest physiologisch analogen Form gegeben ist. Bilder sind vielfach überliefert, Klänge in der Regel nicht. Visuelle Medien in Form etwa von Kunstwerken oder Architektur bieten sich oftmals dem Blick des Historikers oder der Historikerin selbst dar und gewinnen ihre Qualität als „Zeugen ihrer Zeit“ (Bernd Roeck) gerade durch die Differenz zum Blick vergangener Betrachter. Das konstitutiv Ephemere des Klangs, seine existenzielle Zeitgebundenheit verhindert zunächst diese sich gleichsam von selbst einstellende Historisierungsaufgabe. Die Überlieferung von Klängen als akustischen Ereignissen schaltet daher immer eine mediale Zwischenebene ein: Notenschrift, Klangobjekte als Überreste vergangener materieller Kultur sowie vor allem Versprachlichungen von Hörerfahrungen aller Art. Das betrifft auch, wenngleich in unterschiedlicher Weise, Formen technischer Klangaufzeichnung. Walzen, Tonbänder, Schallplatten oder mp3Dateien suggerieren zwar den Realitätseffekt einer naturgetreuen Wiedergabe des Verklungenen, sind aber prinzipiell nicht weniger medial form(at)iert als andere Medien der akustischen Inskription.60 Daraus folgt zum einen, dass jede Geschichte des Klangs immer auch Mediengeschichte seiner Speicherung sein muss. Dabei besteht zunächst einmal kein qualitativer Unterschied darin, ob diese Speicherung als Verschriftlichung von akustischen Wahrnehmungen vorliegt oder als Einschreibung in technische Medien. Mediengeschichte gerade auch des Akustischen erschöpft sich damit nicht in der Nacherzählung technischer Innovationen, sondern lässt sich als Kulturgeschichte komplexer Einschreibungsprozesse in unterschiedliche Medien, von Sprache über Schrift 58 Vgl. in diesem Sinne auch die Bemerkungen bei Martin Jay, In the Realm of the Senses. An Introduction, in: American Historical Review 116. 2011, S. 307 – 315, bes. S. 311 f. 59 Ähnlich auch Geisthövel, Tonspur, S. 166 f. 60 Vgl. zu diesem Zusammenhang instruktiv Lisa Gitelman, Scripts, Grooves, and Writing Machines. Representing Technology in the Edison Era, Stanford, CA 1999. 34 Jan-Friedrich Missfelder bis zu digitalen Speichern beschreiben. Jonathan Sterne hat gerade für technische Medien der Klangaufzeichnung gezeigt, dass ihre Erfindung und Entwicklung auf außertechnischen, kulturellen Voraussetzungen beruht.61 Er wendet sich damit gegen eine starke Strömung insbesondere in der deutschen Medientheorie und -geschichtsschreibung, die die Geschichte einem technisch-medialen Apriori unterwirft und damit auch einen qualitativen Bruch in der Entwicklung technischer Medien annimmt.62 Zum anderen wird durch die Einsicht in die mediale Verfasstheit alles Verklungenen deutlich, dass dieses nur im Kontext einer kulturellen Einordnung und Deutung greifbar ist, was wiederum nur möglich ist durch den Rekurs auf nichtklangliches Quellenmaterial, das über die Sinnhorizonte und Zuschreibungsformen akustischer Wahrnehmung informiert.63 Aus diesen Überlegungen lassen sich zwei methodische Prämissen ableiten. Erstens: Klanggeschichte konstituiert ihren Gegenstand über Umwege, über Quellen also, die nicht den Klang selbst überliefern, sondern allenfalls Aufschluss über seine spezifische historische Wahrnehmung bieten. Klanggeschichte ist daher immer auch Mediengeschichte seiner Repräsentationen. Zweitens: Geht man von der fundamentalen Historizität akustischer Wahrnehmungsformen aus, die sich über wandelbare Deutungen von Klängen äußert, dann treten vor allem die kulturellen, sozialen und politischen Kontexte der Klangproduktion wie -rezeption in den Mittelpunkt des Interesses. Aus der Tatsache, dass Klanggeschichte also überhaupt nur als Geschichte der Klangwahrnehmung, -verarbeitung und -speicherung, letztlich also als Hörgeschichte geschrieben werden kann, resultiert methodisch daher fast notwendig ein gemäßigter (oder radikaler) Konstruktivismus als analytische Grundhaltung: Klänge sind eben erst durch die sich historisch wandelnden Wahrnehmungs- und Deutungsmuster sowie ihre medialen Repräsentationsformen als historische Phänomene und Gegenstände historischer Forschung konstituierbar. Es wäre daher schon aus quellenkritischen Überlegungen heraus irreführend, eine reine Rekonstruktion einer verklungenen Klangumwelt (soundscape) zu versuchen. Absicht und Ziel von Klanggeschichte kann also keineswegs eine 61 Vgl. Sterne, Audible Past. 62 Vgl. zum technisch-medialen Apriori zusammenfassend Knut Ebeling, Das technische Apriori, in: Archiv für Mediengeschichte 6. 2006, S. 11 – 22; auch Jan-Friedrich Missfelder, Endlich Klartext. Medientheorie und Geschichte, in: Jens Hacke u. Matthias Pohlig (Hg.), Theorie in der Geschichtswissenschaft. Einblicke in die Praxis des historischen Forschens, Frankfurt 2008, S. 181 – 198. 63 Vgl. in diesem Sinne auch Bruce R. Smith, Listening to the Wild Blue Yonder. The Challenges of Acoustic Ecology, in: Bandt, Hearing Places, S. 249 – 270. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 35 Inventarisierung des Verklungenen sein,64 sondern vielmehr die Erforschung der Bedeutungshorizonte, welche vergangene Gesellschaften und historische Akteure der akustischen Dimension ihrer Erfahrung zuschrieben. Man wird nie wissen, wie es eigentlich geklungen, sondern nur, wie Menschen ihre Klangumwelt wahrnahmen und in ihr handelten. Diese Wahrnehmungen und Handlungen sind demnach als soziale Praktiken und politische Strategien innerhalb einer Gesellschaft zu verstehen. Man hat es also mit „Dramatisierungen“ akustischer Wahrnehmungen als „conventions of persuasive speaking about sound“ zu tun,65 durch die historische Akteure politische und gesellschaftliche Ziele verfolgen können, ihre soziale Position markieren, ihre Sensibilität ausstellen oder Lärmbelästigung einklagen. Hier lassen sich akustische Sagbarkeitsregime identifizieren, die den Rahmen historisch gegebener Dramatisierungen abstecken und damit eine spezifische Klangund Hörkultur bestimmen. Zur Beschreibung einer solchen Klang- und Hörkultur empfiehlt es sich für die Geschichtswissenschaft, auch in diesem Fall auf die Signale zu hören, die eine theoretisch ausgeformte Sinnesanthropologie schon seit einiger Zeit aussendet,66 um so dem seit bald 25 Jahren antrainierten ethnographischen Blick auch ein ethnographisches Ohr oder besser : einen ethnographischen Sinnesapparat hinzufügen zu können.67 Besonders hilfreich für den Ansatz der hier skizzierten Klanggeschichte erscheint Steven Felds Begriff der „acoustemology“. Indem er Akustik und Epistemologie verschaltet, bezeichnet Felds Terminus das „potential of acoustic knowing, of sonic presence and awareness of sounding as potent shaping forces in how people make sense of experiences“.68 Akustemologie zielt demnach auf die spezifisch akustische Art der 64 Vgl. dazu schon die Polemik gegen einen solchen klanggeschichtlichen Positivismus, wie ihn z. B. Guy Thuiller vertritt (vgl. ders., Pour une histoire du quotidien au XIXe sicle, Paris 1977), bei Corbin, Geschichte und Anthropologie, S. 123 f. 65 Vgl. zu Begriff und Konzept Bijsterveld, Mechanical Sound, hier S. 30. 66 Vgl. nur David Howes, Sensual Relations. Engaging the Senses in Culture and Social Theory, Ann Arbor, MI 2003; ders., Can these dry Bones Live? An Anthropological Approach to the History of the Senses, in: Journal of American History 95. 2008, S. 442 – 451; David Le Breton, Le saveur du monde. Une anthropologie des sens, Paris 2006; Constance Classen, Worlds of Sense. Exploring the Senses in History and across Cultures, London 1993. 67 Begriff nach James Clifford, Introduction. Partial Truths, in: ders. u. George E. Marcus (Hg.), Writing Cultures. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, CA 1986, S. 1 – 26, hier S. 12; vgl. auch Veit Erlmann, But What of the Ethnographic Ear?, in: ders., Hearing Cultures, S. 1 – 20 und Regina Bendix, The Pleasures of the Ear. Toward an Ethnography of Listening, in: Cultural Analysis 1. 2000, S. 33 – 50. 68 Steven Feld, Waterfalls of Song. An Acoustemology of Place Resounding in Bosavi, Papua New Guinea, in: ders. u. Keith H. Basso (Hg.), Senses of Place, Santa Fe, NM 1996, S. 91 – 135, hier S. 97; auch ders., A Rainforest Acoustemology, in: Bull, Auditory 36 Jan-Friedrich Missfelder Welterfahrung und Weltdeutung einer Gesellschaft. Klangphänomene, so Felds Hypothese, spielen eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung sozialer Ordnung, der Organisation von Wissen und gesellschaftlicher Kommunikation sowie – für Anthropologen zentral – der Kosmologie. Klang ist daher in der Perspektive der Akustemologie stets mit Bedeutung versehen und wird zu einem sozialen Phänomen durch seine Wahrnehmung und Einordnung in ein deutendes System. Schließlich bietet das Konzept der Akustemologie auch die Möglichkeit der reflexiven Wendung. Es geht dann nicht nur um die Bedeutung von Klängen für die Etablierung sozialer und kultureller Ordnungen, sondern auch um die „soundways“ historischer Akteure, also „the paths, trajectories, transformations, mediations, practices and techniques – in short, the ways – that people employed to interpret and express their attitudes and beliefs about sound“.69 Anthropologen wie Steven Feld oder David Howes zeigen in ihren Arbeiten, dass Ethnien wie die Kaluli oder Massim in Papua-Neuguinea umfassende Parameter der Weltorientierung nach vornehmlich akustischen Kriterien entwickeln.70 Sie beschreiben differenzierte Klang- und Hörkulturen, die im Zentrum der jeweiligen Weltdeutungssysteme stehen. Auf diese Weise können sie starke Argumente gegen eine allgemeine Fixierung auf Visualität ins Feld führen, laufen aber zugleich Gefahr, ex negativo wiederum in die audiovisuelle Litanei einzustimmen und statt rein visueller nun rein auditive Kulturen zu postulieren.71 Ihr Forschungsobjekt wird auf diese Weise akustemologisch homogenisiert und verliert an Vielschichtigkeit und historischer Dynamik. Dabei verfügt das Konzept der Akustemologie durchaus über das Potential, um damit gerade den Wandel historischer Klang- und Hörkulturen zu beschreiben. So stellt Mark M. Smith’s Arbeit ein exzellentes Beispiel dafür dar, dass sich politische und kulturelle Konflikte auch und vielleicht entscheidend aus differierenden Klangwahrnehmung des Eigenen und des Anderen, aus gegensätzlichen acoustemes also, erklären lassen.72 In manchem schließt die Idee der Akustemologie an Modelle der interpretierenden Kulturanthropologie zum Beispiel Clifford Geertz’ an, die für die Geschichtswissenschaft schon seit langer Zeit fruchtbar gemacht werden.73 Neu und innovativ ist aber die Aufmerksamkeit auf akustische Phänomene 69 70 71 72 73 Culture Reader, S. 223 – 239 sowie das instruktive Interview: ders. u. Donald Brenneis, Doing Anthropology in Sound, in: American Ethnologist 31. 2004, S. 461 – 474. Rath, How Early America Sounded, S. 2. Vgl. Feld, Waterfall of Sound; Howes, Sensual Relations, S. 61 – 94. Ganz ähnlich, allerdings mit Blick auf taktile und olfaktorische Weltorientierung verfährt auch Constance Classen, McLuhan in the Rainforest. The Sensory Worlds of Oral Cultures, in: Howes, Empire of the Senses, S. 147 – 163. Vgl. Smith, Listening to Nineteenth-Century America. Vgl. Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt 19954. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 37 und deren Integration in eine historische Sinnesanthropologie. Steven Feld und anthropologisch arbeitende Klanghistorikerinnen und -historiker knüpfen in dieser Hinsicht an Überlegungen des Komponisten und Pioniers der Klangökologie R. Murray Schafer an. Dieser versucht, Klänge als systemisches Netz aus „vernommenen Geschehnissen“ natürlicher, menschlicher und technischer Provenienz zu fassen, die historisch wandelbar sind, vor allem aber bewusst gestaltet werden können: „die Welt als eine makrokosmische musikalische Komposition“.74 Ein solcher soundscape setzt sich nach Schafer aus dem Zusammenwirken von Grundlauten („keynote sounds“), Signalen („signals“) und Lautmarken („sound marks“) zusammen, welche die akustische Gestalt einer gegebenen historischen oder auch geographischen Situation bestimmen.75 Grundlaute werden von Schafer als vorbewusste, in der Regel durch die natürlichen Bedingungen eines soundscape bestimmte „Tonarten“ definiert, die überhaupt nur ohrenfällig werden, wenn sie sich massiv verändern oder gar wegfallen. Signale sind dagegen „Vordergrundgeräusche“, die zu „ausgeklügelte[n] Codes organisiert“76 und können somit eine kommunikative Funktion innerhalb eines soundscape erfüllen. Lautmarken schließlich wirken vergesellschaftend, indem sie Gruppen, Gemeinschaften oder Gesellschaften akustische Identitäten verleihen und dadurch „akustische Gemeinschaften“ konstituieren.77 Man muss Schafers Analyseraster nicht tel quel auf alle historischen Situationen übertragen. Ebensowenig muss man die massiven zivilisationskritischen Untertöne seines auf diesem Modell basierenden klangökologischen Impetus teilen, um die Leistungen des soundscape-Begriffs anzuerkennen und ihn für eine anthropologisch informierte Klanggeschichte zu operationalisieren.78 Zwei Punkte sind in dieser Hinsicht besonders hervorzuheben. Zunächst bietet Schafer überhaupt einen Systematisierungsansatz von Klängen, der sich nicht primär an deren phänomenologischer Gestalt, sondern an ihrer sozialen Funktion orientiert. Dies ermöglicht die Historisierung von Klangzuschreibungen und Klangfunktionalisierungen in vergangenen Gesellschaften als 74 R. Murray Schafer, Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens [1977], hg. v. Sabine Breitsameter, Mainz 2010, S. 42 u. S. 38. 75 Vgl. ebd., S. 45 f. 76 Ebd., S. 46. 77 Vgl. ebd., S. 350 f.; auch Barry Truax, Acoustic Communication, Westport, CT 20012, S. 66. 78 Vgl. zur Kritik an Schafer nur Ari Y. Kelman, Rethinking the Soundscape. A Critical Genealogy of a Key Term in Sound Studies, in: The Senses & Society 5. 2010, S. 212 – 234; Sophie Arkette, Sounds like City, in: Theory, Culture and Society 21. 2004, S. 159 – 168; dagegen die sympathetische Lesart bei Sabine Breitsameter, Hörgestalt und Denkfigur. Zur Geschichte und Perspektive von R. Murray Schafers Die Ordnung der Klänge. Ein einführender Essay, in: Schafer, Ordnung der Klänge, S. 7 – 28. 38 Jan-Friedrich Missfelder spezifischen Ordnungen von Klängen.79 Mithin lassen sich historische Akustemologien über das je spezifische Zusammenklingen von keynote sounds, signals und soundmarks beschreiben. Schafer selbst bietet eine historische Großthese zu diesem Zusammenhang, die eine vormoderne Hi-Fi-soundscape von einer modernen Lo-Fi-soundscape abgrenzt. Während Hi-Fi-Umgebungen wie die vorindustrielle Natur für Schafer „ein günstiges Verhältnis von Signal und Rauschen“ auszeichnet und „einzelne Laute deutlich [werden], weil der Pegel der Umweltgeräusche niedrig ist“, werden in einer Lo-Fi-Situation wie der modernen Stadt „die einzelnen akustischen Signale überdeckt von einer übermäßig verdichteten Anhäufung von Lauten.“80 Für Schafer stellt der Weg von Hi-Fi zu Lo-Fi eine akustische Verlustgeschichte dar, in welcher der Reichtum und die Differenzierungskraft des vormodernen Hörens im Gebraus der industriellen, urbanisierten und medialisierten Moderne verloren gegangen ist. Auch diese Zivilisationskritik ist nicht zwingend, unterschätzt sie doch die Komplexität moderner urbaner soundscapes, die nicht als Degenerationsphänomen, sondern eher als akustisches Kommunikationssystem eigenen Rechts analysiert werden sollten.81 Dennoch bietet Schafers Unterscheidung eine Handhabe, historische Klänge als dynamische Systeme und soziale Aneignungen zu thematisieren. Daneben ermöglicht der Terminus einen synthetischen Zugriff auf das gesamte Spektrum akustischer Phänomene und ihre Situierung im sozialen Raum. Er vermeidet die künstliche Aufspaltung des Akustischen in Geräusch, Sprache und Musik und begreift alle in je eigener Weise als sozial eingebundene Klänge. Er lenkt dadurch die Aufmerksamkeit auf die Historizität dieser Unterscheidung selbst. Darauf wird unten noch einmal zurückzukommen sein. Soundscape wird von Schafer explizit in Analogie zu landscape verstanden, einem Konzept also, das die fließende Grenze von Natur und Kultur problematisiert und historisiert.82 Klanggeschichtlich gewendet bedeutet dies, dass Naturklänge und menschengemachte sounds nur als wechselseitig 79 Sabine Breitsameter weist auf die Doppeldeutigkeit des Titels „Die Ordnung der Klänge“ hin, der nicht nur eine deskriptive, historische Dimension enthält, sondern eben auch eine präskriptive, klangökologische. Dem entspricht die Mehrdeutigkeit im Originaltitel „The Tuning of the World“ als „Stimmen eines Instruments, […] Einstellen eines Radiosenders und […] Manipulieren (das ,Frisieren‘) eines Autos, dessen so erhöhte Leistung sich lautstark darbietet“, S. 9. 80 Schafer, Ordnung der Klänge, S. 91. 81 Vgl. v. a. Arkette, Sounds like City. 82 Vgl. Thompson, Soundscape of Modernity, S. 1: „Like a landscape, a soundscape is simultaneously a physical environment and a way of perceiving that environment; it is both a world and a culture constructed to make sense of that world.“ Vgl. dazu auch klassisch Joachim Ritter, Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft, in: ders., Subjektivität. Sechs Aufsätze, Frankfurt 1974, S. 141 – 163 u. S. 172 – 190. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 39 aufeinander bezogen analysiert werden können.83 „Natur“ ist auch in klanglicher Hinsicht eine kulturelle Konstruktion. Henry David Thoreau hatte zum Beispiel keine Bedenken, Kirchenglocken in seine Wahrnehmung einer akustisch unberührten Natur seines Refugiums Walden zu integrieren, schreckte aber vor dem Pfeifen der Dampflokomotive kulturkritisch zurück. Was hier als Kultur- oder Naturklang gilt, steht also keineswegs von vornherein fest, sondern ist als Bestandteil der spezifischen Klang- und Hörkultur, der Thoreau angehört, neu zu eruieren.84 Die Analyse einer historischen Akustemologie zielt demnach in letzter Konsequenz auf die Rekonstruktion eines Period Ear, also auf die spezifischen „Hörbarkeitsregime“, welche die akustische Wahrnehmung einer Gesellschaft strukturieren.85 III. Klanggeschichte als politische Geschichte Klanggeschichte, wie sie hier verstanden werden soll, beschäftigt sich nicht mit Klängen als rein akustischem Material, sondern als kulturellen und gesellschaftlichen Phänomenen. Klingende Räume sind immer auch soziale Räume. Diese wiederum klingen nicht einfach so, sondern können akustisch besetzt, bestritten und umkämpft und dadurch zuallererst als politische Räume konstituiert werden.86 Es gilt daher, die soziale und politische Wirkungsmacht von Klängen herauszuarbeiten, um so Politiken des Akustischen analysieren 83 Vgl. exemplarisch Jan-Friedrich Missfelder, Donner und Donnerwort. Zur akustischen Wahrnehmung der Natur im 18. Jahrhundert, in: Sophie Ruppel u. Aline Steinbrecher (Hg.), „Die Natur ist überall bey uns…“. Mensch und Natur in der Frühen Neuzeit, Zürich 2009, S. 81 – 94. 84 Vgl. zu diesem Zusammenhang instruktiv Peter Coates, The Strange Stillness of the Past. Toward an Environmental History of Sound and Noise, in: Environmental History 10. 2005, S. 636 – 665, bes. S. 643 f.; auch Diane Collins, Acoustic Journeys. Explorations and the Search for an Aural History of Australia, in: Australian Historical Studies 37. 2006, S. 1 – 17 sowie David Matless, Sonic Geography in a Nature Region, in: Social & Cultural Geography 6. 2005, S. 745 – 766. 85 Vgl. zum Begriff des Period Ear in ähnlichem wie dem hier gemeinten Sinne, aber aus musikwissenschaftlicher Perspektive Shai Burstyn, In Quest of the Period Ear, in: Early Music 25. 1997, S. 693 – 701; auch Michael Toyka-Seid, Von der „Lärmpest“ zur „akustischen Umweltverschmutzung“. Lärm und Lärmwahrnehmung als Themen einer modernen Umweltgeschichte, in: Bernd Hermann (Hg.), Beiträge zum Göttinger umwelthistorischen Kolloquium 2008/2009, Göttingen 2009, S. 253 – 276, bes. S. 265; Veit Erlmanns Polemik gegen diesen Begriff (Reason and Resonance, S. 23) zielt eher auf diesen musikalischen Kontext einer vornehmlich authentischen historischen Aufführungspraxis und geht daher an dem hier gemeinten Zusammenhang vorbei. 86 Vgl. dazu systematisch aus der Perspektive der sound studies Brandon LaBelle, Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life, New York 2010 sowie die Beiträge in Bandt, Hearing Places. 40 Jan-Friedrich Missfelder zu können. Als ein besonders geeignetes Analysekriterium zur Untersuchung historischer Klangkulturen erscheint dabei die Kategorie der Legitimität. Das breite Klangspektrum vergangener Gesellschaften war alles andere als sozial homogen. Deutungen und Sinnzuschreibungen des soundscapes durch historische Akteure etablierten eine eigene Hierarchie von legitimen und illegitimen Klängen. Ein illegitimer Klang kann als „Lärm“ rubriziert werden. Eine politische Geschichte des Klangs, welche mit der Kategorie der Legitimität arbeitet, ist also strukturell Lärmgeschichte. Dabei gilt: Was zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt als legitim oder illegitim, als Lärm also, gehört wurde, war Gegenstand gesellschaftlicher Konflikte und Aushandlungsprozesse zwischen konkurrierenden Klang- und Hörkulturen. Historische Akusteme stellten also keine stabilen und homogenen Strukturen dar, sondern waren durchzogen von vielfältigen Machtbeziehungen. So ergeben sich Fragen, die Klanggeschichte als politische Geschichte denkbar werden lassen: Welche Klänge wurden wann in welchem Kontext als Lärm begriffen, stigmatisiert, bekämpft oder zum Schweigen gebracht? Mögliche Antworten auf diese Fragen lassen sich über einen der angesprochenen Quellenumwege zum Hören skizzieren: über ein Bild. Auf William Hogarths Holzschnitt „The Enraged Musician“ (Abbildung 1) von 1741 ist ein wahres akustisches Pandämonium zu sehen (nicht zu hören). Hogarths Bild soll hier als Quelle für eine politische Geschichte des Klanges – und des Hörens – im urbanen Raum dienen, das die akustische Ordnung legitimer und illegitimer Klänge in einem spezifischen historischen Kontext vor Augen führt. Gezeigt wird eine Straßenszene in London, angefüllt mit Menschen unterschiedlichster Professionen und Beschäftigungen. Aus einem sich zur Strasse hin öffnenden Fenster lehnt sich ein höfisch gekleideter Geiger, der sich – den Bogen noch in der einen Hand – mit beiden Händen die Ohren zuhält und offensichtlich gegen den von außen in den musikalisierten Innenraum seines Hauses dringenden Lärm protestiert. Dieser Lärm ist außerordentlich vielgestaltig. Im rechten Bildvordergrund geht ein Scherenschleifer seinem kreischenden Handwerk nach, ein kleinwüchsiger Trommler steht daneben. Im Hintergrund läutet ein „dustman“ seine Glocke, während der ankommende Postreiter in sein Horn stößt. Dem Geiger direkt gegenübergestellt ist ein Straßenmusiker mit Oboe, eine Mutter versucht unter seinem Fenster, ein herzzerreißend brüllendes Baby vergeblich durch Gesang zu beruhigen. Ein weiteres Kleinkind schwingt eine Rassel, während es einem etwa Gleichaltrigen beim Urinieren gegen des Musikers Hauswand zusieht. Inmitten dieses akustischen Chaos steht, herausgehoben durch eine leicht übernatürliche Größe und seinen weißen Rock, ein Milchmädchen, das den Betrachter mit leicht geöffnetem Mund anblickt. Dieses Bild ist eine der meistzitierten Bildquellen in der klanggeschichtlichen Literatur, wird aber oftmals rein illustrativ herangezogen. Seine Interpretation fällt auch nicht gerade leicht, transportiert es doch kaum eine eindeutige Botschaft. R. Murray Schafer sieht in Hogarths Stich den „Konflikt zwischen ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 41 Abb. 1: William Hogarth, The Enraged Musician, 1741, Radierung, Tate Gallery London. Musik im Innenraum und Musik im Freien“.87 Die englische Historikerin Emily Cockayne erkennt darin ganz allgemein eine Repräsentation von „urban disorder and disharmony“.88 Für den österreichischen Stadthistoriker Peter Payer thematisiert es dagegen „Lärm als Form des Protests“.89 Wer allerdings Subjekt und Objekt sowohl des Lärms als auch des Protests sind und wogegen sich dieser im Einzelnen richtet, bleibt unklar. Auffällig an Hogarths Bild ist zunächst nur eines: Der Künstler bietet eine extrem verdichtete Vision des Londoner soundscape um die Mitte des 18. Jahrhunderts, welches auch in 87 Schafer, Ordnung der Klänge, S. 126. 88 Emily Cockayne, Hubbub. Filth, Noise and Stench in England, 1600 – 1770, New Haven, CT 2007, S. 129. 89 Peter Payer, Vom Geräusch zum Lärm. Zur Geschichte des Hörens im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Aichinger, Sinne und Erfahrung, S. 173 – 191, hier S. 185. 42 Jan-Friedrich Missfelder schriftlichen Quellen als außerordentlich laut und lärmig beschrieben wird.90 Wichtiger für die politische Perspektive ist aber, dass er damit eine in diesem Kontext gültige Hierarchie der Klänge aufzeigt. Der etablierte Kontrast von klanglich stark reguliertem Innenraum und der außer Kontrolle geratenen Klanglandschaft der Straße wird durch das friedlich und ein wenig unbeteiligt dastehende Milchmädchen, das den Ruhepol zwischen beiden Szenen verkörpert, kontrapunktiert. Es hält zu beiden Extremen, der sich selbst als einzig legitim begreifenden Kunstmusik ebenso wie zum für illegitim erklärten Sound der Straße gleichermaßen Distanz. Lärm wird in Hogarths Bild also zu einer relativen Größe, der seine Qualität als Lärm einzig durch die Beziehungen zwischen den akustischen Akteuren gewinnt. Diese sozialen Beziehungen sind überdies sowohl hierarchisch strukturiert als auch moralisch aufgeladen. Das distanzierte Milchmädchen erhebt sich graziös über den sie umgebenden Lärm, sein Mund ist leicht geöffnet, es scheint etwas zu sagen (oder zu singen?), das sich qualitativ vollkommen vom es umgebenden soundscape abhebt. Zugleich weist das Bild aber auch auf die arrogante Haltung des professionellen Musikers hin, welcher keinen Klang als den von ihm produzierten als legitim gelten lassen kann.91 Es ist eben der Musiker durch den urbanen Klang enraged, nicht das Milchmädchen. Hogarths Stich zeigt, dass Klang nicht nur ein akustisches Ereignis ist, sondern auch und vor allem ein Medium sozialer Konstellationen. Diese Konstellationen als politisch-gesellschaftliche Ordnung bilden den Kontext für die historisch variable Legitimitätszuweisung, die Lärm erst zum Lärm macht. Lärm ist also nicht gleich Lärm, sondern wird erst durch seine Kontextualisierung und seinen spezifischen Ort zu einem solchen: „Le bruit n’existe donc pas en lui-mÞme, mais par rapport au systme dans lequel il s’inscrit: metteur, transmetteur, rcepteur.“92 Der kanadische Kulturhistoriker Peter Bailey bestimmt Lärm in Anlehnung an Mary Douglas’ berühmte Definition von Schmutz in „Reinheit und Gefährdung“ als „sound out of place“.93 Hierbei ist „place“ eben nicht nur rein räumlich zu verstehen, sondern bezieht sich vor allem auf einen Ort in der legitimen sozialen und symbolischen Ordnung einer Gesellschaft. R. Murray Schafers Schüler und Kollege Barry Truax macht diesen Zusammenhang noch 90 Vgl. Smith, Acoustic World of Early Modern England, S. 52 – 71; Cockayne, Hubbub, S. 106 – 130. 91 Vgl. zu Beschreibung und Deutung des Bildes Jeremy Barlow, The Enraged Musician. Hogarth’s Musical Imaginary, Aldershot 2005; vgl. auch in diesem Sinne Cockayne, Hubbub, S. 129. 92 Jacques Attali, Bruits. Essai sur l’conomie politique de la musique [1977], Paris 2001, S. 49. 93 Peter Bailey, Breaking the Sound Barrier. A Historian Listens to Noise, in: Body & Society 2. 1996, S. 49 – 66, hier S. 50, leicht gekürzt auch in Smith, Hearing History, S. 23 – 35; vgl. Mary Douglas, Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Frankfurt 1988. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 43 deutlicher und definiert Lärm ebenfalls mit Bezug auf Mary Douglas als „unwanted sound“.94 Die eigentlich historische Frage, wer welchen Klang in welchem Kontext nicht will, zielt auf politische und soziale Machtverhältnisse in der Stadtgesellschaft, also auf Fragen der politischen Geschichte. Indem urbane Klänge gesellschaftlich situiert werden, eröffnen sich Möglichkeiten zur Präsenzmarkierung sozialer Gruppen und Individuen im städtischen Raum. Die Macht über den Raum schließt auch seine akustische Besetzung ein. Dies reicht schon für die Zeit der Frühen Neuzeit vom trompetenbeschallten Introitus des Herrschers95 über die akustische Formung sakraler Räume und religiöser Rituale96 bis zur Katzenmusik oder „rough music“ zur öffentlichen Ridikülisierung untreuer Ehegatten.97 Die Frage nach der Legitimität solcher akustischer Praktiken verdeutlicht aber nicht nur ihre Situativität, sondern eröffnet auch die weitergehende Frage, welche Klänge in welchen Räumen als zulässig galten. Hogarths Profigeiger befindet sich eben nicht mit auf der Straße, um dem schäbigen Oboisten die akustische Herrschaft über dieselbe streitig zu machen, sondern verteidigt einen spezifisch inneren, privaten Klangraum gegen die Sound-Invasion von außen. Hier deutet sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein Fundamentalprozess der Modernisierung an: die Privatisierung und „Spatialisierung“ von Klängen im Sinne ihrer Zuweisung an bestimmte legitime Räume innerhalb des urbanen Raums.98 Wichtig wird dies insbesondere im Zuge der Industrialisierung, welche die Trennung nach lärmintensiven öffentlichen und stillen Räumen und damit eine neue Strukturierung des Stadtraums vorantreibt.99 Noch einmal zurück zu Hogarth: Seine Relationierung von verschiedenen Klängen im Stadtraum regt dazu an, in methodischer Hinsicht nicht systematisch zwischen Musik und „Geräusch“ zu unterscheiden, sondern beide im Anschluss an Schafer als soziale Klangpraktiken entlang einer historisch variablen Legitimitätsskala zu verorten.100 94 Truax, Acoustic Communication, S. 95; vgl. auch Garrett Keizer, The Unwanted Sound of Everything We Want. A Book about Noise, New York 2010. 95 Vgl. z. B. instruktiv Florence Alazard, Art vocal, art de gouverner. La musique, le Prince et la cit en Italie au XVIe sicle, Paris 2002 und Evelyn Korsch, The „Loud Joy“. Music as a Sign of Power, in: Renaissance Journal 8. 2003, S. 4 – 14. 96 Vgl. z. B. Jan-Friedrich Missfelder, Akustische Reformation. Lübeck 1529, in: Historische Anthropologie [20. 2012]. 97 Vgl. Emily Cockayne, Cacophony, or Vile Scrapers on Vile Instruments. Bad Music in Early Modern English Towns, in: Urban History 29. 2002, S. 35 – 47; Edward P. Thompson, Rough Music, in: ders., Customs in Common, London 1991, S. 467 – 538. 98 Vgl. z. B. John M. Picker, Victorian Soundscapes, New York 2003; auch Martin Hewitt u. Rachel Cowgill (Hg.), Victorian Soundscapes Revisited, Leeds 2007. 99 Vgl. Bijsterveld, Mechanical Sound, S. 68 f.; auch Peter Payer, Der Klang von Wien. Zur Neuordnung des öffentlichen Raumes, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 15. 2004, S. 105 – 131. 100 Vgl. hierzu v. a. Attali, Bruit; auch Paul Hegarty, Noise/Music. A History, London 2007. 44 Jan-Friedrich Missfelder Anhand der Kategorie der Legitimität lässt sich also ein sozial und politisch bestimmtes Netz von Klängen identifizieren und rekonstruieren, das Aufschluss über die sinnliche Erfahrbarkeit gesellschaftlicher Strukturen verspricht. Die Frage nach dem Klang als Objekt der historischen Analyse impliziert also immer die Frage nach der politischen und sozialen Definitionsmacht in einer gesellschaftlichen Ordnung. Was Hogarth ins Bild setzt, sind nicht nur Klänge in der Stadt, sondern im Wortsinne die verklungene Stadt als soziale Ordnungsformation.101 Diese Kontextabhängigkeit des Lärms impliziert folglich immer auch Lärmkritik, aber nicht zwingend als Kritik am klanglichen Ereigniszusammenhang, sondern an der sozialen Ordnung, welche die akustische Legitimitätsverteilung garantiert. Das bedeutet aber auch, dass sich Status und gesellschaftliche Position durch Klänge ausdrücken und sozial manifestieren können. Dies wiederum hat Folgen für die spezifische Form von Lärmkritik, welche der „Enraged Musician“ repräsentiert. Hogarths London ist das London des 18. Jahrhunderts. Der städtische Raum, in dem sich die von ihm verbildlichten Klänge ereignen, ist damit der einer frühneuzeitlichen Anwesenheitsgesellschaft.102 Die Lärmkritik des „Enraged Musician“ erweist sich in genau dem Maße als eine spezifisch frühneuzeitliche, da alle Klänge – legitim oder illegitim – spezifischen Akteuren in dieser Anwesenheitsgesellschaft zugerechnet werden können. Die gleichsam sonifizierten Sozialbeziehungen sind daher in direkten Interaktionen verhandelbar, was die Wahrscheinlichkeit von personaler Gewalt – eben „rage“ – signifikant erhöht. Die frühneuzeitliche Akusteme des Lärms bezieht sich in der Regel weniger auf den Klang als solchen als auf die Lärm produzierenden Akteure, ist also sozial relational und nicht phänomenologisch orientiert. Im Zentrum städtischer Lärmregulierungen stehen daher die üblichen Verdächtigen der sozialen Devianz: Jugendliche und die notorisch Unruhe stiftenden Handwerksgesellen.103 Die obrigkeitlich gewünschte Ruhe ist damit nicht nur eine rein akustische, sondern auch und vor allem eine politische. Beide aber, und das ist hier entscheidend, hängen unmittelbar zusammen. Es sind eben ganz bestimmte soziale Gruppen, deren akustische Präsenz kontrolliert und reglementiert werden muss. 101 Vgl. in diesem Sinne, wenn auch eher impressionistisch Garrioch, Sounds of the City. 102 Vgl. Rudolf Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in der Frühen Neuzeit, in: GG 34. 2008, S. 155 – 224; auch ders., Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Politischen in der vormodernen Stadt, in: ders. (Hg.), Interaktion und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 9 – 60. 103 Vgl. Christian Casanova, Nacht-Leben. Orte, Akteure und obrigkeitliche Disziplinierung in Zürich, 1523 – 1833, Zürich 2007, bes. S. 83 – 104; auch Norbert Schindler, Nächtliche Ruhestörung. Zur Sozialgeschichte der Nacht in der frühen Neuzeit, in: ders. (Hg.), Widerspenstige Leute. Studien zur Volkskultur in der frühen Neuzeit, Frankfurt 1992, S. 215 – 257. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 45 Diese frühneuzeitliche Akusteme unterscheidet sich signifikant von derjenigen, die spezifisch neuzeitlicher Lärmbekämpfung zugrunde liegt. Lärm gilt seit spätestens der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr in erster Linie als Problem sozialer Stabilität, sondern als zentraler Bestandteil der „unbeabsichtigten Nebenfolgen der Moderne“.104 Zwar spiegelt sich auch im neuzeitlichen Lärmdiskurs ein gesellschaftliches Problem – die Angst der bürgerlichen Eliten vor den lärmenden Massen des Proletariats –, doch richten sich die konkreten Maßnahmen weniger gegen solche sozialen Gruppen als gegen die akustischen Folgen der Urbanisierung und Mechanisierung der Gesellschaft in Verkehr, Industrie und Handel.105 Entscheidend daran ist, dass Klänge nicht mehr personal zurechenbar sind, die politische Akustemologie der Moderne also klangliche und politische Ordnung zunehmend entkoppelt. Zwischenstufen lassen sich dennoch konstatieren. John Picker und Peter Payer haben für London und Wien nachgezeichnet, dass eine der ersten konzertierten urbanen Lärmschutzinitiativen um die Mitte des 19. Jahrhunderts sich gegen wandernde Straßenmusiker wandte.106 Diese stehen als soziale Gruppe gleichsam zwischen den Zeiten: Einerseits bilden sie als Objekt obrigkeitlicher Regulierung eine soziale Außenseitergruppe alteuropäischen Zuschnitts, andererseits erscheinen sie in der modernen Akusteme als Störungen einer akustischen, nicht sozialen Homogenisierung des Stadtraums. Aufschlussreich sind diese Befunde aber auch hinsichtlich der oben angesprochen Frage nach alternativen Periodisierungsmodellen. Es ist auffällig, dass systematische Lärmbekämpfungsanstrengungen erst nach 1850 einsetzten, dass Lärm also erst seit dieser Zeit „als negativ konnotierter Schlüsselbegriff des Modernisierungsprozesses besetzt wird“.107 Versteht man den modernen Lärmbegriff auf diese Weise als ein Produkt der industrialisierten und urbanisierten Moderne, so ist die Lücke von mindestens einem halben Jahrhundert zwischen dem Take-Off der Industrialisierung in den meisten Ländern Europas und dem Auftreten einer verstärkten akustischen Sensibilität 104 Monika Dommann, Antiphon. Zur Resonanz des Lärms in der Geschichte, in: Historische Anthropologie 14. 2006, S. 133 – 146, hier S. 135; vgl. auch Philipp Felsch, Die Stadt, der Lärm und der Ruß. Mechanische Spuren der Psyche, 1875 – 1895, in: Cornelius Borck u. Armin Schäfer (Hg.), Psychographien, Zürich 2005, S. 17 – 42. 105 Vgl. Daniel Morat, Zwischen Lärmpest und Lustbarkeit. Die Klanglandschaft der Großstadt in umwelt- und kulturhistorischer Perspektive, in: Bernd Hermann (Hg.), Beiträge zum Göttinger umwelthistorischen Kolloquium 2009/2010, Göttingen 2010, S. 174 – 190; Peter Payer, The Age of Noise. Early Reactions in Vienna, 1870 – 1914, in: Journal of Urban History 33. 2007, S. 773 – 793; ders., Vom Geräusch zum Lärm. Zur Geschichte des Hörens im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Aichinger, Sinne und Erfahrung, S. 106 – 118. 106 Vgl. John M. Picker, The Soundproof Study. Victorian Professionals, Workspace and Urban Noise, in Victorian Studies 42. 2000, S. 427 – 454; Payer, Klang von Wien. 107 Dommann, Antiphon, S. 135; vgl. auch Toyka-Seid, „Lärmpest“. 46 Jan-Friedrich Missfelder für deren Nebenfolgen erklärungsbedürftig.108 Erfolgten die Modernisierung der Gesellschaft und die Modernisierung ihrer Akusteme demnach mit einer gewissen Phasenverschiebung? Genauere Studien zur Klanggeschichte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts liegen bisher nicht vor, es ist aber anzunehmen, dass die Entwicklung der Klang- und Hörkultur dieser Zeit nach anderen Rhythmen vonstatten zu gehen scheint als Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vorgeben. Klanggeschichte als politische Geschichte zielt also auf die sinnliche Wahrnehmbarkeit sozialer Beziehungen und politischer Machtverhältnisse und kann damit einen Beitrag zu der Frage leisten, wie diese Strukturen überhaupt lebensweltlich erfahrbar waren. Ein solcher Versuch einer sozialen Akustemologie, so skizzenhaft ihr Entwurf hier bleiben muss, sollte doch deutlich gemacht haben, dass Klänge, ihre Produzenten und ihre Rezipienten nicht nur Machtbeziehungen spiegeln, sondern diese zuallererst herstellen: weder Bindestrich-, noch Komplementärgeschichte also. IV. Coda: Der wilde Westen des Hörens Man kann den oben eingeschlagenen Weg weiter verfolgen bis in die akustische Gegenwart. Unter den vielfältigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2009 Linz befindet sich auch ein Projekt mit dem Titel „Hörstadt“. Das Projekt setzt sich für eine „bewusste und menschenwürdige Gestaltung unser hörbaren Umwelt“ ein und veröffentlichte am 20. Februar 2009 in der französischen Tageszeitung Le Figaro ein „Akustisches Manifest“, das auf den Tag genau hundert Jahre später mit Filippo Tommaso Marinettis „Futuristischem Manifest“ abrechnen möchte. Dessen Feier des Lärms wird eine politische Kritik entgegengesetzt, die durch die Schule Michel Foucaults gegangen ist. Der zweite Abschnitt des Manifests ist überschrieben mit „Der Wilde Westen des Hörens“: Schall ist die neue Waffe der Macht. Schall ist zu Strahlung geworden. Das Volk wird mit Schall bestrahlt und apathisch und blöd gemacht – an jedem Ort, zu jeder Zeit und unter allen Umständen. Längst werden Produkte akustisch manipuliert und Werbung akustisch inszeniert. In Supermärkten, Geschäften, Einkaufszentren, Restaurants, Warteräumen, Telefonwarteschleifen, ja Wohnungen, Stiegenhäusern, sogar Toiletten sind täglich Millionen Menschen Opfer toxischer Schallstrahlung, die durch ihre Körper kriecht. Verkehrsschneisen schleudern als Strahlungskanonen ihren krankmachenden Lärm auf Junge und Alte, sie schleudern ihn auf Frauen und Männer, ja selbst auf Babys und Greise! Niemand entrinnt dem Bombardement. Automobile, Stahlrosse und Aeroplane machen uns mit Strahlenmilitarismus gefühllos, leblos und tot. Das ist die Schönheit der Schnelligkeit! Das ist der Krieg, 108 Dieses Problem fiel auch schon R. Murray Schafer auf. Vgl. ders., Ordnung der Klänge, S. 141 – 144. ipabo_66.249.66.96 Perspektiven einer Klanggeschichte 47 den Marinetti pries! Die Mächtigen vergewaltigen die Machtlosen. Willkommen im Wilden Westen des Hörens!109 Hier ist der Lärm nicht mehr – wie bei Hogarth – spezifischen Akteuren zurechenbar und auch nicht mehr – wie in der Moderne – als Technologiefolge bekämpfbar, sondern wirkt durch die Mikrophysik der Macht, durch Strahlung und Gift. Die Forderung nach bewusster und menschenwürdiger Gestaltung der akustischen Umwelt richtet sich also vor allem gegen die Dauer- und Zwangsbeschallung des öffentlichen Raumes durch mechanische Klänge und Muzak, also eigens als Hintergrund designte Musikformen: „Das Irrenhaus der Akustik ist bevölkert von Parasiten: Warteschleifen, Jingles, Audiologos, Warn- und Signaltöne, Corporate Sounds, Auftragsfirmensongs, Klingeltöne“. Lärmkritik dieser Art hat zwar eine spezifisch moderne Vorgeschichte. Der 1908 vom Hannoveraner Philosophen Theodor Lessing gegründete „Anti-Lärm-Verein“ identifizierte zum Beispiel Lärm als eine kulturell ansteckende Krankheit zum Tode des modernen Menschen.110 Ebenfalls gemeinsam ist all diesen Diagnosen ihre Ambivalenz zur akustischen Moderne. Marinetti und sein futuristischer Mitstreiter Luigi Russolo hatten Maschinenklänge und die sounds der industrialisierten Moderne insgesamt als Objekte spezifisch moderner Kunst beansprucht. Gemeinsam ist all diesen Initiativen auch die Diagnose eines sozial unspezifisch klingenden LärmRaumes. Im Gegensatz zum London des 18. Jahrhunderts ist der urbane Raum demokratisiert: seine Klänge können nicht mehr persönlich adressiert werden, sie sind genuin gesellschaftliche Klänge geworden. Die dem „Akustischen Manifest“ beigefügte „Linzer Charta“ des „Hörstadt“-Projekts zieht hieraus die Konsequenz: „Der akustische Raum ist Gemeingut. Er gehört allen […] Die Teilhabe am akustischen Raum erfordert das Recht auf akustische Selbstbestimmung und die Entwicklung eines akustischen Verantwortungsgefühls.“111 Eine historische Akustemologie des Lärm-Hörens könnte diese Entwicklung nachzeichnen und die Verschiebungen ihrer politischen Implikationen thematisieren. Mit Phänomenen der langen Dauer ist auch hierbei zu rechnen. Die akustische Dominanz und Besetzung städtischer Räume geschieht auch in der Moderne möglicherweise nicht nur durch die Mikropolitik der Macht. Demokratisierung des Klangs beinhaltet auch die Geschichte von Ghettoblaster und iPod und ihren Nutzern als Medien der akustischen Raumkonstitution.112 Man kann das täglich hören – an jedem öffentlichen Platz und in jedem Pendlerzug der Welt. Dr. des. Jan-Friedrich Missfelder, NCCR „Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen“, Historisches Seminar, Universität Zürich, Culmannstr. 1, CH-8006 Zürich E-Mail: [email protected] 109 http://www.hoerstadt.at/ueberuns/das_akustische_manifest/das_akustische_manifest_im_wortlaut.html. 110 Vgl. hierzu Dommann, Antiphon, und Morat, Zwischen Lärmpest und Lustbarkeit. 111 http://www.hoerstadt.at/ueberuns/die_linzer_charta.html. 112 Vgl. Michael Bull, Sound Moves. iPod Culture and Urban Experience, London 2007. Die Politik des Schweigens Veränderungen im Publikumsverhalten in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Sven Oliver Müller* Abstract: From the historian’s point of view, it is important to acknowledge that audiences make the performance of music meaningful and relevant. This article argues that the impact of concert performances depends less on their musical content than on the power of the social relations involved in musical reception. The reception of music by audiences establishes a link between musical production and society. One section deals with the change of cultural practices and the new evaluation of musical taste. It demonstrates how inattentive audiences evolved into listeners during this period. Public acts of self-discipline during concerts were used for the identification and the demarcation of audiences. Musical behaviour increasingly led to culture wars among audiences, which therefore constituted a form of politics. Middle class concertgoers, fighting to legitimate their new lifestyle, frequently accused the aristocracy for displaying uneducated manners during performances. I. Das Publikum. Eine kulturgeschichtliche Kategorie Die Geschichtswissenschaft hat in der Musikkultur viel zu entdecken. Die tradierten methodischen und empirischen Abgrenzungen der Musik- und der Geschichtswissenschaft behinderten lange Zeit die Erkenntnismöglichkeiten beider Disziplinen.1 Erst in den letzten Jahren haben Historiker der Musikkultur – gemessen an ihrer hohen gesellschaftlichen Bedeutung – eine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Es kommt darauf an zu zeigen, wie soziale Beziehungen in einer Gesellschaft durch Teilnahme an musikalischen Aufführungen geprägt wurden. Hilfreich ist es, Musik gleichsam in die Geschichte * Für wichtige Hinweise und Korrekturen danke ich sehr herzlich Iris Törmer, Jürgen Osterhammel und Sarah Zalfen. 1 Wichtige Überlegungen zu diesem Problem trifft Victoria Johnson, Introduction. Opera and the Academic Turns, in: dies. u. a. (Hg.), Opera and Society in Italy and France from Monteverdi to Bourdieu, Cambridge 2007, S. 1 – 26. Vgl. Trevor Herbert, Social History and Music History, in: Martin Clayton u. a. (Hg.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York 2003, S. 146 – 156; Leo Treitler, History and Music, in: Ralph Cohen u. Michael S. Roth (Hg.), History and …: Histories within the Human Sciences, Charlottesville 1995, S. 209 – 230, und den wichtigen Literaturbericht von Daniel Morat, Zur Geschichte des Hörens. Ein Forschungsbericht, in: AfS 51. 2011, S. 695 – 716. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 48 – 85 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 49 einzuführen – sie als Teil einer Geschichte von Gesellschaften zu begreifen, nicht als eine Spezialdisziplin. Das Musikleben in der Gesellschaft lässt sich besonders eindringlich durch eine Untersuchung des Publikumsverhaltens erfassen. Die soziale und kulturelle Bedeutung des Konzert- und Opernpublikums im 19. Jahrhundert ist in der Forschung immer noch unzureichend erfasst. Es wäre gänzlich irreführend, das Publikum lediglich als Beobachter und passiven Rezipienten musikalischer Spektakel zu betrachten. Die Teilnehmer an den musikalischen Aufführungen des 19. Jahrhunderts waren selbst Akteure, die den Charakter eines Abends durch ihre körperliche Präsenz, ihre Bewertung der Musik und ihr Hörverhalten wesentlich prägten. Das Benehmen des Publikums sollte als gesellschaftlich relevantes Handeln deutend verstanden und dadurch im Idealfall erklärt werden. Sein Verhalten stellt eine kodierte Praxis dar, mit Hilfe derer Musikliebhaber eigene Erfahrungen und Interessen artikulieren. Da das Erlebnis von Musik nicht allein von der Komposition und den Künstlern abhängt, sondern auch durch die Anteilnahme an musikalischen Aufführungen sozial vorgeprägt ist, ist es wichtig, das Spannungsfeld zwischen der Vorführung, dem Erwartungshorizont des Publikums und seinen Reaktionen zu vermessen. Im Anschluss an die Konjunktur konstruktivistischer Ansätze in den Kulturwissenschaften ist es unstrittig, dass auch die Bedeutung von Musik nicht unverrückbar besteht, sondern immer auch von den Hörern selbst erzeugt wird.2 Aufführungen der Musik bilden ein Kommunikationselement, um das sich allmählich festere Formen kristallisierten. Das musikalische Material erleichterte die Kommunikation des Publikums, weil es ästhetisch reizvoll war, aber Botschaften nur in konnotativer Form weitergab. Die gesellschaftliche Bedeutung der Musik kann mit Hilfe drei ausgewählter Kategorien untersucht 2 Eine stärkere Konzentration auf Rezeptionsanalysen forderten bereits vor zwanzig Jahren Hermann Danuser u. Friedhelm Krummacher (Hg.), Rezeptionsästhetik und Rezeptionsgeschichte in der Musikwissenschaft, Laaber 1991. Trotz der Belebung dieser Forschungsrichtung konstatierten führende Vertreter der Musik- und Kulturwissenschaften nach wie vor große Lücken in diesem Bereich. Vgl. etwa die Beiträge in: Archiv für Musikwissenschaft 57. 2000; Wolfgang Kemp (Hg.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992; Susan Bennett, Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception, London 1990; die wichtigen Aufsätze von Jerrold Levinson, Performative vs. Critical Interpretation in Music, in: Michael Krautz (Hg.), The Interpretation of Music, Oxford 1993, S. 34 – 60; Martyn Thompson, Reception Theory and the Interpretation of Historical Meaning, in: History and Theory 32. 1993, S. 248 – 272. Wegweisend in den Musikwissenschaften waren in jüngster Zeit vor allem die Forschungen zur Bach-Rezeption in dem vierbändigen Werk von Michael Heinemann u. Hans-Joachim Hinrichsen (Hg.), Bach und die Nachwelt, 4 Bde., Laaber 1997 – 2004; vgl. auch Gundula Kreuzer, Verdi and the Germans. From Unification to the Third Reich, Cambridge 2010. 50 Sven Oliver Müller werden: dem Publikum (das heißt, dem Verhalten einer Gruppe und seinem Umgang mit der Musik), den Aufführungen (das heißt, dem Musikbetrieb in Konzert- und Opernhäusern) und dem Geschmack (das heißt, der Bewertung und der Auswahl von Kompositionen). Statt ästhetische Phänomene von den Aufführungsorten und den sozialen Strukturen zu trennen, kommt es darauf an, die Beziehung zwischen Werk und Wirkung zu nutzen. Das Publikum verständigt sich durch seinen musikalischen Geschmack im Kontext bestehender baulicher und kultureller Institutionen (Konzert- und Opernhäuser, Sinfonieorchester, Presseberichte). Scheut man die Zuspitzung nicht, dann besuchte das Publikum nicht einfach nur öffentliche musikalische Veranstaltungen – es war die Öffentlichkeit. Genauer : Es wurde zur Öffentlichkeit durch den Akt des kollektiven Musikkonsums. Geteilte ästhetische Vorlieben und öffentliche Verkehrsformen verbanden Menschen von unterschiedlicher Herkunft und von unterschiedlichem Status. Bestimmte Geschmackspräferenzen brachten bestimmte soziale Gruppen hervor, für die der amerikanische Historiker William Weber den Begriff „taste publics“ geprägt hat.3 Auf diesen Zusammenhang von kultureller Praxis und sozialer Genese hat Jürgen Habermas als einer der Ersten hingewiesen: „Strenger noch als am neuen Lese- und Zuschauerpublikum läßt sich am Konzertpublikum die Verschiebung kategorial fassen, die nicht eine Umschichtung des Publikums im Gefolge hat, sondern das ,Publikum‘ als solches überhaupt erst hervorbringt.“4 Der historische Blick auf das Musikleben im Konzertsaal und im Opernhaus mag helfen, die immer noch wenig erforschte Rolle des Publikums besser zu verstehen. Erklärungsbedürftig ist es, dass sich in den beiden wichtigsten musikwissenschaftlichen Lexika, „Musik in Geschichte und Gegenwart“ und „New Grove“, keine Einträge unter der Rubrik „Publikum“ beziehungsweise „audiences“ finden lassen.5 Gleichwohl wird inzwischen die Frage nach dem Verhalten und dem Geschmack des Publikums diskutiert. Der wichtigste Anstoß ging dabei von James Johnsons Buch „Listening in Paris“ aus, das die sich wandelnde Beziehung zwischen der in Opern- und Konzerthäusern aufgeführten Musik und den Publikumsreaktionen vom späten 18. bis ins frühe 19. Jahrhundert untersucht. Seine pointierte, doch einer international vergleichenden Überprüfung noch harrende These besagt, dass sich in Paris ein schweigendes Hörverhalten in Folge neuer Kompositionen und neuer 3 William Weber, Music and the Middle Class. Social Structure of Concert Life in London, Paris and Vienna, London 20042, bes. S. 11 f. 4 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt 19904. Vgl. HannsWerner Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform, 2 Bde., Wilhelmshaven 1983, S. 100 – 116. 5 Ludwig Finscher (Hg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 29 Bde., Kassel 1994 – 20082 (MGG); The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 29 Bde., Oxford 20012. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 51 Aufführungspraktiken durchsetzte.6 Die relativ wenigen neueren Arbeiten zur historischen Dimension kultureller Verhaltensmuster, wie etwa die Monographien von Celia Applegate, Jennifer Hall-Witt und Christophe Charle, zeichnen das Bild eines heterogenen Publikums, heben das sinnliche Erleben opulenter Inszenierungen und die vielfältigen nationalistischen und kulturellen Implikationen musikalischer Vergnügungen hervor.7 Ein erster Befund besagt, dass in der Forschung die Trennung zwischen Komposition, Aufführung und Rezeption immer weiter an Bedeutung verliert. Die Sinneswahrnehmungen des Publikums stehen in Relation zur Gesellschaft. Damit ist die Unterscheidung zwischen Komponisten und Rezipienten im Begriff, ihre Substanz zu verlieren. Kunstwerke büßten spätestens im 19. Jahrhundert ihre ästhetische Autonomie ein – wenn sie diese je hatten. Mit guten Gründen diskutieren Historiker aber auch Musikwissenschaftler die Frage, ob aus dieser Konsequenz eine Auflösung des Werkbegriffs folgen könnte. Allerdings würde man durch einen konsequenten Wechsel vom Werkbegriff zum Aufführungsbegriff neue hermeneutische Schwierigkeiten erhalten.8 6 James H. Johnson, Listening in Paris, Berkeley 1995 und von John M. Picker, Victorian Soundscapes, Oxford 2003, gelang eine Analyse der auditiven Wahrnehmungen und neuer Verhaltensweisen im viktorianischen England. Ebenso stimulierend für die Debatte zwischen den Disziplinen sind der soziologische Ansatz von Tia DeNora, Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803, Berkeley 1995 und die Arbeit von Dana Gooley, The Virtuoso Liszt, Cambridge 2004, über die gesellschaftliche Rezeption von Franz Liszt in Europa. Vgl. zur Untersuchung des Publikumsverhaltens zudem die Überlegungen von Jennifer L. Hall-Witt, Representing the Audience in the Age of Reform, Critics and the Elite at the Italian Opera in London, in: Christina Bashford u. Leanne Langley (Hg.), Music and British Culture, 1785 – 1914. Essays in Honour of Cyril Ehrlich, Oxford 2000, S. 121 – 144. 7 Vgl. Celia Applegate, Bach in Berlin. Nation and Culture in Mendelssohn’s Revival of the St. Matthew Passion, Ithaca, NY 2005; Christophe Charle, Thtres en capitales. Naissance de la socit du spectacle Paris, Berlin, Londres et Vienne 1860 – 1914, Paris 2008; Jennifer L. Hall-Witt, Fashionable Acts. Opera and Elite Culture in London, 1780 – 1880, Durham, NH 2007; David Gramit, Cultivating Music. The Aspirations, Interests, and Limits of German Musical Culture, 1770-1848, Berkeley 2002; Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa, 1815 – 1914, Wien 2006; Sven Oliver Müller, Analysing Musical Culture in Nineteenth-Century Europe: Towards a Musical Turn?, in: European Review of History 17. 2010, S. 833 – 857. 8 Vgl. etwa Hans-Joachim Hinrichsen, Musikwissenschaft und musikalisches Kunstwerk. Zum schwierigen Gegenstand der Musikgeschichtsschreibung, in: Laurenz Lütteken (Hg.), Musikwissenschaft. Eine Positionsbestimmung, Kassel 2007, S. 67 – 87; ders., Musikwissenschaft. Musik, Interpretation, Wissenschaft, in: Archiv für Musikwissenschaft 57. 2000, S. 78 – 90, und die Überlegungen von Christian Kaden, Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann, Kassel 2004; Helga de la MotteHaber u. Hans Neuhoff, Vorwort, in: dies. (Hg.), Musiksoziologie, Laaber 2007, S. 9 – 17. 52 Sven Oliver Müller Hier wird der Blick gelenkt auf die öffentlichen Arenen der Konzert- und Opernhäuser in Berlin, London und Wien in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese nutzten Bürger und Adelige um sowohl ihren Beifall als auch ihr Missfallen öffentlich zu demonstrieren. In diesem Beitrag werden vermeintlich nichtige Details des Musiklebens an die großen gesellschaftlichen Dramen des 19. Jahrhunderts angebunden. Ein Musikstück zu mögen oder nicht, sich für die Kleidung und das Gespräch eines Sitznachbarn zu interessieren oder nicht – all das waren mehr als unterhaltsame Selbstverständlichkeiten. Diese Indikatoren offenbaren die gesellschaftlichen Ordnungsstrategien der Eliten des 19. Jahrhunderts. Adelige und Bürger, Berliner und Londoner suchten einigen brennenden Problemen der Epoche durch ihre Handlungen im Auditorium zu begegnen – oder zu entfliehen. Viele Hörer nutzten ihre sozialen Beziehungen und politischen Geschmacksurteile, um auf der musikalischen Bühne ihre Interessen und Werturteile zu demonstrieren. Um die Bedeutung dieser Form der Kommunikation aufzuzeigen, ist es notwendig den Bestand und den Wandel der Verhaltensmuster des Publikums zu beleuchten. Das kann anhand der Untersuchung scheinbar unwichtiger Manieren im Musikleben deutlich werden. So war beispielweise die Geräuschkulisse in den Opern- und Konzerthäusern des 19. Jahrhunderts auffällig. Die Besucher lärmten ohne Unterlass. Man kam und ging, das heißt, man öffnete und schloss Türen, manchmal verspätete man sich oder ging etwas früher ; einige warfen versehentlich Stühle um, andere absichtlich Geschirr ; Zugaben wurden erklatscht oder der Auftritt missfallender Künstler lärmend abgebrochen. Diese Musikkultur veränderte sich. Zwischen 1820 und 1860 erfand das Publikum das Schweigen. Konzert- und Opernbesucher verwandelten sich in Musikhörer im wörtlichen Sinne – sie hörten Musik. Die Menschen begannen Geräusche zu verhindern, sich im Laufe des Abend selbst zu kontrollieren: Sie applaudierten statt zwischen den Sätzen am Ende einer Sinfonie und beschränkten die Konversation auf die Treffen im Foyer in der Pause. Die Unruhe und die spätere Disziplinierung des Publikums waren nicht nur pittoreske Eigenarten, sie waren gesellschaftlich wichtig. Denn die Veränderung des Publikumsverhaltens, die Art und Weise wie Musik gehört und angeeignet wurde, ermöglicht es, den Wandel kultureller Geschmacksnormen und sozialer Beziehungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu erfassen. Die Konzert- und Opernhäuser erfüllten genau diese Funktion als Orte, in denen Musikfreunde zunehmend vom Urteil der Anderen abhängig und so für das eigene Verhalten sensibilisiert wurden. Der Wandel des Hörverhaltens markiert eine Periode des historischen Übergangs und bietet die Chance, die Konkurrenz etablierter und innovativer Praktiken, musikalische Kontrollverluste mit Kontrollversuchen zu vergleichen. Dadurch eröffnen zunächst ergebnisoffene Prozesse neue Einsichten. Die Bedeutung des neuen Hörverhaltens ist kaum zu überschätzen, war es doch Indiz für einen nachhaltigen ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 53 Wandel von sozialer Praxis, politischen Urteilen und ästhetischem Geschmacksurteil.9 Der Fokus richtet sich hier auf die ästhetische und die politische Bewertung der symphonischen Musik des 19. Jahrhunderts im Konzertsaal, was umgekehrt bedeutet, viele Genres auszublenden: Die Kirchen- und die Chormusik ebenso wie die ganze Bandbreite der Unterhaltungsmusik. Die Aufführungen von Sinfonien lassen sich empirisch leichter untersuchen. Zwar funktioniert diese Kombination aus kultureller und sozialer Ordnung auch in anderen öffentlichen Orten wie Tanzlokalen oder Cafs. Was dort aber im Vergleich zu den Begegnungsräumen der Elite fehlt, sind die institutionelle Verfestigung der Spielstätten, ein regelmäßiges Repertoire und ein fester Publikumsstamm. Öffentlich auffällig sind formal aufwändig konzipierte Werke und groß besetzte musikalische Gattungen – Aufführungen, die aus sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen ein großes Publikum benötigen. Lieder und Kammermusik werden deshalb ganz ausgeblendet, weil sie für die öffentliche Rezeption der Musik nur einen relativ geringen Stellenwert besaßen. Von Interesse ist, wie sich durch musikalische Aufführungen Kommunikationsgemeinschaften in den großen Städten herausbildeten. Der Umgang der Eliten miteinander im Konzertsaal und im Opernhaus lässt nicht nur manche soziale und ökonomische Differenzen in Berlin, in London und in Wien erkennen. Dem gegenüber ist die vergesellschaftende Wirkung in allen Spielstätten nicht zu unterschätzen. Erkennbar sind wichtige kulturelle Übereinstimmungen in den drei Metropolen in der Herausbildung des Konzertwesens, im wachsenden Publikumsinteresse und im sich verändernden Geschmack. In Wien machten die vielfältigen Institutionen der Kaiserstadt und besonders die Kultur der Adelshäuser die Stadt zu einem musikalisch bedeutsamen Ort. Hierin lag ein wichtiger Unterschied zum Musikleben in Berlin und in London. Adelige Familien, wie gerade Esterhzy, Lichnowski und Lobkowitz, engagierten sich als Mäzene, als Veranstalter zunächst halböffentlicher Konzerte und finanzierten ohne Bedenken selbst Beethovens Karriere. Weder in der 9 Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass über diesen Prozess des Hörenlernens immer noch recht wenig bekannt ist. Vgl. neben Johnson, Listening; Christina Bashford, Learning to Listen, Audiences for Chamber Music in Early-Victorian London, in: Journal of Victorian Culture Edinburgh 4. 1999, S. 25-51; William Weber, Did People Listen in the 18th Century? in: Early Music 25. 1997, S. 678-691; Michael P. Steinberg, Listening to Reason. Culture, Subjectivity, and Nineteenth-Century Music, Princeton 2004; Hall-Witt, Fashionable, S. 227 – 264; Peter Gay, Die Macht des Herzens. Das 19. Jahrhundert und die Erforschung des Ich, München 1997, S. 19 – 48; Sven Oliver Müller, Hörverhalten als europäischer Kulturtransfer. Zur Veränderung der Musikrezeption im 19. Jahrhundert, in: Peter Stachel u. Philipp Ther (Hg.), Wie Europäisch ist die Oper? Wien 2009, S. 41 – 53. 54 Sven Oliver Müller Struktur der Habsburgermonarchie noch im Musikleben ist ein „bürgerliches Zeitalter“ zu erkennen. Der Hochadel achtete auch nach 1848 auf seine Abgrenzung zum aufsteigenden Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum. Das aber eröffnete den Orchesterkonzerten neue Möglichkeiten. Die Konzertsäle waren für alle Eliten zugänglich, für den Adel und für das gehobene Bürgertum gleichermaßen. Das zeigte exemplarisch die erfolgreiche Neugründung der „Gesellschaft der Musikfreunde“ 1813. Diese Konzertreihe changierte zunächst zwischen aristokratischem Salon und öffentlichen Konzerten. Im Unterschied zu den Kaufleuten und Händlern interessierten sich gerade Beamte und Lehrer für diese neue musikalische Unterhaltung.10 Auch in Berlin erkannten viele Anwälte, Ärzte und Beamte, dass ihre Chancen in der Gesellschaft durch den individuellen Erwerb musikalischer Bildung wuchsen und nicht mehr allein durch die Herkunft und den materiellen Besitz. Spätestens seit den 1830er Jahren erlaubten neue Konzertserien die öffentliche Sichtbarkeit der Bürger und nutzten der Herausbildung einer bürgerlichen Elite. Das Repertoire der staatlichen Königlichen Kapelle war überaus konservativ ausgelegt (Potpourris aus Spätbarock und Frühklassik) und erst die Initiativen privat gegründeter Orchester bereicherten das Berliner Konzertleben. Im Ergebnis zeichnete sich in Berlin ein gemeinsamer Musikkonsum von Adeligen und Bürgern ab. Auch die königliche Familie nahm an den Konzerten der von Bürgern organisierten Singakademie teil und erlebte beispielsweise die Wiederaufführung von Bachs Matthäus-Passion durch Felix Mendelssohn Batholdy und Carl Friedrich Zelter 1829. Die Tatsache, dass sich Adelige und Bürger immer öfter im Konzert begegneten, sich in Gespräche über Sinfonien und Solokonzerte vertieften, zeigt, dass sich Berlin wenigstens in seiner kulturellen Praxis weiter als Wien öffnete.11 In London war vor allem der Hochadel (nobility) und weniger der niedere Adel beziehungsweise der Landadel (gentry) in den kulturellen Veranstaltungen präsent. Die gentry hatten es aus Gründen der räumlichen Entfernung und ihrer beschränkten finanziellen Mittel weit schwerer, die musikalische Saison in der Hauptstadt zu besuchen. In dieser Hinsicht galten in London ähnliche Rahmenbedingungen wie in Wien und in Berlin. Ein zentraler Unterschied zwischen London und den übrigen Metropolen bestand aber in der Organisation des Opernhauses selbst. In Wien und Berlin beherrschten die Hoftheater den Spielplan und das Gesellschaftsleben, wohingegen in London freie Unternehmer ohne staatliche Subventionen um die Gunst des Publikums 10 Die Angaben folgen Weber, Music, S. 87 – 98 u. S. 159 – 161. Vgl. die Beiträge in Rudolf Flotzinger u. Gernot Gruber (Hg.), Musikgeschichte Österreichs, Bd. 2: Vom Barock zum Vormärz, Wien 19952. 11 Vgl. Christoph Helmut Mahling, Zum „Musikbetrieb“ Berlins und seinen Institutionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Carl Dahlhaus (Hg.), Studien zur Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert, Regensburg 1980, S. 27 – 284; Applegate, Bach, S. 10 – 44. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 55 werben mussten.12 Ärzte, Rechtsanwälte und Verwaltungsfachleute, nicht aber das Wirtschaftsbürgertum, gründeten neue Konzertreihen, um ehemals private Aufführungen von Kunstmusik so in den öffentlichen Raum zu überführen. Ohne die bestehenden musikalischen Institutionen erweiterten sie in eigener Verantwortung die musikalische Praxis. Auffällig war die Neugründung der Royal Philharmonic Society 1813, einer Konzertreihe, welche nicht nur die neuen musikalischen Ideale der middle class (Sinfonien, Solokonzerte) befriedigte, sondern auch den ästhetischen Konservatismus (Barock, Chormusik) der aristokratisch dominierten „Ancient Concerts“ verdeutlichte.13 Dieser Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte und ein knappes Fazit. Nach diesen einführenden Bemerkungen handelt der zweite Teil vom neuen Hörverhalten des Konzertpublikums. Zunächst wird die Alltäglichkeit des undisziplinierten Musikkonsums im frühen 19. Jahrhundert beschrieben. Die Frage drängt sich auf, warum das bürgerliche Publikum überhaupt begann, sich schweigend auf die Aufführungen zu konzentrieren und warum sich diese Entwicklung in verschiedenen europäischen Städten und Ländern – wenn auch in unterschiedlichem Tempo und zeitlich versetzt – in dieselbe Richtung vollzog. Dabei interessiert der Übergang von der relativen habituellen Unordnung im Musikleben um 1800 zur relativen Ordnung um 1850, eine Entwicklung von der Vielfalt der Werte und Praktiken hin zur Angleichung. Die Entscheidung, Affekte zu disziplinieren, kann als eine Stufe des wachsenden bürgerlichen Selbstbewusstseins verstanden werden und speiste sich aus Widersprüchen einerseits und neuen Grenzziehungen andererseits. Durch wen und auf welche Weise setzten sich schärfer ausgewählte und kontrolliert gehörte Musikwerke durch? Verursachten neue Kompositionen und Aufführungen oder neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelle Entscheidungen diesen Wandel? Das heißt, es ist zu diskutieren, ob sich in erster Linie das Benehmen der Hörer oder der gesellschaftliche Stellenwert musikalischer Aufführungen veränderte. Der dritte Teil schildert die Politisierung dieser neuen musikalischen Praktiken in der Mitte des 19. Jahrhunderts – die politische Reichweite der kulturellen Gemeinschaft der Musikfreunde in Berlin, in London und in Wien.14 Die ästhetischen Auseinandersetzungen des Konzert- und Opernpu12 Vgl. Hall-Witt, Fashionable, S. 12 – 22 u. S. 149 – 172; Michael Walter, „Die Oper ist ein Irrenhaus“. Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1997, S. 71 – 109. 13 Vgl. Weber, Music, S. 61 – 80 u. S. 162 – 164; Simon Gunn, The Public Culture of the Victorian Middle Class. Ritual and Authority in the English Industrial City, 1840 – 1914, Manchester 2000, S. 134 – 162. 14 Vgl. die Beiträge in Sven Oliver Müller u. a. (Hg.), Die Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters in Europa, Wien 2010; Philip V. Bohlman, The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History, Santa Barbara 2004. 56 Sven Oliver Müller blikums über einen angemessenen musikalischen Geschmack eröffneten in den 1830er und 1840er Jahren vielen Bildungs- und Wirtschaftsbürgern zusätzliche politische Handlungsspielräume gegenüber den herrschenden Adeligen. Denn wer die Kunstmusik nicht sensibel zu hören vermochte, so die Argumentation, der schien auch ungeeignet für die Kontrolle des Staatswesens zu sein. Weil das Bürgertum seinen gesellschaftlichen Stellenwert auch durch den Besuch der Konzerthäuser sichtbar machen konnte, wurde diese kulturelle Praxis auch als politische Form immer wichtiger. Eine These lautet, dass die kulturelle Konkurrenz der Institutionen und der Streit um ein adäquates Hörverhalten die politische Konkurrenz zwischen Bürgertum und Adel erleichterte. Die eigenen Erfahrungen im Konzertsaal konnten Musikliebhaber strategisch nutzen, um etwa eigene Positionen in der Debatte über Pressefreiheit oder Wahlrechtsreformen zu markieren. Hier interessiert die Frage, ob die Freude an der Musik die Hörer zu politischen Freunden verband. Mit Hilfe welcher kulturellen Strategien verwandelten manche Bildungsbürger die Adeligen im Konzerthaus in eine kulturell verfeindete Gruppe? Waren es primär Kategorien der Musik, die divergierende politische Positionen formulierten? Oder geschah es doch umgekehrt, und musikalische Konflikte ließen sich in der Sprache der Politik austragen? Schließlich wirft die Politisierung des musikalischen Geschmacks auch die Frage nach dem Zeitraum auf: Manches spricht dafür, dass das musikliebende Bürgertum eine stärkere eigene kulturelle Identität in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigte als in der zweiten Hälfte. Die Tageszeitungen und Musikzeitschriften sind die wichtigste Quellengruppe in diesem Beitrag, sie eröffnen viele Möglichkeiten, um den gesellschaftlichen Rang und die Bewertung von Musik zu untersuchen. Dieser Befund mag überraschen, denn musikalische Aufführungen verschwanden im Laufe des 20. Jahrhunderts im Kulturteil der Tageszeitungen. Der Unterschied zu den Berichten im 19. Jahrhundert könnte kaum größer sein. In Berlin informierten Zeitungen über ein wichtiges Konzert oft auf dem unteren Drittel des Titelblattes. In London fanden Leser die über zwei oder drei Spalten gehende Schilderung einer Gala-Aufführung im Opernhaus gleich neben dem politischen Leitartikel. Die zeitgenössische Presse bewertete nicht nur die musikalischen Werke und die Qualität der Aufführungen, sondern enthielt auch umfangreiche Informationen über die Erscheinung, die Zusammensetzung und das Verhalten des Publikums. Zu Beginn jeder Spielzeit druckten die wichtigsten Tageszeitungen eine vollständige Besucherliste der Konzert- und Opernhäuser ab, das heißt, ein minutiöses Verzeichnis der adeligen und großbürgerlichen Rezipienten, die Sitzplatzverteilung und die Kartenpreise. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 57 Anwesende und Abwesende wussten um diese kulturelle Anordnung der Gesellschaft und nutzten sie.15 Die Zeitungslandschaft veränderte sich mit ihren Lesern. Der Übergang zwischen Zeitungen und Zeitschriften war im frühen 19. Jahrhundert fließend. Oft unterschieden schriftstellerisch arbeitende Journalisten kaum zwischen Meldung, Hintergrundanalyse und Kommentar. In Wien wollten die Sonntagsblätter oder die Allgemeine Wiener Musikzeitung 1847 sowohl über die Musik als auch über die Politik in der Donaumonarchie berichten. Wichtig waren zudem die individuellen Leistungen einiger Schriftsteller, die sich vom professionellen Arbeitsethos späterer Kritiker deutlich unterschieden. E.T.A. Hoffmann wirkte als Dichter, Schriftsteller und Journalist. Ludwig Rellstab verfasste nicht nur Opernlibretti, sondern brachte auch gelehrte Kunstzeitschriften wie die Iris auf den Markt. Adolf Bernhard Marx gab die analytisch hochrangige Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung heraus.16 II. Die Erfindung des Schweigens Ein heutiger Konzert- oder Opernbesucher hätte sich in einer typischen Vorstellung um 1820 vermutlich nicht besonders wohl gefühlt. Bis in die Mitte des Jahrhunderts hinein entsprach das Hörverhalten oft nicht schweigender bildungsbürgerlicher Distanz, sondern erinnerte an die lautstarke Anteilnahme auf einem Fußballplatz. Das galt für London und Paris, mit geringen Abstrichen aber auch für Berlin, Wien und die übrigen europäischen Metropolen. Während die Musik lief, plauderte man, mal leiser, mal lauter, aß und trank, besuchte sich gegenseitig in den Logen und promenierte durch den Saal. Geschäftsleute besprachen ihre kommerziellen Angelegenheiten, Frauen führten ihre neueste Kleidung vor, Kurtisanen machten potenzielle Liebhaber auf sich aufmerksam. Körperlich gezeigte Freuden kamen zumal bei guten Weinsorten, leckeren Appetithäppchen und köstlichen Desserts ins Spiel. Stendhal beispielsweise schwärmte in Mailand darüber, dass die Diener 15 Vgl. aus der Literatur der Zeitungsforschung die Beiträge von Jörg Requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und Entwicklung des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 1995; Peter Borchardt, Die Wiener Theaterzeitschriften des Vormärz, Wien 1961; Imogen Fellinger, Verzeichnis der Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts, Regensburg 1968; Die Sprachwendungen und ungewöhnlichen Schreibweisen des frühen 19. Jahrhunderts werden hier im Regelfall beibehalten. Vgl. Derek B. Scott, Sounds of the Metropolis. The Nineteenth-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna, Oxford 2008, bes. S. 15 – 57; Hall-Witt, Fashionable, S. 23 – 56. 16 Vgl. Applegate, Bach, S. 104 – 124; Jürgen Rehm, Zur Musikrezeption im vormärzlichen Berlin. Die Präsentation bürgerlichen Selbstverständnisses und biedermeierlicher Kunstanschauung in den Musikkritiken Ludwig Rellstabs, Hildesheim 1983. 58 Sven Oliver Müller Gefrorenes in die Loge brachten und die Anwesenden darüber wetteten, welche der allabendlich angebotenen Sorbetsorten wohl am besten mundeten.17 Auch der Tabakkonsum fehlte im Musikleben nicht. Bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein genossen viele Männer Zigarren und Pfeifen während der Aufführung. Zur Entspannung breiteten viele Besucher sich genüsslich in ihren Sitzen aus und behielten dabei ihre Hüte zu oft auf und ihre Schuhe zu selten an. Dabei waren die Musikfreunde nicht eigentlich unaufmerksam; sie konzentrierten sich nur höchst selektiv auf bestimmte zirzensische Glanzleistungen der Künstler und die „schönen“ Stellen einer Partitur. Dann aber nahmen sie in der Regel überaus aktiv am Geschehen teil, wobei sie potenziell jedes Musikstück und jede Bravourarie bejubeln oder ausbuhen konnten. Oft zog sich die Aufführung erheblich in die Länge, weil einzelne Arien oder Szenen nach der Aufforderung der Zuhörer zum Teil mehrfach wiederholt werden mussten.18 Überraschenderweise stechen im Vergleich des Opern- mit dem Konzertpublikum im frühen 19. Jahrhundert zunächst die Parallelen ins Auge. Auch wenn die Besucher der Konzerte später die Avantgarde eines neuen schweigenden Hörverhaltens bilden sollten, unterschied sich ihr Benehmen lange kaum von dem des Opernpublikums. Hier wie dort waren der spontane Genuss musikalischer Darbietungen und der eigenmächtige Konsum von Musik ausschlaggebend. Der nach London gereiste Franz Grillparzer klagte 1836 über das in seinen Augen völlig ungehörige Benehmen des Opernpublikums. Wem’s einfällt, der behält den Hut auf dem Kopfe. Kommen nun gar die half-price Leute, so setzt sich jeder wo sein Platz ist. Die später kommenden stürmen nun in die Logen, steigen hinter dem Rücken der Sitzenden auf die Bänke, drängen sich ein. Die Logenthüren bleiben offen. Besonders empörend sei „die Frechheit der Weiber in den Corridors“.19 Diese Freiheit bedeutete nicht unbedingt, jede Kontrolle aufzugeben, nur bestimmten diese Musikliebhaber selbst, was für die Elite zu wünschen war 17 Stendhal, Rom, Neapel und Florenz im Jahre 1817, in: Stendhal (Henri Beyle), Werke, hg. v. Carsten Peter Thiede, Frankfurt 1980, S. 24. 18 Grundlegend zur Musikkultur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts in England ist John Brewer, The Pleasures of the Imagination. English Culture in the Eighteenth Century, London 1997. Vgl. Howard Chandler Robbins Landon, Mozart. Die Wiener Jahre, 1781 – 1791, München 1990; Daniel Fuhrimann, Herzohren für die Tonkunst. Opern- und Konzertpublikum in der deutschen Literatur des langen 19. Jahrhunderts, Freiburg 2005; Marjorie Morgan, Manners, Morals and Class in England, 1774 – 1858, London 1994 und den Sammelband von Carl Dahlhaus (Hg.), Die Musik des 18. Jahrhunderts, Laaber 1985. 19 Zitiert nach Eduard Hanslick, Musikalisches Skizzenbuch. Neue Kritiken und Schilderungen, Bd. 4: Die moderne Oper, Berlin 1888, S. 262. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 59 und was nicht. Der eigene Rang und das eigene Verhalten setzten Markierungspunkte, welche in feinen Abstufungen die soziale Position kenntlich machten. So stellte das häufigste Freizeitvergnügen in der Oper den gegenseitigen Besuch in den Logen mit anschließenden Gesprächen und Scherzen dar. Männer bewegten sich meist zwischen den Logen, ihre Frauen blieben dort, hatten aber das Recht, selbst zu entscheiden, wen sie einließen und wen nicht.20 In den Begegnungen der elitären Musikfreunde waren alle geschäftlichen und privaten Angelegenheiten von Interesse. Besondere Aufmerksamkeit zogen die jüngeren höheren Töchter der Gesellschaft auf sich. Was immer die Musik den Männern auch offerieren mochte, alles verblasste hinter der Aussicht auf weibliche Offerten. Die Allgemeine Musikalische Zeitung berichtete über das Berliner Konzertleben: Das allgemeine laute Plaudern hörte nicht einen Augenblick auf; es hatten auch sogar verschiedene Herren sich mit ihren Stühlen vor die Sitze der Damen so gesetzt, dass sie dem Orchester den Rücken zukehrten, um sich mit diesen desto bequemer laut unterhalten zu können.21 Das Publikum hörte viele der gespielten Kompositionen kaum, weil die Aufmerksamkeit dem eigenen Lärmen, dem Kartenspiel oder der gegenseitigen Unterhaltung galt. Die musikalischen Aufführungen auf der Bühne zu erleben, war zwar wichtig, entscheidend aber war das Interesse an den sozialen Aufführungen auf der Bühne des Zuschauerraums. Über das geltende Verhalten in der Oper in Berlin hieß es dazu: Bey den nachkommenden Vorstellungen wird geschwätzt, gelärmt, in den Logen Besuch gegen Besuch gewechselt, Karten gespielt, suopirt, ja, man lässt wohl gar die Vorhänge an der Loge herab, um auch nicht zufällig von der Bühne her im Spiele oder im Gespräche gestört zu werden. Bei berühmten Cavatinen und Duetten „werden Karten oder Essbesteck auf einige Minuten bey Seite gelegt […] um sich gleich […] wieder vom Theater ab, und zu seiner vorigen Unterhaltung zu wenden“.22 Die fehlende Begeisterung des Publikums verärgerte häufig die auftretenden Künstler. Louis Spohr wunderte sich vor seinem Konzert am Braunschweiger Hof darüber, dass die Herzogin ihn aufforderte, nicht forte zu spielen, denn zu laute Klänge lenkten sie von ihrem Kartenspiel ab. Oft beeinträchtigte das Publikumsverhalten die Qualität neuer Kompositionen. Gioacchino Rossini passte gelegentlich eilig geschriebene Bühnenwerke der unkonzentrierten Aufmerksamkeit seiner Hörer an. Mehr noch: In seiner Oper „Ciro di Babilonia“ schrieb er für eine zweitklassige Sängerin eine wenig komplexe „Sorbet-Arie“ (aria del sorbetto). Den Namen erhielt das Stück durch das 20 Vgl. Hall-Witt, Fashionable, S. 59 – 73. 21 Allgemeine Musikalische Zeitung 10. 1808, S. 380. 22 Ebd., 16. 2. 1820, S. 110. 60 Sven Oliver Müller Publikum, das sich dadurch zum ungestörten Konsum seiner Eiscreme während der Vorstellung stimuliert sah.23 In der Mitte des 19. Jahrhunderts verschwand dieses Hörverhalten. Die Übergangsperiode von der Fremd- zur Selbstkontrolle der Konzert- und Opernbesucher ist schwer zu begründen, weil der Wandel so massiv ausfiel und die Entstehung eines neuen Lebensstils aufzeigte. Ab dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Hörverhalten nicht allein als Folge neuer ästhetischer Prämissen, sondern ebenso als ein Resultat unbekannter akustischer Reize, einer sich wandelnden Klangwelt in den europäischen Metropolen. Neue akustische Belastungen sind zu beobachten und die Entwicklung neuer Anpassungsstrategien gegen die hörbare Lautstärke. Viele Stadtbewohner ärgerten sich nicht allein über die exzessiven Baumaßnahmen und die lärmenden technischen Transportmittel, sondern bereits über die akustischen Störungen von Straßenmusikern und Zirkustruppen. Die Menschen vermochten sich der belastenden Präsenz von öffentlichen Klängen viel schwerer zu entziehen als der öffentlichen Existenz von Bildern. Dieser akustischen Unordnung begegnete das Bürgertum durch Ordnungsversuche, dem akustisch Fremden durch neue Grenzziehungen.24 In vielen großen Städten formte sich ein eigenes distinktives Publikum und brachte das Schweigen gleichsam von außen in den Konzertsaal. Die Festlegung des Benehmens, des Konsums und der Pünktlichkeit ist ein Produkt der gesellschaftlichen Veränderung nach 1800. Im Publikumsverhalten ist eine neue Bewertung der politischen, sozialen und kulturellen Ordnung erkennbar, die sich idealtypisch, aber eben nicht ausschließlich im Konzert- und Opernhaus beobachten lässt. Aufführungen von Musik sind Elemente einer neuen Kommunikation in pluralen Gesellschaften, durch die sich im Laufe der Zeit festere Gruppen herausbilden.25 Öffentlich zu schweigen, stellte eine mehr 23 Gay, Macht, S. 25. Louis Spohr hielt in seinen Lebenserinnerungen, hg. v. Folker Göthel, Kassel 1860/61, Bd. 1, 245 f., fest, dass die soziale Praxis des musikalischen Lärmens ganz Europa im Griff hatte. Über seinen Besuch in der Mailänder Scala im Jahre 1816 schrieb er : „Während der kräftigen Ouvertüre, mehreren sehr ausdrucksvoll akkompagnierten Rezitativen und allen Ensemblestücken war ein Lärm, daß man kaum etwas von der Musik hörte. In den meisten Logen wurde in Karten gespielt und im ganzen Hause überlaut gesprochen. Es läßt sich für einen Fremden, der gern aufmerksam zuhören möchte, nichts Unausstehlicheres denken als dieser infame Lärm. Indessen ist von Leuten, die dieselbe Oper vielleicht dreißig- bis vierzigmal sehen, und die das Theater nur der Gesellschaft wegen besuchen, keine Aufmerksamkeit zu erwarten, und es ist schon viel, daß sie nur einige Nummern ruhig anhören.“ 24 Das ist die treffende Beobachtung von Picker, Victorian Soundscapes, bes. S. 15 – 81. 25 Vgl. Heinz-Dieter Meyer, Taste Formation in Pluralistic Societies. The Role of Rhetorics and Institutions, in: International Sociology 15. 2000, S. 33 – 56; Sven Oliver Müller, Körper und Kommunikation. Das Publikum in der Berliner Hofoper, 1820 – 1870, in: Jens Elberfeld u. Marcus Otto (Hg.), „Beauty politics“. Zur Genealogie von Ethik und ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 61 oder minder bewusste Entscheidung dar, um den Lebensstil zu klassifizieren, um mit der neu begründeten Schönheit der Musik auch den eigenen sozialen Rang zu festigen. Der Geschmack vereinte die Hörer, die in ihrem Verhalten aufeinander abgestimmt waren und zueinander passten, je länger sie gemeinsam Musik hörten und sich dabei regelmäßig beobachteten. Zunächst war es die Bildungselite in einigen norddeutschen Städten, die sich für einen Wandel der bestehenden musikalischen Praxis durch eine teilweise Neubewertung des Spielbetriebes entschied. Die Musik im Allgemeinen und die Instrumentalmusik im Besonderen wurden von einer der niederen zu einer der höchsten Kunstformen stilisiert. Gerade im deutschsprachigen Raum schrieb man der Musik transzendentale Qualitäten zu, sie versprach, höhere Gegenwelten zu eröffnen. Musikalische Spielstätten, zumal die Konzertsäle begriffen viele Bürger gleichsam als sakrale Tempel, die es vor Entweihung und eben auch vor unangepasstem und unaufmerksamem Verhalten zu schützen galt. Von dieser Position ausgehend, war es nur ein konsequenter Schritt zum Ausbau der eigenen und zur Bekämpfung der vermeintlich fremden Ideale. Eine der Ursachen für die wachsende Disziplinierung der Hörer war die Professionalisierung des Spielbetriebs. Im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts zeichnete sich eine neue Organisation musikalischer Aktivitäten ab. Musiker veranstalteten immer seltener Konzerte in eigener Regie, wohingegen die Anzahl der regelmäßig durchgeführten Konzertveranstaltungen wuchs. Die Ausdifferenzierung der Gattungen und wachsende Ansprüche an die Aufführungen verstärkte die Trennung zwischen Amateuren und Experten, zwischen privaten und öffentlichen Darbietungen.26 Die vorsichtige soziale Öffnung des Spielbetriebes funktionierte weniger als eine Demokratisierung, sondern eher als eine Professionalisierung der Aufführungen. Im Zeitalter wachsender Kommerzialisierung, Popularisierung und sich verändernder Geschmackspräferenzen schwand das Interesse an musikalischen Laien, ad hoc zusammengestellten Ensembles und unzureichend ausgebildeten Solisten. Die gestiegene Nachfrage und die höheren Erwartungen des Publikums beförderten adäquate berufliche Leistungen einzelner Künstler und der Orchester. Qualität beruhte auf langen und Ästhetik in der Moderne, Wiesbaden 2009, S. 205 – 223; Ulrike Döcker, Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. Jahrhundert, Frankfurt 1994, S. 77 – 85; die Beiträge in Hermann Danuser (Hg.), Musikalische Interpretationen, Laaber 1992; insges. Oliver Sacks, Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn, Reinbek 20086. 26 Zur neuartigen Professionalisierung des Spielbetriebs vergleiche Rebecca Grotjahn, Die Sinfonie im deutschen Kulturgebiet 1850 bis 1875. Ein Beitrag zur Gattungs- und Institutionengeschichte, Sinzig 1998, S. 88 – 121; Simon McVeigh, Concert Life in London from Mozart to Haydn, Cambridge 1993, S. 223 – 229; William Weber, Redefining the Status of Opera, London and Leipzig, 1800 – 1848, in: Journal of Interdisciplinary History 36. 2006, S. 507 – 532, hier S. 530 f. 62 Sven Oliver Müller intensiven Vorbereitungen, auf einer minutiösen Ausbildung, so dass statt praktizierender Laien nunmehr musikalische Experten erwartet wurden. Damit stiegen auch die Honorare der Musiker. Das künstlerische Niveau erhöhte sich zusätzlich durch den Einsatz von Stimmführern für bestimmte Instrumentengruppen innerhalb des Orchesters und durch die Etablierung eines die Aufführung leitenden Dirigenten. Institutionell betrachtet, ist eine erhebliche quantitative Zunahme organisierter Abonnementkonzerte zu beobachten. Diese Professionalisierung führte unter anderem dazu, dass die Programme immer stärker nach künstlerischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden. Inhaltlich verschwanden um die Mitte des Jahrhunderts die überwiegend gemischten Konzertprogramme, die aus Ouvertüren, Duetten, Chorszenen, Arien, solistischen Einlagen, Sinfonien und Tänzen bestanden, zu Lasten zeitlich verkürzter Veranstaltungen mit wenigen Werken.27 Besonders deutlich wird dieser ästhetische und habituelle Wandel durch den Blick auf die Aufwertung der Sinfonie im Musikleben. In der Sinfonie erblickten viele Bildungsbürger eine ideale kulturelle Leistung, denn sie vereine die unterschiedlichen Stimmen im Orchester. Die Sonatenhauptsatzform mit ihrem dialektischen Spannungsverlauf und ihrem kontrastreichen Verschmelzen der Einzelstimmen zu einer harmonischen Einheit bildete das wichtigste Stilelement des Konzertbetriebes. Weit stärker als die Oper wurde die Musik im Konzert nach Auffassung der bürgerlichen Elite allmählich nur noch dank der Internalisierung eines bestimmten Wissenskanons konsumierbar und damit tendenziell allein einem gebildeten Publikum zugänglich.28 Die Kanonisierung der Sinfonie initiierte zweierlei: den Glauben an eine absolute Musik und Ansätze für ein neues Hörerverhalten im Konzert. Diese neuen Standards im Musikleben eröffneten dem Publikum andere Wege der Deutung, Aneignung und Reproduktion seiner Umwelt. Vereinzelte Habsburgische Aristokraten ausgenommen, war es namentlich das deutschsprachige Bildungsbürgertum, das seit den 1820er Jahren eine Sinfonie zunehmend 27 Vgl. Daniel Koury, Orchestral Performance Practices in the Nineteenth Century, Ann Arbor 1986, S. 176 – 199 u. S. 299 – 325; Percy A. Scholes, The Mirror of Music, 1844 – 1944. A Century of Musical Life in Britain as Reflected in the Pages of the Musical Times, 2 Bde., London 1947, hier Bd. 1, S. 376 f. 28 Vgl. Leo Balet u. Eberhard Gerhard, Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert, hg. v. Gert Mattenklott, Frankfurt 1972, S. 334 – 394 u. S. 468 – 481; Mark Everist, Reception Theories, Canonic Discourses, and Musical Value, in: Nicholas Cook u. Mark Everist (Hg.), Rethinking Music, Oxford 1999, S. 376 – 402; Ute Daniel, Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 1995, S. 126 – 157; Thomas Nipperdey, Kommentar : „Bürgerlich“ als Kultur, in: Jürgen Kocka (Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 143 – 148; Eberhard Preußner, Die bürgerliche Musikkultur. Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts, Kassel 1935. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 63 als wertvolles „Werk“ und weniger als unterhaltendes „Beiwerk“ begriff.29 Diese Form der so genannten „absoluten“ Musik im Orchester sollte nicht einfach nur genossen, sondern verstanden werden, und auf lange Sicht hin zur Erbauung der Individuen und zur Vereinheitlichung des Kollektivs wirken. Die Auseinandersetzung des Publikums zunächst mit den Sinfonien Beethovens (und in den 1840er Jahren mit denen Mendelssohn Bartholdys und Schumanns) öffnete Gelegenheiten für ein neues Hörverhalten. Beethoven durch erworbenes Verständnis verehren zu wollen, verband Kanonisierung und Kultivierung. Sinfonien zu hören, hieß ihre Bedeutung zu erlernen und die tradierte Unterhaltung zu verlernen. Auch das neue Hörverhalten war eine Form der Unterhaltung, aber erweitert um den Charakter der Bildung. Erkannte das gebildete Publikum diese Bedeutung, wollte es immer mehr derartige Konzerte besuchen und seinen Umgang diesen Werken anpassen. Anders gewendet: Die Zuhörer hatten ihre Aufmerksamkeit durch die disziplinierenden Regeln des Konzertbetriebes erst zu erlernen. „Bei der Aufführung einer Symphonie“ hieß es aus Berlin bereits 1824, „wirkt nicht äußerliches. […] Wer nicht der Komposition in ihrem Gange folgt, hat gar nichts, und so lehren Symphonien, Musik ohne Zerstreuung und um ihrer selbst willen zu hören.“30 Den Besuchern der Berliner Sinfoniekonzerte wünschte man für diesen Weg der Selbsterkenntnis nicht nur „Treue und Pietät“, sondern die immer zu wiederholende konzentrierte Teilnahme an sinfonischen Konzerten: Die Beethovensche Symphonie ist zu groß, zu reich und zu tief, um in ihrer Ganzheit und vollen Herrlichkeit auf das erste Mal gefasst zu werden. […] Vergessen wir aber nicht, daß es das tiefste und gereifteste Instrumentalwerk des genialsten, gereiftesten jetzt lebenden Tonkünstlers ist: so wird das Unverstandene selbst den Wunsch nach Wiederholung der Kunstfeier erwecken.31 Dieser Duktus, durch kanonisierte Stile und Werke die Geltung der musikalischen Praxis zu erweitern, blieb nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Etwa ab 1840 finden sich auch in der Londoner Presse Vorbehalte gegen Konzertveranstalter, die Beethovens Sinfonien falsch oder verkürzt 29 DeNora, Beethoven, S. 11 – 36; sowie Ulrich Schmitt, Revolution im Konzertsaal. Zur Beethoven-Rezeption im 19. Jahrhundert, Mainz 1990; Egon Voss, Das Beethoven-Bild der Beethoven-Belletristik. Zu einigen Beethoven-Erzählungen des 19. Jahrhunderts, in: Helmut Loos (Hg.), Beethoven und die Nachwelt. Materialien zur Wirkungsgeschichte Beethovens, Bonn 1986, S. 81 – 94. 30 Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung 1. 1824, S. 444. Vgl. Anna Pederson, A. B. Marx, Berlin Concert Life, and German National Identity, in: 19th Century Music 18. 1994, S. 87 – 107; Celia Applegate, The Internationalism of Nationalism. Adolf Bernhard Marx and German Music in the Mid-Nineteenth Century, in: Journal of Modern European History 5. 2007, S. 139-158. 31 Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung 3. 1826, S. 384 f. 64 Sven Oliver Müller Abb. 1: Fernand Khnopff, En coutant Schumann, 1883, Muses royaux des Beaux-Arts de Belgique. gespielt hätten. Eine Konzertankündigung der Neunten Sinfonie durch die New Philharmonic Society hielt schlichtweg fest, dass allenfalls das eigene Unverständnis der Zuhörer diese für Beethovens Geist nicht empfänglich mache: We believe no one will depart from the Hall this evening without a deeper conviction that Beethoven’s genius soars immeasurably above all other Composers, of every age and clime. Should any withhold his approval of the work, let him be assured the fault is not Beethoven’s but his own.32 Die Veränderung des Hörverhaltens kann als ein Prozess der Aus-Bildung verstanden werden. Aufmerksam war das Publikum im Jahre 1820 und im Jahre 1860 gleichermaßen, nur unterschieden sich die Formen ihrer Aufmerksamkeit erheblich voneinander. Vielfalt und Unterhaltung wichen Angleichung und Disziplin. Erst im Konzertsaal und etwas später im Opernhaus breitete sich eine zunächst ungewohnte Stille aus. Die Hörer verwandelten sich in Zuhörer. Im Bild „En coutant Schumann“ des belgischen Symbolisten Fernand Khnopff sitzt eine in schwarz gekleidete Hörerin in sich gebeugt in der Mitte 32 Prospectus of the New Philharmonic Society and Programme of the First Concert, London 1852, S. 10 f., in: British Library, Royal Philharmonic Society RB 23 B 3725. Vgl. Athenaeum, 1. 6. 1844, S. 506. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 65 eines bürgerlichen Salons (Abbildung 1). Das Gesicht verbirgt sie in ihrer rechten Hand, der Daumen berührt die Schläfe. Die Kunst des Pianisten kann man nur im Hintergrund erahnen, denn der Maler lenkt den Blick des Betrachters auf die Kunst des Zuhörens. Am leichtesten war die Disziplinierung der Musikfreunde in der Reglementierung ihrer Körper auszumachen. Nicht nur die eigene Bewegung während einer Aufführung, auch die Stimme und den expressiven Gesichtsausdruck verbargen die Zuhörer, um ihre habituelle Fähigkeit unter Beweis zu stellen. Sie verblieben auf ihren Sitzen, verzichteten auf beliebte Imbisse und erlernten das Schweigen. Die Teilnehmer musikalischer Aufführungen folgten allmählich konzentriert dem Verlauf der Musik, beschränkten Beifall und Missfallen maßvoll und stellten die Kommunikation mit den Künstlern wie mit den Sitznachbarn während der Vorstellung ganz ein. Jeder Hörer bemühte sich immer intensiver darum, Disziplin zu üben und seine eigene spontane Begeisterung nicht öffentlich zu zeigen: Aus Konsumenten musikalischer Unterhaltung sollten Kenner musikalischer Kunst werden.33 Mögliche Unregelmäßigkeiten galt es, durch Kontrolle zu bewältigen. Die Hörer passten sich einander an – auch um den Preis, für die gewonnene kollektive Sicherheit mit dem Verlust der eigenen eindrucksvollen Vorstellung zu bezahlen. Sie kalkulierten nicht nur ein, dass ihr eigenes Verhalten für jedermann im Konzertsaal sichtbar war, sondern orientierten sich auch an den neuen mehrheitsfähigen Informationen, welche das Publikum sich auf Dauer erschloss. Die Musikliebhaber stellten die seit langem etablierten Ordnungsvorstellungen im Konzertsaal in Frage und begannen die Suche nach Alternativen. Die traditionellen Besucher im Konzertsaal hatten zunächst kaum erklärte Feinde, zu ihren gefährlichsten Gegnern aber wurden im Laufe der Zeit ihre disziplinierten Freunde.34 In den 1820er und 1830er Jahren erlernten erst wenige Hörer das Schweigen. Recht zaghaft formierte sich ein über etwa vierzig Jahre andauernder Prozess der Geschmacksumwertung. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts aber waren die musikalischen Fachzeitschriften und Feuilletons intensiv mit dem Problem beschäftigt, wann man während der Vorstellungen applaudieren dürfe und wann man zu schweigen habe. Relativ leicht fielen Beschwerden über die 33 Vgl. die soziologische und musikwissenschaftliche Perspektive in Volker Bernius u. a. (Hg.), Der Aufstand des Ohrs. Die neue Lust am Hören. Reader neues Funkkolleg, Göttingen 2006; Wolfgang Gratzer, Motive einer Geschichte des Musikhörens, in: ders. (Hg.), Perspektive einer Geschichte abendländischen Musikhörens, Laaber 1997, S. 9 – 31; Johannes Goebel, Der Zu-Hörer, in: Bernius, Aufstand, S. 15 – 28; sowie Ute Bechdolf, Ganz Ohr, ganz Körper. Zuhörerkultur in Bewegung, in: Ganz Ohr. Interdisziplinäre Aspekte des Zuhörens, hg. v. Zuhören e.V., Göttingen 2002, S. 74-84. 34 Vgl. Johnson, Listening, S. 92 f.; Bashford, Learning, S. 25 – 28; Weber, People, S. 678 f., und insges. Erving Goffman, Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, München 20097, S. 193 – 207. 66 Sven Oliver Müller endlosen Zugaben im Konzertsaal. Im Urteil des Spectator hieß das: Da oft ganze Sinfonien durch einzelne Sätze unterbrochen würden, die ganze Aufführung mithin zerstörten, gelte es, Sinn zu stiften und diesen „sound of alarm“ zu bewältigen.35 In erster Linie aber zogen Kritiker und Journalisten gegen den Mangel an ernsthaften Verhaltensmaßstäben im zeitgenössischen Musikleben zu Felde. Beobachter in Berlin machten derartige Bewertungen früher als diejenigen in Wien oder in London. Nach 1850 jedoch unterschieden sich die großen europäischen Städte in dieser Frage immer weniger voneinander. Die Londoner Musical World beispielsweise verteilte Ratschläge über die im Konzert erwünschte Etikette. Auch nur zu flüstern oder gar sich im Saale zu bewegen, ginge bei Beethoven leider gar nicht, da der Meister dadurch zum Opfer seiner eigenen Verehrer würde. Selbstredend solle man nicht den Takt mitschlagen, Stücke vor sich hin summen oder sich aus Bewunderung zu lachhaften Gesten hinreißen lassen.36 Die wachsende Vermittlung musikalischer Nachrichten gelang durch die Tagespresse, die Kulturzeitschriften und die Fachorgane. Journalisten verwandelten ihre musikalischen Erlebnisse in eine wortreiche, aber geregelte Sprache. Diese Möglichkeiten des Schreibens müssen ausgelotet und nach den Begriffen, Sprachbildern und musikalischen Kategorien in den Zeitungen gefragt werden. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts setzten sich die Musikkritiker in der Presse durch. Ihre Urteile beeinflussten das Verhalten des Publikums, das seine musikalische Welt auch durch die Brille des Kritikers wahrnahm. In London schätzten die Leser etwa die Expertisen von Henry Chorley (Athenaeum) und die von Henry Davison (Times). Die Karriere von Eduard Hanslick in Wien stellte alles in den Schatten. Sein Berufsethos kannte keine Grenzen. Kompromisslos aber erfolgreich verteidigte Hanslick den Bestand des musikalischen Regelwerkes und rühmte sich selbst seiner öffentlichen Bildungsstrategie: „Dem Publikum gegenüber fühle ich mich zu dem Geständnis verpflichtet, daß ich eigentlich selbst das Publikum bin, dessen Befriedigung ich bei Bearbeitung dieser Schrift fürerst im Auge hatte.“37 Neue Regeln griffen in die Bewegungen des Publikums im Konzerthaus ein. Die Musiker und ihr Publikum wurden im Laufe der Zeit räumlich getrennt, im Konzertsaal setzte sich ein erhöhtes Podium durch. So wurden akustische und visuelle Verbesserungen erreicht, die Hörer leichter auf die Mitte des Saales hin 35 The Spectator, 23. 3. 1850, S. 276. Vgl. Müller, Hörverhalten, S. 41 – 53. 36 The Musical World, 3. 4. 1852, S. 217; A Word to Concert-Goers, in: ebd., 21. 9. 1867, S. 647. 37 Eduard Hanslick, Aus meinem Leben, 2 Bde., Berlin 1894, Bd. 1, S. 11. Vgl. Sandra McColl, Music Criticism in Vienna 1896 – 1897. Critically Moving Forms, Oxford 1996; Leon Botstein, Listening through Reading, Musical Literacy and the Concert Audience, in: 19th Century Music 16. 1992, S. 129 – 145. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 67 ausgerichtet, das heißt, auch für das Spiel der Künstler sensibilisiert. Die Einführung von festen Sitzreihen seit der Jahrhundertmitte beschränkte das Umhergehen und erschwerte die gewohnte Plauderei. Neu eingerichtete Konzertpausen trennten Aufmerksamkeit und Zerstreuung zeitlich voneinander.38 Die Veranstalter bestimmten, dass Konzerte pünktlich zur angekündigten Zeit zu beginnen hätten. Nach 1850 setzte man fest, dass der Zutritt nur vor dem Konzert und in der Pause zu erfolgen hatte. Das Publikum sollte nicht innerhalb der Aufführung, sondern nur zwischen den gespielten Werken den Saal verlassen. Die Royal Philharmonic Society veranlasste 1888 sogar, die Eingangsportale während der Sätze einer Sinfonie geschlossen zu halten.39 In diesem Lernprozess mischten sich handwerkliche Peinlichkeiten und bildungsbürgerliche Werturteile. „Hunde werden nicht geduldet“ – diese Vorschrift der Frankfurter Konzertgesellschaft lässt sich heute als Kuriosum, im 19. Jahrhundert aber als erwünschte Maßnahme begreifen.40 Im europäischen Musikleben folgte seit 1830 eine wachsende Mehrheit bürgerlicher und adeliger Zuhörer den neuen Umgangsregeln im Hörverhalten. Im Ergebnis zeichnete sich mehr ab als eine schweigende Selbstdisziplinierung. Die Mehrheit im Publikum verzichtete auf öffentliche Sinnlichkeit, entschied sich, um seinen gesellschaftlichen Stellenwert zu erhalten, neuen Bildungsidealen zu folgen und im Konzert Passivität und Sammlung zur Schau zu stellen. Diese Entwicklung erkannte die Allgemeine Wiener Musikalische Zeitung bereits 1842 und bilanzierte: Der Vergleich des heutigen Konzertwesens mit dem vergangenen bedeute zunächst, dass jene minder passiver Art waren als die unseren. Die Leute wollen, um unterhalten zu seyn, selbst müßig gehen. […] Die Concerte sind Mode geworden, also in die Luxusartikel aufgenommen. Sie zu besuchen, erfordert der Anstand, die Rücksicht auf Bildungsansprüche. […] Wer Gutes haben kann, braucht das Mittelmäßige nicht. […] Das Publikum ist gesammelter.41 In den Opern- und Konzerthäusern in Europa vollzog sich eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Musikliebhabern und verschiedenen Verhaltensnormen. Statt schlicht von einem teleologischen Prozess auszugehen, welcher zur glatten Durchsetzung eines „modernen“ – mithin eines uns heute noch bekannten – Publikumsverhaltens führte, scheint es aufschlussreicher, 38 Vgl. zur Frühphase dieser Entwicklung, Peter Schleuning, Der Bürger erhebt sich. Geschichte der deutschen Musik im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2000, bes. S. 141 – 179; James van Horn Melton, School, Stage, Salon. Musical Cultures in Haydn’s Vienna, in: Journal of Modern History 76. 2004, S. 251 – 279. 39 Directors’ Meetings 1887 – 93, Bl. 54, 7. 4. 1888, in: British Library, RPS/MS/288 (= 48.2.10). Vgl. ebd., Bl. 55, 23. 4. 1888; Phil. Society 1867 – 72. Konzertprogramme, in: ebd., RPS/MS/322 (= 48.5.2). 40 Zitiert nach Heinrich Schwab, Konzert. Öffentliche Musikdarbietungen vom 17. bis 19. Jahrhundert, Leipzig 1971, S. 68. 41 Allgemeine Wiener Musikzeitung 2. 1842, S. 241 – 243. 68 Sven Oliver Müller den wechselseitigen Verhandlungsprozess verschiedener Hörertypen zu verfolgen. Denn die wiederholten Beschwerden über unangemessenes Verhalten demonstrierten nicht nur den allmählichen Wandel kultureller Praktiken und Manieren, sondern ebenso eindringlich den Fortbestand traditioneller Geschmacksmuster. Als Ludwig Rellstab sich in Berlin im Jahre 1844 über den unkontrollierten Applaus des Publikums anlässlich einer Vorstellung der legendären Jenny Lind als „Norma“ beschwerte, blieb sein abwertendes Urteil über das Publikumsverhalten nicht unwidersprochen. Obwohl Rellstab Linds Interpretation der Arie „Casta Diva“ über die Maßen lobte, monierte er doch in der Vossischen Zeitung, dass diese Arie mitten im Akt da capo verlangt wurde. Als ein Anhänger des neuen Hörverhaltens erkannte er darin eine „Barbarei des Beifalls, der allen dramatischen Zusammenhang des Kunstwerks zerstört“.42 Doch diese Betonung disziplinierter Selbstbeschränkung stellte zu diesem Zeitpunkt noch keinesfalls einen allgemein geteilten Konsens dar. Wenige Tage später empörte sich ein verärgerter Leser des Artikels in der gleichen Zeitung und unterstrich die Bedeutung spontaner und freier Beifallsbekundungen: Der Referent dieser Blätter nennt den Hervorruf während des Aktes, Barbarei des Beifalls, anstatt ihn als den reinsten Erguß der Begeisterung und des wohlverdienten Dankes zu betrachten, zumal die Handlung der Oper dadurch gar nicht gestört ward.43 Manche Beobachter sahen genau in der Maßregelung, in den kulturellen Regieanweisungen didaktische Zwänge, welche ein freies Urteil erschwerten. Verliefen Fremd- und Selbstkontrolle so weiter wie bisher, verschwände auch der Applaus aus dem Musikleben: „Es wird aber noch so weit kommen, dass sich der noble Theil des Publikums von jeder Beifalls-bezeigung zurückzieht.“44 Damit drängt sich die Frage auf, ob der „noble Theil“ eher dem Adel oder dem Bürgertum zuzurechnen war. Ein eindeutiges Urteil ist schwer zu bestimmen, weil viele Bürger etwa zwischen 1830 und 1850 ihre musikalischen Kenntnisse und ihre Verhaltensmuster im Konzertsaal oft unzulässig über die Fähigkeiten des Adels stellten. Sicher scheint: Die soziale Anordnung folgte kulturellen Mustern. Das schweigende Zuhören wurde zu einem wichtigen kulturellen Muster des europäischen Bürgertums.45 Die musikalische Ästhetik und die 42 43 44 45 Vossische Zeitung, 17. 12. 1844. Ebd., 20. 12. 1844. Allgemeine Musikalische Zeitung 46. 1844, S. 427. Vgl. Döcker, Ordnung; Manfred Hettling u. Stefan-Ludwig Hoffmann (Hg.), Der bürgerliche Wertehimmel. Innenansichten des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2000; Gunn, Public Culture; Pamela Horn, Pleasure and Pastimes in Victorian Britain, Thrupp 1999; Eric M. Sigsworth (Hg.), In Search of Victorian Values. Aspects of Nineteenth-Century Thought and Society, Manchester 1988; Geoffrey Best, Mid-Victorian Britain 1851 – 75, London 1971; Jose Harris, Private Lives Public Spirit. Britain, 1870 – 1914, London 1993. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 69 soziale Stellung verwiesen aufeinander. Das Medium der Musik entsprach geradezu idealtypisch dem Wertehimmel des aufstrebenden Bildungsbürgertums: Die musikalische Harmonie korrespondierte mit der Utopie bildungsbürgerlichen Lernens. In der Struktur der auf gesetzmäßige Wiederholung angelegten Musik erkannte das Bildungsbürgertum seine Ordnungsprinzipien. Damit wurde das stumme Hören das Element einer Überprüfung des eigenen Verhaltens. Durch distinktive Verhaltensformen machte der eigene Geschmack gebildete Musikkenner als Wertegemeinschaft sichtbar. Gerade der Musikgeschmack hob die eigene Stellung in der Gesellschaft hervor. Und umgekehrt: Die sozialen Eliten kreierten die musikalische Kultur.46 Dennoch kann die musikalische Kultur keineswegs als eine allgemeine Verbürgerlichung verstanden werden. Entgegen dem Forschungsstand der 1980er Jahre ist dem Bürgertum nicht einmal ein konkurrenzloser kultureller Aufstieg in Europa zuzurechnen. Tatsächlich formierten sich bürgerliche und adelige Hörergruppen gleichermaßen durch ihre geschmacklichen Präferenzen. Das hat William Weber für das europäische Konzertleben gezeigt.47 Die Kommunikation über und durch die Musik war entscheidend und verfestigte allmählich neue Geselligkeitsformen. Der kulturelle Disput trennte und verband Bürgertum und Adel gleichzeitig, beide stritten und interagierten im sozialen Raum des Auditoriums und formierten aus diesem Handlungskontext heraus allmählich ein neues Publikumsverhalten. Habituelle Unterschiede waren zwischen Bürgertum und Aristokratie zwar zu erkennen – sie wurden nur immer weniger. Der Erfolg des schweigenden Hörverhaltens und dessen oft polemische Verteidigung sind nicht zuletzt durch den neuen Stellenwert des musikalischen Geschmacks zu erklären. Seit den 1820er Jahren unterstrichen Tageszeitungen und Fachzeitschriften in wohlformulierten Artikeln verstärkt die gesellschaftliche Bedeutung des Geschmacks. In praktisch endlosen Variationen nutzte das Publikum seine verfeinerten kulturellen Regeln zur öffentlichen Darstel46 Vgl. Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980, S. 39 – 42; Angelika Linke, Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1996, S. 22 – 31; Hermann Bausinger, Bürgerlichkeit und Kultur, in: Kocka, Bürger und Bürgerlichkeit, S. 121 – 142; Johnson, Listening, S. 228 – 238; Ivo Supičić, Music in Society. A Guide to the Sociology of Music, Stuyvesant 1987, S. 68 – 72; Isabel Matthes, Der Raum des Paradieses. Gesellige Erfahrung und musikalische Wahrheit im 18. und 19. Jahrhundert, in: Hans-Erich Bödeker u. a. (Hg.), Le concert et son public. Mutations de la vie musicale en Europe de 1780 1914. France, Allemagne, Angleterre, Paris 2002, S. 273 – 301. 47 Weber, Music and the Middle Class, bes. S. 11 f. Vgl. ders., The Great Transformation of Musical Taste. Concert Programming from Haydn to Brahms, Cambridge 2008, S. 88 – 92; ders., Mass Culture and the Reshaping of European Musical Taste, 1770 – 1870, in: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 8. 1977, S. 5 – 21; sowie insges. Meyer, Taste. 70 Sven Oliver Müller lung. Der jedermann gezeigte Geschmack verband die Wissenden und schloss die Unwissenden aus. Das Publikum formierte sich neu, indem es entzückt den Lärm zur Unanständigkeit und das Schweigen zur Anständigkeit erklärte. Die Kategorie des Geschmacks beschreibt nicht nur Präferenzen des Publikums, sie ist selbst eine Ressource der Deutung, ein Mittel, um gesellschaftliche Positionen zu erreichen. Der Geschmack verwandelt nach Pierre Bourdieu Beobachtungen in „distinkte und distinktive Zeichen, der kontinuierlichen Verteilung in diskontinuierliche Gegensätze“.48 Die Entstehung des Geschmacks ist dabei nicht nur durch die Institutionen und die Lernbedingungen bestimmt, sondern wenigstens anteilig auch eine persönliche Auswahl. Die Bestimmungen der vermeintlich „richtigen“ Musik und des „richtigen“ Hörverhaltens existieren dadurch, dass diese Phänomene den Menschen gefallen. Ob Beethovens oder Mendelssohn Bartholdys, ob Rossinis oder Webers Werke durch das Publikum „verstanden“ werden können, ist hier vielleicht nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist, ob Musik und deren Interpreten öffentlich gefallen können. Den Geschmack als ein Gebildeter zu praktizieren, ist ein Versuch der Kommunikation – mit all den dadurch initiierten Möglichkeiten und Zwängen. Das neue Hörverhalten verbreitete sich in den europäischen Städten mit Hilfe einer erfolgreichen Werbung für diesen Lebensstil. Kenner und Kritiker warben für relevante Kompositionen, Interpreten und Veranstalter. Diese öffentliche wie private Werbung beschleunigte den Transfer in Europa. Dass die Attraktivität kultureller Normen durch ihre erfolgreiche internationale Übertragung wuchs, mag die Auswirkung des neuen Hörverhaltens in London verdeutlichen. Zwar lässt sich, streng methodisch betrachtet, kein kausaler Nexus zwischen dem schweigenden Hörverhalten in England und der Wirkung bestimmter Musikstücke und habitueller Praktiken deutschsprachiger Provenienz ausmachen. Das ist wahrscheinlich aber gar nicht die entscheidende Frage. Vielmehr glaubten am Ende des 19. Jahrhunderts viele, die Musik liebende Briten, dass ihr verfeinertes Hörverhalten nachhaltig von deutschen Werten und deutscher Musik geprägt worden war. Und auch wenn die Musik italienischer Komponisten erklang, hatte man dieser adäquat, 48 Vgl. zur Definition des Geschmacks die Überlegungen von Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt 19979, S. 277 – 399, Zitat S. 284; Antoine Hennion, Music Lovers. Taste as Performance, in: Theory, Culture and Society 18. 2001, S. 1 – 22; Andreas Gebesmair, Grundzüge einer Soziologie des Musikgeschmacks, Wiesbaden 2001, S. 16 f. u. S. 47 – 75; Simon Dentith, Society and Cultural Forms in Nineteenth-Century England, London 1998, S. 8 – 25, und bereits Thorstein Veblen, Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen, Frankfurt 2000, bes. S. 119 – 163. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 71 mithin schweigend zu folgen und sprach von dem herrschenden „custom borrowed from Germany of observing silence until the end of the act“.49 Erklärt die Durchsetzung der musikalischen Kenner die Erfindung des Schweigens? Auf diese Frage ist eine eindeutige Antwort bislang noch nicht gefunden worden. Vieles spricht dafür, dass die Gesellschaft ein neues Publikum hervorbrachte. Ein wichtiger Erklärungsansatz zur Veränderung des Publikumsverhaltens liegt aber in den Kategorien von Norbert Elias, der einen „Prozess der Zivilisation“ beschrieb.50 Mit Blick auf die Transformation des frühneuzeitlichen Europas hat Elias den wachsenden Einfluss der eigenen Disziplin und den Rückgang spontaner Affektausbrüche in der Öffentlichkeit als eine Form von wechselseitigem Selbstzwang bezeichnet. Diese Entwicklung war keinesfalls das Verdienst einer einzelnen Klasse oder Gruppe, sondern resultierte aus der gegenseitigen Reaktion vorher vielleicht getrennter Berufe, Geschlechter und Konfessionen in öffentlichen Räumen aufeinander. Die Konzerthäuser des 19. Jahrhunderts erfüllten genau diese Funktion als Orte, in denen Musikhörer zunehmend vom Urteil der Anderen abhängig und so für das eigene Verhalten sensibilisiert wurden. Die beinahe gleichen Besucher kamen häufiger zu denselben Orten, hörten die gleichen Werke derselben Interpreten. Diese Angleichung und die engere Bindung aneinander resultierten in erster Linie aus den wechselseitigen Beobachtungen der Menschen. Die relative Autonomie einzelner Konzertbesucher sank durch die regelmäßige Ausrichtung an anderen und die gegenseitige Abhängigkeit von anderen Zuhörern. Das Publikum des 19. Jahrhunderts bildete sich in erster Linie als ein Produkt vieler voneinander abhängiger Individuen. Eben weil durch diesen sozialen Zwang der Selbstbeherrschung sich das individuelle Benehmen zunehmend anglich, wuchs die Aufmerksamkeit für eine gemein- 49 The Morning Post, 21. 5. 1913. Vgl. zur Auswirkung der Werke Richard Wagners in Paris die Beobachtungen von Hector Berlioz, Schriften. Betrachtungen eines musikalischen Enthusiasten, hg. v. Frank Heidlberger, Kassel 2002, S. 68 – 77; und zur Wagner Rezeption in Bayern Sven Oliver Müller, Richard Wagner und die Entdeckung des Schweigens in Bayern und in Europa, in: Margot Hamm u. a. (Hg.), Götterdämmerung. König Ludwig II. und seine Zeit, München 2011, S. 120 – 126. 50 Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bde., Frankfurt 19807. Vgl. Richard Sennett, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt 1986; ders., The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities, New York 1992. Zur kulturwissenschaftlichen Einordnung vgl. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt 2001, S. 254 – 269; und zur musikwissenschaftlichen Perspektive insges. Goffman, Theater, bes. S. 189 – 215; Christopher Small, Musicking. The Meanings of Performing and Listening, Middletown, CT 1998; Richard Leppert, Music and Image. Domesticity, Ideology and Socio-Cultural Formation in EighteenthCentury England, Cambridge 1988, S. 71 – 106; Wolfgang Welsch, Auf dem Weg zu einer Kultur des Hörens? in: Bernius, Aufstand, S. 29 – 47. 72 Sven Oliver Müller same Vertrautheit innerhalb der eigenen Welt – für verfeinerten Geschmack, für differenzierende Gesten und eben auch für „schweigende“ Verhaltensmuster. Die sich angleichende neue Anonymität im Publikum erschwerte selbstredend, andere Zuhörer persönlich kennen zu lernen, und damit das private Gespräch und das kommunizierende Herumlaufen während der Vorstellung.51 Die gegenseitige Wahrnehmung im Auditorium verstärkte Gefühle von Scham und beförderte ein neues diszipliniertes Hören von Musik. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte das Publikum eine solche Aversion davor, in seinen Musiktempeln in Verlegenheit zu geraten, dass es sich zunehmend von der Last möglicher negativer öffentlicher Beurteilung, vom Ausleben eigener Lust und demonstrativen Handelns, befreite – und sich in das Schweigen zurückzog. Sosehr gebildete Musikliebhaber auch von der verklärenden „Verinnerlichung“ ihrer abendlichen Teilhabe schwärmten, relevant war die Entscheidung, die eigenen Grenzen des Körpers, der Gestik und der Sprache in der Öffentlichkeit zu kontrollieren. Dieser Selbstzwang, Affekte oder Spontaneität zu disziplinieren, kann als eine Stufe des wachsenden Selbstbewusstseins verstanden werden. Die Verlaufsformen des Redens und des Schweigens zeigten schließlich, inwieweit auch Schweigen ein Gespräch darstellt. Durch bewusste Demonstration konnte auch Schweigen beredt sein. Denn die Kommunikation in den Konzert- und Opernhäusern war mit guten Gründen auch deshalb so intensiv, weil sich die einander Wahrnehmenden nicht auf hörbare Gespräche einließen. Die Funktion von Musik wandelte sich daher, und zwar nicht nur, weil die notierten Werke sich änderten, sondern – konzeptionell erklärt – weil sich das Hörverhalten in Gesellschaften veränderte.52 III. Die Politisierung des Schweigens In der Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete das Schweigen im Konzertsaal eine politische Dimension. Die Disziplinierung des musikliebenden Bürgertums, die Herausbildung einer kulturellen Gemeinschaft, erhöhte dessen Chancen, Deutungskämpfe gegen den Adel zu führen. Weil die bürgerlichen und 51 Bereits der Harmonicon 2. 1824, S. 145, wunderte sich darüber, dass günstigere Eintrittspreise für ein neues Konzert das Publikum anonymisiere, man neue Leute sehe, „whom one did not recognise“. 52 Vgl. Johnson, Listening, S. 228 – 238 u. S. 281 – 285; Gebesmair, Grundzüge, S. 15 – 18; Wolfgang Gratzer, Motive einer Geschichte des Musikhörens, in: ders. (Hg.), Perspektive einer Geschichte abendländischen Musikhörens, Laaber 1997, S. 9 – 31; Ellis, Structures, S. 343 – 370; Weber, Redefining; Balet u. Gerhard, Verbürgerlichung, S. 334 – 394 u. S. 468 – 481; Daniel, Hoftheater, S. 126 – 157; Armin Owzar, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Konfliktmanagement im Alltag des wilhelminischen Obrigkeitsstaates, Konstanz 2006, S. 20 – 32. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 73 adeligen Eliten ihren gesellschaftlichen Stellenwert durch den Besuch der Opern- und Konzerthäuser sichtbar machten, wurde diese kulturelle Praxis als politische Form immer wichtiger. Seit den 1830er und 1840er Jahren werteten wachsende Teile des Bürgertums in London, aber seltener in Berlin und in Wien, die Institution des Konzertes auf. Sie verwiesen auf den Rang des Konzerthauses und des sinfonischen Repertoires und grenzten sich vom Opernbetrieb ab. Bereits die exklusive soziale Zusammensetzung des Opernpublikums veranschaulichte hier die aristokratische Vorherrschaft. Auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts blieb die Zahl der Adeligen in den Logen und auf den teuren Plätzen hoch. Im Jahre 1847 beispielsweise besuchten 35 Prozent aller englischen Peers das Londoner Her Majesty’s Theatre und das Royal Italian Opera House Covent Garden.53 Gerade weil die Aristokratie die Opernhäuser so häufig frequentierte und sich in diesen inszenierte, förderten Bürger das Konzert als eine alternative kulturelle Praxis. Die Kanonisierung des sinfonischen Repertoires exkludierte gesellschaftlich. Der Verteilungskampf um den Rang der ausgewählten Werke im Musikleben wurde regelmäßig mit nicht-musikalischen Mitteln geführt. Kanonisch organisierte Konzertprogramme nutzten der Herrschaftsstabilisierung der Elite, welche ihren Status durch ihren Musikgeschmack festigte.54 Kanons exkludierten ästhetisch, das heißt, sie wirkten durch den Ausschluss nicht akzeptierter Stile und Werke ebenso auf das Musikleben wie durch die Inklusion der „großen“ Schöpfungen der Meister. Der Glaube an eine absolute Musik begünstigte ein neues Hörerverhalten im Konzert. Gerade die Aufwertung der Sinfonie setzte neue Standards im Musikleben und eröffnete dem Publikum andere Wege der Deutung, Aneignung und Reproduktion seiner Umwelt.55 Ein faszinierendes Problem ist zu beobachten: Die kulturelle Konkurrenz der Institutionen und der Streit um adäquaten Geschmack konstruierte die politische Konkurrenz zwischen Bürgertum und Adel. Gemeinsame kulturelle und soziale Orte verbanden das Bürgerturm – mehr noch: Sie wirkten als Integrationsfaktoren und erleichterten die Möglichkeit zum Handeln. Dieser politische Konflikt war ein wichtiger Sonderfall in den 1830er und 1840er Jahren. Die neu entstehenden sinfonischen Konzertreihen ermöglichten es Bürgern und Adeligen, sich einfacher zu begegnen, leichter über neue Themen, 53 Vgl. die Berechnungen von Jennifer L. Hall-Witt, Representing the Audience in the Age of Reform, Critics and the Elite at the Italian Opera in London, in: Christina Bashford u. Leanne Langley (Hg.), Music and British Culture, 1785 – 1914. Essays in Honour of Cyril Ehrlich, Oxford 2000, S. 121 – 144, hier S. 137, Anm. 70; dies., Reforming the Aristocracy, Opera and Elite Culture, 1780 – 1860, in: Arthur Burns u. Joanna Innes (Hg.), Rethinking the Age of Reform, Britain 1780 – 1850, Cambridge 2003, S. 225 – 232. 54 Vgl. Weber, Transformation; Ellis, Structures, S. 356 – 359. 55 DeNora, Beethoven, S. 11 – 36; sowie Schmitt, Revolution; Voss, Beethoven-Bild, S. 81 – 94. 74 Sven Oliver Müller Präferenzen und Geschmäcker zu kommunizieren. Im Unterschied zu den hierarchischen Traditionen im Opernhaus, der teuren und sozial strengen Kartenvergabe, gelang beiden Schichten der Zutritt ins Konzerthaus leichter. So frei der öffentliche Zutritt der Adeligen auch war, so schwer war nach der Meinung vieler Bürger ihr kultureller Zugang. Weder entspräche die von ihnen bevorzugten Kompositionen noch ihr ästhetischer Geschmack, geschweige denn ihr undiszipliniertes Hörverhalten dem kulturellen Standard der Zeit. Musikliebende Bürger stritten um die Beherrschung öffentlich gelebter Affekte. „Falsch“ genossene Musik im Konzertsaal im Allgemeinen und der Opernbetrieb im Besonderen verwandelten sich in Chiffren, in denen Reformer die Schwäche adeliger Lebensart erblickten. Teile des liberalen Bürgertums begründeten ihre politischen Partizipationsansprüche auch auf dem Schlachtfeld der musikalischen Kultur. Ihnen war es wichtig, sich gegenüber dem inkompetenten Adel als überlegen zu erweisen, einen ausgewählten musikalischen Kanon und ein verfeinertes Hörverhalten als Früchte eines kompetenten Bildungswissens herauszustellen.56 Deshalb eignete sich der musikalische Geschmack als politische Waffe. Die Hör- und Verhaltenskodizes im Musikleben zu verschärfen, bedeutete, politische Reformdebatten zu führen. Polemische Debatten über den richtigen und den falschen Geschmack im Konzertsaal erleichterten es, zumal in Berlin und in Wien, die Zensur zu passieren. „Das öffentliche Leben stürmte und brauste im Theater und Konzertsaal, weil es anderswo nicht stürmen und brausen durfte“, befand Wilhelm Heinrich Riehl in einer Erzählung, die im Jahre 1885 entstand und 1839 spielte.57 Die auf den ersten Blick als unpolitisch geltende öffentliche Bewertung von Musik half, politische Positionen zu markieren und zu legitimieren. Wo die institutionellen Bedingungen das politische Potenzial der Reformer beschränkten, eröffneten Konzertsäle und Feuilletonartikel alternative Handlungsmöglichkeiten. Die Akteure in diesen zunächst rein ästhetischen Auseinandersetzungen konnten aus guten Gründen erwarten, öffentlich zu reden und zu handeln, ohne sich zu eng an Debatten über Wahlrechtsreformen oder Versammlungsfreiheit zu binden – und sich damit manche unangenehmen 56 Vgl. zu diesem Spannungsverhältnis Hall-Witt, Fashionable, S. 131 – 145; Gramit, Cultivating Music, S. 128 – 160; Gunilla-Friederike Budde, Stellvertreterkriege. Politik mit Musik des deutschen und englischen Bürgertums im frühen 19. Jahrhundert, in: Journal of Modern European History 5. 2007, S. 95 – 117; den Ansatz von Norbert Elias, Mozart, Frankfurt 1993, S. 17 – 40. Vgl. zur Konstituierung des Bürgertums im europäischen Vergleich, Jürgen Kocka, Das europäische Muster und der deutsche Fall, in: ders. (Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert, Bd. 1: Einheit und Vielfalt Europas, Göttingen 1995, S. 9 – 75; ferner Bausinger, Bürgerlichkeit, S. 121 – 142; Weber, Music, S. 51 – 59. 57 Wilhelm Heinrich Riehl, Gradus ad Parnassum, in: W. H. Riehls Geschichten und Novellen, Bd. 7: Lebensrätsel. Fünf Novellen, Stuttgart 1900, S. 77 – 142, hier S. 79. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 75 Folgen ersparen. Vielleicht befreite die eigene transzendentale Verklärung der Musik viele Bürger nicht nur von den Problemen des Alltags, sondern stimulierte sie auch zu unwahrscheinlichen politischen Lösungsversuchen. Indem besonders in London der Adel die bürgerlichen Verhaltensweisen übernahm, wurde in gewisser Hinsicht ein Sieg des Bürgertums im kulturellen Bereich errungen, der auch explizit soziale Konsequenzen beinhaltete.58 Die Aufführungen von Musik und das Reden über Musik passten sich nahtlos in das Wertesystem und das Konfliktverhalten des Bildungs- und Wirtschaftsbürgertums ein. Die potenzielle musikalische Harmonie stimulierte das Ideal politischer Eintracht. Die Struktur der auf Wiederholungen angelegten musikalischen Aufführungen und die sich wiederholende Struktur musikalischer Kompositionen selbst halfen dem bürgerlichen Musikkennern die eigenen kulturellen und politischen Ordnungsideale zu erlernen. Ein „korrektes“ und sich selbst disziplinierendes Verhalten während öffentlicher musikalischer Darbietungen galt daher nicht nur als Ausdruck guten Geschmacks, sondern als kulturelle und politische Auszeichnung.59 Die Konflikte zwischen divergierenden Lebensstilen und Wertesystemen bildeten eine der zentralen politischen Bruchlinien der europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Ihre politische Brisanz erhielten die musikalischen Mittel der Adelskritik dadurch, dass sie Elemente innerhalb eines weitreichenden diskursiven Kontextes waren. So wichtig die Forderungen nach einem verfeinerten Hörverhalten in den Fachzeitschriften, Tageszeitungen und Karikaturen auch waren, von ungleich höherer Bedeutung zeigten sich zumal in den 1830er und 1840er Jahren die Reformdebatten über die Pressefreiheit, das Wahlrecht oder die Verfassung. Was aber die Musikkritik gleichwohl leistete, war beachtlich, denn erst die Bewertung einer vermeintlichen Unterhaltungsform ermöglichte es, selbst kleine habituelle Abweichungen zu beurteilen – pointiert und polemisch. Die Musikkritik reihte sich glänzend in die kritischen Vorstöße der liberalen Presse ein und war genau deshalb so erfolgreich und verbreitet, weil sie politisch harmlos schien. Seine theatralischen Bewegungen und exklusiven Verhaltensmuster machten den Adel in den Hauptstädten sichtbar. Viele liberale Bürger bestaunten oder kritisierten den aristokratischen Lebensstil, die Kleidung, die Pferde – und die 58 Vgl. Hans-Christoph Schröder, Der englische Adel, in: Armgard von Reden-Dohna u. Ralph Melville (Hg.), Der Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters, 1780 – 1860, Stuttgart 1988, S. 21 – 88, bes. S. 47 – 51; Elisabeth Fehrenbach, Adel und Bürgertum um deutschen Vormärz, in: HZ 258. 1994, S. 1 – 28. 59 Vgl. Richard Leppert, The Social Discipline of Listening, in: Bödeker, Le concert et son public, S. 459 – 485; Johnson, Listening, S. 228 – 238; Balet u. Gerhard, Verbürgerlichung, S. 334 – 394 u. S. 468 – 481; Daniel, Hoftheater, S. 126 – 157; insges. Lothar Gall, Bürgertum in Deutschland, Berlin 1989; die Beiträge in ders. (Hg.), Stadt und Bürgertum im Übergang von der traditionalen zur modernen Gesellschaft, München 1993. 76 Sven Oliver Müller musikalischen Neigungen des Adels. Denn warum ging Graf von SaynWittgenstein Hohenstein immer in die Oper, aber nie ins Konzert, und wieso liebte die Countess of Wessex gerade die Sopranistin Maria Malibran? Erstaunlich schien es für manche Gebildete, das Adelige aus Frivolität Opernszenen in Konzertprogramme aufnahmen oder durch ihre Ignoranz professionelle Musiker und deren Kunst beschädigten, weil sie diese nicht ernst nähmen. Spielerisch und eitel genossene Musik drohte wie jedes modische Accessoire ihr gesellschaftliches Prestige einzubüßen, weil ihre Konsumenten sich durch die Presse leicht beobachten und persiflieren ließen. Nur unter schweren, vielleicht sogar gefährlichen Bedingungen war diese kulturelle Adelskritik außerhalb Englands öffentlich sagbar. Über die schwerwiegenden politischen Unterschiede wird noch zu reden sein. Dennoch: Nicht in ihren politischen Möglichkeiten, aber in ihren kulturellen Wahrnehmungen ähnelten sich die bürgerlichen Eliten in den drei Städten. Eine vergleichbare kulturelle Medialisierung ist seit dem frühen 19. Jahrhundert in Berlin, in London und in Wien zu beobachten. Bürgerliche Leser nutzten Bücher, Broschüren, Gedichte und Karikaturen, um die kulturellen Gewohnheiten des Hofadels und des Landadels zu sezieren. Diese Kette bürgerlicher Stereotypen spannte einen weiten Bogen und umfasste Scherze über gestelzte Tänze, gierige Essgewohnheiten im Opernhaus oder das Interesse der Adeligen an fremden, zumal französischen und italienischen Sängern. Die kulturellen Werte des Bürgertums formierten sich auch durch die Witzeleien über den peinlichen, verweichlichten und letztlich falschen Musikkonsum der Aristokratie. Und viele Adelige unterschätzten die mediale Beschleunigung kultureller Deutungsmöglichkeiten, welche sich allenfalls auf den ersten Blick als politisch harmlose Spielereien zu erkennen gaben.60 Am intensivsten führte die middle class in London ihre musikalischen Deutungskämpfe. Erst andeutend und dann immer offener kontrastierten Londoner Tageszeitungen und Unterhaltungsblätter in den 1830er und 1840er Jahren adäquates Hörverhalten im Sinfoniekonzert (mithin das eigene bürgerlich konzentrierte und schweigende) mit dem geschwätzigen und genusssüchtigen Benehmen der Adeligen im Opernhaus. Die bürgerlichen Eliten suchten durch eine Aufwertung des musikalischen Geschmacks die von ihrem Ideal abweichenden Wertekanons gezielt in Frage zu stellen. Vorsichtiger und zaghafter äußerte sich dagegen die Presse in Berlin und in Wien. In London aber entschieden sich Fachzeitschriften und auch liberale Blätter dafür, den adeligen Ochsen bei den Hörnern zu packen. Jedermann sehe ein, dass Adelige Kunstmusik nicht wertschätzten, weil sie sich letztlich nur lautstark amüsierten. Der adäquate Umgang mit der Kunstmusik zeichnete 60 Vgl. Gramit, Cultivating, S. 129 – 151; Hall-Witt, Fashionable, S. 131 – 145; Applegate, Internationalism, S. 139 – 159. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 77 sich dabei als bürgerliche Strategie ab. Die Musical World urteilte über eine Aufführung von Vincenzo Bellinis „I Puritani“ im Her Majesty’s Theatre: A school for behaviour should be provided for some of the aristocratic tenants of the boxes at this theatre. The incessant gabbling of lordling coxcombs is doubtless interesting to themselves, but by others cannot be regarded otherwise than as an obtrusive impertinence, and, as such, should be put down without ceremony.61 Lobend bekundete die britische Presse dagegen die Erfolge eines kulturellen Erziehungsprozesses. Den Anlass bot das ungezügelte Verhalten des Herzogs von Gloucester, der mit seiner Entourage lautstark von seiner Loge herab über Carl Maria von Webers „Freischütz“ herzog. Ein aufgeklärter Musikfreund aber rief den Herzog von seinem billigen Stehplatz vom Parkett aus zur Ordnung.62 Bürgerliche musikalische Kenntnisse zeichneten den augenscheinlich räumlich und sozial unterlegenen Hörer aus. Kritische Journalisten klagten darüber, dass die Londoner Adeligen stets französische und deutsche Opern, aber keine Werke englischer Meister hörten. „Scarcely one of these noble animals is to be found offering encouragement to that which has so many claims on their patronage.“63 Diese Zeilen stammten aus einer linksliberalen Spottzeitschrift, die unter dem werbewirksamen Titel Figaro in London erschien. So schwer es auch ist, die öffentliche Anerkennung dieses Angriffes zu bewerten, so erstaunt doch bereits die Gleichsetzung von mangelndem menschlichem Benehmen mit tierischem Benehmen. Unzivilisierte adelige Musikfreunde subsumierte dieses Blatt nicht nur unter dem Schlagwort „the idiot aristocracy“, sondern auch unter der naturverbundenen Kategorie „the aristocratic animals“.64 Hier sind sprachliche Diffamierungen und aggressive Wortspiele zu entdecken, die sich wohl in keiner anderen Hauptstadt in Europa hätten veröffentlichen lassen. Gelobt wurden dagegen diejenigen Adeligen, welche sich nicht lachend und störend benähmen, sich während der schönsten Stellen der Oper nicht unterhielten. Kulturell betrachtet sei der Landadel (gentry) besser als der Hochadel (nobility), am besten aber wäre es, wenn die Aristokratie gleich daheim bliebe und den Musikbetrieb dem geschmacklich souveränen Bürgertum (middle class) überließe. Some point of peculiar harmony – all was attention. There was no vulgarity, for the aristocracy kept away. The audience consisted of gentry, which presented a strong contrast to the class facetiously called nobility. The house was full, which proves there is taste among the middle classes of the community.65 61 62 63 64 65 The Musical World, 30. 4. 1840, S. 274. Figaro in London (Figaro), 25. 5. 1833, S. 84. Ebd., 23. 6. 1832, S. 116. Ebd., 16. 6. 1832, S. 110 u. 9. 3. 1833, S. 38 – 40. Vgl. ebd., 24. 4. 1833, S. 64. Ebd., 10. 8. 1833, S. 128 (Hervorhebung im Original). Vgl. ebd., 27. 6. 1835, S. 109 f. Eine Karikatur im Punch witzelte darüber, dass der Rang eines Adeligen – auch gemessen an 78 Sven Oliver Müller Die Aneignung der Musik verband Menschen, weil musikalische Reize über einen hohen Wiedererkennungswert verfügten. Sie erlaubten die Verständigung durch sinnliche Mitteilungen, welche durch die gesprochene Sprache unter den Bedingungen der Zensur schwerer vermittelt werden konnten. Musikalische Aufführungen vermochten es, ihre Hörer politisch zu verbinden. Weil sie es verschiedenen Hörern erleichterten, über die gleichen Werke zu kommunizieren, intensivierten sie zudem Gegensätze.66 Durch das Wissen über den gewünschten musikalischen Kanon und die habituellen Regeln des Musikkonsums wählten die Gebildeten aus, wer politisch zu ihnen gehörte – und wer nicht. „Geschmacklose“ Musikkonsumenten ließen sich dadurch aus der Gemeinschaft ausschließen.67 Die Regeln der neuen disziplinierenden Musikkultur stifteten durch die Sprache und die Handlungen bildungsbürgerlicher Protestgruppen den politischen Zusammenhalt. Der musikalische Geschmack bildete gerade in einer pluralen Gesellschaft wie Großbritannien eine kulturelle Strategie der Nachahmung und der Verfeinerung, ein Merkmal der Zugehörigkeit. Durch eine distinktive Verhaltensform machte der eigene Geschmack die Musikliebhaber nicht nur als kulturelle, sondern auch als politische Wertegemeinschaft sichtbar. Die Kategorie des Geschmacks beschrieb nicht nur Präferenzen des Publikums, sie war selbst eine Ressource der Deutung, ein Mittel, um gesellschaftliche Positionen zu erreichen. Die gemeinsame Begeisterung für Musik und die gemeinsame Ablehnung derjenigen, die ihren Stellenwert missachteten, vermochten soziale, politische oder kulturelle Differenzen zu überbrücken. So ließen sich auf dem Umweg ästhetischer Stellvertreterkriege politische Ansprüche viel ungehinderter formulieren. Die musikalische Hochkultur belebte auch in Berlin und in Wien die Konkurrenz. Die gemeinsame Front gegen diejenigen, die sich als Gegner bürgerlicher Hochkultur zu erkennen gaben, stärkte den Zusammenhalt der durchaus unscharf abgegrenzten Gruppe der Bürger. Zumal die bildungsbürgerlichen Akteure suchten und fanden kulturelle Gegner in ihren Konzert- und Opernveranstaltungen. Auf die unnachsichtige Verteidigung tradierter adeliger Distinktionsprivilegien, auch auf die Verweigerung, sich musikalischen seiner Körperform – allein aus seinem Erbe, nicht aber aus seinem Erwerb stamme. „Phrenological View of Social Rank“, in: Punch 65. 1873, S. 4. 66 Vgl. Bourdieu, Unterschiede, S. 442 – 462; Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt 19897, S. 14 – 34; Ute Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen? in: GG 35. 2009, S. 183 – 208; sowie die Beiträge in Sabine A. Döring (Hg.), Philosophie der Gefühle, Frankfurt 2009. 67 Vgl. Lawrence Kramer, Music as Cultural Practice, 1800 – 1900, Berkeley 1990; Wolfgang Kaschuba, Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. Kultur als symbolische Praxis, in: Kocka, Bürgertum im 19. Jahrhundert. Bd. 1, S. 92 – 127; M. Rainer Lepsius (Hg.), Lebensführung und ständische Vergesellschaftung (= Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Teil 3), Stuttgart 1992, S. 9 – 18. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 79 Innovationen zu öffnen, reagierte das gebildete Bürgertum oft diffamierend. Denn in der Adelsdistanzierung erkannten manche auch eine gewinnbringende Chance, die bürgerliche Kulturwelt zu verfestigen.68 Eben weil gerade das Bildungsbürgertum seine neuen Konzertserien als Organisationsstruktur der Zukunft förderte, kam es ihm darauf an, sie vor den vermeintlichen Bedrohungen aus der kulturellen Vergangenheit zu schützen. Ein Bildungsbürgertum im deutschsprachigen Sinne gab es in England zwar nicht, wohl aber lassen sich massive kulturelle Interessen der middle class in der liberalen Öffentlichkeit erkennen.69 Geschickt kontrastierten die liberale Presse und die musikalischen Fachzeitschriften die eigene bürgerliche Wertschätzung der Musik mit dem adeligen Desinteresse. Musik sei für die Aristokratie kein Wert an sich, sondern nur modisches Beiwerk. Über die vom Adel organisierten und frequentierten „Ancient Concerts“ urteilte der Spectator vernichtend: The destiny of the ancient concerts is controlled by the mere caprice of fashion. […] Nevertheless, these concerts have their use; for they constitute the last link that connects any portion of the aristocracy with the music in England. Their faults are to be traced to their constitution, and their failures are the necessary consequences of their system of management.70 Mehr noch: Die Konzertprogramme der Adeligen seien ebenso reformunfähig wie diese selbst und vom fortschrittlichen Zeitgeist getrennt. Vor dem Hintergrund der Reformdebatten im Parlament konnten auch Forderungen nach musikalischen Reformen kaum in die politische Leere laufen. Selbstredend ließe sich argumentieren, dass die bürgerlich-liberale Kritik an den ausschließlich von der Aristokratie geleiteten „Ancient Concerts“ letztlich auf rein ästhetischen Kriterien beruhte, die allein von der Kunst handelten. Schließlich konservierte die adelige Musikkultur im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts zwar ein altmodisches, aber ursprünglich mehrheitsfähiges Repertoire. Doch ein solcher Befund ging ins Leere – eine kulturpolitisch neutrale Perspektive existierte in keiner europäischen Metropole. Tatsächlich gab es über dieselben Konzerte – je nach weltanschaulichem Standpunkt – vernichtende Kritiken (Spectator, Athenaeum, Harmonicon), aber auch be68 Vgl. Rudolf Braun u. David Guggerli, Macht des Tanzes, Tanz der Mächtigen. Hoffeste und Herrschaftszeremoniell, 1550 – 1914, München 1993, S. 226 – 241; Susanne Kill, Politische Konstituierungsfaktoren des Bürgertums, in: Gall, Stadt und Bürgertum, S. 183 – 202; Budde, Stellvertreterkriege, S. 103 – 105; Kocka, Muster, S. 18 f. 69 Deutlich wird das u. a. in den Ausführungen des Harmonicon, 7. 1829, S. 190 f., über den sich verbessernden Geschmack der „enlightened people“ im Musikleben. Beschworen wird ein „system of education, of religious belief, of manners, sentiments, and habits. […] It is also necessary to elaborate these in moments of calm thought, in order to give them correctness and consistency.“ 70 The Spectator, 8. 5. 1841, S. 445. 80 Sven Oliver Müller geisterte adelige Hofberichterstattung (Morning Post, Times). Die Tory-treue Morning Post führte die Verteidigungslinie aristokratischer Musikkultur in London an. Immer wieder rühmte sie die Veranstaltungen als nationale Errungenschaften und druckte spaltenweise – vom Herzog absteigend – die Liste der aristokratischen Besucher : As we have repeatedly said before these Concerts are a credit to the country, and are entitled to the support of the Nobility and Gentry ; for, had it not been for these performances, some of the finest compositions that were ever written would have been entirely lost to us.71 Durch diese konservative Bewertung des musikalischen Geschmacks wird deutlich, dass die Besprechungen nicht allein – vielleicht in diesem Kontext nicht einmal primär – ästhetischen Kriterien folgten, sondern auch politische Kritiken waren. In den musikalischen Fachzeitschriften gaben die Kritiker ihre Konzerteindrücke nicht originalgetreu wieder, sondern filterten sie aus ihrer spezifischen Perspektive heraus. Die Revolution von 1848 bot manchen bildungsbürgerlichen Musikfreunden in Wien und in Berlin eine ungekannte politische Chance. Vielleicht erreichten die demonstrierenden Musikfreunde nur in diesem Jahr auf dem Kontinent das, was die britischen und französischen Konzertbesucher seit den 1830er Jahren verwirklicht hatten. Die musikalische Hochkultur reihte sich erfolgreich in die politischen Demonstrationen ein. Denn die demokratische Gesellschaft sollte das exklusive und elitäre Musikleben der Vergangenheit öffnen. Teile des Bildungsbürgertums unternahmen einen kulturellen Angriff auf das Repertoire und das Hörverhalten des Adels. Die Rezensenten wichtiger Zeitungen und Zeitschriften ordneten das Musikleben in Zugehörige (Bürger) und Fremde (Adelige) und verknüpften damit implizit Herrschaftsansprüche. Wer sich im Konzert nicht benehmen konnte, wer seine Geschmacklosigkeit öffentlich zur Schau stelle, schien auch für die Ausübung der staatlichen Herrschaftsgewalt denkbar ungeeignet zu sein. Das unruhig gewordene liberale Bildungsbürgertum in Berlin und in Wien setzte seine anscheinend überlegene musikalische Ästhetik auch in den deutschen Staaten als politische Waffe ein. Ein diszipliniertes Hörverhalten einzufordern und neue musikalische Ideale durchzusetzen, kam einer politischen Handlung gleich.72 Durch eine Neubewertung des musikalischen 71 The Morning Post, 7. 6. 1833. Vgl. die erhaltenen Besucherlisten und Presseberichte: Alphabetic List of the Subscribers to the Antient Music for the Present Season 1810, by W. Lee, London 1810, in: British Library, 1607 – 1212 u. 11778.aa26; sowie The Performances of Antient Music, for the Season 1820, Published by Permission of the Royal and Noble Directors, are most Humbly Presented to the Subscribers by G. Wilding, London 1820; John Parry, Notices of the Concerts of Ancient Music Covering the Period 1834 – 1848, extracted from the Morning Post, 2 Bde., London 1843 u. [1848]. 72 Vgl. aus soziologischer Perspektive zu dieser Wechselwirkung Gebesmair, Grundzüge, S. 55 – 63; Klaus-Ernst Behne, Hörertypologien. Zur Psychologie des jugendlichen ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 81 Geschmacks stellten die bürgerlichen Eliten die Herrschaftsansprüche der Aristokratie gezielt in Frage. Gegen dieses instrumentalisierte Diktat des Geschmacks konnte sich die Aristokratie lange erfolgreich wehren, nur kaum in der revolutionären Öffentlichkeit des Jahres 1848. Zu diesem Zeitpunkt riskierten manche Bürger etwas im deutschsprachigen Raum so nie Dagewesenes: Sie vertrauten sich einer selbständigen musikalischen Kulturpolitik an. Einen „Zusammenhang zwischen Musik und Politik“ erkannte die Allgemeine Musikalische Zeitung darin, dass die gegenwärtigen humanistischen Ideale die vergangenen Manierismen der Aristokratie ersetzten. Die Musik werde das Volk erziehen und das Publikum bilden – in seinem Geschmack und in seiner Politik. Jetzt hofften viele in Deutschland, dass die Adelsaristokratie […] gefallen ist, […] dadurch aber auch auf das wahre Bedürfnis und die Veredelung des Volkes durch die Kunst Rücksicht genommen werden wird. […] [Es] herrscht bei Hofe ein schlechter Geschmack, sei es in der Kleidung oder anderen Dingen, namentlich in der Kunst, so muss der schlechte Geschmack um jeden Preis für nobel und nachahmungswerth gelten. Der Adel wagt nicht, einen anderen Gout zu haben, als die allerhöchsten Herrschaften, und das Publikum richtet sich nach dem Adel, hält italienische Musik für unübertrefflich, man mag dagegen predigen, man mag ihn vordemonstrieren, dass sein eigentlicher Geschmack das gar nicht sein könne, so viel man will. […] Das Publikum ist ein Kind, welches erzogen werden kann und muss. Die Kunst solle solchen Männern anvertraut werden, welche fühlen, wie das deutsche Volk seiner inneren Natur nach fühlen muss, welche wissen, was dem Volke zur Bildung und Veredelung dient. Solche Männer werden unter unseren Aristokraten aber schwer zu finden sein, denn diese sind nicht deutsch, sondern adelig, aristokratisch, sie bilden eine Kaste für sich und weiter nichts. Sie müssen und sie werden deshalb über kurz oder lang von dem Ruder entfernt werden.73 Die Befürworter gesellschaftlicher Reformen relativierten die Grenze zwischen Musik und Politik. Das hatte nicht nur ideologische, sondern auch pragmatische Ursachen, denn das Reden und Schreiben über Musik war 1848 längst zum bürgerlichen Alltag geworden. Die öffentliche Bewertung von Musik, das tatsächliche oder vermeintlich harmlose Plaudern über Mozart fiel jahrzehntelang leichter als die politische Bewertung staatlicher Ordnung. Die Neue Zeitschrift für Musik hielt fest: Die künftige Gestaltung der Kunst wird sicher einen politischen Charakter annehmen. Denn die Kunst, die das innerste Leben äußerlich darstellt, nimmt schon durch die öffentliche Musikgeschmacks, Regensburg 1986, S. 418 – 437; Hans Neuhoff, Die Konzertpublika der deutschen Gegenwartskultur. Empirische Publikumsforschung in der Musiksoziologie, in: Motte-Haber u. ders., Musiksoziologie, S. 473 – 509; und bereits Carl Dahlhaus u. Helga de la Motte-Haber (Hg.), Systematische Musikwissenschaft, Laaber 1982. 73 Allgemeine Musikalische Zeitung 50. 1848, S. 538 – 542. Geschrieben im August 1848 unter dem Titel: „Ueber den Zusammenhang zwischen Musik und Politik“. Vgl. zur Reichweite dieses Blattes Schmitt-Thomas, Entwicklung. 82 Sven Oliver Müller Darstellung der persönlichen Ideen und Gefühle die gemeinsame Sympathie in Anspruch, und wird dadurch politisch.74 Eine ähnlich pointierte Begründung stellte die Neue Berliner Musikzeitung im Dezember 1848 auf. Heutzutage sei Musik keine weltentrückte Mode mehr, sondern zur unmittelbaren politischen Angelegenheit aller Menschen geworden. „Die Musik ist sociale Kunst, sie gehört mehr denn irgend eine andere allen Ständen, dem ganzen Volke an.“75 Es gibt viele Gründe dafür, warum in London wenigstens im Musikleben diese kulturelle Utopie und die Erfolge innerhalb der Institutionen leichter gelangen als in Berlin und in Wien. In ihrer Häufigkeit, musikalische Reformen einzufordern, unterschieden sich die Journalisten und Konzertbesucher in allen drei Hauptstädten relativ wenig voneinander. Schärfer und chancenreicher aber fielen die kulturellen Vorstöße und Provokationen der middle class in Großbritannien aus. Der Befund liegt gewissermaßen auf der Hand: Wenn es eine bürgerliche Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhundert in Europa gab, dann war sie in London am stärksten. Unzensiertes Reden und Handeln in der Öffentlichkeit war weit weniger staatlich-aristokratisch geregelt, die Forderungen daher variantenreicher und schärfer. Vielleicht zeigte sich der sprachliche Stil härter und der öffentliche Konflikt im Musikleben größer, weil die politischen bereits vor den musikalischen Reformen angelaufen waren. Ein ungebrochener Siegeszug der middle class – geschweige denn des Bildungsbürgertums – über den Adel mit Hilfe der Musik ist daraus jedoch nicht abzuleiten. Die meisten Bürger in den verschiedenen europäischen Metropolen tendierten nur selten dazu, die Herrschaft des Adels politisch brechen zu wollen. Nicht nur das: Die bildungsbürgerliche Adelskritik trug zur Selbstbehauptung des Adels auch deshalb bei, weil dieser sich in seinem Geschmack und in seiner Lebensführung nicht nur in London, sondern auch in Berlin und in Wien dem Bürgertum allmählich anglich und damit willentlich seine Angriffsflächen verringerte.76 Die Musikkultur des 19. Jahrhundert sollte als ein Bestandteil der sozialen und der politischen Strategien des Bürgertums verstanden werden. Die Kriterien musikalischer Bewertung und Erziehung lassen sich in Beziehung zur Demokratisierung und Politisierung setzen. Sie sind dynamisch und ideologisierbar, weil sie über den benannten Zweck hinausweisen, weil sie kulturelle 74 Neue Zeitschrift für Musik 28. 1848, S. 45 – 47, Zitat S. 47. 75 Neue Berliner Musikzeitung 2. 1848, S. 376. 76 Vgl. Dieter Langewiesche, Bürgerliche Adelskritik zwischen Aufklärung und Reichsgründung in Enzyklopädien und Lexika, in: Fehrenbach, Adel und Bürgertum, S. 11 – 28; Schröder, Adel, bes. S. 37 – 59; insges. Braun u. Gugerli, Macht, S. 202 – 256. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 83 und politische Interessen aneinanderbinden.77 Reinhart Koselleck vermutet bei jedem öffentlichen Wortgebrauch nicht nur die abweichende Standortbezogenheit der Akteure. Noch wichtiger sei vielleicht der mögliche „Zwang zur Politisierung“, da immer mehr Personen angesprochen und mobilisiert würden.78 Für die musikalischen Deutungskämpfe zwischen Adel und Bürgertum folgt daraus, dass kulturelle und politische Praktiken ähnliche gesellschaftliche Lernprozesse, das heißt, auch Bildungsprozesse, eröffnen konnten. Die Forderungen nach demokratischem Musikkonsum und demokratischer Pressefreiheit waren sich erstaunlich ähnlich, die politischen Folgen aber unterschieden sich nachhaltig voneinander in London, Berlin und Wien. IV. Schlussbemerkungen Die Geschichtswissenschaft hat viele Möglichkeiten, die Entstehung und den Wandel kultureller Praktiken zu analysieren. Die gleichen Musikstücke konnten in unterschiedlichen Konzerten und bei verschiedenen Hörern heterogene Handlungen auslösen. Zu zeigen ist, wie menschliches Verhalten in einer Gesellschaft durch Teilnahme an musikalischen Aufführungen geprägt und verändert wurde. Die hier diskutierten Fragen verweisen auf genuin historische Probleme, die einen historischen Ansatz erfordern. Warum etwa das Publikum während der Vorstellungen im Konzerthaus in Berlin aufhören wollte zu reden, zu essen, herumzulaufen und im Auditorium lauthals zu lärmen – das sind Fragen, die Historiker anders und vielleicht präziser als Musikwissenschaftler beantworten können. Um den historischen Stellenwert der Musikkultur in der Gesellschaft zu zeigen, ist ein Perspektivwechsel hilfreich: von musikalischen Werken hin zur Wirkung von Musik, von der Partitur einer Komposition hin zur Aufführungspraxis.79 Aus historischer 77 Das ist der treffende Befund von Reinhart Kosellecks Einleitung in ders. u. a. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 2004, S. XIII – XXVII. Vgl. ders., Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt 2010. In vergleichender Perspektive zur Politisierung der Musikkultur in Europa siehe Sven Oliver Müller u. Jutta Toelle (Hg.), Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Wien 2008. 78 Koselleck, Grundbegriffe, Zitat S. XVIII. 79 Zwar wird das auch in der Musikwissenschaft regelmäßig gefordert, doch nur selten eingelöst. Vgl. Small, Musicking; Richard Taruskin, Text and Act. Essays on Music and Performance, New York 1995; Nicholas Cook, Music as Performance, in: Clayton u. a., Cultural Study, S. 204 – 214; Richard Münch, Die soziologische Perspektive. Allgemeine Soziologie, Kultursoziologie, Musiksoziologie, in: Motte-Haber u. Neuhoff, Musiksoziologie, S. 33 – 59; Johnson u. a., Opera and Society. 84 Sven Oliver Müller Sicht interessiert Musikkultur, weil für sie und durch sie eine Kommunikationsgemeinschaft konstituiert wird. Musikalische Aufführungen sind Bühnen der Gesellschaft. In einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive zählen die Komposition und die Interpretation einer Partitur weniger, als die öffentliche Rezeption ihrer Aufführung. Denn die musikalische Produktion, das Komponieren, bedarf der künstlerischen Reproduktion, der Wiedergabe und diese der gesellschaftlichen Rezeption, des Publikums. Aus der Betonung der Rezeption folgert keinesfalls, dass die Komposition selbst nicht zählt. Vielmehr besteht ein Wechselverhältnis zwischen dem Werk und dem Publikum, weil beide einander bedürfen. Erst die Rezeption der Musik erschafft auch die Musik, da Komponisten ihre Schöpfungen oft auf den Geschmack ihrer Hörer hin ausrichten und auf diese Weise eine Verbindung zwischen musikalischer Produktion und sozialer Gemeinschaft entsteht. Das ist der kreative Spielraum musikalischer Aufführungen. Das Publikum teilt die Musik, die es liebt, und dadurch vervielfacht sie diese.80 Stark vereinfacht betrachtet, erfolgte eine grundlegende ideelle, ja, ideologische Umwertung der Musik durch viele Bildungsbürger. Die Musik im Allgemeinen und die Instrumentalmusik im Besonderen wurden von einer der niederen zu einer der höchsten Kunstformen stilisiert. In Deutschland schrieben Philosophen wie Arthur Schopenhauer der Musik gar transzendentale Qualitäten zu und begriffen sie als Matrix der realen Welt, welche höhere Gegenwelten eröffne und den Zugang zum letzten Glück ermögliche.81 Musikkultur funktionierte gewissermaßen als eine Form der Kommunikation. Sie stellte mehr dar als eine Zielutopie der Lebensführung, sie warb mit bildungsbürgerlichen Normen und machte diese für neue Interessierte attraktiv. Die Kenner werteten bestimmte Kompositionen geschmacklich auf und erfanden so die Kunstmusik. Viele Bildungsbürger begriffen die Kunstmusik demnach nicht nur als besondere Sinnstiftungsinstanz, sondern integrierten musikalische Praktiken (wie den Konzert- und Opernbesuch, die Laien- und Hausmusik) auch intensiv in ihr Leben.82 Die Kontroversen zwischen unterschiedlichen Hörergruppen im Konzertsaal veranschaulichen nicht nur den kulturellen Wandel in der Mitte des 19. 80 Vgl. die methodischen und empirischen Überlegungen von Müller, Analysing Musical Culture, S. 835 – 859; Small, Musicking; S. 183 – 221; Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2004, S. 31 – 57. 81 Vgl. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, in: Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden, hg. v. Ludger Lütkehaus, Zürich 1988, Bd. 2, S. 423 – 532. 82 Vgl. Bernd Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst. Untersuchungen zur Dichotomie von „hoher“ und „niederer“ Kunst im musikästhetischen Denken zwischen Kant und Hanslick, Kassel 1987; Botstein, Listening, S. 129– 145; zur bürgerlichen Verdi-Rezeption im Deutschen Kaiserreich Kreuzer, Verdi, S. 85 – 137; und zur Funktion publizierter Werkerläuterungen in der bildungsbürgerlichen Musikrezeption Christian Thorau, Der Hörer und ihr Cicerone. Werkerläuterung in der bürgerlichen Musikrezeption, in: Andreas Jacob (Hg.), Musik, Bildung, Textualität, Erlangen 2007, S. 207– 220. ipabo_66.249.66.96 Die Politik des Schweigens 85 Jahrhunderts. Sie zeigen auch, dass sich durch den Besuch musikalischer Aufführungen politische Konflikte leichter austragen ließen. Viele Konzertbesucher betrachteten ihren Musikkonsum als eine unpolitische Bereicherung. Die Kommunikation zwischen Bildungsbürgern und Adeligen in den 1830er und 1840er Jahren macht aber deutlich, dass Politik keine fest bestimmbare Kategorie ist, sondern eine Projektionsfläche kollektiver Zuschreibungen sein kann. Durch ihre gegenseitige Verständigung entscheiden Akteure, was politisch ist und was durch sie selbst politisch wird. Abhängig von den Akteuren und ihrer Kommunikation verwandeln sich auch augenscheinlich nicht politische Aufführungen in politische Felder. Dieses Verständnis unterscheidet sich grundlegend von der Annahme einer „natürlichen“ Trennung der Sphären von Kunst und Politik. Musikalische Aufführungen im öffentlichen Raum sollten vielmehr als potentiell politische Zuschreibungen begriffen werden. Der Blick auf eine – mögliche – politische Dimension der Kunstmusik erlaubt es, Aufführungen als kollektiv gewünschte politische Tatsachen und als umstrittene Ereignisse zu deuten. Die Kunstmusik der Bildungsbürger war stärker noch als die der Adeligen eine Projektion, die manches über die Werte und Wünsche ihrer Schöpfer und oft weniges über die Strukturen der Komposition offenbarte. Mit der Zurschaustellung der Musik übertrug man die Werte bürgerlicher Bildung zugleich auf die Kunst. Genau deshalb aber faszinierte diese bildungsbürgerliche Utopie – als Kontrast zu den zahlreichen Herausforderungen der Lebenswelt des 19. Jahrhunderts und zur Orientierung an offenbar zeitlosen Maßstäben. Kunstmusik als Ideal zu leben, als Religion, Wissenschaft und Politik zu erfinden, kann als eine Kommunikationsform begriffen werden, durch die man sich über Zustand, Zuschnitt und Zukunft der bürgerlichen Gesellschaft verständigte. Die Veränderungen des Publikumsverhaltens und die ästhetische Kanonisierung der symphonischen Musik zwischen 1820 und 1860 lassen sich als eine kulturelle Zäsur begreifen. Die bürgerlichen Eliten glaubten, das Musikleben zum Nutzen der Gesellschaft in Ordnung zu bringen, es nach einem „modernen“ Modell umbauen zu können. Die Frage bleibt, ob das Konzertpublikum des 19. Jahrhunderts durch seine am Ende erfolgreiche Selbstdisziplinierung langfristig betrachtet mehr kulturelle Probleme schuf, als es löste. Der Preis, den viele Musikliebhaber für diese Umwertung ihres Objektes der Begierde bis heute im Konzert- und Opernhaus zahlen müssen, ist hoch: Durch den beschriebenen Wandel gewann das europäische Publikum vielleicht neue musikalische Einsichten, büßte dafür aber viel vom spontanen Genuss musikalischer Erlebnisse ein. Es gewann an Geschmack, was es an Unterhaltung verlor. Dr. Sven Oliver Müller, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-14195 Berlin E-Mail: [email protected] Globale Horizonte europäischer Kunstmusik, 1860 – 1930 von Jürgen Osterhammel* Abstract: The European tradition of what became known as “classical” music is unique among Western arts because it resisted influences from non-Western civilisations. In the contemporary world, both the European canon of musical masterpieces and the social setting of western musical life have been exported to many different parts of the world with few changes. This tradition of European musicmaking should not obscure the global contexts in which music evolved, in particular from the mid-nineteenth century onwards. This article outlines several of these contexts, including exoticism, colonial rule, the mobility of musicians, the impact of new reproductive technologies, and the concept of “world music”. Musik ist das globalisierte Kulturgut par excellence. Sie ist über den Tonträgerhandel,1 über Radio und Fernsehen und zunehmend über Downloads aus dem Internet weltweit verfügbar. Die Strategien der Musikindustrie übersteigen seit langem den nationalen Rahmen; sie ignorieren politische Grenzen und geographische Entfernungen. Anders als Literatur erfordert Musik keine Übersetzung. Nicht jede Musik ist jedem verständlich, doch ermöglicht die kulturneutrale Konservierung musikalischen Sinns durch Notenschrift prinzipiell eine Umsetzung des Geschriebenen in Klang durch einschlägig geschulte Musiker mit den unterschiedlichsten kulturellen Voraussetzungen.2 Auch wenn es noch Residuen „nationaler“ Schulen instrumentaler Interpretation gibt, werden selbst feinhörige Experten selten treffsicher unterscheiden können, ob eine Mozartsonate von einer asiatischen oder einer europäischen Pianistin gespielt wird. Musik ist eine besonders mobile * Für kritische Hinweise zum Manuskript danke ich Sven Oliver Müller, Martin Rempe und Steffen Rimner, für Hilfe bei Recherche und Literaturbeschaffung Christian Gütgemann und Jan-Markus Vömel. Das Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an der Universität Konstanz hat meine Arbeit durch eine Freistellung gefördert. 1 Dieser Handel erlebt allerdings seit einigen Jahren eine dramatische Umstrukturierung. Der Umsatz von CDs, einem 1983 kommerziell eingeführten Medium, und anderen mobilen Tonträgern fiel weltweit von 40,5 Milliarden US-Dollar im Jahre 1999 auf 27,8 Milliarden im Jahre 2008. So Ulrich Dolata, The Music Industry and the Internet. A Decade of Disruptive and Uncontrolled Sectoral Change (= SOI Discussion Paper 2. 2011), Stuttgart 2011, S. 8. 2 Nirgendwo wird dies deutlicher als in Kinshasa Symphony, Dokumentarfilm von Claus Wischmann u. Martin Baer, 2010. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 86 – 132 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 87 und in ungewöhnlich hohem Maße globalisierungstaugliche Form kulturellen Ausdrucks. Dies trifft nicht für alle Arten von Musik in gleichem Maße zu. So ist zum Beispiel genuine Folklore (zu unterscheiden von einem marktgängigen „Country“-Stil) stärker ortsgebunden und schwieriger über kulturelle Grenzen hinweg transportierbar als die von Massenmedien weltweit verbreitete Popmusik. Die sogenannte „ernste“ oder „klassische“ Kunstmusik der neuzeitlichen europäischen Tradition steht zwischen diesen Extremen.3 Auf der einen Seite ist sie bisher noch nicht in einer umfassenden Weltmusik aufgegangen, sondern hat sich trotz kombinatorischer und hybrider Kompositionsweisen, die in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten immer häufiger erprobt worden sind, eine randscharfe Identität gegenüber nichteuropäischer Musik bewahrt. Andererseits sprechen zahlreiche Belege für eine erdumspannende Resonanz auf dieses in Europa geschaffene ästhetische Idiom. Auf allen Kontinenten werden Opern und Symphonien europäischer Herkunft gespielt. Das Publikum in Ländern wie Japan oder Südkorea gilt im internationalen Vergleich als besonders empfänglich und sachverständig für europäische Musik.4 Etwa ein Drittel der Studierenden an deutschen Musikhochschulen stammen heute aus dem Ausland; die meisten sind Asiaten. Jährlich bewerben sich allein aus Südkorea um die siebentausend junge Instrumentalisten und Sänger.5 Einige weltweit anerkannte Interpreten europäischer Kunstmusik stammen aus Asien. Seit kurzem besuchen asiatische Orchester den Westen und führen dort Musik aus dem europäischen Kanon auf, oft in Verbindung 3 Zur Genesis der Kategorie der „Klassischen“ vgl. Tim Blanning, The Triumph of Music. The Rise of Composers, Musicians and Their Art, Cambridge, MA 2008, S. 111 – 114; tiefgründiger Carl Dahlhaus, Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Teil 1: Grundzüge einer Systematik, Darmstadt 1984, S. 47 – 51. Dahlhaus hat auch auf eine weitere Zwischenlage im 19. und 20. Jahrhundert hingewiesen: „mittlere Musik“, also solche „jenseits der Dichotomie von Trivialmusik und Musik als Kunst“. So Carl Dahlhaus, Über die „mittlere Musik“ des 19. Jahrhunderts, in: ders., Gesammelte Schriften in zehn Bänden, hg. v. Hermann Danuser, Bd. 5, Laaber 2003, S. 570 – 582, Zitat S. 578. 4 Ein Bericht des Musikredakteurs Wolfgang Schreiber in der Süddeutschen Zeitung, 2. 11. 2006, über einen Besuch des Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado in Tokyo stand unter der Überschrift: „Zu Gast beim besten Publikum der Welt“. 5 Jochen Wiesigel, Deutsche Klassik in Korea, in: http://www.spiegel.de/unispiegel/ studium/0,1518,345218,00.html. Vgl. weitere Daten in Deutscher Akademischer Austauschdienst, Wissenschaft weltoffen 2010. Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland, Bonn 2010. Bei einigen Musikhochschulen ist der Ausländeranteil (nicht nur Asiaten) extrem hoch, etwa in Trossingen mit 47 Prozent (ebd., S. 21). In umgekehrter Richtung helfen europäische Lehrer beim Aufbau des Musikunterrichts in Asien. 88 Jürgen Osterhammel mit Werken asiatischer Komponisten.6 Seit 1969 war Japan – mit der bereits 1887 gegründeten Firma Yamaha als Weltmarktführer – der wichtigste Produzent des Klaviers, dieses Universalinstruments für westliche Musik und prototypischen Möbels europäischer Bürgerlichkeit.7 Inzwischen wurde es von China überholt, das vor allem billige Klaviere sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export herstellt, sich zunehmend aber auch anspruchsvollere Marktsegmente erschließt. Der größte Klavierproduzent der Welt, die Firma Pearl River in Guangzhou (Kanton), ist mittlerweile Joint Ventures mit Yamaha und der amerikanischen Nobelmarke Steinway & Sons eingegangen.8 Umgekehrt verkaufte Steinway im Geschäftsjahr 2010 11 Prozent seiner Eigenproduktion an Flügeln und Pianos in China, 10 Prozent in Japan und 10 Prozent in anderen asiatischen Ländern.9 Die Rezeption und, wenngleich in bescheidenerem Maße, die Reproduktion europäischer Musik hat längst die Grenzen des Okzidents übersprungen. Klassische Musik ist ein wichtiges Element kultureller Globalisierung. Jene Kunst, die im Selbstverständnis des Westens lange Zeit als die europäischste überhaupt galt, ist nicht länger eine reservierte Domäne ihrer Ursprungszivilisation. Mozart, Beethoven oder Verdi sind Kulturikonen von grenzüberschreitender Erkennbarkeit und Markenzeichen auf einem globalen Markt geworden. Die Spannung zwischen europäischer Genesis und weltweiter Geltung verlangt nicht allein musikwissenschaftliche und musiksoziologische Kommentare, sondern fordert auch die Globalgeschichte heraus. Im Folgenden sollen einige Dimensionen weiträumiger und transkultureller Vernetzung, Vergesellschaftung und Normbildung durch Musik mit der Absicht umrissen werden, das Feld für künftige Forschungen zu erschließen. Populäre Musikformen, vor allem auch der wegen seiner transatlantischen Dimension besonders faszi- 6 So etwa das 1977, ein Jahr nach dem Tod Mao Zedongs und der Entmachtung der „Viererbande“, gegründete Beijing Symphony Orchestra, das seit 2001 mehrere Europatourneen unternommen hat. Vgl. http://www.bjso.cn/index.php/introduction/. 7 Diese oft, u. a. von Max Weber, zitierte Charakteristik des Klaviers stammt aus Oscar Bie, Das Klavier und seine Meister, München 19012, S. 292 f. So Christoph Braun u. Ludwig Finscher, Einleitung, in: Max Weber Gesamtausgabe. Bd. I/14: Zur Musiksoziologie. Nachlaß 1921, hg. v. Christoph Braun u. Ludwig Finscher, Tübingen 2004, S. 1 – 126, hier S. 70 f. 8 Johnny Erling, Steinway aus China, in: Welt-online, 6. 12. 2005, http://www.welt.de/ print-welt/article182458/Steinway_aus_China.html. Zur Bedeutung des Klaviers als Mittel sozialer Distinktion in China vgl. bereits Richard C. Kraus, Pianos and Politics in China. Middle-Class Ambitions and the Struggle over Western Music, New York 1989. 9 Steinway Musical Instruments, 2010 Annual Report, S. 6, http://www.steinwaymusical.com/investor relations/financial reports/. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 89 nierende Jazz, müssen unberücksichtigt bleiben.10 Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf den Jahrzehnten zwischen etwa 1860 und 1930: musikhistorisch die Zeit des Übergangs zur Moderne, musiksoziologisch eine Phase der Fixierung von Musikerrollen und der Schematisierung von Rezeptionshaltungen,11 zugleich auch eine distinkte Epoche der Globalisierungsgeschichte. Nach etwa 1860 wurde die Fernmigration von Musikern durch regelmäßigen Dampfschifffahrtsverkehr erleichtert; es entstand eine integrierte transatlantische Musikwelt.12 In den 1930er Jahren wiederum flohen zahlreiche Komponisten und Interpreten aus Europa nach Nord- und Südamerika, die meisten von ihnen – etwa Arnold Schönberg (1874 – 1951), Kurt Weill (1900 – 1950), Bruno Walter (1876 – 1962) oder Bronisław Huberman (1882 – 1947) – als Juden bedroht, aber keineswegs alle: Der ungarische Komponist Bla Bartk (1881 – 1945) oder der deutsche Geiger Adolf Busch (1891 – 1952) wollten nicht länger in einem faschistisch werdenden Europa leben, und Arturo Toscanini (1867 – 1957), der berühmteste Dirigent der Welt, kehrte Italien den Rücken, verschloss sich Angeboten aus einem nazifizierten Bayreuth und verlegte den Schwerpunkt seines Wirkens endgültig in die USA, wo er bereits seit 1908 immer wieder aufgetreten war. Mit diesem Exodus endete der europäische Monopolanspruch auf musikalische Maßstäblichkeit.13 Wenn hier auf umgreifende Horizonte der europäischen Musik hingewiesen wird, dann geschieht dies nicht in der oberflächlichen Absicht, nach einer 10 Jazzgeschichte ist ein eigenes Feld, das spezielle Fachkenntnisse verlangt. Zu den frühen amerikanisch-europäischen Verbindungen in der Jazz-Geschichte vgl. etwa William A. Shack, Harlem in Montmartre. A Paris Jazz Story between the Great Wars, Berkeley, CA 2001; zu den afrikanischen Wurzeln Maximilian Hendler, Vorgeschichte des Jazz. Vom Aufbruch der Portugiesen zu Jelly Roll Morton, Graz 2008; zur frühen Einführung von Jazz im kolonialen Indien durch afro-amerikanische Musiker vgl. Bradley Shope, The Public Consumption of Western Music in Colonial India. From Imperialist Exclusivity to Global Receptivity, in: South Asia. Journal of South Asian Studies 31. 2008, S. 271 – 289. 11 Siehe die Einleitung zu diesem Heft. 12 Zum Einfluss sinkender Transportkosten auf die Mobilität von Komponisten vgl. Frederic M. Scherer, Quarter Notes and Bank Notes. The Economics of Music Composition in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Princeton, NJ 2004, S. 142 – 154. 13 Zur Musikeremigration vgl. die biographische Literatur, außerdem als Übersicht Joseph Horowitz, Artists in Exile. How Refugees from Twentieth-century War and Revolution Transformed the American Performing Arts, New York 2008; Dorothy L. Crawford, A Windfall of Musicians. Hitler’s Emigrs and Exiles in Southern California, New Haven, CT 2009; Reinhold Brinkmann u. Christoph Wolff (Hg.), Driven Into Paradise. The Musical Migration from Nazi Germany to the United States, Berkeley, CA 1999; HannsWerner Heister u. a. (Hg.), Musik im Exil. Folgen des Nazismus für die internationale Musikkultur, Frankfurt 1993. Die erste große Emigrationswelle war bereits durch die russische Oktoberrevolution ausgelöst worden. 90 Jürgen Osterhammel nationalen nunmehr eine transnationale oder globale Betrachtungsweise als überlegen und zeitgemäßer zu empfehlen. Vielmehr stehen zwei Gesichtspunkte im Vordergrund. Erstens ist musikgeschichtlich auch innerhalb Europas eine nationale Perspektive alles andere als selbstverständlich. In der gesamten europäischen Neuzeit ist keine der Künste ähnlich transfertauglich wie die Musik gewesen, keine andere Kategorie von Künstlern mobiler als die Musiker. Schon die erste aus den Quellen markant hervortretende Komponistenpersönlichkeit, Josquin des Prez (um 1450/55 – 1521), verbrachte nach einem typischen Muster als gebürtiger Flame oder „Burgunder“ einen großen Teil seines Berufslebens an italienischen Höfen. Die Idee „nationaler“ Musik wurde selbst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man sie vielfach propagierte, niemals wirklich dominant. Schon um 1800 hatte der Göttinger Musikhistoriker Johann Nikolaus Forkel (1749 – 1818) den Plan aufgegeben, eine Geschichte allein der deutschen Musik zu schreiben. „Der Antheil,“ so Forkel, „den die Deutschen von den frühesten Jahrhunderten an, an der Entwickelung der neuen Europäischen Musik-Art überhaupt genommen haben, hat ihre Specialgeschichte so sehr mit der allgemeinen verwebt“, dass der nationale Strang kaum zu isolieren gewesen wäre.14 Allerdings ist es bis heute eine Eigenart insbesondere kleiner oder junger Nationen, Stolz auf international prominente Komponisten des eigenen Landes zu entwickeln und zu pflegen. Eine solche Rolle spielen Jean Sibelius (1865 – 1957) für Finnland, Carl Nielsen (1865 – 1931) für Dänemark, Carlos Chvez Ramrez (1899 – 1978) für Mexiko oder Arvo Pärt (geb. 1935) für Estland. Musik prägt, wie Theodor W. Adorno sagt, „die Antinomien des nationalen Prinzips in sich aus“.15 Sie ist eine universale Sprache und ebnet dennoch Unterschiede nicht ein.16 Zweitens sollen die Grenzen einer globalhistorischen Sicht ausgelotet werden. Die berechtigte Aufforderung, Europa zu „provinzialisieren“, kann nicht a priori eine genaue Einschätzung der jeweiligen empirischen Chancen für eine solche Dezentrierung Europas ersetzen. So wird man aus globalhistorischer Sicht den Anspruch der europäischen Kunstmusik, sie sei eine kulturelle Jungfrauengeburt und verdanke anderen Zivilisationen wenig, mit Misstrauen betrachten oder gar unter Ideologieverdacht stellen. Was ist europäische Musik und als wie autonom muss sie gelten? Diese Frage soll am Anfang der folgenden Kartierung des Feldes stehen. 14 Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 2 Bde., Leipzig 1788 – 1801, hier Bd. 2, S. iii. Die Geschichte der deutschen Musik hätte den 3. Band dieses Werkes bilden sollen. 15 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Reinbek 1968, S. 167. 16 Vgl. aber Reinhard Kopiez, Der Mythos von Musik als universell verständliche Sprache, in: Claudia Bullerjahn u. Wolfgang Löffler (Hg.), Musikermythen. Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen, Hildesheim 2004, S. 49 – 94. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 91 I. Weltgeschichten der Kunst und Weltgeschichten der Musik Seit dem Erscheinen des ersten Bandes von Martin Bernals dreibändigem Werk „Black Athena“ im Jahre 1987 erhitzen sich die Gemüter von Altertumswissenschaftlern über Bernals These, die Kultur des klassischen Hellas verdanke dem Orient Entscheidendes, die Wissenschaften von der Antike hätten jedoch seit der Zeit um 1800 diese nahöstlichen Ursprünge der europäischen Tradition verdrängt und unterschlagen.17 Eine ähnliche, wenngleich gemäßigter formulierte Herausforderung hat 2008 der Kunsthistoriker und Theoretiker der Bildwissenschaft Hans Belting in die Diskussion eingeführt.18 Belting schließt an jüngere Arbeiten von George Saliba und anderen über arabische Einflüsse auf Vorstellungen der Renaissance von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit an19 und entwickelt die These, dass die Perspektive, ein seit der frühen italienischen Renaissance verwendetes künstlerisches Mittel, ihre Existenz einer älteren mathematischen Theorie über Strahlen des Sehens und die Geometrie des Lichts verdanke, die in muslimischen Ländern entstanden war. Keineswegs behauptet Belting, die Araber hätten die Perspektive „erfunden“ und die Europäer hätten sie später kopiert. Er argumentiert subtiler, wenn er zeigt, wie Künstler und Denker in Italien eine an Bildern gar nicht interessierte arabische Theorie des Sehens in eine Theorie des Bildes verwandelten, die für ihre eigene künstlerische Praxis unmittelbar relevant wurde. Belting interessiert sich nicht für Fragen der Priorität oder des historischen „copyright“. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen Weisen der Uminterpretation von Wissen im Prozess des Überquerens kultureller Grenzen. Weder das europäische noch das arabische Wissen sind in Beltings Sicht dem jeweils anderen überlegen. Auch wäre es unrichtig anzunehmen, die 17 Grundthese und wissenschaftsgeschichtliche Herleitung bei: Martin Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, Bd. 1: The Fabrication of Ancient Greece, 1785 – 1985, London 1987. Die anderen Bände, die der empirischen Beweisführung dienen, erschienen 1991 und 2006. Vgl. zur Debatte um Bernal Mary R. Lefkowitz, Not Out of Africa. How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History, New York 1996; dies. (Hg.), Black Athena Revisited, Chapel Hill, NC 1996; dies., History Lesson. A Race Odyssey, New Haven, CT 2008; David Chioni Moore (Hg.), Black Athena Writes Back. Martin Bernal Responds to His Critics, Durham, NC 2001. Deutsche Autoren haben wenig Interesse an dieser Debatte gezeigt, vgl. aber Jan Assmann, Sentimental Journey zu den Wurzeln Europas. Zu Martin Bernals „Black Athena“, in: Merkur 522. 1992, S. 921 – 931; Thomas A. Schmitz, Ex Africa lux? Black Athena and the Debate About Afrocentrism in the US, in: Göttinger Forum für Altertumswissenschaften 2. 1999, S. 17 – 76. 18 Hans Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München 2008. 19 Zusammenfassend George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, Cambridge, MA 2007. 92 Jürgen Osterhammel Gelehrten der Renaissance hätten die Einsichten ihrer arabischen Vorgänger verfeinert und auf eine „höhere Entwicklungsstufe“ gehoben. Es war viel einfacher : Sie bemächtigten sich einer Idee, die zu genau jenem Zeitpunkt auf dem intellektuellen Markt bekannt wurde, als die Schwächung kirchlicher Gedankenkontrolle neue Experimentierräume öffnete. Es war nicht Hans Beltings Absicht, eine Weltgeschichte der Kunst zu schreiben. Er begnügte sich damit, einen entscheidenden Moment in der Kontaktgeschichte zwischen zwei unterschiedlichen, aber räumlich benachbarten Zivilisationen hervorzuheben. Es gibt aber mittlerweile solche Weltgeschichten der Kunst, und sie verdienen es, in der Historiographie des „Globalen“ berücksichtigt zu werden.20 Nichts Vergleichbares existiert bisher zur Musik. Im 18. Jahrhundert wurden einige Versuche unternommen, „allgemeine Geschichten“ der Musik zu schreiben. In mehreren Fällen, allen voran der dreibändigen „Storia della musica“ (1757 – 1781) des bei den Zeitgenossen berühmten Bologneser Komponisten und Theoretikers Giovanni Battista Martini (Padre Martini, 1706 – 1784), beruhten sie auf umfassender Gelehrsamkeit nach den höchsten Ansprüchen der damaligen Epoche.21 Dass sämtliche Werke des 18. Jahrhunderts sich auf den Okzident beschränkten, kann man ihren Verfassern nicht vorwerfen. Gerade auf dem Gebiet der Musik ließ das verfügbare Material die universalistisch und kosmopolitisch gesinnten Autoren der Aufklärung im Stich. Nur sehr wenige Beispiele nichteuropäischer Musik waren bis dahin in Notenschrift notiert und europäischen Kennern als Manuskripte oder im Druck zugänglich gemacht worden; kaum ein Text nichtwestlicher Musiktheorie lag in einer Übersetzung in eine der europäischen Sprachen vor. Trotz solch enormer Schwierigkeiten fehlte es nicht an dem Willen, die europäische Tradition zu „provinzialisieren“. Der große Musikologe Johann Nikolaus Forkel, dessen Position als Musikdirektor der Universität Göttingen ihn in engen Kontakt mit der Göttinger Schule von Welthistorikern wie Johann Christoph Gatterer und August Ludwig Schlözer brachte, entwickelte ein ehrgeiziges und weitsichtiges Programm von Studien, die weit über die Untersuchung schriftlich fixierter Musik hinausgehen und die Betrachtung 20 Jeweils recht unterschiedlich konzipierte Werke, aber alle über den europäischen Kanon hinausgehend: Hugh Honour u. John Fleming, A World History of Art, London 1982; David Summers, Real Spaces. World Art History and the Rise of Western Modernism, London 2003; Julian Bell, Mirror of the World. A New History of Art, London 2007; Elke Linda Buchholz, Art. A World History, New York 2007; David Carrier, A World Art History and Its Objects, University Park, PA 2008; Ben-Ami Scharfstein, Art Without Borders. A Philosophical Exploration of Art and Humanity, Chicago 2009. 21 Christof Stadelmann, Art. Martini, Giovanni Battista, in: Ludwig Finscher (Hg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 29 Bde., Kassel 1994 – 20082 (fortan: MGG), Personenteil, Bd. 11 (2004), Sp. 1197 – 1202, bes. Sp. 1200. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 93 von schriftlosen Traditionen, von Gebräuchen und Musikinstrumenten einschließen sollten.22 Forkel drang bis an die Grenzen des damals Denkbaren vor und fand zu einer weitgehenden Relativierung eines eurozentrischen Zugangs zur Geschichte der Musik: Der Neugrieche, der Türke, der Perser, der Chinese, der amerikanische Wilde, dessen Tonleitern, woraus er seine Melodien bildet, von den unsrigen so sehr abweichen, daß wir nicht im Stande sind, nur die mindeste Ordnung und Schönheit darin zu finden, hat dennoch eine schöne Musik, weil sie ihm gefällt und weil er die nämliche Unordnung, die wir der seinigen vorwerfen, auch an der unsrigen gewahr zu werden glaubt.23 Gleichzeitig äußerte sich Charles Burney, der maßgebende englische Musikhistoriker, in ganz ähnlicher Weise: „we hear of no people, however wild and savage in other particulars, who have not music of some kind or other, with which we may suppose them to be greatly delighted“.24 Toleranz in Geschmacksdingen bedeutete nicht, die Musik der „Wilden“ und diejenige Georg Friedrich Händels auf dieselbe Stufe zu stellen, doch wurde Nichteuropäisches nicht grundsätzlich aus der Sphäre legitimer Klangproduktion verbannt und dem Bereich des vorästhetischen Lärms zugeschlagen. Ähnlich wie in der allgemeinen Historiographie, traten solche universalistischen Ansätze nach dem Ende der Aufklärung auch in der Musikgeschichtsschreibung in den Hintergrund. Eine „abendländische“ Denkweise gewann die Oberhand. Zur allgemeinen Ansicht wurde es nun, allein in Europa habe die Musik den Zustand der Perfektion erreicht. Europa sei nicht nur eine künstlerisch kreative Zivilisation unter mehreren, sondern die maßstäbliche und universal gültige Musikzivilisation schlechthin. Nichts sei mit einer Kultur vergleichbar, die Bach und Händel, Mozart und Beethoven hervorgebracht habe. An die Stelle zumindest universal gemeinter Geschichten der Musik traten, wie bei dem kenntnisreichen Wiener Hofrat und Amateurmusiker Raphael Georg Kiesewetter (1773 – 1850), Geschichten der „europäischabendländischen Musik“, die oft evolutionistisch als Fortschrittsgeschichten angelegt waren, manchmal unterlegt mit der Furcht, die lang andauernde Blüte der Musik könnte in Verfall übergehen.25 So schilderte Kiesewetter in einem konzisen Band „die allmählige stufenweise Entwickelung der Tonkunst bis auf 22 Vgl. über die ästhetischen und historiographischen Anschauungen Forkels immer noch Vincent H. Duckles, Johann Nicolaus Forkel. The Beginning of Music Historiography, in: Eighteenth-Century Studies 1. 1968, S. 277 – 290; Oliver Wiener, Apolls musikalische Reisen. Zum Verhältnis von System, Text und Narration in Johann Nicolaus Forkels „Allgemeiner Geschichte der Musik“, 1788 – 1801, Mainz 2009. 23 Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 1 (1788), S. xiv. 24 Charles Burney, General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period [1789], Bd. 1, hg. v. Frank Mercer, New York 1935, S. 11. 25 Zum Beispiel Joseph Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik in übersichtlicher Darstellung, Leipzig 1863, S. 107 ff.: Epigonentum nach Beethoven und Schubert. 94 Jürgen Osterhammel unsre Zeit“.26 Von „Kunst“ konnte nur im Okzident die Rede sein, denn, wie es der in ganz Europa einflussreiche belgische Musikologe FranÅois-Joseph Ftis (1784 – 1871) ausdrückte, es sei von dem Grundsatz auszugehen „qu’en dehors des peuples de la race blanche il n’y a pas de musique leve la dignit d’art et que les chants instinctifs des autres races n’ont pas contribu sa cration“.27 Solche streng hierarchisierenden Aussagen in der Sprache einer selbstverständlich werdenden rassischen Klassifikation der Menschheit – Ftis spricht auch gern von „la race arienne“ – müssen allerdings neben Ftis’ genuinem Interesse an nichteuropäischer Musik und seiner tiefen Kenntnis davon gesehen werden; sein Werk enthält lange Kapitel über die Musik der Araber, Iraner, Türken und Inder. Damit stand Ftis nicht allein. Seit Guillaume-Andr Villoteaus (1759 – 1839) Beiträgen zu der vielbändigen „Description de l’ gypte“, in der die wissenschaftlichen Erträge von Bonapartes kurzer Besetzung Ägyptens (1798 – 1801) ausgewertet wurden, sammelten französische, englische, deutsche und österreichische Gelehrte umfassendes Material besonders zur Musik in der muslimischen Welt. Daher wäre es ungerecht, das 19. Jahrhundert im Blick auf die Musikhistoriographie pauschal als ein dunkles Zeitalter eines hochmütigen „Orientalismus“ abzutun, auch wenn nichteuropäische Musik niemals als vollkommen gleichwertig und stets nur als Randphänomen oder Vorstufe der „eigentlichen“ Musikgeschichte betrachtet wurde.28 Wenn man an die Epoche nicht die heutigen Maßstäbe einer Verpönung kultureller Hierarchien anlegt, dann kann man die Pionierarbeiten von Gelehrten wie Ftis, Kiesewetter und dessen in Prag und Wien tätigem Neffen August Wilhelm Ambros (1816 – 1876), einem Spezialisten für türkische und arabische Musik, neben die bekannteren Errungenschaften der Geisteswissenschaften in jener Zeit stellen.29 26 Raphael Georg Kiesewetter, Geschichte der europäisch-abendländischen Musik [1846], Darmstadt 2010, S. 11. Zum Autor vgl. Herfrid Kier, Raphael Georg Kiesewetter, Ahnherr der modernen Musikwissenschaft, in: ebd., S. v-xx. 27 FranÅois-Joseph Ftis, Histoire gnrale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’ nos jours, Bd. 1, Paris 1869, S. 6. Zu Ftis vgl. Robert Wangerme, Art. Ftis, FranÅois-Joseph, in: MGG, Personenteil, Bd. 6 (2001), Sp. 1087 – 1095. 28 August Wilhelm Ambros, Geschichte der Musik, 4 Bde., Breslau 1862 – 78, hier Bd. 1, S. xvii; diese eigentliche Geschichte beginnt für Ambros mit den Griechen. 29 Raphael Georg Kiesewetter, Die Musik der Araber nach Originalquellen dargestellt, Leipzig 1842. Dazu Philip V. Bohlman, R. G. Kiesewetter’s „Die Musik der Araber“. A Pioneering Ethnomusicological Study of Arabic Writings on Music, in: Asiatic Music 18. 1986, S. 164 – 196. Ambros, Geschichte der Musik, behandelt erstmals in einer allgemeinen Musikgeschichte auch China: Bd. 1, S. 20 – 41. Vgl. insgesamt Philip V. Bohlman, The European Discovery of Music in the Islamic World and the „NonWestern“ in Nineteenth-Century Music History, in: Journal of Musicology 5. 1987, S. 147 – 163. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 95 Dennoch erweisen sich Versuche, aus der Selbstbespiegelung der okzidentalen Hochkultur auszubrechen, als wenig repräsentative Außenseiterpositionen. Weit in das 20. Jahrhundert hinein wurden im Geiste des Hegelianismus nichteuropäischer Musik sowohl Geschichtlichkeit als auch ästhetischer Wert abgesprochen. Noch 1968 konzentrierte eine umfangreiche „Weltgeschichte der Musik“ sämtliche „außereuropäische Musik“ in einem kurzen Einleitungskapitel von 36 Seiten.30 1979 blieb in der keineswegs kurzgefassten „Concise Oxford History of Music“ so gut wie kein Raum für eine Behandlung außerokzidentaler Musikpraxis.31 Erst in den achtziger Jahren berücksichtigte ein deutsches Standardwerk außereuropäische Musik, allerdings vom Durchgang durch die abendländische Musikgeschichte säuberlich geschieden.32 Unter den Autoren, die sich diesem eurozentrischen Mainstream jedenfalls teilweise verweigerten, muss an erster Stelle Curt Sachs (1881 – 1959) erwähnt werden, ein deutscher Emigrant, der nach mehreren Jahren in Paris 1937 in New York Zuflucht fand und im Jahre 1943 eine allgemeine Geschichte der Musik veröffentlichte, die lange Kapitel über nichteuropäische Zivilisationen einschließt und sich von dem üblichen Glauben an die Überlegenheit und Perfektion der westlichen Musik bemerkenswert weit entfernt.33 Sachs war eine Weltautorität der Musikinstrumentenkunde, in die er nichteuropäische Objekte großzügig einbezog, und er gehört zu den Klassikern der Ethnomusikologie.34 Seine wissenschaftshistorische Bedeutung wird dadurch nicht geschmälert, dass er sich stark auf die Kulturkreislehre bezog, einen in der deutschen und österreichischen Völkerkunde des frühen 20. Jahrhunderts einflussreichen Ansatz, der auf der holistischen Annahme säuberlich abgegrenzter und klar definierbarer Zivilisationsräume beruht.35 Curt Sachs gehörte zu den ersten namhaften Musikwissenschaftlern, die die europäische Musiksprache der Polyphonie und der Dur-Moll-Tonalität nicht teleologisch als den zwangsläufigen Höhe- und Endpunkt der universalen Kulturentwicklung betrachteten, sondern als einen Sonderweg, dessen Entstehung und Entwicklung selbst ein faszinierendes historisches Problem darstellt. Sachs würdigte die beispiellose Kreativität der europäischen Tradition, ohne nicht30 Kurt Honolka u. a., Knaurs Weltgeschichte der Musik, München 1968. 31 Gerald Abraham, The Concise Oxford History of Music, London 1979. 32 Hans Oesch, Außereuropäische Musik, 2 Bde., Laaber 1984/87 (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft. hg. v. Carl Dahlhaus, fortgef. v. Hermann Danuser, Bde. 8 – 9). 33 Andreas Eichhorn, Art. Sachs, Curt, in: MGG, Personenteil, Bd. 14 (2005), Sp. 767 – 770; Curt Sachs, The Rise of Music in the Ancient World East and West, New York 1943. 34 Vgl. vor allem sein letztes Werk: Curt Sachs, The Wellspring of Music. An Introduction to Ethnomusicology, hg. v. Jaap Kunst, Den Haag 1962. 35 Vgl. Werner Petermann, Die Geschichte der Ethnologie, Wuppertal 2004, S. 583 – 593. Über Kulturkreisvorstellungen in der Musikethnologie vgl. Bruno Nettl, The Study of Ethnomusicology. Thirty-one Issues and Concepts, Urbana, IL 20052, S. 320 – 338, bes. S. 323 f. 96 Jürgen Osterhammel europäische Musiksprachen und Praktiken des Musizierens abzuwerten und zu Verlierern der Musikgeschichte zu erklären. Ein anderer Musikwissenschaftler, der über den europäischen Horizont hinausblickte, war Walter Wiora, der an den Universitäten Kiel und Saarbrücken lehrte, einer der originellsten Musikologen seiner Zeit. Sein Buch „Die vier Weltalter der Musik“ (1961) umriss eine universale Musikgeschichte als Evolution durch vier Stadien.36 Lange bevor der Terminus „global“ Verbreitung fand, nannte Wiora sein viertes Stadium das „Weltalter der Technik und globalen Industriekultur“.37 Er ging in seinem schmalen Band allerdings niemals über allgemeine Bemerkungen hinaus und beließ es bei der Vision einer künftigen Weltgeschichte der Musik, ohne sie selbst auszuarbeiten. Dennoch stand er mit seiner offenen Denkweise im Kontrast zu der abendländischen Selbstbeschränkung, die in der musikwissenschaftlichen Zunft bis in die 1960er Jahre vorherrschte, nicht selten auch noch darüber hinaus. Weltgeschichten der Musik sind bis heute nicht geschrieben worden, und Fragen der Prägung der europäischen Musikkultur durch Einflüsse von außen, wie sie in Analogie zu den Arbeiten Martin Bernals und insbesondere Hans Beltings gestellt werden könnten, fehlen weitgehend in der musikhistorischen Literatur. II. Musikkulturen und die Besonderheiten Europas Die globalgeschichtlich unabweisbare Frage, was denn jene „europäische“, „abendländische“ oder „westliche“ Musik überhaupt sei,38 deren stufenweise Entfaltung durch die Stilepochen man internalistisch beschrieb, ließ sich solange nicht klären, wie alles „Fremde“ zur Vorgeschichte der „eigentlichen“ Musik erklärt wurde. Sofern sie die vergleichende Methode in den Mittelpunkt stellte, kam erst die in den 1890er Jahren entstehende Musikethnologie einer Antwort näher, die weder ästhetisch noch geschichtsphilosophisch grundiert war. Zu ihren frühesten außerfachlichen Rezipienten zählte Max Weber (1864 – 1920). In einer kurzen Schrift, die im wesentlichen 1912 entstand, dann aber unvollendet beiseite gelegt und postum als Fragment veröffentlicht 36 Walter Wiora, Die vier Weltalter der Musik. Ein universalhistorischer Entwurf, München 1988. 37 Ebd., S. 139 - 178. 38 Während die englischsprachige Literatur in kulturvergleichenden Zusammenhängen gerne von „Western music“ spricht, soll in diesem Aufsatz der Ausdruck „europäische Musik“ bevorzugt werden. Er bezieht sich auf den gesamten musikalischen Okzident einschließlich Russlands und des Transfers europäischer Musik in die Neue Welt. Von einem eigenen nordamerikanischen Musik-„Dialekt“ in der „klassischen“ Kunstmusik kann erst im 20. Jahrhundert die Rede sein, und auch dieser blieb in den Bahnen der europäischen Tradition. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 97 wurde, entwarf er eine Theorie der musikalischen Rationalisierung.39 Weber, dessen Verständnis der technischen Seite der Musik die eines durchschnittlichen Bildungsbürgers seiner Zeit deutlich überstieg, begriff Musik als die vielleicht deutlichste Artikulation des allgemeinen Entwicklungsprozesses der modernen Welt.40 Für ihn war Musik ein kultureller Komplex, der mindestens vier verschiedene Elemente umfasste: erstens die materiale Logik der Tonproduktion und ihre Systematisierung in Form einer tonalen Musiksprache; zweitens die Anwendung dieser Sprache im kreativen Prozess des Erfindens und Komponierens individueller musikalischer Werke; drittens die diesen Objektivationen durch ein musizierendes und zuhörendes Publikum, dessen „Geschmack“ einer eigenen Geschichte unterlag, zugeschriebenen Bedeutungen; viertens die institutionelle Organisation des musikalischen Lebens innerhalb spezifischer Gesellschaften. Dem Komparatisten Max Weber ging es vor allem darum, die Singularität des modernen Westens so scharf wie möglich zu fassen. Er tat dies in einer bewusst werturteilsfreien Erkenntnishaltung, vermied also jegliche hegelianische Konstruktion der Geschichte, die in einer Apotheose der perfekten europäischen Kunstmusik gipfeln würde.41 Wertfreiheit hielt den zeittypisch unvermeidlichen Eurozentrismus nahe an seinem im Zeitalter des Hochimperialismus möglichen Minimum. Für Weber bot die Entwicklung des musikalischen Materials hin zu einem Tonsystem von Dur- und Molltonarten, technisch fundiert durch die akustischen Verhältnisse einer „temperierten“ Tonskala, wie sie im späten 17. Jahrhundert festgelegt worden war, ein ausgezeichnetes Beispiel für „Rationalisierung“ in der Neuzeit, vielleicht das beste überhaupt. Diese intrinsische Rationalisierung war begleitet von einem Wandel in der Konstruktion von Musikinstrumenten (mit dem Klavier als der mechanischen Verkörperung der temperierten Skala), in der Notation, in künstlerischen Verfahrensweisen wie dem polyphonen Tonsatz, usw. All diese Entwicklungen zusammengenommen bildeten den einzigartigen kulturellen Komplex europäischer Kunstmusik in der Neuzeit, wie sie musikgeschichtlich im 16. Jahrhundert begann. Als ein solcher charakteristisch ausgeprägter kultureller 39 Max Weber, Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, München 1921. 40 Max Weber Gesamtausgabe, Bd. I/14. Das Folgende nach Christoph Braun u. Ludwig Finscher, Einleitung, in: ebd., S. 1 – 126; Christoph Braun, Max Webers „Musiksoziologie“, Laaber 1992; vgl. auch Ronald Kurt, Indien und Europa. Ein kultur- und musiksoziologischer Verstehensversuch, Bielefeld 2009, S. 22 – 32. Wenig überzeugend ist die Denunziation von Webers Seriosität bei James Wierzbicki, Max Weber and Musicology. Dancing on Shaky Foundations, in: Musical Quarterly 93. 2010, S. 262 – 296; treffender Leon Botstein, Max Weber and Music History, in: ebd., S. 183 – 191. 41 Über Hegel und die Musik vgl. Herbert Schnädelbach, Hegel, in: Stefan Lorenz Sorgner u. Oliver Fürbeth (Hg.), Musik in der deutschen Philosophie. Eine Einführung, Stuttgart 2003, S. 55 – 76. 98 Jürgen Osterhammel Komplex unterschied sich die europäische Musik unverwechselbar von jeder anderen in der Welt. Auch Max Weber blieb so weit dem Denkhorizont seiner Zeit verhaftet, dass ihm einige Bemerkungen über den „primitiven“ Stand musikalischer Rationalisierung in nicht-literaten Zivilisationen und über die „Irrationalitäten“ in einigen Richtungen nichteuropäischer Musik unterliefen, aber er war bestens vertraut mit den Forschungen der ersten Generation im Felde tätiger Musikethnologen. Er sah japanische, indische oder indonesische Musik als respektable „Kulturmusiken“ und zeigte einen Grad an ästhetischer Offenheit für solche Musik, der unter Zeitgenossen mit einem ähnlichen sozialen und kulturellen Hintergrund ungewöhnlich und vielleicht seit Johann Nikolaus Forkel in der Musiktheorie beispiellos war. Wenn Weber die grundlegenden Merkmale „westlicher Musik“ definierte, so verfiel er nicht in einen ideologischen Idealismus. Wie Weber in Übereinstimmung mit Akustikern und Musikwissenschaftlern seiner Zeit zeigen konnte, ist „westliche Musik“ kein Phantasma eines kulturell autistischen Europa und keine kontingente Konstruktion, sondern ein mit reichem Verwendungspotenzial ausgestatteter Code kultureller Artikulation, der in den wissenschaftlich beobachtbaren Tatsachen der physikalischen Akustik eine materiale Grundlage besitzt. Dies ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Dass die sogenannte „klassische“ Musik, verstanden als ein Kanon „großer Werke“ und als eine olympische Versammlung komponierender Genies, auch ein Resultat von Zuschreibung ist und ihre eigene Geschichte von Wertung und Prestige besitzt, war bereits für Max Weber selbstverständlich. Dennoch verflüchtigt sich die Idee europäischer Musik keineswegs unter einem dekonstruktionistischen und postkolonialen Zugriff. Okzidentale Musik ist nicht bloß das Produkt semantischer Operationen, sondern eine gleichermaßen physikalische wie historische Tatsache. Die meisten Musikwissenschaftler dürften heute ihrem amerikanischen Kollegen Richard Taruskin beipflichten, wenn er feststellt „that the literate tradition of Western music is coherent at least insofar as it has a completed shape“; diese Tradition sei eine historische Tatsache, weil sie einen identifizierbaren und erklärbaren Anfang und, so Taruskins Erwartung, auch ein absehbares Ende besitze.42 Ein solcher kultureller Komplex „westliche Musik“ ist in den Augen externer Beobachter klar identifizierbar gewesen. Überall wo Europäer im Zuge ihrer siedelnden und erobernden Expansion mit Nichteuropäern in Kontakt kamen, wurde ihr Musizieren als charakteristisch, eigenartig und möglicherweise „fremd“ gesehen. Sein Klangcharakter war hörbar, die Praktiken des Musikmachens waren sichtbar für alle Ohren- und Augenzeugen. Man erkannte die Europäer an ihrer Sprache, ihrer Religion, ihren Gebräuchen und auch an ihrer Musik. 42 Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, Oxford 2005, Bd. 1, S. xv. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 99 Dieses Argument lässt sich verallgemeinern: Bis hin zum jüngst angebrochenen Zeitalter der „Weltmusik“, der cross-overs, der Hybriditäten, Mischungen, des ästhetischen Kosmopolitanismus und einer global operierenden Musikindustrie koexistierten in der Welt verschiedene Musikkulturen, die sich gegenseitig als unterschiedlich empfanden und die in eine Vielzahl von Beziehungen zueinander traten. Diese Musikkulturen, etwa die europäische und die japanische, lassen sich nicht auf ein jeweils klar benennbares „Wesen“ reduzieren. Sie variieren vielmehr entlang einer großen Anzahl unterschiedlicher Parameter : 1. Systeme der Harmonie und Tonalität, rhythmische Möglichkeiten, Existenz und Grad der Ausbildung von Polyphonie; 2. Unterscheidung unterschiedlicher Formtypen und Genres und ihrer hierarchisierten Bewertung in gesellschaftlicher wie ästhetischer Hinsicht; relative Wertschätzung von Vokal- und Instrumentalmusik, Formen des Tanzes und ihr Verhältnis zur Musik; 3. charakteristische Musikinstrumente, zugehörige Spieltechniken und Möglichkeiten des Arrangements verschiedener Instrumente zu Ensembles; Gesangsstile und Gesangstechniken; 4. Abgrenzung und Interaktion zwischen religiös-geistlichem und säkularprofanem Musizieren; 5. Existenz einer (geschriebenen) musikalischen Theorie und ihr Verhältnis zu Praktiken des Komponierens und Aufführens; 6. Ausprägungsgrad, Art und Akkuratheit von Notenschrift und, als unmittelbare Konsequenz daraus, Vorkehrungen für die Speicherung, Erhaltung und materielle Tradierung verschriftlichter Musik; Verhältnis von geschriebener Musik und textungebundener Improvisation; 7. soziale Anlässe für unterschiedliche Arten des Musikmachens; Herausbildung professioneller Musikerrollen und (evtl.) ihr Verhältnis zum „Amateur“; Status von unterschiedlichen Gruppen von musikalischen Praktikern in der Gesellschaft; Geschlechterrollen und ihre Verbindung zu spezifischen musikalischen Praktiken unter besonderer Berücksichtigung des Tanzes; 8. generationelle Weitergabe musikalischen Wissens, Arten des Lehrens und Lernens von Musik und die dazugehörigen Institutionen. Jeder einzelne dieser Parameter muss als historisch betrachtet werden. Allein schon ein kurzer Blick auf die europäische Musikgeschichte der letzten vier Jahrhunderte zeigt, dass es in jeder der genannten Hinsichten große Veränderungen gab; Ähnliches war in asiatischen oder afrikanischen Traditionen der Fall. Dennoch ist es möglich, unterschiedliche Musikkulturen nach solchen Kriterien zu vergleichen und zu Kartographierungen und Typologien zu gelangen: eine wichtige Aufgabe der Musikethnologie, also des komparativen Studiums der Musik von einer anthropologischen Warte aus. Jeder Vergleich dieser Art unterstreicht die deutliche Besonderheit des kulturellen 100 Jürgen Osterhammel Komplexes der europäischen Musik, wie er sich, auf mittelalterlichen Grundlagen aufbauend, im letzten halben Jahrtausend entwickelt hat. In welchem Ausmaß trugen nichteuropäische Traditionen zur Herausbildung europäischer Musik bei? Da nichtwestliche Einflüsse auf den Hauptstrom der europäischen Musik zwischen Monteverdi und Debussy kaum nachweisbar sind, muss ein prägender Einfluss in früheren Epochen vermutet werden, am ehesten in der formativen Phase der europäischen Musik während des Mittelalters. Weil es zu dieser Zeit allein schon physisch keine Transmissionswege musikalischen Wissens von China, Japan, Indonesien, Indien, Amerika oder dem südlichen Afrika nach Europa gab, ist die arabische Musik die einzige Kandidatin für eine tiefergehende Anregung von außen. Seit dem 10. Jahrhundert zeigten arabische Gelehrte, mit dem Erbe der Griechen eng vertraut, ein großes Interesse an musikalischer Theorie. Im Sizilien der Normannenherrschaft (seit den 1160er Jahren und während des Aufenthalts von Kaiser Friedrich II. auf der Insel, ca. 1220 – 1250) und – noch wichtiger – in Spanien, also al-Andalus, waren europäisch ausgebildete Musiker anhaltenden und intensiven Erfahrungen mit Musik aus dem muslimischen Orient ausgesetzt. Vor allem der Süden Spaniens, wo die jüdische Kultur als ein drittes wichtiges Element hinzu kam, wurde zu einem Labor von ästhetischem Synkretismus und kultureller Befruchtung, allerdings mit dem Vorrücken der christlichen Reconquista zunehmend in die Defensive gedrängt. Die Frage der Bedeutung arabischer Musiktheorie und arabischer musikalischer Praxis bildet eine enge Parallele zu der von Hans Belting studierten Rezeption optischen Wissens aus der muslimischen gelehrten Kultur. Sie lässt sich nur von Fachleuten für mittelalterliche Musikgeschichte diskutieren und vielleicht entscheiden, muss aber für den vorliegenden Zusammenhang in ihrer systematischen Bedeutung betont werden. Denn es ist von größter Signifikanz für das Selbst- wie für das Fremdverständnis Europas, ob die europäische Kunstmusik der Neuzeit das Ergebnis im Wesentlichen autonomer kultureller Produktion war oder ob ihre Entstehung aus einem multikulturellen, nach mittelalterlichen Verhältnissen geradezu „globalen“ Interaktionszusammenhang zu erklären ist. Sollte die zweite These zutreffen, dann wäre, analog zu Martin Bernals Kritik an einer unliebsame Fremdspuren verwischenden Altertumskunde, die Vorstellung einer eigenständigen europäischen Musikentwicklung das Ergebnis einer kritikwürdigen späteren Ideologisierung. Es scheint indes, als würden beim jetzigen Stand der Forschung die Belege für einen arabisch-islamischen Beitrag zur Herausbildung der europäischen Kunstmusik nicht ausreichen, um eine solche revisionistische These zu stützen. Die Frage der Bedeutung arabischer Musiktheorie und Musikpraxis für die Entstehung der europäischen Musik hat Gelehrte schon lange beschäftigt. 1925 veröffentlichte der britische Musikwissenschaftler und Arabist Henry George Farmer (1882 – 1965) seine Abhandlung „The Arabian Influence on Musical Theory“, die zur am meisten beachteten Formulierung ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 101 der Einflussthese wurde.43 Abgesehen vom Problem der Quellen und ihrer Interpretation ist die Frage des arabischen Einflusses mit allen möglichen politischen und ideologischen Tücken behaftet. Der Nachweis einer hinreichend umfangreichen Rezeption arabischer Einflüsse würde die lateinische Christenheit, ganz im Sinne gewisser Bestrebungen in der heutigen Mediävistik, tiefer in die multikulturelle Welt des Mittelmeeres einbetten und europäische Musik ihres herkömmlichen Anspruchs auf voraussetzungslose Autogenesis berauben. Sollten indes die Araber mehr als Übermittler alten griechischen Wissens denn als Schöpfer ihrer eigenen „mittelalterlichen Modernität“ erscheinen, würde das Argument in eine andere Richtung gewendet und könnte jenen Eurozentrismus eher noch stärken, den die Anhänger der These von einer arabischen Prägung eigentlich bekämpfen wollen. Die Debatte wird dadurch weiter kompliziert, dass manche Musikwissenschaftler auch heute noch die Musik des christlichen Mittelalters und nichteuropäische Musik überhaupt als „primitive in a similar sense“ betrachten.44 Eine mögliche Antwort gibt der israelische Musikhistoriker Amnon Shiloah.45 Er warnt davor, eine zu enge und zu selbstverständliche Parallele zwischen den bekannten arabischen Einflüssen auf Gebieten wie Medizin, Mathematik, Physik, Astrologie und Philosophie auf der einen Seite und musikalischer Transmission auf der anderen zu ziehen. Der musikalische Transfer beschränkte sich im Wesentlichen auf Musiktheorie und war selbst auf diesem Gebiet Shiloah zufolge von relativ geringer Bedeutung. Die generelle kulturelle Überlegenheit der Araber übersetzte sich nicht in tatsächliche Impulse auf jedem einzelnen Feld der muslimisch-christlichen Begegnung. Selbst wenn spezifische musikalische Elemente wie etwa bestimmte Instrumente oder charakteristische Formen gesungener Verskunst unter besonderen lokalen Bedingungen übernommen worden sein sollen (und selbst hier ist Shiloah skeptisch), dann ist dies nicht so zu verstehen, als hätten zentrale Komponenten eines musikalischen Codes kulturelle Grenzen überschritten und einen entscheidenden Einfluss auf Tonmaterial, Rhythmik und Kompositionsverfahren als dem Kern von Musik, verstanden als eine regelgeleitete Ausprägung von Kunst, gewonnen. Folgt man Amnon Shiloah, dann gab es keine musikalische Analogie zu dem „Beltingian moment“, den der Kunsthistoriker auf dem Gebiet der visuellen Präsentation nachzuweisen vermochte. Einflüsse 43 Henry George Farmer, The Arabian Influence on Musical Theory, in: Journal of the Royal Asiatic Society 1. 1925; ders., Historical Facts for the Arabian Musical Influence, London 1930, und zahlreiche andere Arbeiten. Ein zweiter Begründer der Einflussthese war der Spanier Julin Ribera. Vgl. mit kritischer Tendenz Eva R. Perkuhn, Die Theorien zum arabischen Einfluss auf die europäische Musik des Mittelalters, Walldorf 1976. 44 Daniel Leech-Wilkinson, The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance, Cambridge 2002, S. 66. 45 Amnon Shiloah, Art. Arabische Musik, in: MGG, Sachteil, Bd. 1 (1994), Sp. 753 f. 102 Jürgen Osterhammel wie die Verwendung arabischer Muster in der spanischen Volksmusik oder örtliche Übernahmen auf dem Balkan beschränkten sich zumeist auf die Popularkultur und berührten selten die europäische great tradition.46 Bis zum empirischen Beweis des Gegenteils wird man daher an einer „weberianischen“ Sonderwegsvermutung festhalten müssen: Die europäische Musik ist kein Derivat externer Vorbildkulturen, und sie hat sich in ihrer formativen Periode weniger für Impulse von außen empfänglich gezeigt als die bildende Kunst. Ihr „Globalisierungsgehalt“ war vergleichsweise gering. III. Exotismus Sobald der kulturelle Komplex „Europäische Musik“ in der Renaissance deutlich ausgeprägt und fest etabliert war – wie sehr öffnete sich dieser Komplex in den folgenden Jahrhunderten gegenüber Einflüssen von außen? Diese Frage wird zumeist unter dem Problemtitel des „Exotismus“ behandelt, also der Evokation kultureller Bedeutungen, die sich von lokal akzeptierten Normen grundlegend unterscheiden.47 Exotisierende Tendenzen findet man in sämtlichen Künsten, in zahlreichen Musikkulturen und keineswegs nur über große geographische Entfernungen hinweg. Im frühneuzeitlichen Europa zum Beispiel war die kulturelle Kluft zwischen der Dorfgesellschaft und der städtisch-höfischen Sphäre der Elitenkultur so tief, dass bereits ein ländliches Bühnenbild in einer Oper, die für Pariser Bühnen geschrieben wurde, als ein Fall von Exotismus angesehen werden kann.48 Eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen der Verarbeitung exotischer Stoffe auf der Theaterbühne und der Inkorporation fremden musikalischen Materials in Partituren und Aufführungspraktiken. Nur der zweite Falltypus ist für die Geschichte der Musik von erstrangiger Bedeutung.49 Beide Aspekte 46 David Wulstan, Boys, Women and Drunkards. Hispano-Mauresque Influences on European Song? in: Dionisius A. Agius u. Richard Hitchcock (Hg.), The Arab Influence in Medieval Europe, Reading 1994, S. 136 – 167; Donna A. Buchanan (Hg.), Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene. Music, Image and Regional Political Discours, Lanham, MD 2007, zumeist über zeitgenössische Entwicklungen. 47 Vgl. als Überblick Klaus von Beyme, Die Faszination des Exotischen. Exotismus, Rassismus und Sexismus in der Kunst, Paderborn 2008. Grundlegend zur Musik ist Ralph P. Locke, Musical Exoticism. Images and Reflections, Cambridge 2009, der einen sehr weit gefassten Begriff von „Exotismus“, einschließlich „exoticism without exotic style“, bevorzugt. 48 Ralph P. Locke, Art. Exoticism, in: Stanley Sadie (Hg.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 29 Bde., London 20012, Bd. 8, S. 459 – 462, hier S. 459. 49 Peter Gradenwitz, Musik zwischen Orient und Okzident. Eine Kulturgeschichte der Wechselbeziehungen, Wilhelmshaven 1977; Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, in: ders., Gesammelte Schriften in zehn Bänden, hg. v. Hermann Danuser, Bd. 5, ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 103 des Exotismus sind oft eng miteinander verwandt, doch müssen sie keineswegs zusammenfallen. Georg Friedrich Händels Oper „Tamerlano“ (1724) zum Beispiel ist wie zahlreiche Stücke im barocken Sprechtheater auf einem orientalischen Schauplatz angesiedelt, enthält aber keine Musik, die orientalisch klingt oder vom Komponisten als exotisches Ornament gemeint ist, anders als später etwa Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ (1782) mit seinen Zitaten türkischer Janitscharenmusik.50 Wie die meisten seiner Zeitgenossen dürfte Händel wenig von Musik außerhalb Europas gewusst haben. Nichtwestliche Melodien, Harmonien, Rhythmen und Instrumente gelangten nicht über eine allgemeine kulturelle Annäherung nach Europa, sondern auf ganz spezifischen und in der frühen Neuzeit verhältnismäßig engen Übermittlungswegen. Vor der Erfindung von Apparaten zur technischen Schallaufzeichnung war es für die Bewohner Europas extrem schwierig, die Musik der Anderen aus erster Hand kennenzulernen. Für lange Zeit beschränkten sich direkte akustische Eindrücke auf türkische Janitscharenkapellen, die entweder von Kriegsgefangenen in osmanischen Militärlagern gehört oder als Teil der „Türkenmode“ an deutschen oder auch polnischen Fürstenhöfen engagiert wurden; manchmal bestanden sie auch aus Kriegsgefangenen.51 Die früheste nachgewiesene Darbietung chinesischer Musik in Europa fand 1756 in London statt, blieb aber vereinzelt und folgenlos.52 Vor 1838 scheinen keine indischen Musiker in Europa aufgetreten zu sein.53 Authentische Darbietungen japanischer, vietnamesischer oder siamesischer Musik waren erst wesentlich später im Westen zu vernehmen. Ein zweiter Transmissionskanal, anfänglich der wichtigste, war das Studium von Manuskripten. Hier stellte sich von Anfang an das Problem der Notation.54 Vor der Entschlüsselung nichteuropäischer Notationssysteme war Musik, die nicht in europäischen Manieren notiert war, für europäische Musiker und Musikgelehrte unverständlich; sie ließ sich nicht oder nur sehr schwer in europäische Notationssysteme übersetzen. Wenn Missionare oder musikalische Amateure, die in Übersee lebten oder ferne Gegenden durchreisten, ihre Höreindrücke in europäischer Notenschrift festhielten, beschränkte sich dies 50 51 52 53 54 Laaber 2003, S. 11 – 390, hier S. 294 – 302; Thomas Betzwieser u. Michael Stegemann, Art. Exotismus, in: MGG, Sachteil, Bd. 3 (1995), Sp. 226 – 243. Über Händel und den Orient vgl. Locke, Musical Exoticism, S. 89 – 97. Edmund A. Bowles, The Impact of Turkish Military Bands on European Court Festivals in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in: Early Music 34. 2006, S. 533 – 559; Ralf Martin Jäger, Art. Janitscharenmusik, in: MGG, Sachteil, Bd. 4 (1996), Sp. 1316 – 1329. David Clarke, An Encounter with Chinese Music in Mid-18th-Century London, in: Early Music 38. 2010, S. 543 – 558, bes. S. 547 – 549. Locke, Exoticism, S. 459. Vgl. umfassend über die technischen Aspekte der Verschriftlichung von Musik: Elaine Gould, Behind Bars. The Definitive Guide to Music Notation, London 2011. 104 Jürgen Osterhammel lange auf einzelne und simple Melodien, während komplexere musikalische Formen und vor allem kunstvolle Improvisationen überhaupt nicht erfasst werden konnten. Viel nichteuropäisches Tonmaterial sperrte sich grundsätzlich gegen die Fixierung durch europäische Aufschreibetechniken. Sofern man sie überhaupt anwenden konnte, führte dies zwangsläufig dazu, dass beim Versuch, chinesische oder javanische Klänge zu notieren, das Original europäisiert wurde.55 Die Disposition des europäischen Ohrs und die Formatierung der Niederschritt durch die „Software“ des europäischen Notationssystems bewirkten notwendig eine Harmonisierung und damit ästhetische Glättung nichtwestlicher Musik.56 Selbst große Bewunderer asiatischer Musik mussten bei dem Versuch versagen, dem heimischen Publikum einen getreuen Eindruck von jener Musik zu vermitteln, die sie in den Kolonien oder auf Reisen gehört hatten. Dennoch blieben schriftliche Quellen ohne Alternative. Deshalb ließ sich zum Beispiel viel von dem, was europäische Komponisten über chinesische Musik wussten, bis weit in das 19. Jahrhundert hinein auf zwei Quellen zurückführen: ein paar Melodien in der weit verbreiteten China-Enzyklopädie des Paters Jean-Baptiste Du Halde von 1735 sowie das dünne Büchlein „Mmoire de la musique des Chinois tant ancient que moderne“ (Beijing 1779, Paris 1780) des gelehrten Jesuitenpaters Jean-Joseph Marie Amiot (1718 – 1793), außerdem die Sammlung „Divertissements chinois“ (1779) desselben Autors, in der er mit einer west-östlichen Mischform experimentierte, die darin bestand, chinesische Schriftzeichen in europäische Notenlinien einzufügen.57 Ein großer Aufschwung des Interesses an fremden Klängen lässt sich ab 1670 in Frankreich beobachten, zunächst allerdings nur dort. Allein in Frankreich setzten sich Musiktheoretiker mit fremder, zumeist nahöstlicher, Musik 55 Über musikalische Sinnbrechung durch Notation vgl. Gerry Farrell, Indian Music and the West, Oxford 1997, S. 45 f. Zum Wechsel von Notationsweisen als Teil einer staatlichen Verwestlichungsstrategie im Osmanischen Reich ab 1827 vgl. Ruhi Ayangil, Western Notation in Turkish Music, in: Journal of the Royal Asiatic Society 18. 2008, S. 401 – 447. 56 Eine gute Diskussion findet sich in Peter Revers, Das Fremde und das Vertraute. Studien zur musiktheoretischen und musikdramatischen Ostasienrezeption, Stuttgart 1997, S. 62 – 71. 57 Jean-Baptiste Du Halde, Description gographique, historique, chronologique, politique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, 4 Bde., Paris 1735; Peter Revers, Jean-Joseph Marie Amiot in Beijing. Entdeckung und Erforschung chinesischer Musik im 18. Jahrhundert, in: Christian Utz (Hg.), Musik und Globalisierung. Zwischen kultureller Homogenisierung und kultureller Differenz, Saarbrücken 2007, S. 50 – 58. Zum umgekehrten Vorgang, der frühen Rezeption europäischer Musik in China, vgl. Wai Yee Lulu Chiu, The Function of Western Music in the Eighteenth-Century Chinese Court, Diss. Chinese University of Hong Kong 2007, dort S. 154 ff. über Amiot und andere westliche Musikexperten in Beijing. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 105 auseinander, und nur dort integrierten führende Komponisten exotisches Material in einige ihrer Werke. Ein Höhepunkt dieser Tendenz wurde im Jahr 1735 mit Jean-Philippe Rameaus (1683 – 1764) opra-ballet „Les Indes galantes“ erreicht, das Türken, Perser, „les Incas du Prou“ und „les sauvages“ auf die Bühne brachte und sie mit musikalischen Charakterisierungen versah, die zu einem großen Teil auch dem heutigen Hörer noch einleuchten.58 Andere französische Komponisten bedienten denselben Geschmack. Seine Verbreitung im frühen 18. Jahrhundert ist nicht leicht zu erklären, denn das musikalische Exotikinteresse korrespondierte keineswegs exakt mit der Geschichte des französischen Kolonialismus. Das französische Publikum begeisterte sich eher für authentische oder erfundene Melodien aus dem nichtkolonialen Persien oder aus Spanisch-Amerika als für Sklavengesänge aus Frankreichs eigenen westindischen Zuckerkolonien. In unterschiedlichen Formen setzte sich dieser französische musikalische Exotismus während der nächsten beiden Jahrhunderte fort. Dabei durchlief er, mit dem orienterfahrenen und -begeisterten Saint-Simonisten Flicien David (1810 – 1876) in den vierziger Jahren neu ansetzend,59 eine Reihe von Stadien und Metamorphosen, die ihn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Höhepunkt führten: bei Claude Debussy (1862 – 1918) 1903 in „Pagodes“, im gleichen Jahr bei Maurice Ravel (1875 – 1937) in „Shhrazade“ und – die finale Kulmination – bei Olivier Messiaen (1908 – 1992) in seiner „Turangalla“-Symphonie (1946 – 1948) und „Sept Ha Ka“ (1963). Die eigenen Kolonien waren für die französischen Komponisten dabei von geringerer Bedeutung als etwa Ägypten oder Ostasien. Der aufgeschlossenste und musikalisch geschickteste koloniale Exotisierer war Camille Saint-Sans (1835 – 1921), der bei mehreren Reisen und Aufenthalten in Nordafrika lokale Melodien und Harmonien gesammelt hatte und sie in einigen seiner Werke zitierte und variierte („Suite algrienne“ op. 60, Klavierkonzert Nr. 5 F-dur op. 103).60 Nirgendwo sonst gab es eine ähnliche musikalische Obsession mit dem Orient, allenfalls noch in Russland zwischen etwa 1870 und 1910, wo Komponisten wie Milij Balakirev, Alexandr Borodin und Nikolaj Rimskij-Korsakov vor allem Material aus den zentralasiatischen inneren Kolonien des Zarenreiches aufgriffen.61 Die italienische Oper ließ zahlreiche Türken und andere Exoten auftreten, doch nur wenige Komponisten gingen so weit wie Giuseppe Verdi, der in „Aida“ (1871) in einigen Szenen orientalische Stimmungen schuf. 58 Siehe Thomas Betzwieser, Exotismus und „Türkenoper“ in der französischen Musik des Ancien Rgimes. Studien zu einem ästhetischen Phänomen, Laaber 1993, S. 151 – 180. 59 Ralph P. Locke, Music, Musicians and the Saint-Simonians, Chicago 1986, S. 171 – 219. 60 Franzpeter Messmer, Musiker reisen. Vierzehn Kapitel aus der europäischen Kulturgeschichte, München 1992, S. 208 – 217. 61 Richard Taruskin, „Entoiling the Falconet“. Russian Musical Orientalism in Context, in: Cambridge Opera Journal 4. 1992, S. 253 – 280; ders., Oxford History of Western Music, Bd. 3, S. 392 – 405. 106 Jürgen Osterhammel „Aida“ war für die Öffnung des Suez-Kanals im Jahre 1869 in Auftrag gegeben worden, wurde aber erst zwei Jahre später in Kairo mit ägyptologischer Beratung uraufgeführt. Bei der ersten Inszenierung der Oper an der Opra de Paris sorgte der Komponist, abermals von Ägyptenkennern unterstützt, persönlich dafür, dass das Bühnenbild eine „authentische“ Atmosphäre vermittelte.62 In Ägypten selbst war eine Oberschicht, die sich kulturell viel stärker nach Frankreich als nach Italien oder Großbritannien orientierte, keineswegs nur an ägyptischen Sujets und Stimmungen interessiert. Das musikdramatische Lieblingswerk des Khediven (Vizekönigs) Isma‘il (reg. 1863 – 1879) war Jacques Offenbachs (1819 – 1880) vollkommen unorientalische Operette „La Belle Hlne“ (1864), von Franzosen auf Französisch auf den Bühnen Ägyptens dargeboten.63 Verdi machte den Exotismus indes nicht zu seinem Markenzeichen: In seinen anderen Werken findet man allenfalls die „Zigeuner“-Exotik von „Il Trovatore“ (1853).64 Giacomo Puccini (1858 – 1924) unterschied sich von anderen führenden italienischen Opernkomponisten darin, dass er tatsächlich orientalisches Material studierte und es für mehr als nur eine oberflächliche couleur locale verwendete, insbesondere in seinem letzten Meisterwerk „Turandot“ (postum 1925). Turandot, die „chinesische“ Prinzessin, die der italienische Dramatiker Graf Carlo Gozzi (1720 – 1806) in Europa populär gemacht hatte, war einer der beliebtesten orientalischen Stoffe, seit Carl Maria von Weber (1786 - 1826) ihn 1809 in der Bühnenmusik „Turandot“, op. 37, für sich entdeckt hatte. Außer Puccinis und Ferruccio Busonis Gestaltung des Gegenstandes 1917 gab es im langen 19. Jahrhundert mindestens sechs andere Turandot-Opern.65 62 Karen Henson, Exotisme et nationalit. Aida l’Opra de Paris, in: Herv Lacombe (Hg.), L’opra en France et en Italie, 1791 – 1925. Une scne privilgie d’changes littraires et musicaux, Paris 2000, S. 263 – 297, bes. S. 274 – 288; Ralph P. Locke, Aida and Nine Readings of Empire, in: Roberta Montemorra Marvin (Hg.), Fashion and Legacies of Nineteenth-Century Opera, Cambridge 2010, S. 152 – 175. Berühmt ist die Kritik von Aida bei Edward W. Said, Culture and Imperialism, London 1993, S. 134 – 157; dagegen argumentiert Paul Frandsen, Aida and Edward Said. Attitudes and Images of Ancient Egypt and Egyptology (2000), http://web.archive.org/web/20010210224405/ www.ucl.ac.uk/archaeology/events/conferences/enco/Visual/Fransden.htm. Als Verteidigung Saids gegen seine radikalen Anhänger vgl. Jonathan D. Bellman, Musical Voyages and Their Baggage. Orientalism in Music and Critical Musicology, in: Musical Quarterly 94. 2011, S. 417 – 438. 63 Alexander Flores, Offenbach in Arabien, in: Die Welt des Islams 48. 2008, S. 131 – 169, hier S. 135. 64 Locke, Musical Exoticism, S. 154 – 160. 65 Kii-Ming Lo, „Turandot“ auf der Opernbühne, Frankfurt 1996; vgl. auch Peter W. Schatt, Exotik in der Musik des 20. Jahrhunderts. Historisch-systematische Untersuchungen ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 107 Sehr wenig Exotisches lässt sich in der deutschen protestantischen Barockmusik finden; bei Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), dem nahezu exakten Zeitgenossen des französischen Orientalisierers Jean-Philippe Rameau, sucht man es vergeblich. Allerdings: der bei Bach und vielen anderen Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts beliebte Tanzrhythmus der Sarabande ist zuerst in Mexiko belegt und mag auf indianische Vorbilder zurückgehen.66 Ebenso marginal ist die Rolle des Exotischen in jener Tradition, welche die europäische Musik seit dem späten 18. Jahrhundert dominierte und die in der ganzen Welt als ihre charakteristischste Verkörperung angesehen wurde: dem österreichisch-deutschen „klassischen Stil“ mitsamt seinen Konsequenzen bis hin zu Arnold Schönberg. Spuren finden sich bei Joseph Haydn (1732 – 1809), dessen eigener Exotismus freilich eher eine „zigeunerische“ und später eine „schottische“ Einfärbung aufwies als eine orientalische,67 und bei Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) im Finale der Symphonie Nr. 9 („türkische“ Musik, T. 343 ff.).68 Franz Schubert (1797 – 1828) und Anton Bruckner (1824 – 1896) sind exotikfrei; der „Orient“ des Wahlwieners Johannes Brahms (1833 – 1897) lag innerhabsburgisch in Ungarn. Die österreichisch-deutsche Tradition öffnete sich dem Osten viel zaghafter als die französische. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bilden wenige, aber beim Publikum bis heute beliebte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart: das Rondo alla turca aus der Klaviersonate A-Dur KV 331, das Violinkonzert in ADur KV 219 sowie einige Nummern aus dem Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ (1782). Dasjenige unter den Großwerken der österreichischdeutschen Tradition, das den höchsten Exotikgehalt aufweist, ist chronologisch eines ihrer letzten: Gustav Mahlers (1860 – 1911) symphonischer Liederzyklus „Das Lied von der Erde“ (postum 1911), eine ausladende Gestaltung chinesischer Gedichte, bei der der Komponist, ohne dass eine bewusste Übernahme bewiesen werden kann, einen allgemeinen, vielleicht zur Metamorphose einer ästhetischen Fiktion, München 1986, mit einem guten Kapitel über Busoni, S. 53 – 60. 66 Timothy D. Taylor, Beyond Exoticism. Western Music and the World, Durham, NC 2007, S. 23. Vgl. auch Rainer Gstrein, Art. Sarabande, in: MGG, Sachteil, Bd. 8 (1998), Sp. 991 – 1002, hier Sp. 992. 67 Vgl. aber Nicholas Cook, Encountering the Other, Redefining the Self. Hindostannie Airs, Haydn’s Folksong Setting and the „Common Practice“ Style, in: Martin Clayton u. Bennett Zon (Hg.), Music and Orientalism in the British Empire, 1780s – 1940s. Portrayal of the East, Aldershot 2007, S. 13 – 37. 68 Lawrence Kramer deutet dieses türkische Element als eine philhellenische, also antitürkische Aussage: The Harem Threshhold. Turkish Music and Greek Love in Beethoven’s „Ode to Joy“, in: ders., Critical Musicology and the Responsibility of Response. Selected Essays, Aldershot 2006, S. 95 – 107, bes. S. 101 – 105. 108 Jürgen Osterhammel durch musikethnologische Phonogramme gewonnenen Klangeindruck ostasiatischer Musik verarbeitete.69 Das wichtigste Jahr in der Geschichte des musikalischen Exotismus war 1889, als in Paris die Exposition Universelle europäischen Hörern und Zuschauern die erste Gelegenheit bot, an authentischen Aufführungen asiatischer Musik teilzunehmen. Ein Publikum, das an die eleganten, aber doch oberflächlichen Schilderungen orientalischer Menschen, Orte und Stimmungen durch Komponisten wie Camille Saint-Sans (auch in seiner Oper „Samson und Dalilah“), Georges Bizet (1838 – 1875, insbesondere die Oper „Les pÞcheurs des perles“) oder den dominierenden Opernschöpfer der Zeit, Jules Massenet (1842 – 1912, insbesondere „Le roi de Lahore“), gewöhnt war, wurde nun plötzlich mit einem Gamelan-Ensemble aus Java oder einer Operntruppe aus Vietnam konfrontiert. Diese Art von Realitätsschock sabotierte in der Wahrnehmung mancher Hörer den offiziellen Zweck der Weltausstellung. Während sie als Bühne für die Demonstration europäischer Überlegenheit auf allen erdenklichen Gebieten, auch der Musik, gedacht war, führte die überraschende und verstörende Erfahrung „roher“ Musik aus dem Osten zur Destabilisierung von Normen und Erwartungen und öffnete neue ästhetische Horizonte, von denen aus Zweifel am Solipsismus sogar der französischen Musikkultur möglich wurden.70 Vor allem indonesische Musik weckte überraschend positive, nicht selten enthusiastische Reaktionen bei praktizierenden Musikern ebenso wie professionellen Musikkritikern.71 Der bekannteste Fall ist der von Claude Debussy, der später drei Klavierstücke schrieb, in denen erstmalig in der europäischen Musikliteratur die technische wie ästhetische Amalgamation unterschiedlicher musikalischer Codes gelang. Das Ergebnis waren nicht bloß – wie so oft in der Vergangenheit – europäisierende Angleichungen des importierten Materials, sondern neue Klänge. Debussys Periode der Absorption fremder Einflüsse dauerte allerdings nur wenige Jahre, von etwa 1903 bis 1910, eine Zeit, in der sich der Komponist auch für spanischen Flamenco und amerikanischen Ragtime interessierte.72 Während seiner letzten Lebensjahre wandte 69 Peter Revers, Das Lied von der Erde, in: Bernd Sponheuer u. Wolfram Steinbeck (Hg.), Mahler-Handbuch, Stuttgart 2010, S. 343 – 361, hier S. 346 f. 70 Annegret Fauser, Musical Encounters at the 1889 Paris World’s Fair, Rochester, NY 2005, S. 145 u. S. 162 – 165. 71 Jürgen Arndt, Der Einfluß der javanischen Gamelan-Musik auf Kompositionen von Claude Debussy, Frankfurt 1993, S. 49 – 69. 72 Ebd., S. 145 – 147. Antonn Dvořks (während seines Aufenthalts in den USA 1892 – 1895) und Ferruccio Busonis Studien über die Musik der Native Americans und der schwarzen Amerikaner gehören ebenfalls in diesen Zusammenhang. Zu Dvořk vgl. Ulrich Kurth, Aus der Neuen Welt. Untersuchungen zur Rezeption afro-amerikanischer Musik in europäischer Kunstmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Göppingen 1982, S. 117 – 157; zu Busoni Regine Wild, Lieder der nordamerikanischen ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 109 sich Debussy wieder Europa zu und konzentrierte seine durch Krankheit verminderten Kräfte auf den Versuch, die französische Kultur in einer Zeit, wie er es sah, heraufziehender Barbarei zu bewahren. Debussys persönliche Entwicklung steht symptomatisch für ein allgemeineres Muster : Insofern europäische Komponisten Einflüsse von außerhalb der eigenen Klangwelt aufnahmen, revolutionierte dies selten ihre gesamte künstlerische Identität. Typisch war, dass sie nach einer exotisierenden Phase zu Interessen zurückkehrten, die dem europäischen Mainstream näher lagen, ohne notwendigerweise konservativ zu sein. Um 1930 war das Interesse westlicher Musiker an Exotisierung gegenüber der Jahrhundertwende deutlich zurückgegangen. IV. Musik und europäische Expansion Das Konzept eines „Western impact“ wird heute in der globalhistorischen Literatur vermieden, vor allem deshalb, weil es Nichteuropäern nur die Chance zu passivem „response“ zu lassen scheint. Dennoch eignet es sich weiterhin dafür, die Grundstrukturen einer Weltgeschichte der Musik zu erfassen.73 Die Idee eines „Western impact“ kombiniert zwei unterschiedliche Aspekte musikalischer Expansion: Auf der einen Seite näherten sich Europäer dem Rest der Welt mit Musik als Teil ihres kulturellen Gepäcks und ihres Instrumentariums von Herrschaftstechniken. Ebenso wie sie selbst oft unwillkommen waren, so traf auch ihre Musik mitunter auf Unverständnis. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige Beispiele dafür, dass Nicht-Europäer westliche Musik außerhalb jedes imperialen oder kolonialen Zwangszusammenhangs aus freien Stücken importierten und sich aneigneten. Die europäische Expansion war von vielfältigen Formen des Musikmachens begleitet: militärischem Signalisieren, Liedern von Seeleuten und Soldaten, kirchlichen Liturgien, Festmusiken für die verschiedensten Gelegenheiten.74 Im Britischen Empire unterhielten Gouverneure unweigerlich eine Militärkapelle, die zu zeremoniellen Anlässen aufspielte, nicht zuletzt dann, wenn einheimische Würdenträger unterhalten und beeindruckt werden sollten.75 Solche kleinen Ensembles wurden zu Akteuren musikalischer Mobilität: Kurz nach Erscheinen erreichten die melodienreichsten Opern Giuseppe Verdis – insbesondere Indianer als kompositorische Vorlagen. In der Zeit von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg, Köln 1994, S. 175 – 202. 73 Bruno Nettl, The Western Impact on World Music. Change, Adaptation and Survival, New York 1985 – ein reichhaltiges, aber unsystematisches und historisch wenig tiefenscharfes Buch. 74 Übersicht bei Ian Woodfield, English Musicians in the Age of Exploration, Stuyvesant, NY 1995, S. 39 – 91. 75 Trevor Herbert u. Margaret Sarkissian, Victorian Bands and Their Dissemination in the Colonies, in: Popular Music 16. 1997, S. 165 – 179. 110 Jürgen Osterhammel „Rigoletto“ (1851), „Il Trovatore“ (1853) und „La Traviata“ (1853) – rasch durch Arrangements für Blasinstrumente, die von jeder besseren Militärkapelle gemeistert werden konnten, weltweite Bekanntheit.76 Die früheste institutionelle Rahmung musikalischer Praxis, die in einen anderen Teil der Welt verpflanzt wurde, war die sakrale Musik der spanischen Eroberer. Spanisch-Amerika wurde rasch mit einem Netz von Kathedralen, Dorfkirchen, Klöstern und Konventen überzogen, und überall gehörte Musik zur Routine des Alltags, sowohl bei religiösen Anlässen als auch in weltlichen Situationen. Wie alle Kolonialherren, so kultivierten Übersee-Spanier Musik nicht zuletzt deshalb, weil sie eine affektive Verbindung zur Alten Welt bot. Wie Geoffrey Baker in einer Studie über das koloniale Cuzco gezeigt hat, übernahm die örtliche Kreolen-Bevölkerung, das heißt in Amerika geborene Menschen spanischer Abstammung, schon früh Elemente aus der Musik der Anden als einen Unterscheidungsmarker. Sobald die Unterwerfung des Inka-Reiches eine irreversible Tatsache geworden war, fanden andine Traditionen Eingang in die koloniale Kultur. Umgekehrt wurde europäische Musik nicht bloß in kulturimperialistischer Weise von Europäern ausgeübt, um das Projekt der christlichen Missionierung der einheimischen Bevölkerung zu flankieren. Das europäische und kreolische Personal reichte für die Bedürfnisse in Amerika nicht aus. Missionare benötigten kompetente indianische Musiker und gaben sich viel Mühe, sie auszubilden, zumal Musik als ein ideales Werkzeug für die „Zivilisierung“ der Einheimischen verstanden wurde. Baker kommt zu dem Schluss, dass vermutlich in den Dörfern und Missionsstationen SpanischAmerikas mehr Musik betrieben wurde als in den ländlichen Regionen der iberischen Halbinsel.77 Die musikalische Tradition des Mutterlandes zu kopieren, ist eine weithin verbreitete Praxis zur Wahrung von sozialer Kohärenz und kultureller Identität in Diaspora-Situationen. Chinatowns im Nordamerika des 19. Jahrhunderts 76 John Rosselli, The Life of Verdi, Cambridge 2001, S. 191 (Anm. 1). Vgl. auch Trevor Herbert, The Repertory of a Victorian Provincial Brass Band, in: Popular Music 9. 1990, S. 117 – 132. In Europa verbreiteten sich Opern nicht nur von Verdi durch Bearbeitungen für Stimmen und Piano beziehungsweise unterschiedliche Kammerensembles. In Großbritannien z. B. wurden die Texte gelegentlich bei der Übersetzung ins Englische den herrschenden moralischen Normen angepasst. Vgl. Roberta Montemorra Marvin, Verdian Opera in the Victorian Parlor, in: dies., Fashion and Legacies of Nineteenthcentury Opera, S. 53 – 75, bes. S. 54 – 57 u. S. 67. 77 Geoffrey Baker, Imposing Harmony. Music and Society in Colonial Cuzco, Durham, NC 2008, S. 239. Vgl. auch Victor Anand Coelho, Music in New Worlds, in: Tim Carter u. John Butt (Hg.), The Cambridge History of Seventeenth Century Music, Cambridge 2005, S. 88 – 110; sowie eine schöne Studie zu einem anderen Bereich der spanischen Kolonialgeschichte: David R. M. Irving, Colonial Counterpoint. Music in Early Modern Manila, Oxford 2010. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 111 waren bemüht, ihr musikalisches Erbe zu erhalten.78 Noch in der kleinsten Gemeinschaft von Siedlern und Kolonialfunktionären wurde irgendeine Art von privater Musik betrieben. Spätestens sobald Frauen präsent waren, wurde Musik zu einer wichtigen Freizeitbeschäftigung und zu einem Kristallisationskern für gesellige Anlässe. Größere überseeische Niederlassungen von Kolonialisten bemühten sich, das Musikleben europäischer Provinzstädte zu imitieren. Im späten 18. Jahrhundert konnte zum Beispiel Kalkutta niemals hoffen, mit dem kulturellen Glanz Londons zu konkurrieren, doch war es nicht unrealistisch, das Niveau einer kultivierten englischen Mittelstadt wie Bath oder Norwich zu erreichen. Gesellige Zusammenkünfte waren unvollständig ohne musikalische Aktivitäten, Klavierspiel und Gesangskünste unentbehrliche Pluspunkte auf dem kolonialen Heiratsmarkt. Das ehrgeizigste Ziel einer größeren Gemeinschaft nicht nur in Indien war es, professionelle Künstler engagieren und vielleicht sogar eine Serie von Abonnementskonzerten einrichten zu können.79 Unter den Briten in Indien gab es, insbesondere in den zwei oder drei Jahrzehnten nach 1780, ein großes Interesse nicht nur an der letzten oder vielleicht eher vorletzten Mode, die aus Europa eintraf, sondern auch an indischer Musik – vorausgesetzt die erheblichen Schwierigkeiten, indische Melodien auf einem klimabedingt schwer stimmbaren Cembalo zu spielen, konnten gemeistert werden. Die wahren Orte interkultureller Begegnung waren weniger die britisch dominierten Herrschaftszentren Kalkutta, Bombay und Madras als vielmehr einige der indischen Fürstenhöfe. An Orten wie Awadh (Oudh) mit seiner Hauptstadt Lakhnau (Lucknow) trafen sich indische und britische Eliten im sozialen Raum einer geteilten musikalischen Kultur, wo Briten zu Kennern von indischer Musik und indischem Tanz wurden und Inder Georg Friedrich Händel oder Carl Philipp Emmanuel Bach schätzen lernten.80 Erst eine größere Zahl von Fallstudien würde ein nuanciertes Bild kolonialen Musizierens entstehen lassen. Es dürfte aber plausibel sein, dass Musik oft eine integrierende Funktion erfüllte. Sie stiftete Kohärenz in der begrenzten sozialen Welt der Kolonisierer und öffnete zuweilen eine gemeinsame Geselligkeitssphäre für indigene und fremde Eliten.81 Auf imperialer Ebene 78 Krystyn R. Moon, Yellowface. Creating the Chinese in American Popular Music and Performance, 1850s – 1920s, New Brunswick, NJ 2005, S. 68 – 70; vor allem aber eine Studie über die Kanton-Oper, die seit 1852 in Kalifornien aufgeführt wurde: Daphne Piwei Lei, Operatic China. Staging Chinese Identity across the Pacific, New York 2006. 79 Ian Woodfield, Music of the Raj. A Social and Economic History of Music in Late Eighteenth-century Anglo-Indian Society, Oxford 2000, S. 70 – 75. 80 Ebd., S. 149 – 158. Für eine entfernt ähnliche Konstellation im frühen 20. Jahrhundert vgl. Bradley Shope, Anglo-Indian Identity, Knowledge, and Power. Western Ballroom Music in Lucknow, in: The Drama Review 48. 2004, S. 167 – 182. 81 Im Sinne von David Cannadine, Ornamentalism. How the British Saw Their Empire, London 2001. 112 Jürgen Osterhammel wurde erwartet, dass Musik, die oft durch imperiale Propaganda aktiv gefördert wurde, eine Art von weltweiter corporate identity schuf, zumindest unter den Briten zu Hause und in den Kolonien. Imperiale Festanlässe wurden mit einer bestimmten, als wiedererkennbares Markenzeichen dienenden Musik verbunden. Georg Friedrich Händels Status als führender englischer Nationalkomponist, ein Rang, der ein Vierteljahrhundert nach dem Tod des aus Halle an der Saale stammenden Meisters erreicht war,82 wurde in kolonialen Zusammenhängen immer wieder bekräftigt. Die aufwendigen Händel-Feierlichkeiten in Kalkutta 1797, die ein Echo auf das prunkvolle Händel-Fest in der Westminster Abbey 1784 bildeten, können als Anspruch der Stadt auf kulturelles Gewicht verstanden werden. Sie erlaubten den Briten in Bengalen, an einem symbolischen Universum universaler Britishness teilzuhaben.83 Ein Jahrhundert später wurden Sir Arthur Sullivan (1842 – 1900), im Team mit seinem Librettisten als Schöpfer der „Gilbert & Sullivan“-Operetten bekannt, und Sir Edward Elgar (1857 – 1934) in den Rollen „imperialer“ Komponisten installiert. Elgar, ein Mann von hohem Kunstanspruch und keineswegs auffälliger imperialistischer Gesinnung, zollte seit 1897 dem Zeitgeist durch das Verfertigen „imperial“ gemeinter, aber klanglich wenig exotischer Märsche Tribut, deren Popularität das Empire überlebt und die besseren Werke des Komponisten überschattet hat. Gesangsstars wie die australische Sopranistin Nellie Melba (1861 – 1931) oder die englische Altistin Clara Butt (1862 – 1936) ergänzten ihre ansonsten überwiegend kontinentaleuropäischen Recital-Programme um imperiale Evergreens und betätigten sich ab 1914 enthusiastisch in der musikalischen Truppenbetreuung.84 Der koloniale Transfer europäischer Musik und ihrer Institutionen nahm viele andere Formen an. Im französischen Imperium diente die Garnier-Oper in Paris, der architektonische Prototyp des modernen Opernhauses, als Muster, das in verkleinertem Maßstab überall kopiert werden konnte. 1911 wurde Hanoi, die Hauptstadt Französisch-Indochinas, wo man in den 1890er Jahren mit regelmäßigen Opernaufführungen begonnen hatte, nach zehnjähriger Bauzeit mit einem Opernhaus geschmückt, das einer Gemeinschaft von etwa 82 So William Weber, The Rise of Musical Classics in Eighteenth-century England. A Study in Canon, Ritual, and Ideology, Oxford 1992, S. 101. 83 Woodfield, Music of the Raj, S. 145 – 148. Vgl. auch das Gesamtbild bei Holger Hoock, Empire of the Imagination. Politics, War, and the Arts in the British World, 1750 – 1850, London 2010. 84 Jeffrey Richards, Imperialism and Music. Britain, 1876 – 1953, Manchester 2001, S. 19 – 87 u. S. 475 – 492; Bernard Porter, Edward Elgar and Empire, in: Journal of Imperial and Commonwealth History 29. 2001, S. 1 – 34; Corissa Gould, „An Inoffensive Thing“. Edward Elgar, The Crown of India, and Empire, in: Clayton u. Zon, Music and Orientalism in the British Empire, S. 129 – 146. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 113 2.700 Franzosen 750 Sitzplätze bot.85 Auch im französischen Kontext verband sich mit „klassischer“ Musik und ihrem buchstäblich spektakulärsten Genre, der Oper, die Absicht, die Überlegenheit der europäischen, insbesondere der französischen, Zivilisation sinnfällig zu machen. Das kurzlebige (1927 – 1930) Conservatoire FranÅais d’ExtrÞme-Orient bediente nicht allein die französischen Siedler in Hanoi, sondern versuchte auch Vietnamesen anzuziehen, die eine Ausbildung in europäischem Musizieren anstrebten.86 Ein Glaube in die „zivilisatorische“ Macht der Musik, so durchsichtig die imperiale Interessenlage im Allgemeinen war, sollte jedoch nicht ausschließlich als eine zynische Strategie zur Indoktrination der Kolonisierten und zu ihrer Entfremdung vom eigenen kulturellen Erbe gesehen werden. Ein solcher Glaube hatte tiefere Wurzeln in antiken orphischen Mythen und spielte bereits in der Aufklärung eine wichtige Rolle.87 Als man während der drei Weltreisen des Kapitän James Cook im Zeitraum von 1768 bis 1779 den Bewohnern der Pazifischen Inseln europäische Musik vorspielte, war dies einer der harmloseren Aspekte europäischer Expansion. Insgesamt gesehen, ist Musik ein schwer kontrollierbares Werkzeug kolonialer Hegemonie. Selbst unter den asymmetrischen Machtverhältnissen des Kolonialismus konnte niemand gezwungen werden, europäische Musik zu mögen oder sie gut auszuführen. Wenige andere Formen kulturellen Ausdrucks sind widerspenstiger als das Singen und das Spielen von Musikinstrumenten. Außerhalb der Kolonien war der Import europäischer Musik ein komplexer Prozess, in dem sich Widerstand, Aneignung, Anpassung und Transformation verbanden. In einigen Fällen ging die Initiative vom Staat aus, nirgendwo mehr als in Japan. Westliche Musik war im 16. Jahrhundert von den Jesuitenmissionaren eingeführt worden, dann aber mit der Unterdrückung des Christentums, die 1639 abgeschlossen war, wieder verschwunden. Nach der Öffnung des Landes 1854 wurde die Musik des Westens neu entdeckt. Wie auch sonst im Orient und im ferneren Asien,88 etwa in Siam (Thailand), das mit europäischer Musik erstmals Ende 1861 Bekanntschaft machte, als die Militärkapelle im Gefolge des preußischen Sondergesandten Graf Friedrich zu Eulenburg vor dem königlichen Hofstaat aufspielte,89 wurde der früheste Musikkontakt 85 Michael E. McClellan, Performing Empire. Opera in Colonial Hanoi, in: Journal of Musicological Research 22. 2003, S. 135 – 166, hier S. 154. 86 Ders., Music, Education and FranÅais de couleur. Music Instruction in Colonial Hanoi, in: Fontes artis musicae 56. 2009, S. 315 – 325. 87 Vanessa Agnew, Enlightenment Orpheus. The Power of Music in Other Worlds, Oxford 2008, S. 165. 88 Etwa in Ägypten seit den 1820er Jahren, vgl. Salwa Aziz El-Shawan, Western Music and Its Practitioners in Egypt, ca. 1825 – 1985. The Integration of a New Musical Tradition in a Changing Environment, in: Asian Music 17. 1985, S. 143 – 153, hier S. 143 f. 89 Suphot Manalapanacharoen, Die Geschichte deutsch-thailändischer Musikbeziehungen, Frankfurt 2000, S. 42 – 48. 114 Jürgen Osterhammel zwischen Japan und dem Westen über Militärmusik hergestellt. Bereits vor dem Beginn der Meiji-Umgestaltung 1868 hatten mehrere große Feudalfürsten ihre eigenen Militärkapellen im europäischen Stil gegründet.90 Als erneut Missionare ins Land kamen, brachten sie eine Flut christlicher Hymnen mit. Für die Meiji-Regierung, die Japan als ein „zivilisiertes“ Land erscheinen lassen wollte, war die Unterstützung westlicher Musik auf Kosten der einheimischen Traditionen Teil ihrer kulturpolitischen Strategie. 1872 verfügte das Erziehungsministerium, dass sich die Musikerziehung in allen Grundund Mittelschulen auf westliche Musik beschränken solle.91 Ausländische Musiker wurden angeworben, um das musikalische Leben in Japan auf mehreren Ebenen neu zu organisieren.92 1887 entstand in Tokyo die erste Musikakademie, 1890 die erste Musikzeitschrift. Bevor noch eine einzige Note Wagners in Japan erklungen war, debattierten japanische Intellektuelle bereits die Vorzüge und Mängel des Wagnerianismus.93 Die erste Opernvorstellung, die Aufführung einer Szene aus Charles Gounods „Faust“ (1859), einer der im späten 19. Jahrhundert populärsten Opern der Welt, fand 1894 statt. So begann – ohne jede koloniale Initiative, aber mit Hilfe frei engagierter europäischer Berater – der Aufstieg der westlichen Musik in einem Land, das bereits 1878 sein erstes Klavier aus eigener Herstellung auf einer Weltausstellung in Paris vorstellen konnte.94 Allerdings fehlte es auch nicht an Verteidigern der indigenen Musiktradition.95 90 Eta Harich-Schneider, A History of Japanese Music, London 1973, S. 533 f. Über die frühe Übernahme von Militärkapellen westlichen Stils in China vgl. Gong Hong-yu, Missionaries, Reformers, and the Beginnings of Western Music in Late Imperial China, 1839 – 1911, unveröff. Diss. University of Auckland 2006, S. 188 ff. 91 Harich-Schneider, History of Japanese Music, S. 540. Enttäuschend Genkichi Nakasone, Die Einführung der westlichen, besonders deutschen Musik im Japan der Meiji-Zeit, Hamburg 2003; aber vgl. den vorzüglichen Aufsatz Toru Takenaka, Foreign Sound as Compensation. Social and Cultural Factors in the Reception of Western Music in Meiji Japan, 1867 – 1912, in: Susan Ingram u. a. (Hg.), Floodgates. Technologies, Cultural (Ex) Change and the Persistence of Place, Frankfurt 2006, S. 185 – 202. 92 Mattias Hirschfeld, Beethoven in Japan. Zur Einführung und Verbreitung westlicher Musik in der japanischen Gesellschaft, Hamburg 2005, S. 37 – 43. 93 Toru Takenaka, Wagner-Boom in Meiji-Japan, in: Archiv für Musikwissenschaft 62. 2005, S. 13 – 31, hier S. 22. 94 Cyril Ehrlich, The Piano. A History [1976], Oxford 1990, S. 67. 95 Vgl. William P. Malm, The Modern Music of Meiji Japan, in: Donald H. Shively (Hg.), Tradition and Modernization in Japanese Culture, Princeton 1971, S. 257 – 300; Ury Eppstein, Musical Instruction in Meiji Education. A Study of Adaptation and Assimilation, in: Monumenta Nipponica 40. 1985, S. 1 – 38, über Izawa Shūji, den wichtigsten Musikpädagogen der Meiji-Zeit: Toru Takenaka, Izawa Shūji’s „National Music“. National Sentiment and Cultural Westernisation in Meiji Japan, in: Itinerario 34. 2011, S. 97 – 118. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 115 Japan war ein Extremfall. Aber auch in anderen Ländern Asiens sorgte sich der Staat um so etwas wie Musikpolitik. In Siam (Thailand) geschah dies in Fortsetzung einer fest etablierten Tradition der Hofmusik.96 Noch vor Japan engagierte die Regierung des Osmanischen Reiches europäische Musikexperten. 1828 wurde Giuseppe Donizetti (1788 – 1856), der ältere Bruder des berühmten Opernkomponisten Gaetano Donizetti, als Generalinstruktor der kaiserlichen osmanischen Musik (mit dem „Pascha“-, das heißt Generalstitel) an den Hof des Sultans Mahmud II. berufen, wo er den Rest seiner Laufbahn als Leiter des Hoforchesters, Lehrer, Zeremonienmeister, gelegentlicher Komponist und Gastgeber europäischer Musiker – etwa im Juni 1847 von Franz Liszt – verbrachte.97 Am Sultanshof in Istanbul wurde europäische Musik gepflegt: Prinzen und Prinzessinnen ließ man am Klavier ausbilden, und mehrere Sultane versuchten sich als Komponisten von Märschen und anderen kurzen Stücken.98 Auf der Ebene volkstümlicher Unterhaltung traten „böhmische“ Kapellen, viele von ihnen aus den niedergehenden Bergbauregionen des Erzgebirges stammend, in zahlreichen levantinischen Städten auf.99 In weniger radikaler Weise als in Japan gründete später die Türkische Republik die staatliche Erziehung und das öffentliche Zeremonienwesen auf Musik westlicher Herkunft, in die allerdings folkloristische Element eingeschmolzen werden sollten.100 Andernorts waren Marktkräfte stärker als staatliche Interventionen. In der 1912 proklamierten Republik China gab es nach dem Untergang der Monarchie plötzlich keine kaiserliche Hofmusik mehr. Die politisch schwache Zentralregierung verfolgte nicht wie die kemalistische Staatsmacht in der Türkei eine umfassende Politik kultureller Verwestlichung. Immerhin errichtete sie 1922 an der Universität Beijing eine Musikabteilung und 1927 in Shanghai eine Nationale Musikhochschule, Chinas erste quasi-professionelle Organisation für musikalischen Unterricht. Ihr Curriculum war überwiegend westlich orientiert mit traditioneller chinesischer Musik als einem langsam an 96 Manalapanacharoen, Geschichte deutsch-thailändischer Musikbeziehungen, S. 1 – 40. 97 Vgl. Emre Araci, A Levantine Life. Giuseppe Donizetti at the Ottoman Court, in: The Musical Times 143. 2002, S. 49 – 56. 98 So das Buch eines türkischen Pianisten (aber ohne Quellenbelege): Vedat Kosal, Westliche klassische Musik in dem Osmanischen Reich, Istanbul 2003, S. 22 – 44, S. 50 – 58 u. S. 87 – 92. Vgl. auch eine CD mit osmanischer Hofmusik: The London Academy of Ottoman Court Music. Invitation to the Seraglio, Warner Brothers 2004. 99 Malte Fuhrmann, Down and Out on the Quays of Izmir. „European“ Musicians, Innkeepers, and Prostitutes in the Ottoman Port Cities, in: Mediterranean Historical Review 24. 2009, S. 169 – 185, hier S. 172 – 174. 100 Orhan Tekelioğlu, Modernizing Reforms and Turkish Music in the 1930s, in: Turkish Studies 2. 2001, S. 93 – 108, bes. S. 95 f. 116 Jürgen Osterhammel Bedeutung gewinnenden Ergänzungsfach.101 Das Studentenorchester der Musikhochschule war das erste auf europäische Musik spezialisierte Ensemble, das ausschließlich aus chinesischen Musikern bestand.102 In Shanghai, dem von der Zentralregierung unabhängigen Mittelpunkt der ausländischen Präsenz in China, zelebrierte seit der Wintersaison 1919/20 ein gut besetztes Orchester unter dem Florentiner Klaviervirtuosen und Dirigenten Mario Paci (1878 – 1946), einem Enkelschüler Liszts, die europäische symphonische Literatur von der Wiener Klassik bis hin zu Debussy, Ravel, Stravinskij und sogar dem italienischen Avantgardisten Gian Francesco Malipiero. Zum 100. Todestag Beethovens wurde 1927 die Neunte Symphonie aufgeführt, nur drei Jahre nach ihrer Erstaufführung in Tokyo, wo westliche Kulturimporte zumeist früher eintrafen als in China.103 Um diese Zeit trat auch der erste chinesische Musiker in das Shanghai Municipal Orchestra ein, ein Geiger, der seinen Anfangsunterricht bei deutschen Missionaren erhalten hatte.104 Das Orchester bestand ansonsten aus Versprengten vieler europäischer Länder, darunter russische Flüchtlinge vor dem Bolschewismus und in den dreißiger Jahren jüdische Emigranten aus Zentraleuropa. Maestro Paci leitete es, bis ihn die japanischen Besatzungsbehörden 1942 aus dem Amt entfernten. V. Musikermobilität Die individuelle Mobilität von Musikern folgte nur sehr bedingt der Infrastruktur der Imperien. Keiner der berühmten europäischen Komponisten hatte persönliche Wurzeln in der kolonialen Welt. Vereinzelt traten überseeische Interpreten auf. Der in Polen geborene George Augustus Polgreen Bridgetower (1799 – 1860), ein vielfach gelobter Geiger, hatte zwar Europa nie verlassen, fiel aber auf, weil er der Sohn eines farbigen Kammerpagen war. Der zeitweilig mit ihm befreundete Beethoven widmete ihm die Violinsonate A-dur op. 47, zunächst „Sonata mullatica“ genannt, deren Widmung später auf 101 Jonathan P. J. Stock, Musical Creativity in Twentieth-Century China. Abing, His Music, and Its Changing Meanings, Rochester, NY 1996, S. 143 f.; auch Zhang Que-May, Bildungsreform und westliche Musikerziehung in China, in: Periplus. Jahrbuch für außereuropäische Geschichte 6. 1996, S. 147 – 155. 102 Vgl. Zhu Shi-Rui, Entstehung und Entwicklung moderner professioneller chinesischer Musik und ihr Verhältnis zum eigenen Erbe und zum westlichen Einfluß, Aachen 2000, S. 65 – 70. 103 Die ostasiatische Erstaufführung der Neunten Symphonie hatte am 1. Juni 1918 durch deutsche und österreichisch-ungarische Kriegsgefangene im japanischen Lager Bandō stattgefunden. Vgl. Hirschfeld, Beethoven in Japan, S. 79 f. 104 Sheila Melvin u. Jindong Cai, Rhapsody in Red. How Western Classical Music Became Chinese, New York 2004, S. 34 – 40 u. S. 89 – 92. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 117 Rodolphe Kreutzer übertragen wurde.105 Von Joseph Boulogne (oder Bologne), Chevalier de Saint-Georges (ca. 1745 – 1799), auf Guadeloupe als Sohn eines Pflanzers und einer aus dem Senegal stammenden Sklavin geboren, der ein ausgezeichneter Komponist, der beste französische Geiger seiner Zeit und zugleich ein berühmter Fechtmeister war, sind in den letzten Jahren Violinkonzerte und Streichquartette auf CD eingespielt worden; sie klingen ausgesprochen „mozartisch“ und in keiner Weise kolonial oder exotisch.106 Zu Beginn des 19. Jahrhundert bewegten sich die gefragteren unter den Instrumental- und Gesangsvirtuosen in einem europäischen Kernraum, der Italien, die Habsburgermonarchie, die deutschen Länder, Frankreich und England umfasste. Gelegentlich kamen Spanien, Schottland, Kairo und Konstantinopel hinzu. Seit dem Ende der 1820er Jahre wurde das Zarenreich, besonders die großstädtischen Zentren wie Warschau, die baltischen Städte, St. Petersburg, Moskau und Odessa, immer häufiger in Tourneen einbezogen.107 Überseereisen europäischer Musiker waren vor der Einrichtung eines regelmäßigen transatlantischen Dampferverkehrs sehr selten. Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte (1749 – 1838) emigrierte in die USA und starb im Alter von 89 Jahren in New York als pensionierter Professor für italienische Literatur,108 doch Mozart selbst war niemals in Übersee. Auch in den letzten Jahrzehnten vor 1914 war eine Transatlantikreise für bekannte Komponisten keine Selbstverständlichkeit. Nur eine Minderheit unter den berühmten europäischen Meistern überquerte vor 1914 den Atlantik: Pjotr Iljič Čajkovskij (April/ Mai 1891 in New York, Baltimore und Philadelphia), Antonin Dvořk (USAAufenthalt von September 1892 bis April 1895) und Gustav Mahler (von Dezember 1907 bis April 1911 in New York).109 Der deutsch-italienische 105 Vgl. die Romanbiographie von Dieter Kühn, Beethoven und der schwarze Geiger, Frankfurt 1990; auch Janet Schmalfeldt, Beethoven’s „Bridgetower“ Sonata op. 47, in: Darla Crispin (Hg.), New Paths. Aspects of Music Theory and Aesthetics in the Age of Romanticism, Löwen 2009, S. 37 – 68. Zu den Erfahrungen eines kubanischen Geigers in Süddeutschland Daniel Jütte, Schwarze, Juden und die Anfänge des Diskurses über Rasse und Musik im 19. Jahrhundert. Überlegungen anhand von Claudio Jos Domingo Brindis de Salas’ Reise durch Württemberg und Baden im Jahre 1882, in: Archiv für Kulturgeschichte 88. 2006, S. 117 – 140. 106 Thomas Betzwieser, Art. Saint-Georges, Joseph Bologne, in: MGG, Personenteil, Bd. 14 (2005), Sp. 792 – 796. 107 Olga Lossewa, Die Russlandreise Clara und Robert Schumanns 1844, Mainz 2004, S. 29, die Schumanns reisten von Januar bis Mai 1844. 108 Anthony Holden, The Man Who Wrote Mozart. The Extraordinary Life of Lorenzo da Ponte, London 2006, S. 163 – 214 über seine amerikanischen Jahre; auch Rodney Bolt, Lorenzo da Ponte. The Adventures of Mozart’s Librettist in the Old and New Worlds, London 2006. 109 Elkhonon Yoffe, Tchaikovsky in America. The Composer’s Visit in 1891, New York 1986; Jens Malte Fischer, Gustav Mahler. Der fremde Vertraute, Wien 2003, S. 698 – 754. 118 Jürgen Osterhammel Komponist und Klaviervirtuose Ferruccio Busoni hielt sich zwischen 1891 und 1915 fünfmal in den USA auf und nutzte die Gelegenheit, um die Musik der einheimischen Indianer kennenzulernen.110 Der aktivste Reisende unter den Musikern seiner Zeit war Camille Saint-Sans, der als Konzertpianist 1915 eine triumphale Tour durch die USA absolvierte; er besuchte auch Algerien, Ägypten, Uruguay, Ceylon (Sri Lanka) und Vietnam.111 Johannes Brahms und Giuseppe Verdi hingegen beglückten niemals ihre amerikanischen Bewunderer mit ihrem persönlichen Erscheinen.112 Franz Liszt, der während seiner Virtuosenzeit zwischen 1838 und 1847 kreuz und quer durch Europa mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt hatte,113 überwiegend in der Kutsche, kannte die westliche Hemisphäre ebenso wenig wie sein Schwiegersohn Richard Wagner. Allerdings äußerte Wagner 1880 in missmutiger Stimmung die Absicht, nach Minnesota auszuwandern und den „Parsifal“ den Amerikanern zu widmen.114 Es gibt vor 1900 in der Musik kein Gegenstück zu weitgereisten Literaten und bildenden Künstlern wie Luis Vaz de Cames, Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Rudyard Kipling oder Paul Gauguin. Unter den wenigen globalen Lebensläufen von Musikern vor dem Ende des 19. Jahrhunderts fällt der von Louis Moreau Gottschalk (1829 – 1869) deshalb besonders auf, weil er sich in Musik niedergeschlagen hat. Gottschalk wurde in dem multikulturellen melting pot New Orleans geboren, wo er früh die unterschiedlichsten musikalischen Eindrücke aufnahm, bevor er zur Ausbildung nach Frankreich geschickt wurde. Neben ausgedehnten Konzertreisen als Pianist durch die USA besuchte er Kanada, Kuba und Haiti; auch auf Puerto Rico und Jamaika und in Venezuela trat er auf. Er selbst behauptete, 95.000 Meilen zurückgelegt zu haben, und er starb während einer Reise in Brasilien. Gottschalk war einer der ersten interkontinental mobilen Instrumentalisten und der früheste Komponist mit einem genuin neuweltlichen „Sound“. Allerdings war sein Einfluss auf seine komponierenden Zeitgenossen nicht sehr groß; seine einfallsreichen musikalischen Beschwörungen der Tropen und der nordamerikanischen 110 Wild, Lieder der nordamerikanischen Indianer, S. 175 – 202, bes. S. 176 f.; Antony Beaumont, Busoni the Composer, Bloomington, IN 1985, S. 190 – 203. 111 Brian Rees, Camille Saint-Sans. A Life, London 1999, S. 289. 112 Ein anderes Thema ist die amerikanische Resonanz auf europäische Komponisten, nicht nur durch Aufführungen ihrer Werke, sondern auch durch die Berichterstattung in amerikanischen Periodika oder durch Kontakte über zurückgekehrte amerikanische Schüler. Vgl. als Fallstudie etwa, Nancy B. Reich, Clara Schumann and America, in: Peter Ackermann u. Herbert Schneider (Hg.), Clara Schumann. Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone, Hildesheim 1999, S. 195 – 203. 113 Karte und Liste seiner Reisen bei Alan Walker, Franz Liszt, Bd. 1: The Virtuoso Years, 1811 – 1847, London 1983, S. 292 – 295. 114 Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert, München 1983, S. 788. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 119 Südstaaten – in Miniaturen mit Titeln wie „Le Bananier. Chanson ngre“ oder „Souvenir de Porto Rico“ – finden allenfalls Echos in den Werken einer späteren Generation, etwa bei Debussy und Ravel.115 Nordamerika wurde zunehmend zum Reisemagneten für europäische Musiker, für manche auch zum Ziel dauerhafter Emigration. Amerikanische Veranstalter boten ökonomische Konditionen und Arbeitsbedingungen an, mit denen auf dem europäischen Kontinent wenige mithalten konnten. Der Virtuose und Klavierbauer Henri (Heinrich) Herz tourte 1846 bis 1851 ausgiebig durch beide Amerikas;116 der norwegische Geiger Ole Bull (1810 – 1880) bereiste ab 1843 mehrfach Nordamerika und konzertierte auch in Panama und Kuba.117 1845 hatte Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847), nicht nur als Komponist, sondern auch als Stardirigent und -pianist geschätzt, ein üppiges Angebot aus New York erhalten und eine Weile gezögert, bis er es aus Gesundheitsgründen ablehnte.118 Auch Richard Wagner verbarg 1880 seine finanziellen Motive nicht. Die aus Amerika über den Atlantik hinweg Einladenden waren oft Deutsche, in deren Hände der Aufbau eines amerikanischen Musiklebens in großem Umfang gelangt war. Als Gruppe gesehen, waren sie die wichtigsten Globalisierer des Musikbetriebs in den fünf oder sechs Jahrzehnten vor 1914.119 Konzerttourneen durch die USA konnten auch direkten kommerziellen Zwecken dienen, wenn etwa die Klavierfabrikanten Steinway & Sons als Sponsoren auftraten, zum Beispiel bei einer sehr erfolgreichen Rundreise 1872/73 des russischen Virtuosen, Komponisten und Pädagogen Anton Rubinstein (1829 – 1894).120 115 S. Frederick Starr, Louis Moreau Gottschalk, Urbana, IL 2000; James E. Perone, Louis Moreau Gottschalk. A Bio-bibliography, Westport, CT 2002; Jack Sullivan, New World Symphonies. How American Culture Changed European Music, New Haven, CT 1999, S. 195 – 199. Eine schöne Charakterisierung von Gottschalks Stellung in der Musikgeschichte der USA bei Richard Crawford, America’s Musical Life. A History, New York 2001, S. 331 – 350. 116 Laure Schnapper, La tourne de Henri Herz aux Amriques, 1846 – 1851, in: Christian Meyer (Hg.), Le musicien et ses voyages. Pratiques, rseaux et reprsentations, Berlin 2003, S. 203 – 222. 117 Harald Herresthal, Art. Bull, Ole (Bornemann), in: MGG, Personenteil, Bd. 3 (2000), Sp. 1239 – 1243. 118 R. Larry Todd, Mendelssohn Bartholdy. A Life in Music, Oxford 2003, S. 486. 119 Grundlegend: Jessica C. E. Gienow-Hecht, Sound Diplomacy. Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850 – 1920, Chicago 2009, bes. Kap. 3 – 4; daneben Joseph Horowitz, Classical Music in America. The History of Its Rise and Fall, New York 2005. 120 R. Allen Lott, Anton Rubinstein in America, 1872–1873, in: American Music 21. 2003, S. 291–318; über Rubinsteins mitreisenden Violinpartner vgl. Renata Suchowiejko, Henryk Wieniawski in America, in: Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth- und Nineteenth-Century Instrumental Music 3. 2005, S. 45–55. Eine ähnliche Megatournee absolvierte Hans von Bülow 1875/76, als er 139 Konzerte in beinahe 40 Städten gab: R. Allen Lott, „A Continuous Trance“. Hans von Bülow’s Tour of America, in: Journal of Musicology 12. 1994, S. 529–549. Weitere Fälle in ders., From Paris to Peoria. How European Piano Virtuosos Brought Classical Music to the American Heartland, Oxford 2003. 120 Jürgen Osterhammel Auch Sängerinnen und Sänger überquerten den Atlantik in stetig zunehmender Zahl. Erst waren es Südeuropäer, etwa der bedeutende spanische Tenor und Gesangspädagoge Manuel Garca d. Ä. (1775 – 1832), der im November 1825 den Grafen Almaviva in der amerikanischen Erstaufführung von Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ darstellte – mit ihm reiste seine Tochter Mara, die später unter dem Namen Mara Malibran (1808 – 1836) gefeierte Primadonna.121 Später kamen Künstler aus allen Teilen Europas, zumal nach der Eröffnung des Metropolitan Opera House in New York 1883. Zwischen 1884 und 1891 war die „Met“ de facto ein deutsches Opernhaus, in dem sogar „Trovatore“ und „Aida“ auf Deutsch gesungen wurden; danach verbreiterte sich die personelle Rekrutierungsbasis, und es wurde üblich, das Repertoire in den Originalsprachen singen zu lassen.122 Mit wenigen Ausnahmen, vor allem Mattia Battistini (1856 – 1928), dem führenden Belcanto-Bariton der Epoche, der die Strapazen einer Atlantiküberquerung fürchtete, gastierten alle maßgebenden europäischen Sängerinnen und Sänger irgendwann einmal an der Met oder gehörten zu deren Ensemble.123 Eine andere Art von Musikerwanderung fand im Südatlantik statt.124 Alljährlich zogen Scharen italienischer Musiker nach Südamerika: Orchester, ganze Opernensembles, einzelne Sängerinnen und Sänger, auch Chöre, manchmal bestehend aus rustikalen Laiensängern vom Dorfe, die keine Noten lesen konnten.125 Wenn sie in Südamerika Pech hatten, mussten sich manche die Rückfahrt in die Heimat durch Landarbeit verdienen. So wie Argentinien, Uruguay und Brasilien zu wichtigen Zielen der italienischen Massenauswanderung wurden, so kann man die Opernhäuser Lateinamerikas als Außenposten des europäischen Musikbetriebs beschreiben. An erster Stelle unter ihnen standen die verschiedenen Theater von Buenos Aires, vor allem das 1857 eröffnete Teatro Coln (als Neubau 1908 wiedereröffnet). Die italienische Hegemonie über den argentinischen Opernbetrieb erlebte ihr goldenes Zeitalter zwischen etwa 1873 und 1914; sie endete mit der Weltwirtschaftskrise. Bis dahin wurden zwar nicht ausschließlich Werke von italieni121 James Radomski, Manuel Garca, 1775 – 1832. Chronicle of the Life of a Bel canto Tenor at the Dawn of Romanticism, Oxford 2000. 122 Susan Richardson, Art. New York, in: MGG, Sachteil, Bd. 7 (1997), Sp. 153 – 161, hier Sp. 157 f. 123 Battistini war immerhin als junger Anfänger zweimal, 1881 und 1889, in Südamerika: Jacques Chuilon, Mattia Battistini. King of Baritones and Baritone of Kings, Lanham, MD 2009, S. 320. 124 Das Folgende nach John Rosselli, The Opera Business and the Italian Immigrant Community in Latin America, 1820 – 1939. The Example of Buenos Aires, in: Past & Present 127. 1990, S. 155 – 182. 125 Hochqualifizierte italienische Chorsänger wurden um 1900 an den großen Opernbühnen des Auslands angestellt, die sich spezielle italienische Chöre leisteten. Vgl. John Rosselli, Singers of Italian Opera. The History of a Profession, Cambridge 1992, S. 207. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 121 schen Komponisten gespielt, aber alles wurde unterschiedslos auf Italienisch gesungen, von in Italien ausgebildeten Sängern unter italienischen Dirigenten und Managern und in Kostümen und Bühnenbildern, die oft komplett aus Italien importiert wurden. Neben den wenigen großen Stars traten zahlreiche Künstler auf, die schlecht bezahlt an italienischen Provinztheatern fünfmal in der Woche auf der Bühne standen und den Umstand nutzten, dass die argentinische Hauptsaison in die Zeit der sommerlichen Theaterferien Italiens fiel. Das Publikum verteilte sich auf zwei Arten von Häusern: In den vornehmen und teuren Theatern dominierte die spanisch sprechende kreolische Oberschicht, durchsetzt mit Angehörigen der britischen und deutschen Kaufmannschaft. Ein italienisches Publikum vorwiegend plebejisch-kleinbürgerlichen Charakters sammelte sich hingegen in Theatern mit niedrigeren Eintrittspreisen, in denen es turbulent wie in Italien zuging.126 Auch erstklassige Sänger wie die Sopranistin Luisa Tetrazzini (1871 – 1940) traten hier auf. Tetrazzini zog sogar mit einer eigenen Truppe durch Südamerika und stand dort öfter auf der Bühne als an der Met.127 Wann wurde die Welt außerhalb des Atlantik in die Musikermigration einbezogen? Darüber fehlt es noch an Studien. Ein früher musikalischer Globetrotter war der belgische Geigenvirtuose Ovide Musin (1854 – 1929), der Japan, China, Niederländisch-Ostindien, Neuseeland und Australien besuchte.128 Dass Australien nach der Jahrhundertwende eine Rolle zu spielen begann, war hauptsächlich das Verdienst der großen Primadonna Nellie Melba, der Tochter eines von Schottland nach Melbourne ausgewanderten Bauunternehmers, die von London oder New York aus immer wieder in ihr Heimatland zurückkehrte und sich dort für den Aufbau des Musiklebens einsetzte.129 Der erste pianistische Weltstar, der Pole Ignacy Paderewski (1860 – 1941), Historikern als kurzzeitiger (Januar bis Dezember 1919) Ministerpräsident und Außenminister der Republik Polen bekannt, durchquerte mehrmals Europa und die USA und besuchte mit dem für ihn unentbehrlichen großen Tross, also Flügel, Ehefrau, Kammerdienern, Sekretär, Manager, Klavierstimmer und über 126 Rosselli, Opera Business, S. 168 ff. 127 Zur Biographie und künstlerischen Charakterisierung von Sängerinnen und Sägern an der „langen“ Jahrhundertwende vgl. Jens Malte Fischer, Große Stimmen. Von Enrico Caruso bis Jessye Norman, Stuttgart 1993, zu Tetrazzini ebd., S. 65 – 67. 128 Malou Haine, Les voyages autour du monde du violiniste Ovide Musin de 1872 1908, in: Bulletin des Muses Royaux d’Art et d’Histoire 71. 2000, S. 281 – 298. 129 Die Standardbiographie ist John Hetherington, Melba. A Biography, Melbourne 1995; daneben Ann Blainey, I am Melba. A Biography, Melbourne 2008. Das wichtigste Ereignis für die Weltgeltung der australischen Musiklebens dürfte aber erst die Eröffnung des Opernhauses in Sydney 1973 gewesen sein. Melbas Ruhm als australischer Weltstar setzte sich später in der Sopranistin Joan Sutherland (1926 – 2010) fort, die seit 1959 regelmäßig im Ausland auftrat. 122 Jürgen Osterhammel hundert Koffern auch Südafrika, Australien und Neuseeland; auf seiner weitläufigsten Tournee gelangte er 1904 bis nach Tasmanien.130 Das war eine Ausnahme. Vor den zwanziger, im Grunde vor den sechziger Jahren, als der Luftverkehr das Fernreisen erleichterte, lagen Japan, China und Ozeanien, außerhalb des Radius des internationalen Tourneebetriebs. Wenn einmal eine Zelebrität wie im Sommer 1925 der österreichische, damals in Berlin lebende Geiger Fritz Kreisler (1875 – 1962) Australien und Neuseeland besuchte (1923 war er bereits in China gewesen), war dies von großer Medienaufmerksamkeit begleitet und wurde zu einem Ereignis in der Geschichte des Musiklebens dieser Länder.131 Der Komponist und Pianist Sergej Prokofjev reiste im Mai 1918 von Russland über Japan in die USA, hatte dabei aber nur flüchtigen Kontakt mit japanischen Musikern.132 Der irische Tenor John MacCormack (1884 – 1945), dessen Ruhm auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn demjenigen Enrico Carusos (1873 – 1921) nahekam, besuchte, durch Nellie Melba animiert, dreimal Australien und gastierte 1926 in China und Japan – in China in der segregierten Welt der von Westlern dominierten Vertragshäfen wie Shanghai, in der allerdings Eintritt zahlende Chinesen zunehmend auch zu Aufführungen europäischer Musik Zutritt hatten.133 Charakteristisch für das Reiseverhalten musikalischer Prominenter um die Jahrhundertwende ist die Auftrittsgeschichte des größten männlichen Gesangsstars der Epoche, Enrico Caruso. Zwischen 1895 und 1920 gastierte der reisefreudige neapolitanische Tenor in ganz Europa von Palermo bis Glasgow und von Lissabon bis St. Petersburg, in fast jeder nordamerikanischen Großund Mittelstadt, in Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro und Mexico City,134 aber nur ein einziges Mal, als zweiundzwanzigjähriger Nobody, in Kairo, wo seit der Eröffnung des Opernhauses 1869 italienische Impresarii das Musiktheater kontrollierten.135 Niemals war Caruso an anderen Orten des 130 Adam Zamoyski, Paderewski, London 1982, S. 116 – 119; Richard K. Liebermann, Steinway and Sons, New Haven, CT 1995, S. 108 – 115. 131 Anne-Marie H. Forbes, The Local Impact of an International Celebrity. Fritz Kreisler in Australia, in: Musicology Australia 31. 2009, S. 1 – 16. 132 David Nice, Prokofiev. From Russia to the West, 1891 – 1935, New Haven, CT 2003. S. 146. 133 Ausführliche Biographie auf der Homepage der MacCormack Society, http:// www.mccormacksociety.co.uk/. Zur sozialen und musikalischen Segregation in Shanghai vgl. Joys Hoi Yan Cheung, Chinese Music and Translated Modernity in Shanghai, 1918 – 1937, Diss. University of Michigan 2008, S. 79 ff.; auch Melvin u. Cai, Rhapsody in Red, S. 39. 134 Liste seiner sämtlichen Auftritte in Michael Scott, Caruso. Die Jahrhundertstimme, München 1993, S. 285 – 349. Es gibt erst wenige solcher Register ganzer Auftrittskarrieren, vgl. etwa für den bedeutendsten Belcanto-Bariton um die Jahrhundertwende: Chuilon, Mattia Battistini, S. 317 – 385. 135 Scott, Caruso, S. 37. Zur Oper in Kairo vgl. Adam Mestyan, From Private Entertainment to Public Education? Opera in the Late Ottoman Empire, 1805 – 1914. An Introduction, ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 123 Orients. Ganze Orchester begannen noch später zu reisen. Die Berliner Philharmoniker unternahmen ihre weiteste Vorkriegsreise 1899 nach Russland. Schon 1895 waren sie nach Wien gekommen; die Wiener Philharmoniker erwiderten den Besuch erst 1918. Nach dem Ersten Weltkrieg gastierten europäische Orchester zunächst in Lateinamerika, nicht vor dem Zweiten Weltkrieg auch in Asien. Die Wiener Philharmoniker fuhren 1956 erstmals nach Japan, 1959 nach Indien, 1973 nach China.136 VI. Technische Tonträger. Die Trennung von Klang und Person Die Pariser Weltausstellung von 1889 war ein in ganz Europa beachtetes und daher reich dokumentiertes Ereignis. Sie setzte die Musikwelt Klängen aus, die nicht länger ohne Bedenken als „primitiv“ oder „barbarisch“ abgetan werden konnten. Zu exakt derselben Zeit machte die Medienentwicklung erstmals Töne aus der Ferne in Europa hörbar. In Fortsetzung früheren Nachdenkens darüber, wie unsichtbare und flüchtige Schallwellen sichtbar und konservierbar gemacht werden könnten, erfand Thomas Alva Edison, damals bereits ein bekannter Konstrukteur telegraphischer Apparate, den Phonographen. Im Dezember 1877 gelang erstmals die Aufnahme und Wiedergabe von Schall durch ein Gerät, das akustische Schwingungen über einen Griffel auf eine mit Zinnfolie überzogene rotierende Walze übertrug.137 Ab 1888 war die Grundtechnologie für einen ausgereiften und serienmäßig herstellbaren Phonographen verfügbar, der nunmehr beschreibbare Wachszylinder und einen Elektromotor verwendete. Der neue Apparat, den Edison zunächst als Diktiergerät für den Bürogebrauch verstanden hatte, war transportabel. Im Prinzip konnte man nun überall in der Welt Klänge sammeln, sie speichern und sie an anderen Orten und zu anderen Zeiten wiedergeben. Die technische Weiterentwicklung über das Grammophon, die elektromagnetische Aufzeichin: Sven Oliver Müller u. a. (Hg.), Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa, Wien 2010, S. 263 – 276; Adam Mestyan, „A Garden with Mellow Fruits of Refinement“. Music Theatres and Cultural Politics in Cairo and Istanbul, 1867 – 1892, Diss. Central European University Budapest 2011, Kap. 5; El-Shawan, Western Music and Its Practitioners in Egypt, S. 144; Flores, Offenbach in Arabien. 136 Herta u. Kurt Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters, Orchester der Welt [1986], Wien 1992, S. 280 u. S. 284; Herbert Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biographie, Mainz 2007, S. 61 u. S. 69. 137 David L. Morton Jr., Sound Recording. The Life Story of a Technology, Baltimore, MD 2004, S. 5 – 10, die beste technologiegeschichtliche Einführung; daneben der Klassiker Roland Gelatt, The Fabulous Phonograph, 1877 – 1977, London 19772. Zu Deutschland umfassend: Stefan Gauß, Nadel, Rille, Trichter. Kulturgeschichte des Phonographen und des Grammophons in Deutschland, 1900 – 1940, Köln 2009. 124 Jürgen Osterhammel nung und die Glanzzeit der Vinylschallplatte in den 1960er Jahren bis zur Digitaltechnik bereicherte die akustischen und kommerziellen Möglichkeiten, änderte aber nichts am Grundprinzip der maschinellen Trennung des Klangs von seinen menschlichen Produzenten. Noch bevor der Phonograph zur Aufnahme europäischer Kunstmusik genutzt wurde, erkannten experimentelle Tonpsychologen und Ethnologen sein Potenzial. Die frühesten Aufzeichnungen der Gesänge nordamerikanischer Indianer mit einem Edison-Phonographen datieren aus dem Jahre 1890.138 Bereits wenige Jahre später liefen breit angelegte Aufnahmeprojekte in den USA und in den europäischen Kolonien an.139 1886 hatte der Philosoph, Psychologe und Musikforscher Carl Stumpf (1848 – 1936) die empirische Erforschung nichteuropäischer Musik angeregt.140 1904 veröffentlichten Stumpfs Schüler Erich Moritz von Hornbostel (1877 – 1935) und Otto Abraham (1872 – 1926) einen bahnbrechenden Aufsatz mit dem Titel „Über die Bedeutung des Phonographen für die Vergleichende Musikwissenschaft“.141 Die erste wichtige Sammlung technisch fixierter Klänge wurde 1899 eingerichtet, das Wiener Phonogramm-Archiv. 1900 gründeten Stumpf und von Hornbostel ein Phonogramm-Archiv in Berlin, das Hornbostel leitete, bis er 1933 in die Emigration gezwungen wurde.142 Nun war eine wahrhaft universale, zugleich naturwissenschaftliche Methoden nutzende Musikwissenschaft möglich geworden, die den abendländischen Kanon innerhalb größerer Zusammenhänge relativierte, auch wenn manche ihrer Vertreter unter evolutionstheoretischen Prämissen Europa einen gewissen Entwicklungsvorsprung zubilligten. Sie setzte der okzidental orientierten, geistesgeschichtlich, werkanalytisch und biographisch vorgehenden Musikgeschichte, prominent vertreten durch Hugo Riemann (1849 – 1919) in Leipzig,143 ein 138 Schriftliche Aufzeichnungen sind etwas älter. Zu einer wichtigen Quelle wurde die Leipziger Dissertation des Amerikaners Theodore Baker, „Über die Musik der nordamerikanischen Wilden“, die z. B. Edward McDowell zu „indianischen“ Kompositionen anregte. Vgl. Wild, Lieder der nordamerikanischen Indianer, S. 20 – 23. Einige der aufzeichneten Gesänge stammten aber aus den Hymnenbüchern christlicher Missionare: S. 28 u. S. 34. 139 Burkhard Stangl, Ethnologie im Ohr. Die Wirkungsgeschichte des Phonographen, Wien 2000, S. 67; Timothy Day, A Century of Recorded Music. Listening to Musical History, New Haven, CT 2000, S. 233, dort das Datum 1889; Erica Brady, A Spiral Way. How the Phonograph Changed Ethnography, Jackson, MS 1999. 140 Jobst Fricke u. Albert Wellek, Art. Stumpf, (Friedrich) Carl, in: MGG, Personenteil, Bd. 16 (2006), Sp. 228 – 231, hier Sp. 228. 141 Zeitschrift für Ethnologie 36. 1904, S. 222 – 233, auch in: Hornbostel Opera Omnia, Bd. 1, hg. v. Klaus P. Wachsmann u. a., Den Haag 1975, S. 183 – 222. 142 Ein kleiner Teil der Bestände dieser Archive ist heute auf CD zugänglich, etwa in der Serie „Historische Klangdokumente“ des Berliner Phonogramm-Archivs. 143 Vgl. Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought, Cambridge 2003. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 125 völlig neues wissenschaftliches Konzept entgegen, das sich methodisch an die vergleichende Sprachwissenschaft anlehnte und Forschungstechniken der Verhaltensbeobachtung und des exakten Messens nicht verschmähte. Fachpolitisch und institutionell vermochte sich der umfassende Ansatz von Stumpf, Hornbostel und Sachs allerdings nicht gegen die eurozentrische Prägung des Faches durchzusetzen.144 Ab ungefähr der Jahrhundertwende konnten Live-Darbietungen von Musik aller Art aufgezeichnet, gesammelt, archiviert und durch wiederholtes Abspielen studiert werden. Erstmals ließ sich nun unverschriftlichte Musik auf ein Speichermedium bannen. Die alte Abhängigkeit von unzureichenden Notationssystemen war damit gebrochen. Authentische Phonogramme von „Naturvölkern“, wie es damals hieß, wurden keineswegs zu Objekten westlicher Massenkultur.145 Aber Komponisten, die an der authentischen Musikproduktion der „Anderen“ interessiert waren, konnten sich fortan den Originalklängen viel unmittelbarer nähern als ihre Vorgänger, die auf notwendig unvollkommene Transkriptionen angewiesen waren. Es muss jedoch eingeräumt werden, dass sich die meisten von ihnen der neuen Möglichkeiten mit großer Zurückhaltung bedienten. Als Puccini 1920 mit der Arbeit an der Partitur seiner Oper „Turandot“ begann, bestand die Grundlage für seine akustischen Eindrücke vom Osten nicht in phonographischen Aufnahmen, sondern in einer Spieldose, die ein italienischer Diplomat aus China mitgebracht hatte.146 Zwar rückten der Phonograph und sein Nachfol144 Ein Grundtext ist Erich Moritz von Hornbostel, Die Probleme der vergleichenden Musikwissenschaft [1905], in: Hornbostel Opera Omnia, Bd. 1, S. 247 – 270. Zur schwachen fachlichen Verankerung und der Unterbrechung der vergleichenden Forschungsrichtung vgl. Pamela M. Potter, Die deutscheste der Künste. Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs, Stuttgart 2000, S. 219 – 224. Gute allgemeine Überblicke: Braun u. Finscher, Einleitung, S. 42 – 51; Dieter Christensen u. a., Art. Musikethnologie, in: MGG, Sachteil, Bd. 6 (1997), Sp. 1259 – 1291; Bruno Nettl u. Philip V. Bohlman (Hg.), Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology, Chicago 1991; Vanessa Agnew, The Colonialist Beginnings of Comparative Musicology, in: Eric Ames u. a. (Hg.), Germany’s Colonial Pasts, Lincoln, NE 2005, S. 41 – 60; Hansjakob Ziemer, Homo Europaeus Musicus. Musikwissenschaftler, Musik und kulturelle Identität im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, in: Lorraine Bluche u. a. (Hg.), Der Europäer – ein Konstrukt. Wissensbestände, Diskurse, Praktiken, Göttingen 2009, S. 33 – 57, hier S. 38 – 48. 145 Etwas anderes ist die ebenfalls mit der Schallplatte verbundene Entwicklung der Kategorie „ethnic music“. Vgl. etwa William Howland Kenney, Recorded Music in American Life. The Phonograph and Popular Memory, 1890 – 1945, New York 1999, S. 65 – 87. 146 Kii-Ming Lo, „Turandot“, S. 325; Über die breitere westliche Rezeption der chinesischen Melodie „Molihua“, die Puccini so faszinierte, vgl. Chen Tzu-Kuang, Chinesische Kultur in der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts. Modelle zur interkulturellen Musikpädagogik, Frankfurt 2006, S. 68 – 89. 126 Jürgen Osterhammel ger, das Grammophon, die Vision eines Archivs von „Weltmusik“ in den Horizont des Realisierbaren, doch waren die Folgen dieser buchstäblichen Horizonterweiterung für die europäische Kunstmusik einstweilen keineswegs dramatisch. Wenn nicht gerade Komponisten – wie die jungen Ungarn Bla Bartk (1881 – 1945), Zltan Kodly (1882 – 1967) und Lszl Lajtha (1892 – 1963) in Ungarn, Rumänien, der Türkei, auf dem Balkan und in Nordafrika oder der Australier Percy Grainger (1882 – 1961) im englischen Lincolnshire147 – selbst mit Aufnahmegeräten ins ethnographische Feld zogen, blieb die Chance, dass nichteuropäische Musik oder auch europäische Volksmusik in den Prozess musikalischer Schöpfung eingeschmolzen werden würden, relativ gering. Auch nach dem doppelten Realitätsschub der technischen Reproduktion und der Live-Aufführung nichteuropäischer Musik in Europa stellten nur eine kleine Zahl wichtiger Komponisten, etwa der Pole Karol Szymanowski (1882 – 1937), die Herausforderung durch das musikalisch Andere in den Mittelpunkt ihrer kreativen Arbeit. Einen ganz anderen globalen Effekt löste die neue Technik samt ihrer industriellen Verwertung dadurch aus, dass Musik über käufliche Abspielgeräte und Tonträger ins häusliche Wohnzimmer geholt werden konnte. Auch die Dokumentation europäischer Kunstmusik wurde nun möglich. Manche der ganz frühen Tondokumente sind so undeutlich, dass sie noch nicht einmal die Aura des Authentischen verströmen, so etwa eine Aufnahme vom Klavierspiel des alten Johannes Brahms, festgehalten kurz vor seinem Tod am 3. April 1897. Aber schon wenig später wurden technisch wesentlich bessere Aufnahmen möglich. Die frühesten Gesangsaufnahmen, die einen Originalklang erahnen lassen, stammen aus den Jahren ab 1902. Damals traten neben Jungstars wie Enrico Caruso mit seinen ersten Aufnahmen in Mailand im April 1902 auch einige Sängerveteraninnen und -veteranen des 19. Jahrhunderts, die noch mit Wagner oder Verdi zusammengearbeitet hatten, im reiferen Alter vor den Aufnahmetrichter : so etwa Adelina Patti (1843 – 1919), Lilli Lehmann (1848 – 1929) oder Francesco Tamagno (1850 – 1905).148 Der Geiger Joseph Joachim (1831 – 1907), der bereits mit dem 1847 verstorbenen Felix Mendelssohn-Bartholdy konzertiert hatte und mit Clara Schumann und Johannes Brahms befreundet gewesen war, kam 1903 ins Studio und dokumentierte eine Spieltechnik, die bald darauf als antiquiert betrachtet wurde.149 Aufnahmen 147 Vgl. Katie Trumpener, Bla Bartk and the Rise of Comparative Ethnomusicology. Nationalism, Race Purity, and the Legacy of the Austro-Hungarian Empire, in: Ronald Radano u. Philip V. Bohlman (Hg.), Music and the Racial Imagination, Chicago 2000, S. 403 – 434; Bob van der Linden, Percy Grainger and Empire. Kipling, Racialism, and all the World’s „Folk Music“, in: British Music 32. 2010, S. 13 – 24. 148 Scott, Caruso, S. 92 – 97; Gelatt, Fabulous Phonograph, S. 114 – 116. 149 Daniel Leech-Wilkinson, Recordings and Histories of Performance Style, in: Nicholas Cook u. a. (Hg.), The Cambridge Companion to Recorded Music, Cambridge 2009, S. 246 – 262, hier S. 251; zur Dokumentation Joachims und anderer Geiger um 1900 vgl. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 127 von passabler technischer Qualität – bei Pianisten seit etwa 1905 auch durch Lochstreifenklaviere möglich – schufen, unterstützt durch allmählich sinkende Preise, mit der Zeit einen Massenmarkt für „klassische“ Musik.150 Nicht nur in Europa und Nordamerika fanden Aufnahmen westlicher Musik Interessenten. Die „talking machine“, wie es lange Zeit offiziell hieß, ein Gerät, das sogar die Stimmen von Toten auszuspucken vermochte, wurde überall als ein Wunder bestaunt. In China wie in Indien, Ländern mit einem potenziell riesigen Publikum, lösten Phonograph und Grammophon eine Medienrevolution aus. Die amerikanischen und europäischen Grammophon-Gesellschaften nahmen diese beiden Märkte von einem frühen Zeitpunkt an ins Visier. Sie verkauften Wiedergabegeräte und Wachswalzen beziehungsweise Schallplatten mit Opernarien, gesungen von Stars wie Melba oder Caruso, oder kurzen Instrumentalstücken, die im Westen aufgenommen wurden. Schon ab 1889/90 wurden Abspielgeräte in Shanghai und Japan zum Kauf angeboten.151 Die Kundschaft fand sich unter einer wachsenden Mittelschicht in den großen Städten Indiens und Chinas. Das Grammophon im Wohnzimmer und Carusos Tenorstimme, wie sie aus einem riesigen Schallhorn drang, wurden zu Emblemen eines neuen, „modernen“, zum Westen offenen Lebensstils. Zu einem frühen Zeitpunkt schickten die großen Gesellschaften Aufnahmetechniker in die Länder des Ostens, um einheimische Musik in asiatischen Umgebungen aufzuzeichnen. Schon 1902 entsandte Gramophone & Typewriter Limited den jungen Fred Gaisberg (1873 – 1951), einen klangtechnisch versierten und diplomatisch geschickten Pianisten, der wenige Monate zuvor in Mailand die ersten Aufnahmen Carusos realisiert und überall in Europa Sängertöne eingesammelt hatte, auf eine große Asienreise. Gaisberg und sein Team erhielten den Auftrag, örtliche – etwa tatarische, indische, burmesische oder chinesische – Musik aufzuzeichnen und kommerziell verwertbar zu machen.152 Dies hatte mit den wissenschaftlichen Interessen der frühen Ethnomusikologen wenig zu tun. Vielmehr ging es darum, einheimische Märkte für Schallträger mit „nationaler“ indischer oder chinesischer Musik zu erschlieMark Katz, Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Berkeley, CA 2004, S. 85 – 97. 150 Vgl. den Überblick über die technische Erschließung des Repertoires bei Day, A Century of Recorded Music, Kap. 2. Ein breiterer kultursoziologischer Ansatz bei David Suisman, Selling Sounds. The Commercial Revolution in American Music, Cambridge, MA 2009. Vgl. auch Gauß, Nadel; Andre Millard, America on Record. A History of Recorded Sound, Cambridge 20052. 151 Andreas Steen, Zwischen Unterhaltung und Revolution. Grammophone, Schallplatten und die Anfänge der Musikindustrie in Shanghai, 1878 – 1937, Wiesbaden 2006, S. 69, eine vorbildliche Studie zur globalen Schallplattengeschichte. 152 Ebd., S. 58 ff.; Farrell, Indian Music and the West, S. 114 – 119; Pekka Gronow u. Ilpo Saunio, An International History of the Recording Industry, London 1998, S. 11 f. 128 Jürgen Osterhammel ßen; auch die Bewohner amerikanischer Chinatowns wurden bereits als Kunden ins Visier genommen. Da Leute wie Gaisberg so gut wie nichts über asiatische Musik wussten und umgekehrt indische oder chinesische Musiker völlig unvorbereitet vor der neuen Technik standen, war dieses Unternehmen mit allen nur denkbaren Anfangsschwierigkeiten behaftet. Aber bald wurde klar, dass ein neues Kapitel der auditiven Kulturgeschichte begonnen hatte. Für asiatische Musiker öffneten sich neue Tätigkeitsfelder und Märkte jenseits fürstlicher oder staatlicher Patronage; generell hob sich ihr sozialer Status. Ausübende, die diese kurzen Formate meisterten, profitierten von den neuen Möglichkeiten, während die früher hoch angesehenen Meister traditionaler Formen ins Hintertreffen gerieten.153 Neue überlokale Stars stiegen auf, so etwa die Sängerin Gauhar Jan (ca. 1875 – 1930), die Vertreterin eines Stils, den man im indischen Zusammenhang als „light classical“ bezeichnen könnte.154 Die Hierarchie der Wertschätzung musikalischer Gattungen verschob sich. Lange fassten Grammophonseiten maximal viereinhalb Minuten Musik. Ebenso wie dies in Europa die typische Opernarie begünstigte, so traten in asiatischen Ländern knappe Liedformen vor ausgedehnten instrumentalen Improvisationen in den Vordergrund. Neue Konzepte von dem, was „indische“ oder „chinesische“, also „nationale“ Musik sei, wurden nun diskutiert. Das Konzept solcher „nationalen“ Musik verdankte seine Existenz überhaupt erst dem Zusammenfluss von frühem Nationalismus und der Technologie und Ökonomie massenhaft produzierten Klangs. Westliche Technik und westliche Geschäftsmethoden ließen Traditionen einer rein indigenen Musik wieder aufleben oder gar erst entstehen. Und von Anfang an stand der Anspruch herausfordernd im Raum, die „seriöse“ europäische Kunstmusik sei der zivilisierte und allgemeine Maßstab aller Dinge, die lokale Musik hingegen partikulare Folklore.155 153 Für China vgl. Steen, Zwischen Unterhaltung und Revolution; Andrew F. Jones, Yellow Music. Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age, Durham, NC 2001, S. 53 – 72; für Indien: Farrell, Indian Music and the West, S. 111 – 143; Stephen P. Hughes, The „Music Boom“ in Tamil South India. Gramophone, Radio and the Making of Mass Culture, in: Historical Journal of Film, Radio and Television 22. 2002, S. 445 – 473. Über Nationalismus und Musikpolitik vgl. Janaki Bakhle, Two Men and Music. Nationalism in the Making of an Indian Classical Tradition, Oxford 2005 (diesen Hinweis verdanke ich Harald Fischer-Tin); Pamela Moro, Constructions of Nation and the Classicisation of Music. Comparative Perspectives from Southeast and South Asia, in: Journal of Southeast Asian Studies 35. 2004, S. 187 – 211. 154 Farrell, Indian Music and the West, S. 118 – 120. Vgl. auch die Bemerkungen von Peter Manuel im Booklet zu einer CD mit indischen Grammophonaufnahmen ab 1906: Vintage Music from India. Early Twentieth-century Classical and Light-classical Music, Rounder Records 1993. Für weitere Erläuterungen danke ich Anil Bhatti. 155 So, etwas übertreibend, Karl Miller, Talking Machine World. Selling the Local in the Global Music Industry, 1900 – 1920, in: Anthony G. Hopkins (Hg.), Global History. Interactions Between the Universal and the Local, Basingstoke 2006, S. 160 – 190. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 129 VII. Schluss Um 1930 waren Grundmuster eines globalen Musikmarktes entstanden. Genauer gesagt, waren es mindestens zwei Märkte: Erstens gab es nun eine Topographie des Opern- und Konzertbetriebs, die sämtliche Kontinente umfasste und die durch die Mobilität international agierender Musiker zusammengehalten und verwoben wurde. Zweitens führte die frühe Nutzung der Phonographie durch grenzüberschreitend tätige Konzerne dazu, dass konservierter Klang jene Kunden und Hörer erreichen konnte, denen der Zugang zu Aufführungen fehlte. Diese Entlokalisierung von Vokal- und Instrumentalklängen machte europäische Töne in Asien oder brasilianische Töne in Nordamerika wahrnehmbar. Als Folge der medialen Revolution auditiver Reichweiten stellt sich die Frage nach der ästhetischen Entgrenzung von Musik, also nach der fortdauernden Stabilität des kulturellen Komplexes „europäische Musik“. Die Antwort darauf muss nahe an die Gegenwart heran führen. Im Verlauf musikalischer Globalisierung nahm die Bedeutung ferner Ursachen und Einflüsse zu. Europäische Musik, die in neue kulturelle und soziale Zusammenhänge verpflanzt wurde, erfuhr dabei nur geringe Veränderungen. Die Partituren wurden nicht in einer solchen Weise indigenisiert, wie sich umgekehrt westliche Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts Freiheiten mit östlichem Material genommen hatten. Heute werden überall auf der Welt die Werke der westlichen Kunstmusik getreu nach den Notentexten aufgeführt. Das auch in Europa erst im 20. Jahrhundert – etwa durch die Proben- und Dirigierpraxis Toscaninis – verbindlich gewordene Ideal der Texttreue wird sorgsam beachtet. Die Aufführungstechniken sind im Prinzip überall dieselben. Koreanische Geiger gehen mit ihren Instrumenten in der derselben Weise um wie ihre westlichen Kollegen. Die gesamte soziale Konfiguration, die sich im 19. Jahrhundert um „klassische“ Musik gelagert hatte, wurde im Paket mit dieser Musik in außereuropäische Länder exportiert, damit zugleich auch meist der in Europa übliche Kanon von „großen Werken“. Opernhäuser funktionieren in aller Welt nach denselben Mechanismen. In öffentlichen Konzerten in Tokyo oder Shanghai werden dieselben Verhaltensnormen und Rituale beachtet wie in Europa oder Nordamerika. Während der etwa vier Jahrhunderte ihrer Existenz und mindestens bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich die europäische Musik, zunehmend von der Kirche emanzipiert und seit Beethoven und den ihn fördernden Kritikern die „absolute“ Instrumentalmusik an die Spitze der kulturellen Hierarchie stellend, als ein relativ hermetischer kultureller Komplex erwiesen. Die europäische Expansion in der Welt durch Handel und Eroberung, Reisen und Mission hat an dieser grundsätzlichen Tatsache wenig geändert, der Exotismus die Musikgeschichte bereichert, aber nicht revolutioniert.156 Bis zum Ende des 156 Das könnte auch an der erstaunlich begrenzten Rezeption des Jazz in der „ernsten“ Musik vor etwa 1950 gezeigt werden. 130 Jürgen Osterhammel 19. Jahrhunderts blieb die Bekanntschaft mit nichteuropäischer Musik begrenzt und dem Zufall überlassen. Obwohl zeitweise, insbesondere in Frankreich, Anleihen bei nichteuropäischen musikalischen Idiomen gemacht wurden, unterlagen diese stets einer radikalen Verwestlichung und blieben an der dekorativen Oberfläche der musikalischen Textur. Sie wurden niemals so weit einbezogen, dass sie im Stande gewesen wären, die Harmonien, Rhythmen und Formschemata, welche die westliche Tradition definierten, außer Kraft zu setzen. Um 1890 wurde erstmals eine gegenstandsnahe Kenntnis nichteuropäischer Musik technisch möglich. Ungefähr gleichzeitig mit der für die europäische Kunst folgenreichen Rezeption japanischer Holzschnitte oder afrikanischer Plastik schien die Entdeckung des Ostens und des Südens einen Weg aus der Krise der westlichen Musik im Zeitalter einer überreifen Spätromantik zu weisen. In musikgeschichtlich beispiellosen Umfang wurde frische Inspiration außerhalb der ästhetischen Sphäre des Westens gesucht. Die Jahre um die Jahrhundertwende von 1900, als Debussy, Mahler, Puccini, Richard Strauss („Salom“, 1905) oder Igor Stravinskij in seiner Ballett-Periode vor dem Ersten Weltkrieg sich mit dem Exotischen in seiner orientalischen ebenso wie in seiner folkloristischen Gestalt ernsthaft auseinandersetzten, bildeten, gleichzeitig mit der Zeit des Hochimperialismus, den Extrempunkt ästhetischer Inklusion. Lawrence Kramer hat die bedenkenswerte Vermutung geäußert, der – nicht nur musikalische – Exotismus sei im Zeitalter der Kolonialwaren und des Transfers großer Mengen asiatischer und afrikanischer objets d’art in die Museen und bürgerlichen Salons des Westens eine Form des Konsums des Fremden gewesen.157 Allerdings wirkte der Exotismus nicht traditionsbildend, und nach 1918 wurde in Europa das Konsumklima rauer. Die klassische Moderne jenseits der Spätromantik, wie sie Arnold Schönberg und seine Zweite Wiener Schule, der strenge Stravinskij der Nachkriegszeit oder Komponisten wie Bla Bartk und der franko-amerikanische Individualist Edgar Varse (1883 – 1956) schufen, wurde weder auf Inklusion (Exotismus) noch auf Pluralismus (dem Programm einer multikulturellen Weltmusik) aufgebaut. In der musikalischen ebenso wie der musiktheoretischen Sprache der künstlerischen Revolution erlebte die Selbstbezogenheit der großen europäischen Tradition eine Art von Wiederauferstehung.158 Allerdings ging dies zumindest in den zwanziger Jahr da und dort mit dem Willen einher, durch einen möglichst weit gefassten Musikbegriff künstlerisch zur Versöh- 157 Lawrence Kramer, Consuming the Exotic. Ravel’s „Daphnis et Chlo“, in: ders., Classical Music and Postmodern Knowledge, Berkeley, CA 1995, S. 201 – 225, bes. S. 204. 158 Zur Rezeption afrikanischer Musik (die in diesem Beitrag unbeachtet bleiben muss) vgl. Florian Carl, Was bedeutet uns Afrika? Zur Darstellung afrikanischer Musik im deutschsprachigen Diskurs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Münster 2004. ipabo_66.249.66.96 Globale Horizonte europäischer Kunstmusik 131 nung der Völker beizutragen, so etwa 1927 in der Frankfurter Ausstellung „Musik im Leben der Völker“.159 Der Klassikerkanon und seine soziale Einbettung zeigen eine in der neuzeitlichen Kulturgeschichte seltene Stabilität und Konsistenz. Westliche Musik hat die Welt „kolonisiert“ und sich dabei wenig verändert. Neuansätze lassen sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten. Zum ersten Mal fanden Komponisten wie der Japaner Tōru Takemitsu (1930 – 1996) und die Koreaner Isang Yun (1917 – 1975) und Nam June Paik (1932 – 2006)160 Zugang zum Pantheon „ernster“ Musiker von globaler Geltung. Noch berühmter waren und sind asiatische Interpreten westlicher Klassik wie der indische Dirigent Zubin Mehta (geb. 1936), der Cellist Yo-Yo Ma (geb. 1955), ein in Paris geborener Sohn chinesischstämmiger Eltern, oder der aus der Mandschurei stammende Pianist Lang Lang (geb. 1982). In den 1950er Jahren besuchte der Violinvirtuose Yehudi Menuhin (1916 – 1999) Indien und fand sich mit dem SitarMeister Ravi Shankar (geb. 1920) zu einer engen künstlerischen Partnerschaft zusammen. Der Höhepunkt ihres gemeinsamen Musizierens war 1966 erreicht, als sich Shankar und Menuhin zu öffentlicher Improvisation trafen.161 Eine andere Neuheit der letzten Jahre ist das Konzept der „Weltmusik“, ein spätes Echo auf Goethes Programm der „Weltliteratur“. Es baut auf Ideen auf, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Erich Moritz von Hornbostel und anderen Pionieren der Musikethnologie formuliert worden waren: eine Abflachung kultureller Hierarchien, ein strikter ästhetischer Relativismus, für den jede Musikkultur von gleichem Wert ist, Verzicht auf eine teleologische Konstruktion der Musikgeschichte und die Freiheit, mit hybriden Formen und Idiomen zu experimentieren.162 Mit der Erschöpfung der Avantgarde ist die große Tradition westlicher Musik als kreativer Prozess möglicherweise (im Sinne Richard Taruskins) an ihr Ende gelangt. Dem steht die ungebrochene weltweite Beliebtheit der „großen“ Werke aus der europäischen Vergangenheit gegenüber. Weltmusik lässt solche Musealisierung zu. Sie selbst ist keine eigene Musiksprache oder Musikkultur, sondern ein allgemeiner Rahmen, der alle Arten musikalischer Äußerung mit Legitimität versieht. Kritiker wenden freilich ein, dass ein solch multikulturelles Generalkonzept die Besonderheit 159 Hansjakob Ziemer, Die Moderne hören. Das Konzert als urbanes Forum, 1890 – 1940, Frankfurt 2008, S. 239 – 255; ders., Homo Europaeus Musicus, S. 48 – 52. 160 Paik ist auch als Videokünstler bekannt. 161 Peter Lavezzoli, The Dawn of Indian Music in the West, New York 2006, S. 43 – 64. 162 Vgl. Philip V. Bohlman, World Music at the „End of History“, in: Ethnomusicology 46. 2002, S. 1 – 32; auch ders., World Music. A Very Short Introduction, Oxford 2002; Jonathan Stock, Peripheries and Interfaces. The Western Impact on Other Cultures, in: Nicholas Cook u. Anthony Pople (Hg.), The Cambridge History of Twentieth-century Music, Cambridge 2004, S. 18 – 39. Wie neu für die Musikwissenschaft das Konzept der „Weltmusik“ ist, zeigt sich daran, dass MGG es erst im Supplementband von 2008 berücksichtigte (Artikel von Max Peter Baumann, Sp. 1078 – 1097). 132 Jürgen Osterhammel lokalen Musikmachens dann verschleift, wenn es den little traditions nicht gelingt, die Aufmerksamkeit transnationaler Medienkonzerne zu finden.163 So stellt sich genau hundert Jahre nach der Niederschrift von Max Webers Skizze zur Musiksoziologie erneut die damals formulierte Frage nach dem Schicksal lokaler und „exotischer“ Musikformen im Zeitalter der „rapiden Ausbreitung der europäischen Kultur“ (Erich Moritz von Hornbostel) und des „Kapitalismus“ (Max Weber).164 Die Antwort dürfte ambivalenter ausfallen als die düsteren Prognosen am Fin de sicle: Der globale Medienkapitalismus hat die „universelle Bedeutung und Gültigkeit“ (Weber) der europäischen Kunstmusik zum erfolgreichen Geschäftsprinzip erhoben und zugleich mit dem Konzept einer pluralisierten „Weltmusik“ einen Markt für zahllose Sonderbedürfnisse geschaffen, für Avantgarde und lokale Folklore, für Mozart und Madonna. Prof. Dr. Jürgen Osterhammel, Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Postfach 6, D-78457 Konstanz E-Mail: [email protected] 163 Vgl. etwa das Themenheft „Indigenous Peoples, Recording Techniques, and the Recording Industry“ der Zeitschrift The World of Music 49. 2007. 164 Hornbostel, zit. nach Braun u. Finscher, Einleitung, S. 50. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper Die Macht des historischen Erbes der Oper am Ende des 20. Jahrhunderts von Sarah Zalfen* Abstract: A broad range of buildings and formal contexts of behaviour were developed in past centuries in order to perform and perceive music adequately. This article focuses on the way in which music was institutionalised, and refers in particular to the attempted reforms of opera houses in the late twentieth century. The operatic repertoire, the opera house as social space, and the opera as an arena of political performance show that the processes by which music was institutionalised do not follow a linear pattern of alternating change and consolidation. Instead, they produce institutional effects which can be described as feedback loops, oscillating between historically habitualized practices, with their sets of norms and rules, and the new and continually changing configurations in which they find expression. I. Die Institutionalisierung des Ephemeren Die Bedeutung der Kunstmusik in der Kultur Europas ist nicht zuletzt ein Produkt ihrer Institutionalisierung. Musik braucht Institutionen, Musik schafft Institutionen, und Musik erhält Institutionen. Orchester, Opernhäuser und Konzerthallen, Musikvereine, Kapellen und freie Ensembles, Abonnements, Clubs und Plattenlabels bilden die Orte der Aufführung und Überlieferung von Musik und oft auch ihrer Speicherung. Um diese Funktionen zu erfüllen, sind in den vergangenen Jahrhunderten ebenso zahllose Bauten zur Darbietung von Musik entstanden wie formale Kontexte, um die angemessene Aufführung und Rezeption von Musik zu organisieren und zu praktizieren. Doch wie verläuft dieser Prozess der Institutionalisierung? Und wie trägt die Kunstform Musik zu der charakteristischen Art ihrer Institutionalisierung bei? Das sind die beiden zentralen Fragen, die in diesem Beitrag diskutiert werden sollen. Dabei wird ein erweiterter Institutionenbegriff verwendet, der sich nicht auf die Untersuchung von Institutionen als zweckbezogene Einrichtungen beschränkt, zu denen unter anderem Musikrecht, Tarifverträge, Musikverlage und Konzertagenturen, also alle Instanzen gehören, die an der Produktion, * Für sachkundige Lektüre und konstruktive Hinweise danke ich Sabine Hering, Sven Oliver Müller, Jürgen Osterhammel und Iris Törmer. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 133 – 157 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X 134 Sarah Zalfen Verbreitung, Rezeption und Verarbeitung von Musik mitwirken.1 Es soll auch geprüft werden, welche von der Musik beziehungsweise der musikalischen Aufführung selbst erzeugten Verhaltensformen und Vorstellungen sozialer Wirklichkeit als Elemente der Institutionenbildung definiert werden können.2 Für diesen Zugang spricht der gängig gewordene Ansatz, Institutionen als Regelsysteme zu verstehen, die soziales Verhalten und Handeln durch ihre normative Geltung koordinieren und konditionieren. Praktiken und Wissen verfestigen sich in wiederholten, habitualisierten Handlungen und hegen dynamische soziale Prozesse in erlernbaren Erwartungen, Ordnungen, Ritualen und Vorschriften ein. Damit werden sie gesellschaftlich und überzeitlich wirkungsmächtig. „Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution.“3 So lautet die berühmte Definition von Peter L. Berger und Thomas Luckmann. Wie passt dieser Ansatz zum scheinbar ephemeren Charakter der Musik, die im Hier und Jetzt entsteht und im nächsten Moment vergangen ist? Musik erklingt und verklingt im gegenwärtigen Augenblick, sie ist eine – beinahe – ausschließlich an ihre performative Ausführung gebundene Kunst und daher der ständigen Erneuerung und der immer wieder vollzogenen Vergegenwärtigung unterworfen. Sie ist weniger als etwas Aufgeführtes zu verstehen denn als eine Aufführung (performance),4 welche die Vergangenheit, in der die Musik entstanden ist, mit der Gegenwart verbindet. Damit rückt nicht die Musik als Text, sondern als eine soziale Praxis in den Fokus – der Vergangenheit ebenso wie einer jeweiligen Gegenwart. Institutionalisierung wird durch eine ständige Erneuerung der durch die Aufführung der Musik vergegenwärtigten Vergangenheit hergestellt und interpretativ stabilisiert.5 1 Arnold Jacobshagen, Musikgeschichte als Institutionengeschichte, in: ders. u. Frieder Reininghaus (Hg.), Musik und Kulturbetrieb. Medien, Märkte, Institutionen (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 10), Laaber 2006, S. 145 – 149, hier S. 149. 2 Art. Organisation/Institution, in: Helga de la Motte Haber u. a. (Hg.), Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft, Laaber 2010, S. 359. 3 Peter L. Berger u. Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt 1970, S. 58. 4 Nicholas Cook, Between Process and Product. Music and/as Performance, in: Music Theory Online. The Online Journal of the Society for Music Theory 7. 2001, S. 2; Vgl. Erika Fischer-Lichte, Performativität und Ereignis, Tübingen 2003; dies., Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2004. 5 Freilich unterliegt grundsätzlich auch das (Sprech)theater diesen performativen Kriterien. Es weist jedoch zwei fundamentale Unterschiede auf: Der eine basiert auf dem Umstand, dass der Text eines Theaterstücks, anders als der Notentext einer Partitur, auch ohne seine dramatische Form als Drama rezipiert werden kann; die Musik verlangt fasst immer die Interpretation, um in ihrem Charakter erkennbar zu werden. Zweitens gilt für die soziale Reichweite des institutionalisierten Ereignisses einer ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 135 Dieser Grundgedanke soll anhand von Auseinandersetzungen verfolgt werden, mit denen die institutionellen Veränderungen der Oper an zahlreichen Orten Europas am Ende des 20. Jahrhunderts einhergingen. Die vielfältigen Opernformen, die im 18. und 19. Jahrhundert entstanden, erfuhren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine bemerkenswerte organisatorische Vereinheitlichung: Die Hofopern, die städtischen und privaten Opernhäuser, die reisenden Opernensembles und Festopern – sie endeten spätestens nach 1945 fast ausnahmslos in der Obhut des Staates. Das finanzielle Risiko ihres Betriebs wurde vom Fürstenhof auf die Gesamtgesellschaft verteilt, das Musiktheater durch eine kulturpolitische Regulierung in neue Legitimationszusammenhänge gestellt.6 Den Opernbetrieb sicherten fortan hohe Subventionen, gestützt durch einen politisch begründeten Bildungsauftrag, der den Zugang aller Schichten der Bevölkerung zur Oper gewährleisten sollte. Nach 1980 wurde diese Neuformierung der Oper jedoch auf die Probe gestellt – ein Vorgang, der am Beispiel der Opernhäuser dreier europäischer Musikmetropolen (Paris, Berlin und London) dargestellt werden soll. In diesen drei Städten, wie auch an zahlreichen anderen Opernhäusern Europas zu jener Zeit, wurden umfassende Reformen konzipiert und teilweise auch umgesetzt, die darauf abzielten, die Einrichtungen den ökonomischen Restriktionen ebenso wie den sozialen Herausforderungen und den Maßstäben der kulturellen Produktion der Gegenwart anzupassen. Es galt der Pluralisierung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse des Publikums Rechnung zu tragen, das Marktversagen des Opernbetriebs zu kompensieren und die etablierten Institutionen des Musiktheaters inmitten der Ästhetik, Omnipräsenz und Schnelligkeit der Medialisierung zu behaupten.7 Auch andere Instanzen des Kulturbetriebs mussten sich in diesem Zeitraum Reformen unterziehen, sich verändern und anpassen. Doch keine musikalische Gattung oder Kunstform wies in dieser Zeit so sichtbar Beharrlichkeit und Schwerfälligkeit, feste Rituale, etablierte soziale Räume und prestigereiches Wissen auf wie die Oper. Die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung der Theater- oder Musiktheateraufführung, dass zwar Bauten für Theater, Tanz und Musik sich parallel und ihn ihrem Aufbau sehr ähnlich entwickelt haben. Doch die spezifische Übertragung der Theatralität der Bühne auf den Zuschauerraum – die in der obligaten Königs- oder Fürstenloge als Teil des performativen Akts oder als Blickpunkt des einzig idealen Betrachtes gipfelt, die wiederum Ausgangspunkt für die soziale Funktion des Zuschauerraums ist – ist für die Oper spezifisch. Vgl. Ulrike Haß, Das Drama des Sehens. Auge, Blick und Bühnenform, München 2005. 6 Vgl. Rudolf Klinger, Braucht der Staat die Oper? Braucht die Oper den Staat?, in: Politische Studien 48. 1998, S. 76 – 82; Bernard Bovier-Lapierre, Die Opernhäuser im 20. Jahrhundert, in: Jacobshagen u. Reininghaus, Musik und Kulturbetriebe, S. 231 – 256, hier S. 248. 7 Vgl. Sarah Zalfen, Staats-Opern? Der Wandel von Staatlichkeit und die Opernkrisen in Berlin, London und Paris am Ende des 20. Jahrhunderts, Wien 2011, S. 17 – 23. 136 Sarah Zalfen geplanten Opernreformen auftraten, und die Hartnäckigkeit, mit der sich die Oper diesen zu widersetzen vermochte, verweisen auf die Stabilität der historischen Schichten ihrer institutionellen Geschichte. Diese Widerständigkeit macht deutlich, dass die Institution Oper sich keinesfalls darin erschöpft, einen Betrieb zu repräsentieren, der als juristische Person in einem Gebäude untergebracht ist, von einer künstlerischen und technischen Spitze verwaltet wird und zahlreiche Beschäftige dafür entlohnt, allabendlich ein Produkt auf die Bühne zu bringen, für dessen Konsum andere Menschen Geld ausgeben. Dieser Betrieb, der auf den ersten Blick die „eigentliche“ Institution Oper darstellt, bildet nur die Hülle jener wirkungsmächtigen Regelsysteme, die sich in ihrem Inneren institutionalisiert haben. Diese Regelsysteme beginnen dort, wo sich in Form einer Partitur aus Noten und Text ein Werk behauptet und dann als Kunstform mit Musik, Gesang und Bühnengeschehen aufgeführt wird. Die sich wiederholenden Aufführungen und ihre technischen und organisatorischen Bedingungen sowie die kommunikativen und repräsentativen Bedürfnisse der Rezeption schaffen den Rahmen, in dem das Werk gespielt wird. Sie institutionalisieren sich im Opernhaus, und zwar zugleich als Gebäude und als Organisationsform. In diesem Rahmen manifestiert sich die Oper schließlich als ein kultureller Typus, der als kollektive Errungenschaft eine Projektionsfläche für Identifikation und Ablehnung schafft und als Ereignis wiederum neue spezifische Praktiken der Rezeption und Kommunikation hervorbringt, die ihrerseits neue Ästhetiken und Rahmenbedingungen erschaffen.8 In diesem Kreislauf, der als Institutionalisierung der Musik bezeichnet werden kann, findet ein ständiger Transfer vergangener Ästhetiken, Strukturen und Praktiken in die jeweilige Gegenwart und zugleich eine Anpassung an die Veränderungen der (sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen) Umwelt statt. Auch in der betrieblichen Struktur eines Opernhauses sind viele Reminiszenzen an seine Geschichte zu finden. Doch bilden diese nicht die eigentliche Institution im oben definierten Sinne. Sie repräsentieren vielmehr die Organisation, die aus den institutionalisierten Formen der musikalischen Aufführung und dem Ereignis Oper hervorgegangen ist. Beispielhaft wird dies an der Kostenstruktur von Opernhäusern deutlich, welche als Inbegriff der institutionellen Probleme der Oper gilt:9 War die Oper um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein geeignetes Unternehmen, um einen Impresario reich zu machen, wurde sie 100 bis 150 Jahre später mit bis zu 85 Prozent ihrer Ausgaben von der öffentlichen Hand subventioniert. Betrachtet man die Hintergründe dieser Entwicklung, so wird deutlich, dass Kosten- und 8 Vgl. Silke Leopold u. Dörte Schmidt, Art. Oper, in: Ludwig Finscher (Hg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik (fortan MGG), Supplement-Band, Kassel 20082, S. 623 – 646. 9 Vgl. Manfred Jochum u. Isolde Schmid-Reiter (Hg.), Teure Kunstform Oper? Musiktheater im neuen Jahrtausend. Strategien und Konzepte, Innsbruck 2006. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 137 Finanzierungsstrukturen nicht die unmittelbare Eigenart der Institution Oper bilden, sondern eher eine Konsequenz der spezifischen musikalischen Prozesse der Vergegenwärtigung durch ihre Aufführung und ihren Konsum sind. Für die Analyse der Kostenstruktur der Oper kann das als „Baumolsche Kostenkrankheit“ berühmt gewordene Theorem zugrunde gelegt werden, das die amerikanischen Ökonomen William J. Baumol und William G. Bowen 1966 aufgestellt haben. Dieses besagt, dass die generelle Entwicklung der Arbeitsprozesse und der Preise die Kosten des Musiktheaterbetriebs in die Höhe getrieben haben, ohne dass ausgleichende Effizienzsteigerungen möglich waren.10 Die Beobachtungen der beiden Wirtschaftswissenschaftler zeigen, dass die Steigerung der Produktivität im Laufe des 20. Jahrhunderts die Arbeitskosten, aber auch die Produktion von Waren generell hat steigen lassen. Inflationsbereinigt seien deswegen die meisten Produkte billiger, die der darstellenden Künste jedoch teurer geworden. Verliefen die Produktivitätsentwicklungen in der Musik ähnlich wie in der Landwirtschaft, so hat es Hans Abbing pointiert zusammengefasst, dann würden heute nicht mehr vier Musiker ein Haydn-Quartett spielen, sondern nur einer täte dies und das im doppelten Tempo.11 Verdis „Gefangenenchor“ lässt sich ebenso wenig einfach halbieren wie die Orchesterbesetzung von Richard Strauss’ „Elektra“; eine Bravourarie kostet noch immer die gleiche Kraft wie zum Zeitpunkt der Uraufführung, und auch an modernen Schnürböden hängen immer noch weitgehend handgefertigte Kulissen. Das heißt: die unveränderte Art und Weise, in der Musik im Theater dargeboten und rezipiert wird – nämlich live, in festgelegten, meist großen Besetzungen, auf professionellem Niveau, in angemessenen Gebäude – interferiert mit den Veränderungsprozessen, die andere Wirtschaftsbereiche durchlaufen haben und unterscheidet sich daher signifikant von deren Entwicklung.12 Sie ist an die Oper als Aufführung gekoppelt, nicht an die 10 Vgl. William J. Baumol u. William G. Bowen, Performing Arts. The Economic Dilemma. A Study of Problems Common to Theatre, Opera, Music and Dance, New York 1966; aktueller und zu einzelnen Aspekten und Ländern vgl. Clemens Hoegl, Das ökonomische Dilemma. Musik um welchen Preis? in: Jacobshagen u. Reininghaus, Musik und Kulturbetrieb, S. 166 – 177. 11 Hans Abbing, Why are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam 2002, S. 150. 12 Der Blick auf die Entwicklung während des 20. Jahrhunderts demonstriert, wie rasant die Kosten seit seinem Beginn gestiegen sind und macht deutlich, warum das staatliche Finanzierungssystem gegen Ende des Jahrhunderts an seine Grenzen gestoßen ist: An der Pariser Oper etwa hat sich das Budget für die Mitarbeiter zwischen den 1880er Jahren und den 1980er Jahren inflationsbereinigt mehr als vervierfacht, während die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen ist. Der Zuschuss an die Londoner Opernhäuser stieg, ebenfalls unter Berücksichtigung der Inflation, allein zwischen 1950 und 1987 fast um das Neunfache. Vom Beginn der öffentlichen Musiktheaterförderung in Deutsch- 138 Sarah Zalfen besonderen politischen, sozialen oder geographischen Rahmenbedingungen, denen diese Aufführung unterliegt. Wie die Kostenstruktur, so sind die meisten Formationen und Verfahren in der Oper nur Ausdruck der institutionalisierten Musik. Sie sind als Organisation die Träger, welche zur Erhaltung ihrer Legitimation die institutionellen Strukturen regeln und reproduzieren.13 Die betriebliche Hülle der Oper verleiht ihnen eine prinzipielle Stabilität, sagt aber über die spezifischen Formen der Institutionalisierung in ihrem Inneren wenig aus. Anhand drei unterschiedlicher Formen der Institutionalisierung von Musik sollen im Folgenden institutionalisierte „Atavismen“ untersucht werden, das heißt am Ende des 20. Jahrhunderts präsente historische Entwicklungsmomente, auf welche die Reformen der Oper gestoßen sind. Damit soll erhellt werden, wie deren institutionellen Entwicklungsprozesse verlaufen sind und welche Folgen sie hatten. Zunächst wird die Institutionalisierung von Musik im Prozess der Repertoirebildung betrachtet: Es wird gefragt, aus welchen Praktiken sich die Maßstäbe abgeleitet haben, welche Opern in den „Kanon“ eingehen sollten und welche nicht. Hier steht das Repertoire als kulturpolitisches Instrument der Berliner Opernlandschaft nach der deutschen Vereinigung im Vordergrund (II). Im Anschluss daran rückt der soziale Raum Oper als ein zentraler Ort der Habitualisierung in den Blick: Es wird gefragt, welche Merkmale innergesellschaftlicher Machtbeziehungen sich in der Oper erfassen und abbilden lassen. Anhand der Renovierung des Londoner Opernhauses Mitte der 1990er Jahre wird dieser Aspekt beispielhaft erörtert (III). Es folgt schließlich die Betrachtung der Oper als Herrschaftsinstitution: Warum können auch Staatsoberhäupter im späten 20. Jahrhundert von den in der monarchischen Repräsentationskunst Oper angelegten Strategien der Selbstdarstellung profitieren? Dies wird am Beispiel des Neubaus der Opra-Bastille in Paris in den 1980er Jahren und ihrer Einweihung zur Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution verdeutlicht (IV). Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei jeweils auf dem Vexierspiel zwischen den Diskussionen und Problemen am Ende des 20. Jahrhunderts und den verschiedenen historischen Schichten, auf denen Oper bis heute basiert. Auf diese Weise werden die zeitlichen Bezüge sichtbar, die durch die Institution Oper hergestellt werden und die sich oftmals über mehrere Jahrhunderte spannen. land im Jahr 1889 bis 1975 wuchsen die Ausgaben der Operntheater um das neuntausendfache in Relation zum Lebenshaltungsindex. Vgl. Maryvonne de Saint Pulgent, Le syndrome de l’Opra, Paris 1991, S. 47 und S. 136; Francis Donaldson, The Royal Opera House in the Twentieth Century, London 1988, sowie Forschungsinstitut für Musiktheater Universität Bayreuth (Hg.), Strukturprobleme des Musiktheaters in der Bundesrepublik Deutschland, Thurnau 1978, S. 283. 13 Vgl. John W. Meyer u. Brian Rowan, Institutional Organizations. Formal Structure as Myth and Ceremony, in: American Journal of Sociology 83. 1977, S. 340 – 363. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 139 II. Das Repertoire Repertoirebildung ist ein Prozess der Typisierung, der sich über die gesamte Operngeschichte erstreckt; die Berufung auf ein Repertoire zeigt die Regelungsfunktion, die von dieser institutionalisierten Form der Musik ausgeübt wird. Vierzig Jahre lang entwickelten sich im geteilten Berlin Kunst und Kultur thematisch und organisatorisch parallel. Nach der Wiedervereinigung galt es deshalb in den 1990er Jahren, die getrennten Kulturlandschaften zusammenzuführen und „hauptstadttauglich“ zu machen. So auch die drei Opernhäuser, von denen die Staatsoper Unter den Linden im Osten und die Deutsche Oper im Westen jeweils den Status des führenden Hauses in der Stadt für sich beanspruchten, während das dritte Haus, die Komische Oper, seinen Platz dazwischen finden musste. Diese drei Opern erschienen von politischer Seite nicht mehr finanzierbar, es sei denn, sie konnten ihre Einzigartigkeit beweisen. Die schien vor allem deswegen nicht gewährleistet, weil die Opernhäuser sich in ihrem gespielten Repertoire weder von anderen großen Opernhäusern noch voneinander unterschieden. Doppelte oder sogar dreifache Produktionen zahlreicher Mozart-, Wagner-, Verdi- und Puccini-Opern beflügelten in der Presse eine lebhafte „Doubletten“- und „Tripletten“-Diskussion. Die Welt etwa schrieb: „Nicht auszudenken, was da an Synergien und sinnvollem Nebeneinander möglich wäre. Abgestimmte und ergänzte Spielpläne, ein reiches Musikleben, das seine Ressourcen bündelt und stärkt, statt sie durch sinnlose Doubletten zu verschleudern.“14 Die um die Lösung dieses öffentlich diskutierten Problems bemühten Kulturpolitiker setzten auf das Prinzip der Profilierung und zielten damit in erster Linie auf die Frage nach dem „richtigen“ Repertoire der Opernhäuser. Für die drei Opern wurden Profile gezeichnet, die den jeweilig gewünschten Aufgabenbereich formulierten. Diese Profile waren nichts anderes als Zuweisungen eines bestimmten Repertoireausschnittes. Die Staatsoper sollte – so die ursprüngliche Idee – das klassische und moderne Repertoire abbilden, die Deutsche Oper als „Bürgeroper“ das „große“ Repertoire des 19. Jahrhunderts repräsentieren. Die Komische Oper sollte sich mit „leichten“ Opern von Mozart bis Smetana einen eigenen Platz schaffen.15 Ein konkurrierendes kulturpolitisches Papier konzipierte die Staatsoper als prädestinierten Ort für das vorklassische, klassische und frühe romantische Belcanto-Repertoire, während die Deutsche Oper das Repertoire des 19. Jahrhunderts und der Moderne zu spielen hatte; die Komische Oper konzipierte man als Bühne für 14 Die Welt, 6. 12. 1999, S. 29. 15 Friedrich Dieckmann u. a., Überlegungen zur Situation der Berliner Theater. Textfassung von Ivan Nagel. Berlin, 6. 4. 1991(aus dem noch nicht archivierten Bestand der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur, Berlin). 140 Sarah Zalfen Spieloper und Operette.16 Die Konzepte setzten sich vielfach von der gängigen Praxis an den drei Opern ab, missachteten mitunter sogar die musikalischen Kompetenzen der berufenen künstlerischen Leitungen. Der ausgewiesene Wagner-Experte Daniel Barenboim beispielsweise sollte nun die Staatsoper als ein Haus der Vor- und Frühklassik leiten und das spätromantische Repertoire der Deutschen Oper überlassen. Was hier wirksam wurde, war weniger der persönliche Geschmack der agierenden Kulturpolitiker als die Folge der stärksten Form der Institutionalisierung von Musik – die der Kanonisierung oder Repertoirebildung. Durch diese Form der Institutionalisierung werden bestimmte Stücke aus „der Ahistorizität in den geschichtlich fundierten Kanon tradierungswürdiger kultureller ,Werke‘ erhoben“.17 Damit gehen Wertungs- und Normierungsprozesse einher, die an spätere Generationen weitergegeben, gegebenenfalls variiert und wiederum tradiert werden. Dieser Prozess setzt als strenge Typisierung Maßstäbe dafür,18 was in Opernhäusern gespielt, in Opernführern besprochen und auf Tonträgern eingespielt werden soll. Das Repertoire ist also das Anerkannte und mithin in dadurch institutionalisiertem Wissen (zum Beispiel in den Opernführern) Berechenbare. Es reglementiert das kulturelle Wissen und die Musikbetriebe einer Gesellschaft. Der Prozess der Kanonisierung hat die Spielpläne Europas von der Mitte des 19. Jahrhunderts an bis heute stärker geprägt als irgendein Komponist oder ein musikalischer Stil. Denn „jede Repertoirebildung bedeutet den Verzicht aufs Neue“.19 Schätzungen gehen davon aus, dass seit der „Erfindung“ der Oper um 1600 weit über 50.000 Opern geschrieben worden sind.20 In der Mitte des 20. Jahrhunderts bildete davon etwa ein Promille, also etwa 500 Werke, das Repertoire der Opernhäuser rund um die Welt. 16 Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur, Maßnahmen zur Bühnenstrukturreform (Teil 2), Berlin, 12. 10. 2000 (aus dem noch nicht archivierten Bestand der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur, Berlin). 17 Ralf von Appen u. a., Pop zwischen Historismus und Geschichtslosigkeit. Kanonbildung in der Populären Musik, in: Beiträge zur Popularmusikforschung 36. 2008, S. 25 – 49. 18 Das aus dem Griechischen stammende Wort „Kanon“ bedeutet „Maßstab“ und bezeichnete ursprünglich die zur Bibel zusammengefassten heiligen Texte. 19 Werner Braun, Die Musik des 17. Jahrhunderts, Wiesbaden 1981 (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 4), S. 303. 20 Vgl. Rudolf Kloiber u. a., Handbuch der Oper, Kassel 19855, S. XVII. Die Oper – als Musik im unmittelbaren Bühnengeschehen – wurde, so die gängige Auffassung, an der Wende zum 17. Jahrhundert von der Künstlergruppe Camerata Fiorentina beim Versuch erfunden, die griechische Tragödie wiederzubeleben. Die historischen Entwicklungen hinter dieser zur Legende gewordenen Entstehungsgeschichte stellen sich etwas vielschichtiger dar : Vgl. Leo Karl Gerhartz, Oper. Aspekte der Gattung, Berlin 1983, S. 11 – 17. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 141 Diese Herausbildung eines Kanon, im Verlauf dessen sich „große“ und „klassische“ Kunst von unbedeutenden Werken trennen ließ und die „Genies“ von den Kleinmeistern oder vergessenen Komponisten geschieden wurden, erfolgte in der Oper seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es kam zu einem „shift in musical taste from a preference for contemporary music to a preference for works by dead masters“.21 Während die Spielpläne zuvor fast ausschließlich zeitgenössische Musik zeigten und alte Stücke vernachlässigten, hatte sich das Bild bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig umgekehrt. Die Oper war zu einem Museum geworden, das einem festen Gefüge musikalischer Werke und kultureller Werte huldigte. Neben der dadurch gewährleisteten Berechenbarkeit des Opernbesuchs provozierte diese Verengung des Repertoires auch Kritik. Beispielhaft dafür steht Adornos Polemik gegen die „Versteinerung“ des Repertoires im amerikanischen Opernbetrieb: „Schrumpfte in Amerika das gesamte gängige Opernrepertoire zu kaum mehr als fünfzehn Titeln, darunter Donizettis ,Lucia di Lammermoor‘, zusammen, so bestätigte das die Petrifizierung.“22 Die Kritik an der Verengung der Spielpläne führte zu einer Welle von „Ausgrabungen“ und „Wiederentdeckungen“, die dazu beitragen sollten, die festgefahrene Institution des Repertoires in Bewegung zu bringen. Die Beliebtheit des „Standardrepertoires“ wurde dadurch allerdings nicht berührt. Deutlich wurde dies zuletzt an der konzertierten Aktion verschiedener Fernsehsender und Zeitungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als durch eine Abstimmung unter dem Publikum die „schönste Oper aller Zeiten“ gekürt werden sollte. Das Millionenpublikum (das sich schließlich für „La Traviata“ von Giuseppe Verdi entschied) durfte von vorneherein nur aus dreißig Opern auswählen.23 Das Ausmaß der Macht dieser Institution, die das Repertoire bildet und die Spielpläne und kulturpolitischen Konzepte so „selbstverständlich“ prägt, ebenso wie der dahinter verborgene Institutionalisierungsprozess erschließen sich erst in der historischen Rückschau. In der neu entstehenden Oper des 17. und 18. Jahrhunderts war die Variabilität und Funktionalität der Stücke das maßgebliche Gütekriterium, nicht ihr absoluter Wert und auch nicht ihr spezifischer Charakter. Situationsangepasste Bearbeitungen und Arrangements bildeten in ästhetischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht die Basis des Musiklebens. Das musikalische Konsumbedürfnis verlangte keine Kunst 21 David Clay Large u. a. (Hg.), Wagnerism in European Culture and Politics, Ithaca, NY 19852, S. 29. 22 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt 1975, S. 129. 23 Ausgewählt nach den Besucherzahlen der vergangenen zehn Spielzeiten, die jährlich in der Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins erhoben werden; vgl. die Broschüre des Programms, http://www.die-schoensten-opern-aller-zeiten.de/theater/pdf/schoenste_ opern_daten.pdf. 142 Sarah Zalfen für die Ewigkeit, sondern neues musikalisches Material, das für vielerlei Anlässe und Räume – Kirchen und Klöster, höfisches Zeremoniell und fürstliche Feste, Theater und die wachsende Zahl von Opernhäusern – eingesetzt werden konnte.24 Der Komponist war weder die zentrale Figur, welche die Beachtung und Bewunderung des Publikums erhielt, noch der ökonomische Profiteuer seiner Arbeit. Die Autorenschaft spielte mithin in der Musik erst spät überhaupt eine Rolle, dann aber, nach 1800, entwickelte sie sich zum bestimmenden Merkmal.25 Mit dem Autor entstand das Werk als schriftliche Fixierung und als Schöpfungsakt.26 Noch bevor diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch zu den Grundpfeilern des Urheberrechts wurden, bedingten sie eine Würdigung und Überhöhung bestimmter Autoren und ihrer Stücke. Die damit einhergehende Typisierung und normative Aufladung der Musik mündete im Kanon „großer“ Musik. Die Formung eines Repertoires, das schon im 19. Jahrhundert die Bezeichnung „klassisch“ erhielt, erfolgte vor allem als gesellschaftliche Bewertungsstrategie, als eine Definition kultureller Größe und als eine Antwort auf kulturelle Herausforderungen.27 In einer Zeit immenser Veränderung und Beschleunigung, die auch für die ästhetische Entwicklung nicht ohne Folgen blieb, war die Repertoirebildung ein Garant für die kulturellen Werte. Das Repertoire bildete eine Orientierungshilfe, die der Bewunderung des Bekannten Recht gab, neue Werke zu bewerten möglich machte, Wissen strukturierte und Geschmack kultivierte. Diese Herausbildung von Maßstäben war nicht nur Aufgabe der Fachleute und der Kritiker, sondern unterlag auch der Dynamik der allabendlichen Rezeption.28 Der „Maßstab“ des Kanons oder Repertoires war eine Folge der Typisierung von Musik und wurde als 24 Vgl. Lorenzo Bianconi u. Thomas Walker, Production, Consumption and Political Function of 17th Century Opera, in: Christian Kaden u. Karsten Mackensen (Hg.), Soziale Horizonte von Musik. Ein kommentiertes Lesebuch zur Musiksoziologie, Kassel 2006, S. 60 – 69. 25 Vgl. Leopold u. Schmidt, Oper, S. 636; Laurenz Lütteken, Art. Werk/Opus, in: MGG, Supplement-Band, Sp.1102 – 1114, hier Sp. 1107. 26 Die komplizierte Aushandlung, „wer wann und auf welcher Grundlage die Rechte an Aufführungen einer Oper innehat, führt dazu, dass man Partituren immer deutlicher die Eigenschaft zuspricht, das integrale Werk verbindlich festzulegen“, Leopold u. Schmidt, Oper, S. 638 f. Die Partitur avancierte zum wichtigsten Überlieferungs- und Speichermedium und deshalb auch zur Repräsentanz des Werks an sich. Vgl. auch Sieghart Döhring, Von der Inszenierung zur Regie. Die Aufwertung des Szenischen in der Geschichte der Oper, in: Gerhard Brunner u. Sarah Zalfen (Hg.), Werktreue. Was ist Werk, was Treue? Wien 2011, S. 37 – 56. 27 Vgl. Sven Oliver Müller, Analysing Musical Culture in Nineteenth-Century Europe. Towards a Musical Turn? in: European Review of History 17. 2010, S. 833 – 857. 28 Vgl. Ders., Die Gesellschaft macht die Musik. Das Opern- und Konzertpublikum in Berlin, London und Wien im 19. Jahrhundert, Habil. Universität Bielefeld 2011, S. 307. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 143 erlernbares Instrument der Systematisierung selbst zu einem Mittel der Typisierung. Das betrifft die Entwicklung der Oper in Deutschland ebenso wie in anderen europäischen Staaten.29 Von der im Repertoire institutionalisierten Bewertung der Musik sind heute keine Aufführung und kein Musikbetrieb frei. Sie bildet ein Regelsystem, weil dieses als Ordnungskategorie auf zahlreiche Entscheidungen, Prozesse und Strukturen einzuwirken vermag. Dies gilt etwa für die Spielplangestaltung, in der ein einziges Experiment stets mit ein oder zwei Werken des Standardrepertoires aufgewogen werden muss, um den Opernetat in der Balance zu halten; in der Ausbildung von Sängerinnen und Sängern, die sich alle in bestimmten Rollen schulen, um auf großen Opernbühnen singen zu können; in den Karrieren von Opernstars, die ihren internationalen Ruhm auf nur wenigen, aber eben publikumsübergreifend bekannten Partien aufbauen können. Die Bedeutung des Repertoires schlägt sich handfest in Aufführungsund Besucherzahlen nieder, in der Spielplangestaltung wie in den Platteneinspielungen. Auch im eingangs erörterten Opernleben im Berlin der 1990er Jahre behauptete sich die Institution des Standardrepertoires besser als der kulturpolitische Wille zu einem innovativ profilierten Repertoire. Gerade dadurch, dass es die „Klassiker des Repertoires“ spielte, konnte ein Opernhaus seinen Status als bedeutendes Theater behaupten. Augenfällig wurde aber auch hier die Orientierungsfunktion, die man dem Repertoire beziehungsweise einer bestimmten Aufteilung des Repertoires beimaß. Es sollte die Opernhäuser mit Etiketten versehen, von denen die kulturpolitischen Akteure sicher sein konnten, dass sie das Musikpublikum zu decodieren vermochte. Auf diese Weise wollten sie Zuordnungen treffen, Erwartungen bedienen, Regeln für die Gestaltung des gesamtstädtischen Opernspielplans schaffen und dem Publikum die Orientierung nach bekannten Maßstäben in der Kulturlandschaft erleichtern. Dazu bildete das Repertoire als historisch institutionalisierte Form der Kategorisierung und Bewertung von Musik einen geeigneten Bezugspunkt. 29 In der Musikgeschichte hat ein bestimmtes Repertoire oftmals sogar die Struktur des Darbietungsrahmens Oper geprägt. Das britische Royal Opera House Covent Garden beispielsweise nannte sich im 19. Jahrhundert „Italian Opera House“, was für die Dominanz des italienischen Repertoires und die internationale Ausrichtung der Spielplangestaltung stand. Die Opra Comique in Paris verwies im Namen bereits darauf, dass hier ein anderes, damals moderneres Repertoire zu erwarten war, vgl. Sieghart Döhring u. Sabine Henze-Döhring, Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert, Laaber 1997. 144 Sarah Zalfen III. Sozialer Raum In der Oper haben sich spezifische Praktiken in Form eines sozialen Raums institutionalisiert, der als Regelsystem bis in die Gegenwart hinein Verhaltensund Kommunikationsformen der Opernbesucher vorgibt. 1997 schloss das Royal Opera House Covent Garden in London für zwei Spielzeiten die Pforten. In einem seit bereits zwanzig Jahren geplanten Umbau sollte das Haus saniert, technisch modernisiert und zugänglicher gemacht werden. Zur großen Überraschung der Opernleitung brachten die Umbauzeiten eine massive Verunsicherung des Publikums mit sich. Als das Haus nach einem prachtvollen Galaabend am 14. Juli 1997 schloss, war für die Zeit des Umbaus kein alle technischen und künstlerischen Bedürfnisse abdeckendes Ersatzhaus gefunden worden. Daher kam es zur Aufteilung des Spielplans auf verschiedene alternative Spielstätten: Das Royal Ballet musste in eine alte Konzerthalle im entlegenen Stadtteil Hammersmith ziehen, die Oper bespielte unter anderem das Theater im Barbican Centre, einem modernen Kulturzentrum der 1980er Jahre aus Waschbeton nahe der Londoner City sowie das South Bank Centre. Wie sich bald zeigen sollte, hatten der ständige Ortswechsel und der fehlende würdige Rahmen katastrophale Auswirkungen auf die Gunst der Zuschauer : „The exile era lacked glamour and the public voted with its feet.“30 Die Auslastungszahlen sanken schnell und deutlich; die Einnahmen blieben weit hinter den kalkulierten Erwartungen der Finanzplanung zurück. Für die Presse war die Ursache des Phänomens deutlich: „Audience’s loyalty clearly lay with the crimson velvet and gilt of the house in Covent Garden“, stellte etwa der Independent fest.31 Auch der Guardian erkannte: „the rich go to Covent Garden to be seen at Covent Garden, to throng in the Crush Bar, to enjoy the spirit of the place“, und zog daraus den Schluss: „That is why audiences have collapsed now that the Royal Opera is using other London venues.“32 Vor der ersten Premiere in der neuen Spielstätte in Hammersmith wurde in der Presse polemisch vor den Gefahren, welche der umbaubedingte Umzug in gewisse Stadträume Londons auch für das Publikum barg, gewarnt: In dieser Gegend könne allzu fragiles Schuhwerk ebenso gefährdet sein wie kostbarer Schmuck. Ein prominenter Londoner Herrenausstatter befürchtete sogar grundsätzlich „another down-grading of the great tradition of the night out at Covent Garden, one of the last bastions where a white tie can be worn“.33 Die damit zum Ausdruck gebrachte Besorgnis zielte nur augenscheinlich auf die Kleidung der Zuschauer, vor allem aber auf das dahinter stehende Ritual in dem sozialen Raum, den eine Opernaufführung bildet und im späten 30 31 32 33 Norman Lebrecht, Covent Garden. The Untold Story, London 2000, S. 429. The Independent, 2. 11. 1997. The Guardian, 10. 11. 1997, S. 14. Jeremy Hackett, zitiert nach The Times, 26. 7. 1997. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 145 20. Jahrhundert nur an wenigen Orten noch ein solch mächtiger Faktor war wie in London. Was macht ein Opernhaus zu einem sozialen Raum, und warum handelt es sich dabei um eine Form der Institutionalisierung von Musik? Der im Buchhandel unserer Tage erhältliche Opernführer „Oper für Dummies“ warnt den ungeübten und verunsicherten Opernneuling gleich auf der ersten Seite: „Tatsächlich sind viele der Opernsnobs sehr glücklich darüber, dass Sie nicht alles verstehen. Sie wünschen sich ihre Oper als einen exklusiven Club, eine Eliteeinheit und einen heiligen Tempel.“34 Ein anderes Einführungswerk, „Opera: A Crash Course“, verspricht dem Erstbesucher einer Oper kompetente Hilfestellung, das dort omnipräsente „miasma of social snobbery“ zu durchdringen.35 Diese Beispiele ließen sich zahlreich erweitern. Sie alle zeigen: Wo Vorurteile gegen die Oper laut werden, steht in der Regel nicht ihre ästhetische Eigenart, sondern ihre soziale Funktion im Vordergrund. Was die Oper in diesem Diskurs eint, ist also weniger die musikalische oder ästhetische Formensprache als ihr institutionalisierter sozialer Kontext: das Spektakel, dessen exponierte Räumlichkeit und dessen informell geregeltes Zeremoniell. Gilt die Oper als ein Teil der „klassischen“ Kultur oder „Hochkultur“, so verweist diese Bezeichnung weniger auf die Werke selbst, als vielmehr auf die Art und Weise, wie sie sich als kultureller Typus im oben genannten Sinne verfestigt hat.36 Die klassifizierende soziale Wirkung, die die Oper auf ihre Besucher und Nichtbesucher auszuüben scheint, kennzeichnet sie als einen sozialen Raum im Sinne Pierre Bourdieus.37 Der Raumbegriff veranschaulicht nicht nur die situative oder generelle Ordnung, in der sich die Mitglieder einer Gesellschaft über die Grundlagen ihres Zusammenlebens verständigen können. Er verdeutlicht auch, wo und warum in einer Oper die zentralen zur Institutionalisierung führenden Habitualisierungen und Typisierungen von Darbietungs-, Konsum- und Umgangsformen des Musiklebens stattfinden. Der soziale Raum ist eine kommunikativ erzeugte symbolische Form, durch die gesellschaftliche Strukturen hervorgebracht und handhabbar werden, etwa als soziales Beziehungsgefüge oder als Hierarchisierung, das heißt durch Kohäsion und Distinktion von Gruppen.38 34 David Pogue u. a., Oper für Dummies, Weinheim 1998, S. 1. 35 Stephen Pettitt, Opera. A Crash Course, London 1998, S. 2. 36 Vgl. Ken Hirschkop, The Classical and the Popular. Musical Form and Social Context, in: Christopher Norris (Hg.), Music and the Politics of Knowledge, London 1989, S. 283 – 304; John Shepherd, Music and Social Categories, in: Martin Clayton, u. a. (Hg.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York 2003, S. 69 – 79. 37 Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und „Klassen“. LeÅon sur la leÅon, Frankfurt 1991. 38 Vgl. zur hier verwendeten Kategorie des Raumes jenseits von Bourdieu auch Brigitta Hauser-Schäublin u. Michael Dickhardt (Hg.), Kulturelle Räume, räumliche Kultur. Zur Neubestimmung des Verhältnisses zweier fundamentaler Kategorien menschlicher 146 Sarah Zalfen Das bestimmende Kennzeichen im sozialen Raum ist die Position, die etwas oder jemand darin einnimmt, und die Bedeutung, die damit transportiert wird. Durch die im sozialen Raum stattfindende „Inkorporierung der objektiven Strukturen“39 kann ein Opernhaus dazu dienen, eine sozial strukturierte Institution zu schaffen oder zu unterstreichen. Das heißt, ihr architektonisch und ornamental geschaffener Raum (die „objektive Struktur“) dient einem bestimmten rituellen Verhalten und Abläufen, die einem kulturell determinierten Muster folgen, das sich die Besucher durch den auch körperlich stets wiederholten Vollzug (der „Inkorporierung“) aneignen, stabilisieren und durch Habitualisierung und Typisierung perpetuieren. Die im Inneren einer Oper versammelten Menschen positionieren und erkennen sich an den typisierten Merkmalen: daran, wo sie sitzen, wie sie auftreten und wie sie gekleidet sind. Sie tragen dazu bei, die institutionalisierte Ordnung des Opernereignisses hervorzubringen, die sie als zunächst heterogene Menge wiederum strukturiert sowie durch eine Standardisierung ihre Verhaltensformen homogenisiert.40 Dabei ist der Umstand besonders bemerkenswert, dass das Verhalten in der Oper kein durch hoheitliche Instanzen reglementiertes oder fixiertes ist, sondern von den Besuchern selbst geschaffen, erhalten und weiter getragen wird. Der innerhalb der Oper gebildete soziale Raum, der den Kern sowohl der Institution „Oper“ birgt und zugleich auch der zentrale Ort der Institutionalisierungsprozesse ihrer Rezeptionsformen ist, lässt sich an den architektonischen Voraussetzungen und den darin transportierten Traditionen verdeutlichen. Er beginnt am Eingang des Gebäudes: Zumeist in originaler oder nachempfundener barocker oder klassizistischer Pracht, entheben Opernhäuser ihre Besucher dem Alltag und zugleich auch den alltäglichen Kommunikationsformen. Eingangshallen und Treppenaufgänge, edle Gesteine und Dekormaterialien sowie eine festliche Beleuchtung schaffen einen Zustand der „Liminalität“ (Victor Turner) und damit den rituellen Übergang in eine eigene Welt und deren Ordnungsprinzipien.41 Diese Prinzipien setzen sich im Auditorium fort: Die Anordnung der Plätze im Parkett und in den Rängen und Logen mit ihren unterschiedlichen Sicht- und Sichtbarkeitsverhältnissen Praxis, Münster 2003, S. 30; Kathrin Groh u. Christine Weinbach, Zur Genealogie des politischen Raumes der Demokratie, in: dies. (Hg.), Zur Genealogie des politischen Raums. Politische Strukturen im Wandel, Wiesbaden 2005. 39 Bourdieu, Sozialer Raum, S. 17. 40 Vgl. Bruce A. McConachie, New York Operagoing, 1825 – 50. Creating an Elite Social Ritual, in: American Music 6. 1988, S. 181 – 192, bes. S. 190. 41 Liminalitätbeschreibt nach Victor Turner die Schwellenphase in einem Ritual, welche das Individuum seiner normalen sozialen Ordnung enthebt, vgl Victor Turner, Liminalität und Communitas, in: Andra Belliger u. David J. Krieger (Hg.), Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch, Wiesbaden 1998, S. 251 – 262. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 147 bestimmen die soziale Schichtung des Publikums entsprechend der jeweils erworbenen Eintrittskarten. Die Architektur der historischen Opernsäle segmentiert das Publikum mithin nach Prestige beziehungsweise finanzieller Potenz und konstituiert damit ein räumliches Bild der Sozialstruktur des Publikums. Das Publikum wiederum agiert durch den Einsatz von Kapital, Wissen, Kleidung, Sprache und so weiter im Rahmen des räumlichen Abbildes und trägt so zur Manifestation des Regelsystems innerhalb des sozialen Raums bei. Damit wird nicht nur ein gegenwartsbezogenes Abbild der unterschiedlichen finanziellen und kulturellen Ressourcen der Besucher geschaffen, sondern auch ein Bild der gesellschaftlichen Ordnungsmuster zur Entstehungszeit der Gebäude: Eine Hofoper – das zeigt schon ein flüchtiger Blick in den Zuschauerraum des 17. oder 18. Jahrhunderts – ist eben auch hierin ein Spiegel der höfischen Gesellschaft gewesen, mit klarer Rang- beziehungsweise Kleiderordnung und einem unverrückbaren Zeremoniell.42 Alle späteren Zuschauergenerationen nahmen und nehmen deshalb bei ihrem Besuch Räume ein, welche für das Musikpublikum einer bestimmten historischen Epoche und ihrer politischen und sozialen Ordnung geschaffen worden sind (etwa die Logen für die Aristokratie). Durch den Einsatz von vor allem ökonomischem Kapital lässt sich heute ein Platz an einem jener Orte im Opernhaus erwerben, die im 18. oder frühen 19. Jahrhundert nur durch Rang und Herkunft zugänglich waren. Zugleich wird dadurch im allabendlichen Vollzug die feudale Ordnung symbolisch in die Gegenwart übertragen. Dieser performative, als eine Art von Rückkoppelung vorstellbare Prozess unterstützt die spezifische Dynamik, mit welcher der soziale Raum Oper zur Institution wird. Die in der Regel in den 1960er bis 1980er Jahren eingeführten Abonnements und Freundes- und Förderkreise reproduzieren und verfestigen damit früher habitualisierte Verhaltensformen. Sie bieten eine vordefinierte Position im sozialen Raum und schaffen Gruppierungen, mittels derer sich der Einzelne positionieren kann, selbst wenn die ursprünglichen Verfahren der Typisierung gar nicht mehr praktiziert werden. Der 1962 gegründete Freundeskreis der Londoner Royal Opera macht die dazu dienliche Segmentierung deutlich: Er schuf ein bis in die 1990er Jahre gültiges Mehrklassensystem, das die Besucher des Hauses in outer circle (die normalen aber regelmäßigen Besucher), inner circle (den Freundeskreis) und Drogheda circle (die besonders wohlhabenden oder mit der Oper gut vernetzten Patrone) einteilte.43 Die Vertreter der einzelnen Gruppen durften zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Karten erwerben, hatten Zugang zu unterschiedlichen Pausenfoyers und verfolgten die Geschehnisse auf der Bühne aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 42 Ingrid Scheurmann, Szenenwechsel. Eine Kulturgeschichte der Oper und der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Bonn 1998, S. 19. 43 Vgl. Lebrecht, Covent Garden, S. 197. 148 Sarah Zalfen Wenn nicht gravierende Brüche die Tradierung der institutionalisierten musikalischen Räume unterbrochen haben, übertrugen und übertragen gerade die sozialen Räume die historischen Gesellschaftsordnungen durch die Rückkoppelung auf die zeitgenössischen Besucher. Mit der Übernahme der Opernhäuser durch den Staat erfolgte allerdings die politische Steuerung auch auf der Ebene der sozialen Räume. An zahlreichen Orten kam es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem kulturpolitisch hergestellten Bruch, der darauf zielte, die Oper durch Subventionen und Kontrolle der Eintrittspreise für alle Menschen zu öffnen und sie damit zu „demokratisieren“. Die Zugänglichkeit zur Oper oder die „Oper für Alle“ avancierte zu einem zentralen kulturpolitischen Programmpunkt.44 Zudem sollten überall dort, wo neue Opernhäuser erbaut wurden, die Zuschauerräume demokratischer und die Häuser auch baulich transparenter werden. Die Spuren des feudalen Erbes und damit der hermetische und elitäre Charakter, der bis dahin in den Opernbauten unangetastet überlebt hatte, sollten aus der Oper verschwinden. Das Konzept der architektonischen Demokratisierung zeigte sich etwa in den Neubauten der Deutschen Oper Berlin (1961) und der Opra de la Bastille (1989): Das Publikum saß nun in langen mit gleichem Gestühl ausgestatteten Sitzreihen, die an die Stelle der Logen und schmalen Ränge getreten waren, und verfügte ausnahmslos über einen guten Blick auf die Bühne. Die Kunst, nicht mehr die Präsentation der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen Statusgruppen, sollte im Fluchtpunkt der Zuschauerblicke liegen.45 In London fand dieser Bruch nicht statt, weder architektonisch noch kulturpolitisch. Das 1858 erbaute Royal Opera House Covent Garden, das weitgehend nach dem Vorbild des abgebrannten Vorgängerbaus aus dem Jahr 1809 entstand, blieb unverändert und behielt auch die hierarchische Segmentierung des Publikums bei.46 Die Zuschauer waren nach wie vor in das gestaffelte Gerüst einer dreirangigen Hufeisenform eingebunden. Über dem Parkett (stalls) erheben sich die teuren und oftmals exklusiven Plätze, das Hochparkett sowie die unteren Ränge, die sich in unterschiedlich stark voneinander separierte Logen (boxes) gliedern. Der dritte, hoch oben liegende Rang wird weit nach hinten durch das „amphitheatre“, ein rund sechshundert Plätze umfassendes zweites Sitzplateau, erweitert – die billigen Plätze. Bereits 44 Vgl. Zalfen, Staats-Opern? S. 200 – 209; Hilmar Hoffmann, Die Oper wurde sozialisiert. Keine Domäne gesellschaftlicher Elite, in: Lothar Romain (Hg.), Zwischen Oper und Kulturladen, Bonn 1978, S. 77 – 87. 45 Der erste Bau, der diese die Theaterarchitektur der Moderne prägende Idee und Struktur hat, war freilich bereits Richard Wagners Festspielhaus in Bayreuth, eröffnet im Jahr 1876. 46 „The (most) reserved response from the body of the house stems from its seat allocation.“ Clive Bournsnell, The Royal Opera House Covent Garden, London 1982, S. 202. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 149 an den Eingangstüren entschied sich bis zum Umbau 1997, zu welcher „Preisklasse“ die Zuschauer gehörten, da die Plätze des dritten Rangs nicht durch den eleganten Haupteingang, sondern nur über die hinteren, schlichten Treppenhäuser des Theatergebäudes zugänglich waren. Weiterhin blieb nach 1945 auch in London zwar die öffentliche Musikförderung beibehalten, die während des Zweiten Weltkrieges eingesprungen war, um mit dem Kulturbetrieb die Moral der Menschen an der Heimatfront zu stärken. Anders als auf dem europäischen Kontinent, musste aber der größte Teil des Etats weiterhin durch eigene Einnahmen gesichert werden. Daher blieb der Opernbesuch ein Privileg der Oberschicht und als solcher fest in ihren Ritualen verankert. Zahlreiche Demokratisierungsprogramme versuchten vergeblich mit dem institutionalisierten sozialen Raum in der Oper zu brechen: Ab dem Ende der 1980er Jahre galt etwa eine preiswert zugängliche Veranstaltungsreihe bereits als das Maximum der sozialen Öffnung der Royal Opera. Damals wurde für eine Woche das Interieur – und damit auch die geschlossene Atmosphäre des Opernraums – aufgelöst und den Zuschauern für wenige Pfund die Möglichkeit geboten, die Aufführungen auf einem Stehplatz im leer geräumten Parkett zu genießen.47 Um den Zugang zu den Kunstgenüssen für die breiten Bevölkerungsschichten noch weiter zu öffnen, veranstaltete das Opernhaus ab 1995 Live-Übertragungen direkt vor dem Gebäude, insbesondere von Galavorstellungen mit bekannten Stars. Auf der Covent Garden Plaza kamen tatsächlich Tausende zusammen, um auf einer großen Leinwand zu verfolgen, was im Inneren nur ein vergleichsweise kleiner privilegierter Kreis genießen konnte. Eine wirksame Auflösung der institutionalisierten Form der Oper kam dabei nicht zustande. Die räumliche Nähe zum „Original“ blieb nur denen vorbehalten, die sich im Inneren beziehungsweise in der „echten“ Vorstellung befanden. Die Besucher der Extraveranstaltungen wurden eben nicht Teil dessen, was das Besondere am Opernbesuch ausmachte. Bourdieus Konzeption des sozialen Raums bestätigend, veranschaulicht hier die objektive Distanz zwischen den Publika drinnen und draußen deren deutlich vollzogene soziale Trennung.48 Die Veranstaltungen betonten die Nichtzusammengehörigkeit der Publikumsgruppen weit mehr als ihr gemeinsames Erleben. Mithin bestand das zentrale Problem zur Zeit des Opernumbaus darin, dass die dem Londoner Opernereignis innewohnende Institution des sozialen Raums plötzlich fehlte und die Aufführungen dadurch dekontextualisiert worden waren. Zuvor war es leichter möglich, den gültigen Regeln (typisierten Verhaltensformen, Kleidungsstilen und Kommunikationsformen) einer Opernaufführung zu folgen – so man sie denn kannte. Die Loslösung des 47 Vgl. Jeremy Isaacs, Never Mind the Moon. My Time at the Royal Opera House, London 2001, S. 258 f. 48 Vgl. Bourdieu, Sozialer Raum, S. 16. 150 Sarah Zalfen Opernereignisses von einem bestimmten Raum, an dessen Regeln das Publikum sich bisher orientiert hatte, stellte viele Besucher vor neue Herausforderungen: „Getting dressed for a spot of corporate entertainment used to be so easy – bun on a tux, shove a few sparklers around the lady wife’s swan-like neck and then just sit it out in gilded splendour“,49 karikierte die Times diese Sorge. Die Abwesenheit der spezifischen in der Räumlichkeit des Opernhauses festgeschriebenen Institution wurde nicht zuletzt deshalb zu einem Problem, weil sich zeigte, dass ein Teil des Publikums auf die Kunst der Oper gerne verzichtete, wenn sie nicht den gewohnten gesellschaftlichen Rahmen bot. Ohne die typisierten Strukturen der bekannten Oper – die urbane Covent Garden Plaza, die roten Sessel, Logen und exklusiven Pausensalons –, ohne die Möglichkeit der Selbstvergewisserung, dass man in das Royal Opera House ging, war manchen Zuschauern der Opernbesuch nichts mehr (oder erheblich weniger) wert. IV. Herrschaftstheater Opernaufführungen zeigen eine habitualisierte und institutionalisierte Verschränkung von Musikkonsum und Herrschaftsrepräsentation, die mitunter stärker wirkt als die modernen architektonischen Rahmenbedingungen, in denen sie stattfindet. Unmittelbar nach dem „historischen“ Wahlsieg der Sozialisten 1981 kündigte der neue französische Präsident FranÅois Mitterrand ein großes Städtebauprogramm an, darunter ein neues Opernhaus an der Place de la Bastille. Mit dem Bau sollte das monarchische Symbol von Kultur und Macht in das Pariser „Volksviertel“ und an den Ursprungsort des modernen französischen Nationalbewusstseins getragen werden. Die Inauguration der Oper am Vorabend des 14. Juli 1989, der Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution, wurde ein theatralisches Spiel zwischen Tradition und Moderne. Die demokratische Architektur, ein massiger, aber transparenter Bau, der einen 2.700 Plätze umfassenden Saal ohne Logen, Ränge, Goldornamente und roten Samt umschloss, wurde mit dem hoheitlichen Anspruch verknüpft, ein vom Präsidenten für „sein“ Volk erdachtes Opernhaus prachtvoll zu repräsentieren.50 Zwischen Militärdefilee, Parade, Gala-Diner und Volksball bildete die Eröffnung der Oper ein hervorragend eingepasstes Element.51 Die Feier 49 The Times, 26. 7. 1997. 50 Vgl Frdrique Jourdaa, A l’pera aujourd’hui. De Garnier Bastille, Paris 2004; Saint Pulgent, Le syndrome de l’Opra; Jean-Pierre Biojout (Hg.), Les insolites de l’Opra Bastille, Paris 2000. 51 Vgl. Jean-Nol Jeanneney, Le Bicentenaire de la Rvolution FranÅaise. Rapport du Prsident de la Mission du Bicentenaire au Prsident de la Rpublique sur les activits de ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 151 veranschaulichte pointiert, wie der institutionalisierte Akt einer Operngala durch sein spezifisches musikalisches Zeremoniell seiner Tradition verhaftet blieb, ohne auf Erneuerung zu verzichten. Für 19 Uhr war die Gala angesetzt. Auf dem Programm stand ein nur gut einstündiges Potpourri aus Ballettszenen und großen Arien, die fast ausschließlich von französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts stammten.52 Die eigentliche Inszenierung des Ereignisses fand jedoch nicht auf der Bühne statt. Wie die Tageszeitung Le Monde beobachtete, gab es zwei Spektakel: „premier, le concert sur la scne; mais bien sr le deuxime dans la salle, autour de Monsieur FranÅois Mitterrand“.53 In der Eröffnungszeremonie zeigte sich das Potenzial der Oper, einen Raum zu formieren, in dem das Erscheinen und Erklingen auf der Bühne auch die Theatralität im Zuschauersaal legitimierte. Die geladenen Zuschauer erhielten wegen der strengen Sicherheitsvorschriften für die Staatsgäste bereits Stunden vor Beginn der Vorstellung Einlass in das Gebäude; das die Straßen säumende Volk wurde weiträumig durch Abriegelung fern gehalten. In einem langen Zug schwarzer Limousinen kamen schließlich die Staatsgäste vorgefahren und nahmen mit ihren Begleitungen auf der mittleren Terrasse des ersten Ranges Platz. Zuletzt betrat FranÅois Mitterrand mit seiner Frau Danielle den Saal, um sich, alle anderen in der Reihe zum Aufstehen nötigend, zu seinem Platz in der Mitte der ersten Reihe dieser Terrasse zu begeben – genau an jene Stelle, wo in den meisten Opernhäusern zuvor die Königsloge lag, die aber hier architektonisch nicht einmal mehr angedeutet war. Der amerikanische Präsident George Bush saß bereits auf dem Platz daneben. Die Staatsgäste saßen gestaffelt um Mitterrand herum. Helmut Kohl und Margaret Thatcher waren Plätze abseits in der zweiten Reihe zugewiesen worden. Die Sitzordnung transportierte eine für alle sichtbare Ordnung, die sich von den üblichen runden Tableaus politischer Bauwerke der Demokratie deutlich unterschied. Die Kamerabilder des live übertragenen Ereignisses zeigten während dieses Ablaufes, wie alle Anwesenden im Saal sich erhoben und dem cet organisme et les dimensions de la clbration. La Documentation FranÅaise, Paris 1990. 52 Auszüge aus „Faust“ und „Romo et Juliette“ von Charles Gounod, „Dinorah“ und „Le Pardon de Ploermel“ von Giacomo Meyerbeer, „Thais“, „Herodiade“ und „Werther“ von Jules Massenet, „Alceste“ von Christoph Willibald Gluck, „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Sans, „Carmen“ von Georges Bizet und „La Damnation de Faust“ von Hector Berlioz. Damit wies das Programm erstaunliche Ähnlichkeit mit dem der Eröffnung des Palais Garnier auf, das Frdrique Patureau als ein „banales“ Potpourri aus Opern von Auber, Meyerbeer, Halvy, Rossini und ein paar Ballettszenen beschreibt; vgl. Frdrique Patureau, Le Palais Garnier dans la socit parisienne, 1875 – 1914, Lige 1991, S. 22. 53 Le Monde, 15. 7. 1987. 152 Sarah Zalfen imaginären Zentrum des Raumes im ersten Rang zugewendet applaudierten. Mitterrand nahm diese Akklamation winkend entgegen, um dann selbst in den Applaus einzustimmen. Die „Marseillaise“ wurde gespielt, und das musikalische Spektakel auf der Bühne konnte beginnen. „L’Opra est une des dernires manations de l’Ancien Rgime, d’un tat monarchique fond sur le pouvoir centralis“,54 hatte das Magazin Actualit kurz zuvor noch geurteilt. Und genau dieser „pouvoir centralis“ wurde durch die Eröffnungsfeierlichkeit räumlich präsentiert und repräsentiert. Die Platzwahl, der Gang zum Präsidentensitz und die huldigende Geste im Kreise der hohen politischen Gäste, vor allem aber die Hinwendung der Blicke der Anwesenden hin und – vom Parkett aus – hoch zum zentralen Ort im Raum schufen einen Prozess der Vergegenwärtigung von Macht, der sich über die zeitgenössische Architektur und ihren antihierarchischen Duktus hinweg setzte. Mit einer Analogie verwies die Beschreibung in Le Monde auf die Bezüge beziehungsweise die Herkunft dieses Zeremoniells hin: „Tous ces personnages autour du Prsident de la Rpublique qui apparaissent sur les belles vagues arrondies des galeries comme Jupiter et Juno des opras baroques.“55 FranÅois Mitterrand vermochte sich bei diesem Festakt ebenso wie die Londoner Oberklasse auf das fest in der Architektur und im Aufführungszeremoniell der Oper verankerte Fundament beziehen. Denn, ob Hof- oder Staatsoper – deren exponierte Baulichkeiten galten stets auch als Bühnen für Herrschaftstheater. Im historischen Rückblick zeigt sich, dass in eben dieser Funktion das konstitutive Moment zwischen Oper und politischer Macht liegt, das über Brüche und Systemwechsel hinweg tradiert und institutionalisiert worden ist. Die noch 1989 zum Ausdruck kommende Funktion von Opernhäusern und Opernaufführungen, durch Raum, Ausstattung und rituelle Dramaturgie das Erscheinen auf der Bühne mit dem im Zuschauersaal in Einklang zu bringen, hat sich bereits in der Frühzeit der Oper herausgebildet. Sie verweist auf die Herkunft der Kunstform, die ihre kommunikative Wirkung gerade aus der Kombination ihrer alle Sinne ansprechenden Darbietungen im Rahmen besonderer Anlässe zog.56 Insbesondere die Opernspektakel der Barockzeit, die den Aufstieg der Gattung begleiteten, dienten keineswegs der reinen 54 Actualit, 1986 (Datum unbekannt, Dossier Opra Bastille 1986, Bibliothque de l’Opra, Paris). 55 Le Monde, 17. 7. 1987. 56 Nolle Grme, La tradition politique des fÞtes. Interpretation et appropriation, in: Alain Corbin u. a. (Hg.), Les usages politiques des fÞtes au XIXe–XXe sicles, Paris 1994, S. 15 – 23. „Daß sich Kulturen in ihren Festen und Feiertagen nicht nur manifestieren, sondern auch begründen und tradieren“, betont Thomas Macho, Fest, Spiel und Erinnerung. Zur Gründungsgeschichte moderner Feste, am Beispiel der Salzburger Festspiele, Salzburg 2006, S. 5. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 153 Erbauung und Unterhaltung oder der Demonstration einer luxuriösen Verschwendungssucht. „Vielmehr belegen Korrespondenzberichte etwa der europäischen Diplomatie […], in welchem Maß diese Inszenierungen eine politische Sprache führten und in diesem Sinne genuiner und unverzichtbarer Teil der offiziellen Politik des Hofes waren.“57 Die Inszenierung des Herrschers im Zuschauerraum der Oper entsprach dabei in der Regel der für die Frühzeit der Oper typischen Bühnensprache der Allegorien und Verherrlichung. Beide Darstellungsformen waren eng miteinander verwoben, etwa am Hofe des französischen Königs Ludwig XIV. – so eng, dass der König selbst als Darsteller auf der Opernbühne auftrat.58 Oder in Berlin, wo Friedrich II. in seiner Hofoper meist statt in der Königsloge unmittelbar hinter dem Orchester auf einem „Thron von Menschen“, vor allem seines Militärs saß, um die Vorstellung mit zu dirigieren. Einen „palais enchanteur et magique“ nannte er sein Opernhaus und verwies damit sowohl auf jene die Realität verzaubernde Aura der Oper wie auf deren Funktion als Bauwerk und Bollwerk der Macht.59 Die sich in der Opernaufführung herstellende Verbindung zwischen dem Repräsentationssubjekt, seiner ornamental hervorgehobenen Loge und dem von dort aus beobachteten Spektakel auf der Bühne ist das zentrale Element der dritten Ebene der Institutionalisierungsprozesse der Oper : der Institutionalisierung von Herrschaft. Diese Ebene wurde, wie auch die beiden zuvor dargestellten, durch den performativen und repetitiven Charakter der musikalischen und theatralen Aufführung verfestigt; sie bestimmte die zeremonielle Habitualisierung des Opernbesuchs von Seiten sowohl des Publikums als auch der gekrönten Häupter oder Repräsentanten des Staates. Dadurch, dass die Herrscher erst dann erschienen, wenn das gesamte Publikum versammelt war, zogen sie die Blicke symmetrisch auf sich. Die durch den Raum vorgegebene Struktur wurde durch die Körper, die Bewegungen und die visuelle Kommunikation der Beteiligten nachgebildet und dann durch ein Ritual in eine eigene symbolische Form überführt, die Ausdruck und Anerkennung der abgebildeten Ordnung war. Auch als sich die unmittelbare Verknüpfung mit den Höfen durch die zunehmende Autonomie der Opernhäuser aufgelöst hatte und die theatrale Huldigung des Herrschers auf der Bühne ihren Bezug zum realen Machtzen57 Uta Hengelhaupt, Die große Inszenierung als Repräsentation des Staates. Frühe Opernprojekte am Wiener Kaiserhof. Vortrag zur Eröffnung der Tage Alter Musik in Bamberg (Die Habsburger und die Musik), unveröff. Ms. Bamberg 2006; Vgl. auch Silke Leopold, Höfische Oper und feudale Gesellschaft, in: Udo Bermbach u. Wulf Kunold (Hg.), Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin 1991, S. 65 – 82. 58 Vgl. Fritz Reckow, Die Inszenierung des Absolutismus. Politische Begründung und künstlerische Gestaltung höfischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV. (= Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 60), Erlangen 1992. 59 Vgl. Scheurmann, Szenenwechsel, S. 62 u. S. 80. 154 Sarah Zalfen trum verlor, blieb die Mittelloge (in einigen Häusern auch die Proszeniumsloge) der typisierte und typische Ort, an dem sich auch jene Machthaber in Szene setzen konnten, die den Fürsten und Königen historisch folgten. Wo alte Zuschauersäle erhalten wurden, blieb „der Platz in der vormaligen Königsloge nicht leer“, wie Ingrid Scheurmann am Berliner Beispiel erläutert hat: Nunmehr erwartete man hier Persönlichkeiten wie Friedrich Ebert und Feldmarschall von Hindenburg, später dann Walter Ulbricht, Erich Honecker und Leonid Breschnew, Richard von Weizsäcker und Roman Herzog, um nur einige zu nennen. […] So richten sich die Blicke der Zuschauer auch weiterhin erwartungsvoll auf die Plätze in der Mitte des ersten Ranges.60 In den Opernhäusern, in denen kein baulich hervorgehobener Balkon mehr vorhanden war, hob man – wenn es die Anwesenheit entsprechender Gäste erforderte – jene Plätze, an denen im traditionellen Opernhausschema die Königsloge lag, mit Schmuckelementen, Baldachinen oder Girlanden hervor. So entstand ein Punkt der Orientierung im sozialen Raum des Auditoriums, dessen Ordnung nicht allein durch die Anordnung des Publikums zueinander, sondern auch durch dessen Nähe oder Distanz zur Loge des Herrschers aufrechterhalten wurde. Am Vorabend der Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution in Paris erwies sich die institutionalisierte Zentralität und Theatralität des Ortes der Macht als wirksamer als der moderne Theaterbau. Das Ritual um FranÅois Mitterrand kreierte ein imaginäres Bild einer alten Oper, die durch das Zeremoniell gewissermaßen über den neuen Saal projiziert wurde, ohne dass sich dessen egalisierende Struktur selbst wirklich veränderte. Das Verhalten der Besucher wurde wesentlich durch den rituellen Nachvollzug inkorporierter beziehungsweise habitualisierter tradierter Verhaltensmuster geprägt; der Applaus, das sich Erheben und sich Zuwenden gegenüber dem im imaginierten Brennpunkt des Saales Platz nehmenden Präsidenten zeigten sich als Anerkennung und Umsetzung der alten Institution in einem neuen äußeren Rahmen. Nicht der unmittelbare Zusammenhang von Gebäude oder Raum zum Präsidenten, sondern die Re-Inszenierung im Rahmen der Opernaufführung, die auch ohne geeignete räumliche Vorgabe einer bestimmten Ordnung folgte, vergegenwärtigte die in diesem Ritual verankerte Beziehung zwischen Herrscher und Beherrschten. Die symbolische Form der höfischen Oper blieb im kulturellen Gedächtnis als „institutionell bedingte Geformtheit, durch [ihre] Zeremonialität charakterisiert“61 bestehen und vermittelte und verstärkte den Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 60 Scheurmann, Szenenwechsel, S. 84 f. Vgl. auch Michael Forsyth, Bauwerke für Musik. Konzertsäle und Opernhäuser, Musik und Zuhörer vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 1992. 61 Jessica Cohen u. Denise Langenhan, Steuerung durch Symbole, in: Gerhard Göhler u. a. (Hg.), Weiche Steuerung. Studien zur Steuerung durch diskursive Praktiken, Argu- ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 155 V. Resümee: Unzeitgemäße Institutionen? Die politischen Versuche am Ende des 20. Jahrhunderts die Institution Oper zu reformieren, scheiterten gewissermaßen an einem Missverständnis: Das Bemühen Kosten zu senken, administrative Verflechtungen aufzulösen und die Zugänglichkeit der Häuser zu verbessern, stieß auf manifeste, im Inneren dieses organisatorischen Rahmens institutionalisierte Ordnungen, die als Bestandteile oder Folgen des „Problems“ erkannt wurden, aber bei näherem Hinsehen ihren Ursprung bilden. Die Annahme, dass die „Oper an sich“ das Verhalten ihrer Besucher lenke und den Entscheidungsträgern Orientierungsmaßstäbe vermittele, erwies sich als unzutreffend. Es waren vielmehr zahlreiche in ihrer Geschichte herausgebildete, durch ihren performativen Ereignischarakter habitualisierte und in der gesellschaftlichen Kommunikation typisierte Merkmale, die sich als institutionalisierte Schichten in jedem einzelnen Opernhaus wie im kulturellen Typus der Oper verfestigt haben. Die Beispiele der drei dargestellten Opern sollten deutlich werden lassen, dass es sich bei diesen Institutionalisierungsprozessen der Musik um keine lineare Entwicklung der abwechselnden Verfestigung und Veränderung handelt. Vielmehr wurden institutionelle Effekte erkennbar, die als Rückkoppelung bezeichnet werden können: als Interferenz zwischen den früheren Formen des habitualisierten Handelns und Verhaltens sowie den daraus hervorgegangenen Regeln und Normen und den im Zuge der fortschreitenden Institutionalisierung veränderten Formen, in denen sie sich ausdrücken. Dieser bei den Opern beispielhaft deutlich gewordene Effekt der Rückkoppelung erfordert, wo er wirksam wird, Institutionalisierung nicht als Addition historischer Entwicklungen zu betrachten, sondern als deren Tradition beziehungsweise Tradierung, in dem Sinne, wie Murray Edelman sie konzipiert hat: als Konstruktionen der Vergangenheit in der und für die Gegenwart.62 Sie sind nicht die Vergangenheit selbst, sondern Bezugnahmen der Gegenwart auf eine aktuell relevante Historizität. Aus ihnen erwächst die institutionalisierte Ordnung einer als sinnhaft wahrgenommenen Welt, ganz unabhängig davon, ob die Ordnung in formal verrechtlichten Normen, als kollektiv anerkannte informelle Prinzipien oder als gelebte Praktiken des Musiklebens erscheinen.63 mente und Symbole, Baden-Baden 2009, S. 138 – 188, hier S. 152; vgl. auch Beate Binder, Eine Hauptstadt wird gebaut, in: Erika Fischer-Lichte (Hg.), Wahrnehmung und Medialität, Tübingen 2001, S. 177 – 196. 62 Vgl. Murray Edelman, Constructing the Political Spectacle, Chicago 1988, S. XV. 63 Vgl. Andreas Reckwitz, Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Göttingen 2000, S. 33; Werner Heinrichs, Kulturpolitik und Kulturfinanzierung. Strategien und Modelle für eine politische Neuorientierung der Kulturfinanzierung, München 1997, S. 48 f. 156 Sarah Zalfen Diese Weise der Vergegenwärtigung zeigt sich in der kulturpolitischen Reproduktion des Repertoires und dessen Kanonisierung. Sie findet sich aber auch in all den die historische Gesellschaftsordnung rekonstruierenden Verhaltensweisen des Publikums. Schließlich wird sie in der symbolischen Form der höfischen Opernhäuser deutlich, die auf Grund ihrer Habitualisierung auch jenseits ihrer architektonischen Gestaltung weiter bestehen und wirkungsmächtig bleiben. Stets wird eine Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart sichtbar, welche frühere Regelwerke und Verhaltensformen überträgt und weiterträgt. Die dahinter stehenden Prozesse und die davon ausgehenden Wirkungen mögen auf den ersten Blick weitgehend „außermusikalischen“ Charakter haben und die Kunst der Oper beziehungsweise die Musik selbst außer Acht lassen. Für sie alle ist jedoch die Musik ein konstitutiver Bestandteil. Denn Musik ist eine Zeitmaschine – so ließe sich eine Beobachtung der Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte abwandeln: Alles, was sie zum Klingen bringt, verwandelt sie in Gegenwart.64 Umgekehrt ist die Interpretation ebenso wie die Rezeption von Musik niemals zeitlos, sondern stets mit der Deutung von etwas Vergangenem verwoben. Durch diesen paradoxen Charakter schafft die Musik einen Nexus zwischen ihrer Entstehungszeit, der Gegenwart und der Rezeptionsgeschichte. Der performative Ausdruck, an den der Fortbestand einer Musik gekoppelt ist, bedingt strukturell Wiederholungen und formiert damit alle bestimmenden Handlungen und Praktiken in ihrem Umfeld. Daher gilt für sie Victor Turners Feststellung: „Cultural performances are not simple reflectors or expressions of culture or even of changing culture but may themselves be active agencies of change“.65 Als Kunstwerk entwickelt und verändert sich die Oper zwar unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, aber als kultureller Kanon und als Repertoire wird sie selbst eine Institution und eine Rahmenbedingung für das Wissen und die kulturelle Praxis einer Gesellschaft. Die Musik lässt Typisierungen, neue Wissensbestände und Praktiken entstehen, die als Institutionen an die nächste Generation übermittelt werden und in der Regel eher Reformbemühungen bestimmen als ihnen unterliegen.66 Kanonisierung, Zuschauerrituale und repräsentative Staatsakte institutionalisieren sich als Prozess der Vergegenwärtigung und werden auch als solche tradiert. Sie zeigen, dass mit der performativen Verbindung von Geschichte und Gegenwart einer weitgehend atavistisch gewordenen Kunstform auch die historisch entstandenen Räume und Praktiken, die sich im Laufe der Geschichte dieser Kunst gebildet haben, vergegenwärtigt werden können. 64 Erika Fischer-Lichte, Was ist eine „werkgetreue“ Inszenierung? Überlegungen zum Prozess der Transformation eines Dramas in eine Aufführung, in: Erika Fischer-Lichte (Hg.), Das Drama und seine Inszenierung, Tübingen 1985, S. 37 – 49, hier S. 37. 65 Victor Turner, Anthropology of Performance, New York 1988, S. 24. Vgl. auch Cook, Music as Performance. 66 Vgl. Berger u. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion, S. 79. ipabo_66.249.66.96 Zeitmaschine Oper 157 Die auf diesem historischen Fundament entstandenen Institutionen der Musik erweisen sich daher als stabiler, als es die Konzepte eines „demokratisierten“, staatlich organisierten Kulturbetriebs vorsehen. Die institutionalisierten Prozesse der Musik, wie sie an drei ausgewählten Beispielen verdeutlicht wurden, erweisen sich also als wenig anpassungsfähig. Zwar steigen neue Opernstars auf und erobern, wie zuletzt Anna Netrebko, auch die Medien. „Digitale“ Konzerthallen und „Public Viewing“ unterziehen das Zuschauerzeremoniell einer modernen Eventlogik, und in den Königslogen sitzen längst nicht mehr nur die Mächtigen des Staates, sondern auch prominente Unternehmer und Medienpersönlichkeiten. Doch verändern diese Neuerungen die musikalische Aufführung kaum, denn sie führen – anders als es der Aufstieg der Rock- und Popmusikkultur gezeigt hat – zu keinen signifikanten neuen Habitualisierungen. Auch eine Netrebko bedient die Repertoire-Erwartungen ihres Publikums, bei einer „Aida auf Schalke“ spielt auch das Publikum „große Oper“,67 und die modernen Mächtigen genießen in der Opernloge den Nimbus des Monarchen, freilich ohne dadurch in den Verdacht der antidemokratischen Gesinnung gerückt zu werden. Kurt Westphal hat 1928 zur Dominanz der Musik der Romantik pointiert formuliert: „Wir beherrschen das 19. Jahrhundert noch nicht; es beherrscht zum großen Teil uns.“68 Am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich dies bestätigt. Auch kulturelle und soziale, politische und ökonomische Veränderungen unterliegen im Zweifelsfall der Macht der Gewohnheit, die in zahlreichen Momenten des Musiklebens festgeschrieben ist. Dr. Sarah Zalfen, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-14195 Berlin E-Mail: [email protected] 67 Im Jahr 2001 fand in der Gelsenkirchener Fußballarena eine großformatige AidaProduktion statt, von welcher der Westdeutsche Rundfunk u. a. berichtete: „Pinguingleich bevölkerten Hunderte von schwarzbefrackten Männern die Wege, im Schlepptau den weiblichen Anhang, der sich nicht minder in Schale geschmissen hatte. Nur hier und da war im Getümmel auch ein blauweißes Schalke-Trikot zu entdecken.“ Zitiert nach Zalfen, Staats-Opern, S. 220 f. 68 Kurt Westphal, Das neue Hören, in: Melos 7. 1928, S. 352 – 354, hier S. 354. Diskussionsforum „Eine Welt“ Globales Interdependenzbewusstsein und die Moralisierung des Alltags in den 1970er und 1980er Jahren von David Kuchenbuch* Abstract: In the 1970s and 1980s, Western European and American concepts of the global changed profoundly. The article illustrates this by tracing discourses on global interdependency in this period. From the late 1960s onwards, ideas about the “limits of growth” prompted efforts by experts and supranational organisations to solve economic, environmental and social problems on a global scale. But these endeavours also prompted a countercultural criticism of the ideology of growth, development and progress, as well as of materialism and ethnocentrism, which was heavily influenced by the notion of “One World”. A “glocal” ethic emerged which considered Western consumer practices and living standards in global terms. I. Diskurse über „Welt“ als Thema der Zeitgeschichte Seit einigen Jahren befasst sich die Zeitgeschichtsforschung vermehrt mit geografischen Imaginationen, realen Landschaften und sozialen Räumen. Der Raum ist in der Geschichtswissenschaft en vogue, das zeigt schon das Leitthema des Historikertags 2004 – „Kommunikation und Raum“ – oder auch das (eher metaphorische) Motto des Kongresses 2010 – „Über Grenzen“. Ob das Konzept der Situiertheit in den Postcolonial Studies im Zentrum steht oder die Standortgebundenheit der Produktion wissenschaftlichen Wissens im Labor :1 Die Rede vom spatial turn ist seit einigen Jahren kaum zu überhören,2 die Rehabilitierung der in Deutschland nach 1945 lange Zeit desavouierten, * Der vorliegende Aufsatz hätte ohne ein großzügiges Forschungsstipendium des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C. 2010/11 und die Diskussionen mit den Mitarbeitern und Stipendiaten dort nicht entstehen können. Sehr profitiert hat der Text zudem von den Anregungen von Thomas Etzemüller, Timo Luks und Anette Schlimm, aber auch von den Vorschlägen der Redaktion und der anonymen Gutachter von Geschichte und Gesellschaft. Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt. 1 Vgl. Hans-Jörg Rheinberger u. a., Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, in: ders. u. a. (Hg.), Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin 1997, S. 7 – 21. 2 Zur Rede vom turn aufschlussreich Doris Bachman-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek 2010. Geschichte und Gesellschaft 38. 2012, S. 158 – 184 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2012 ISSN 0340-613X ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 159 weil zuvor völkisch ideologisierten Kategorie „Raum“ ist selbst bereits historisiert worden.3 Schließlich hat die historiografische Beschäftigung mit dem Raum durch eine soziologische Raumtheoriedebatte neue Impulse erhalten.4 Der Raum und seine veränderliche kulturelle und soziale Verfasstheit sind aber nicht nur Thema der Geschichtswissenschaft, die Frage nach dem Raum ist auch zum heuristischen Werkzeug eines der Hauptgeschäfte der Historiker geworden: des Periodisierens. Insbesondere bei der Auseinandersetzung mit dem Übergang von der – je nach Standpunkt – schweren oder Hochmoderne zur flüchtigen, reflexiven oder Postmoderne wird dem Wandel von Raumgrenzen und Raumvorstellungen große Bedeutung beigemessen. So scheint sich die Zäsur hin zur Welt „nach dem Boom“ in den 1970er und 1980er Jahren auch an Veränderungen festmachen zu lassen,5 die die geografischen Koordinatensysteme, die räumlichen Selbstverortungen (oft auch mental maps) von Individuen und Gesellschaften betreffen.6 Mit diesen Transformationen des Raums – beziehungsweise durch sich verändernde Räume – im letzten Drittel des zurückliegenden Jahrhunderts kann allerdings ungeheuer viel gemeint sein. So ist etwa ein Ende der „Territorialisierung“ beobachtet worden, also ein Bedeutungsverlust der Kopplung Nationalstaat/Territorium zugunsten von trans- und supranationalen Konstellationen;7 aus kultur- und mediengeschichtlicher Sicht wird die „Enträumlichung“ der Lebensentwürfe und -erfahrungen in der virtuellen oder auch Netzwerkgesellschaft diagnostiziert und auf alltags- und sozialgeschichtlicher Ebene das Auseinanderdriften von Ortsbezug und Identität in den von multiplen, „hybriden“ Zugehörigkeiten geprägten postkolonialen Migrationsgesellschaften angeführt. In allen Daseinsbereichen, so scheint es, gerät seit einigen Jahrzehnten das überkommene, hierarchische Verhältnis von Zentren und Peripherien ins Fließen – ob auf den multiethnisch besetzten Baustellen der Ölmetropolen im Nahen Osten oder in den digitalen Sozialräumen des web 2.0. Zugleich überwölbt diese komplexen, teils auch widersprüchlichen Entwicklungen ein 3 Vgl. Werner Köster, Die Rede über den „Raum“. Zur semantischen Karriere eines deutschen Konzepts, Heidelberg 2002. Zuletzt auch Christof Dipper u. Lutz Raphael, „Raum“ in der Europäischen Geschichte. Einleitung, in: JMEH 9. 2011, S. 27 – 41. 4 Vgl. Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt 2001; Markus Schroer, Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums, Frankfurt 2006. 5 Vgl. Anselm Doering-Manteuffel u. Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008. 6 Vgl. in diesem Sinne zuletzt Niall Ferguson u. a. (Hg.), The Shock of the Global. The 1970s in Perspective, Cambridge, MA 2010; Geoff Eley, End of the Post-war? The 1970s as a Key Watershed in Europea History, in: JMEH 9. 2011, S. 12 – 17. Vgl. auch Ulrich Herbert, Europe in High Modernity. Reflections on a Theory of the 20th Century, in: JMEH 5. 2007, S. 5 – 21, bes. S. 19. 7 Vgl. Charles S. Maier, Consigning the Twentieth Century to History. Alternative Narratives for the Modern Era, in: American Historical Review 105. 2000, S. 807 – 831. 160 David Kuchenbuch Makroprozess: die sogenannte Globalisierung, die Grenzen überschreitende Verflechtung der Wirtschaftsprozesse, von Kommunikation, Kulturen und sozialen Beziehungen, von Sinnbezügen, Identitäten und Erfahrungen.8 Auf der einen Seite verzeichnet die Forschung also eine zunehmende Differenzierung und Dynamisierung der alltäglichen Raumdeutungen, -aneignungen, ja, -produktionen (Henri Lefebvre), der sehr heterogenen sozio-kulturell erzeugten Räume. Auf der anderen Seite entsteht ein gewissermaßen supraterritorialer Raum, wenn nicht sogar eine Weltgesellschaft (Niklas Luhmann),9 für die es kein Außen und keine Anderen mehr zu geben scheint, was sich in der politischen Rhetorik der sogenannten global governance, in Begriffen wie „Weltinnenpolitik“ widerspiegelt.10 Gerade die Bezugnahme auf die Welt hat aber selbst eine Geschichte –11 und im Folgenden will ich einen Aspekt dieser Geschichte genauer betrachten. Es gilt zu zeigen, wie historisch variabel, wie brüchig, wie heterogen und wie lokal […] Vorstellungen der Einheit, Gesamtheit und Geschlossenheit der Welt sind und wie eng sie an spezifische Akteurinnen und Akteure sowie deren Praktiken gebunden sind. Globalgeschichte als Raumgeschichte zu fassen bedeutet demnach, eine Kulturgeschichte der Globalität zu 8 Zu diesem Konzept als einer neuen „großen Erzählung“ kritisch: Heiner Goldinger, Die Mär von der Globalisierung. Morphologie einer Täuschung, in: Historische Anthropologie 18. 2010, S. 306 – 320. Zum zirkulären Charakter mancher Globalisierungstheorie aufschlussreich: Justin Rosenberg, The Follies of Globalisation Theory. Polemical Essays, London 2000. Vgl. außerdem Matthias Middell, Der Spatial Turn und das Interesse an der Globalisierung in der Geschichtswissenschaft, in: Jörn Döring u. Tristan Thielmann (Hg.), Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008, S. 103 – 123. Als Überblick über die Positionen siehe Jürgen Osterhammel u. Niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung, München 2007, bes. S. 7 – 27. 9 Zum Topos „Weltgesellschaft“ Ulrich Beck (Hg.), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt 1998; Georg W. Oesterdiekhoff, Entwicklung der Weltgesellschaft, Münster 2005; Rudolf Stichweh, Die Weltgesellschaft. Soziologische Analysen, Frankfurt 2000. Vgl. auch Alexander Schmidt-Gernig, Ansichten einer zukünftigen „Weltgesellschaft“. Westliche Zukunftsforschung der 60er und 70er Jahre als Beispiel einer transnationalen Expertenöffentlichkeit, in: Hartmut Kaelble u. a. (Hg.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt 2002, S. 393 – 422. 10 Vgl. Ulrich Beck, Nachrichten aus der Weltinnenpolitik, Frankfurt 2010. 11 Vgl. zur Geschichte des Weltbegriffs Hermann Braun, Welt, in: Otto Brunner u. a. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 433 – 510. Als philosophische Annährung an die Geschichte des Globalismus Peter Sloterdijk, Sphären II. Globen, Frankfurt 1999. Stärker kultur- und medienwissenschaftlich Ulrike Bergermann u. a. (Hg.), Das Planetarische. Kultur, Technik, Medien im postglobalen Zeitalter, München 2010, S. 17 – 42. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 161 schreiben, die der häufig unkritisch angenommenen Universalität globaler Referenzen ihre historische Partikularität entgegenhält.12 Konkret beschäftige ich mich im Folgenden mit der Semantik des Ausdrucks „Eine Welt“. Ich will zeigen, dass dieser Begriff im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine wichtige Bezugsgröße lokaler Handlungsimperative und -muster bestimmter sozialer Gruppierungen in den „westlichen“ Gesellschaften war. Dabei geht es mir auch darum, zu verdeutlichen, dass die Rede von der Einen Welt nicht nur auf bestimmte Raumvorstellungen, auf eine zeitweilig verbreitete imaginary landscape schließen lässt, sondern dass sich an ihrem Beispiel auch veranschaulichen lässt, wie solche Vorstellungen als framings das Handeln der Menschen im Raum beeinflussen und dieses gewissermaßen formatieren. Das gilt es näher zu erläutern. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Ausdruck Eine Welt in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts zwei eng verwandte, aber doch unterschiedliche Bedeutungen hatte. Einerseits bezeichnete er die kulturelle, die historische, die soziale und ökonomische Interdependenz der Bewohner des Planeten Erde und damit verbunden ihre wechselseitige moralische Verantwortung füreinander – das Schlagwort war „One world to share“.13 Anderseits verwies er aber auch auf die Tatsache, dass die Erde eine begrenzte Entität ist, die als finites, gerecht zu verteilendes Gut aufgefasst werden musste, wenn nicht sogar als Ressource – hier lautete die Formel eher „One world only“.14 Dieser doppelte Sinngehalt des Begriffs, so meine erste These, bildete sich erst gegen Anfang der 1970er Jahre wirklich breitenwirksam heraus. Zugleich, das ist die zweite, wichtigere These, veränderte die Einsicht in die Interdependenzen in Einer Welt, die der Begriff markierte, ganz wörtlich die politisch-moralische Orientierung vieler im weitesten Sinne gesellschaftlich engagierter Menschen im „Westen“, in Europa und Nordamerika.15 Zentraler Aspekt dieser Veränderung war, dass der geografische Sinnraum und die von diesem geprägten politischen Praktiken 12 Iris Schröder u. Sabine Höhler, Welt-Räume. Annäherungen an eine Geschichte der Globalität im 20. Jahrhundert, in: dies. (Hg.), Welt-Räume. Geschichte, Geographie und Globalisierung, Frankfurt 2005, S. 9 – 47, hier S. 12. 13 Vgl. etwa Shridath Ramphal, One World to Share. Selected Speeches of the Commonwealth Secretary-General, 1975 – 9, London 1979. 14 Vgl. z. B. One World Only. Industrialisation and Environment: An International Forum under the Auspices of the Friedrich Ebert Stiftung, Tokyo 25.11. – 1.12.1973, o. O. 1973. 15 Natürlich ist bei dieser geografischen Kategorie Vorsicht geboten – einerseits angesichts des grenzüberschreitenden Probleme, um die es den „Entdeckern“ der „Einen“, der interdependenten Welt ging, und anderseits angesichts des teils dezidiert antinationalistischen Charakters der Eine Welt-Rhetorik – also auch angesichts ihrer Positionierung außerhalb etwa der bewährten Oppositionen von Ost und West, Nord und Süd etc. Dennoch, das soll das Folgende zeigen, ist es plausibel, die Eine Welt als lokales Sinnstiftungsmuster in den kapitalistischen westeuropäischen und nordamerikanischen Gesellschaften dieser Zeit zu untersuchen. 162 David Kuchenbuch vieler Menschen auseinanderrückten, und zwar insbesondere in der sogenannten undogmatischen Linken, im alternativen Milieu,16 der Gegenkultur, aber auch in manchen kirchlichen Kreisen sowie im „Helfermilieu“ humanitärer think tanks und NGOs. Mit der Welt, der Erde, ja sogar mit der Weltkarte oder dem grafisch allgegenwärtigen Globus im Blick verlagerte sich für diese Akteure im Laufe der 1970er und 1980er Jahre die politische Praxis ins eigene Leben, in den lebensweltlichen Nahbereich also, und zwar oft in Form der Problematisierung der eigenen alltäglichen Konsummuster. Diesen Umorientierungsprozess will ich versuchsweise – und bei bewusster Umdeutung dieses Begriffs – als „Glokalisierung der Moral“ bezeichnen.17 Der Bereitschaft, den individuellen, lokalen Alltag zur sinnstiftenden Größe „Welt“ in Bezug zu setzen, will ich mich dabei auch ausgehend von der Vermutung annähern – und das ist eine dritte, eher implizite These –, dass die Semantik der Einen Welt letztlich bis in die Gegenwart hinein viele Lebensentwürfe im transatlantischen Zusammenhang prägt, wenn auch in abgewandelter Weise. Dass die Erhaltung des Planeten, globale Gerechtigkeit und Alltagshandeln zusammenhängen, ist heute – insbesondere als Imperativ, nachhaltig zu agieren –18 eine bewusstseinsbestimmende Gewissheit, zudem eine, deren Infragestellung als zynisch oder naiv gilt und über deren Genese entsprechend selten gesprochen wird. Im Folgenden werde ich in einem ersten Schritt – ausgehend von einem kurzen Überblick über die Verwendung des Begriffs Eine Welt im Wandel – die wissens- und mediengeschichtlichen Rahmenbedingungen der Thematisierung von „Welt“ gegen Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre beleuchten. Es sollen bestimmte Krisendiagnosen beschrieben werden, die sich auf planetarische Grenzen und Interdependenzen bezogen, sowie Strategien des „planet management“ durch Politiker und Experten, die Reaktionen auf diese Krisenwahrnehmung darstellen (II). Daran anschließend will ich zeigen, dass sowohl die Beobachtung globaler Prozesse und Abhängigkeiten als auch die Antwort der Experten darauf eine fundamentale Kritik am 16 Vgl. zu dieser Kategorie zuletzt die Beiträge in Sven Reichardt u. Detlef Siegfried (Hg.), Das Alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa, 1968 – 1983, Göttingen 2010. 17 Vgl. Roland Robertson, Glokalisierung. Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit, in: Beck, Perspektiven der Weltgesellschaft, S. 192 – 220. Der Glokalisierungsbegriff, der eigentlich der Managementtheorie entstammt, ist ausgesprochen vage. Oft bezeichnet er fast dasselbe wie „Globalisierung“, nur dass er stärker auf die Multidimensionalität der Wirkungen etwa einer Verdichtung von Kommunikation abhebt – beispielsweise auf den paradox anmutenden Effekt, dass die Globalisierung vermehrt lokale Identitätsstiftungen hervorruft. Von „Glokalisierung der Moral“ ist im Folgenden daher nur dann die Rede, wenn es um den Imperativ „think globally, act locally“ geht. 18 Vgl. dazu Ulrich Grober, Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs, München 2010. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 163 entfesselten Fortschritts-, Planungs- und Entwicklungsdenken provozierten, die in die skizzierte Tendenz mündete, das eigene Handeln – unter Bezugnahme auf die Welt – zu problematisieren (III). Abschließend sollen diese Befunde mit Blick auf die erwähnte Forschung zu den 1970er und 1980er Jahren als Umbruchszeit diskutiert werden (IV), wobei auch die Frage gestellt werden soll, inwieweit die „glokale Moral“ auf bestimmte gegenwärtig beobachtete Veränderungen voraus weist. Dazu gehören insbesondere die viel diskutierte Fragmentierung klassischer Solidargemeinschaften in der „Postmoderne“ sowie – und damit verbunden – die zunehmende Bedeutung einer projektförmigen „Arbeit am Selbst“, wie sie der oft zitierte „neue Geist des Kapitalismus“ heute vermeintlich ausschöpft.19 II. „Raumschiff Erde“. Wissenschaftliche Krisendiskurse und supranationales planet management in den 1960er und 1970er Jahren Ausdrücke wie Eine Welt, One World oder ungeteilte Welt – eigentlich ja Tautologien – entstanden nicht erst in den 1970er Jahren. Sie wurden jedoch im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts häufiger verwendet, und es lässt sich ein Wandel ihrer Bedeutung und der diskursiven Kontexte, in denen sie auftauchten, feststellen.20 Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kamen sie nur 19 Vgl. Luc Boltanski u. ðve Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2006. 20 Diese Beobachtung stützt sich auf eine Durchsicht der Kataloge der Library of Congress und der Staatsbibliothek zu Berlin hinsichtlich der Vorkommenshäufigkeit der Lexeme „one world“ und „eine Welt“, also der unmittelbaren Kookkurrenz der Wörter „one“ und „world“ beziehungsweise „eine/einer/einen“ und „Welt“ in Buch-, Reihen- und Zeitschriftentiteln und -untertiteln im 20. Jahrhundert. Verzeichnet wurden Erstauflagen, beziehungsweise bei Reihen und Zeitschriften das Ersterscheinungsjahr. Hier wird nicht der Anspruch einer lückenlosen korpusgestützten Erfassung erhoben – zumal die Repräsentativität von Bibliothekskatalogen mit Blick auf gesellschaftliche Diskurse zweifelhaft ist. Dennoch zeigt die Stichprobe einen Anstieg der Anzahl dieser Lexeme im Deutschen und im Englischen ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, mit einer Spitze in den 1990er Jahren: Während „one world“ zwischen 1900 und 1964 52 Mal auftaucht (mit einer Häufung – 24 Titel – unmittelbar nach Erscheinen von Wendell Willkies „One World“ in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre), findet die Phrase sich 1965 bis 2000 in 101 Titeln, wobei die Spitze in den 1990er Jahren liegt (34 Titel). Schwieriger stellt sich die Zählung angesichts der verschiedenen Bedeutungen des Artikels „eine“ für deutschsprachige Veröffentlichungen dar – hier ist eine gewisse Interpretation unumgänglich. Indizien dafür, dass der Begriff mit den Konnotationen „ganze“, „geeinte“ beziehungsweise „einzige“ Welt verwendet wurde, sind hier der zusätzliche bestimmte Artikel („Die eine Welt“) oder die Großschreibung („Eine Welt“). In dieser Weise 164 David Kuchenbuch vereinzelt zur Anwendung; kurz vor und nach 1945 dann vor allem bei der Erörterung einer friedlichen, durch die Vereinten Nationen stabilisierten Nachkriegsordnung – etwa in dem gerade im US-amerikanischen Diskurs nahezu sprichwörtlichen Buch „One World“, das der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Wendell Willkie 1943 veröffentlichte.21 Willkies Bestseller – die Beschreibung seines Flugs um die Welt im Jahr zuvor, der ihn unter anderem in den Nahen Osten, nach Indien und China geführt hatte – befürwortete einen entschieden anti-isolationistischen Kurs in der amerikanischen Außenpolitik. Willkie beschrieb seine Treffen mit Politikern alliierter Staaten, aber auch Zufallsgespräche mit deren Bürgern und zeichnete dabei das Bild einer durch moderne Verkehrsmittel geschrumpften Erde. Sein Reisebericht antizipierte durchaus hellsichtig ein Ende des Kolonialismus, vor allem jedoch entwarf er eine Zukunft des Wohlstands,22 der durch freien Handel zwischen Industrienationen geschaffen und durch eine Art „Weltföderalismus“ garantiert werden sollte – Themen, die bis in die 1960er Jahre hinein die Eine Welt-Semantik bestimmen sollten.23 Im selben Zeitraum erscheint der Begriff zwischen 1900 und 1964 in lediglich 9, zwischen 1965 und 2000 in 60 Titeln (davon in den 1990er Jahren 33). 21 Vgl. Wendell Willkie, One World, London 1943; deutsch: Unteilbare Welt, Stockholm 1944. Vgl. auch William George Carr, One World in the Making. The United Nations, Boston 1946; Eliot Grinnell Mears, A Trade Agency for One World, New York 1945; Ernest Minor Patterson (Hg.), Looking Toward One World, Philadelphia 1948; Ralph Barton Perry, One World in the Making, New York 1944; Gordon Donald Hall, The Hate Campaign against the U. N. One World under Attack, Boston 1952. 22 Victoria De Grazia scheint sich implizit auf Willkie zu berufen, wenn sie mit dem heuristischen Begriff „One Worldism“ eine Haltung bezeichnet, die die weltweite Verbreitung der Konsumgesellschaft nach amerikanischem Vorbild befürwortet. Mit „One Worldism“ meint sie den Gedanken bestimmter US-Ideologen der Nachkriegszeit, dass Wünsche und Bedürfnisse der Menschen – etwa hinsichtlich besserer materieller Lebensbedingungen, Freizeit, Komfort – weltweit prinzipiell identisch sind: Victoria de Grazia, Irresistible Empire. America’s Advance through Twentieth-Century Europe, Cambridge 2005, S. 210. 23 In den 1950er und 1960er Jahren verwendeten zudem verschiedene indische Autoren den Begriff wiederholt im Zusammenhang mit Forderungen nach einer teils regelrecht autokratischen „Weltregierung“. Vgl. z. B. Sudhir Bera, A Dream for One World, Kalkutta 1976; Shankar Dev, One World. One Government, New Delhi 1974; Swami Madhavtirtha, One World Government, Based on Field Theory, o. O. 1954; Guru Prasad Mohanty, One World. Why, How and When, o. O. 1965. Vgl. außerdem Arnold Toynbee, One World and India, Kalkutta 1960. Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch die Reaktivierung dieser Semantik unter negativen Vorzeichen seit den 1990er Jahren: Unter rechtsradikalen US-amerikanischen Aussteigern kursieren Verschwörungstheorien, die sich auf ein „One-World-Government“ richten, das vermeintlich auf die Abschaffung der amerikanischen Freiheitsrechte dringt. Das ähnelt manchen Äußerungen prominenter „Islamkritiker“, etwa Ayaan Hirsi Alis, die Barack Obama ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 165 erschienen die Begriffe Eine Welt und One World allerdings auch vielfach in kirchlichen Kontexten. Im Mittelpunkt standen dabei die ökumenische Bewegung und die Herausforderungen der Dekolonisierung, etwa die Absicht, Kontakte zu den Kirchen in den neuen Staaten zu stiften – wobei teils durchaus ein missionarischer Ton anklang.24 Nicht selten transportierte der Begriff Eine Welt während des Kalten Krieges zudem Kritik an der Aufteilung der Welt in politische Blöcke und fasste die Forderung in ein Schlagwort, die Mauern zwischen Ost und West, zwischen der „freien“ „ersten“ und der „zweiten“ Welt einzureißen beziehungsweise die Barrieren abzubauen, die die blockfreie „dritte“ Welt umgrenzen.25 Oft ging es dabei implizit um den drohenden Atomkrieg, der ja erstmals in der Geschichte die Vernichtung der ganzen Welt nicht nur zum rhetorischen Topos, sondern zur konkreten Naherwartung machte und damit die Weltbevölkerung zur potentiellen Schicksalsgemeinschaft, die vor der Alternative stand: „Eine Welt oder keine“.26 Für die Jahre ab ca. 1965 lässt sich dann nicht nur ein – bis in die 1990er Jahre anhaltender – Anstieg der Zahl von Publikationen verzeichnen, die die Eine Welt im Titel führen, sondern zudem ein veränderter Gebrauch der Formulierung beobachten. Sie bleibt verbunden mit den Themen Ökumene, Weltregierung und Kernwaffenkritik, erscheint nun jedoch auch in Verbindung mit Topoi wie der Überbevölkerung und der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung, den Problemen der sogenannten „Entwicklungsländer“ und der sozialen Ungerechtigkeit des Gefälles zwischen Norden und Süden; in den 1980er Jahren taucht sie überdies in den Slogans und angesichts seiner Politik der demonstrativen Öffnung gegenüber „dem Islam“ als naiven „One Worlder“ bezeichnet, der, so Hirsi wörtlich, dem „Sieg des Westens im Kampf der Zivilisationen“ im Weg stehe: vgl. Ayaan Hirsi Ali, How to Win the Clash of Civilizations, in: Wall Street Journal, 18. 8. 2010, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703 426004575338471355710184.html. 24 Vgl. etwa Francis Clement Capozzi, One World and One God. A Twentieth Century Homily, Boston 1945; Olive L. Johnson u. Frances M. Nall, One Church for One World, New York 1951; Norman Victor Hope, One Christ, One World, One Church. A Short Introduction to the Ecumenical Movement, Philadelphia 1953; Henry E. Kolbe, One World under God, Nashville o. J. [1963]; Lesslie Newbigin, A Faith for this One World?, London 1961; Albert Theodore, Christian Responsibility in One World, New York 1965. Zu den Herausforderungen der Dekolonisierung vgl. beispielsweise Clarence Tucker Craig, One God, One World. The Bible and Our Expanding Faith, New York 1943; Foreign Missions Conference of North America, One World in Christ. A Program of Advance in Foreign Missions, Columbus, Ohio 1948; William Richey Hogg, One World, one Mission, New York o. J. [1960]; International Student Missionary Convention, One Lord, One Church, One World. A Missionary Compendium, Chicago 1958. 25 Vgl. zur Entstehung dieser Einteilung zuletzt Christoph Kalter, Die Entdeckung der Dritten Welt. Dekolonisierung und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt 2011. 26 Vgl. Ossip Kurt Flechtheim, Eine Welt oder keine?, Frankfurt 1964; Dexter Masters u. Katharine Way (Hg.), One World or None, New York 1946. 166 David Kuchenbuch Veröffentlichungen der Friedensbewegung auf. Die Eine Welt durchzieht nicht nur verschiedenste Diskurse – sie liegt auch quer zu sehr verschiedenartigen Sprecherpositionen und Kommunikationssituationen. Politiker und Politik beratende Experten, Vertreter supranationaler Gremien und kirchlicher Organisationen führen sie im Munde, aber auch, wie eingangs angedeutet, Akteure aus der gesellschaftskritischen counter culture. Diese interdiskursive Konjunktur der Rede von der Einen Welt lässt sich zunächst auf die Tatsache zurückführen, dass gerade für Europäer vermehrt Gelegenheit bestand, mit Menschen aus anderen Erdteilen in Kontakt zu kommen – zu nennen sind hier die Anwerbung von „Gastarbeitern“, der Massentourismus und auch die Wanderungsbewegungen in Folge der Dekolonisierung. Auffällig ist aber auch, dass der Ausdruck zu einem Zeitpunkt an Resonanz gewann, als der Planet wissenschaftlich und medial auf neue Weise sichtbar gemacht geworden war. Gegen Ende der 1960er Jahre verbreiteten die Massenmedien erstmals vergleichsweise scharfe (farb-)fotografische Draufsichten des Planeten aus dem All – sie waren im Zuge der amerikanischen Apollo-Expeditionen entstanden. Die Rezeption dieser Bilder war von Beginn an von Texten begleitet, die die auratische Schönheit des geometrisch perfekten „Erdballs“, vor allem aber die Fragilität des „blauen Planeten“ und die kollektive Verantwortung aller Menschen für dessen Erhalt thematisierten – wobei nicht selten der Begriff One World fiel. Solche Interpretationen standen durchaus in Verbindung mit dem strategischen Versuch der amerikanischen Kalten Krieger, ihr ursprünglich rein militärisches Raketenprogramm zu einer „Menschheitsmission“ umzudeuten – was durch den Hinweis auf die weltumspannende Gemeinschaft all jener Menschen beglaubigt wurde, die die Mondlandung am Fernseher mitverfolgt hatten. In seiner Wirkung kaum zu unterschätzen ist aber auch ein Narrativ, das bereits kurz nach der Veröffentlichung der Bilder lanciert wurde: Es war die Rede von der „Selbstbegegnung der Erde“.27 In den Erfahrungsberichten der Astronauten ließ sich oft lesen, diese hätten auf ihrer Reise weniger den Mond erobert als vielmehr die Erde entdeckt. Für die NASA selbst hätten Fotografien des Planeten ursprünglich geringe Priorität besessen. Der Astronautenblick machte die Erde als begrenzte physikalische Entität sichtbar, wenn nicht gar als rührend schutzlose Heimat aller Menschen. Zugleich ließ er sich aber auch als Abkehr vom fortschrittssicheren Blick auf die endlose frontier des Alls interpretieren.28 27 Vgl. Günther Anders, Der Blick vom Mond. Reflexionen über Weltraumflüge, München 1970, bes. S. 89 – 97. 28 Die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Apollo 8-Aufnahme „Earthrise“ (1968) und des Apollo 17-Bildes „Whole Earth“ (1972) sind gut erforscht. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie insbesondere die entstehende amerikanische Umweltbewegung entscheidend prägten. Auf dem ersten Earth Day 1970 etwa ließen sich Erdfotografien kaum übersehen. Seit den 1970er Jahren sind sie auf ungezählten ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 167 Die große Aufmerksamkeit, die den Erdfotografien gezollt wurde, zeigt zumindest eins: Die synoptische Perspektive der Mondfahrer aufs Weltganze, beziehungsweise die Deutung ihrer Bilder als Repräsentationen der Einen, der zusammenhängenden, endlichen Welt leuchtete vielen Menschen ein. Es bestand, so scheint es, eine Wechselwirkung zwischen der Karriere dieser Bilder und der Entstehung eines neuen Problembewusstseins, das der Diffusion wissenschaftlicher Interdependenzkonzepte in gesellschaftliche Debatten, gerade auch der Gegenkultur, der 1970er Jahre folgte. Es liegt auf der Hand, dass die Rezeption der Fotografien vom Planeten mit einer spätestens ab Mitte des Jahrzehnts kaum zu überhörenden Diskussion über globale limits und Grenzwerte zusammenhing. Deren Thema waren einerseits Wachstumsgrenzen, aber auch – und damit verbunden – die Notwendigkeit einer individuellen Selbstbegrenzung. Meines Erachtens lassen sich grob zwei, unmittelbar aufeinander folgende Stränge dieser Debatte unterscheiden. Zum einen prägte der Topos „globale Interdependenz“ Diskurse von Akteuren, die vergleichsweise optimistisch auf die planvolle Bewältigung grenzüberschreitender Probleme drängten. Zum anderen verband sich mit der Einsicht in die weltweiten wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse aber auch eine wesentlich fundamentalere Kritik am Fortschrittsmodell der „westlichen Gesellschaften“ – darum soll es in Abschnitt III. gehen. Erstens war bereits in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre eine ganze Reihe von im weitesten Sinne ressourcenökonomischen, teils neo-malthusianischen Prognosen zur „Tragfähigkeit“ des Planeten erarbeitet worden,29 also zu den „natürlichen“ Grenzwerten von Bevölkerungsentwicklung, agrarischer Produktion und Welternährung. Diese Prognosen widmeten sich Fragen der technischen Optimierbarkeit des „Systems Erde“ und entsprachen damit noch ganz dem Denkstil der Kybernetik und Futurologie des zu Ende gehenden „Jahrzehnts von Planbarkeit und Machbarkeit“.30 Die Abbildungen unterstriPostern, Buttons, T-Shirts und Buchumschlägen abgebildet worden. Vgl. Robert Poole, Earthrise. How Man First Saw the Earth, New Haven, CT 2008. Die gewählten Bilder gehorchten in ihrer Komposition teils alten Gestaltungstraditionen. Oft wurde zusätzlich mittels Bildbearbeitung die Singularität des belebten, vor dem schwarzen Nichts des Alls schwebenden Planeten herausgestrichen: vgl. Denis Cosgrove, Contested Global Visions. One-World, Whole-Earth, and the Apollo Space Photographs, in: Annals of the Association of American Geographers 84. 1994, S. 270 – 294. Vgl. außerdem ders., Apollo’s Eye. A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination, Baltimore 2001; Horst Bredekamp, Blue Marble. Der Blaue Planet, in: Christoph Markschies u. a. (Hg.), Atlas der Weltbilder, Berlin 2011, S. 367 - 375 sowie Robin Kelsey, Reverse Shot. Earthrise and Blue Marble in the American Imagination, in: New Geographies 4. 2011, S. 10 – 16. 29 Vgl. Sabine Höhler, „Carrying Capacity“. The Moral Economy of the „Coming Spaceship Earth“ in: Atenea XXVI. 2006, S. 59 – 74. 30 Zu Prognostik, Kybernetik und Planungseuphorie in den 1960er Jahren Gabriele Metzler, „Geborgenheit im gesicherten Fortschritt“. Das Jahrzehnt von Planbarkeit und 168 David Kuchenbuch chen in diesem Kontext, wie dringend nötig eine Beschäftigung mit den Bedingungen war, die hergestellt werden mussten, um ein dauerhaftes Überleben im „spaceship earth“ (so die bezeichnende, weil technizistische Metapher für den Planeten) zu sichern.31 Auf den Umschlägen einer ganzen Reihe von populär aufbereiteten, teils regelrecht alarmistisch betitelten Büchern prangten hochsymbolische Bearbeitungen der Apollo-Fotografien, die diesen Handlungsbedarf unterstrichen: der Planet als kleine Kugel in Menschenhänden, als fragiles Ei, als Murmel am Abgrund, in Ketten gelegt. Als visuelle Repräsentation der physikalischen Begrenztheit der Erde und der Abhängigkeit ihrer Bewohner von ihr und von einander – aber auch der jüngst wissenschaftlich entdeckten biologischen „Systeme“ Ökosystem und Biosphäre – versinnbildlichten Ansichten des Planeten also die fast zum Schlagwort gewordenen „Grenzen des Wachstums“.32 Sie untermauerten die Naherwartung, dass der globale, der Systemkollaps angesichts der „Menschheitskrise“,33 also des exponentiellen Wachstums von Wirtschaft, Konsum und Weltbevölkerung bei einer gleichzeitig bloß linear zunehmenden Effektivität der Ressourcenausnutzung, kurz bevor stehe. Gerade die düstersten jener Szenarien, die eine M.I.T.-Forschergruppe um Dennis und Donella Meadows im Auftrag des Club of Rome am computergestützten „Weltmodell“ errechnet hatten, lassen sich als Synthesen verschiedener zu dieser Zeit virulenter Krisendiagnosen betrachten – Diagnosen ökologischer, ökonomischer und Machbarkeit, in: Matthias Frese u. a. (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufstieg. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 2003, S. 777 – 797; Alexander Schmidt-Gernig, Das „kybernetische Zeitalter“ – Zur Bedeutung wissenschaftlicher Leitbilder für die Politikberatung am Beispiel der Zukunftsforschung der 60er und 70er Jahre, in: Stefan Fisch u. Wilfried Rudloff (Hg.), Experten und Politik. Wissenschaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspektive, Berlin 2004, S. 349 – 368; sowie die Beiträge in Michael Hagner u. Erich Hörl (Hg.), Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, Frankfurt 2008. Vgl. außerdem Heinrich Hartmann (Hg.), Zukunftswissen. Prognosen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit 1900, Frankfurt 2010. 31 Vgl. Barbara Ward, Spaceship Earth, New York 1966; Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth, Carbondale 1969. Vgl. zu dieser Figur Sabine Höhler, „Raumschiff Erde“. Lebensraumphantasien im Umweltzeitalter, in: dies u. Schröder, Welt-Räume, S. 258 – 281. 32 Damit einher ging eine Art Entmetaphorisierung des Begriffs „Welt“, der oft nicht mehr eine abstrakte Totalität, sondern eine materielle Realität meinte. Formulierungen wie „worldwide world“ (Michael Serres, The Natural Contract, in: Critical Inquiry 19. 1992, S. 1 – 21, hier S. 15) oder „Global Earth“ (Fernando Elichirigoity, Planet management. Limits to Growth, Computer Simulation, and the Emergence of Global Spaces, Evanston 1999, S. 6) sind nur auf den ersten Blick Tautologien, sie weisen auf Versuche hin, den Weltbegriff regelrecht zu re-ontologisieren. 33 Jay W. Forrester u. Eduard Pestel, Der teuflische Regelkreis. Das Globalmodell der Menschheitskrise, Stuttgart 1972. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 169 demografischer Art. Das aus diesen Forschungen 1972 hervorgegangene Buch „The Limits to Growth“ verkaufte sich millionenfach.34 Der „Ölpreisschock“ ein Jahr später schien die Begrenztheit der globalen Ressourcen zusätzlich unter Beweis zu stellen, auch wenn er tatsächlich eher wirtschaftlichen Abhängigkeiten geschuldet war, als dass er ein Erreichen der sogenannten peak oil markierte, also der maximalen Förderrate der weltweiten Mineralölvorkommen.35 Sicherlich ist es möglich, viele Kennzeichen dieses in der jüngeren amerikanischen Forschung sogar als „Shock of the Global“ interpretierten Problembewusstseins bereits früher ausmachen.36 Es ist ohnehin müßig, nach dem Beginn eines Verständnisses der physischen Welt als Letztreferenz politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Verhältnisse zu fragen. Offenkundig prägte die Welt das kollektive Imaginäre internationalistischer politischer Strömungen im 19. Jahrhundert; Globen brachten in Imperialismus und Kolonialismus die territorialen Machtansprüche der entstehenden Weltmächte zum Ausdruck.37 Der Sinnraum „Welt“ kennzeichnete konkurrierende Konzepte von der 34 Vgl. Donella H. Meadows u. a., The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York 1972. Zur Studie Elichirigoity, Planet Management; Niels Freytag, „Eine Bombe im Taschenbuchformat“? Die „Grenzen des Wachstums“ und die öffentliche Resonanz, in: Zeithistorische Forschungen 3. 2006, http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Freytag-3-2006; Friedemann Hahn, Von Unsinn bis Untergang. Rezeption des Club of Rome und der Grenzen des Wachstums in der Bundesrepublik der frühen 1970er Jahre, Diss. Universität Freiburg 2006; Patrick Kupper, „Weltuntergangs-Vision aus dem Computer“. Zur Geschichte der Studie „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972, in: Jens Hohensee u. Frank Uekötter (Hg.), Wird Kassandra heiser? Beiträge zu einer Geschichte der falschen Öko-Alarme, Stuttgart 2003, S. 98 – 111; Elke Seefried, Towards The Limits to Growth? The Book and its Reception in West Germany and Britain 1972/73, in: German Historical Institute London Bulletin 33. 2011, S. 3 – 37. Vgl. außerdem Rüdiger Graf, Die Grenzen des Wachstums und die Grenzen des Staates. Konservative und die ökologischen Bedrohungsszenarien der frühen 1970er Jahre, in: Dominik Geppert u. Jens Hacke (Hg.), Streit um den Staat. Intellektuelle Debatten in der Bundesrepublik, 1960 – 1980, Göttingen 2008, S. 207 – 228. 35 Rüdiger Graf hat gezeigt, dass das OPEC-Embargo für deutsche Politiker durchaus nicht als Schock kam: ders., Gefährdungen der Energiesicherheit und die Angst vor der Angst. Westliche Industrieländer und das arabische Ölembargo 1973/74, in: Patrick Borman u. a. (Hg.), Angst in den internationalen Beziehungen, Göttingen 2010, S. 227 – 250. 36 Vgl. Ferguson, The Shock of the Global. 37 Vgl. in diesem Zusammenhang Iris Schröder, Das Wissen von der ganzen Welt. Globale Geographien und räumliche Ordnungen Afrikas und Europas 1790 – 1870, Paderborn 2011. 170 David Kuchenbuch Weltordnung,38 er überformte aber auch die Fortschrittsgewissheit, die aus den Weltausstellungen und aus den großen Infrastrukturprojekten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sprach. Die Welt war seit der Jahrhundertwende die Bezugsgröße verschiedener Bemühungen um Effizienz – etwa um eine weltweite Standardisierung von Raummaßen, um die Kompatibilität von Kommunikationstechniken, aber auch um eine vereinheitlichte Weltzeit und sogar die Weltsprache –39 und sie prägte die Ziele des Missionswesens und den Gedanken der Weltkirche. Und selbstverständlich trugen die Weltwirtschaftskrise, die beiden Weltkriege mit ihren Flüchtlingsströmen, und, wie eingangs erwähnt, die Dekolonisierung das ihre zur Bewusstwerdung um den grenzüberschreitenden Charakter gesellschaftlicher Prozesse bei – und um die Bedeutung internationaler Organisationen und supranationaler Gremien für deren Regulierung.40 Schon in den 1940er Jahren waren außerdem insbesondere in den USA die Appelle zur Intensivierung des geostrategischen Denkens lauter geworden. Vermehrt wurde beispielsweise thematisiert, in welch bedrohliche Nähe die „Achsenmächte“, später dann die Sowjetunion im Zeitalter der „raumüberwindenden“ Flug- und Raketentechnik gerückt waren, und damit Gebiete, die noch wenige Jahrzehnte zuvor weit entfernt schienen. Das wurde auch mit neuen kartografischen Abbildungstypen veranschaulicht, die durch ihre Verbreitung in Tageszeitungen die öffentliche Debatte – unter anderem über Willkies „One World“ –41 prägten, und die in gewisser Hinsicht die Perspektive der Erdfotografien zwei Jahrzehnte später vorwegnahmen. Veröffentlichungen der 1970er Jahre aber, die die Eine Welt zum Thema hatten, thematisierten mit Nachdruck die faktische wirtschaftliche, soziale und ökologische Interdependenz von Problemen in verschiedenen Erdteilen. 38 Vgl. die Beiträge in Sebastian Conrad u. Dominic Sachsenmaier (Hg.), Competing Visions of World Order. Global Moments and Movements, 1880s–1930s, New York 2007. 39 Dazu ausgezeichnet Markus Krajewski, Restlosigkeit. Weltprojekte um 1900, Frankfurt 2006. Vgl. auch Jo-Anne Pemberton, Global Metaphors. Modernity and the Quest for One World, London 2001. 40 Vgl. etwa Akira Irye, Global Community. The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley 2002 sowie die Beiträge in John Boli u. George M. Thomas (Hg.), Constructing World Culture. International Nongovernmental Organizations since 1875, Stanford 1999. 41 Das Cover von Willkies Buch zeigt eine Weltkarte von Richard Edes Harrison, der den Begriff „One World“ 1942 noch auf den geostrategischen Charakter des Kriegs bezogen hatte: Vgl. Richard Edes Harrison, One World, One War. A Map Showing the Line-Up and the Strategic Stakes in this the First Global War, o. O. [New York] 1942. Vgl. zu solchen Visualisierungen Susan Schulten, Richard Edes Harrison and the Challenge to American Cartography, in: Imago Mundi 50. 1998, S. 174 – 188 sowie Denis Cosgrove u. Veronica della Ora, Mapping Global War. Los Angeles, the Pacific, and Charles Owens’s Pictorial Cartography, in: Annals of the Association of American Geographers 95. 2005, S. 373 – 390. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 171 Globale Risiken erschienen als geteilte Risiken;42 im viel gelesenen sogenannten Brandt-Report etwa, der ab Mitte des Jahrzehnts von einem hochkarätig besetzten Gremium erstellt worden war, und der als Zusammenschau einer ganzen Reihe der in den Jahren zuvor diagnostizierten globalen Krisen betrachtet werden kann, wurde die Welt als ein „fragile and interlocking system“ verstanden, und man beschwor zugleich die integrative Kraft der grenzüberschreitenden gemeinsamen Interessen.43 Wie bereits einige viel gelesene Vorgängertexte, die die Eine Welt im Titel führten,44 empfahl der Bericht den Abbau von Handelsbarrieren, vor allem aber drängte er auf eine planerische Bewältigung der planetarischen Probleme durch supranationale Expertenstäbe – er ist diesbezüglich auch klar als Produkt einer Phase der relativen Entspannung im Kalten Krieg zu erkennen. Die Optimierung der globalen Tragfähigkeit mit Blick auf die „Welternährungskrise“,45 die effizientere und zugleich gerechtere Verwaltung der vorhandenen Ressourcen und die Verbesserung ihrer technischen Ausnutzung, überhaupt die Wiederherstellung des Gleichgewichts verschiedener, dem Anschein nach homologer Systeme (sozialer, ökonomischer, biologischer Art) verstand man als komplex miteinander verschränkte Aufgaben. Man war sich einig: Wirtschaftswissenschaftler und Futurologen, die Agronomen der green revolution, also der wissenschaftsgestützten Ertragssteigerung in der Landwirtschaft, Ernährungs- und Bevölkerungsexperten – sie alle mussten nun konzertiert und gemeinsam mit der Politik das „stewardship of the earth“ übernehmen.46 Gegen Ende der 1960er Jahre bündelten sich im Begriff Eine Welt Forderungen 42 Die Evidenz dieser Beobachtung lässt sich – etwas später – vielleicht auch am Erfolg von Ulrich Becks „Risikogesellschaft“ ablesen, einem Buch, das just im grenzüberschreitenden Charakter bestimmter Risiken ein zentrales Merkmal der angebrochenen „reflexiven Moderne“ ausmachte: ders., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 1986. 43 North-South. A Programme for Survival. Report of the Independent Commission on International Development Issues, Cambridge, MA 1980, S. 13. Vgl. auch Towards One World? International Responses to the Brandt Report, hg. v. Friedrich Ebert Stiftung, London 1981. 44 Zu nennen wären beispielsweise Publikationen vom Vorsitzenden der Standing Conference on the Second Development Decade, Donald Tweddle, Only One World. A New Look at Development, London 1975 oder die Taschenbuchausgabe des Abschlussberichts zur Stockholmer United Nations Conference on The Human Environment: Barbara Ward u. Ren Dubos, Only One Earth. The Care and Maintenance of a Small Planet, London 1972. Vgl. auch The Stockholm Conference, Only One Earth, London 1972 sowie Barbara Ward u. a. (Hg.), Who Speaks for Earth?, New York 1973. 45 Vgl. Christian Gerlach, Die Welternährungskrise, 1972 – 1975, in: GG 31. 2005, S. 546 – 585. 46 Ward u. Dubos, Only One Earth, S. 25. 172 David Kuchenbuch nach einer blockübergreifenden Planung und Kontrolle von Wirtschaft und Demografie sowie – pejorativ bezeichnet – „ökotechnokratisches“ Denken.47 III. Experten- und Wachstumskritik und die „Glokalisierung der Moral” ab Mitte der 1970er Jahre Die Rede von der Einen Welt hatte aber, zweitens, ab etwa 1973 noch eine weitere, radikalere Implikation, und zwar hinsichtlich der räumlichen Nahbezüge des politisch-moralischen Bewusstseins vieler Menschen im transatlantischen alternativen Milieu. Die Interpretation der Erde als dynamisches System, als Interdependenzgeflecht, bildete auch die Grundlage einer weniger offensichtlichen, jedoch langfristig – mit Blick auf die eingangs erwähnte Frage nach Raumvorstellung und Moral – wirkungsmächtigeren Variante des Diskurses über „Welt“. Wo nämlich Teil und Ganzes sich wechselseitig beeinflussten, wo das homöostatische Gesamtsystem Erde, das Gleichgewicht der „World Dynamics“,48 durch die disproportionale Entwicklung einzelner Komponenten in akute Gefahr geraten schien, da lag eine Inversion des Blicks nahe, ein Problematisierung der eigenen Rolle im Weltzusammenhang. Viele prominente Befürworter der planerischen Bewältigung der planetarischen Krisen – etwa die Ökonomen Kenneth Boulding und Barbara Ward, der Ernährungswissenschaftler Georg Borgström, der Mikrobiologe Ren Dubos, der Bevölkerungswissenschaftler Paul R. Ehrlich oder die Verfasser der „Limits to Growth“-Studie – boten sich als Berater der Politik an. Sie zielten auf eine Implementierung ihres „Weltwissens“ mit Blick auf die technisch-politische Lösung der globalen Probleme. Gesellschaftskritische Autoren wie beispielsweise Ernst Friedrich Schumacher griffen nun zwar deren Krisendiagnosen auf und arbeiteten damit einer Disziplinengrenzen überschreitenden Neuordnung und Stabilisierung des Diskurses über die Welt zu. Während die Experten aber allenfalls unterstrichen, es sei wichtig, dass ihre Einsichten beim „Normalbürger“ einsickerten, um diesen zu mobilisieren, demokratisch Druck auf die politisch Verantwortlichen auszuüben, zogen diese Kritiker durchaus andere Schlüsse aus der Weltlage. Es ging ihnen darum, ein Problembewusstsein zu schaffen, das eben nicht nur das planet management im großen Stil zu legitimieren hatte. Vielmehr sollte es einzelne Menschen dazu bewegen, über den eigenen Beitrag zur Entstehung der prekären Situation des Planeten nachzudenken. In den 1970er Jahren lässt sich eine Variante des Eine WeltAppells beobachten, die ein Steuerungsdenken, das erst im All an seine 47 Vgl. Wolfgang Sachs, Satellitenblick. Die Ikone vom blauen Planeten und ihre Folgen für die Wissenschaft, in: Ingo Braun u. Bernward Joerges (Hg.), Technik ohne Grenzen, Frankfurt 1995, S. 305 – 346. 48 Jay W. Forrester, World Dynamics, Cambridge, MA 1971. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 173 Grenzen stieß, just als Ursache der Probleme identifizierte, die dieses Denken zu bewältigen anhob. Viele Autoren identifizierten das exponentielle Wachstum – weit über die Bedeutung des Begriffs hinsichtlich von Produktivität und Absatzsteigerung hinaus – auf einer abstrakten Ebene mit der Hybris der „westlichen Kultur“ schlechthin, mit Technikbegeisterung, Expertokratie, Fortschrittsoptimismus und Machbarkeitsideologie. Verschiedene Beobachtungen schienen diese These zu stützten: Spätestens seit Veröffentlichung des von der Weltbank in Auftrag gegebenen Pearson-Berichts 1969, der die Ideologie der „Entwicklung durch Wachstum“ zum Teil zurückwies,49 lag auf der Hand, dass die modernisierungstheoretisch geprägte Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit beziehungsweise die „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der „Dritten Welt“ gescheitert waren.50 Die Kritik an der „Entwicklung“, die nicht selten als quasi-kolonialistische Strategie zur Schaffung neuer Absatzmärkte interpretiert wurde, war auch den Imperialismusdiagnosen der Protestbewegung der späten 1960er Jahre geschuldet – überhaupt hatten Dekolonisierung, „68“ und der Vietnamkrieg die Aufmerksamkeit für Konflikte in zuvor wenig beachteten Weltregionen erhöht, aber auch die länderübergreifende Vernetzung politischer Akteure vorangetrieben.51 Zu Beginn der 1970er Jahre wurde aber nun ganz grundsätzlich festgestellt, dass die „westlichen“ Instrumente einer „aufholenden Entwicklung“ sich nicht kontextunabhängig anwenden ließen, ja, dass sie einem Eurozentrismus und naiven Universalismus geschuldet waren, der endgültig ausgedient hatte.52 Verkürzt dargestellt, markiert diese Skepsis auch einen intellektuellen Umbruch, in dessen Zuge der Konstruktionscharakter bestimmter, oft dezidiert als westlich apostrophierter Deutungskategorien entdeckt und gerade sprachliche Sinnstiftungsprozesse als „große Erzählungen“ entlarvt wurden – ein Prozess, der eigentlich bis heute nachwirkt, mit einiger Verspätung auch in der Historiografie, im Trend zur 49 Mit mehr Literatur Hubertus Büschel, Geschichte der Entwicklungspolitik, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6. 6. 2011, http://docupedia.de/zg/Geschichte_der_Entwicklungspolitik?oldid=75517. 50 Vgl. zu diesem Scheitern, das selbst nur vor dem Hintergrund bestimmter Modernisierungsziele diagnostiziert werden kann: Hubertus Büschel u. Daniel Speich, Einleitung – Konjunkturen, Probleme und Perspektiven der Globalgeschichte von Entwicklungszusammenarbeit, in: dies. (Hg.), Entwicklungswelten. Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbeit, Frankfurt 2009, S. 7 – 29. 51 Vgl. dazu etwa Martin Klimke, The Other Alliance. Student Protest in West Germany and the United States in the Global Sixties, Princeton 2009. 52 An dieser Stelle darf auch der Hinweis auf eine weitere Welttheorie dieser Jahre nicht fehlen, nämlich Immanuel Wallersteins „Weltsystem“, vgl. ders., The Modern WorldSystem. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York 1974. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Hans-Heinrich Nolte, Die eine Welt. Abriß der Geschichte des internationalen Systems, Hannover 1982. 174 David Kuchenbuch Historisierung von Großkategorien wie „Modernisierung“ oder eben auch „Entwicklung“.53 Die Gewissheit, die Weltlage verbessern zu können, die aus den Aussagen vieler Experten und Politiker sprach, schien diese Lage also in den Augen ihrer Kritiker unfreiwillig zu perpetuieren.54 Es galt eben nicht, globale Missstände „von oben“ zu korrigieren, auf die „planetarische Wende“ mittels einer „Weltregierung“ zu reagieren.55 Vielmehr sollten Probleme schrittweise im Kleinen angegangen werden, durch individuelles Umdenken und durch persönlichen Verzicht. Den Experten wurde unterstellt, sie neigten dazu, den Planeten zu trivialisieren. Das glaubte man schon an den Namen mancher think tanks ablesen zu können, etwa an dem der 1974 vom Agronomen Lester R. Brown gegründeten NGO Worldwatch.56 Der technokratischen Selbstüberschätzung, die sich auch in der Vereinheitlichung des Planeten im eigentlichen Wortsinn abzubilden schien, nämlich in der Interpretation des Weltganzen als steuerbare Entität – auch dafür stand das Bild vom „Raumschiff Erde“ –, stellten diese Stimmen einen Aufruf zur Revision entgegen. Sie fragten insbesondere nach dem Sinn jener konsumorientierten Lebensentwürfe, die aus ihrer Sicht in die globale Krise geführt hatten. Dabei aktualisierten sie ältere konsumkritische Diskurse mit Blick auf die Weltressourcen.57 Der Kontext dieser Eine Welt-Semantik war also auch das Unbehagen, das viele Bürger gegenüber einem aus ihrer Sicht rein materialistischen Wirtschaften empfanden, das sich bloß „mechanisch“ an statistischen Fiktionen wie dem Bruttosozialprodukt orientierte und dabei „qualitative“ Aspekte des Lebens 53 Die Forschung zusammenfassend Corinna Unger, Histories of Development and Modernization. Findings, Reflections, Future Research, in: H-Soz-u-Kult, 9. 12. 2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2010-12-001. Vgl. außerdem Gurminder K. Bhrambra, Rethinking Modernity. Postcolonialism and the Sociological Imagination, Basingstoke 2009 sowie grundlegend Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 2000. Vgl. außerdem die Themenhefte „Postkoloniale Perspektiven auf ,Entwicklung‘“ von PERIPHERIE 120. 2010, „Writing the History of Development“ des JMEH, 8. 2010 und „Global inequality and development after 1945“ des Journal of Global History 6. 2011. 54 Symptomatisch ist in diesem Zusammenhang auch die Kritik am „Missbrauch“ der Erdfotografien in Empfehlungen zum Management des Planeten: Yaakov Jerome Garb, The Use and Misuse of the Whole Earth Image, in: Whole Earth Review 45. 1980, S. 18 – 25; Sachs, Satellitenblick. 55 Vgl. etwa Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz unserer Politik, Frankfurt 1975, S. 298 – 305. 56 Vgl. etwa Wolfgang Sachs, The Gospel of Global Efficency. On Worldwatch and Other Reports on the State of the World, in: International Foundation for Development Alternatives Dossier 68. 1988, S. 33 – 39. 57 Neuer Popularität erfreuten sich insbesondere die Konsumkritiker John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Boston 1958; Vance Oakley Packard, Die große Verschwendung, Düsseldorf 1961. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 175 vernachlässigte. Dieses Unbehagen mündete in die Tendenz, den eigenen Lebensstandard zu hinterfragen, in eine Moralisierung des eigenen Verbrauchs- und Kaufverhaltens, die dieses zugleich zur Welt als einem Ganzen in Beziehung setzte.58 Eine steigende Zahl von Entwicklungsskeptikern rückte ab Beginn der 1970er Jahre nicht nur den angesichts begrenzter Ressourcen unsinnigen „Wachstumswahn“ und die Umweltverschmutzung in den Fokus – wenn nicht sogar die dem vorgeblich zu Grunde liegende Manipulation der Verbraucher.59 Sie brachten diese Phänomene auch in Zusammenhang mit einer von den wirklichen Bedürfnissen entrückten industriellen Produktion, ja sogar mit einer bedrohlichen kulturellen Homogenisierung, Technisierung und Bürokratisierung der westlichen Gemeinwesen. Oft wurde auch beklagt, dass all dies mit einer Verarmung der Erfahrungen der Menschen in der „Überflussgesellschaft“ einherging, mit „Entfremdungs“-Phänomenen, die sogar für Zivilisationskrankheiten verantwortlich gemacht wurden.60 Derartige teils bewusst als konservativ ausgewiesene Um-, und Rückbesinnungsimperative gingen einher mit der Würdigung der Geschichte und Kultur „nicht-westlicher“, subsistenzorientierter, „frugaler“ Gesellschaften.61 Wo „Selbstbegrenzung“ auf der Agenda stand – um stellvertretend ein Schlagwort Ivan Illichs zu nennen –62, da verschränkten sich Demutsbekundungen und Befreiungsrhetorik. Die 1970er Jahre brachten eine neue Semantik der Mäßigung hervor. Es galt, einen individuellen Beitrag dazu zu leisten, ein Wachstum zu stoppen, das sich dem Anschein nach verselbstständigt hatte, das destruktiv und unersättlich geworden war. Partizipationsziele beziehungsweise allgemein emanzipatorische Absichten, ein demonstrativ zur Schau gestellter Altruismus, die Sorge um die Natur, 58 Ronald Inglehart wies in seiner einflussreichen Studie zum Wertewandel in den 1960er und 1970er Jahren auf die Korrelation zwischen einer „postmaterialistischen“ Haltung und einem kosmopolitischen Gefühl der Zugehörigkeit zur „world as a whole“ hin, ders., The Silent Revolution. Changing Values and Polticial Styles among Western Publics, Princeton 1977, S. 63. Allerdings kritisch zur ungeprüften Übernahme der Diagnose Ingleharts durch Zeithistoriker : Rüdiger Graf u. Kim Christian Priemel, Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin, in: VfZ 59. 2011, S. 479 – 508. 59 Barry Commoner, Wachstumswahn und Umweltkrise, München 1971. 60 Vgl. beispielsweise die Beiträge in Hans-Eckehard Bahr u. Reimer Gronemeyer (Hg.), Brennpunkte. Anders leben – überleben, Frankfurt 1977. 61 So wurde häufig auf das buddhistische Ethos der Selbstgenügsamkeit und des Verzichts verwiesen, etwa durch Gruhl, Ein Planet wird geplündert, bes. S. 281 – 287; sowie Ernst Friedrich Schumacher, Die Rückkehr zum menschlichen Maß. Alternativen für Wirtschaft und Technik „Small is Beautiful“, Reinbek 1977. 62 Ivan Illich, Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik, Hamburg 1975. Vgl. auch ders., Die sogenannte Energiekrise oder die Lähmung der Gesellschaft, Hamburg 1976. 176 David Kuchenbuch Eurozentrismuskritik sowie eine durchaus kulturpessimistisch geprägte Technik-, Konsum- und Entwicklungsskepsis waren verbunden durch ein Lager übergreifendes Bild von der Welt, das bald auch in den politischen Diskurs wiedereingespeist wurde. Erhard Eppler beispielsweise, der seit 1974 – nach seinem Rücktritt als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit – als Leiter der Grundwertekommission der SPD offiziell für Moralfragen zuständig war, schrieb im Jahr darauf: Daß Menschen den Erdball verlassen und auf dem Mond landen können, die wohl spektakulärste aller Grenzüberwindungen, hat die Menschheit keineswegs beflügelt, sondern auf sich selbst zurückgeworfen: Im Weltall war nichts zu gewinnen außer der Einsicht, daß wir auf einen Erdball verwiesen sind, der in seiner Schönheit und Fülle seinesgleichen sucht, von dem es aber auch kein Entrinnen gibt. […] Die faszinierenden Fotos vom Raumschiff Erde forderten die Fragestellungen des Klubs von Rom heraus: Was hält diese Erde aus? Wieviele Menschen kann sie tragen, versorgen mit Rohstoffen, Energie, Wasser, Nahrung, Raum zur Entfaltung? Daß ein endlicher Erdball kein unendliches materielles Wachstum zuläßt, ist eine Binsenweisheit. Daß diese Binsenweisheit erst zur Kenntnis genommen wurde, als ein Computer sie errechnet hatte, ist eine Parodie auf die Expertengläubigkeit unserer Zeit. „Verteilungsprobleme“, so Eppler, könnten „nicht mehr durch Wachstum allein entschärft, geschweige denn gelöst werden“.63 Wo dergestalt zugleich das entgrenzte Wachstum abgelehnt und angesichts drohender Konflikte um die begrenzten Ressourcen unmittelbarer Handlungsbedarf ausgerufen wurde, verlagerte sich die politische Verantwortung für die Zukunft unmittelbar auf ein individualmoralisches Terrain. Fast paradigmatisch für diese Entwicklung ist Frances Moore Lappes bereits 1971 erschienenes Buch „Diet for a Small Planet“, in dem der Verzicht auf eine ressourcenintensive, fleischreiche Kost direkt als Beitrag zur Rettung der Erde präsentiert wurde.64 Vermehrt wurde dazu aufgerufen, den „Leuten die Augen dafür zu öffnen, was von einem Menschen, der im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts lebt, erwartet werden muß und kann, mithin innerhalb bestimmter Grenzen, die letztlich die Grenzen der einen Welt sind“, wie es 1977 in einer Publikation zum „Dialog Nord-Süd“ hieß.65 63 Erhard Eppler, Ende oder Wende. Von der Machbarkeit des Notwendigen, Stuttgart 1975, S. 9 u. S. 65. 64 Frances Moore Lappe, Diet for a Small Planet, New York 1971. 65 H. M. De Lange, Möglichkeiten entwicklungspolitischer Bewußtseinsarbeit, in: Jan Tinbergen (Hg.), Der Dialog Nord-Süd. Informationen zur Entwicklungspolitik, Frankfurt 1977, S. 198 – 214, hier S. 210. An dieser Stelle muss betont werden, dass solche Aussagen auch als Versuche einer Elite gesehen werden können, die in den internationalistischen Milieus bestimmter NGOs gemachten eigenen Erfahrungen zu verallgemeinern. Paradigmatisch für solche Lernprozesse ist die Biografie Petra Kellys: Vgl. etwa Stephen Milder, Thinking Globally, Acting (Trans-)Locally. Petra Kelly and the ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 177 Solche Anregungen trafen auf ein handlungswilliges Publikum. Um nur ein Beispiel zu nennen: Bereits 1972 hatte der norwegische Autor Erik Damman sein Manifest „Fremdtiden i vre hender“ („Die Zukunft in unseren Händen“) veröffentlicht, in dem er – unter Berufung auf Illich, auf Schumacher und andere – angesichts des Ressourcenmangels, der Umweltverschmutzung und der Armut in der Welt, deren Wurzeln seiner Meinung nach im Kolonialismus lagen, demonstrativ zur Arbeit an sich selbst aufrief. Die englische Übersetzung hatte den bezeichnenden Untertitel: „What We Can All Do towards the Shaping of a Better World“.66 Kurze Zeit später gründeten Leser des Buches in mehreren skandinavischen Ländern eine nach diesem benannte, mitgliederstarke grass roots-Bewegung.67 Deren Aktivisten trafen sich in Form von Selbsthilfegruppen, um über praktische Möglichkeiten zur Veränderung des eigenen Alltags zu diskutieren. Sie erprobten Strategien, die bis heute verfolgt werden, etwa Fair Trade und Carsharing,68 unternahmen aber auch Versuche, ganz grundsätzlich auf materielle Güter zu verzichten. Außerdem setzte man darauf, in Kindern und Jugendlichen das Verantwortungsgefühl für die Welt zu stärken. Georg Borgström hatte im Vorwort von Dammans Buchs geschrieben: At this crucial turning point in world history, when circumstances make it both inevitable and indispensable for us Westerners to move out into One World, our own highly structuralized formal education has prepared us poorly for this essential step.69 Vermehrt beschäftigten sich engagierte Alternativpädagogen mit der Vermittlung des Wissens um die Eine Welt, dem „Teaching about Spaceship Earth“.70 Schüler und Studierende sollten ihren lokalen Standpunkt spielerisch transzendieren und Konzepte wie Interdependenz und Systemhaftigkeit verstehen 66 67 68 69 70 Transnational Roots of West German Green Politics, in: Central European History 43. 2010, S. 301 – 326. Erik Dammann, The Future in Our Hands. What We Can All Do towards the Shaping of a Better World [norw. 1972], Oxford 1979. Vgl. auch ders., Revolution in the Affluent Society, London 1984. 1980 hatte Fremdtiden i vre hender allein in Norwegen 20.000 Mitglieder : vgl. Toralf Ekelund, Possibilities for Voluntary Reduction of Private Consumption and Change in Lifestyles, in: International Foundation for Development Alternatives Dossier 19. 1980, S. 57 – 66. Hier darf auch der Hinweis auf die „Welt“- beziehungsweise „Eine Welt-Läden“ nicht fehlen, die Anfang der 1970er Jahre gegründet wurden, wobei zu Beginn noch von „Dritte Welt-Läden“ die Rede war. Vgl. dazu Konrad J. Kuhn, Fairer Handel und Kalter Krieg. Selbstwahrnehmung und Positionierung der Fair-Trade-Bewegung in der Schweiz, 1973 – 1990, Bern 2005. The Future in Our Hand, S. XII. Vgl. Teaching about Spaceship Earth. A Role-Playing Experience for the Middle Grades, New York 1972; David C. King, International Education for Spaceship Earth, New York 1970. 178 David Kuchenbuch lernen.71 So wurden in den 1970er und 1980er Jahren beispielsweise zahllose Varianten von trade games entwickelt, die, so der Gedanke, mittels verteilter Rollen die Multidimensionalität der globalen Interessenkonflikte oder das Machtgefälle bei der Aushandlung von Preisen für Importgüter einsichtig machen würden – und zwar als Beitrag zum „,one world‘ development“.72 Im 1973 von Oxfam America publizierten Simulationsspiel „the decision is yours“ wiederum wurde den Schülern regelrecht der Blick des klassischen Entwicklungshelfers ausgetrieben. Sie übernahmen die Rolle von Mitarbeitern einer NGO in Burkina Faso, die über die Finanzierung verschiedener Hilfsprojekte zu entscheiden hatten. Nach Spielende wurden sie aufgefordert, darüber zu diskutieren, ob sie ihre Entscheidung auf „priorities based on your own cultural values“ gegründet hatten, um sich im Anschluss daran zu fragen, ob der Lebensstandard der US-Bürger angesichts der „,limits‘ to growth“ überhaupt erstrebenswert sei.73 Immer wieder wurde seitens der Erzieher auf die Folgen des eigenen Konsums hingewiesen – ob es um Ernährungsweisen ging, um die Folgen unreflektierter Mobilitätsansprüche auf den Energiemarkt, den Beitrag unfairer Handelsbeziehungen zu Konflikten in anderen Ländern. Meist wurde angeregt, im eigenen lokalen Umfeld sowohl nach Indizien solcher Folgen zu suchen als auch nach Ansätzen, diese Probleme zu lösen. In der Einleitung eines Handbuchs für Erzieher mit dem Titel „Global Connection. Local Action for World Justice“ wurde 1977 Ren Dubos mit dem Ausspruch zitiert: „One must think about global problems. But the only way you can act is locally.“74 Die moralisierende Bemessung des eigenen Lebensstandards am globalen Maßstab konnte so weit gehen, dass der Entwicklungsbegriff selbst dahingehend umgedeutet wurde, dass, wie es 1975 in einer westdeutschen Publikation mit dem Titel „Die Eine Welt“ hieß, die Arbeit am eigenen Problembewusstsein zum eigentlichen „Beitrag zur Entwicklungshilfe“ wurde.75 Für die Eine Welt-Pädagogen fiel letztlich die performative Einübung von agency in Eins mit der hochmoralischen Aufforderung, situativ das eigene Handeln zu hinterfragen, es als Input in ein 71 1979 erschien eine vom Club of Rome in Auftrag gegebene Studie „No Limits to Learning“, die in direkter Anspielung auf die „Grenzen des Wachstums“ das entgrenzte, also auch lebenslange Lernen zur Voraussetzung der Lösung globaler Probleme erklärte: Vgl. James W. Botkin u. a., No Limits to Learning. Bridging the Human Gap. A Report to the Club of Rome, London 1979. 72 Vgl. etwa Nance Lui Fyson, The Development Puzzle. A Sourcebook for Teaching about the „Rich World/Poor World“ Divide, and Efforts towards „One World“ Development, o. O. 1974, S. 7. 73 Oxfam America (Hg.), Teaching Towards Global Perspectives, New York 1973, S. 28. 74 Dennis E. Shoemaker, The Global Connection. Local Action for World Justice. A Development Education Handbook, New York 1977, S. IV. 75 Herta Frenzel, Vorwort, in: dies. (Hg.), Die Eine Welt. Eine Sammlung entwicklungspolitischer Texte zum Spielen, Singen und Erzählen, Wuppertal 1975, S. 9 f., hier S. 9. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 179 komplexes weltweites „System“ zu betrachten. Es ging regelrecht darum, verantwortungsvolle Individuen zu formen, indem man einen permanenten Druck zur Selbstprüfung auslöste: Waren die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angesichts ihrer wörtlich weit reichenden Konsequenzen im globalen Interdependenzgeflecht legitim? Natürlich gab es viele Überlappungen zwischen beiden Varianten des Weltbezugs, zwischen planetarem Management und Selbstbegrenzungsmoral. So analysierte beispielsweise der amerikanische Ökonom Bruce Hannon 1975 in seinem Beitrag zur jährlich stattfindenden Limits to Growth-Konferenz technisch-adminstrative Möglichkeiten, der Energieknappheit mittels Rationierung oder Besteuerung zu begegnen, kam aber dann doch zu dem Schluss: In the long run, we must become materially poorer to avoid the trauma of a complete and sudden collapse of the stored energy resource base. […] [T]he question is unanswered as to whether or not we can muster sufficient altruism to equitably self-impose so pervasive a restriction.76 Denis Cosgrove differenziert außerdem (nicht ganz trennscharf) zwischen dem tendenziell technokratischen „One World“-Diskurs und einem eher esoterischen „Whole Earth“-Diskurs.77 Das Spektrum reichte jedenfalls von der Kritik an der Ineffizienz der Experten bis hin zu einer Ablehnung der „abendländischen“ Rationalität schlechthin, die Überlappungen mit der New Age-Bewegung aufwies. Insbesondere die sogenannte Gaia-Hypothese des Chemikers James Lovelock – die Annahme also, die Erde sei ein beseeltes Lebewesen – entwickelte in einem Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und Esoterik große Resonanz;78 einen Hauch Spiritualität verströmte auch die oft anzutreffende, beinahe religiöse Dignität suggerierende Großschreibung des Problemkinds: „Eine“ Welt. Der von einer Gruppe von kalifornischen Aussteigern um Stewart Brandt herausgegebene „Whole Earth Catalogue“ wiederum (dessen Cover eine der Apollo-Fotografien zierte) war zugleich radikalliberales politisches Pamphlet, protoökologische Überlebensfibel und Mailorder-Katalog. Seine Technikemphase und sein do it yourself-Ethos wurden richtungsweisend für die Tüftlerkultur im späteren Silicon Valley.79 Gegen Ende der 1970er Jahre nahmen im Übrigen auch die Empfehlungen 76 Bruce M. Hannon, Energy, Growth and Altruism, o. O. 1975, S. 24. 77 Vgl. Cosgrove, Contested Global Visions. 78 Vgl. James Lovelock, Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford 1979. Exemplarisch für die Mischformen: Norman Myers, Gaia. An Atlas of Planet Management, o. O. 1984. 79 Vgl. Andrew G. Kirk, Counterculture Green. The Whole Earth Catalog and American Environmentalism. Lawrence 2007; Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, Chicago 2006 sowie Sam Binkley, The Seers of Menlo Park. The Discourse of Heroic Consumption in the „Whole Earth Catalog“, in: Journal of Consumer Culture 3. 2003, S. 283 – 313. 180 David Kuchenbuch vieler Politiker unter dem Eindruck der bottom up-Moralisierung der Einen Welt eine andere Flughöhe ein als noch wenige Jahre zuvor. Im Vorwort des eingangs erwähnten Buchs „One World to Share“ des ehemaligen Leiters des Commonwealth Secretariat, Shridat Ramphahl (er war übrigens auch Mitglied der Brandt-Kommission), konstatierte Barbara Ward 1979 zwar noch ganz aus der Makroperspektive des Planers: „The vision of ,earth rise‘ seen by human beings standing on the moon had its brief impact. Planet earth is a small place.“ Ramphahl selbst gab sich aber hinsichtlich der Lösung der gobalen Probleme bescheidener : „[T]he true interlocuters might be, indeed, the ordinary decent people in the North.“80 IV. Von der „Einen Welt“ der 1970er zu den „vielen Welten“ der 1990er Jahre? Zusammenfassung und Ausblick Das Eine Welt-Denken stellt einen neuen, transnationalen Problematisierungsmodus dar, der sich aus heterogenen Diskursen der späten 1960er Jahre speiste. Die interdependente Erde war gewissermaßen als „wissenschaftliche Tatsache“ (Ludwik Fleck) entdeckt worden; das Weltganze erschien als Systemzusammenhang, als hochdynamische Gesamtheit sich wechselseitig beeinflussender Entitäten und Prozesse. Diese auch massenmedial verbreitete neue Sicht löste in vielen Menschen ganz buchstäblich ein UmDenken aus, eine Art Inversion des eigenen moralischen Fluchtpunkts, ein Hinterfragen des eigenen Daseins als Normalfall – und damit verbunden die Relokalisierung der eigenen politischen Handlungsspielräume: die „Glokalisierung der Moral“. Der Begriff Eine Welt war zwar schon in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg als „Pathosformel“ in Verwendung und markierte einen abstrakten Sehnsuchtsort oder auch – im Sinne der „Weltgemeinschaft“ – eine imagined community.81 In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts stieg die Eine Welt jedoch zur zentralen Größe einer neuen politischen Moral auf, die mit Blick auf die Selbstverhandlung der „westlichen“ Gesellschaften dieser Zeit interessant ist.82 Nicht der Staat, nicht die „Führer“ der Völkergemeinschaft, nicht die 80 Ramphal, One World to Share, S. XI u. S. 132. 81 Zur Operationalisierung dieses von Aby Warburg geprägten Begriffs für die Zeitgeschichtsforschung vgl. Martin Sabrow, Pathosformeln des 20. Jahrhunderts. Kommentar zu Christian Geulen, in: Zeithistorische Forschungen 7. 2010, http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Sabrow-1-2010. 82 Auf die Bedeutung der Dynamisierung von Selbstthematisierungen als Kennzeichen der „Hochmoderne“ wurde zuletzt wiederholt hingewiesen: vgl. insbesondere Christof Dipper, Moderne, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 25. 8. 2010, http://docupedia.de/zg/Moderne, und Lutz Raphael, Ordnungsmuster der „Hochmoderne“? Die Theorie der Moderne und die Geschichte der europäischen Gesellschaften im 20. Jahr- ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 181 technisch-wissenschaftliche Elite, sondern der einzelne Bürger war der Ausgangs- und Endpunkt dieser neuen „glokalen“ Ethik. Für den Ausdruck Eine Welt galt dabei zeitweilig, was Christian Geulen in einem programmatischen Aufsatz zur Erneuerung der Begriffsgeschichte der Moderne am Begriff „Umwelt“ zeigt: Es handelte sich um einen „Konsensbegriff“ mit einer stark „verantwortungsethische[n] Dimension“.83 Dieser Fokus auf das individuelle Handeln stand in Zusammenhang mit den vielschichtigen Prozessen der Pluralisierung und Liberalisierung der westlichen Gesellschaften in dieser Zeit, aber auch mit Konzepten wie Partizipation oder active citizenship. Der Eine Welt-Diskurs der 1970er Jahre exemplifiziert also nicht nur die erwähnte These vom Ende der Territorialisierung oder beispielsweise den Bedeutungsverlust nationaler Identität in bestimmten Milieus. Gerade der Wandel von Subjektivität und Moral, der sich in der Rede von der Einen Welt abbildet, passt zu den Befunden der immer umfangreicher werdenden Forschung zu den 1970er und 1980er Jahren als Umbruchsphase.84 Denn der Aufstieg der „glokalen“ Ethik, so scheint es, korrelierte auch mit dem Bedeutungsverlust bestimmter – das 20. Jahrhundert über lange Strecken prägender – politischsozialer Kategorien, ja mit einer Fragmentierung des politischen Bewusstseins schlechthin. Daniel Rodgers etwa sieht in den 1970er Jahren ein „Age of Fracture“ einsetzen, das gekennzeichnet ist von der Aufkündigung der sozialen Solidarität, vom Bedeutungsverlust wohlfahrtspolitischer Institutionen, wenn nicht allgemein von der Aufwertung individueller Initiative.85 Viel spricht dafür, dass das Eine Welt-Denken nicht bloß Symptom, sondern auch Faktor einer Verschiebung der ethischen Referenzen insbesondere der sogenannten undogmatischen Linken war, die diese Prozesse beschleunigte.86 83 84 85 86 hundert, in: ders. u. Ute Schneider (Hg.), Dimensionen der Moderne, Frankfurt 2008, S. 73 – 91. Christian Geulen, Plädoyer für eine Geschichte der Grundbegriffe des 20. Jahrhunderts, in: Zeithistorische Forschungen 7. 2010, http://www.zeithistorische-forschungen.de/ 16126041-Geulen-1-2010. Vgl. Doering-Manteuffel u. Raphael, Nach dem Boom; Ferguson, The Shock of the Global; Jeremy Black, Europe Since the Seventies, London 2009; Konrad H. Jarausch (Hg.), Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte, Göttingen 2008; Hans Maier, Fortschrittsoptimismus oder Kulturpessimismus? Die Bundesrepublik Deutschland in den 70er und 80er Jahren, in: VfZ 56. 2008, S. 1 – 17; Thomas Raithel u. a. (Hg.), Auf dem Weg in eine neue Moderne? Die Bundesrepublik Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren, München 2009. Vgl. auch das Forum: The 1970s and 1980s as a Turning Point in European History, in: JMEH 9. 2011, S. 8 – 26, sowie die Themenhefte von AfS 44. 2004, „Die Siebzigerjahre. Gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland“ und von Zeithistorische Forschungen 3. 2006 „Die 1970er-Jahre. Inventur einer Umbruchzeit“. Daniel T. Rodgers, Age of Fracture, Cambridge, MA 2011. Symptomatisch hierfür ist das hyperliberale Manifest des Gegenkulturtheoretikers Theodore Roszak, das 1978 ein regelrechtes Ineinsfallen der spirituellen „Bedürfnisse“ 182 David Kuchenbuch Der Bezug auf das Weltganze ließ sozusagen die Mikro- und Makroebene, oder besser : die Letztbegründung und den Interventionsraum ihres politischen Handelns auseinander driften. Das Interdependenzbewusstsein kann also als Teilursache einer Entwicklung betrachtet werden, die das Terrain ihrer Aktivität nach und nach weg von den Schauplätzen der „heroischen Moderne“ – den meist nationalen, allenfalls internationalistischen Schlachtfeldern des Klassenkampfs etwa – in die alltägliche Lebenswelt verlagerte.87 Dies öffnete zugleich Spielräume für neue Allianzen, in der Bundesrepublik etwa für die äußerst heterogen zusammengesetzten Gründungsgrünen.88 Die hier präsentierte Erzählung ist allerdings nicht als Erfolgsgeschichte zu verstehen – auch wenn man sie, wie eingangs erwähnt, als Vorgeschichte des heutigen Nachhaltigkeitsdiskurses betrachten kann. Die „Glokalisierung der Moral“ beschränkte sich auf eine, allerdings zunehmend einflussreiche, Minderheit gesellschaftlich engagierter Menschen. Viele gegenläufige Entwicklungen und konkurrierende Deutungsmuster ließen sich anführen. Hier mag der Hinweis auf die neuen Grenzziehungen genügen, die mit der europäischen Integration und der damit verbundenen Arbeit an einer europäischen Identität verbunden waren und sind. Vielleicht muss man in der langen Sicht sogar von einem Scheitern des Eine Welt-Gedankens an seinen inhärenten Widersprüchen sprechen. Es ist beispielsweise aufschlussreich, dass die Rede von der Einen Welt oft schon überformt war von Überlegungen wie jener des amerikanischen Pädagogen Robert Hanvey, der „global education“ 1976 als Versuch verstand, eine, wie er schrieb, „postmoderne“ Fähigkeit zur „transspection“ zu entwickeln.89 Es ging ihm darum, die heranwachsende Generation dazu auszubilden, die Relativität des eigenen Standpunkts ständig mitzureflektieren und so eine unflexible (Hanvey zufolge „moderne“) Geisteshaltung auszuschließen. Das weist auf einen latenten Konflikt voraus, der bald klarer hervortreten sollte. Erziehungsziele wie global awareness und mehr noch „interkulturelle Kompetenz“ standen schließlich kaum den Erfordernissen eines sich verändernden Kapitalismus, insbesondere eines zunehmend entgrenzten und sich diversifizierenden Marktes im Weg, und das, obwohl der Kapitalismus für viele Vertreter des Eine Welt-Gedankens des Individuums und der Belange „des Planeten“ behauptete: Theodore Roszak, Person/ Planet. The Creative Disintegration of Industrial Society, Garden City, NY 1978. 87 Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Entdeckung des Alltags auch in Verbindung stand mit einer allgemeinen Aufwertung der „warmen“, intimen, lokalen Gemeinschaften durch die gegenkulturellen Bewegungen der 1970er Jahre: vgl. Sven Reichardt, „Wärme“ als Modus sozialen Verhaltens? Vorüberlegungen zu einer Kulturgeschichte des linksalternativen Milieus vom Ende der sechziger bis Anfang der achtziger Jahre, in: vorgänge 44. 2005, S. 175 – 187. 88 Vgl. Silke Mende, „Nicht rechts, nicht links, sondern vorn“. Eine Geschichte der Gründungsgrünen, München 2011. 89 Robert G. Hanvey, An Attainable Global Perspective [1976], o. O. 2004, S. 18. ipabo_66.249.66.96 „Eine Welt“ 183 ja die beobachteten Folgen von Konsumismus und Wachstumsorientierung überhaupt erst verursacht hatte. Polemisch könnte man sagen, dass in den 1980er und 1990er Jahren der „glokale“ Imperativ, eigene Gewohnheiten kontinuierlich zu hinterfragen, nach und nach von seinen altruistischen Implikationen entkoppelt worden ist. Die Bereitschaft, die Welt anders zu sehen, ist identisch mit der Wunschqualität des Gegenwartssubjekts etwa auf dem Arbeitsmarkt: seiner Anpassungsfähigkeit. Auch das entspricht Befunden der Forschung zur Epoche „nach dem Boom“. Die Postmoderne erscheint dieser als implizit normative Begleitdiagnose der zunehmenden Flüchtigkeit und Flexibilität der Lebensstile im neoliberalen Kapitalismus.90 Tatsächlich zeichnet sich in der „glokalen Moral“ ein Trend zu neuen Praktiken der Subjektivierung ab, die kennzeichnend sind für die Ablösung klassisch moderner Sinnstiftungsmuster (etwa der wohlfahrtsstaatlichen „Planung“) durch eine „Kultur des Projekts“, der „Arbeit an sich“, oder gar das „unternehmerische Selbst“ –91 Entwicklungen, die tendenziell entpolitisierend wirkten. Der Versuch, globale Systemzusammenhänge aufzudecken, um so die eigene Verantwortung für eine gerechtere Welt sichtbar zu machen, lief zudem unfreiwillig auf die Einübung eines gewissen Relativismus hinaus. Wer den Entwicklungsuniversalismus als eurozentristisch kritisierte, der riskierte beispielsweise, das dem Eine Welt-Denken ursprünglich zu Grunde liegende Umverteilungsmotiv zu korrumpieren. Das lässt sich an dem neuen Attribut ablesen, das der Welt ab Ende der 1980er Jahre vermehrt angehängt wurde. „One world“ verwies noch auf die Fiktion globaler Gerechtigkeitsstandards;92 eine konsequent relationale, pluralistische Weltsicht aber artikulierte sich am besten im Schlagwort „many worlds“, mit dem nun auch darauf hingewiesen werden konnte, dass universelle Menschenrechte angesichts der Vielfalt ethischer Systeme in verschiedenen Kulturen problematische Größen waren.93 90 Vgl. etwa Anselm Doering-Manteuffel, Nach dem Boom. Brüche und Kontinuitäten der Industriemoderne seit 1977, in: VfZ 44. 2007, S. 559 – 581, hier S. 576. 91 Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt 2007; ders., Alle planen, auch die, die nicht planen. Niemand plant, auch die, die nicht planen. Konturen einer Debatte, in: Mittelweg 36 17. 2008, S. 61 – 79. 92 Vgl. etwa Ralf Dahrendorf, Ohne Titel, in: Towards One World?, S. 204 – 210. „The promise of One word […] has already induced the partial obliteration of Many Worlds, the forgetting of histories, and the arrogance of empires“ hieß es in R. B. J. Walker, One World, Many Worlds. Struggles for a Just World Peace, London 1988, S. 164. Vgl. auch Wolfgang Sachs, Die eine Welt, in: ders. (Hg.), Wie im Westen so auf Erden. Ein polemisches Handbuch zur Entwicklungspolitik, Reinbek 1993, S. 429 – 450. 93 Zur Menschenrechtsdebatte der 1970er Jahre vgl. etwa den Bericht zur Freiburger Tagung Thomas Probert (2010), „A New Global Morality? The Politics of Human Rights and Humanitarianism in the 1970s“, in: H-Soz-u-Kult, http://www.h-net.org/reviews/ showrev.php?id=31033. Vgl. außerdem die Beiträge in: Stefan-Ludwig Hoffmann (Hg.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010; 184 David Kuchenbuch Ohnehin hatten viele Akteure gegen Mitte der 1990er Jahre – zu einem Zeitpunkt also, als die Alternativlosigkeit des Kapitalismus angesichts des Endes der „Systemkonkurrenz“ evident schien – nicht ohne eine gewisse Verzweiflung festgestellt, dass sie die Bedeutung transnationaler global player und die Entkopplung von wirtschaftlicher Ausbeutung und „westlicher“ Dominanz unterschätzt hatten. Sie fanden sich nun auf der Seite der Gegner bestimmter globaler Grenzüberwindungsprozesse wieder, was sich auch in einer veränderten Semantik wiederspiegelte. So beklagen die jüngsten Veröffentlichungen zur Einen Welt die negativen Effekte der „Globalisierung“ in Gesellschaften, die nicht auf diese vorbereitet sind: „One World – Ready or not. The Manic Logic of Capitalism“ lautet der Titel eines Buchs von 1997.94 Dr. David Kuchenbuch, Justus-Liebig-Universität Gießen, Historisches Institut, Otto-Behaghel-Str. 10, D-35394 Gießen E-Mail: [email protected] sowie Jan Eckel, Utopie der Moral, Kalkül der Macht. Menschenrechte in der globalen Politik seit 1945, in: AfS 49. 2009, S. 437 – 484. 94 William Greider, One World, Ready or Not. The Manic Logic of Capitalism, New York 1997; vgl. auch Peter Singer, One World. The Ethics of Globalization, New Haven, CT 2004 und Thomas Pogge u. a. (Hg.), Gerechtigkeit in der „Einen Welt“, Essen 2009. ipabo_66.249.66.96 Lothar Kreimendahl (Hrsg.) MOZART UND DIE EUROPÄISCHE SPÄTAUFKLÄRUNG problemata 148. 2010. 440 S., 2 Abb. Br. € 148,-. ISBN 978 3 7728 2538 5. Lfb. Als ein dringendes Desiderat der Mozart-Forschung darf die Kontextualisierung seines Werks in seiner Epoche gelten. Der Band vereint Beiträge namhafter Spezialisten verschiedener Disziplinen, die den Einflüssen nachgehen, welche die europäische Spätaufklärung und namentlich ihre philosophischen Strömungen in den sieben großen Opern hinterlassen haben. Abhandlungen zur spezifisch josephinischen Aufklärung sowie zu Mozarts Kenntnis aufklärerischer Literatur und seiner Einstellung zur Religion tragen zur Korrektur des gängigen MozartBildes bei und zeigen den Komponisten als einen Menschen, der die intellektuellen Strömungen seiner Zeit aufmerksam registrierte und besonders in seinem Opernschaffen auch reflektierte. – Mit Beiträgen von J. Assmann, K. Bayertz, W.O. Deutsch, M.Fontius, R.Köhnen, L.Kreimendahl, E.Krippendorff, L. Lütteken, G. Mohr, K. Oehl, W. Proß, H. Reinalter, Th. Seedorf, W. Seidel, M. Stegemann und S. Steiner. »[Es] ergänzen sich die verschiedenen disziplinären Herangehensweisen auf das Schönste zu einem Panorama historisch informierter Deutungen von Kunst als einem Produkt und Agenten ihrer spezifischen Zeit. … Dieser Band bietet eine rundum anregende Lektüre.« Melanie Wald-Fuhrmann, Acta Mozartiana Renate Steiger GNADENGEGENWART Johann Sebastian Bach im Kontext lutherischer Orthodoxie und Frömmigkeit. – Doctrina et Pietas II,2. 2001. XXIII, 397 S. mit 27 Abb. und 63 Notenbeispielen. 74 Hörbeispiele auf 2 CDs. Format 22,5 x 30 cm. Leinen. Bei Gesamtabnahme oder Abnahme der Abteilung € 99,-; einzeln € 123,-. ISBN - 1871 4. Lieferbar Johann Sebastian Bachs geistliches Vokalwerk umfasst mehr als die Hälfte seines Œuvres. Seine Kantaten, Passionen und Oratorien sind heute Gegenstand der Musikhistorie und -interpretation und gelten zugleich als ein Höhepunkt der Schriftauslegung. – Die in diesem Band versammelten Arbeiten gehen methodisch davon aus, dass ein historisch-theologisch gesichertes Verständnis der Texte die Musik umfassender zu erschließen hilft, während umgekehrt die Analyse der Komposition Inhalte und Aussagen der Texte aufdeckt. Die Autorin zeigt in zahlreichen Einzelanalysen den engen Zusammenhang der geistlichen Dichtung mit der lutherischen Predigt- und Erbauungsliteratur des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. Sie stellt die musikalische »Sprache« vor, mit deren Hilfe Johann Sebastian Bach theologische Inhalte präsentiert und geistliche Erfahrung sowie seelsorglichen Zuspruch in ästhetische Erfahrung übersetzt. frommann-holzboog [email protected] . www.frommann-holzboog.de König-Karl-Straße 27 . D-70372 Stuttgart-Bad Cannstatt Macht und Musik Im Mai 2012 erscheint: Andrea Ammendola / Daniel Glowotz / Jürgen Heidrich (Hg.) Sabine Mecking / Yvonne Wasserloos (Hg.) Musik – Macht – Staat Kulturelle, soziale und politische Wandlungsprozesse in der Moderne ca. 350 Seiten mit 25 Abbildungen, gebunden ISBN 978-3-89971-872-0 Von Märschen, Hymnen und Schnulzen. Oder: Wie wurden politische, gesellschaftliche und kulturelle Ziele, Ereignisse und Umbrüche musikalisch begleitet und verarbeitet? Polyphone Messen im 15. und 16. Jahrhundert Funktion, Kontext, Symbol 348 Seiten mit 30 Abbildungen und einer Audio-CD, gebunden ISBN 978-3-89971-822-5 Dieser Band untersucht die polyphone Messe als Instrument zur symbolisch vermittelten, öffentlichkeitswirksamen Kommunikation im Spannungsfeld liturgischer und artifizieller, konfessioneller und politischer sowie stilistischer und gattungsgeschichtlicher Parameter. Leseproben und weitere Informationen unter www.vr-unipress.de www.vr-unipress.de | Email: [email protected] | Tel.: +49 (0)551 / 50 84-301 | Fax: +49 (0)551 / 50 84-333 ipabo_66.249.66.96 Musikforschung Short Cuts | Cross Media l 5 Short Cuts | Cross Media l 3 Christofer Jost Jost | Klug | Schmidt | Neumann-Braun [Hrsg.] Musik, Medien und Verkörperung Populäre Musik, mediale Musik? Transdisziplinäre Analyse populärer Musik Transdisziplinäre Beiträge zu den Medien der populären Musik Musik, Medien und Verkörperung Populäre Musik, mediale Musik? Transdisziplinäre Analyse populärer Musik Von Christofer Jost Transdisziplinäre Beiträge zu den Medien der populären Musik 2012, ca. 330 S., brosch., 49,– € ISBN 978-3-8329-7226-4 Herausgegeben von Christofer Jost | Daniel Klug | Axel Schmidt | Klaus Neumann-Braun (Short Cuts | Cross Media, Bd. 5) 2011, 248 S., brosch., 29,– € ISBN 978-3-8329-6719-2 Erscheint ca. März 2012 www.nomos.shop.de/14375 Wie analysiert man populäre Musik? Wer verfügt über die angemesseneren Zugangsweisen: Musik- oder Kulturwissenschaft? Bezüglich dieser Fragen herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Der Band nimmt die Diskrepanz der bestehenden Ansätze zum Anlass, ein eigenständiges transdisziplinäres Analysemodell vorzustellen. Im Rahmen einer umfassenden Fallanalyse gelangt dieses zur Anwendung. (Short Cuts | Cross Media, Bd. 3) www.nomos.shop.de/13819 Der transdisziplinär ausgerichtete Sammelband legt den Fokus auf die technisch-medialen Rahmenbedingungen der populären Musik und untersucht den Einsatz von Medien als Schnittstelle ästhetischer Transformationsprozesse und kultureller Sinnzuschreibungen. Ein Vorgehen, das als Desiderat einer zeitgemäßen Musikforschung erscheint. Nomos Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Band 201: Dirk Mellies Band 202: Karin Hausen Modernisierung in der preußischen Provinz? Geschlechtergeschichte als Gesellschaftsgeschichte Der Regierungsbezirk Stettin im 19. Jahrhundert 2012. 394 Seiten mit 13 Tab., gebunden € 64,95 D ISBN 978-3-525-37025-4 2012. 380 Seiten mit 14 Diagrammen und 7 Tabellen, gebunden € 59,95 D ISBN 978-3-525-37023-0 Dieser Band enthält Karin Hausens wichtigste Texte zur Geschlechtergeschichte. Ausgehend von der bereits zeitgenössisch in jeder Hinsicht als »rückständig« wahrgenommenen Provinz Pommern untersucht die Arbeit den Anteil der verschiedenen Instanzen des preußischen Staates und der Gesellschaft am Modernisierungsprozess des 19. Jahrhunderts. Dirk Mellies beleuchtet anhand der drei Untersuchungsfelder »Hebung des Schulwesens«, »Ausbau der Infrastruktur« und »Entfaltung zivilgesellschaftlicher Strukturen«, welche Akteure diesen beförderten oder hemmten. Er zeigt, dass das gängige Klischee über die ostelbische Provinz zwar nicht widerlegt, doch erheblich modifiziert werden muss. Geschlechtergeschichte war Anfang der 1970er Jahre noch eine Terra Incognita. Mit ihrer unermüdlichen Forschungsarbeit hat Karin Hausen viel dazu beigetragen, dass sie es seit den 1990er Jahren nicht mehr ist. Die in diesem Buch zusammengestellten Aufsätze verdeutlichen Programm und Methode der Geschlechtergeschichte und eröffnen überraschend neue Wahrnehmungshorizonte. Sie widmen sich Themen wie der Bürgerlichen Geschlechterordnung, Haushalt und Technik sowie Arbeiten, Wirtschaften und Geschlechterdifferenz. ipabo_66.249.66.96 Aus dem Inhalt von Heft 2-2012 Übersetzungen Herausgeberin: Simone Lässig Simone Lässig Übersetzungen in der Geschichte – Geschichte als Übersetzung? Überlegungen zu einem analytischen Konzept und Forschungsgegenstand für die Geschichtswissenschaft Michael Facius Japanisch – Kundoku – Chinesisch. Zur Geschichte von Sprache und Übersetzung in Japan Heike Liebau „Alle Dinge, die zu wissen nöthig sind“. Religiös-soziale Übersetzungsprozesse im kolonialen Indien Diskussionsforum Jannis Panagiotidis “The Oberkreisdirektor Decides Who Is a German”. Jewish Immigration, German Bureaucracy, and the Negotiation of National Belonging, 1953–1990