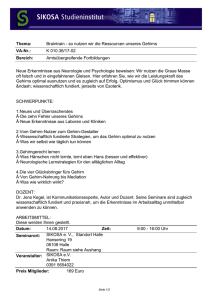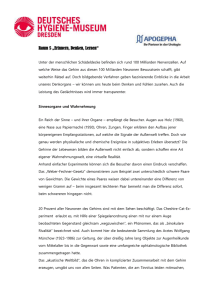Rainer Limmer / Alexander von Pecmann / Sybille
Werbung

In: Widerspruch Nr. 29 Geist und Gehirn (1996), S. 8-36 AutorenInnen: Rainer Limmer / Alexander von Pecmann / Sybille Weicker Artikel Rainer Limmer / Alexander von Pecmann / Sybille Weicker Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Einführung in die gegenwärtige Problemlage Der folgende Beitrag will einen Überblick über die gegenwärtige Diskussion einer neurowissenschaftlichen Erklärung des Geistes und des Erkennens geben. Hierbei erscheint es uns sinnvoll, beide Bereiche, Geist und Gehirn, zunächst getrennt vorzustellen. Worüber besteht im Rahmen einer allgemeinen Psychologie Konsens, so daß diese mentalen Phänomene von den Neurowissenschaften zu erklären sind? Und wie ist auf der anderen Seite der gegenwärtige Kenntnisstand über den Aufbau, die Struktur und die Funktionsweise des Gehirns im Allgemeinen. Auf diesen Grundlagen wollen wir die zur Zeit relevanten Positionen in der Geist-Gehirn- sowie der Erkenntnis-Debatte vorstellen. Dabei gehen wir davon aus, daß die Fragen nach einem möglichen Zusammenhang von Geist und Gehirn sowie nach einem adäquaten Begriff von Erkennen, zumindest derzeit, weder von der Neurophysiologie noch von der Psychologie beantwortet werden können, sondern daß sie im Rahmen von ontologischen und erkenntnistheoretischen Konzepten zu beantworten sind, die philosophischer Natur sind. Der erste Teil befaßt sich mit Erklärungsansätzen von Bewußtsein überhaupt; im zweiten Teil werden wir Zur Philosophie des Geistes und Erkennens nur einen Teilaspekt unserer bewußten Tätigkeit behandeln: die Erkenntnis bzw. Kognition. In der philosophischen Diskussion nimmt dieser Aspekt jedoch seiner gnoseologischen Dimension wegen seit jeher eine herausragende Stelle ein. 1. Psychologie: unser Wissen vom Bewußtsein Fragen wir am Beginn nach einem Vorbegriff dessen, was von den Neurowissenschaften erklärt werden müßte, so mag dafür der vage Begriff der „Psyche“ stehen, der der Psychologie den Namen gegeben hat, und worunter traditionell unsere Wahrnehmungs-, Empfindungs-, Reflexions- und Orientierungsfähigkeiten verstanden werden. Die allgemeine Psychologie unterscheidet daher unsere Psyche in die kognitiven Fähigkeiten, unter die sie Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken faßt, die emotionalen Prozesse, die unsere Empfindungs- und Erlebnisfähigkeiten umfassen, sowie die motivationalen Aspekte, die „Triebfedern unserer Handlungen“. Im folgenden wollen wir diese Bereiche und die jeweiligen, psychologisch relevanten Fragestellungen benennen. Der Forschungszweig, der sich mit unseren Wahrnehmungen beschäftigt, betrachtet diese heute nicht mehr als eine Abbildung von Gegebenem, sondern fragt nach den internen kognitiven Prozessen und Mechanismen, die der Objektwahrnehmung zugrundeliegen. Was läuft ab, wenn wir einem Gegenstand eine bestimmte Größe, Form, Farbe verleihen und ihn als Apfel identifizieren; und welche Funktion haben die Objektwahrnehmungen in unserem emotionalen Erlebnis- und motivationalen Handlungskontext? Dabei tendiert die Psychologie gegenwärtig dazu, die phänomenologischen und neurophysiologischen Aspekte der Wahrnehmung sowie deren Funktion der Handlungs- und Verhaltenssteuerung in der Weise zu integrieren, daß unsere Wahrnehmung als ein Informationsverarbeitungsprozeß aufzufassen sei. Ein anderer, zunehmend mehr mit der Wahrnehmung zusammen untersuchter Bereich der psychologischen Forschung ist unser Gedächtnis. Auch hier betrachtet man unsere Seele nicht mehr als den „Spiegel der Welt“, sondern untersucht die Lernvorgänge, die Art der Abspeicherung des Gelernten, sowie die Zusammenhänge zwischen unserem Erinnern mit der Art unserer Wahrnehmung, der emotionalen Bewertung und unseren handlungsleitenden Motiven. Auch hier neigt man, naheliegenderweise, heute dazu, unser Gedächtnis als „Informationsspeicher“ anzu- Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker sehen, und dementsprechend die Prozesse und Strukturen der Informationsaufnahme, -codierung und -speicherung zu untersuchen. Ein weiterer Bereich psychischer Vorgänge ist der weite Bereich der Reflexion, der Intuition und der Phantasie, der traditionell als „Einbildungskraft“ bezeichnet wurde. Dieser ist derzeit in Mißkredit geraten, nicht zuletzt, weil er der Probleme wegen, die er der Formalisierung und Berechenbarkeit macht, nicht recht ins Bild der Informationsverarbeitung paßt. Unseres Erachtens bleiben jedoch die Anforderungen an die psychologischen wie physiologischen Theorien, auch diesen Bereich des Vagen und Unvorhersagbaren in angemessener und überzeugender Weise erklären zu können. Ein wachsendes Interesse ziehen in der letzten Zeit die Emotionen auf sich. Sie galten lange Zeit als das „Abgründige“ im Menschen, das entweder zu vermeiden sei oder sein wahrhaft Inneres ausmacht. Gegenwärtig werden sie eher als eine Art psychischer Zustände verstanden, die notwendig für die Ausbildung unserer Verhaltensweisen und Orientierungsmuster sind. Durch sie, sagt man, wird Erkanntes bewertet. Sie sind in starkem Maße mit physiologischen Vorgängen verbunden und manifestieren sich in einer Reaktionstrias aus subjektivem Erleben, Ausdruck und Erregungszuständen des autonomen Nervensystems. Das psychologische Interesse richtet sich neben der Bewertungsfunktion und dem kommunikativen Aspekt des emotionalen Ausdrucks auf die Frage, welche Bedeutung die expressive Funktion der Emotionen für die Qualität unseres subjektiven Erlebens hat. Unsere Kognitionen und Emotionen bündeln sich, normalerweise, in Handlungen. Im Bereich der Motivationspsychologie ist man davon abgegangen, unsere Handlungen entweder als kognitiv-rational oder als emotional bestimmt anzusehen, sondern konzentriert sich auf Kooperation beider, die Handlungsmotive und Verhaltensdispositionen hervorrufen. Hier geht es um die Fragen nach der Herausbildung unserer langfristigen Grundüberzeugungen und Zwecksetzungen, der handlungsrelevanten Situationsbeurteilung und der Bewertung unseres subjektiven Zustandes, der Evaluation der (möglichen) Handlungsfolgen sowie der Antizipation von Ereignissen, die, in direkter oder indirekter Weise, wichtig für unsere Handlungsmotivationen sind. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Auch wenn die gegenwärtige Psychologie die eine oder andere methodische Vorliebe hat, so bleibt das wissenschaftliche Interesse darauf gerichtet, die drei wesentlichen Bereiche des Seelischen, Kognition, Emotion und Motivation, nicht nur jeweils präziser zu erfassen, sondern sie auch, zunehmend mehr, als ein notwendig kooperierendes Gesamtsystem beschreiben zu können. An diesen Maßstäben wird sich die Gehirnforschung, soweit sie die Psyche erklären will, messen lassen müssen. 2. Neurowissenschaft: Unser Wissen vom Gehirn Das menschliche Gehirn ist das wohl komplexeste Gebilde im Universum. Es kann aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten seiner Teile erheblich mehr Funktionszustände haben als es Teilchen im Universum gibt. Wie läßt sich angesichts solch astronomischer Verhältnisse dieses komplexe, - bei dem einen mehr, dem anderen weniger - gut funktionierende System verstehen? Beginnen wir auf der Makroebene. Unser zentrales Nervensystem besteht aus fünf, sichtbar verschiedenen Teilen: verlängertes Rückenmark, Kleinhirn, Mittelhirn, Zwischen- und Großhirn, die über Sensoren und Effektoren mit den anderen Körperorganen verbunden sind. Über die weiteren Einteilungen, die Verbindungen dieser Teile untereinander sowie den derzeitigen, auf klinischen und experimentellen Daten beruhenden Wissensstand der „funktionellen Architektur“ unseres Gehirns informiert der folgende Artikel von Martin Korte, sodaß wir hier darauf verweisen können. Auf der mittleren Größenebene des Gehirns befindet sich das Bauelement des Gehirns, das Neuron oder die Nervenzelle. Sie unterscheidet sich von den anderen Körperzellen im wesentlichen durch ihre Funktion des Empfangs, der Weiterleitung und der Übertragung von Reizen. Nervenzellen haben eine Länge von wenigen Millimeter bis zu einem Meter und bestehen aus drei Teilen: dem baumartig verzweigten Dendriten, der mehr als 10 000 Äste haben kann und der Reizaufnahme dient, dem Zellkörper und dem Axon, der die aufgenommenen Reize weiterleitet. Diese Nervenzellen, deren Anzahl bis zu einer Billion geschätzt wird, verbinden sich untereinander an den Eingangs- und Ausgangsstellen, den sog. Synapsen, und bilden das neuronale Netz des Gehirns. Dabei nimmt man an, daß sie sich auf der untersten Ebene in lokalen Schaltkreisen verbinden, die sich ihrerseits in komplexer Weise zu kleinen kortikalen Regio- Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker nen, sog. „Karten“, und subkortikalen Kernen verknüpfen. Diese Regionen und Kerne sind untereinander in Systemen vernetzt, wie dem limbischen System. Das Gehirn insgesamt gilt als das Supersystem von Systemen, in dem die spezialisierten Funktionen sich aus dem Ort ergeben, den die Neuronenkomplexe in diesem großräumigen System einnehmen. Auf der Ebene dieses neuronalen Netzwerkes ist es „die zentrale wissenschaftliche Herausforderung ..., zu erklären, wie die Axone und Dendriten auswachsen, ihre richtigen Partner finden und selektiv mit ihnen Synapsen aufbauen, um ein funktionierendes Netzwerk zu erschaffen.“1 Auf der Mikroebene steht die Synapse im Zentrum. Sie bildet die Kontaktstelle zwischen zwei Neuronen und ihre Größe befindet sich unterhalb des Nanometerbereichs. Auch die Synapse besteht aus drei Teilen: der präsynaptischen Membran der erregenden Nervenzelle, dem synapti1 B. Albers u.a., Molekularbiologie der Zelle, Weinheim 1995, S.1322. - Man nimmt an, daß im Embryonalstadium die zunächst auseinanderliegenden Gehirnzentren nach einem internen Programm wachsen. In der nächsten Phase werden durch das Auswachsen von Axonen und Dendriten entlang spezifischer Bahnen geordnete, aber erst vorläufige Verbindungen zwischen den Zentren geschaffen. In der abschließenden Phase bis ins Erwachsenenalter werden die Verbindungen durch ihre Interaktion in einer Weise angepaßt und verfeinert, die von den Signalen, die zwischen ihnen verlaufen, abhängt. Synapsen, die häufig aktiv sind, werden verstärkt, andere Zellen sterben ab. Auf die Weise dieser Strukturbildung werde, sagt man, das Gehirn fähig, die Ereignisse der Außenwelt widerzuspiegeln (nach: ebd., S.1323). Zur Philosophie des Geistes und Erkennens schen Spalt und der subsynaptischen Membran der erregten Nervenzelle. Die Funktion der synaptischen Signalübertragung von einer Nervenzelle zur anderen wird folgendermaßen erklärt: ist eine Nervenzelle aktiv, läuft im Ionenkanal des Axons ein elektrischer Impuls. Dieser bewirkt am Axonende in der präsynaptischen Membrane eine kurzzeitige Ausschüttung bestimmter chemischer Stoffe, der sog. Neuro-Transmitter, die über den synaptischen Spalt von der nachgeschalteten Zelle durch die subsynaptische Membran aufgenommen werden. Ob diese Zelle durch die Aufnahme der Neuro-Transmitter elektrisch aktiviert oder gehemmt wird, hängt zum einen von der Chemie dieser Transmitter und zum anderen von den Wechselbeziehungen mit den anderen Synapsen der Zelle ab. Eine hemmende Wirkung wird insbesondere dem Glycin, eine erregende Wirkung dem Glutamat zugeschreiben. So blockiert Strychnin etwa Glycin und bewirkt Muskelzuckungen und schließlich den Tod. An den Synapsen setzen die Psychopharmaka, wie Valium oder Librium, an, die durch ihre hemmende Funktion beruhigend wirken. Das Hauptproblem auf diesem Feld der biologischen Elektrochemie ist heute weniger die chemische Entschlüsselung der verschiedenen Stoffe, sondern die Interpretation der Vorgänge: wie werden durch diese elektro-chemischen Prozesse bestimmte Informationen gespeichert; nach welchen Kriterien „verrechnet“ die Nervenzelle die Signale aus den bis zu 10000 Synapsen zu einem Aktivitätszustand, den sie als einen elektrischen Impuls weitergibt; und wie schließlich ermöglicht dieses komplexe Gesamtsystem billionenfacher synaptischer Verbindungen das koordinierte Verhalten und das Bewußtsein des Menschen? 3. Zur Philosophie des Bewußtseins Fragen wir nach dem Anfang der „modernen Theorie“ des Bewußtseins, so werden wir auf R. Descartes zurückverwiesen. Er ist, anwesend oder nicht, die Bezugsperson in der Diskussion. Sein dualistisches Konzept war es, durch das er mit den antik-mittelalterlichen Theorien der „Seinsstufen“ Schluß gemacht hatte, in denen die menschliche Seele auf dem Erlösungsweg der sehnend-strebenden Materie zum ewigen Geist gleichsam eine Etappe zwischen den Tieren und den Engeln eingenommen, und wo die Seele, als Lebenshauch oder -atem, irgendwie zwischen Irdi- Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker schem und Himmlischem gespukt hatte. Dies erhabene Weltgebäude riß Descartes ein2 und machte das Problem einfach: entweder ewig-einfache Geistseele oder vergänglich-komplexe Körpermaterie; ein Drittes gibt es nicht! Und er eröffnete auch schon selbst die moderne Debatte: auf der einen Seite ist es evident, daß unsere psychischen Vorgänge, unsere Empfindungen und Gefühle, unsere Gedanken und Wünsche, getrennt von unserem Körper ablaufen. Wir suchen nach Gründen, setzen uns Zwecke, wählen Mittel; wir tun das, was unser Körper nicht tut. Die Seele gehorcht, können wir sagen, einer anderen „Logik“ als der Körper. Auf der anderen Seite aber ist es ebenfalls evident, daß unsere Seele auf den Körper wirkt: wenn wir sprechen wollen, dann setzen wir unseren Sprechapparat in Gang - normalerweise. Die Kontaktstelle, sagt Descartes, wo die Seele auf den Körper einwirkt, ist nicht das Herz, sondern das Gehirn, genauer: die Zirbeldrüse.3 Was nun aber: sind Seele und Körper getrennt und als solche zwei Substanzen, oder sind sie verbunden, wirken aufeinander und sind daher nicht zwei Substanzen? Darüber grübelnd spielte Descartes' Körper seiner Seele einen Streich. Sie verschied in einer der langen nordischen Winternächte Schwedens wegen einer Entzündung der Lunge. Doch schon bald machten die Nachfolger sich über sein Erbe her - und zankten sich weidlich. Es bildeten sich das Lager der „ersten Person“ und das Gegenlager der „dritten Person“. Die ersten proklamierten: eine Theorie des Bewußtseins ist immer und je schon eine Theorie des Selbstbewußtseins. Denn niemand - außer dem lieben Gott - kennt mein 2 „Es ist ein Irrtum zu glauben,“ schreibt er, „die Seele verleihe dem Körper Bewegung und Wärme.“ Dieser Irrtum habe bislang die „richtige Erklärung der Leidenschaften und anderer Zustände der Seele verhindert.“ (Über die Leidenschaften, Artikel 5) 3 „Im Gehirn ist eine kleine Eichel, in welcher die Seele wirksamer ist als in den übrigen Körperteilen.“ (ebd., Artikel 31). - Prinzessin Elisabeth von der Pfalz, mit der er in Briefkontakt stand, wandte richtig ein: dies sei ganz uneinsichtig; denn wie sollte sich an einem Punkt im Raum zwischen zwei Substanzen ein Kontakt ergeben können, von denen die eine räumlich, die andere aber nicht räumlich ist? Descartes riet ihr - ebenfalls richtig -, nicht zuviel über dies äußerst verwirrende Thema nachzugrübeln. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Bewußtsein besser als ich selbst.4 Mein Bewußtsein und mein bewußtes Sein ist dasselbe, da ich bin, der Ich bin. Und rasch erhoben sich auf dem Fundament des „Ich bin“ architektonische Wunderwerke, die das Bewußtsein ausloteten und exakt und für immer jedem „Vermögen“, jeder „Strebung“ und jedem „Gedanken“ seinen gehörigen Ort zuwiesen. Aus dem (Selbst-)Bewußtsein wurden glänzende Pälaste, in dessen Räumen alles wie am Schnürchen unter der Leitung des rastlos-tätigen Ich funktionierte. Anders die anderen. Sie errichteten keine glanzvollen Bauten, sondern buken die kleinen Brötchen. Wenn, wie Descartes sagte, zwischen Körper und Seele ein Zusammenhang besteht, - läßt sich Descartes' Modell nicht umkehren? Statt: „die Seele beeinflußt den Körper“, „der Körper beinflußt die Seele“. Vielleicht, spinnt Diderot vor sich hin, ist es ja so, daß die Materie selbst denkt. Und für den Cheftheoretiker der französischen Aufklärung, d'Holbach, war die Sache schon ausgemacht. Nicht: „ich denke“, sondern „es denkt“, das Gehirn.5 Doch die ersten Präzisierungsversuche dieser Theorie verliefen kläglich. Die Gedanken seien so etwas wie cerebrale Schweißperlen, Exkremente des Gehirns, behaupteten im 19.Jahrhundert die Physiologen Moleschott, Büchner und Vogt unter dem Hohngelächter der Zeitgenossen. Das Ich - die Ausschwitzung eines puddingweichen Eiweißklumpens?! Den wirklichen Anfang einer Bewußtseinstheorie der „dritten Person“ machte kurz darauf Fechner6, der einen gesetzmäßigen und experimentell überprüfbaren Zusammenhang zwischen physischem Reiz und psychischem Erleben entdeckte, das sog. Fechner-Webersche Gesetz. Dann folgte Pawlows Theorie der „bedingten Reflexe“, die das, was „Bewußtsein“ hieß, als ein erlerntes Reaktionsschema erklärte. Heute scheint sich das Verhältnis von „Descartes' feindlichen Erben umgekehrt zu haben. Die Theorie der „ersten Person“ erscheint heute so lächerlich wie ein Jahrhundert zuvor die der „dritten Person“. Niemand in der „science community“ stellt ernsthaft in Frage, daß nicht das „Ich“, sondern das Gehirn die Basis unseres Bewußtseins ist. Der Wissenschaft, heißt es in einem aktuellen Lexikon, ist „völlig klar: Gemüt, Gefühl, 4 So definiert denn auch J. Locke: „Bewußtsein ist die Wahrnehmung dessen, was im eigenen Geiste vorgeht.“ (J. Locke, Untersuchungen über den menschlichen Verstand) 5 d'Holbach, System der Natur, VII. Kapitel: Von der Seele. 6 Gall Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Denken und Erinnern sind materielle, energetische Prozesse auf biochemischer und bioelektrischer Grundlage; sie sind physiologisch Nervenerregungen und Reaktionen auf Reize.“7 Nicht mehr, daß dem so ist, wird in Frage gestellt, sondern vielmehr, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Im folgenden wollen wir daher, schematisch, die drei relevanten Grundpositionen darstellen, die diese Aussage unterschiedlich interpretieren. Die erste nimmt an, daß in der Tat die geistigen Zustände auf jene materiellen Prozesse reduzierbar sind. Die zweite hingegen vertritt die Auffassung, daß diese Reduktion nicht restlos möglich ist, weil das Geistige eine eigene Qualität besitzt. Die dritte schließlich geht von einem Zusammenhang von geistigen Zuständen und materiellen Prozessen aus, der erforscht und erklärt werden kann und muß. Der „eliminative Materialismus“ Wenden wir uns zuerst der materialistischen Position zu, die annimmt, daß die geistigen auf materielle Zustände reduzierbar sind. Den Einstieg dazu hatte der Behaviourismus zu Beginn dieses Jahrhunderts gemacht. Er ging davon aus, daß sinnvolle Aussagen über psychische Vorgänge und Zustände nur solche Aussagen sind, die das äußere Verhalten von Menschen beschreiben. Nur diese seien nachprüfbar und objektiv, während die „erste-Person-Methoden“ der Introspektion und des Verstehens als unkontrollierbar abzulehnen seien.8 Diese, von B.F. Skinner ausgebaute Verhaltenspsychologie9 hat lange die amerikanische Psychologie beherrscht. An dieses Konzept anknüpfend gab dann der analytische Philosoph G. Ryle 1949 in The Concept of Mind10 eine umfassende Theorie des Geistes. Nach seiner Auffassung resultiert der Begriff des Geistes als einer eigenen Substanz, wie Descartes ihn verwendet hatte, aus einem category-mistake, einem falschen Gebrauch der Kategorie. So wenig der Ausdruck „Teamgeist“ einen zwölften Mann neben der Fußball-Elf bezeichnet, so wenig bezeichne „Geist“ ein Ding, das es zusätzlich zu 7 Die große Bertelsmann Lexikothek, Mensch und Gesundheit, S. 266. - „Geistige Phänomene sind ein Produkt der materiellen, der von physikalischen Gesetzen bestimmten Welt.“ (Zeit, 50) 8 J.B. Watson, Behaviourism 1913 9 B.F. Skinner/W. Corell, Denken und Lernen 1961 10 Gilbert Ryle, Der Begriff des Geistes, Stuttgart 1969 Zur Philosophie des Geistes und Erkennens dem geäußerten Verhalten noch gäbe. Dieser Ausdruck werde sinnvoll nur in Bezug auf verschiedene Handlungs- und Verhaltensdispositionen von Personen gebraucht. So würde nach Ryle mit „Zorn“ keine innere, gar heilige Macht bezeichnet, die den Menschen treibe, sondern nur die Disposition zu einem gewissen Verhalten: erhöhte Blutzufuhr im Gesicht, Traktieren des Tisches (oder eines anderen Gegenstandes) mit Fäusten oder Füßen und Amplitudenerhöhung der Sprechfrequenz. Doch bei diesen ersten Eliminierungsversuchen des Geistes blieb unklar: gibt es den Geist gar nicht; ist er eine „black box“, über die Aussagen zu machen, eine reichlich sinnlose und unkontollierbare Veranstaltung ist; oder gibt es ihn nicht, weil wir nichts Sinnvolles über ihn aussagen können? Aus einer anderen, schon direkter an den Neurowissenschaften orientierten Richtung kam die sog. „Identitätstheorie“. Diese, von den Wissenschaftstheoretikern U.T. Place und J.J.C. Smart in den 50er und 60er Jahren begründete Auffassung widersprach Ryles Erklärung. Die Annahme Descartes', daß der Geist etwas Eigenes sei, sei kein Mißgriff, sondern eine durchaus plausible Erklärung dafür, daß wir phänomenale Zustände haben, Schmerzen fühlen oder rot empfinden. Die moderne Wissenschaft könne jedoch zeigen, daß die Annahme weit plausibler ist, daß unser Bewußtsein keine Expression des Geistes, sondern ein Prozeß in unserem Gehirn ist: „The thesis that conscienceness is a process in the brain“, schreibt Place, „is put forward as a reasonable scientific hypothesis.“11 Diese Annahme wird mit dem Erkenntnisfortschritt in der Elektrodynamik erläutert: Jahrhunderte lang hatte man geglaubt, die himmlischen Blitze und die irdischen Funken seien wesenhaft verschieden - die einen Willensbekundungen Gottes, die anderen „Ausflüsse“ einer geheimnisvollen Kraft -; die Theorie der Elektrodynamik aber hat gezeigt, daß beide identisch sind: Blitze sind große Funken, und Funken elektrische Entladungen. In analoger Weise wird die Neurowissenschaft zeigen können, daß die unsere Bewußtseinszustände und die neuronalen Gehirnvorgänge nichts wesenhaft verschiedenes, sondern identisch sind. Das Schmerzgefühl, so das Beispiel, das seither durch die Debatte 11 U.T. Place, Is Consciousness a Brain Process? In: V.C. Chappell, The Philosophy of Mind, Englewood Cliffs 1962, S.101. - J.J.C. Smart, Sensations and Processes. In: The Philosophical Review LXVIII (1959), S.141-156. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker 'geistert'12, sei identisch mit einer akuten C-Faser-Reizung. Unklar und umstritten blieb allerdings, was der Ausdruck „identisch“ in diesem Falle bedeuten soll.13 Hatte G. Ryle seine Theorie des Geistes noch auf den „richtigen Gebrauch“ des Wortes gestützt, und Smart und Place ihre Identitätstheorie, wissenschaftseuphorisch, auf den Fortschritt der Wissenschaft“, so ist der sogenannte „eliminative Materialismus“ im Kern logisch fundiert. Er geht einen entscheidenden Schritt weiter und sagt nicht nur, daß wir über den Geist nichts sinnvolles aussagen können oder daß Geistiges und Neuronales identisch ist, sondern daß es mentale Zustände gar nicht gibt. Das Argument hierfür hat Paul Feyerabend schon 1963 geliefert: Nehmen wir die Existenz mentaler Ereignisse als Funktionen des Gehirns an, dann nehmen wir an, so Feyerabend, daß „einige physikalische Ereignisse, nämlich Prozesse des Zentralnervensystems, nichtphysikalische Eigenschaften haben.“14 Und, wenden wir diese Schlußfolgerung auf die Identitätstheorie an, dann nehmen wir an, daß einige physikalische Ereignisse, C-Faser-Reizungen, mit nicht-physikalischen Ereignissen, Schmerzen, identisch sind. Diese Annahme enthält in sich aber einen Widerspruch; denn die Aussage, daß „p“ und „non-p“ identisch ist, ist logisch nicht möglich. Will man Widersprüche in den Wissenschaften nicht zulassen und auch nicht in die cartesische Lehre von den zwei Substanzen zurückfallen, so muß die Annahme der Existenz mentaler Zustände ausgeschlossen werden. In der Wissenschaft kann es 12 Dies vor allem seit R. Rortys „Der Spiegel der Natur“, Kap. II: Personen ohne mentale Zustände, Frankfurt/Main 1981, S.85ff. Zu dem „C-Fasern-Gerede“ siehe: J. Searle, Die Wiederentdeckung des Geistes, Frankfurt/Main 1996, S.285. 13 Zur anschließenden Debatte in den USA: H. Feigl, The 'Mental' an the 'Physical'. In: Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol.II, Minneapolis 1958; J. Shaffer, Could Mental States be Brain Processes? In: Journal of Philosophy 58 (1961), S.813-822; N. Block/J. Fodor, What Psychological States are Not. In: Philosophical Review 81 (1972), S.159-181; H. Putnam, The Mental Life of some Machines. In: H. Castaneda (Hg), Intentionality, Mindes, and Perception, Detroit (1967); S.A. Kripke, Naming and Necessity. In: D. Davidson/G. Harman (Hg), Semantics of Natural Language, Dordrecht 1971. 14 P. Feyerabend, Mentale Ereignisse und das Gehirn. In: P. Bieri (Hg), Analytische Philosophie des Geistes, Bodenheim 1993, S.121. - ursprünglich: Mental Events and the Brain, Journal of Philosophy 60 (1963), S.295f. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens daher keine mentalen Ereignisse geben, sondern nur physikalische Ereignisse mit physikalischen Eigenschaften. In den 80er Jahren ist dieses Argument dann vor allem von dem Neurophilosophen P.M. Churchland in Hinblick auf die wissenschaftliche Erkenntnis erläutert worden15. Die Situation der Neurowissenschaften heute sei ähnlich der Situation der Thermodynamik in ihren Anfängen. Lange Zeit glaubte man, die Wärme sei eine eigene Qualität - sei es als sinnliche Empfindung oder als eigene Substanz. Das Ergebnis der Thermodynamik bestehe nun aber nicht in der Erkenntnis, daß die Wärme keine eigene Qualität, sondern durch den ungeordneten Bewegungszustand der Moleküle verursacht wäre (sodaß sie deren Wirkung sei), und auch nicht, daß sei mit dieser Bewegungsart identisch sei, sondern genau darin, daß Wärme diese Bewegungsart ist. Das Gleiche zeigt die Genetik: Gene werden weder durch Basenpaarabschnitte der DNS verursacht noch sind sie mit diesen identisch; sie sind diese Basenpaarabschnitte16 In derselben Weise werde die Neurowissenschaft zeigen, daß das Geistige weder etwas Eigenes ist, noch daß er von den neuralen Prozessen verursacht wird oder mit ihnen identisch ist, sondern daß das Geistige dies Neurale ist. Auf beides, die Widerspruchsfreiheit des eliminativen Materialismus und den Vergleich mit anderen Wissenschaften, stützt sich die aktuelle These von P.S. Churchland: „Der Materialismus ist höchstwahrscheinlich wahr“, d.h. „Bewußtsein ist so gut wie sicher eine Eigenschaft des physischen Gehirns“. Aus dieser These leitet Churchland ab, daß in absehbarer Zukunft alle Erklärungsversuche scheitern werden, die das Bewußtsein als eine 'Wirkung' oder 'Funktion'der Gehirnprozesse darstellen und also Nicht-Physikalisches 'irgendwie' auf Physikalisches zurückführen wollen. Das Scheitern dieser Versuche werde zeigen, daß dies NichtPhysikalische ein bloßes Gespenst ist, daß es Geistiges gar nicht gibt. Nun ist diese Theorie von der Nicht-Existenz des Geistigen natürlich mit der harschen Kritik seitens des gemeinen wie gesunden Menschenverstandes konfrontiert, der sich ebenso schlicht wie jene auf die Logik 15 P.M. Churchland, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. In: Journal of Philosophy 78 (1981), 67-90. 16 P.S. Churchland, Die Neurobiologie des Bewußtseins. Was können wir von ihr lernen? In: Th. Metzinger, Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie“, 1995, S.473. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker und die Wissenschaften auf die Alltagserfahrung beruft. Nur kranken Hirnen sei es möglich zu leugnen, daß sie selbst und wir allesamt phänomenale Zustände und damit Bewußtsein haben, und daß wir uns dieser Zustände auch als wirkliche bewußt sind.17 Die Existenz von Bewußtsein sei eine ebenso evidente, unleugbare Tatsache wie die Existenz von Physischem. Nun sind jedoch, für den gesunden Menschenverstand ärgerlich genug, diese Materialisten nicht auf den Kopf gefallen. Sie antworten: in der Tat haben wir mentale Zustände; wir nehmen an, daß wir essen, weil wir essen wollen, daß wir den „Widerspruch“ kaufen, weil wir begierig wünschen, ihn zu lesen. Nur, diese Annahme beweist nicht die Existenz dieser mentalen Zustände. Es sind Annahmen über unser Verhalten, die wir machen, weil wir dessen richtige Ursachen noch nicht erkannt haben. Sie sind bloße „folk psychology“, die uns eine Existenz von inneren Zuständen vorgaukelt, die es aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gibt.18 So wie man früher ganze Heerscharen äußerer Geister, 17 siehe M. Pauen, Mythen des Materialismus. Die Eliminationstheorie und das Problem der psychophysischen Identität. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1, Berlin 1996, S.77-99. - Die wohl schwersten Geschütze hat in der jüngsten Vergangenheit J. Searle abgefeuert: diese Klasse von Materialisten seien „Zwangsneurotiker“, für die keine Argumente mehr zählen, sondern die, wenn überhaupt, nur therapeutisch von ihrer Krakheit geheilt werden könnten. Denn wie, fragt Searle, könnten sie widerlegt werden? „Sollte ich die Anhänger dieser These vielleicht irgendwohin kneifen, um sie daran zu erinnern, daß sie Bewußtsein haben? Sollte ich mich vielleicht selbst kneifen und das Resultat im Journal of Philosophy veröffentlichen?“ (21). Ihre argumentationsresistente Neurose führt Searle auf ihre „panische Angst vor einem Absturz in den cartesianischen Dualismus“ (26) zurück, die sie lieber Absurditäten annehmen läßt als vom Selbstverständlichen auszugehen. Mir will allerdings scheinen, daß nicht dieser Gemütszustand das Entscheidende ist, sondern, wenn wir so reden wollen, ihre „Angst vorm Widerspruch“. Searle jedenfalls, der zwischen der Skylla des cartesianischen Dualismus von Geist und Körper und der Charybdis des materialistischen Monismus von Körperlichem segeln will, schlingert zweifellos - bewußt oder unbewußt - in Paradoxien: „Bewußtsein ist eine geistige und folglich physische - Eigenschaft des Hirns in dem Sinne, in dem Flüssigkeit eine Eigenschaft eines Systems von Molekülen ist.“ Oder: „Ich bin etwas Denkendes, also bin ich etwas Physisches.“ (28) Und schon beginnt das Mühlrad der Dialektik sich zu drehen: Ich bin Ich, also bin Ich Es; weil Ich Es ist, bin Ich Ich, und weil Es auch Ich ist, bin Ich auch Es... Wie Searle mit diesen Paradoxien fertig werden will, bleibt abzuwarten. (Vgl. die Rezension von I. Knips in diesem Heft) 18 siehe dazu insbesondere P.M. Churchland, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, a.a.O., S.67-90; D. Dennett, Intentionale Systeme. In: P. Bieri, Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Dämonen und Engel, Trolle und Gespenster, in Gang gesetzt hatte, um menschliche Zustände und Verhaltensweisen zu erklären, - und an deren Existenz glaubte -, so setzt die heutige Volkspsychologie eine ganze Armee innerer Geister in Bewegung, um sie zu erklären: Ich und Wille, Wünsche und Bedürfnisse, Ängste und Hoffnungen, - und glaubt, daß es sie gibt.19 Aber diese Annahmen belegen nur, daß wir die eigentlichen Ursachen menschlicher Verhaltensweisen noch nicht verstanden haben. Mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über die Arbeitsweise des Gehirns werden, so die eliminativen Materialisten, diese vorwissenschaftlichen Erklärungsmodelle wahrscheinlich bald verschwinden; sie werden den Geist aufgeben. Die Volkspsychologie, schreibt P.M. Churchland, „wird wie andere Theorien auch eliminiert werden, und die vertraute Common-Sense-Ontologie mentaler Zustände wird den Weg gehen, den die stoischen pneumata, die alchemistischen Essenzen eines Phlogistons, einer Wärme und eines lichttragenden Äthers schon geganAnalytische Philosophie des Geistes, a.a.O., S.162-183); S.M Christensen/D.R Turner, Folk Psychology and the Philosophy of Mind, Hillsdale 1993; S.P. Stich, From Folk Psychology to Cognitive Science. The Case Against Belief, Cambridge 1983. S.P. Stich formuliert vorsichtiger: „Sollte sich herausstellen, daß die Volkspsychologie ernstlich einen Fehler über die Gesamtorganisation unserer Erkenntnisökonomie (cognitive economy) macht, dann gibt es nichts, auf das das Prädikat „... glaubt, daß p“ sich bezieht.“ (229) 19 Inzwischen ist eine vielseitige Literatur entstanden, die nach den Ursachen für diese Annahme innerer Zustände fragt. Die gängige Erklärung hat W. Sellars in Empiricism and the Philosophy of Mind (dt. in: P. Bieri (Hg), Analytische Philosophie des Geistes, Bodenheim 1993, S.184-197) gegeben. Danach sei die Annahme innerer Zustände durch die Erklärung des Verhaltens anderer entstanden. Rannte jemand einem Pferd hinterher, so erklärte man sich dies eigenartige Verhalten durch dessen Wunsch, das Tier zu fangen. Erst dann wurde diese Erklärungsart auch auf das eigene Verhalten übertragen und geglaubt, innere Zustände seien unmittelbar gegeben. - Mir scheint, daß aus der Sicht des eliminativen Materialismus diese Erklärungen nur vorläufige Rationalisierungen sind. Auf die Frage, warum Menschen glauben, daß Nicht-Existentes existiert, können m.E. viele und verschiedene Antworten gegeben werden: sie glauben, was der Pfarrer oder ein 'großer Philosoph', der Medizinmann oder ihr Politiker sagt; sie glauben, was ihnen irgendwie vernünftig erscheint usw. Für den eliminativen Materialismus hängt nichts an diesen Erklärungen. Für ihn sind nur zwei Thesen zentral: 1. Mentale Zustände gibt es (aller Wahrscheinlichkeit nach) nicht; 2. Es kann Menschen geben, die (fälschlich) glauben, es gibt mentale Zustände. Die Frage nach dem „Warum“ dieses Glaubens kann aus dieser Sicht befriedigend erst beantwortet werden, wenn ein genauerer Kenntnisstand über die Arbeitsweise des Gehirns erreicht worden sein wird. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker gen sind.“20 Die Festigkeit, mit der der gesunde Menschenverstand am Glauben an seine inneren mentalen Zustände festhält, zeige nur einmal mehr, wie schwer es seit jeher - von Anaxagoras angefangen, über Sokrates, Galilei bis hin zu Darwin - ist, wissenschaftliche Erkenntnisse gegen die Vorurteile des gesunden Menschenverstand durchzusetzen. „Daß eine wissenschaftlich plausible Theorie komisch klingt,“ so P.S. Churchland, „ist lediglich ein Anzeichen dafür, daß sie nicht zum Allgemeinwissen gehört, und nicht dafür, daß sie falsch ist.“21 So legt dieser moderne Materialismus in oft polemisch-erfrischender Weise das alte Programm neu auf, alles Teleologisch-Intentionale aus der Wissenschaft zu eskamotieren: In ihr gibt es nichts als physikalisch beschreibbare Prozesse, und deren Eigenschaften sind - physikalische Eigenschaften. In bester Aufklärungsmanier streitet er für die Auffassung, daß die mentalistische Rede über innere Zustände uns bald ebenso alt erscheinen wird, wie heute die mythologische oder die alchemistische Rede. Er startet, gegründet auf die Neurowissenschaften, in der Tat einen Generalangriff auf unseren gesunden Menschenverstand. Die Dualisten Die Gegner dieses Materialismus sind - zumindest in Deutschland höchst zahlreich, und wir vermuten, daß auch Sie sich zu ihnen zählen. Sie halten, aus den unterschiedlichsten Gründen, daran fest, daß es mentale Zustände gibt. Dieser „Minimalkonsens“ der Gegner läßt sich in die knappe These Searles fassen: „Bewußtsein ist wichtig“22; und daß es daher sinnvoller und lohnender sei, darüber zu streiten, was Bewußtsein ist und wie sein Dasein erklärt werden kann, statt dessen Existenz zu leugnen. Gleichsam typologisch wollen wir dieses Lager der Gegner unterscheiden: die „Dualisten“, die annehmen, daß unsere inneren Bewußtseinszustände letztlich nicht durch die Struktur und die Funktionsweise des Gehirns erklärbar sind, und die „anderen“, die eben dies annehmen und sich voneinander durch das Modell unterscheiden, von dem 20 P.M. Churchland, Scientific Realism and the Plasticity of Mind, London 1979, S.114. 21 P.S. Churchland, Die Neurobiologie des Bewußtseins, a.aO., S.470. 22 J. Searle, Die Wiederentdeckung des Geistes, a.a.O., S.23. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens sie sagen, es erkläre den Zusammenhang von Bewußtseins- und Gehirnzuständen. Um die dualistische These von der Nicht-Eliminierbarkeit der inneren Bewußtseinszustände zu erläutern, sei Mary vorgestellt, die den Sprung zum literarischen Gegenstand geschafft hat, seit sie der Philosoph F.C. Jackson 1984 kreiiert hatte.23 Mary ist eine Ausnahmeerscheinung im Wissenschaftsbetrieb: sie weiß alles über die physiologischen Prozesse der menschlichen Farbwahrnehmung auf ihrem Weg von der Netzhaut des Auges bis zur Verarbeitung im Hinterhauptslappen. Sie hat nur ein Problem: sie hat bislang in einer Schwarz-Weiß-Welt gelebt und noch nie die Farben erlebt, über deren Wahrnehmung sie alles weiß. Nun Gretchens epistemologische Frage: gesetzt, Mary sieht Farben. Weiß sie dann etwas, was sie bisher nicht wußte? Die Dualisten sagen: „ja“. „Es erscheint einfach offensichtlich,“ sagt Jackson, „daß sie etwas über die Welt und unser visuelles Erleben dieser Welt lernt.“24 Die Art dieses Wissens sei ein „subjektives Erlebniswissen“, das sie nun in die Lage versetzt, zu wissen, was sie bisher nicht wußte, nämlich wie Menschen Farbwahrnehmungen erleben. Insofern besitzt sie ein Tatsachenwissen, das sie vorher nicht hatte, und wer sagt, dieses Wissen ist kein Wissen, liegt falsch. Daher war Marys vollständiges Wissen über die menschliche Farbwahrnehmung in Wirklichkeit ein „unvollständiges Wissen“. Zum neurologischen Dritte-Person-Wissen muß das nicht-physikalische, phänomenologische Erste-Person-Wissen hinzukommen. Auf diesem Argument des „unvollständigen Wissens“ beruht auch der Einwand, den Th. Nagel schon 1974 gegen die physiologische Erklärbarkeit mentaler Zustände formuliert hat. Wir könnten alles über den Aufbau, die Struktur, die Operationen und die Eigenschaften des menschlichen Gehirns wissen, und wüßten doch nichts darüber, was all dies für den Menschen ist (Nagel hat dies - verfremdend - an der Fledermaus durchgespielt: wir können alles über die Physiologie der Fledermaus wissen; als Nicht-Fledermäuse können wir nicht wissen, was dies für sie ist.)25. Es bestehe daher zwischen der ersten Person, die sich 23 F. Jackson, What Mary didn't know. In: Journal of Philosophy 83, 1984, S.291-5. Übersetzung nach: Th. Metzinger, Bewußtsein, a.a.O., S.253. 25 Th. Nagel, What Is It Like to Be a Bat? Philosophical Review 83 (1974), S.435-50 (dt. in: P. Bieri (Hg), Analytische Philosophie des Geistes, Königstein/Taunus 1993, S.261-275). 24 Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker ihrer phänomenalen Zustände bewußt ist, und der dritten Person, die durch ihr äußeres Verhalten und ihre neuronalen Zustände beobachtbar und beschreibbar ist, eine Erklärungslücke, ein „explanatory gap“, der nicht durch ein Mehr an Forschung geschlossen werden kann, sondern der substanzieller Natur ist. Die Seinsweise der ersten Person ist nicht die Seinsweise der dritten Person. Auf diese Einwände folgten eine umfangreiche Debatten, wie dieses „Sichwissen“ exakter zu fassen ist, und ob diese Erklärungslücke vielleicht doch zu schließen ist26. Statt sie hier zu referieren, wollen wir auf das Problem eingehen, wie die Entstehung solcher erlebensfähiger „IchZentren“ erklärt werden kann. Denn auf den ersten Blick scheint die Theorie vom Dualismus der ersten und dritten Person sowohl mit unserem Menschenverstand als auch mit den Gesetzen der Logik übereinzustimmen. Zum einen erscheint die Auffassung höchst plausibel, daß wir zwar mit unserem Gehirn wahrnehmen, daß aber das, was wir erleben, davon unterschieden ist; daß also die Physiologie unserer Farbwahrnehmung nicht die Psychologie unseres Farberlebnisses ist. Und zum anderen wird hier auch nicht behauptet, daß Nicht-Physikalisches in irgendeiner Weise eine physikalische Eigenschaft sei, sondern daß beides eben getrennte „Seinsbereiche“ sind: Ich - Natur. Ein ganzes Problemfeld tut sich jedoch auf, wenn wir fragen, wie diese „Ich-Zentren“ denn entstehen. Denn wenn es sie gibt, so muß legitimerweise auch gefragt werden können, wie sie entstanden sind. Auf diese Frage kommen mindestens drei mögliche Antwortsstrategien in Betracht. Eine Strategie wäre, diese Frage zu verbieten. Denn, so das transzendentale Argument, das „IchZentrum“ darf nicht als ein objektives „Ding“ verstanden werden (nach dessen Entstehen man fragt), sondern ist der Fragende selbst, der daher in der Frage sich je schon voraussetzt. Aus diesem Grund ist die Frage nach der Entsehung des Ich falsch gestellt; sie beruht auf einem Kategorienfehler. Oder aber man gibt eine kosmologische Antwort und sagt, daß im mittelpunktlosen Universum plötzlich Ich-Zentren, Brennpunkte des Bewußtseins, entstehen. In diesem Fall hängt die Antwort an dem „plötzlich“. Verstehen wir dies so, daß diese Ich-Zentren (plötzlich) aus 26 siehe u.a. M. Nida-Rümelin, Was Mary nicht wissen konnte. Phänomenale Zustände als Gegenstand von Überzeugungen. In: Th. Metzinger, Bewußtsein, a.a.O., S.259282. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens gewissen Bedingungen des mittelpunktlosen Universums entstehen, dann ist nicht mehr einsichtig, warum die Existenz der Zentren nicht aus diesen materiellen Bedingungen erklärbar sein soll. Das Argument des „unvollständigen Wissens“ bricht zusammen. Oder aber wir nehmen an, sie entstehen zwar im Universum, aber nicht aus dem Universum, dann tritt an die Stelle einer klaren Antwort die ratlose Frage: „wie aber dann?“ Die dritte Strategie schließlich führt in die traditionelle Seelenlehre zurück und nimmt an, daß diese Ich-Zentren unentstanden und unvergänglich sind, daß sie nur hier und jetzt an ein materielles Gehirn gebunden sind, daß vormals und dereinst aber ... - Alle diese drei möglichen Antworten auf die Entstehensfrage dieser Ich-Zentren: das „Frageverbot“, das „Plötzlichkeits-Argument“ und die „Unsterblichkeitsthese“, sind bei weitem nicht so evident wie die Annahme, daß ich es bin, der erlebt. Der nicht-reduktive Materialismus Diese Position schließlich kramt sich aus beiden das Beste heraus. Sie nimmt auf der einen Seite - entgegen den eliminativen Materialisten - an, daß es mentale Zustände gibt, und auf der anderen Seite - entgegen den Dualisten -, daß diese mentalen Zustände entstanden sind und ihre Existenz erklärbar ist. Sie repräsentiert gewissermaßen den „wissenschaftlichen Normalverstand“, dem die geistigen Zustände „Produkte“ der menschlichen Gehirnprozesse sind. Auf der Grundlage dieser Annahme stellt sich daher nicht mehr die philosophische Frage, ob es Geistiges überhaupt gibt, sondern die empirisch-wissenschaftliche Frage, wie es dies gibt. Die Antwort auf diese Frage kann nun nicht mehr vom Lehnstuhl des Philosophen, durch introspektive Evidenzen, durch die Zergliederung von Begriffen oder durch historische Betrachtungen, gegeben werden, sondern nur durch die experimentelle Erforschung der Gehirntätigkeit. Um zu wissen, wie geistige Zustände erzeugt werden, so der philosophiekritische Impetus, muß man das Gehirn anschauen, was es ist und wie es arbeitet. - Die kontroversen Fragen, die sich auf dieser Ebene stellen, sind zum einen die Modalitätsfrage, ob ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen Bewußtsein und Gehirntätigkeit besteht, oder ob Bewußtsein auch durch andere materielle Substrate erzeugt werden kann; zum anderen die strategisch-technische Frage, wo im Komplex des Gehirns anzusetzen ist, um die Entstehung von Bewußtsein zu erklären. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker a) der Funktionalismus: diese mit der Computer-Euphorie entstandene und wohl weitgehend vertraute Konzeption nimmt an, daß das menschliche Gehirn seinem Wesen nach eine informationsverarbeitende Maschine und das Bewußtsein als Funktion unseres Gehirnsystems beschreibbar ist. Während es in diesem Fall den „Ingenieuren“ eher darum geht, den Konstruktionsplan des Zentralnervensystems und die Arbeitsweise dieser Maschine aufzudecken und ggf. zu rekonstruieren, geht es den „Programmierern“ um die Software, um den Algorithmus der Algorithmen, der dem Menschen koordiniertes und intelligentes Verhalten ermöglicht.27 In diesem Fall gilt es als die Aufgabe der Computer- und/oder Kognitionswissenschaft, unser internes verhaltenssteuerndes System aufzudecken. Allgemein vertritt der „Funktionalismus“ die heute sehr umstrittene Auffassung der Computerfreaks, daß unsere mentalen Zustände auf Mechanismen beruhen, die auch von anderen Systemen als dem menschlichen Gehirn realisiert werden können, daß also auch künstliche Maschinen Bewußtseinszustände haben können. Er ist in dieser Hinsicht „ontologisch neutral“28. b) Das eher abseitige „Quanten-Modell“ sucht den Zugang zum Bewußtsein nicht abstrakt auf der Ebene der Informationsverarbeitung, sondern konkret auf der sub-neuronalen Mikroebene. Hier gilt als das erklärungsbedürftige Phänomen des Bewußtseins nicht dessen verhaltenssteuernde Funktion, sondern seine Fähigkeit zur intuitiven, unberechenbaren und daher nicht-algorithmischen Erkenntnisart. Die Ursache 27 Eine dezidierte Auffassung vertritt noch heute D. Dennett, der das Bewußtsein als eine virtuelle Maschine beschreibt, die durch das Gehirn simuliert wird. Sowenig es bei einer Flugsimulation durch den Computer Sinn macht, nach dem „wirklichen Cockpit“ oder nach dem „Cockpit im Computer“ zu suchen, so mache es keinen Sinn, die Ursache unserer Bewußtseinszustände in der „Realität“ oder im „Gehirn“ zu suchen. Das Bewußtsein gehorche seiner internen Logik. (siehe D. Dennett, Consciousness Explained, Boston 1991; ders., COG: Schritte in Richtung auf Bewußtsein in Robotern. In: Th. Metzinger, Bewußtsein, a.a.O., S.691-712) - Ähnlich G. Ray: „Phänomene wie z.B. Wahrnehmungszustände, intentionale Zustände, intentionale Zustände über intentionale Zustände (Gedanken über Gedanken über Gedanken...), ... sind meiner Meinung nach alle mit relativ wenig Schwierigkeiten auf existierenden Computerprogrammen zu programmieren.“ Annäherung an eine projektivistische Theorie bewußten Erlebens. In: Th. Metzinger, Bewußtsein, a.a.O., S.159) 28 P. Bieri, Analytische Philosophie des Geistes, a.a.O., S.50. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens für diese Fähigkeit des Bewußtseins könne nicht, so sagt etwa R. Penrose, auf der Makroebene des neuronalen Netzwerkes liegen, das mit den Kausalgesetzen der klassischen Physik beschreibbar ist, sondern sei in Vorgängen im Inneren der Nervenzellen zu suchen, die nur mit den Mitteln der Quantenmechanik interpretierbar sind.29 Dieses quantenmechanische Erklärungskonzept von Bewußtsein erinnert doch recht stark an die vormalige These, die Quantensprünge der Elementarteilchen als „Beweis“ für die Existenz von Freiheit in der Welt einzusetzen. Das derzeit erfolgversprechendste Erklärungsmodell läßt sich unter den Namen „biologischer Materialismus“ fassen. Dieser verpricht sich wenig von einer bloß funktionalistischen Modellierung oder eines partikularen Zugangs zur subneuronalen Ebene des Gehirns, sondern von der Erforschung des Gesamtkomplexes des menschlichen Gehirns selbst. Nach diesem Modell ist der Schlüssel zum Bewußtsein nicht der Computer und auch nicht die Nervenzellinnere, sondern die Biologie des menschlichen Gehirns.30 Dementsprechend werden die Überlegungen, ob intelligent geordnete Blechkisten oder extraterristische Wesen Bewußtsein haben können, als abwegig und irreführend abgetan. Hier konzentriert sich die Erforschung auf das menschliche Gehirn als Gesamtsystem. Unter dieser gemeinsamen Voraussetzung werden derzeit zwei unterschiedliche Zugänge gewählt: der evolutionstheoretisch-biologische und strukturalistisch-interdisziplinäre. 29 Hameroff und Penrose nehmen an, daß im Inneren der Nervenzellen, in den Mikrotubuli, gravitative Quanteneffekte stattfinden, die, unvorhersehbar, Signalübertragungen modifizieren und die Aktivitätsmuster der Hirntätigkeit ändern. (siehe S.R. Hameroff, Quantum Coherence in Microtubules: A neural basis for emergent consciousness? In: Journal of Conscienceness Studies 1 (1994), S.98-118; R. Penrose, Computerdenken. Des Kaisers neue Kleider oder die Debatte um Künstliche Intelligenz, Bewußtsein und die Gesetze der Physik, Heidelberg 1991; ders., Schatten des Geistes, Heidelberg 1994. - Zur Kritik: R. Grush/P.S. Churchland, Lücken im Penrose-Parkett. In: Th. Metzinger, a.a.O., S.221-249.) Auch wenn hier das Bewußtsein physikalisch erklärt wird, so ist dieses Modell schwerlich unter das Materialismus-Schema zu bringen. Denn insbesondere Penrose entdeckt in dieser Übereinstimmung von physischen und mentalen Vorgängen die Harmonie eines großen Weltbewußtseins. 30 Dies bedeutet insbesondere, daß die Frage, ob Computer oder irgendwelche extraterristische Wesen auch Bewußtsein haben, als irreführend abgetan werden. Der Weg der Computerfreaks, durch gewitzte Programme oder durch ausgeklügelte Chipproduktionen mentale Zustände zu erzeugen oder zu simulieren, habe in Hinblick auf eine „Wissenschaft des Bewußtseins“ nichts ergeben. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Der evolutionstheoretische Ansatz besteht in der historisch-genetischen Rekonstruktion der Bewußtseinsentstehung: Wenn das Bewußtsein evolutionär entstanden ist, dann muß es, sagt einer seiner Vertreter, der Biochemiker G.M. Edelman, „Wege geben, den Geist zur Natur zurückkehren zu lassen, die denen entsprechen, auf denen er in sie hineingekommen ist.“31 Hier wird der Versuch unternommen, die Ausbildung des menschlichen Gehirns sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch mithilfe des Darwinschen Mechanismus von Kopie, Variation und Wettbewerb zu rekonstruieren. Diese Theorie des „neuralen Darwinismus“ nimmt an, daß sich aufgrund genetischer Dispositionen und unter dem Druck der Umwelt insbesondere im Großhirn neuronale Muster ausbilden und nach dem trial-an-error-Verfahren stabilisieren, deren Aktivitäten unser Bewußtsein repräsentieren. Im Zentrum dieses Modells steht die Biologie des Gehirns als eines „lernenden Systems“: die Ausbildung neuronaler Aktivitätsstrukturen, die uns ein umweltgerechtes und überlebensfähiges Verhalten ermöglichen.32 Neben diesem evolutionstheoretischen Ansatz, der in der Biologie den Schlüssel zum Gehirn sieht, steht das strukturalistische Modell. Es setzt bei der Erforschung des Gehirns auf die Kooperation der klinischen und experimentellen Psychologie und der Neurologie und -chirurgie, die die relevanten Daten erhebt und sichert, sowie auf die Biochemie, die den biochemischen Mechanismen der Gehirntätigkeit erklärt und beschreibt. Dieser Ansatz vertritt am dezidiertesten die Auffassung, daß die materialistische These, der Geist sei das Produkt des menschlichen Gehirns, nicht als ein weltanschaulicher Grundsatz oder als eine Schlußfolgerung aus Wissenschaftserkenntnissen zu verstehen sei, sondern als heuristischer Leitsatz zur Erforschung der Entstehung mentaler Zustände. Sie macht keine Apriori-Aussagen über den Zusammenhang von Gehirn und Bewußtsein, sondern formuliert experimentell nachprüfbare Hypothesen. 31 Andreas Sentker, Wie kommt die Welt in den Kopf? In: Die Zeit, 50/1995, S.45. G.M. Edelman, Unser Gehirn, ein dynamisches System: die Theorie des neuronalen Darwinismus und die biologischen Grundlagen der Wahrnehmung, München 1987; ders., Göttliche Luft, vernichtendes Feuer. Wie der Geist im Gehirn entsteht, München 1995; W.H. Calvin/G.A. Ojemann, Einsicht ins Gehirn. Wie Denken und Sprache entstehen, München/Wien 1995. 32 Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Soweit sich diese neurowissenschaftliche Forschung überblicken läßt, konzentriert sie sich derzeit auf vier Einzelfelder: a) die visuelle Wahrnehmung, weil hier das vorhandene Material am reichhaltigsten ist, und sie vielleicht den Schlüssel zur Kenntnis anderer Felder bietet;33 b) die Anästhesie34 und c) der Zustandswechsel von Schlaf-Traum-Wachheit,35 weil aus der Kenntnis des Komazustands und des Wecksystems Einsichten für unseren Bewußtseinszustand gewonnen werden können; sowie d) der Aufbau der neuralen Repräsentation unseres Körpers, der das Modell für die Repräsentationen abgeben könnte, in denen wir uns als das „IchZentrum“ erleben.36 Dabei steht zur Zeit die Hypothese im Mittelpunkt, unser Bewußtsein sei auf Synchronisationsleistungen des Gehirns zurückzuführen, das die neuronalen Netze zu raum-zeitlichen Mustern aktivieren. Hierbei kommen insbesondere die neuronalen Verbindungen zwischen dem Thalamus im Zwischenhirn und dem Cortex in Betracht.37 Jedenfalls schließt man diese neuronale Aktivität aus dem Vorhandensein einer stabilen 40-HertzFrequenz im Wach- und Schlafzustand, die im Tiefschlaf verschwindet38, und aus anderen klinischen und experimentellen Daten. Näherhin ist diese synchrone Aktivität als ein Paar gekoppelter Oszillatoren konzipiert worden, deren einer den Gehalt, der andere den integrativen Kontext repräsentiere.39 In diesem neurowissenschaftlichen Kontext gewinnt der Begriff der Emergenz an Bedeutung. Dieser Begriff dient zunächst einmal nur der Beschreibung dieses Ansatzes, nach dem zum einen die Basis des Bewußtseins das menschliche Gehirn ist, bzw. bestimmte mentale Zustände 33 F. Crick/C. Koch, Towards a neurobiological theory of consciousness, Seminar in the Neurosciences 4, S.263-76; F. Crick, Was die Seele wirklich ist. München 1994. 34 H. Flohr, Qualia and Brain Processes. In: A. Beckermann u.a. (Hg), Emergence or Reduktion? Berlin 1992, S.220-238. 35 R.R. Llinas/D. Pare, Of dreaming and wakefulness, Neuroscience 44 (1991), S.521-35. 36 A.R. Damasio, Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, München 1995. 37 F. Crick, Function of the thalamic reticular complex: The searchlight hypothesis, Proceedings of the National Academy of Science 81 (1984), S.4586-90. 38 R.R. Llinas/U.Ribary, Coherent 40-Hz oszillation charakterizes dream stat in humans, Proc. Nat. Acad. Sci. 90 (1993), S,2078-81. 39 zu dem Gesamtkomplex siehe Th. Metzingers Versuch: Ganzheit, Homogenität und Zeitkodierung. In: ders., Bewußtsein, a.a.O., S.595-639. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker an jeweils bestimmte Zustände des neuronalen Gesamtsystems gebunden sind; zum anderen aber das Bewußtsein selbst eine Eigenschaft ist, die das Gehirn zwar hervorbringt, die es aber selbst nicht hat. „Wut“ wäre demnach eine emergente Eigenschaft, die unser Gehirn zwar hervorbringt, in dem es aber selbst sich nicht befindet. Der Begriff der „Emergenz“ beschreibt hier zunächst nur unsere Intuition, daß wir, nicht unser Gehirn, wütend sind. Er soll dem materialistischen Ansatz genügen, daß der Geist das Produkt des Gehirns ist, und zugleich der Ansicht Rechnung tragen, daß Geistiges nichts Physisches ist. Er ist, so scheint es bislang, ein schönes Wort für Unvereinbares.40 - An der Einlösung und Auffüllung dieses Begriffs könnte entschieden werden, ob der neurowissenschaftliche Forschungsansatz erfolgreich ist. Scheitert er, so wäre dies das Eingeständnis, daß der Vorgang des „Emergierens“ des Geistigen aus dem Gehirn nicht beschreibbar ist; hat er Erfolg, so würde der Begriff überflüssig. Die dritte Möglichkeit schließlich wäre, in den neurowissenschaftlichen Ansatz allgemeinere Aussagen über die Art der selbstorganisierenden Strukturbildung materieller Systeme fernab vom Gleichgewicht, über die Synergetik und das Chaos-Verhalten zu integrieren, um auf diesem Weg das Bewußtsein als emergente Eigenschaft des neuronalen Gesamtsystem erklären zu können.41 Dies ist zur Zeit im Fluß der Forschung und Theoriebildung.42 Statt die Fachdiskussion hier zu vertiefen, wollen wir zum Abschluß auf die epistemologische Antinomie verweisen, in den dieser physiologische Materialismus gerät. Nehmen wir an, daß es in der Tat so ist, daß all unsere mentalen Zustände emergente Eigenschaften unseres Gehirns sind, - wie können wir diese Tatsache dann wissen? Denn was wir wis40 A. Stephan/A. Beckermann: „Die Verwendung des Emergenzbegriffs zur Definition des nichtreduktiven Physikalismus beansprucht freilich nicht, das psychophysische Problem 'gelöst' zu haben. Was sie allerdings leistet, ist, eine der wichtigsten Positionen in der Philosophie des Geistes klar und przise zu formulieren.“ Emergenz. In: Inforamtion Philosophie 3 ( 1994), S.51. 41 vgl. W. Krohn/G. Küppers (Hg), Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung, Frankfurt/Main 1992. 42 Vielleicht hat G. Roth Recht, wenn er sagt, daß für diese „Nichtabtrennbarkeit von Geist“ erst eine „gemeinsame psychoneuronale Begriffs- und Erklärungssprache zu finden ist“ (Phantasie und feuernde Neuronen. In: Die Zeit 14 (1996), S.34). „Emergenz“ bezeichnete das Unvermögen, das in dualistischer Sprache Unausdrückbare auszudrücken. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens sen, ist nur, daß dieses Wissen ein innerer Zustand ist, den die neuronale Aktivität unseres Gehirns erzeugt. Unser Wissen, so müßte man auf der Grundlage dieses Wissens sagen, bezieht sich nicht auf die Tatsache, daß unsere mentalen Zustände emergente Eigenschaften unseres Gehirns sind, sondern auf einen gewisses neuronales Aktivitätsmuster, daß diesen Wissenszustand erzeugt. Wir haben, so könnten wir die Antinomie formulieren, aufgrund dieses Tatsachenwissens kein Tatsachenwissen, sondern nur gewisse mentale innere Zustände. Aus diesem epistemologischen Widerspruch hat nun G. Roth den Schluß gezogen, daß wir unterscheiden müssen: unser Bild vom Gehirn als interne mentale Repräsentation, das er die „Wirklichkeit des Gehirns“ nennt, und das Gehirn, das dieses Bild vom Gehirn erzeugt, das er als die „Realität des Gehirns“ bezeichnet. Über diese Realität des Gehirns an sich können wir nichts wissen; wir wissen nur über die Wirklichkeit des Gehirns, so wie es in unserem Bewußtsein ist. Doch diese Unterscheidung zwischen Nicht-Wissen und Wissen, die G. Roth trifft, ist nicht konsistent; denn gerade das Wissen, was das Gehirn an sich ist, nämlich der Produzent der Geistigen, bringt ja die Aporie hervor. Nähmen wir an, daß das Gehirn eine funktionslose Eiweißmasse in unserem Körper wäre, und unsere mentalen Zustände von etwas anderem hervorgebracht würden, durch dämonische Einflüsterungen etwa, dann verschwände diese Aporie. Weil wir dies aber nicht annehmen, entsteht sie. Es scheint so, als könne auch der physiologische Materialismus seinen eigenen Standpunkt letztlich nicht widerspruchsfrei begründen. Erkenntnis und Kognition Auch im Fall der Erkenntnistheorie ist letztlich Descartes der Ahnherr der Debatte. Denn seiner radikalen Fragestellung, wie wir überhaupt sichere Gewißheit erlangen, verdanken wir nicht nur die ontologische Unterscheidung von Geist und Materie in zwei Substanzen, sondern auch die Spaltung in das Ich als erkennendes Subjekt und in die Außenwelt als das zu erkennende Objekt. War es bei Descartes allein das klare und deutliche Denken, die mathematische Logik, die die wahre Erkenntnis der Außenwelt ermöglichte43, behaupteten bald darauf die Empiristen Locke und Hume, daß die wahre Erkenntnis nur auf Empirie, auf der 43 „Ich weiß jetzt, daß die Körper nicht eigentlich von den Sinnen oder von der Einbildungskraft, sondern von dem Verstand allein wahrgenommen werden.“ R. Descartes, Meditationen über die Erste Philosophie, Stuttgart, 1986, S.97. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Beobachtung und Empfindung, gründet. Kant schlichtete zwar diesen Streit zwischen den Rationalisten und Empiristen, indem er sagte, beides, Denken und Sinne, gehören zur Erkenntnis, aber er warf dafür ein neues erkenntnistheoretisches Problem auf: wir können prinzipiell nur erkennen, wie die Außenwelt für uns ist, aber nicht, wie sie an sich ist. Aus dieser Debatte um die wahre Erkenntnis hatte der psychologische Begriff der Kognition sich zunächst allerdings herausgelöst. Er bezeichnete nicht die Möglichkeit von Erkenntnis, sondern umfaßte all die Tätigkeiten, die für die faktische Erkenntnis notwendig sind: Wahrnehmen, Gedächtnis, Lernen und Denken. In den 50er Jahren entwickelte sich dann aus der Abkehr vom Behaviorismus, der die Erkenntnisprozesse, die menschlichem Handeln zugrunde liegen, aus seinen Untersuchungen ausgeklammert hatte, eine Richtung, die sich gerade diesen Prozessen zuwandte und die heute als Kognitionswissenschaft bekannt ist. Zuerst ging es hier darum, die abstraktesten geistigen Leistungen, wie das logische und rechnende Denken, im Sinne von Symbolverarbeitung zu erfassen und auf digitale Computer zu übertragen. Mit der Entwicklung der medizinischen Gehirnforschung zeigte sich allerdings bald, daß unser Kognitionsapparat, das Gehirn, nicht wie eine Rechenmaschine funktioniert. Als dann auch die Biologie der Gehirnforschung zuwandte und die Kognition in den Dienst des Überlebens stellte, entwickelten sich bald unterschiedliche Theorien über die Kognition. Und es war nun wieder die klassische Frage nach der Außenwelt bzw. deren Erkennbarkeit, an der sich die Geister schieden. Bestehen unsere kognitiven Prozesse in der Widerspiegelung einer von uns unabhängigen Umwelt oder sind wir es selbst, die unsere Umwelt schaffen? Stehen unsere „internen Repräsentationen“ als Stellvertreter für externe Vorgänge in einem strukturellen Zusammenhang zur Außenwelt (im Sinne einer Abbild-Relation) oder sind Aussagen solcher Art lediglich Beschreibungen eines Beobachters für systeminterne Vorgänge unseres Gehirns? Und weiter, ist es überhaupt möglich, allein durch kognitive Leistungen ein Wissen über die Außenwelt zu erlangen, oder setzt dieses Wissen eine sinnlich-praktische Erfahrung mit der Welt voraus? Mit den Fortschritten der experimentellen Erforschung der kognitiven Prozesse wächst der Zweifel an der Gültigkeit eines naiv realistischen Erkenntnistheorie, die annimmt, wir könnten uns über die Begrenzthei- Zur Philosophie des Geistes und Erkennens ten unseres Kognitionsapparates hinwegsetzen und die Welt erkennen, „wie sie ist“. Dies gilt auch für die Erkenntnis der Erkenntnis: wir können nicht gewissermaßen von einer externen „göttlichen Position“ aus Klarheit über die Funktionsweise des menschlichen Geistes gewinnen, weil wir in der Organisation unseres Wahrnehmungs- und Denkapparates gefangenbleiben. Die Schlußfolgerungen, die von Neurobiologen, Psychologen und Medizinern aufgrund ihrer Forschungen am menschlichen Gehirn in Bezug auf die menschliche Erkenntnis gezogen werden, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie reichen von der idealistischen Position des Konstruktivismus über die „dualistische“ Position von Kognitionswissenschaftlern bis zu Positionen, die das menschliche Handeln einbeziehen und auf den Erkenntnisprozeß rückbeziehen und mit dialektisch-materialistischen Auffassungen vergleichbar sind. Der Konstruktivismus oder: Wie wir unsere Welt erzeugen Der Konstruktivismus bricht mit der traditionellen Vorstellung von der Erkenntnis als Abbild einer unabhängigen Wirklichkeit. Ontologische Aussagen über die Welt, wie sie „wirklich“ ist, seien nicht möglich, da wir lediglich über unsere eigenen Bewußtseinszustände verfügen. Eine Überprüfung dieser Bewußtseinszustände an der Realität sei ebenfalls nicht möglich, da wir nicht außerhalb unserer selbst treten können. Erkenntnis besteht demnach nicht im Erfassen einer „objektiven Realität“, sondern dient der Organisation der Erfahrungswelt eines Individuums bei der Überlebenssicherung. Wissen wird vom Subjekt aktiv aufgebaut (konstruiert) und legitimiert sich durch seine Anwendung44. Diesen konstruktivistischen Ansatz suchten Neurobiologen wie H. Maturana und G. Roth aufgrund empirischer Forschungen an Gehirnen von Tieren argumentativ zu untermauern. Dabei zeigte sich jedoch, daß der 44 „Wissen wird vom lebenden Organismus aufgebaut, um den an und für sich formlosen Fluß des Erlebens soweit wie möglich in wiederholbare Erlebnisse und relativ verläßliche Beziehungen zwischen diesen zu ordnen. Die Möglichkeiten, so eine Ordnung zu konstruieren, werden stets durch die vorhergehenden Schritte in der Konstruktion bestimmt. Das heißt, daß die „wirkliche“ Welt sich ausschließlich dort offenbart, wo unsere Konstruktionen scheitern.“ (E. v.Glasersfeld, Einführung in den radikalen Konstruktivismus. In: P. Watzlawick (Hg), Die erfundene Wirklichkeit, München 1986, S.37) - siehe auch Rezension: S. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Konstruktivismus kein einheitliches Paradigma darstellt; denn obwohl beide Forscher von der Subjektabhängigkeit jeglicher Erkenntnis ausgehen, unterscheiden sie sich wesentlich in der Begründung und in den sich daraus ergebenden Konsequenzen für das menschliche Erkennen. Anhand von Tierversuchen konnte Maturana zeigen, daß der Wahrnehmungsapparat von Lebewesen ein autopoietisches System ist. Es erzeugt und erhält sich selbst und ist strukturdeterminiert, das heißt: sämtliche Aktivitäten werden durch die interne biologische Struktur des Erkenntnisorgans und nicht durch die Umgebung bestimmt. Für die interne Dynamik existiert die Außenwelt nicht; hier finden nur interne Veränderungen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der autopoietischen Organisation statt. Dabei operiert das Nervensystem als operational geschlossenes Netzwerk neuronaler Ensembles. - Für die Erkenntnis dieser Erkenntnis erweist sich in Maturanas Ansatz nun die Instanz des Beobachters als wesentlich. Aus der Außenperspektive können wir als Beobachter die Interaktionen von Lebewesen mit ihrer Umwelt feststellen. Hier wird die Innenansicht irrelevant. Der Beobachter unterscheidet Einheiten, indem er sie von anderen Einheiten und vom Hintergrund abtrennt, und erzeugt durch diese Unterscheidung, Abgrenzung und Absonderung eines Phänomens von seiner Umgebung Realität. Dieses Setzen eines Unterschieds ermöglicht Wahrnehmung und die höheren kognitiven Prozesse. Für Maturana ist der Beobachter jedoch in der Lage, sowohl die Innenwie auch die Außenperspektive lebender Systeme einzunehmen. Beide Perspektiven überlappen sich nicht und werden ausschließlich vom Beobachter in einen Zusammenhang gestellt. Nur der Mensch sei aufgrund seiner Ausbildung der Sprache fähig, als Beobachter zu fungieren45. So erweist sich Maturanas konstruktivistischem Modell die Realität zwar als subjektabhängig, als beobachter-relativ, jedoch keinesfalls als solipsistisch, da die sprachlichen Fähigkeiten, als Voraussetzung der Beobachtungen, sich nur in einer intensiven sozialen Lebeweise entwickeln können. 45 „Der Beobachter ist ein Mensch, wie er spricht, und dabei Unterscheidungen trifft und Beschreibungen anfertigt. Wir alle sind Beobachter. Wir sind nicht mehr und auch nicht weniger als das.“ (H. Maturana/J.F. Varela, Der Baum der Erkenntnis, München 1987.) Maturana 1990 S.58: Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Für Maturana entsteht Erkenntnis konstruktivistisch durch die Zuschreibung eines Beobachters, die in einem sprachlich verfaßten sozialen Rahmen geschieht. Daher, so seine Schlußfolgerung, wird die Erforschung des menschlichen Gehirns weder unser Wissen über die Kognition noch über das Bewußtsein erweitern; sie wird lediglich unsere Zuschreibungen von neuronalen Prozessen mit bestimmten Verhaltensweisen spezifizieren.46 Anders hingegen die Position von G. Roth, dessen konstruktivistische Sichtweise sich gerade auf die Arbeits- und Funktionsweise unseres Gehirns stützt. Dabei nimmt er besonders auf die menschliche Wahrnehmung Bezug und zeigt deren konstruktiven Charakter auf. Einmal ist die menschliche Wahrnehmung äußerst selektiv: wir nehmen faktisch nur einen kleinen Ausschnitt der Umweltereignisse auf, und wir können auch nicht mehr. Schwerer wiegt für ihn jedoch die Tatsache, daß unsere Sinnesorgane lediglich physikalische und chemische Primärreize aufnehmen und diese „Rohdaten“ in neutrale elektrischchemischen Größen umwandeln. Dabei werden Umweltereignisse hinsichtlich ihrer spezifischen Gehalte codiert: die Intensität über die Frequenz der neuronalen Entladung, die Zeitstruktur/Dauer über Beginn und Ende eines Reizes, die Modalität und Qualität über getrennte Verarbeitungsbahnen und Verarbeitungsorte. Die Zusammenbindung dieser räumlich verteilten Informationen zu einem Gesamtbild erfolgt jedoch ausschließlich aufgrund interner Kriterien des Gehirns. Diese mögen angeboren sein oder sich infolge erfolgreicher Anwendung vielfach bewährt haben, - es sind interne Kriterien und nicht die Außenwelt, die die Basis unserer Erkenntnis bilden47. Da sich demnach bereits die sinnliche Wahrnehmung als Konstruktion unseres Gehirns erweist, so Roths Argumentation, gilt dies in umso höherem Maße für komplexe kognitive Vorgänge. Die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, unser Körper, unser Bewußtsein und Selbstbewußtsein, sind sämtlich Konstruktionen unseres Gehirns. Auch unser Wissen über das Gehirn sei lediglich die Konstruktion unseres Gehirns über sich selbst. 46 Vgl. Maturana 1990 S.47 Vgl. G. Roth, Die Konstruktivität des Gehirns. In: H.R. Fischer, Die Wirklichkeit des Konstruktivismus, Heidelberg 1995, S.47-63. 47 Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Eine Realität außerhalb dieser Konstruktionen, müssen wir annehmen, ist für uns nicht erkennbar48. Findet wir im konstruktivistischen Modell H. Maturanas Parallelen und Anknüpfungspunkte zu diskurstheoretischen Überlegungen M. Foucaults oder J. Butlers, nach denen das Erkenntnissubjekt und sein Gegenstand erst im Diskurs erzeugt werden, so knüpft Roth eher an die cartesianische Tradition der Unterscheidung von Ich und Außenwelt an. Der Erkenntniszugang zur Welt an sich, der Realität, bleibt uns der Natur unseres Gehirns wegen versperrt; wir können und müssen zwar Modelle über die Realität entwickeln, dürfen aber keine objektive Gültigkeit für sie beanspruchen. Berechnung der Welt oder direkte Wahrnehmung Leugnet der Konstruktivismus eine Beziehung zwischen der Außenwelt und unserer Wahrnehmung bzw. sieht in dieser Beziehung keine Eindeutigkeit, aus der wir Wissen ableiten können, so steht für Wahrnehmungspsychologen und Kognitionswissenschaftler eine derartige Beziehung außer Frage. Die Art und Weise, wie sie aussehen könnte, und welchen Einfluß die Umwelt auf die interne Informationsaufnahme und -verarbeitung besitzt, unterscheidet die verschiedenen Forschungsstrategien. So geht der Kognitivismus davon aus, daß die Informationen aus der Umwelt in der Form mathematisierbarer Abbildrelationen im Gehirn repräsentiert sind. So sei die visuelle Wahrnehmung die Konstruktion effizienter symbolischer Beschreibungen von Bildern, die man in der Welt antrifft. Wie Roth gehen die Konstruktivisten davon aus, daß die direkte Wahrnehmung nur in der Form physikalischer Primärreize existiert, die auf einer unteren Ebene zunächst in bestimmte neuronale Erregungsmuster verrechnet werden. Diese ersten Repräsentationen, die räumlich im Gehirn verteilt sind, werden dann aufgrund angeborener und erworbener Mechanismen weiterverarbeitet und verbunden. Der gesamte Vorgang läuft automatisch und unbewußt ab, nur das Ergebnis dieses Prozesses wird uns bewußt. Bewußtsein, so die Hypothese, sei 48 Vgl. G. Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Frankfurt/Main 1996, Kap. 13 und 14. Zur Philosophie des Geistes und Erkennens nichts als die neuronale Aktivität in bestimmten kortikalen Schichten und deren Rückkoppelung zum Thalamus49. In diesem Modell wird der Bezug zur Außenwelt durch die streng komputationale Beziehung zwischen den physikalischen Primärreizen und ihrer Verarbeitung gewährleistet. Zwar glaubt man heute in den Kognitionswissenschaften nicht mehr, unser Gehirn arbeite ausschließlich wie ein digitaler Computer. Denn zum einen zeigte sich, daß Fertigkeiten der alltäglichen menschlichen Intelligenz, wie Objekterkennung, Lernen, Gedächtnis, sich auf digitalen Computern nicht darstellen lassen, und zum anderen konnte die moderne Gehirnforschung nachweisen, daß bei komplexen kognitiven Leistungen viele unterschiedliche Regionen im Gehirn aktiv sind. Dennoch hielt man hier an der Vorstellung fest, unser Gehirn arbeite wir eine große Rechenmaschine. Aus der Tatsache, daß im Vergleich zur elektronischen Datenverarbeitung die Reizleistung der Neuronen im Gehirn eher langsam verläuft, wurde auf einen parallelen Verarbeitungsmechanismen geschlossen, und man ist inzwischen zur Modellierung kognitiver Prozesse zu konnektionistischen netzwerkartigen Rechnern übergegangen. Diese Netzwerkrechner bestehen aus vereinfachten Verarbeitungseinheiten, die in stark idealisierter Weise gewisse Eigenschaften von Nervenzellen modellieren; sie arbeiten ohne Symbole und formale Regeln und sind durch Rückkoppelung in der Lage zu „lernen“. Bei diesen Modellierungen wurde der Umweltaspekt stark vernachlässigt. Nun lassen sich jedoch bei der Programmierung der Netzwerkrechner Randbedingungen einbauen, die die externen Umweltfaktoren simulieren, die auf die Repräsentationen in unserem kognitiven System wirken, und die darüberhinaus eine Erklärung für die Intentionalität unserer geistigen Zustände geben könnten. So geht der Philosoph W. Bechtel davon aus, daß es die Beschränkungen sind, die unseren internen Repräsentationen durch die Umwelt, durch unsere Körperlichkeit und durch interpersonelle Prozesse auferlegt werden, die den intentionalen Charakter von geistigen Zuständen herstellen, indem sie letzteren bestimmte Inhalte geben50. Er greift hier auf den Ansatz von J.J. Gibson zurück, 49 Vgl. F. Crick, Was die Seele wirklich ist, München 1994. W. Bechtel, Multiple Ebenen in der Analyse der Kognitionswissenschaften. In: H. Hildebrandt/E. Scheerer, Interdisziplinäre Perpektiven der Kognitionsforschung, Frankfurt am Main, 1993. 50 Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker durch den der Umweltaspekt in die Kognitionswissenschaft zurückgeholt werden soll. Mit dem Ansatz eines ökologischen Realismus bietet J.J.Gibson eine Alternative zu den bisherigen kognitivistischen Vorstellungen von Wahrnehmung. Wahrnehmung beruht demnach nicht auf Primärreizen, sondern auf der Erfassung von Invarianten, die sich dem Lebewesen erst erschließen, wenn es spezifische Handlungen ausführt, z.B. sich bewegt. Für Gibson ist die Wahrnehmung keine kognitive Konstruktion, sondern eine aktive Exploration der Umwelt in Bezug auf ihre reale Zusammensetzung aus veränderlichen und unveränderlichen Aspekten. Damit beruht jede konkrete Wahrnehmung auf einer Interaktion zwischen Organismus und Umwelt. In diesem Modell setzt sich ein Wahrnehmungssystem sowohl aus sensorischen wie auch motorischen Mechanismen zusammen, die gleichermaßen wichtig für den Wahrnehmungsakt sind. Das Lernen wird hier als ein Vorgang verstanden, die Regelmäßigkeiten, die in der Umwelt vorhanden sind, immer schneller und sicherer zu entdecken. „Umwelt“ meint in diesem Zusammenhang nicht die Welt der elektrisch-chemischen Primärreize, sondern den Größen- und Massenbereich von Lebewesen, den sogenannten Mesokosmos51. Gibson hat sich allerdings strikt geweigert, interne Verarbeitungsmechanismen des Gehirns in seine Überlegungen aufzunehmen. Dennoch ist klar, daß Menschen nicht nur Informationen aus der Umwelt aufnehmen, um Handlungen auszuführen. Menschen machen Pläne, haben Vorstellungen und Menschen verwenden symbolische Systeme wie Sprache, Logik und Mathematik. Muß man zur Erklärung dieser kognitiven Tätigkeiten, die ja im eigentlichen mit Wissen und Erkenntnis verbunden sind, doch wieder auf Rechenmodelle zurückgreifen? Verschiedene Denker haben Modelle des Geistes entwickelt, die auf einer Interaktion von Gehirn, Körper und Umwelt beruhen. Die umfassendste Theorie stammt wohl von Gerald Edelman. Er möchte „den Geist in die Natur zurückholen“, der durch die modernen Naturwissenschaften seit Galilei daraus vertrieben wurde.52 Nur eine Theo51 J.J. Gibson, Wahrnehmung und Umwelt, München-Wien-Baltimore1982. Vgl. G. Edelman, Göttliche Luft, vernichtendes Feuer, München-Zürich 1995, S.27. 52 Zur Philosophie des Geistes und Erkennens rie, die berücksichtigt, daß Geist zwar durch neuronale Aktivität entsteht, dabei jedoch auf einen Körper und dieser auf eine Umwelt angewiesen ist, also eine Theorie, die auf biologischen und nicht nur auf physikalischen Gegebenheiten aufbaut, kann seiner Ansicht nach die Entstehung von Bewußtsein und Intentionalität angemessen darstellen. Die Verkörperung des Geistes oder Bewußtsein als Wechselbeziehung von Gehirnprozessen und Umwelteinflüssen Edelman legt eine umfassende und sehr komplexe Theorie für die Entwicklung von Bewußtsein vor, bei der er vor allem auf den evolutionären Ansatz Darwins zurückgreift, aber auch Überlegungen aus Psychologie und Linguistik einbaut. Ich möchte mich hier auf die Darstellung der Entstehung bewußter Wahrnehmungsprozesse und deren Bezug auf Wissen und Erkenntnis beschränken53. Voraussetzung für das Entstehen eines Bewußtseins sind drei komplexe Vorgänge, die zwar getrennt voneinander beschrieben werden, jedoch untrennbar miteinander verknüpft sind und zur Begriffsbildung führen. Es ist dies Wahrnehmungskategorisierung, Gedächtnis und Lernen. Erstere beruht zunächst auf der Erstellung von reziprok miteinander gekoppelten Karten, die aufgrund der Selektion bestimmter Neuronengruppen bei bestimmten Signalen aus der äußeren Welt zu sogenannten Mehrfachkarten zusammengefaßt werden. Mehrfachkarten werden mit nichtkartierten Regionen des Gehirns zu einer dynamischen Struktur zusammengefaßt, einer globalen Karte, die fortwährend Gebärden und Haltung eines Lebewesens an viele davon unabhängige Sinneseindrücke anpaßt. Aufgrund interner Wertkriterien, die im Laufe der Evolution entstanden und artspezifisch sind, werden die Bereiche der Kategorisierung zwar eingeschränkt, aber nicht bestimmt. Gedächtnis ist die spezifische Verstärkung einer zuvor etablierten Fähigkeit zur Kategorisierung, die Veränderung der synaptischen Stärken von neuronalen Gruppen in einer globalen Karte stellt die biochemische Grundlage für Gedächtnis dar. Da Gedächtnis von Kategorisierung abhängt, diese aber vom jeweiligen Verhalten des Individuums beeinflußt wird, kann Gedächtnis auch als fortwährende Neukategorisierung bezeichnet werden. Durch die 53 vgl. auch unsere Rezension von Göttliche Luft, vernichtendes Feuer in diesem Heft. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Koppelung mit dem Kleinhirn, den Basalganglien und dem Hippokampus kann das Gedächtnis den zeitlichen Ablauf von Ereignissen berücksichtigen. Lernen wiederum beruht auf der Abhängigkeit der Kategorisierung von internen Werten, die die Anpassung eines Lebewesens erst ermöglichen. Die Begriffsbildung, die ohne sprachliches Vermögen auskommt und bereits bei Tauben z.B. nachgewiesen wurde, findet im Vorderhirn statt und kann als Kategorisierung der eigenen Aktivitäten des Gehirns beschrieben werden, ohne daß aktuelle Sinnesdaten daran beteiligt sein müssen54. Wesentlich für das Entstehen des Bewußtsein ist das Zusammenwirken zweier Systeme im Gehirn, die unterschiedliche Funktionen haben. Beschäftigt sich das thalamokortikale System mit der Kategorisierung und begrifflichen Erfassung der Welt und sorgt für die Anpassung an eine komplexen Umwelt, so kümmert sich das limbische System um die Ausrichtung an Werte, die im Laufe der Evolution entstanden sind und dient der Erhaltung des Organismus. Diese beiden Systeme haben sich nach Edelman aufgrund wechselseitiger Beziehungen so miteinander verbunden, daß sich ihre Aktivitäten entsprechen konnten, was einen unaufhörlichen Lernprozeß hervorruft und letztlich zur Bildung eines Selbst als Unterscheidung von Welt und Nicht-Welt führt55. Die enge Verknüpfung von Werten mit der Begriffsbildung ermöglicht eine neue Art von Gedächtnis, ein Gedächtnis für Wertekategorien, das sozusagen die Begriffe bewertet. Primäres Bewußtsein entsteht, wenn dieses Gedächtnis mit der gleichzeitig in vielen Sinnesmodalitäten ablaufenden Wahrnehmungskategorisierung verknüpft wird. Durch diese Beziehung zwischen Begriffen und aktuellen Wahrnehmungskategorisierungen kommt bewußte Erfahrung von Wahrnehmung zustande, Lebewesen mit derartigen Gehirnfunktionen haben somit Vorstellungen, geistige Bilder oder „Szenen“, die allerdings auf die „erinnerte Gegenwart“ beschränkt bleiben56. Das primäre Bewußtsein steht im Dienste des Überlebens und ist unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung eines Bewußtseins höherer Ordnung, wie es bis jetzt nur beim Menschen auftritt. 54 Vgl. G. Edelman, ebd., Kap. 9 und 10. Vgl. ebd., S. 174 f. 56 Vgl. ebd., S. 174 55 Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Voraussetzung für die Bildung eines Bewußtseins höherer Ordnung ist zunächst ein reiches Gedächtnis für Begriffe, wie wir es im primären Bewußtsein bereits antreffen. Darüberhinaus mußten sich zunächst Stimmapparat und spezielle Gehirnbereiche zur Erzeugung, Ordnung und Behalten von Sprachlauten entwickeln. Phonologische Fähigkeiten wurden daraufhin mit Begriffen und Gesten verbunden, dies führt allmählich zu bedeutungsvollen Wörtern und Sätzen, einer Semantik. Erst wenn diese bereits vorliegt, können abstrakte Regeln für eine Syntax gebildet werden. Höheres Bewußtsein tritt auf, wenn sich ein Selbstkonzept bildet, was in der sozialen Interaktion durch die Verbindung von Bedürfnisbefriedigung mit Sprachsymbolen erfolgt. Erst wenn auf diese Weise ein symbolisches Gedächtnis entstanden ist, läßt sich aus der Wechselwirkung mit dem Begriffsgedächtnis für Wertekategorien ein Modell für die Welt gewinnen. Diese begrifflich-symbolischen Modelle können nun mit aktuellen Wahrnehmungen verglichen werden, was es ermöglicht, über den zeitlichen Rahmen der erinnerten Gegenwart hinauszugehen. Das Individuum besitzt nun eine erinnerte Vergangenheit und es kann zukünftige Geschehnisse in Gedanken vorwegnehmen, es kann Pläne und Ziele entwickeln, es kann sich eigene Zwecke setzen und es kann ein Wissen über die Welt haben57. Wahrheit und Wissen existieren nur auf der Grundlage unserer Begriffsbildung, die eng mit inneren Wertsystemen und der äußeren Welt verbunden sind. Zwar können wir aufgrund unseres höheren Bewußtseins eine innere Welt des Denkens erschaffen, dennoch sind wir stets, schon durch unsere biologischen Bedürfnisse, auf die äußere Welt angewiesen. Diese äußere Welt in Form einer sozialen Gemeinschaft zeigt uns sowohl Grenzen wie auch Möglichkeiten unserer Erkenntnis auf 58. Schlußgedanken Die verwirrende Vielfalt dieser unterschiedlichen Theorien über Erkenntnis und Kognition wirft fast mehr Fragen auf als sie beantwortet. Dennoch möchte ich abschließend einige Hypothesen aufstellen. 57 58 Vgl. ebd., S.180 ff. Vgl. ebd., S.250. Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker Geht man von den Überlegungen der kognitivistischer Psychologen aus, so beruht unsere Beziehung zur Außenwelt auf der Berechnung und Umcodierung physikalischer Primärreize. Legt man dies unserer Wahrnehmung zugrunde, so werden unsere subjektiven Empfindungen und Wahrnehmungserlebnisse zwangsläufig von unserem Gehirn konstruiert. Der Außenweltbezug kann dann eigentlich nur dadurch aufrechterhalten werden, daß man eine auf streng mathematischen und logischen Gesetzen beruhende Abbildrelation unserer Repräsentationen zu äußeren Gegebenheiten annimmt. Geht man nun jedoch davon aus, daß Logik und Mathematik eine Erschaffung des menschlichen Verstandes sind, so landen wir entweder wieder bei Descartes, für den es ja auch lediglich unser Verstand ist, der uns ein Wissen über die Welt vermitteln kann oder wir landen bei Gerhard Roths „realistischem Konstruktivismus“, der die für uns erfahrbare Wirklichkeit als Konstruktionen eines real existierenden Gehirns ansieht, über das wir jedoch nichts wissen können. Geht man wie die konstruktivistischen Biologen von der Geschlossenheit unseres Nervensystems aus, so haben wir letztlich keinen eindeutigen Bezug zur Außenwelt. Zwar leben wir in einer Umwelt, wir erfahren sie jedoch lediglich als Störung unseres homöostatischen Gleichgewichts. Es ist unser Beobachterstatus aufgrund unserer sprachlichen Fähigkeiten, der es uns ermöglicht, eine Interaktion zwischen Lebewesen und Umwelt zu beschrieben. Ob unsere Beschreibungen allerdings der Realität entsprechen, können wir letztlich nicht wissen. Im Laufe der weiteren evolutionären Entwicklung kann sich lediglich herausstellen, ob unsere Lebensweise, unsere Handlungen, die wir aufgrund unserer Konstruktionen vollzogen haben, ein gangbarer Weg gewesen sind. Beide Ansätze führen meiner Meinung nach in eine Sackgasse und stimmen auch mit unserem intuitiven Verständnis, unseren Empfindungen und Erfahrungen nicht überein. Geht man, wie Gibson und Edelman, dagegen davon aus, daß wir als biologische Wesen in eine physikalische und soziale Welt eingebettet sind, mit der wir in ständiger Interaktion stehen und die unsere Erkenntnis sowohl ermöglicht wie auch einschränkt, so kann dies unser Wissen über uns selbst und die Welt nur vergrößern. Erkenntnis in diesem Sinn ist dann nicht das Erfassen einer absoluten, ewigen Wahrheit, sondern ein Prozeß, der aufgrund unserer Zur Philosophie des Geistes und Erkennens Lernfähigkeit und der Dialektik von inneren, auf dem langen Weg der Evolution entstandenen Werten und äußeren, auf der noch längeren Geschichte der physikalischen Welt basierenden Gegebenheiten, vermutlich niemals ein Ende finden wird. Literaturliste Bechtel William (1993). Multible Ebenen in der Analyse der Kognitionswissenschaften. In Helmut Hildebrandt/Scheerer Eckart. Interdisziplinäre Perpektiven der Kognitionsforschung. Frankfurt am Main: Peter Lang Crick Francis (1994). Was die Seele wirklich ist. Artemis und Winkler Descartes René (1986). Meditationen über die Erste Philosophie. Stuttgart: Philipp Reclam jun. Edelman Gerald (1995). Göttliche Luft, vernichtendes Feuer. MünchenZürich: Piper Glasersfeld Ernst von (1995). Die Wurzeln des „Radikalen“ am Konstruktivismus in Fischer Hans Rudi. Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Heidelberg: Carl Auer Gibson J.James (1982). Wahrnehmung und Umwelt. München-WienBaltimore: Urban & Schwarzenberg Maturana Humberto, Varela J. Francisco (1987). Der Baum der Erkenntnis. Goldmann Nr. 11460 Riegas Volker/Vetter Christian (1990). Zur Biologie der Kognition. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wisenschaft Roth Gerhard (1995). Die Konstruktivität des Gehirns in Fischer Hans Rudi. Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Heidelberg: Carl Auer Roth Gerhard (1996). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Rainer Limmer/Alexander von Pechmann/Sybille Weicker