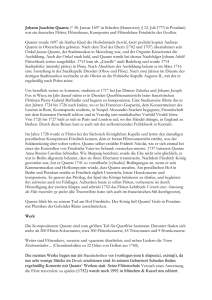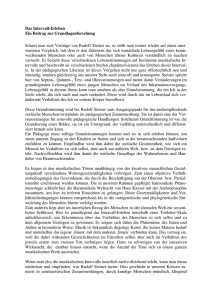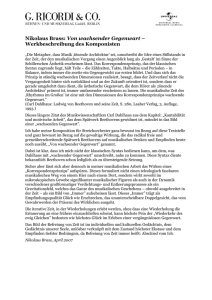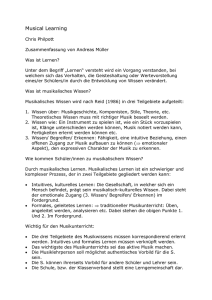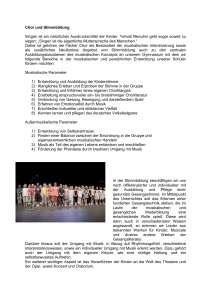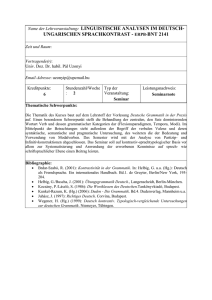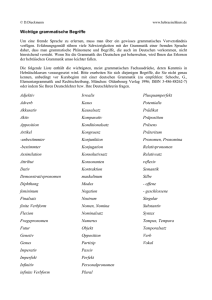Verkörperungen der Musik - Interdisziplinäre Betrachtungen
Werbung

Versuch über Technik samkeit, scharfer Beobachtung und bewusster Absicht eingreifst.« (Krall 1910, S. 23f., zit.n. Röbke 2000, S. 228) »Wenn man beobachtet, wie die Preussischen Rekruten marschiren lernen, wie sie erst das Bein mit stark gebogenem Knie scharf in die Höhe heben und eine Zeit lang in dieser Stellung halten müssen, wie sie darauf den Fuß stramm und mit einem Ruck ausstrecken, wieder einen Moment über dem Boden halten und dann erst auf den Boden treten […], so möchte man im Anfange diese Methode mehr bizarr als nützlich finden. […] Aber gerade dieses Exercitium verleiht dem preussischen Soldaten die Festigkeit und Ausdauer beim Marschiren […]. So auch, wenn der Klavierspieler langsamen Uebens die schwerste, seine Kräfte anspannende und konzentrirende Methode anwendet, wird er seine Fingermuskeln in hohem Maße stärken und bei der Ausführung alle Schwierigkeiten mit grösserer Sicherheit und Leichtigkeit überwinden.« (Ehrlich 1878, S. 273, zit.n. Busch 2008, S. 148) Kostproben aus dem Gruselkabinett einer schwarzen Pädagogik. In allen drei Passagen wird der Körper des Instrumentalisten als geduldiger und gehorsamer Übermittler einer Willenskraft apostrophiert, deren Intentionen rücksichtslos in ihn ›hineingeschrieben‹ werden können. Es geht nicht um seine Entfaltung im Akt des Musizierens oder auch nur um eine Rücksichtnahme auf seine je spezifischen Bedingungen oder Verletzlichkeiten, sondern um fremdbestimmte Zurichtung. Als Methoden dieser Zurichtung bieten sich an: endlose Wiederholungen, Unterwerfung unter das Diktat eines forcierten Langsamübens sowie der Verzicht auf jegliche musikalische Vor- und Einbildungskraft beim Exekutieren der einschlägigen Übungen und Bewegungsfolgen. Musikalische Technik mithin als Inbegriff und Resultat eines gewalttätigen Disziplinierungsprozesses. Seit Michel Foucault derartige Disziplinierungstechniken auf breiter Basis – Architektur, Gesundheits- Militär- und Erziehungswesen, Sexualität und Justiz – analysiert hat (vgl. Foucault 1976, 1977), wissen wir, dass es sich bei den zitierten Textstellen nicht um absonderliche Einzelfälle, sondern um – freilich extreme – Manifestationen eines zentralen Dispositivs des späten 18. und 19. Jahrhunderts handelt, das in den unterschiedlichsten Gestalten und Intensitäten seine Ausprägung fand. Es wäre freilich eine arge – und auch kaum zu belegende – Überzeichnung, wollte man von diesem Dispositiv ausgehend den Instrumentalunterricht des 19. Jahrhunderts in seiner Gesamtheit als versklavend und zurichtend bezeichnen. Eine derartige Kennzeichnung griffe aus drei Gründen ins Leere: Zunächst wäre darauf hinzuweisen, dass die Instrumentalausbildung, zumindest in ihrer professionellen Variante, bis weit in das 19. Jahrhundert hinein eingebettet und integriert war in das Konzept eines umfassenden Musiklernens, das selbstverständlich die Bereiche Improvisation, freie Komposition, Generalbass und Kontrapunkt mit umfasste (vgl. Teriete 2009); 19 20 Wolfgang Lessing selbst für Didaktiker, die in körperlich-instrumentaler Hinsicht ein strikt disziplinierendes Gefügigmachen des »Spielapparats« forderten, war, wie wir noch genauer sehen werden, die Idee einer breit angelegten und vernetzten Musikausbildung, die in ihrer Verbindung von produktiven und reproduktiven Fähigkeiten weitaus vielfältiger war als die vergleichsweise engen instrumentaldidaktischen Zielsetzungen des 20. Jahrhunderts, eine Selbstverständlichkeit. Angesichts der bis über die Jahrhundertmitte hinaus dominierenden Zusammenschau instrumentalpraktischer, improvisatorischer, kompositorischer und musiktheoretischer Aspekte ergäbe eine isolierte Betrachtung der körperlichen Disziplinierungsversuche in den instrumentalpraktischen Fächern daher ein zweifellos unzutreffendes Bild. Des weiteren muss prinzipiell zwischen schriftlich vermittelter Lehre einerseits und jenen unmittelbaren Interaktionen von Lehrer und Schüler andererseits unterschieden werden, die wohl zu jeder Zeit deutlich vielfältigere Erscheinungsformen aufwiesen, als aus den didaktischen Zielsetzungen (und nicht selten auch Zuspitzungen!) gedruckter Lehrwerke abgelesen werden könnte. Und zuletzt sollte auch nicht vernachlässigt werden, dass es durchaus unterschiedliche instrumentenspezifische Lernkulturen gab und gibt: Möglicherweise ist die Tendenz zur körperlichen Disziplinierung beim Klavierspiel als immanentem Bestandteil bürgerlicher Bildung besonders stark ausgeprägt gewesen, während etwa in den Bläserschulen des 19. Jahrhunderts durchaus Lern- und Erfahrungswege beschritten wurden, die sich von heutigen Zugängen keineswegs grundlegend unterscheiden.5 Ungeachtet dieser berechtigten Einwände muss jedoch akzeptiert werden, dass der körper- und musikferne Drill, wenn nicht flächendeckend verbreitet, so doch zumindest derart dominierend war, dass er den an der Schwelle zum 20. Jahrhundert entstandenen physiologisch argumentierenden Lehrwerken – es sei hier auf Namen wie Rudolf Maria Breithaupt oder Friedrich Adolf Steinhausen hingewiesen – als negative Legitimationsbasis eigener Gegenentwürfe diente. Die Rolle der schwarzen Pädagogik in der Geschichte der Instrumentaldidaktik ist bereits Gegenstand mehrfacher Erörterungen gewesen, die hier nicht weiter verfolgt werden sollen (vgl. Wehmeyer 1983, Gellrich 1997, Röbke 2000, Busch 2008). An dieser Stelle soll es vielmehr zunächst um die durchaus beunruhigende Frage gehen, wie es denn möglich sein konnte, dass selbst ein so freier und ungebundener Geist wie Robert Schumann, dessen Musik der französische Poststrukturalist Roland Barthes immerhin die Artikulation und Präsenz einer absoluten, nicht an einen Signifikanten gebundenen Kör5 | Trotz ihres aus heutiger Sicht zunächst »altmodisch« erscheinenden methodischen Zuschnittes, ist etwa die große Flötenschule von Anton Bernhard Fürstenau aus dem Jahre 1844 weitgehend frei von dem körperfernen Drill, der in vielen Klavierschulen vorherrscht (vgl. Fürstenau 1990). Versuch über Technik perlichkeit abgelauscht hat (vgl. Barthes 1990), zeitweise ins Fahrwasser derart drakonischer, im wahrsten Sinne geistloser instrumentaldidaktischer Disziplinierungstechniken gelangen konnte. Um diese Frage zu klären, ist zunächst ein Blick auf die Anfänge des musikalischen Technikbegriffes hilfreich. Betrachten wir dazu einen kurzen Ausschnitt aus den Aesthetisch-historischen Einleitungen in die Wissenschaft der Tonkunst des Bremer Pädagogen Wilhelm Christian Müller aus dem Jahre 1830. In diesem großformatigen Werk, das eine Darstellung aller Bereiche des Musiklebens, vom Instrumentenbau über die Kompositionslehre bis hin zu einer Würdigung aktueller Werke (wie etwa Webers Freischütz) zu sein beansprucht, ist von Technik allenfalls am Rande die Rede. Interesse für unser Thema können Müllers Äußerungen allerdings beanspruchen, wenn man der Frage nachgeht, für welche Aspekte der Begriff der »Technik« verwendet wird – und für welche nicht. Nicht gemeint ist mit ihm, anders als man vermuten könnte, die artistische Geläufigkeit der zeitgenössischen Virtuosengeneration um Paganini, Kalkbrenner, Hummel etc. Für deren Künste finden sich die zeittypischen Zuschreibungen wie »Fingerfertigkeit«, »Geläufigkeit« bzw. pejorative Formulierungen wie »Fingereien« oder – bei Sängern – »Gurgeleien« (Müller 1830, S. 385). Ebenfalls nicht gemeint ist die Zielbestimmung einer instrumentalen Unterweisung – in dem Sinne, in dem etwa Louis Köhler gut 40 Jahre später den ersten Band seiner Systematischen Lehrmethode für Clavierspiel und Musik mit dem Titel Die Mechanik als Grundlage der Technik versah (Köhler 1872). Während Technik bei Köhler als zentraler didaktischer Orientierungspunkt fungiert, nimmt sie bei Müller zunächst noch die Rolle einer bloßen Voraussetzung ein – einer Voraussetzung, die in keiner Weise etwas mit Musik zu tun hat, die aber gleichwohl eine notwendige Vorbedingung des Musizierens darstellt. Es ist aufschlussreich, dass der Begriff der Technik bei Müller in Zusammenhang mit dem seinerzeit berühmten und heute gerne als abschreckendes Beispiel einer »schwarzen Pädagogik« gehandelten Chiroplasten Johann Bernhard Logiers auftaucht, »einer Maschine, den Händen und Fingern die rechte Haltung zu geben« (Müller 1830, S. 393).6 Für Müller sprechen mehrere Gründe für eine derartige äußere Manipulation des Körpers. Diese Gründe werden jedoch, und das muss bei der Bewertung dieses für uns heute aus musikpädagogischen und musikermedizinischen Gründen undenkbaren Verfahrens in Rechnung gestellt werden, nur wirksam, wenn der Chiroplast in dem methodischen Kontext eingesetzt wird, für den er von Logier erdacht wurde: dem instrumentalen Gruppenunterricht: »Die wesentl. Vortheile [des Gruppenunterrichts] können sein: das theoretische Wort ist für alle; b) bei mehreren Schülern ist Wetteifer zu erwecken; c) der Chiroplast […] kann 6 | Vgl. hierzu auch den Beitrag von Akeo Okada, S. 105ff. dieses Bandes. 21 22 Wolfgang Lessing tausend Worte ersparen; d) die Regeln der mus. Grammatik werden früher als gewöhnlich mit der Technik verbunden.« (Müller 1830, S. 393f.) Der Chiroplast wird also nicht um einer musikfernen Unterjochung und Disziplinierung willen eingesetzt, sondern vielmehr um schneller zum ›Eigentlichen‹, der »musikalischen Grammatik«, zu kommen, die für Müller kein Randthema darstellt, sondern – ganz im Sinne der großen instrumentaldidaktischen Entwürfe des 18. Jahrhunderts – das eigentliche Zentrum des instrumentalen Musiklernens bildet. Vor diesem Hintergrund ist es kein befremdlicher Widerspruch, dass der vermeintlich ›schwarze‹ Pädagoge Logier zugleich der Verfasser eines der bedeutendsten musiktheoretischen Werke des frühen 19. Jahrhunderts war. Was ergibt sich daraus für den Bereich der Technik, der sich laut Müller mit Hilfe des Chiroplasten schneller auf den Kernbereich der »musikalischen Grammatik« zubewegen lässt? Als wesentlichstes Merkmal des hier und an anderen Stellen bei Müller auftauchenden Technikbegriffes ist die Tatsache hervorzuheben, dass mit Technik anscheinend eine rein körperliche Seite des Musizierens bezeichnet wird, die von dem eigentlichen Kerninhalt noch gänzlich unberührt ist. An dieser Bestimmung sind zwei Aspekte bedeutsam, die sich von der späteren Verwendung des Technikbegriffs durchaus unterscheiden, die aber zugleich auch seiner Rubrizierung unter den Oberbegriff einer zwanghaften schwarzen Pädagogik im Weg stehen. 1) Technik repräsentiert ein Vormusikalisches, rein Körperlich-Manuelles, dem antithetisch die Welt der »musikalischen Grammatik« entgegengesetzt wird. Dahinter steht eine Sichtweise, die, noch ganz im Geiste des cartesianischen Dualismus, den menschlichen Körper zunächst einmal als ein durch und durch geistloses und damit auch präkulturelles Terrain begreift, das erst in einem zweiten Schritt durch die »Wissenschaft der Tonkunst« überformt wird. Der ›reine‹ Körper hat erst einmal gar nichts mit Musik zu tun. Das zeigt sich auch an den großen, um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen didaktischen Lehrwerken von Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach und Geminiani. Die überaus spärlichen Hinweise zur körperlichen Dimension des Instrumentalspiels (der Begriff der Technik fällt hier noch nicht) tragen in diesen Werken allesamt den Charakter bloßer Prolegomena, die als Setzungen an den Anfang der Unterweisung gestellt und an kaum einer Stelle in entsprechende Übungen überführt werden7. Der in den Instrumentalschulen des späteren 19. Jahrhunderts erstmals auftauchende und bis heute allgemein übliche Gedanke, 7 | Vgl. bei Quantz das 2. Hauptstück (»Von Haltung der Flöte und Setzung der Finger«) sowie das 4. Hauptstück »Von dem Ansatze, (Embouchure)«. Versuch über Technik dass man einen musikalischen Zusammenhang ›benutzen‹ kann, um mit seiner Hilfe seinen eigenen Körper (bzw. dessen Umgang mit dem Instrument) zu fokussieren und den musikalischen Erfordernissen entsprechend zu verändern, scheint dem 18. und frühen 19. Jahrhundert noch weitgehend fremd gewesen zu sein. Sobald der Körper in den Fokus tritt, geht es nicht mehr um Musik bzw. umgekehrt: sobald ein musikalischer Zusammenhang – und sei er noch so elementar – in Erscheinung tritt, geht es nicht mehr um den Körper. Das Zentrum der Unterweisung besteht also auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht in dem, was Müller um 1830 beiläufig ›Technik‹ nennt, sondern in der Kenntnis der »musikalischen Wissenschaft«: der Kunst des guten Vortrags, der »Vorschläge und kleinen wesentlichen Manieren« (Quantz), der »freyen Fantasie« (C.P.E. Bach) etc. Selbst Lerngegenstände, die scheinbar auf eine physiologisch-körperliche Dimension abzielen, wie etwa Quantz’ Ausführungen zum »Athemholen, bey Ausübung der Flöte« (Quantz 1992, S. 73ff.), werden gänzlich aus der Perspektive der musikalischen Grammatik heraus erörtert: es geht hier keineswegs um die Frage, wie der angehende Flötist mit seinem Atem umzugehen hat, sondern vielmehr ausschließlich darum, wann geatmet werden soll: »Wenn ein Stück mit einer Note im Aufheben des Tactes anfängt; die Anfangsnote mag nun die letzte Note im Tacte seyn, oder es mag vor derselben noch eine Pause im Niederschlag stehen: oder wenn eine Cadenz gemachet worden, und sich ein neuer Gedanke anfängt: so muß man bey Wiederholung des Hauptsatzes, oder beym Anfange des neuen Gedanken, vorher Athem holen.« (Quantz 1992, S. 74) Zwar greifen die hier genannten Autoren des 18. Jahrhunderts immer wieder auf das immense Ausdruckspotential des menschlichen Körpers zurück. Doch gerade die Vorliebe für den Bereich psychophysischer Verbindungen, die man etwa bei Carl Philipp Emanuel Bach beobachten kann, ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass der Körper selbst für ›musikalisch‹ gehalten wird bzw. ›sich‹ im musikalischen Affekt ›ausdrückt‹. Walter Benjamin hat gezeigt, dass die barocke Allegorisierung des Körpers gerade nicht auf eine Einheit des psychophysischen Leibs abzielte, sondern den Körper ganz im Gegenteil als Rohmaterial einer rational gesteuerten Bedeutungsgenerierung begriff: »Der menschliche Körper durfte keine Ausnahme von dem Gebot machen, das das Organische zerschlagen hieß, um in seinen Scherben die wahre, die fixierte und schriftgemäße Bedeutung aufzulesen.« 8 (Benjamin 1991, S. 391) 8 | In diesem Zusammenhang muss wohl auch der berühmte §13 im Kapitel »Vom Vortrage« bei Carl Philipp Emanuel Bach gesehen werden. Der »Musickus«, der, um seine Hörer zu rühren, »sich selbst in alle Affeckten setzen« muss und in einem zweiten Schritt 23