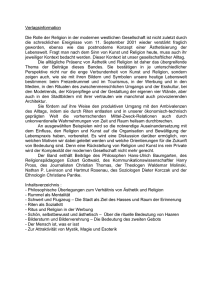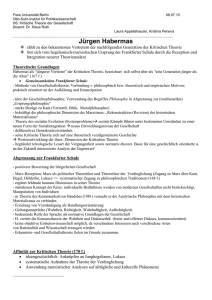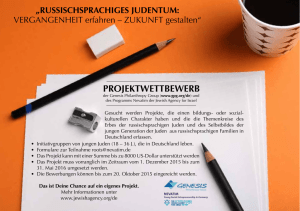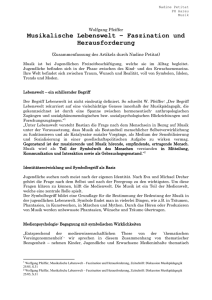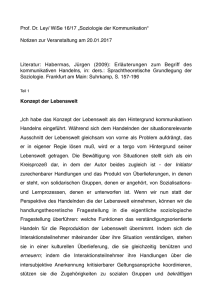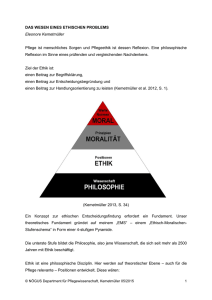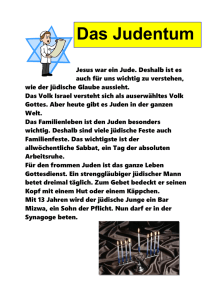(II, S. 206) wird Kommunikation, Handeln und Lebenswelt als
Werbung

Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Jüdischen Studien: Das Basler Beispiel 10.02.2004, 10:45 von Heiko Haumann Das neu gegründete Institut für Jüdische Studien an der Universität Basel nahm zum Wintersemester 1998/99 seine Tätigkeit auf. Damit rückte ein lang gehegter Wunsch, die wissenschaftliche Beschäftigung mit jüdischer Geschichte und Kultur in der Schweiz und in der alemannischen Region zu verstärken, seiner Verwirklichung ein großes Stück näher. Inzwischen wurde Prof. Dr. Jacques Picard zum Leiter des Instituts berufen. Der Stiftungsrat der Stiftung für Jüdische Studien, der die Gründung des Instituts in die Wege geleitet hat und seine Arbeit weiter begleitet, hat die Ziele deutlich formuliert: Die Lebenswelten der Jüdinnen und Juden, ihre Geschichte, Religion, Kultur und Literatur in ihren Wechselbeziehungen mit der nichtjüdischen Umwelt von der Antike bis zur Gegenwart sollen in Lehre und Forschung behandelt und entsprechende Aktivitäten koordiniert werden. Zu untersuchen seien insbesondere die Veränderungen von Lebensbedingungen, Normen, Erfahrungen und Einstellungen, Selbst- und Fremdwahrnehmungen, religiöse, geistige, soziale und politische Strömungen unter den Juden, ihre politische und rechtliche Stellung im Vergleich verschiedener Staaten, ihre Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie ihre Wanderungsbewegungen, Ursachen und Auswirkungen von Antisemitismus und Antijudaismus. In der Erforschung der kulturellen Beziehungen der Juden untereinander seien Sprache, Literatur und Kunst einzubeziehen. Besondere Aufmerksamkeit sei der Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz und in der Region zu schenken. Als Generalthema für ein Forschungsprogramm formulierte der Stiftungsrat: „Nachbarschaft Ausgrenzung - Orientierungssuche. Jüdisches Leben in Ost- und Westeuropa sowie in Israel als multikulturelles Phänomen“. Eine Besonderheit der Basler Beschäftigung mit Jüdischen Studien ist neben der regionalen sowie gesamtschweizerischen Vernetzung, insbesondere mit dem Luzerner Institut für Jüdisch Themenfelder. Desanka Schwara setzte dann das Projekt noch ein Jahr fort, um Kindheit und Jugend in den genannten Regionen zwischen 1881 und 1939 zu untersuchen. Methodisch gingen die MitarbeiterInnen von den Wechselbeziehungen zwischen Strukturen sowie individuellem Denken und Handeln aus. Sie fragten, wie sich Einstellungen, Werte, Normen und Verhalten von Männern und Frauen wandelten, welche neuen Handlungsräume und Tätigkeitsfelder sie sich erschlossen, inwieweit die Religion einen neuen Stellenwert erhielt, wie Jüdinnen und Juden auf die nichtjüdische Umwelt sowie auf Zeitströmungen - Säkularisierung, Aufklärung, Assimilation, Antisemitismus und Nationalismus, Zionismus, Sozialismus - reagierten. Die Ergebnisse dieses Projektes führten zu einer Verfeinerung des Ansatzes. Mehrere Einzelstudien und weitere größere Forschungsvorhaben waren die Folge. Eine Vermittlung wurde versucht durch die Ausstellung „1897 - Der Erste Zionistenkongress in Basel“ samt Begleitpublikationen anlässlich des Jubiläums 1997. Derzeit werden in Basel am Historischen Seminar und am Institut für Jüdische Studien drei Projekte bearbeitet, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. In diesem Jahr gelangen die Arbeiten zum Thema „Überfremdung“ oder die Politik der Ausgrenzung: Ein Vergleich Schweiz - USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diskurs - Handeln – Erfahrung“ zum Abschluss, die 1999 begonnen worden waren. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen des „Überfremdungsdiskurses“ auf die Immigrations- und Flüchtlingspolitik der beiden Staaten. Diskurse, gesellschaftliche Strukturen und subjektive Erfahrungen sollen aufeinander bezogen, die Perspektiven der betroffenen Migranten mit der politischen Ebene, dem gesetzgeberischen Handeln und der behördlichen Praxis, verbunden werden. Auf diese Weise wird die Konstruktion von „Eigen- und Fremdbildern“ deutlich, ebenso die Tradition des Umgangs mit „Fremden“, insbesondere mit Juden. Gleichzeitig ist ein Beitrag zur gegenwärtigen Theorie- und Methodendiskussion in der Geschichtswissenschaft angestrebt. Patrick Kury untersucht den „Überfremdungsdiskurs“ in der Schweiz, Simon Erlanger die Situation der Flüchtlinge in den schweizerischen Lagern während des 2. Weltkrieges und Barbara Lüthi stellt den Vergleich mit den Einwanderungsverhältnissen in den USA an. Neben der gemeinsamen Publikation sind drei Dissertationen zu erwarten. Seit Ende 2000 wird ein Forschungsvorhaben zu „Nation und jüdische Identität“ bearbeitet. Das Erkenntnisinteresse richtet sich darauf, inwieweit die Frage, was ein Jude sei, mit der Herausbildung moderner europäischer Nationalstaaten im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine neue Bedeutung bekam: War „jüdisch sein“ noch vereinbar mit der Zugehörigkeit zu einer Nation, einem Staat? Aus der Perspektive der jüdischen Gesellschaft untersucht die Forschungsgruppe, wie sich Jüdinnen und Juden zum Konstrukt „Nation“ verhielten und wie sie ihre Identität unter diesen Bedingungen bestimmten. Peter Haber wendet sich Assimilationsstrategien von Juden zwischen 1850 und 1910 in Ungarn zu - also in einem Land, das sich als Vielvölkerstaat definierte, Erik Petry geht der jüdischen Identitätssuche im Vielkulturenstaat Schweiz am Beispiel einer Zürcher Gruppe zwischen 1915 und 1955 nach, Daniel Wildmann widmet sich der innerjüdischen Reformierung und Inszenierung des männlichen Körperideals im Kontext von Antisemitismus, Zionismus und der jüdischen Turnund Sportbewegung zwischen 1890 und 1933 in Deutschland, das sich nicht als Vielvölkerstaat verstand. Am Ende der Bearbeitung sollen eine gemeinsame Publikation sowie drei Einzelstudien - zwei Dissertationen, eine Habilitation - und ein Film stehen. Schließlich ist ein interdisziplinäres Projekt anzuführen, das Mitte 2001 begonnen hat: „Vertraut und fremd zugleich. Juden in interkulturellen Beziehungen“. Alexandra Binnenkade untersucht die Mechanismen von Nachbarschaft und Ausgrenzung im schweizerischen „Judendorf“ Lengnau während des 19. Jahrhunderts, Ekaterina Emeliantseva vergleicht die jüdischmessianistische Bewegung der Frankisten in Polen mit der mystisch-messianistischen Gruppe der Chlysty innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche von der zweiten Hälfte des 18. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Svjatoslav Pacholkiv erforscht anhand von Fallstudien die Stellung der Juden in der multiethnischen Gesellschaft Galiziens zwischen 1860 und 1939. Gemeinsam ist allen Teilprojekten die Frage nach dem Verhältnis von Nähe und Distanz in den Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in verschiedenen Gesellschaften und zu verschiedenen Zeiten, das sie über ein Konzept von Kontakt-, Konflikt- und Ausgrenzungszonen näher bestimmen wollen. Langwährende christlich-antijüdische Stereotypen, unterschiedliche Wirtschaftsweisen, Bräuche und Verhaltensformen bewirkten eine „Fremdheit“ der Juden, die durch gesellschaftliche Umbrüche verstärkt wurde. Nachbarschaftliche Nähe war aber auch immer wieder von Vertrautheit geprägt. Die Bedingungen jener Spannung und ihres Umschlagens in Aggressivität - mit erheblichen gesamtgesellschaftlichen Folgen - sollen von einem einheitlichen Ausgangspunkt aus untersucht werden: der Lebenswelt des Individuums. In ihr bündeln sich die Innenwelten der Akteure mit den Einflüssen von Strukturen und Systemen. Erneut werden neben einer gemeinsamen Publikation zwei Dissertationen und eine Habilitation entstehen. Gerade bei den beiden letzten Vorhaben wird deutlich, dass der gemeinsame theoretischmethodische Zugang die höchst unterschiedlichen Einzelthemen, zwischen denen keine unmittelbaren Berührungspunkte bestehen, zusammenhält. Die entsprechenden Diskussionen der MitarbeiterInnen erweisen sich als außerordentlich fruchtbar und geben den Einzelarbeiten entscheidende Anregungen. Schon jetzt kann dieses Experiment als gelungen bezeichnet werden. Durch die lebensweltliche Orientierung und deren Ausgestaltung haben wir die Folgerung daraus gezogen, dass sich nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern auch in der historischen Sektion der Jüdischen Studien ein Paradigmenwechsel vollzogen hat. Nach der Schoa konzentrierten sich die Forschungen zunächst auf die Judenverfolgung und -vernichtung während des „Dritten Reiches“, auf die Geschichte des Antisemitismus und der deutschjüdischen Beziehungen, warfen also den Blick „von außen“ auf das Leben von Jüdinnen und Juden. Abgesehen von einigen Gelehrten, die sich mit der religiösen und geistesgeschichtlichen Entwicklung des Judentums beschäftigten, beginnt sich erst in jüngster Zeit eine Sichtweise „von innen“ auf jüdische Themen auszubilden. Für die Beschäftigung mit dem Ostjudentum lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. Nachdem die intensive wirtschafts-, sozial- und alltagsgeschichtliche sowie volkskundliche Forschung in Osteuropa selbst durch die NS-Zeit abgebrochen war, herrschte lange Zeit ebenfalls ein Zugang vor, der vom staatlichen Handeln, vom Antisemitismus, vom Konflikt her fragte. Gottfried Schramms Anstoß in den sechziger Jahren zur vergleichenden Untersuchung der „Ostjuden als soziales Problem“ zeitigte anfangs nur wenig Wirkung. Erst seit den achtziger Jahren erscheinen zunehmend sozial- und kulturgeschichtliche Arbeiten, die das Leben der Juden zum Gegenstand hatten. Ausnahmen blieben allerdings nach wie vor Studien, die Vorstellungen und Handlungen aus der Sicht der Juden selbst zu rekonstruieren versuchen. Diese Beobachtung bestärkte uns in unseren Überlegungen, den lebensweltlichen Ansatz zu erproben. Was ist damit gemeint? Der Begriff „Lebenswelt“ kommt ursprünglich aus der Philosophie. Nach ersten Überlegungen zum vorwissenschaftlichen, die unmittelbare Erfahrung verarbeitenden „natürlichen Weltbegriff“ (Richard Avenarius, Ernst Mach) sprachen seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr Philosophen von der „Lebenswelt“ (Ernst Troeltsch, Rudolf Eucken, Georg Simmel, Wilhelm Dilthey). In Amerika machte W. James in seinem Aufsatz „The Experience of Activity“ von 1904 auf „the world of life“ aufmerksam und beschrieb Lebenswelt als ein Medium menschlicher Erfahrung. Wichtig war sein Hinweis, dass es keine geschlossene WeltVorstellung gebe, sondern eine Vielzahl menschlicher Lebenswelten, die sich wechselseitig bedingten. Entscheidend für die Wirkung des Lebenswelt-Begriffes wurde Edmund Husserls Phänomenologie. Husserl knüpfte an die erwähnten lebensphilosophischen Konzepte ebenso an wie an Martin Heideggers Vorstellungen von der „Alltäglichkeit des Daseins“, die dieser in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“ 1927 entwickelt hatte. Gegen Auffassungen eines wissenschaftlichen Objektivismus setzte Husserl die Erkenntnis, dass jede menschliche Erkenntnis subjektbezogen und damit auch die Lebenswelt dieses Subjekts durch dessen Erfahrungen und Wahrnehmungen bestimmt sei. Deren Verarbeitung, die Bewusstwerdung, vollziehe sich nicht isoliert und autonom, sondern im Rahmen vielfältiger Verweisungszusammenhänge, die Husserl als „Horizont“ bezeichnet. Ja, er spricht sogar von „Welthorizont“ und identifiziert ihn mit der Lebenswelt des Individuums. Im Anschluss an diese Lehre hat der Lebenswelt-Begriff Einzug in die empirische Forschung gehalten, namentlich in die Soziologie und Pädagogik. Zentral ist er in der „verstehenden Soziologie“, vorab bei Alfred Schütz oder auch bei Thomas Luckmann, der auf Schütz Arbeiten aufbaut. Hier werden Wahrnehmung und Erfahrung des Subjekts durch empirische Analyse mit dem Alltag verbunden. Dabei sehen die Autoren die Lebenswelt nicht als abgeschlossenes, statisches System, sondern mit vielschichtigen intersubjektiven Beziehungen verflochten. Der Kommunikation kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. Diesen Ansatz greift Jürgen Habermas in seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ auf. Allerdings wirft er Schütz und der verstehenden Soziologie vor, letztlich beim „Erleben einsamer Aktoren“ (II, S. 198) stehenzubleiben und die Bedeutung der Kommunikation trotz ausdrücklicher Betonung im Grunde nicht zu erkennen. In diesem Verständnis werde „die Lebenswelt mit dem kulturell überlieferten Hintergrundwissen“ identifiziert (II, S. 204), mit den „kulturellen Deutungs-, Wert- und Ausdrucksmustern“ (II, S. 203). Dabei könnten wir aber nicht stehenbleiben, „wenn wir die Lebensweltanalyse als einen Versuch verstehen, das, was Durkheim Kollektivbewusstsein genannt hat (oder Halbwachs das kollektive Gedächtnis), aus der Innenperspektive der Angehörigen rekonstruktiv zu beschreiben“ (II, S. 203). Habermas macht darauf aufmerksam, dass der Aktor zugleich der „Initiator zurechenbarer Handlungen und das Produkt von Überlieferungen (ist), in denen er steht, von solidarischen Gruppen, denen er angehört, von Sozialisations- und Lernprozessen, denen er unterworfen ist“ (II, S. 204/205). Er hat also Elemente des kollektiven, kulturellen und kommunikativen sowie des sozialen Gedächtnisses - um die Begrifflichkeit der derzeitigen Erinnerungsforschung zu verwenden einbezogen und gleichzeitig als das aktive „Eigene“, das in den bisherigen Gedächtnismodellen nur indirekt angesprochen ist, deutlich benannt. Konsequent gilt Habermas Lebenswelt als „Komplementärbegriff zum kommunikativen Handeln“ (II, S. 182, 198). Kommunikativ bedeutet für ihn „verständigungsorientiert“ (II, S. 184, vgl. I, S. 149 ff., 410 ff., 435 ff.). „Aus der Perspektive von Teilnehmern erscheint die Lebenswelt als horizontbildender Kontext von Verständigungsprozessen (...)“ (II, S. 205). Entscheidend für die Weiterentwicklung des Lebenswelt-Begriffes ist hier der Perspektivenwechsel auf den Teilnehmer, auf den Aktor. Aus seiner oder ihrer Sicht im Alltag (II, S. 206) wird Kommunikation, Handeln und Lebenswelt als „kognitives Bezugssystem (II, S. 207) rekonstruiert. Wenn wir als Historikerinnen und Historiker dies tun, analysieren wir zugleich anhand von Kommunikationsprozessen und Interaktionen des Akteurs dessen Vernetzungen (II, S. 207). Im Begriff der Lebenswelt treffen sich bei Habermas strukturelle Komponenten, nämlich die Kultur - der Wissens- und Deutungsvorrat für die „Kommunikationsteilnehmer“ - und die Gesellschaft - die sozialen Ordnungen und Bezüge sowie diejenigen der Persönlichkeit, die ihr Kompetenzen verleihen und sie damit handlungsfähig machen, mit situationsbedingten, individuellen Faktoren (II, S. 209). Stärker als die phänomenologischen Philosophen und verstehenden Soziologen sieht Habermas die Dialektik des Prozesses zwischen Akteur, Binnenperspektive und Einflüssen von außen (II, S. 223 ff.). Deutlicher könnten wir formulieren: Die Historikerin oder der Historiker rekonstruiert die Vorgänge aus der Sicht des Akteurs in seiner Lebenswelt, analysiert insofern auch das, was auf ihn oder sie von außen einwirkt, etwa die sozialen Strukturen. Das bedeutet unbedingt, dass sich die Historikerin oder der Historiker in diesem Prozess selbst reflektieren muss, um die verschiedenen Ebenen auseinanderzuhalten. Auf diesem Weg kommt Habermas zu einem weiteren maßgeblichen Unterschied gegenüber bisherigen Ansätzen. Er stellt fest, dass ein ausschließlicher Blick auf die Binnenperspektive des Aktors einen wesentlichen Bereich außer acht lässt: Die Gesellschaft ist auch von Vorgängen und Zusammenhängen geprägt, die der Akteur überhaupt nicht wahrnimmt, die er auch nicht beabsichtigt hat. Habermas nennt dies „systemische Mechanismen“ (II, S. 226). Im Kapitalismus und im modernen Staat seien solche Systeme etwa der Markt, die Bürokratie oder das Rechtssystem. Im Grunde greift er hier auf Marx zurück, der festgestellt hatte, dass der Proletarier von Gesetzmäßigkeiten bestimmt werde, die sich „hinter seinem Rücken“ vollzögen, die er also nicht durchschaue; erst im Sozialismus werde er durch bewußte Teilnahme an der Steuerung der Gesellschaft Herr dieser Gesetzmäßigkeiten werden. Laut Habermas stellen somit Lebenswelt und System zwei voneinander zu unterscheidende Mechanismen dar, die auf verschiedenen Arten von Handlungen und Interpretationsformen beruhen. Das lebensweltliche, kommunikative Handeln ist verständigungsorientiert. Systeme hingegen sind nach seiner Meinung selbstgesteuert, nicht kommunikativ. Eine Gesellschaft differenziere sich als System wie als Lebenswelt aus, Gesellschaften stellen „systemisch stabilisierte Handlungszusammenhänge sozial integrierter Gruppen“ dar (II, S. 228). Habermas trennt beide Bereiche voneinander, entkoppelt sie (II, S. 229 ff.), auch wenn sie eng verbunden sind. Je stärker die systemischen Elemente seiner Meinung nach werden - und das gilt für den Prozeß von der archaischen Gesellschaft bis zur Moderne - , um so mehr lösen sie sich von den sozialintegrativen ab und um so nachhaltiger bestimmen sie die „eigensinnigen Strukturen der Lebenswelt“ mit dem „vortheoretischen Wissen“ ihrer Angehörigen (II, S. 229). Diese Lebenswelt bleibe als „Subsystem“ durchaus erhalten. Schließlich komme es zu einer „Kolonialisierung“ der Lebenswelt, die die Moderne kennzeichne (II, S. 293). Der Mensch werde immer stärker fremdgeleitet (vgl. II, S. 593). Es ist hier nicht der Ort, die Habermassche Theorie im einzelnen darzustellen und zu kritisieren. Ihr großes Verdienst ist es, den Begriff Lebenswelt differenziert entfaltet und ausgeleuchtet zu haben und über die bisherigen Vorstellungen hinausgegangen zu sein. Nicht zuletzt über Habermas hat der Begriff dann endlich auch Einzug in die Geschichtswissenschaft gehalten. Bald standen sich Alltags- sowie Sozial- und Strukturhistoriker gegenüber. Während sich die einen seit den achtziger Jahren vermehrt den „eigensinnigen“ Verhaltensformen der Menschen im Widerstand gegen oder in der Anpassung an Systeme zuwandten, nahmen die anderen den Habermasschen Gedankengang auf, daß die modernen Systeme die Lebenswelten zurückdrängten. Nicht die „kleinen Leute“, so argumentierte etwa Hans-Ulrich Wehler, bestimmten den Gang der Geschichte, sondern die Systeme: der Staat, der Kapitalismus, die Bürokratie, der Markt, die Ideologien. Die Systeme wurden auf diese Weise zu Handlungsträgern der Geschichte. Die Hinwendung zu den „kleinen Leuten“ könne die moderne Welt nicht mehr erklären, sei nur für die früheren, eher lebensweltlich organisierten Gesellschaften analytisch sinnvoll. Im Grunde setzt sich dieser Ansatz auch in neueren Theorien fort, so wenn Wissenschaftler, die mit einem enggefassten Diskursbegriff arbeiten, davon ausgehen, daß nicht Menschen, sondern Diskurse in den gesellschaftlichen Prozessen handelten. Rudolf Vierhaus sieht hingegen in der „Rekonstruktion historischer Lebenswelten“ eine Möglichkeit, den „Gegenstandsbereich der Sozialgeschichte“ (S. 9) auf „die von den Menschen erfahrenen (?) Wirklichkeiten des gesellschaftlichen Prozesses“ (S. 8) zu erweitern. Unter „Lebenswelt“ versteht er „die - mehr oder weniger deutlich - wahrgenommene Wirklichkeit (?), in der soziale Gruppen und Individuen sich verhalten und durch ihr Denken und Handeln wiederum Wirklichkeit produzieren“ (S. 13). Der Mensch könne im Laufe seines Lebens „in verschiedenen Lebenswelten gleichzeitig leben“ (S. 14). Wenn Lebenswelt „raum- und zeitbedingte (?) gesellschaftlich konstituierte, kulturell ausgeformte, symbolisch gedeutete Wirklichkeit“ sei (S. 14), ließen sich „strukturanalytische Methoden der Sozialwissenschaft mit phänomenologischen Methoden der Kulturwissenschaften verbinden und die Dichotomien zwischen objektiven Strukturen sozialer Wirklichkeit und subjektiven Vorstellungen von dieser Wirklichkeit überwinden“ (S. 14/15). Der Historiker, von der ethnologischen Methode der „teilnehmenden Beobachtung“ lernend, trete in einen „Prozess der sich gegenseitig kontrollierenden Interpretation und der dichten Beschreibung“ ein (S. 15). Diese angestrebte „von konkreten Lebenswelten“ begreife sich als „historische Kulturwissenschaft“ (S. 16). Mit der Kategorie der Lebenswelt kann am Habermasschen Hinweis angeknüpft werden, Akteur, Binnenperspektive und Einflüsse von außen - eben die Systeme - stünden in einem dialektischen Zusammenhang. Warum soll das seit dem 19. Jahrhundert anders sein? Die Systeme handeln nicht selbst, sondern vermittelt über Menschen: Angehörige der Bürokratie, Teilnehmer der Marktprozesse, Ausführende der Rechtsordnung. Für diese Menschen sind jene Systeme unmittelbare Teile ihrer Lebenswelt. Und für diejenigen, die von den systemischen Elementen eher betroffen sind als dass sie sie aktiv tragen, sind sie es im Grunde auch: Sie müssen sich ständig mit der Arbeits- und Sozialordnung, mit dem Recht, mit dem Markt auseinandersetzen. Indirekt gestalten sie damit diese Systeme mit. Darauf hatte bereits Habermas hingewiesen: der Akteur sei nicht nur „Produkt“, sondern auch „Initiator“. Und warum soll im lebensweltlichen Bereich, ohne die Bedeutung von Wahrnehmung und Erfahrung schmälern zu wollen, nur das intuitive, vortheoretische Wissen eine Rolle spielen? Die Beschäftigung mit Wissenschaft und Theorie kann durchaus zum Alltag gehören. Insofern wäre es angemessen, auch für die Neuzeit nicht von einem Gegensatz von System und Lebenswelt, nicht von zwei voneinander weitgehend abgelösten Bereichen zu sprechen, sondern die systemischen Elemente partiell - und individuell unterschiedlich - in die jeweiligen Lebenswelten zu integrieren. Allerdings müsste dann ebenfalls die Habermassche Annahme aufgeben werden, Kommunikation sei immer verständigungsorientiert. Auch konflikt- oder gar gewaltorientierte Interaktion kann eine Form der Kommunikation sein. Der lebensweltlich orientierte Zugang zur Erforschung von Geschichte versteht sich als Teil einer Kulturwissenschaft, die „Kultur“ in einem weiten Sinn als „Medium historischer Lebenspraxis“ begreift. Im Mittelpunkt steht somit der Mensch in seinen Verhältnissen. Welche symbolischen Ordnungen einschließlich Verschlüsslungen, Codes, Einstellungen, Normen und Werte bestimmen das Verhalten von Menschen? Über welche Deutungsmuster kann er verfügen? Wie verarbeitet er Wahrnehmungen und Erfahrungen? Dieser kulturwissenschaftliche Blick auf Menschen und ihre Geschichte muss sich deshalb untrennbar von ihnen aus auf die Beziehungen zu anderen Menschen - zu Einzelnen und zu sozialen Gruppen -, zu den symbolischen Ordnungen und ihren Repräsentationen, zu den Strukturen in der Gesellschaft und deren Einflüssen auf das Leben einzelner Menschen richten, auf ihre Verknüpfung mit der jeweiligen Umwelt, auf Vernetzungen und Mechanismen. Bei einer solchen Perspektive besteht kein Gegensatz zwischen individueller Lebenswelt und gesellschaftlicher Struktur, zwischen Mikro- und Makro-Geschichte, sondern die Lebenswelt bildet gleichsam die Schnittstelle, in der sich Individuum und System bündeln. Das Individuum findet in seiner Lebenswelt eine bestimmte Situation vor, etwa materielle Bedingungen, politisch-gesellschaftliche Verhältnisse, vorherrschende Ideologien. In einer Wechselwirkung mit Natur und Sozialwelt bilden sich in seiner Innenwelt Gefühle, Einstellungen, Wahrnehmungsweisen heraus. Der Mensch verarbeitet auf diese Weise die Außen- und Innenwelt. Er entwickelt bestimmte Denk- und Verhaltensweisen, Handlungen, die die Strukturen möglicherweise ebenso verändern wie seine eigene Innenwelt. Mit der Analyse der individuellen Lebenswelt werden somit zugleich exemplarisch Strukturen und Systeme materielle, symbolische, mentale, emotionale - analysiert. Da das Individuum nicht isoliert lebt, sondern im Kontakt mit anderen Individuen und deren Lebenswelten steht, bleibt die Analyse nicht im Punktuell-Beliebigen stecken, sondern kann das Netz interkultureller gesellschaftlicher Beziehungen sichtbar machen. Zusammenhänge und Mechanismen in ihren wechselseitigen Bedingungen geraten ins Blickfeld, die Geschichte zerfällt nicht in lauter Einzelteile. Zugleich wird es möglich, eine vorzeitige Blickverengung auf eine reine Strukturgeschichte, auf nur subjektive „Geschichten“ oder auf symbolische Systeme zu vermeiden. Die Lebenswelt der Akteure steht jeweils in ihrem historischen Kontext. Die sozialen und ökonomischen Verhältnisse, die gesellschaftlichen - kulturellen, geschlechtsbezogenen und sozialen Unterschiede, die Herrschaftsorganisation und Machtverteilung werden mit untersucht. Individuelle, lokale, Regional- und Alltagsgeschichte in ihrem uneinheitlichen, vielschichtigen und fragmentarischen Nebeneinander sind zugleich Gesellschaftsgeschichte. Indem Historikerinnen und Historiker den Kommunikationsprozess der untersuchten Individuen verfolgen, treten sie selbst in ihn ein: Sie versuchen, sich den Menschen und deren Lebenswelten, wie sie sie in den Quellen kennenlernen, so zu nähern, als säßen sie ihnen im Zeitzeugengespräch der „Oral History“ gegenüber und müssten dies anschließend auswerten wenngleich im Bewusstsein, keine Nachfragen stellen zu können. Für sie ist der Mensch in den Quellen ein ernstzunehmender Dialogpartner, nicht lediglich ein Untersuchungsobjekt, seine Äußerungen und Handlungen dienen nicht einfach als illustrierende Belegstelle. Das bedeutet, in die vielfältigen Wechselbeziehungen und -wirkungen die kritische Reflexion des eigenen Vorverständnisses, der ihm bekannten oder neu anzueignenden Theorien und Methoden sowie des laufenden Bewusstmachungsprozesses mit einzubringen. Durch diesen Dialog wird es auch möglich, sich „das Eigene“ „fremd“ zu machen und umgekehrt. Als Beispiel eines solchen Vorgehens erwähne ich ein eigenes Projekt. Nach verschiedenen Vorstudien möchte ich jüdisches Leben in Osteuropa zwischen 1850 und 1930 unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation rekonstruieren. In einer ersten Annäherung habe ich die Sichtweisen von Jüdinnen und Juden anhand exemplarischer Selbstzeugnisse mit den Begegnungsorten im Schtetl in Beziehung gesetzt - so, als würde bei einem fiktiven Rundgang jemand aus seinem Leben erzählen. Ansatzweise wurden dabei die Umrisse des Kommunikationsgefüges im Schtetl deutlich. Die gewissermaßen selbstverständliche Interaktion zwischen Juden und Nichtjuden funktionierte so lange, wie der Gleichgewichtszustand, der sich herausgebildet hatte, nicht gestört wurde. Befürchtungen, dass unterschwellig vorhandene Spannungen aufbrechen, etwa judenfeindliche Klischees innerhalb der Dialektik von vertraut und fremd in gewalttätige Aktionen umschlagen könnten, waren vielfach gegenwärtig. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft kam ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zum Ausdruck. Der Verlust des Gleichgewichtszustandes wirkte jedoch durchaus auf sie zurück. Um das Gleichgewicht zu erhalten, waren die verschiedenen Kommunikationsräume im Schtetl klar umrissen und sorgfältig voneinander getrennt, aber zugleich durch formell geregelte Beziehungen - so durch die Einbeziehung von Christen in rituell-religiöse Handlungen der Juden - wie auf informelle Weise durch gegenseitige Achtung und viele Kontakte verbunden. Störungen ergaben sich vor allem, wenn jemand von der einen in die andere Welt vorzustoßen suchte: Eine christlich-jüdische Liebesbeziehung brachte die Ordnung durcheinander, die Suche nach einer auskömmlichen Existenz ließ Juden und Christen zu ökonomischen Konkurrenten werden, ein selbstbewusster jüdischer Sozialist oder Zionist drang in nichtjüdische Bereiche vor und erregte damit Befremden, nicht zuletzt in seinem bisherigen jüdischen Umfeld. Die demographischen, wirtschaftlichen, sozialen und mentalen Veränderungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machten andere Kommunikationsregeln notwendig. Das Ringen um einen neuen Gleichgewichtszustand war in manchen Selbstzeugnissen spürbar. In einem nächsten Schritt könnte aufgrund der vorläufigen Ergebnisse ein Fragenkatalog zusammengestellt werden, mit dessen Hilfe die Berichte der Gewährsleute noch einmal zu durchdenken wären. Abgesehen von Unterscheidungen nach Alter, Geschlecht, sozialem Rang, religiöser und politischer Einstellung ließen sich etwa die Konfliktregelungen im Schtetl oder in anderen Siedlungsformen genauer untersuchen, weiterhin die Wechselwirkungen zwischen Gefühlen, Einstellungen sowie Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensweisen mit den jeweiligen materiellen und symbolischen Strukturen, die Zusammenhänge der persönlichen Ebenen mit den übergreifend gesellschaftlichen thematisieren. Schließlich könnten im Dialog mit den Selbstzeugnissen Erinnerungsvorgänge verdeutlicht und gefragt werden, was sie für die Lebensgestaltung und für das Zusammenleben mit Juden wie mit Nichtjuden bedeuteten. Im Vergleich mit Selbstzeugnissen aus anderen kulturellen Zusammenhängen wäre der Stellenwert von Erinnerung für Verhalten und interkulturelle Beziehungen präziser zu fassen. Die lebensweltliche Orientierung hätte den Akteuren ihren Platz in der Geschichte gegeben, den sie eingenommen hatten, und aus ihrer Perspektive einen Ausschnitt gesellschaftlicher Vorgänge entschlüsselt. In der Auseinandersetzung mit den Quellen und in der Selbstreflexion können Historiker sowie - vielleicht - Leserinnen und Leser die Zusammenhänge von individuellem Denken und Handeln mit Strukturen nachvollziehen, gleichsam „probehandeln“, und Folgerungen für sich selbst ziehen.