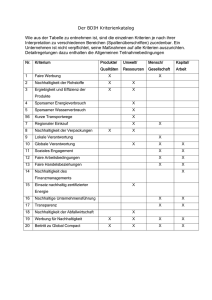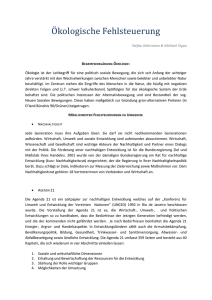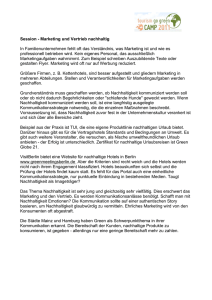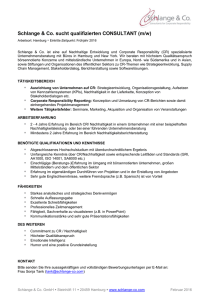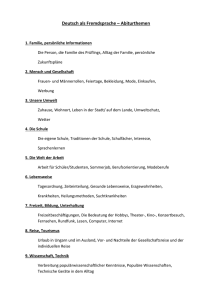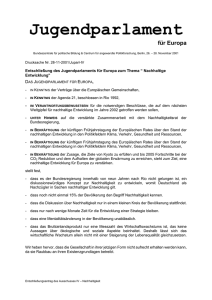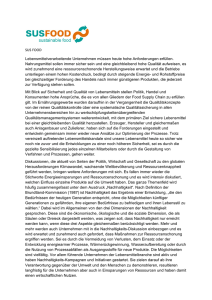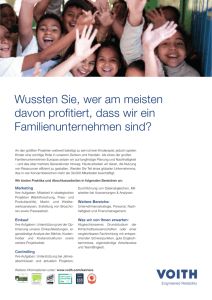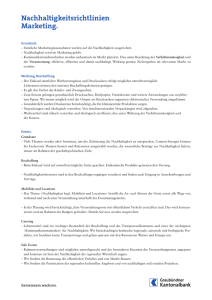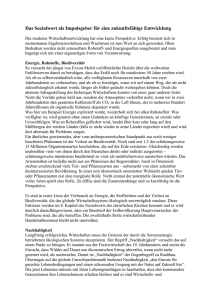Ulrich Brand - Umweltbundesamt
Werbung

1 Ulrich Brand Eine mutige Politik für eine nachhaltige Zukunft Vortrag in der Reihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ am 13.1.2011 in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Das Oberthema der Veranstaltungsreihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ fordert den Sozialwissenschaftler natürlich zu einer kurzen Reflexion der beiden Begriffe im Titel heraus. Auf den Nachhaltigkeitsbegriff werde ich noch eingehen. Doch warum bedarf es eigentlich des Mutes zur Nachhaltigkeit? Mit Mut verbinden wir eine Tugend, die uns in kritischen, ja gefährlichen Situationen zum Handeln verhilft. Mit dem Wort Mut verbinden wir Hoffnung, Aufbruch, manchmal Risiko oder sogar, wenn sich jemand zu viele Hoffnungen macht, Übermut. Wenn jemand unnötig viel Mut an den Tag legt, ist sie oder er tollkühn und wir raten zu mehr Besonnenheit. Andere Gegenbegriffe von Mut sind Zaghaftigkeit oder gar Resignation. Eine der für unsere modernen Gesellschaften wohl bedeutendsten Aussagen, in der es um Mut geht, ist jene des Philosophen Immanuel Kant in seinem wissenschaftlich wie politisch bahnbrechenden Aufsatz von 1784 mit dem Titel „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“. Für Kant war Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sich also seines Verstandes eigenständig, ohne Leitung von anderen zu bedienen. „Habe den Mut“, so der Kant´sche Imperativ, „dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Wenn wir über den Begriff des Mutes nachdenken, dann hat er also viele Facetten. Ich möchte über zwei Dimensionen von Mut sprechen. Über persönlichen Mut im Sinne eines möglichst selbständigen Denkens und Handelns und über gesellschaftlichen, oder wenn Sie so wollen: kollektiven Mut. Bevor ich dazu im zweiten Teil meines Vortrages komme, möchte ich im ersten Teil einige Aspekte der aktuellen gesellschaftspolitischen Konstellation in Erinnerung rufen, die ja dazu führt, dass es überhaupt eine Reihe mit dem Titel „Mut zur Nachhaltigkeit“ geben muss. Der Appell im Titel ist ja Ausdruck dessen, dass 25 Jahre nach Veröffentlichung des BrundtlandBerichts und fast 20 Jahre nach der Rio-Konferenz sich so viel nicht zum Besseren verändert hat. Auf der Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in der brasilianischen Metropole wurden neben der Agenda 21 immerhin die völkerrechtlich verbindlichen Konventionen zu biologischer Vielfalt und zu Klima unterzeichnet, die dann in den Jahren 1993 bzw. 1994 in Kraft traten. Die Konferenz galt nach dem Ende der Blockkonfrontation als Auftakt, die drängenden weltgesellschaftlichen Probleme wirklich kooperativ zu bearbeiten. Warum haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt? Ich spreche dabei nicht über die materielle Dimension der sozial-ökologische Krise selbst. Sie ist in den Grundzügen bekannt, obwohl wir noch viel weiteres Wissen und entsprechende Forschung benötigen. Wir versuchen in unseren politikwissenschaftlichen Forschungen am IPW genauer zu verstehen, wie und warum Umweltpolitik und in einem weiteren Sinne Gesellschaftspolitik funktioniert, welche Problemdeutungen ihnen zugrunde liegen, welche Interessen und Leitbilder sich 2 in Politik niederschlagen, welche unterschiedlichen politischen, ökonomischen und kulturellen Vorschläge es gibt, die unterschiedlichen Dimensionen der sozial-ökologischen Krise zu bearbeiten. Wir befassen uns unter dem Begriff der Implementierungsforschung mit der Frage, wie und warum Politik effektiv ist oder eben nicht. In diesem Sinne möchte ich mich in Vorbereitung der Frage, was aus meiner Sicht „Mut zur Nachhaltigkeit“ und vor allem mutige Politik bedeutet, aus sozialwissenschaftlicher Sicht etwas systematischer damit befassen, warum sich angesichts der allseits bekannten, sich zuspitzenden ökologischen Krise so wenig tut. Dabei gehe ich von einem weiten Politikbegriff aus, der mehr als nur das Handeln von staatlichen und Parteiakteuren umfasst. Politik umfasst nicht nur das Ausdrückliche, als Politik bezeichnete, sondern auch die vielen Handlungen von Menschen im Alltag, in der Wirtschaft, im Kulturellen, die zur gar nicht so nachhaltigen Gestaltung unserer Gesellschaft beitragen. Worin liegen also die zentralen Probleme? Drei Aspekte scheinen mir entscheidend. Erstens haben sich die Institutionen der Umweltpolitik im Hinblick auf eine Bearbeitung der verschiedenen Dimensionen der ökologischen Krise als nur begrenzt wirksam erwiesen. Besonders stechen hier der Klimawandel und die Erosion der biologischen Vielfalt hervor, die beide weiter voranschreiten. Mit dem Aufbau umweltpolitischer Institutionen oder der Einrichtung von Abteilungen in bestehenden Institutionen war und ist die Hoffnung verbunden, dass damit ein Umlenken in Richtung Nachhaltigkeit erreicht werden könnte. Ich erwähnte die Rio-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992. In sehr vielen Ländern gibt es heute auf nationaler Ebene Umweltministerien und nach gelagerte Organisationen. Die EU hat eine eigene Generaldirektion zum Thema. Dieses Umlenken ist bei allen Erfolgen im Einzelnen insgesamt nicht gelungen. Die Bearbeitung der ökologischen Krise wurde zu einem eigenen Politikfeld und eben nicht, wie oft gefordert, zu einem Querschnittsthema. Das hat viel mit Interessen und in Gesellschaft und Politik tief verankerten, gar nicht nachhaltigen Orientierungen zu tun. Politikwissenschaftlich gesprochen ist die Sektoralisierung der Politik, in der Umweltpolitik eben nur ein Sektor ist, Teil des Problems und nicht seiner Lösung. Dabei dominiert bis heute eine Management-Perspektive, der zufolge mit ausreichend Wissen und umweltpolitischem Willen ein grundlegendes Umsteuern durch Regierungen möglich sei. Ich habe das an anderer Stelle als „Rio-Typus“ von Politik bezeichnet. Es ist aber mehr: Die umweltpolitischen Institutionen erweisen sich zudem als zahnlos gegenüber dominanten Entwicklungen. Der Globalisierungsprozess bedeutet eine enorme Aufwertung von privatwirtschaftlichen Kalkülen, von einem intensiveren Zugriff nicht nur auf billige Arbeitskräfte in anderen Ländern, sondern auch auf deren Ressourcen. Die nicht-nachhaltigen Produktions- und Lebensweisen sind derart tief verankert, dass die umweltpolitischen Institutionen daran kaum herankommen. Damit bin ich bereits beim zweiten Grund für die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der Politik für Nachhaltigkeit neben der geringen Steuerungswirkung politischer Institutionen. Dieser liegt in der vorherrschenden Lebensweise, die wir als industriell, kapitalistisch und fossilistisch bezeichnen können. 3 Industriell, weil die enormen Wohlstandsgewinne der letzten zweihundert Jahre der Herausbildung einer Industrie samt ihrer Kultur und technisch-wissenschaftlichen Rationalität zu verdanken sind. Dieser Fortschritt wurde mit einer zunehmenden Beherrschung und Destruktion der Natur erkauft. Kapitalistisch, weil es in unseren Gesellschaften sehr stark darum geht, dass eingesetztes Kapital sich vermehrt oder, wie die Ökonomen sagen, verwertet. Den meisten Investoren und Vermögensbesitzern, das sehen wir in der aktuellen Wirtschaftskrise deutlich, ist es egal, wie ihr Geld vermehrt wird. Das führt im Umgang mit der Natur dazu, dass sie weitgehend aus einer Perspektive betrachtet wird, wie mit ihr bzw. mit ihren Bestandteilen ökonomische Werte geschaffen werden können. Die Inwertsetzung der Natur wurde zu einem dominanten Paradigma, die paradoxerweise mit einer starken Naturblindheit in der Gesellschaft einhergeht. Fossilistisch ist unsere Entwicklungsweise, das muss ich in diesem Kreis wahrscheinlich nicht besonders betonen, da die energetische Grundlage eben auf fossilen Energieträgern beruht. Hier ist zwar einiges in Bewegung gekommen mit dem Ausbau regenerativer Energien. Doch weltweit nimmt aufgrund des starken Wachstums industrieller Produktion und Konsums die Nutzung fossiler Energieträger weiterhin zu. Wir kommen um eine Einsicht nicht herum. Die aktuell dominante und sich globalisierende kapitalistisch-industrialistische Produktions- und Lebensweise hat für viele Menschen eine enorme Attraktivität. Markus Wissen und ich haben dafür den Begriff der imperialen Lebensweise vorgeschlagen. Damit wollen wir eine Perspektive dafür öffnen, dass die in den westlichen Gesellschaften alltäglich gelebten Formen des Zusammenlebens auch darauf basiert, dass Produkte aus anderen Ländern konsumiert werden, die von billigen Arbeitskräften oder oft genug durch Raubbau an der Natur produziert wurden. Diese imperiale Lebensweise betrifft auch die Schwellenländer. Denn die westliche Lebensweise verallgemeinert sich weltweit. Norman Myers und Jenniffer Kent schätzten vor einigen Jahren die »transnationale Verbraucherklasse« der globalen oberen Mittel- und Oberschichten, die vor allem durch ihren Konsum von Fleisch, Autos und Elektrogeräten die Umwelt stark belasten, auf knapp zwei Milliarden Menschen. Von ihnen leben 850 Millionen im Globalen Norden und 1,1 Milliarden als »neue KonsumentInnen« im globalen Süden (vor allem in 17 Ländern des Südens sowie Russland, Polen und die Ukraine); in China etwa so viel wie in den USA. Damit sollen die absoluten Konsumniveaus nicht gleichgesetzt werden, aber eine wichtige Entwicklung wird damit angedeutet und stellt die häufig vorgenommene umweltpolitische Nord-Süd-Dichotomie infrage. Dass diese Produktionsweise tief verankert ist, wird am Thema ökonomisches Wachstum besonders deutlich. Denn die verteilungspolitische Versöhnungsformel moderner kapitalistischer Gesellschaften ist das quantitative ökonomische Wachstum. Damit wächst der Verteilungsspielraum von Staat und Tarifparteien. Die historischen Kämpfe der ArbeiterInnenbewegung haben dazu geführt, dass die wachstums-, wirtschafts- und verteilungspolitischen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung stark politisiert sind. Andere Aspekte wurden dabei an den Rand gedrängt und teilweise erst später politisiert: etwa jene nach Geschlechtergerechtigkeit, nach den Umweltbelastungen des Wachstums und des Produktionsmodells oder nach den internationalen (imperialen) Voraussetzungen, d.h. die Tatsache, dass Menschen in anderen Ländern zu schlechteren Bedingungen arbeiten und durch den internationalen Handel zum Reichtum in den wohlhabenden Ländern beitragen. 4 Besonders in Zeiten ökonomischer Krisen wird deutlich, was es bedeutet, wenn ökonomisches Wachstum nicht gesichert ist. Glücklicherweise wird das Wachstumsdogma derzeit Gegenstand wissenschaftlicher, politischer und öffentlicher Diskussionen. Das war übrigens auch in der letzten großen Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1970er Jahre der Fall. Die Studie an den Club of Rome zu Grenzen des Wachstums ist bis heute ein prominenter Beitrag zur damaligen Krisendiskussion. Die industrielle, fossilistische und kapitalistische Lebensweise, die man in vielen Aspekten auch als imperiale Lebensweise bezeichnen kann, ist also ein zweiter Hauptgrund für den geringen Erfolg einer umfassenden, nachhaltigen Politik. Ein dritter Grund der geringen positiven Wirkungen von Umwelt- oder Nachhaltigkeitspolitik liegt meines Erachtens in ihrer symbolischen Instrumentalisierung. Die relativ starke Politisierung der ökologischen Krise ist ein Erfolg von sozialen Bewegungen und NGOs, von kritischen Medien, der Wissenschaft und nachdenklichen Menschen in Staat und Parteien. Doch das Umweltthema allgemein und die Umweltpolitik im Besonderen werden derzeit zu einem Terrain, auf dem etwas ganz anderes ausgefochten wird: Es geht darum, den Legitimationsverlust neoliberaler Politik und die Repräsentationskrise von Staat und Parteien aufzufangen, so meine These. Lassen Sie mich diesen Gedanken kurz ausführen. Wir erleben ja nicht nur die mitunter dramatischen Auswirkungen der Umweltkrise und Ressourcenverknappung. Es hat auch eine Transformation der Gesellschaft stattgefunden, und in den letzten Jahren nimmt die Kritik an der neoliberalen Veränderung von Staat und Gesellschaft zu. Die Folgen des Umbaus und die multiple Krise schaffen einen Legitimationsverlust für die herrschende Politik. In dieser Konstellation bietet sich ein Thema geradezu an, bei dem alle der Meinung sind, dass dringend etwas geschehen muss und bei dem Staat und Parteien ihre Glaubwürdigkeitskrise bearbeiten können. Das sind das Umwelt- und vor allem das Klimathema. Alle nicken, wenn es darum geht, Klimaschutz zu betreiben. Da gibt es ein Feld, auf dem sich grundsätzlich alle einig sind. Das verdichtet sich auch in der angeblichen Einigkeit über den Begriff Nachhaltigkeit. Das Perfide in dieser Situation ist nun, dass es einen breiten, wenn auch diffusen und nicht offen eingestandenen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass Umweltpolitik nicht das hiesige Wohlstandsmodell infrage stellen darf. Wir wissen längst, dass der Ressourcen- und Energieverbrauch dramatisch sinken muss, aber es geschieht dann doch relativ wenig. Selbst auf der Hand liegende Politiken wie ein Verbot der Stand by-Funktionen bei Elektrogeräten, ein Abbau der Agrarsubventionen für die Fleischproduktion, hohe Kerosinsteuern oder eine stärkere Förderung haltbarer Konsumgüter finden nicht statt. Die Devise lautet: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Alle wissen: Wir können öffentlich besorgt sein und müssen doch nicht besorgt sein im Sinne eines grundlegenden Wandels von Politik und Wirtschaft. Hier liegt ein zentrales Problem für die Nachhaltigkeitspolitik. In diesem Zusammenhang, ich erwähne diesen Aspekt nur, halte ich die dominante Thematisierung der ökologischen Krise für problematisch. Wir erleben weiterhin eine fast katastrophische Aufladung von Klimawandel, Bodenerosion oder Verlust der Biodiversität. Es ist immer „5 nach 12“, die Menschheit als solche muss umdenken und umlenken. Doch seit 20 Jahren tut sich nicht allzu viel und ich zitiere bei diesem Thema gerne einen Begriff, den der Mitbegründer des Frankfurter Instituts für sozial-ökologische Forschung, Egon Becker, nach dem 5 Reaktorunglück in Tschernobyl verwendete. Er sprach von einem „post-katastrophischen Bewusstsein“, das sich herausbilde, wenn jahrelang die Gefahr eines nuklearen GAU damit politisiert würde, dass nach eben einem solchen kein Leben mehr in Europa möglich sei. Doch das Leben ging weiter. Damit möchte ich nicht die Nutzung der Atomkraft rechtfertigen; ich halte sie in der Tat für unverantwortlich. Ich möchte nur auf ein Dilemma hinweisen und ein späteres Argument vorbereiten: Wenn immer nur von Katastrophen gewarnt wird, dann verschütten sich gegebenenfalls Handlungsmöglichkeiten. In meiner einleitenden Bemerkung habe ich als Gegenbegriffe zu Mut Zaghaftigkeit oder Resignation genannt. Ich denke, dass die verallgemeinerte politische und gesellschaftliche Resignation, die eine Politik der Nachhaltigkeit ja aufbrechen muss, durchaus mit der katastrophischen Thematisierung der ökologischen Krise zu tun hat. Bislang habe ich Ihnen zu zeigen versucht, dass aus meiner Sicht drei Aspekte besonders zu berücksichtigen sind, wenn wir nach den Gründen für das bislang wenig erfolgreiche Umsteuern hin zu einer nachhaltigen Politik und Lebensweise suchen: Die recht zahnlosen politischen Institutionen, eine tief verankerte und keineswegs nachhaltige Lebensweise und eine symbolische Instrumentalisierung und katastrophische Aufladung der ökologischen Krise, um von Seiten der herrschenden Politik in der viel umfassenderen Krise Problembewusstsein und Politikfähigkeit zu suggerieren. Wie also nun, angesichts dieser vertrackten Situation, mutige Politik für eine nachhaltige Zukunft vorantreiben? Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages. Nachhaltigkeitspolitik ist dann mutig, wenn sie sich die Schwäche oder gar das Scheitern der bisherigen Bemühungen eingesteht und sich aufmacht, aus den Schwächen und Fehlern zu lernen. Wenn das nicht geschieht, dann laufen wir Gefahr etwas zu betreiben, was der Berliner Politikwissenschaftler WolfDieter Narr in anderem Zusammenhang begrifflich auf den Punkt gebracht hat: Wir betreiben eine recht naive „Hofferei“. Das ist natürlich ein weites Feld und glücklicherweise handelt es sich um eine mehrsemestrige Vorlesungsreihe. Ich muss das Thema also nicht erschöpfend behandeln; das könnte ich auch gar nicht. Deshalb konzentriere ich mich auch hier auf drei Aspekte, die mir wichtig erscheinen. Wenn Sie wollen, könnte man diesen zweiten Vortragsteil unter das Motto „Streiten für gerechte Nachhaltigkeit“ stellen. Erstens: Meines Erachtens müssen wir uns mutig eingestehen, dass der Nachhaltigkeitsbegriff in der gegenwärtig dominierenden Verwendung nicht viel taugt. Er hat sein kritisches Potenzial verloren. Mutig ist so eine Aussage deshalb, weil sie mit der Gefahr der politischen und wissenschaftlichen Ausgrenzung einhergeht. Man kann ja heute kaum gegen Nachhaltigkeit sein; mit dem Begriff ist scheinbar alles gesagt. Das ist mitnichten der Fall. Ich spreche mich nicht gegen den Nachhaltigkeitsgedanken aus, sondern problematisierte die Tatsache, dass der Begriff über eine zu breite Verwendung selbst eher schwammig ist. Vor allem wird der Nachhaltigkeitsbegriff zunehmend auf ökologische Fragen und Strategien der ökologischen Modernisierung eng geführt. Wenn aber alles Mögliche damit gerechtfertigt wird, auch die neuesten Autos, dann gilt es ihn zu präzisieren. 6 Im ein Beispiel zu nennen: Hochgradig umstritten ist eben auch, ob die als nachhaltigen bezeichneten Kraftstoffe, die aus Pflanzen hergestellt werden, sog Bio- oder Agrartreibstoffe, wirklich nachhaltig sind. Sie ziehen etwa Landkonflikte in Indonesien nach sich, wenn KleinbäuerInnen vertrieben werden, es kommt zu einer Konkurrenz mit dem Anbau von Nahrungsmitteln. Fuel versus food lautete das Stichwort der vor zwei Jahren heftig geführten Debatte. Ja, es gibt sogar naturwissenschaftliche Zweifel daran, ob Agrartreibstoffe wirklich eine positive Energiebilanz haben. Daher schlage ich als erstes Element von Mut zur Nachhaltigkeit vor, den Begriff der Nachhaltigkeit zu präzisieren. Wenn wir etwa von „gerechter Nachhaltigkeit“ sprechen, dann können wir zum einen eine präzisere normative und gesellschaftspolitische Vorstellung entwickeln und zum anderen andere Akteure einbeziehen. So ist der Begriff möglicherweise anschlussfähiger an gesellschaftliche Mehrheiten und an bislang nur wenig ökologisch sensibilisierte Akteure. Ich möchte das kurz an den Gewerkschaften verdeutlichen. Für sie werden ökologische Fragen nur an Bedeutung gewinnen, wenn sie mit sozialen Fragen verbunden werden. Das war und ist ja auch die Grundidee von Nachhaltigkeit, aber die ist aus meiner Sicht eben zu sehr auf ökologische Fragen reduziert. Innerhalb der Gewerkschaften wird seit einigen Jahren von einer just transition, einer gerechten Transition gesprochen. Das ist nur eine Minderheit, doch mir geht es um einen anderen Punkt. Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder und die vielen nicht-gewerkschaftlich organisierten Lohnabhängigen als wichtige Akteure bekommen wir nur ins Boot, wenn sie nach Jahren der Schwächung überhaupt mitsprechen können. Wenn es etwa bei der mittelfristigen Konversion der Automobilindustrie in eine Mobilitätsindustrie den Beschäftigten Angebote gemacht werden, wenn sie umgeschult werden, wenn nicht weiterhin unter reinen Rentabilitätsgesichtspunkten über sie hinweg entschieden wird. Ein anderes Beispiel ist die seit zwei Jahren innerhalb der Klimapolitik wichtiger werdende Debatte um Klimagerechtigkeit. Hier soll deutlich werden, dass es nicht abstrakt um Klimaschutz geht, sondern dass die Auswirkungen des Klimawandels wie auch die notwendigen Klimapolitiken unterschiedliche Länder und Schichten sehr verschieden betreffen. Damit bin ich bei einem zweiten Aspekt einer mutigen Politik. Vorhin habe ich argumentiert, dass die katastrophische Rahmung der ökologischen Krise, so sehr sie auch einen richtigen Kern hat, ein politisches Problem ist. Wichtig wäre hier anzuerkennen, dass die globale Krise und insbesondere ihre ökologischen Dimensionen durchaus einen weltweiten Charakter haben. Aber sie betrifft verschiedene Menschen und Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich. Meines Erachtens bedeutet „Mut zur Nachhaltigkeit“ heute nicht so sehr, dass die Menschheit oder die Staatengemeinschaft gemeinsam und entschlossen handeln. Vielmehr muss um Nachhaltigkeit und vor allem um gerechte Nachhaltigkeit gesellschaftlich gerungen werden. Da impliziert politische, aber auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Trotz der tief verankerten imperialen Lebensweise gibt es unzählige Konflikte um den Umgang mit Natur. Viele Menschen wollen anders handeln und können es nicht, weil sie etwa vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten werden oder weil sozial-ökologisch produzierte Produkte unbotmäßig viel teurer sind, da sie ohne oder mit weniger Subventionen auskommen müssen. Die vorhin erwähnten Strategien, Pflanzen für vermeintlich nachhaltige Agrartreibstoffe anzubauen, führen in vielen Ländern des globalen Südens zu massiven Konflikten um Land, um Nahrungsmittel, letztlich um Lebenschancen und Überlebenschancen. 7 Ich halte es hier also mit dem großen liberalen Denker Ralf Dahrendorf, für den gesellschaftliche Konflikte das Lebenselixier der Demokratie waren. Nur so können Interessengegensätze offen gelegt und Innovationen erreicht werden. Die jüngsten Auseinandersetzungen um den Stuttgarter Hauptbahnhof waren m.E. deshalb wichtig, weil sehr viele Menschen gemerkt haben – und dann dagegen protestiert – welche politischen und ökonomischen Interessen hinter solch einem Großprojekt stehen, wie intransparent Planungsprozesse ablaufen und dass es sehr wohl Alternativen gibt. Auf wirkliche Veränderungen abzielende Politik legt sich gegebenenfalls mit mächtigen politischen, ökonomischen und kulturellen Akteuren an, die ihre Interessen eher durchzusetzen in der Lage sind (bei kulturellen Akteuren denke ich an die Medien). Die private und damit exklusive Verfügung über Eigentum, Investitionen sowie Forschung und Entwicklung sind Bestandteil nicht-nachhaltiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Dies gilt auch für viele staatliche Politiken, von der lokalen bis hin zur internationalen Ebene. Insofern sind viele der aktuellen Auseinandersetzungen um Privatisierungen – etwa der kommunalen Wasserversorgung oder der öffentlichen Transportbetriebe – auch solche um konkrete Umwelt- und Gerechtigkeitspolitik. Damit komme ich zu einem dritten Aspekt einer mutigen Politik, die aus meiner Sicht zum Hautproblem des Mutes zu Nachhaltigkeit darstellt. Die oben skizzierte und für viele Menschen attraktive oder zumindest Lebensweise gilt es zu verändern, die Kultur des „Geiz ist geil“. Es muss aus meiner Sicht gelingen, die imperiale Lebensweise auf demokratische Art und Weise in eine attraktive solidarische und nachhaltige Lebensweise umzubauen. Das hat viel mit demokratischer Politik zu tun, aber auch mit Aufklärung im Kant´schen Sinne und mit Bildung, mit einer Demokratisierung der Wirtschaft in dem Sinne, dass eben nicht Profitkalküle, sondern demokratische Entscheidungen darüber mitbestimmen, was wie produziert wird. Bislang werden die Produktions- und Konsumnormen machtvoll von Unternehmen gesetzt, entsprechen aber vielfach auch den historisch entstandenen Bedürfnissen großer Teile der Bevölkerung. Dies kann nicht einfach durch staatliche Politik auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene geändert werden, etwa mit Hilfe neuer Regeln für Unternehmen und KonsumentInnen. Es muss in zunehmendem Masse demokratisch entschieden werden, was wie produziert werden soll. Und wir benötigen darüber hinaus grundlegende kulturelle Umorientierungen (»Was bedeutet Wohlstand?«). Hier setzt die Diskussion um „gutes Leben“ an. Die deutsche IG Metall hat im Jahr 2009 unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben“ eine Kampagne gestartet. In einigen Ländern Lateinamerikas wurden Orientierungen an einem „guten Leben“ aufgrund der negativen bis katastrophalen Konsequenzen neoliberaler Politik für die Bevölkerungsmehrheit gestärkt. Es wurden in heftigen anti-neoliberalen Auseinandersetzungen alternative Orientierungen gegen herrschende Entwicklungs- und Modernevorstellungen durchgesetzt. Der Begriff des guten Lebens, der mit einer deutlichen Kritik an westlichen, industriellen und kapitalistischen Entwicklungsvorstellungen einhergeht, hat es in Ecuador immerhin in die neue Verfassung geschafft. Diese Umorientierung kann, auch wenn es in der Praxis oft ganz anders aussieht, nicht hoch genug geschätzt werden. Die Zurückweisung eindimensionaler Wachstumsvorstellungen zugunsten einer Rekonstruktion des Sozialen, eines guten Lebens als Ziel, einer nicht nur auf das Kulturelle beschränkten Diversität, sondern explizit einer Pluralität von Wirtschaftsfor 8 men, einer praktischen Umwertung des Arbeitsbegriffs, grundlegend andere Naturverhältnisse sowie ganz anderer Vorstellungen von Politik, Recht und Staatlichkeit. Aber schon in Lateinamerika, das möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen, konkurrieren diese Leitbilder und sich verändernden Praktiken mit einem anderen Neoliberalismuskritischen Weg, nämlich einer über starke Staatsinterventionen vorangetriebenen setzenden Neo-Desarrollismus wie er in Argentinien oder Brasilien vorherrscht (Dilma Rousef). Der Raubbau von Ressourcen und die intensive Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft ist die Grundlage eines dynamischen Wachstumsmodells. Wie ich schon an anderen Stellen immer wieder betont habe: Für den Umbau der imperialen Lebensweise hin zu einer solidarischen und nachhaltigen benötigen wir ein starkes Aufbegehren, das sich gegen Konsumismus und Konkurrenzdenken wendet. Damit ist nicht die Moralisierung der Probleme genannt, die ja – wie gegenwärtig – immer wieder von den herrschenden ökonomischen und politischen Institutionen instrumentalisiert werden kann. Notwendig sind Kritik und Lernprozesse, in denen die »Geiz ist geiz«-Kultur und die bisherige Attraktivität der Riesenautos für immer mehr Menschen eine eher unerträgliche, unattraktive und unmoralische Sache wird. Hinter »Geiz ist geil« stehen meist schlechte bis katastrophale Arbeitsbedingungen in anderen Teilen der Welt, steht eine Missachtung ökologischer Standards. Es sind nicht nur die guten Argumente, die etwa die Umweltbewegung, NGOs und kritische Medien ohnehin auf ihrer Seite hat und von allen ja unterschrieben werden. Es ist auch der Kampf um ein anderes, attraktives Lebensgefühl und damit verbunden um eine progressive Lebensweise, die nicht nur von einer grün-alternativen Mittelklasse gelebt werden. Damit sollen Staat und Unternehmen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Natürlich sind staatliche Gesetze und die Förderung von Energiesparmaßnahmen wichtig. Lehrpläne an Schulen müssen sozial-ökologische Themen integrieren. Es geht auch um andere staatliche Politiken und Regeln für Unternehmen und KonsumentInnen. Veränderungen dort müssen aber über öffentliche Diskussionen, soziale Bewegungen und Konsumverhalten abgerungen werden. Umweltpolitik muss daher als demokratische Gesellschaftspolitik verstanden werden. Sie muss Denk- und Handlungsräume öffnen, die das bestehende Produktions- und Lebensmodell, das ja mit Macht und Interessen verbunden ist, grundlegend verändern. Das ist nicht sofort möglich, zumal unter den Bedingungen der gegebenen weltweiten kapitalistischen Standortkonkurrenz. Es sind jedoch vielfältige Einstiegsprojekte denkbar. Ich möchte nur ein Beispiel nennen und wir werden in der anschließenden Diskussion auf weitere kommen. Ein zentraler Ansatzpunkt ist meines Erachtens gerade in der aktuellen Krise und dem Damoklesschwert steigender Arbeitslosigkeit und zunehmender Prekarisierung, dass ein sozialökologischer Umbau mit einer progressiven Arbeitszeitpolitik verknüpft wird. Dabei geht es nicht nur um den Abbau steuerlich begünstigter Überstunden oder um attraktive Modelle von Wochen- und Lebensarbeitszeit. Über das Thema der Arbeitszeitpolitik geraten eben auch ökologische Fragen in den Blick: Jene des Produzierens und Konsumierens um ihrer selbst Willens, der unbedingten Exportorientierung, der Frage, welchen Stellenwert in unserer Gesellschaft Lohnarbeit und Hackln hat und welchen andere Tätigkeiten wie unbezahlte Sorgearbeit für Jüngere und Ältere oder gesellschaftliches Engagement. Ich komme zum Schluss. Was ich heute Abend aus einer politikwissenschaftlichen Sicht verdeutlichen wollte. Mut zu Nachhaltigkeit erfordert eine genaue Kenntnis dessen, was der notwendig weitgehende Gesellschaftsumbau hin zu Nachhaltigkeit verhindert. Es wurden einige, 9 mir wichtig scheinende Aspekte genannt. Im zweiten Teil habe ich einige Gedanken entwickelt, wie eine mutige Politik in Richtung Nachhaltigkeit aussehen könnte. Den Appell der Veranstaltungsreihe wollte ich damit aufnehmen und hoffe, ein paar Anregungen gegeben zu haben. Wir benötigen mehr institutionellen Mut. Institutionen sind komplexe Regelwerke, in denen das Handeln der Menschen enorm kodifiziert ist. Und dennoch bleiben Spielräume bestehen, innerhalb der Institutionen wie auch im Hinblick auf die institutionellen Logiken selbst. In meinem Handlungsfeld Universität und Wissenschaft versuche ich mir das immer wieder zu verdeutlichen; denken sie an staatliche Institutionen, Betriebe, Medien, Schulen. Doch letztendlich hängt institutioneller Mut wie auch jener außerhalb von Institutionen - etwa im Bereich des privaten Alltags oder innerhalb sozialer Bewegungen oder NGOs - eben am kompetenten und im besten Sinne aufgeklärten und gemeinsamen Handeln vieler einzelner. Nun freue ich mich auf den Kommentar von Corinna Milborn und die anschließende Diskussion. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.