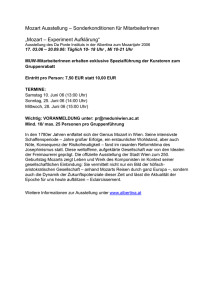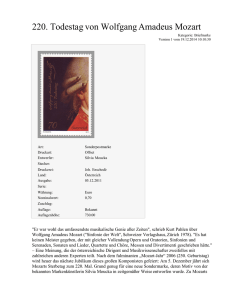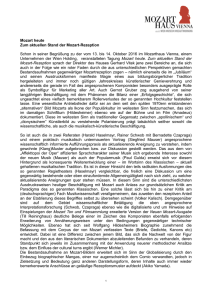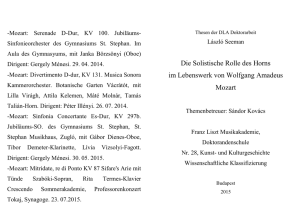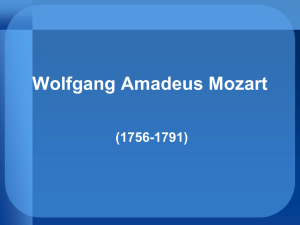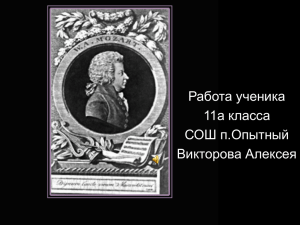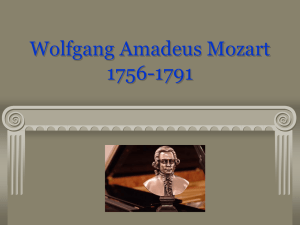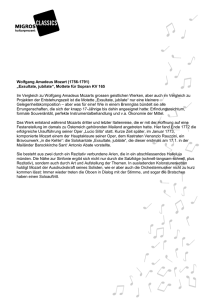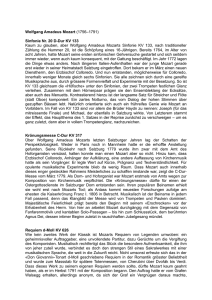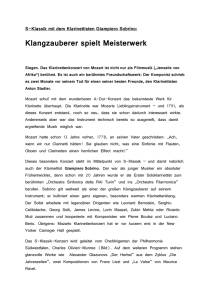mozart matinée
Werbung

STREICHQUINTETT G-MOLL KV 516 I. ALLEGRO II. MENUETTO. ALLEGRETTO-TRIO III. ADAGIO MA NON TROPPO IV. ADAGIO-ALLEGRO Im Mittelpunkt von Mozarts Schaffen für Streichquintett stehen fünf originäre Beiträge zu dieser Gattung. Ihre Entstehung verteilt sich auf drei Zeitabschnitte. Den Anfang macht 1773 das Quintett KV 174, vierzehn Jahre später erst folgen KV 515 und KV 516 und es vergehen weitere drei Jahre, bis 1790/91 die Quintette KV 593 und KV 614 den Beschluss bilden. Der amerikanische Musikwissenschaftler Charles Rosen hat aufschlussreich darauf hingewiesen, dass die Hinwendung zum Quintett immer dann erfolgte, wenn Mozart »eine Serie von Quartetten geschrieben hatte, so als spornten ihn die soeben mit vier Instrumenten gemachten Kompositionserfahrungen dazu an, das reichere Medium aufzugreifen.« Dieses reichere Medium kannte zwei Ausprägungen: die Erweiterung des Streichquartetts um ein zweites Violoncello und die von Mozart bevorzugte Verdopplung der Bratsche. Mozarts Entscheidung für eine zweite Bratsche mag bestimmt gewesen sein von seinem be­ sonderen Verhältnis zu diesem Instrument, nicht minder aber durch die damit gegebenen reicheren Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Mittelstimmen eines Werkes. Das jedenfalls weisen seine Quin­ tette aus. Die erweiterten Möglichkeiten wirken hinein bis in die formalen, strukturellen und klanglich-harmonischen Bereiche des jeweiligen Satzganzen. Das »Streichquintett g-moll KV 516« entstand im Frühjahr 1787 in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zum Schwesterwerk in C-dur. Beide Kompositionen bilden im Quintettschaffen Mozarts einen Höhepunkt persönlichster Ausdrucksgestaltung, die über jeden diver­timentohaften Ansatz weit hinausgeht. Ist dem C-dur-Opus dabei ein eher versöhnlicher Grundton eigen, so zählt das in g-Moll zu den bedrängendsten, tiefsinnigsten, von intensivsten Spannungen durchzogenen Werken Mozarts überhaupt. Man denke hier auch an seine »Sinfonie g-Moll KV 550«. Bemerkenswert übrigens, dass bereits der jugendlich-unbelastete Siebzehnjährige in seiner frühen »Sinfonie g-moll KV 183« über zumindest vergleichbare Ausdrucksund Gestaltungsmöglichkeiten verfügte. So hat denn auch der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer aus seiner langjährigen Beschäftigung mit dem Phänomen Mozart den Schluss gezogen, dem Komponisten sei »eine latent vorhandene Erlebnistiefe menschlicher Empfindungen eigen gewesen«, von der man aber nicht wisse, »aus welchen Quellen auch immer sie sich letztlich gespeist hat«. Natürlich weiß man, dass das »Quintett g-moll« in einer Zeit entstand, als Mozart in großer Sorge um den todkranken Vater war, als er sich zunehmend in einer bedrängenden wirtschaftlichen Lage befand, als Zuspruch und Anerkennung seines Schaffens in der Wiener Gesellschaft auszubleiben begannen. Wie Mozart indes zur Musik dieses Werkes gefunden hat, wissen wir nicht, und jeder Versuch, ihrem Gehalt mit sprachlichen Mitteln auf die Spur zu kommen, ist unangemessen und letztlich zum Scheitern verurteilt. Was wäre zudem mit dem so gänzlich anderen Ausdruck des Schwesterwerkes in C-dur? Was bleibt, ist bis auf den heutigen Tag die zutiefst bewegende Begegnung mit einem der großen Meis­ terwerke Mozarts. VORSCHAU Das nächste Kammerkonzert findet am Sonntag, den 25. Juni 2017 im Funkhaus Wallrafplatz statt und beginnt um 11.00 Uhr. KONTRABASS Bernhard Alt Suite für vier Kontrabässe Erwin Schulhoff Concertino für Flöte, Viola und Kontrabass Giovanni Bottesini Grand Duo concertant für Klarinette, Kontrabass und Klavier Colin Brumby Suite für vier Kontrabässe Karl Kemper Angel Pena Kontrabasstrio Astor Piazzolla »Tango Basso« für vier Kontrabässe Stanislau Anishanka Kontrabass Stefan Rauh Kontrabass Michael Geismann Kontrabass Raimund Adamsky Kontrabass Leonie Brockmann Flöte Mircea Mocanita Viola Nicola Jürgensen Klarinette Zeynep Artun-Kircher Klavier BILDNACHWEIS HERAUSGEBER Titel: Oboe © shutterstock/Alenavlad; Holz © Getty Images/malerapaso Innenteil: Portraits © WDR/­Overmann Westdeutscher Rundfunk Köln Marketing Appellhofplatz 1 50667 Köln Verantwortliche Redaktion Patricia Just Redaktion und Produktion des Konzerts Siegwald Bütow Mai 2017 Änderungen vorbehalten MOZART MATINÉE KAMMERKONZERT SO 21. Mai 2017 11.00 Uhr Funkhaus Wallrafplatz, Köln KAMMERKONZERT mit Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters WOLFGANG AMADEUS MOZART Divertimento Es-dur für Streichtrio KV 563 Pause Oboenquartett F-dur KV 370 Streichquintett g-moll KV 516 Svetlin Doytchinov Oboe Ye Wu Violine Johanne Stadelmann Violine Junichiro Murakami Viola Tomasz Neugebauer Viola Johannes Wohlmacher Violoncello WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791) DIVERTIMENTO ES-DUR FÜR STREICHTRIO KV 563 I. ALLEGRO II. ADAGIO III. MENUETTO. ALLEGRETTO – TRIO IV. ANDANTE V. MENUETTO. ALLEGRETTO – TRIO I/II VI. ALLEGRO Das klassische Streichtrio hat seine wesentliche Wurzel in der ba­ rocken Triosonate mit zwei Violinen und der Generalbasskombina­ tion von Violoncello und Cembalo, aus der das Tasteninstrument schließlich eliminiert wurde. Der Verbund von Violine, Viola und Violoncello geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf Joseph Haydn zurück und begründete eine Gattung, die hinsichtlich der klanglichen Balance eine besondere kompositorische Herausforderung darstellt. Mozart hat sich dieser Herausforderung mit seinem »Divertimento Es-Dur für Streichtrio« als einzigem Beitrag gestellt und zugleich ein Meister­werk geschaffen, das gleichermaßen als ein Höhepunkt der Gattung wie auch der Kammermusik überhaupt gelten darf. Dabei gibt sich der Titel »Divertimento« eher bescheiden, reichen doch Inhalt und Gestaltung deutlich über den Anspruch einer unterhalten­ den Gesellschaftskunst hinaus. Das Werk entstand in unmittelbarer Nachbarschaft zu den großen Sinfonien des Jahres 1788 und teilt mit ihnen die Spannweite tief­ sinnigen wie gelösten Ausdrucks in einer Satzkunst, die von sensibler Homophonie bis zu komplexer Kontrapunktik reicht. Die kaum zu überbietende Nutzung der Ausdrucksmöglichkeiten jeden Instru­ ments und ihre Zusammenführung zu einem überreichen Klangspek­ trum machen die Charakterisierung des Werkes als »konzertierendes Trio« durchaus verständlich. An ein ursprüngliches Divertimento mit einer meist ungebundenen Satzfolge erinnert die sechsteilige, nun deutlich geplante Anlage des Werkes. Das klassische Grundmuster: Sonatensatz – langsamer Liedsatz – Menuett – Rondofinale wird erweitert, indem der Menuett-Komplex sich zu einer Dreiteiligkeit auswächst: Menuett I mit einem Trio findet seine gesteigerte Ent­ sprechung in Menuett II mit zwei Trios, in ihrer Mitte das Andante als Variationen-Satz. Komponiert wurde das anspruchsvolle Opus für Aufführungen im Hause des Logenbruders und Freundes Michael Puchberg, der Mozart in den späten 1780-er Jahren bei großer finanzieller Bedräng­ nis gelegentlich auch als Geldgeber beisprang. Überhaupt war es vornehmlich ein privater oder begrenzter höfischer Rahmen, in dem eine Kammermusik von solchem Rang und Anspruch auf eine entsprechend vorgebildete Hörerschaft treffen konnte. An Auffüh­ rungen seines »Divertimentos« war Mozart selbst nachweislich mehrfach als Bratschist beteiligt. So schreibt er von einer Reise nach Dresden ganz bescheiden an seine Frau, dass das Trio, das er für Puchberg geschrieben habe, hier auf überraschende Einladung des Kurfürsten mit einem ortsansässigen Geiger, einem zufällig zu Gast weilenden Cellisten und ihm an der Bratsche »so ganz hörbar exe­ cutiert« worden sei. OBOENQUARTETT F-DUR KV 370 I. ALLEGRO II. ADAGIO III. RONDEAU. ALLEGRO Mozarts Oboenquartett verdankt seine Entstehung der Begegnung und Freundschaft des Komponisten mit Friedrich Ramm, dem her­ ausragenden Oboisten. Er hatte ihn 1777/78 dort während eines mehrmonatigen Aufenthaltes kennengelernt und war von seinem Spiel so angetan, dass er ihm spontan die Abschrift seines »Konzer­ tes für Oboe und Orchester« zum Geschenk machte, obwohl es eigentlich schon einem italie­nischen Künstler zugedacht war. In kur­ zer Folge erlebte das Werk gleich fünf Aufführungen, und Mozart be­ richtet an seinen Vater, dass es »hier einen großen Lärm macht« und »izt des H:Ramm sein Cheval Bataille« sei. Eine Wiederbegegnung mit Ramm, der inzwischen mit dem Höfischen Orchester nach Mün­ chen übergesiedelt war, gab es 1780 anläßlich der Einstudierung und Uraufführung von Mozarts Oper »Idomeneo« im dortigen Residenz­ theater. Der umfängliche und anspruchsvolle Oboenpart dieser Oper dürfte ohne Zweifel mitinspiriert worden sein von Mozarts Wissen um Ramms hohe Bläser-Qualitäten. Man darf somit durchaus vermu­ ten, dass Mozarts einziges Oboenquartett, das unmittelbar nach der Uraufführung der Oper im Januar 1781 entstand, auch als ein Dank an diesen hervor­ragenden Interpreten zu verstehen ist. Das dreisätzige Werk führt Oboe, Violine, Viola und Violoncello zu einem eben 15-minütigen musikalischen Geschehen zusammen, das von feinstem Divertimento­geist getragen ist. Dabei schlagen die bewegten Eck­ sätze den Ton eines eher heiteren sogenannten »singenden Allegros« an, der immer wieder aber auch in eine hochvirtuose, übermütige Spielfreude mündet. Das nur 37 Takte umfassende »Adagio« in der Werkmitte setzt dazu eindrucksstark einen wesentlichen Akzent melancholischer Nachdenklichkeit. Dass sich bei all der Spielweise der Klang der Oboe in großer Homogenität mit dem Streichersatz verbindet, steht außer Frage.