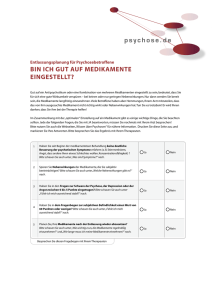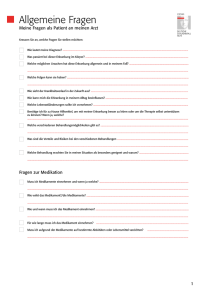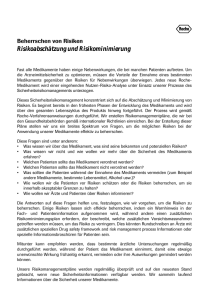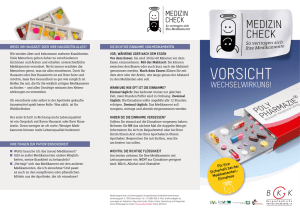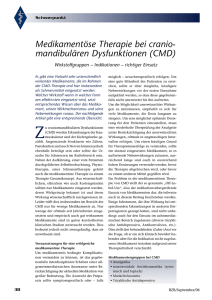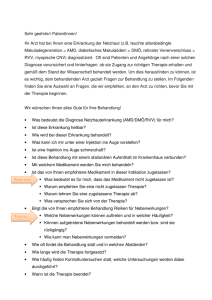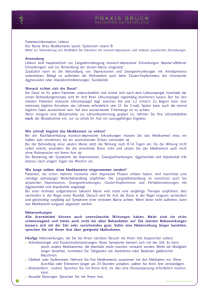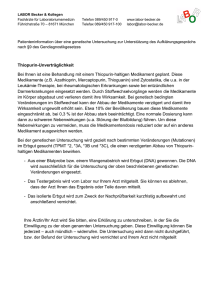psychenet • Falkenried 88 • D-20251 Hamburg
Werbung
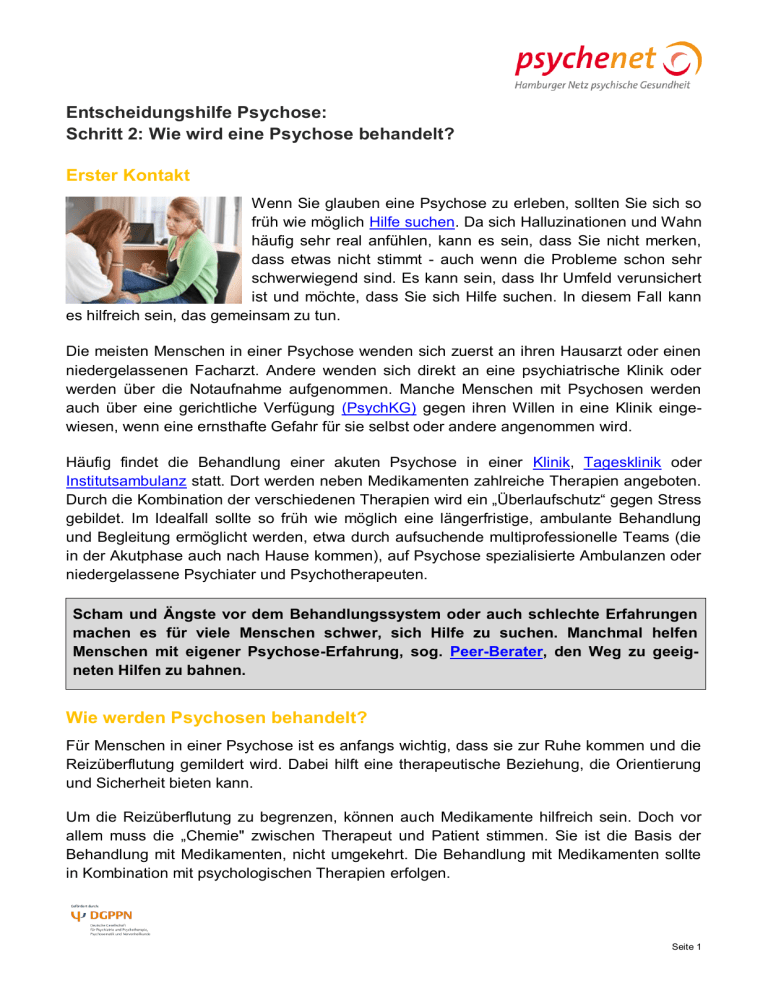
Entscheidungshilfe Psychose: Schritt 2: Wie wird eine Psychose behandelt? Erster Kontakt Wenn Sie glauben eine Psychose zu erleben, sollten Sie sich so früh wie möglich Hilfe suchen. Da sich Halluzinationen und Wahn häufig sehr real anfühlen, kann es sein, dass Sie nicht merken, dass etwas nicht stimmt - auch wenn die Probleme schon sehr schwerwiegend sind. Es kann sein, dass Ihr Umfeld verunsichert ist und möchte, dass Sie sich Hilfe suchen. In diesem Fall kann es hilfreich sein, das gemeinsam zu tun. Die meisten Menschen in einer Psychose wenden sich zuerst an ihren Hausarzt oder einen niedergelassenen Facharzt. Andere wenden sich direkt an eine psychiatrische Klinik oder werden über die Notaufnahme aufgenommen. Manche Menschen mit Psychosen werden auch über eine gerichtliche Verfügung (PsychKG) gegen ihren Willen in eine Klinik eingewiesen, wenn eine ernsthafte Gefahr für sie selbst oder andere angenommen wird. Häufig findet die Behandlung einer akuten Psychose in einer Klinik, Tagesklinik oder Institutsambulanz statt. Dort werden neben Medikamenten zahlreiche Therapien angeboten. Durch die Kombination der verschiedenen Therapien wird ein „Überlaufschutz“ gegen Stress gebildet. Im Idealfall sollte so früh wie möglich eine längerfristige, ambulante Behandlung und Begleitung ermöglicht werden, etwa durch aufsuchende multiprofessionelle Teams (die in der Akutphase auch nach Hause kommen), auf Psychose spezialisierte Ambulanzen oder niedergelassene Psychiater und Psychotherapeuten. Scham und Ängste vor dem Behandlungssystem oder auch schlechte Erfahrungen machen es für viele Menschen schwer, sich Hilfe zu suchen. Manchmal helfen Menschen mit eigener Psychose-Erfahrung, sog. Peer-Berater, den Weg zu geeigneten Hilfen zu bahnen. Wie werden Psychosen behandelt? Für Menschen in einer Psychose ist es anfangs wichtig, dass sie zur Ruhe kommen und die Reizüberflutung gemildert wird. Dabei hilft eine therapeutische Beziehung, die Orientierung und Sicherheit bieten kann. Um die Reizüberflutung zu begrenzen, können auch Medikamente hilfreich sein. Doch vor allem muss die „Chemie" zwischen Therapeut und Patient stimmen. Sie ist die Basis der Behandlung mit Medikamenten, nicht umgekehrt. Die Behandlung mit Medikamenten sollte in Kombination mit psychologischen Therapien erfolgen. Seite 1 Stabilität im Alltag und das Beachten erster Frühwarnzeichen spielen bei der Genesung von Menschen mit Psychosen eine besonders große Rolle. Der Austausch mit Gleichgesinnten in Selbsthilfegruppen und eine Begleitung durch geschulte Peer-Berater (Menschen mit der Erfahrung eigener seelischer Krisen) können eine wichtige Unterstützung sein. Auch gibt es zahlreiche gemeindepsychiatrische Dienste und Einrichtungen (z.B. betreutes Wohnen, Eingliederungshilfen, Kontaktstellen), die Menschen mit Psychosen bei der Bewältigung und Stabilisierung Ihres Alltags unterstützen. Bevor eine Behandlung begonnen wird, muss abgeklärt werden, ob eine andere körperliche oder psychische Erkrankung für die Beschwerden verantwortlich ist (z.B. Krebs oder eine Demenz). Psychologische Therapien In der Regel soll die Behandlung von Menschen mit Psychosen mit psychologischen Therapien in Kombination mit einem antipsychotischen Medikament erfolgen. Sie brauchen über eine längere Zeit einen festen Psychotherapeuten und/oder Psychiater. Welche Therapien für Sie die richtigen sind, sollten Sie immer mit Ihrem Arzt, Ihrem Psychotherapeuten oder Ihrem Behandlungsteam besprechen. Alle Therapien sollten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt werden. Erlauben Sie sich, verschiedene Therapien auszuprobieren. Nicht jede Therapie ist für jeden die Richtige. Führen Sie die fort, die Ihnen hilft und gut tut. Diese Therapien sollen allen Menschen in einer Psychose - im Idealfall bereits in der Akutbehandlung - angeboten und zur Stabilisierung und Erhaltung ambulant weitergeführt werden: Kognitive Verhaltenstherapie Eine kognitive Verhaltenstherapie bei Psychosen kann aus folgenden Teilen bestehen: Seite 2 Aufklärung über die Erkrankung und Medikamente (Psychoedukation), Sicherstellen der regelmäßigen Einnahme Ein Erklärungsmodell entwickeln (den Sinn der Psychose erkennen) Erkennen von Frühwarnsymptomen und Rückfallvorbeugung Erarbeiten eines Krisenplans (Was, wenn es wieder zu einer akuten Psychose kommt?) Umgang mit Vorurteilen Umgang mit Stress Verbesserung des Gesundheitsverhaltens (Ernährung und körperliche Aktivität) Aufbau von Aktivitäten zur Verbesserung der Negativsymptomatik Umgang mit kognitiven Einschränkungen Verbesserung der Realitätsorientierung z.B. durch Hinterfragen von Gedanken Organisation des Alltags, z.B. Alltagsstruktur, Aufbau von sozialen Kontakten, berufliche Wiedereingliederung Verbesserung des Selbstwerts Familientherapie Die Familientherapie wird allen Menschen empfohlen, die in engem Kontakt mit ihrer Familie stehen bzw. sogar mit ihrer Familie zusammenleben. Man hat herausgefunden, dass ein negatives Familienklima (z.B. viel Kritik) die Rückfallgefahr bei Psychosen erhöht. Daher ist es wichtig, Konflikte in der Familie zu reduzieren, z.B. indem der Familien Informationen über die Erkrankung und die damit zusammenhängenden Verhaltensweisen gegeben werden. Der Familientherapeut kann bei auftretenden Problemen beraten und zwischen den Familienmitgliedern vermitteln, wenn es zu Krisen kommt. Suchtbehandlung (bei Substanzmissbrauch oder- abhängigkeit) Viele Menschen mit Psychose konsumieren Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin und Betäubungsmittel (Cannabis, Kokain, Heroin) oder betreiben Medikamentenmissbrauch. In diesem Fall ist eine Suchttherapie entsprechend gültiger Leitlinien sehr wichtig, da eine Heilung ohne Abstinenz nur schwer oder gar nicht möglich ist. Suchttherapien werden zusammen mit anderen Therapien (z.B. bei einer Psychotherapie) angeboten und beinhalten verschiedene Behandlungsschritte wie Entgiftung, ggf. Substitution, positive Anreize und psychologische Betreuung. Sie sollen vor allem die Motivation zur Abstinenz stärken. Diese Therapien sollten nach Berücksichtigung der Bedürfnisse des Einzelnen angeboten werden: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP) Bei dieser Behandlungsform liegt der Schwerpunkt darauf, die aktuellen Belastungen vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte erst einmal zu verstehen, aber auch zu verändern Seite 3 und zu bearbeiten. Bei Psychose kann diese Therapieform auch dabei helfen, psychische Beschwerden wie Angst und Depressionen aber auch aktuelle Lebensthemen wie Stress und Beziehungsprobleme besser zu bewältigen. Psychoedukation Bei der Psychoedukation werden Patienten und auf Wunsch ihren Angehörigen Informationen zur Erkrankung (Symptome, Ursachen, Verlauf, Behandlung) vermittelt. Gerade bei Psychose, deren Symptome oft verwirrend sind, kann es helfen, mehr darüber zu erfahren. Durch Psychoedukation sollen Betroffene und Angehörige emotional entlastet werden und die Zusammenarbeit zwischen Patient und Behandler sowie die Hilfe zur Selbsthilfe (z.B. Krisen und Rückfälle rechtzeitig erkennen, Beteiligung an der Entscheidungsfindung, Ernährungsberatung) gefördert werden. Arbeitstherapie, Berufliche Rehabilitation/Wiedereingliederung Durch berufliche Rehabilitation soll die Arbeits- und Beschäftigungssituation verbessert werden. Für jeden Menschen mit Psychosen kann eine andere Form der beruflichen Rehabilitation sinnvoll sein. Die Ziele reichen von „keine Arbeit“, über „Beschäftigungstherapie“, „Arbeit in geschütztem Rahmen“ (zweiter Arbeitsmarkt) bis hin zu „Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt“ (erster Arbeitsmarkt). Die Arbeitstherapie als erste Stufe der beruflichen Wiedereingliederung kann zwei Ziele haben: den direkten Eintritt oder die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt oder die Aufnahme einer Beschäftigung im Bereich des intensiver betreuten „zweiten Arbeitsmarktes (berufsgleiche oder -ähnliche Tätigkeiten, für die kein oder ein geringeres Gehalt bezahlt wird)“. Wenn Menschen in eine reguläre Beschäftigung eintreten oder zurückkehren möchten, sollte eine schnelle Aufnahme der Tätigkeit mit unterstützender Begleitung (sog. „Supported Employment“) angestrebt werden. Ergotherapie In der Ergotherapie geht es darum, Alltagsfähigkeiten (z.B. Haushaltsführung, Arbeitsfähigkeit, Freizeitgestaltung), die oft durch die Erkrankung beeinträchtigt sind, wieder zu verbessern und dadurch z.B. auch die Unabhängigkeit und den Wiedereinstieg in den Beruf vorzubereiten. Es geht auch darum, dem Grundbedürfnis des Menschen nach Handlung und Betätigung gerecht zu werden. Künstlerische Therapien Künstlerische Therapien haben das Ziel, die Wahrnehmungs- und Regulationsfähigkeit der Patienten zu verbessern und damit die seelische und körperliche Gesundheit zu fördern. Kunsttherapie Kunsttherapie ist ressourcen-, beziehungs-, handlungs- und erlebnisorientiert. Es können dafür verschiedene künstlerische Materialien eingesetzt werden, durch die der Ausdruck von „inneren Bildern“, Gefühlen, Vorstellungen und Erfahrungen möglich gemacht wird. Seite 4 Tanz- und Musiktherapie Hier soll durch den Einsatz von Musik und Bewegung der Kontakt zu sich selbst oder zu anderen Menschen gefördert und so „erfahrbar gemacht“ werden. Theater- und Dramatherapie Das Theaterspielen ermöglicht die spielerische Entdeckung neuer Handlungsmöglichkeiten und die Auseinandersetzung mit sich und einer Gemeinschaft. Dabei sollen insbesondere die „gesunden Anteile“ der Persönlichkeit gestärkt werden. Sport- und Bewegungstherapie Bewegungstherapien verbessern durch den Einsatz körper- und bewegungsbezogener Übungen bei vielen psychischen Erkrankungen die Vorbeugung und Heilung. Der Schwerpunkt kann dabei stärker auf die körperliche Gesundheit (Sporttherapie) oder auf die psychische Gesundheit (Bewegungs- und Körperpsychotherapie) ausgerichtet sein. Sporttherapie Durch verschiedene Aspekte des Sports soll der Patient wieder aktiv in Bewegung kommen. Bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wird dabei ein Fokus auf den Ausdauersport (z.B. Walking, Schwimmen, Fahrrad fahren) gesetzt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit von Kraft-/Muskeltraining und Sportspielen (Badminton, Fußball etc.). Bewegungs- und Körperpsychotherapie Grundlage der Körperpsychotherapie ist die Annahme, dass Körper und Psyche eine untrennbare Einheit darstellen. Durch gezielte Bewegungsübungen können so Probleme sichtbar gemacht und in der Handlung erlebbar und bearbeitbar werden. Ein Fokus liegt auf solchen Krankheitsbildern, die z.B. eine Verzerrung des Körperbildes oder körperbezogene psychische Erkrankungen haben, etwa körperliche Illusionen, Halluzinationen, Depersonalisierungserleben. Soziales Kompetenztraining (SKT) Viele Psychoseerfahrene leiden unter sozialen Ängsten, sind z.B. unsicher, wie ihr Verhalten wirkt oder haben andere Einschränkungen in Alltagstätigkeiten oder im Kontakt mit anderen Menschen. Soziale Kompetenztrainings unterstützen den Ausbau von sozialen Fertigkeiten, um selbstbestimmt ein weitgehend unabhängiges Leben gestalten zu können. Meistens in Gruppen werden z.B. schwierige Gespräche mit dem Arbeitgeber oder mit Familienmitgliedern im Rollenspiel geübt. Es soll sowohl die Fähigkeit, zu anderen Menschen Kontakt herzustellen und mit ihnen gut zu kommunizieren, als auch die Fähigkeit, sein eigenes Recht einzufordern, trainiert werden. Diese Therapien können ergänzend angeboten werden: Psychoedukation (im Rahmen von Trialogforen und Psychoseseminaren) Selbsthilfeprogramme Seite 5 Behandlung mit Medikamenten Sich für oder gegen die Einnahme von antipsychotischen Medikamenten zu entscheiden, kann sehr schwierig sein. Es kann auch sein, dass Sie Ihre Entscheidung immer wieder überdenken. Antipsychotische Medikamente haben manchen Menschen in Psychosen bei Ihrer Genesung geholfen. Gleichzeitig haben bei manchen Menschen diese Medikamente auf dem Weg zur Genesung auch zu Schwierigkeiten geführt. Welches Medikament bei Ihnen wirkt oder welche Nebenwirkungen Sie haben werden, kann niemand vorhersagen. Gemeinsam mit Ihrem Arzt oder Psychotherapeuten können Sie überlegen, ob die Chancen der Einnahme von antipsychotischen Medikamenten größer sind als die Nachteile! Grundsätzlich soll eine Behandlung mit antipsychotischen Medikamenten nur durch einen Psychiater selbst oder unter dessen Einbeziehung erfolgen. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt gemeinsam herausfinden, welches Antipsychotikum für Sie das richtige ist. Eine Entscheidung sollte auf Basis Ihrer Bedürfnisse und Vorstellungen und der Einschätzung des Arztes zu bestimmten Risikofaktoren oder Vorerkrankungen getroffen werden. Meist gilt: nur ein Medikament gleichzeitig - und das so niedrig dosiert wie möglich. Häufige Fragen zu Medikamenten Wenn Sie nicht alles nachvollziehen können, was Ihnen Ihr Arzt zu Ihrer Behandlung gesagt hat, stellen Sie weiter Fragen bis Sie alles verstanden haben! Hier finden Sie häufige Fragen zur Behandlung mit antipsychotischen Medikamenten: Was sind antipsychotische Medikamente? Antipsychotische Medikamente sind eine Gruppe von unterschiedlichen Medikamenten, die helfen können, dass Anzeichen und Symptome von Psychosen oder anderen schweren psychischen Erkrankungen gemildert werden oder sogar vollständig zurückgehen. Manchmal werden sie auch Neuroleptika genannt. Vereinfacht dargestellt gleichen antipsychotische Medikamente einen Überfluss des Botenstoffs Dopamin (ein sogenannter Neurotransmitter) im Gehirn aus. Dopamin ist bei der Steuerung von Bewegungen beteiligt und beeinflusst die Wahrnehmung und Gefühle. Antipsychotische Medikamente können in unterschiedlicher Form verabreicht werden, z.B. als Tabletten, Flüssigkeiten, Schmelztabletten oder als Injektionslösung in Form einer Seite 6 Spritze. Manche antipsychotischen Medikamente wirken schnell, bei anderen kann es bis zu sechs Monate dauern, bis die volle Wirkung eintritt. Was sind die Vorteile von antipsychotischen Medikamenten? Symptombelastung mildern Antipsychotische Medikamente können Ihnen helfen, sich weniger ängstlich zu fühlen, besser zu schlafen, klarer zu denken und sich unter Menschen wohler zu fühlen. Genesung fördern Mit Ihren Symptomen besser klar zu kommen, kann Ihnen dabei helfen, Ihren Alltag zu bewältigen und die Dinge zu behalten, die für Sie wichtig sein können, wie Ihr Zuhause, Ihre Arbeit, oder Ihre Familie und Freunde. Rückfall verhindern Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Psychosen, die regelmäßig antipsychotische Medikamente einnehmen, seltener in eine psychische Krise geraten oder stationär in einer Klinik aufgenommen werden müssen. Hilft ein Antipsychotikum besser als das andere? Studien zeigen, dass alle antipsychotischen Medikamente auf die Symptome einer Psychose vergleichbar gut wirken. Lediglich bei bei einem Medikament (Clozapin) konnte gezeigt werden, dass es besser als andere antipsychotische Medikamente wirkt. Aber Clozapin birgt auch ein hohes Risiko für schwere Nebenwirkungen. Deswegen wird es nur für die Behandlung bei Therapieresistenz empfohlen, d.h. wenn mindestens zwei andere antipsychotische Medikamente keine Wirkung zeigten oder nicht vertragen wurden. Die verschiedenen antipsychotischen Medikamente unterscheiden sich aber teilweise deutlich in den Nebenwirkungen. Manche haben eher motorische Nebenwirkungen (z.B. Steifheit, Zuckungen, Bewegungsunruhe), während bei anderen eher Nebenwirkungen im Stoffwechsel (z.B. Bluthochdruck, Diabetes, Gewichtszunahme) auftreten. Bei der Wahl des Medikaments sollen die Erfahrungen des Patienten mit der Wirkung und den Nebenwirkungen bei früheren und aktuellen Medikamenten berücksichtigt werden. Was sind die Nachteile von antipsychotischen Medikamenten? Das Medikament, das bei Ihnen wirkt, könnte auch unangenehme oder unerwünschte Nebenwirkungen haben. Nebenwirkungen: Können leicht bis schwer sein; Können schnell verschwinden oder lange Zeit anhalten; Manche können schwere gesundheitliche Folgen haben; Seite 7 Es kann sein, dass mehrere antipsychotische Medikamente ausprobiert werden müssen, um eines zu finden, dass Ihnen hilft und mit dessen Nebenwirkungen Sie leben können. Was noch schwierig sein könnte: Die Einnahme nicht zu vergessen; Regelmäßige Termine beim verschreibenden Arzt wahrzunehmen; Es sind zusätzliche Kontrolluntersuchungen und Tests (z.B. Blutuntersuchungen) nötig. Welches Medikament verschrieben wird, hängt von den Besonderheiten des individuellen Menschen ab. Welches Sie am besten vertragen, muss ausprobiert werden. Dabei wird auch berücksichtigt, welche Veranlagungen und Vorerkrankungen Sie haben: sind Sie z.B. gefährdet für Gewichtszunahme oder Herz-Kreislauferkrankungen, so wird ein Medikament gewählt, das darauf möglichst wenig Einfluss hat. Faktoren wie das Alter, der Gesundheitszustand und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können das Auftreten und das Ausmaß der Nebenwirkungen von antipsychotischen Medikamenten beeinflussen. Es ist wichtig mit dem Arzt über die persönliche Situation und alle erlebten Nebenwirkungen – vor allem die möglicherweise lebensbedrohlichen – zu sprechen. Ihr Arzt kann Ihnen nicht ansehen, ob und unter welchen Nebenwirkungen Sie leiden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die therapeutischen Möglichkeiten und was Sie selbst tun können, um mit einer eventuell auftretenden Nebenwirkung zurechtzukommen. Unter folgendem Link finden Sie eine Informationsbroschüre zum Download mit einer Liste möglicher Nebenwirkungen und Informationen darüber, wie häufig diese auftreten und ob sie belastend oder möglicherweise sogar lebensbedrohlich sein können! Was sind Depotpräparate und welche Vor- und Nachteile haben sie? Depotpräparate geben ihren Wirkstoff über einen längeren Zeitraum ab und müssen daher nicht jeden Tag als Tablette eingenommen werden. Sie werden alle 2 bis 4 Wochen als Spritze gegeben und sind für Menschen geeignet, die aufgrund ihrer Probleme nicht in der Lage sind, ein Medikament täglich einzunehmen oder die dies aus anderen praktischen Gründen bevorzugen. Depotpräparate sind für die Erstbehandlung nicht geeignet. Welche körperlichen Untersuchungen müssen gemacht werden? Bei allen antipsychotischen Medikamenten sollen vor Beginn der Behandlung und im weiteren Verlauf jährlich diese körperlichen Untersuchungen gemacht werden: Körpergewicht Hüftumfang Seite 8 Puls Blutdruck Blutbild (u.a. der Blutzucker, Blutfettwerte, Hämoglobin, Prolaktin) Erfassung von Bewegungsstörungen Erfassung von Ernährungsituation, Diäten, körperlicher Fitness Die folgende Untersuchung soll ergänzend bei allen Patienten während des stationären Aufenthalts, ambulant bei Risikopatienten und insbesondere dann durchgeführt werden, wenn Ihr Arzt dies für erforderlich hält: Elektrokardiogramm (EKG) Diese Angaben sind nur Richtwerte! Welche Untersuchungen, wann genau erfolgen und wie häufig diese wiederholt werden müssen, wird Ihr Arzt mit Ihnen besprechen! Nebenwirkungen im Vergleich Die Entscheidung, welches Medikament Sie nehmen, sollte auf Basis Ihrer Bedürfnisse und Vorstellungen und der Einschätzung des Arztes zu bestimmten Risikofaktoren oder Vorerkrankungen getroffen werden. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt besprechen, mit welchen Nebenwirkungen Sie leben können und was für Sie nicht erträglich wäre. So kann Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen ein Medikament wählen, das am besten zu Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorstellungen passt. In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick, wie bestimmte Antipsychotika bezogen auf fünf häufige Nebenwirkungen bei der Behandlung von Menschen mit einer Psychose abschneiden. Was die Zahlen bedeuten Die Zahlen in der Tabelle geben jeweils die Rangfolge eines Medikaments bezogen auf eine bestimmte Nebenwirkung an. Eine höhere Zahl bedeutet, dass das Medikament tendenziell schlechter abschneidet als ein Medikament, das eine niedrigere Zahl hat. In der Tabelle sind nicht alle Medikamente enthalten, die in Deutschland für die Behandlung von Psychosen zugelassen sind. Es wurden Medikamente ausgewählt, für die verlässliche und vergleichbare Forschungsdaten vorliegen. Was die Zahlen nicht bedeuten: Die Zahlen sagen nichts darüber aus, wie viele Menschen unter der Einnahme eines bestimmten Medikaments diese Nebenwirkung entwickeln. Die Angaben beziehen sich nicht auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, auf die Behandlung von Patienten mit vorrangig negativen Symptomen oder die Behandlung von stabilen oder therapieresistenten Patienten. Seite 9 Wirkstoffname Handelsname (alphabetisch) z.B. Bewegungsstörungen Gewichts- Herzrhythmus- Prolaktinzunahme störungen erhöhung Schläfrigkeit Amisulprid Solian® 6 4 8 k.A. 1 Aripiprazol Abilify® 5 3 1 1 4 Haloperidol Haldol® 10 1 3 6 6 Olanzapin Zyprexa® 3 10 5 3 7 Paliperidon Xeplion® 8 5 2 8 2 Quetiapin Seroquel® 4 7 4 2 8 Risperidon Risperdal® 9 6 6 7 5 Sertindol Serdolect® 2 8 9 5 3 Ziprasidon Zeldox® 7 2 7 4 9 Clozapin (*) Leponex® 1 9 k.A. k.A. 10 Quelle: Leucht et al. 2013 Legende: k.A. Es sind keine verlässlichen Daten verfügbar; (*) Clozapin wird nur für die Behandlung bei Therapieresistenz empfohlen (d.h. wenn mindestens zwei andere antipsychotische Medikamente keine Wirkung zeigten oder nicht vertragen wurden). Medikamenteneinnahme Wie lange muss ich die Medikamente nehmen? Wie lange ein antipsychotisches Medikament eingenommen werden muss, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Im Laufe der Zeit versuchen viele Menschen, die Dosis zu reduzieren oder das Medikament vollständig abzusetzen. Manche fühlen sich dann besser und haben keine psychotischen Symptome mehr. Ein großer Teil der Patienten, die Ihr Medikament innerhalb der ersten 2 Jahre absetzen, erleidet jedoch einen Rückfall. Für Ärzte ist es sehr schwierig vorherzusagen, ob ein bestimmter Patient einen Rückfall erleidet. Wenn Ihre Symptome zurückgegangen sind und dieser Zustand über 1 bis 2 Jahre stabil ist, können die Medikamente möglicherweise unter ärztlicher Begleitung langsam herunterdosiert werden. Evtl. wird auch eine niedrige Dosis („Erhaltungsdosis“) weiter eingenommen. Die Entscheidung, ein Antipsychotikum abzusetzen, sollten Sie immer gemeinsam mit Ihrem Arzt treffen. Sie hängt von vielen Faktoren ab, z.B. von Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen, wie hilfreich die Medikamente bei Ihnen sind oder wie die Medikamente Ihre allgemeine Gesundheit beeinflussen. Wenn die Nebenwirkungen Sie sehr belasten, sollte zuerst ein anderes Medikament ausprobiert werden! Die aktuellste Behandlungsleitlinie vom National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Großbritannien empfiehlt, dass Sie: Ihr Medikament regelmäßig einnehmen. Seite 10 gemeinsam mit Ihrem Arzt 1x im Jahr Ihre Medikation überprüfen (Wirkung und Nebenwirkungen). Ihr Medikament nicht zu plötzlich oder zu früh absetzen, da Sie sonst eine hohe Rückfallgefahr haben. Ihr Medikament nach einer Besserung in der gleichen Dosis für weitere 1 bis 2 Jahre einnehmen. nach Absetzen Ihres Medikaments über 2 Jahre regelmäßig zu Ihrem Arzt gehen. Hilft es langfristig, wenn ich das Medikament weiternehme, auch wenn es mir besser geht? Um zu überprüfen, wie hilfreich der Wirkstoff in einem Medikament ist, werden Studien durchgeführt, in denen Patienten entweder ein richtiges Medikament oder ein Placebo (Scheinmedikament, d.h. Tablette ohne Wirkstoff) bekommen. Wie viele Patienten erleiden einen Rückfall? In 24 internationalen Studien* wurden über 2600 Patienten mit Schizophrenie 7 bis 12 Monate nach einer Besserung der Symptome untersucht. Verglichen wurden Patienten, die weiterhin ein antipsychotisches Medikament einnahmen, mit Patienten, die ein Placebo erhielten. Während 67% der Patienten mit Placebo in dieser Zeit einen Rückfall erlitten, erkrankten lediglich 27% der Patienten unter antipsychotischer Behandlung erneut. *Quelle: Leucht et al. 2012 Placebo Medikament 67 von 100 27 von 100 Wie viele Patienten müssen wieder stationär aufgenommen werden? In 16 internationalen Studien* wurden über 2000 Patienten mit Schizophrenie 1 bis 24 Monate nach einer Besserung der Symptome untersucht. Verglichen wurden Patienten, die weiterhin ein antipsychotisches Medikament einnahmen, mit Patienten, die ein Placebo erhielten. Seite 11 Während 25% der Patienten mit Placebo in dieser Zeit stationär aufgenommen wurden, mussten lediglich 10% der Patienten unter antipsychotischer Behandlung erneut in die Klinik. *Quelle: Leucht et al. 2012 Placebo Medikament 25 von 100 10 von 100 Quelle: http://entscheidungshilfen.psychenet.de/index.php?id=894 Seite 12