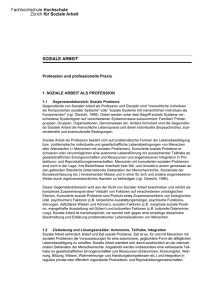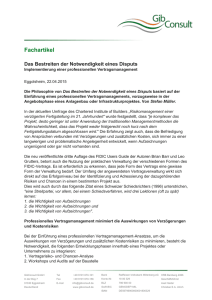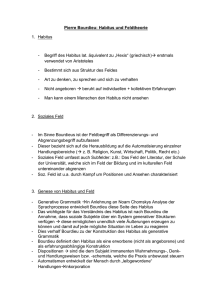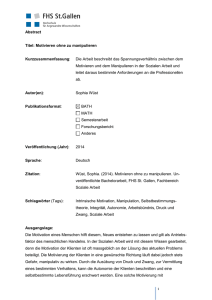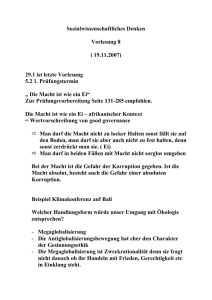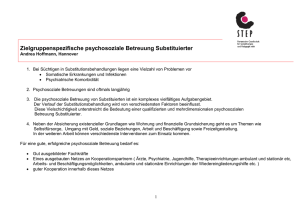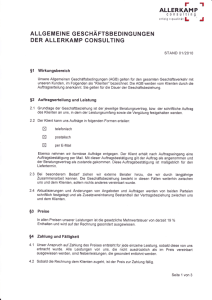Tagungsbericht: ‚Habitussensibilität – (Selbst
Werbung

Tagungsbericht: ‚Habitussensibilität – (Selbst-)Anspruch neuer professioneller Praxis und gesellschaftliche Erwartungshaltungen‘ Sektion Professionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) 7. Juni 2013, HsH Ricklinger Stadtweg, Hannover In seiner Begrüßungsrede formulierte Tobias Sander, Veranstalter der Tagung, die mit dem Thema ‚Habitussensibilität‘ verknüpften Fragestellungen im professionssoziologischen Kontext. Dabei gehe es vor allem darum, in welchem Maße Professionelle vor dem Hintergrund einer gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungshaltung auf ihre Klienten eingehen können und wie es in der Praxis gelingen soll, die ganze Person bis hin zum Habitus in den Blick zu nehmen. Des Weiteren solle geklärt werden, ob es sich lediglich um eine Zusatzqualifikation handelt oder ob Habitussensibilität in bestimmten Bereichen sogar als eine Kernkompetenz aufgefasst werden könne. Demnach war es Ziel der Tagung, anhand von Beiträgen aus unterschiedlichen professionellen Bereichen (Studierendenberatung, Palliativmedizin, Polizeiarbeit, Soziale Arbeit, Schule, Lehrpersonen 1), die Chancen und Schwierigkeiten habitussensibler professioneller Praxis auszuloten. Zunächst stellte Jan Weckwerth (Berlin) einen konzeptionellen Rahmen vor, der das potenziell sozial sensible Handeln von Professionellen in der Interaktion mit ihren Klienten umfasst. Die Forderungen nach sozial sensiblem Handeln kämen vor allem aus dem Feld der Sozialen Arbeit. Die in diesem Zusammenhang verwendeten theoretischen Konzepte, wie etwa das der ‚Sozialen Lage‘, seien jedoch defizitär, da eine Reihe sozialer Differenzen nur unzureichend abgebildet werden. Einen exponierteren Beitrag für die Beschreibung sozial sensibler Interaktionen würden die Arbeiten Pierre Bourdieus liefern, mit dessen Habitus-Begriff sich dieses diffuse Forschungsfeld im Hinblick auf die individuellen Handlungsdispositionen wesentlich schärfer konturieren lässt. Dadurch würden sich für das professionelle Handeln diverse Konsequenzen ergeben, wie etwa die Einsicht, dass die Alltagskulturen des Professionellen wie auch des Gegenübers „jeden Bereich der Interaktion strukturieren“. Beim Professionellen sei daher von großer Wichtigkeit, die eigenen Bewertungs- und Handlungsschemata zu reflektieren. Zusätzlich müsse ein „Einfühlen in die Lebenswelt des Klienten“ erfolgen, um eine adäquate Anpassung der eigenen Praxis leisten zu können. Weiterhin habe der Professionelle zu hinterfragen, welchen Einfluss der Habitus des Klienten auf das eigentliche, professionell zu bearbeitende Problem haben könnte. Gerade für die Professionen im erweiterten Kontext der Sozialen Arbeit seien diese Anforderungen zentral, so dass sich abschließend die Frage stelle, ob der Habitussensibilität hier sogar der Rang einer 1 Die beiden im Tagungsprogramm aufgeführten Vorträge zum Hochschulbereich von Miriam Redlich und Kathrin Rheinländer mussten aus organisatorischen Gründen leider entfallen. Der Beitrag von Kathrin Rheinländer zur sozialen Sensibilität von Hochschullehrenden erscheint im Tagungsband. Kernkompetenz zukomme und diese entsprechend nicht schon in der beruflichen Ausbildung zum zentralen Thema zu machen sei. Daran anknüpfend fragten Martin Schmidt und Johannes Emmerich (beide Hannover) aus eigener Erfahrung in der ‚My Study’-Beratung, nach der Möglichkeit ‚Habitussensibilität als professionelles Kernwissen‘ anzunehmen und welche Anforderungen an die Beratenden dies stellt. Für die Möglichkeit einer gewaltfreien und damit fruchtbaren Kommunikation sei es entscheidend, dass es aus Beraterperspektive gelänge, den Standpunkt des Gegenübers zu reproduzieren, wobei man sich zunächst selbst objektiviere müsse, um den Standpunkt des Anderen einnehmen zu können. Die damit notwendige Analyse der eigenen lebensweltlichen Umstände und Existenzbedingungen ließe sich am besten über Gruppenkonstellationen, etwa habitushermeneutische Workshops, intensive Intervisionen und Supervisionen, aber auch Dokumentationen herstellen. In Anlehnung an Bourdieus Konzept einer ‚rationalen Pädagogik‘ müssten die Beratenden weiterhin sowohl über sozialwissenschaftliches Fachwissen, pädagogisches und psychosoziales Kontextwissen, als auch über fundiertes Wissen über gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, vor allem soziale Ungleichheitsstrukturen verfügen. Daraus ergebe sich ein hoher Anspruch an die Beratenden und aufgrund des hohen Aufwands, der mit der praktischen Umsetzung verknüpft ist, könne ‚Habitussensibilität‘ durchaus als professionelles Kernwissen in diesem Zusammenhang gelten. Im folgenden Beitrag stellte Katrin Heuer (Dresden) dar, wie Konzepte der Habitussensibilität und des biographischen Wissens im medizinischen Feld der professionellen Begleitung Sterbender zunehmend Beachtung und Anwendung finden. In ihrem empirisch orientierten Vortrag auf der Basis von nicht-standardisiertem Interviewmaterial beschränkte sie sich zur Rekonstruktion habitussensibler Zugänge auf Fallbeispiele aus dem Hospiz. Innerhalb der professionellen Praxis würden dabei die Patienten als Experten ihrer selbst ernstgenommen und die professionelle Betreuung richte sich komplett, auch disziplinübergreifend, danach aus. Die Kommunikation sei als zentraler, aber auch fragiler permanenter Prozess genauso wichtig wie das ‚Passungsverhältnis‘ zwischen Bewohner und Professionellen. Als abschließende These formulierte Heuer, dass die Etablierung des Sterbeprozesses als eigenständige Lebensphase neue Handlungsorientierungen und damit neue Modelle professioneller Praxis ermögliche und die Habitussensibilität gerade in diesem Bereich zu einer echten Kernkompetenz würde. Hannu Turba (Kassel) widmete sich habitussensiblen Orientierungen innerhalb polizeilicher Arbeit und konstatierte, dass sich sowohl Selbstbild als auch professionelles Leitbild der Polizisten immer mehr in die Richtung von Sozialer Arbeit bewegen und dabei Täter, Opfer und Zeugen gleichermaßen habitussensibel in den Blick genommen würden. Gerade bei der Ermittlungsarbeit in Fällen von Beziehungsgewalt und Kindesmisshandlung komme einem ‚empathischen‘ Vorgehen bei der ‚Suche nach der Wahrheit‘ eine besondere Bedeutung zu: einerseits um die (oft kindlichen) Opfer und Zeugen vor weiteren Traumatisierungen zu schützen und ihre Aussagen richtig bewerten zu können, andererseits um sich in die Motivation der Täter besser hineinversetzen zu können und sie so möglicherweise besser überführen zu können. Es gäbe allerdings auch Grenzen habitussensibler Praxis durch rechtsstaatliche, finanzielle und organisationskulturelle Hemmnisse. Generell befänden sich Polizeibeamte im „Spannungsfeld zwischen affektiver Neutralität und Empathie“, was in der Praxis dazu führe, dass ein idealtypisches Vertrauensverhältnis im Polizeialltag kaum zu erreichen sei. Aladin El-Mafaalani (Münster) beschäftigte sich in seinem Vortrag 2 mit Habitus-StrukturKonflikten im Feld der Schule und stellte fest, dass der Forderung nach Habitussensibilität in der Praxis große strukturelle Probleme gegenüberstehen. So erlaube etwa die systemische Logik es den Lehrkräften in Deutschland, darauf zu verweisen, die ‚falschen‘ Schüler zu haben und sie bei Problemen einfach einem anderen Ort zuzuführen. Verglichen mit egalitär ausgerichteten Modellen würde viel Aufwand betrieben, um die Selektion und das systemimmanente Ziel der Homogenisierung auf mehreren Ebenen aufrechtzuerhalten. Vor allem das dreigliedrige Schulsystem verhindere weitgehend eine Verantwortungsübernahme der Lehrkräfte und erschwere einen habitussensiblen Zugang. Unter diesen Bedingungen erscheine die Forderung nach mehr Habitussensibilität ohne gleichzeitige strukturelle Veränderungen momentan als wenig sinnvoll. Roland Becker-Lenz (Olten) und Silke Müller-Hermann (Basel) nahmen unter Berücksichtigung von zwei eigenen Studien die ‚Habitusformationen und Bildungschancen im Studium der Sozialen Arbeit‘ in den Blick. Dabei sei zu erkennen, dass sich die Motivlage zur Wahl eines Studiums der Sozialen Arbeit aus dem Habitus und der individuellen Sozialisation der Berufsanwärter ableitet und sich direkt auf den Studienverlauf auswirke. An dieser Stelle sei die Möglichkeit für die Hochschule gegeben, ungünstige Passungsverhältnisse bereits früh zu identifizieren und auf dieser Basis Hilfestellungen und Empfehlungen für die Studierenden zu geben. Zudem sei eine Bewusstmachung des eigenen Habitus empfehlenswert: Im Studium sollte also eine Selbstreflektion stattfinden, die z.B. durch Supervisionen oder Mentoring angeregt werden könne. Für eine mögliche Habitustransformation seien außerdem langfristige Berufspraktika wichtig. Da jedoch Habitusformationen nur relativ schwer veränderbar seien, stelle sich immer auch die schwierige Frage nach der Passung und der Bewertung der habituellen Dispositionen bezüglich der professionellen Anforderungen. Ebenfalls im Feld der Sozialen Arbeit waren die Überlegungen von Sonja Kubisch (Köln) angesiedelt, die grundsätzlich nach der Möglichkeit fragte, wie und ob der Habitus der zu betreuenden Klientel überhaupt wahrzunehmen sei. Gerade aus der Schwierigkeit, den Gesamthabitus erschließen zu können, ergebe sich jedoch die Chance, den Blick für die gegenwärtig relevanten habituellen Dispositionen und der Klienten zu schärfen, ohne diese dabei in festen Milieus zu verankern. 2 Der ursprünglich mit Lars Schmitt konzipierte Beitrag musste krankheitsbedingt umgestellt werden. Gleichzeitig lege der Begriff der Habitussensibilität nahe, sich nicht nur auf habituelle Disposition der Klienten zu konzentrieren, sondern gleichermaßen selbstreflexiv sowohl den eigenen Habitus in Bezug auf das Passungsverhältnis zwischen Professionellem und Klient mitzudenken. Für die professionelle Praxis bedeute dies, durchaus über längere Zeit in einem Stadium des Nicht-Wissens zu verharren und aktiv und systematisch auf die Suche nach habituellen Grundmustern zu gehen, welche dem Handeln des Klienten zugrunde liegen. Als gewinnbringende Perspektive könne festgehalten werden, Prinzipien der qualitativen Forschung in der Praxis der Sozialen Arbeit anzuwenden. Kubisch plädierte dafür, diese Methoden (Dokumentarische Methode, Fallrekonstruktionen) bereits im Studium einzuführen, wobei allerdings eine einseitige Annäherung der Praxis an die Theorie zu vermeiden sei, zugunsten einer Zusammenführung beider Bereiche über den Begriff der Habitussensibilität. Aus der Perspektive der Habitus- und Milieuforschung beschäftigten sich Andrea LangeVester (Darmstadt) und Christel Teiwes-Kügler (Essen) mit der Frage nach der Verankerung von Habitussensibilität im schulischen Alltag, wobei insbesondere die Integration ungleicher sozialer Gruppen im Vordergrund stand. Dabei wurde deutlich, dass die pädagogische Praxis eng mit der habituellen Disposition und der eigenen (auch schulischen) Erfahrung des Lehrpersonals zusammenhängt. Die verinnerlichten Prinzipien würden also an die Schüler herangetragen, wobei aufgrund der Heterogenität jeweils spezifische blinde Flecken entständen und sich zum Teil gravierende Mängel im Passungsverhältnis zu einem Teil der Schüler bemerkbar machten. Um hier zu vermitteln und zu befriedigenderen Ergebnissen zu kommen, sei die Forderung nach mehr Habitussensibilität des Lehrpersonals zwar verständlich, aber in der Praxis oftmals nur schwer einlösbar, da häufig die Kompetenz zum Dekodieren auf Seiten des Lehrpersonals fehle. In diesem Zusammenhang wurde für verbesserte Aus- und Weiterbildungsangebote in Bezug auf das Erkennen des eigenen Habitus und gesamtgesellschaftlicher Herrschaftsmechanismen sowie für eine dialogorientierte Schulkultur plädiert, die sich gerade ungleichheitsspezifischen Diskursen gegenüber offener zeigen sollte. Insgesamt sei Habitussensibilität weder einfach zu verordnen noch schnell zu erlernen und es bedürfe einer großen Anstrengung, diese in der professionellen Praxis der Lehrer zu verankern, was gerade unter den derzeitigen Bedingungen bildungspolitischer Ökonomisierungsprozesse als eher unwahrscheinlich erscheine. Der abschließende Vortrag von Melanie Fabel-Lamla (Hildesheim) betrachtete aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive die bildungspolitischen Erwartungen an Lehrkräfte mit Migrationshintergrund und fragte vor allem danach, wie diese Erwartungen mit den professionellen Selbstkonzepten dieser Gruppe übereinstimmen und welche Probleme sich daraus ergeben könnten. Zunächst wurde festgestellt, dass sich aktuell verschiedene bildungspolitische Entwürfe an Lehrkräfte mit Migrationshintergrund richteten, da diesen aufgrund der eigenen biographischen Erfahrungen besondere multikulturelle Kompetenzen, habituelle Übereinstimmungen, also ein „besonderer Zugang“ zugeschrieben würden. Anhand von zwei Fallbeispielen konnte jedoch gezeigt werden, dass diese Ansprüche von den betroffenen Lehrern nicht immer problemlos akzeptiert werden, da sie ihrem professionellen Selbstverständnis, das auf dem Leistungsprinzip und dem Gleichbehandlungsgrundsatz beruht, zum Teil fundamental widersprechen. Diese Erwartungshaltung würde als ‚DeProfessionalisierung‘ erfahren und abgelehnt, da hier ‚natürliche‘ und nicht erworbene Kompetenzen gefragt seien. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könne eventuell darin bestehen, zunächst die Kompetenz der Mehrsprachigkeit in den Fokus des Anspruchs zu stellen und nicht den diffusen Begriff des ‚Migrationshintergrundes‘. Das professionelle Selbstbild der Lehrenden bliebe unberührt und auch die Gefahr, im biographischen Merkmal ‚Migrationshintergrund‘ völlig verschiedene kulturelle und habituelle Hintergründe unzulässig zu vereinheitlichen, könnte so umgangen werden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Tagung mit insgesamt knapp 50 Personen erfreulich gut besucht war und das Thema ‚Habitussensibilität‘ in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Berufsfeldern offenbar Konjunktur hat, was auch in den engagierten und fachlich kompetent geführten Diskussionen der Vorträge zum Ausdruck kam. Die Vielzahl der Perspektiven ermöglichte einen tieferen Einblick in Problemkonstellationen auf institutioneller, bildungspolitischer, didaktischer und individueller Ebene und die Tagung leistete damit einen ersten wichtigen Beitrag zur Bestandsaufnahme theoretischer und praktischer Überlegungen zu den Chancen und Problemen der Verankerung von Habitussensibiltät in professionellen Betreuungszusammenhängen. Dieser Ansatz soll in dem Anfang 2014 im SpringerVS-Verlag erscheinenden Sammelband zur Tagung in vertiefender Form fortgeführt werden. Michael Bruns