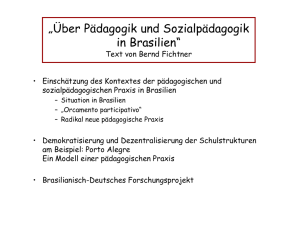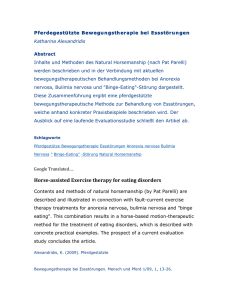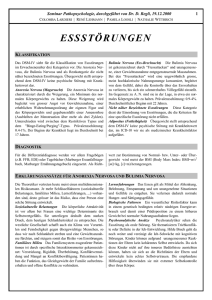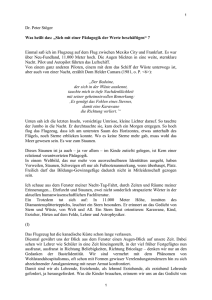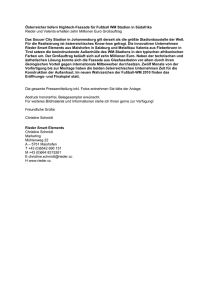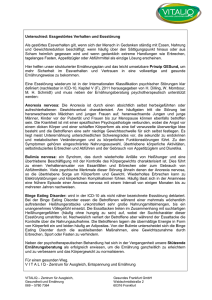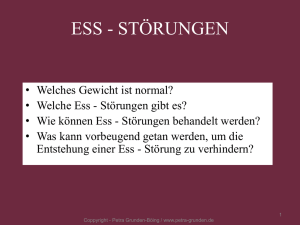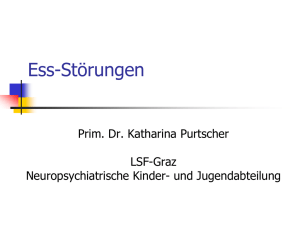Essen ist nicht gleich Ernährung
Werbung

Bakkalaureatsarbeit Stefanie Warum 0633138 Essen ist nicht gleich Ernährung Ernährung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18.Lebensjahr Universität: Medizinische Universität Graz Universitätsplatz 3 A-8010 Graz Institut für Pflegewissenschaft Billrothgasse 6/I 8010 Graz Begutachterin: Maga Beatrix Wimmer Fluchtgasse 7/12 1090 Wien Lehrveranstaltung: Gesundheitspsychologie, Geschlechtsspezifisches Gesundheitshandeln Datum der Einreichung: 31. März 2009 1 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Bakkalaureatsarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Weiters erkläre ich, dass ich diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe. Graz, am 31. März 2009 Stefanie Warum ______________________ Unterschrift 2 Essen ist nicht gleich Ernährung Ernährung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18.Lebensjahr Inhaltsangabe: 1. Das Ernährungsverhalten 1.1. Die Entwicklung des Ernährungsverhaltens 1.1.1. Primär- und Sekundärbedürfnisse 1.1.2. Geschmackspräferenzen 1.2. Funktionen der Ernährung 1.3. Einflussfaktoren 1.3.1. Geschlecht 1.3.2. Ernährungswissen 1.3.3. Der sozioökonomische Status 1.3.3.1 Bildungsstatus 1.3.3.2. Einkommen 1.3.3.3. Soziale Schicht (Klasse) 1.3.4. Lebensstile von Jugendlichen 1.3.5. Einfluss durch elterliche Lebensstile 1.3.6. Werbung 1.3.7. Idole 2. 1.4. Ess- und Tischgewohnheiten 1.5. Die Ernährungserziehung und ihre Grenzen Aspekte der Ernährung 2.1. Energiebedarf und Körpergewicht 2.1.1 Säuglinge und Kinder 2.1.2.Jugendliche 2.2. Körperwachstum und Gestaltwandlung 2.3. Essen und Trinken 2.3.1 Alkoholkonsum 2.4. Sport und Bewegung 2.5. Körperwahrnehmung 3. Psychosomatische Störungen 3.1. Diäten 3.2. Essstörungen 3 3.2.1 Säuglinge und Kinder 3.2.2 Jugendliche 3.3. Formen von Essstörungen 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa Binge Eating Disorder Sonstige Essstörungen Adipositas 4. Schlusswort 4 Im Rahmen meiner Bachelorarbeit werde ich das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen vom Säuglingsalter bis zur Volljährigkeit darstellen. Mit dem Titel „Essen ist nicht gleich Ernährung“ möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich auf den folgenden Seiten nicht nur auf die physiologische Nahrungsaufnahme beschränken, sondern „über den Tellerrand hinausblicken“ möchte. Dabei werde ich ganz besonders darauf Bezug nehmen, wie sich Kinder und Jugendliche ernähren und welche Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten einwirken. Zudem liefere ich auch aktuelle Daten und Informationen dazu, was Kinder und Jugendliche essen und trinken, wie viel Zeit sie in Sport und Bewegung investieren und wie sie ihren Körper wahrnehmen. Anschließend werde ich auch psychosomatische Störungen in Bezug auf Ernährung näher beleuchten. Die Darstellung des Ernährungsverhaltens erfolgt genderspezifisch. 1. Das Ernährungsverhalten In diesem Kapitel möchte ich aufzeigen, wie sich das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen entwickelt und welche Faktoren dieses beeinflussen. Außerdem werde ich die Primär- und Sekundärbedürfnissen der Ernährung beleuchten, deren Bedeutung erklären und die Entwicklung von Geschmackspräferenzen darstellen. Zusätzlich stelle ich die Ess- und Tischgewohnheiten unserer Gesellschaft vor und möchte in Bezug darauf die Ernährungserziehung näher beleuchten. 1.1. Die Entwicklung des Ernährungsverhaltens Prinzipiell entwickelt sich das Ernährungsverhalten nach den gegebenen äußeren Umständen. Solche können zum Beispiel Lebensmittelüberfluss oder Mangelsituationen sein (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, S.37). Wie wir uns ernähren, was und wann wir essen wird bereits in der frühen Kindheit geprägt und wird vor allem von dem sozialen Umfeld und von der Familie beeinflusst (vgl. Rost & Otten 1998, S. 74). Zudem ist das Ernährungsverhalten ein Lernprozess, der von den Eltern auf die Kinder übertragen und über Jahre hinweg ständig gefestigt wird1. Schließlich bildet sich das erlernte Verhalten zur Gewohnheit aus (Diehl 1991; Pudel 1986, zit. nach Pudel & Westenhöfer 1998, S.42f). 1 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.3.5. 5 In der Entwicklung unseres Ernährungsverhaltens unterscheiden Rost und Otten (1998, S. 74) vier Phasen. In der ersten Phase stehen vor allem die Sättigung und das Stillen des Hungergefühls im Vordergrund. Der Säugling vermag seine Bedürfnisse noch nicht verbal zu äußern, doch kennt er Wege wie zum Beispiel das Schreien, um auf sich aufmerksam zu machen. Ernährung bedeutet jedoch auch für ihn nicht nur die physiologische Nahrungsaufnahme, sondern auch Zuwendung und Mittel der Kommunikation. In der zweiten Phase hat das Kind bereits viele Erfahrungen mit der Nahrungsaufnahme gesammelt, die es sowohl als negativ als auch als positiv empfunden haben kann. Diese Erfahrungen sind Schlüsselereignisse und prägen Gewohnheiten. Die dritte Phase ist die Imitationsphase, in der das Kind versucht, das Verhalten seiner Bezugspersonen nachzuahmen. In der vierten Phase können die erlernten Verhaltensweisen erweitert werden, da nun auch neue, äußere Reize wie zum Beispiel gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Mahlzeitenfrequenz oder der Pausenrhythmus in der Schule auf das Kind Einfluss nehmen (vgl. Rost & Otten 1998, S. 74). Im Laufe dieser vier Phasen nehmen sekundäre Bedürfnisse wie Zuwendung neben primären Bedürfnissen wie Sättigung an Bedeutung zu. 1.1.1. Primär- und Sekundärbedürfnisse Unser Ernährungsverhalten wird besonders durch Primär- und Sekundärbedürfnisse gesteuert. Primäre Bedürfnisse sind angeboren und dienen dem Stillen von Hunger und Durst, während sekundäre erlernt werden und einen anderen Zweck als die Sättigung haben. Bei Sekundärbedürfnissen nimmt die Mutter-Kind-Interaktion eine wichtige Rolle ein (Bruch 1973; Selvini-Palazolli 1982, zit. nach Pudel & Westenhöfer 1998, S.38f). Da ein Säugling sich noch nicht mit Worten verständigen kann, liegt es an der Mutter ein Hungergeschrei auch als solches zu identifizieren. Reagiert sie jedoch auf ein Geschrei, dessen Ursache kein Hungergefühl ist, mit einer Nahrungszufuhr, so kann sich bereits ein falsches Ernährungsverhalten entwickeln. Der Säugling erkennt, dass er die erwünschte Zuwendung besonders dann erreichen kann, wenn er gefüttert wird. Auch im Kleinkindalter setzt sich schließlich dieses Verhalten fort: das Kind drückt Freude aus, wenn es etwas zu essen bekommt und der Erwachsene freut sich, wenn es ihm ein Lächeln schenkt. So wird dieser auch in Zukunft das Kind mit Essbarem verwöhnen. Obwohl es hierbei oberflächlich betrachtet um Essen geht, steckt dahinter jedoch das Bedürfnis nach Zuwendung und Aufmerksamkeit (vgl. Kiefer, Schoberberger & Kunze 1996, S.108f). Dies kann laut Pudel und Westenhöfer (1998, S.39) dazuführen, dass 6 Kleinkinder nicht zwischen Hungergefühlen und negativ besetzten Gefühlen unterscheiden können. 1.1.2. Geschmackspräferenzen Studien zufolge haben Säuglinge bereits eine scheinbar angeborene Vorliebe zu süßem Geschmack, während sie eine Abneigung zu Salzigem, Saurem oder Bitterem haben (Desor, Maller & Turner 1973; Nisbett & Gurwitz 1970; Steiner 1979; Ziegler 1984, zit. nach Pudel & Westenhöfer 1998, S.40). Die Vorlieben und Abneigungen können damit zusammenhängen, dass süße Nahrungsmittel mehr Energie liefern und sicherstellen als bittere Speisen, deren Genuss sich im Vergleich zu Süßem öfters als riskant erweist (Rozin 1976, zit. nach Pudel & Westenhöfer 1998, S.40). Eine Abneigung gegenüber Saurem, Bitterem oder Salzigem ändert sich schließlich im Kleinkind- und Grundschulalter, nachdem verstärkt Erfahrungen mit solchen Speisen gemacht wurden (Cowart 1981, zit. nach Pudel & Westenhöfer 1998, S.40). Abgesehen von einer bereits im Säuglingsalter bestehenden Vorliebe und Abneigung gegenüber bestimmten Geschmäckern, legen sich Geschmackspräferenzen und Ernährungsgewohnheiten zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr fest und werden vor allem durch den „Geschmack der mütterlichen Küche“ geprägt. Diese bleiben meist bis ins hohe Alter erhalten. Ebenso verhält es sich mit den Tischmanieren und Trinkgewohnheiten2 (vgl. Holtmeier 1995, S.165). Zudem zeigen Pudel und Westenhöfer (1998, S.42) auf, dass laut Diehl (1991) Geschmacksvorlieben durch Kontakt und Erfahrung mit bestimmten Nahrungsmitteln geformt werden (mere exposure effect). Somit lässt sich auch erklären, warum Kinder aus unterschiedlichen Regionen auch diverse Geschmacksvorlieben haben, nämlich weil sie an eine bestimmte und für eine Region typische Küche gewohnt sind. Bei Säuglingen und Kindern werden noch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede vernommen. Die Entwicklung unterschiedlicher Geschmackpräferenzen zwischen Mädchen und Jungen setzt erst im Jugendalter ein (Rieder & Lohff 2008, S.128). So essen zum Beispiel Jungen mit zunehmenden Jahren mehr Salz, Fett und Zucker, während Mädchen mehr Obst und Gemüse essen (Block et al 1998, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.254). Dies muss aber nicht unbedingt mit geschlechtsspezifischen Geschmacksvorlieben zusammenhängen, sondern kann auch daran liegen, dass junge Frauen ein stärker ausgeprägtes Ernährungswissen aufweisen. Im Erwachsenenalter zeigt 2 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.4. 7 sich dann, dass Frauen ein im Vergleich zu Männern erhöhtes Verlangen nach Süßem haben, was schließlich zu einem übermäßigen Konsum an Kohlenhydraten und den damit verbundenen Fetten führen kann (Wurtmann & Wurtmann 1995, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.129). Vergleicht man aber letztendlich den tatsächlichen Verzehr beider Geschlechter, so kann festgestellt werden, dass Männer mehr Brot, Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten zu sich nehmen, während Frauen mehr Obst, Joghurt und Kaffee konsumieren (Block et al 1998, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.254). 1.2. Die Funktionen der Ernährung Essen ist nicht gleich Ernährung, sondern hat verschiedene Funktionen. Primär dient die Ernährung dazu, dem Körper Essen beziehungsweise Nahrung zuzuführen, ihn mit allen nötigen Nährstoffen zu versorgen und somit alle körperlichen Funktionen aufrechtzuerhalten. Dies wird als die physiologische Funktion bezeichnet. Fast genauso viel Bedeutung wird der sozialen Dimension zugeschrieben.3 Die soziale Umgebung während der Mahlzeiten, die Atmosphäre, die Kommunikation und die Beziehungen mit anderen spielen der Ernährung eine wesentliche Rolle. Essen kann Freundschaft, Verbundenheit, Zugehörigkeit und Nähe ausdrücken, aber auch Macht, Hierarchie und Ausgrenzung. Eine weitere Funktion ist die kulturelle. Diese bestimmt zum Beispiel die Ernährungssitten und –gebräuche, die Ess- und Tischgewohnheiten4 und die Geschmackspräferenzen5 einer Gruppe oder Gesellschaft. Wichtig ist auch die psychische Funktion von Ernährung mit dem damit verbundenden Genuss von Essen, dem Selbstwertgefühl und der emotionalen Sicherheit. Die psychische Dimension kann aber auch Ängste und Schuldgefühle hervorrufen und bei einer Fehlfunktion zu Störungen6 führen. Weitere Funktionen sind die ökonomische, die durch das Einkommen bestimmt wird7, und die zeitliche, die sich auf die Dauer und Häufigkeit der Mahlzeiten bezieht (vgl. Feichtinger 1996, S.9ff). Weitere Informationen dazu finden sich in Kapitel 2. Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.4. 5 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.1.2. 6 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 3. 7 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.3.3. 3 4 8 1.3. Einflussfaktoren Das Ernährungsverhalten wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. So spielen das Geschlecht, das Wissen, der Bildungs- und der sozioökonomische Status eine wesentliche Rolle. Zudem beeinflussen aber auch jugendliche und elterliche Lebensstile, wie und wann Kinder und Jugendliche was zu sich nehmen. Jedoch nicht nur diese Faktoren wirken auf das Verhalten ein, sondern auch die auf junge KonsumentInnen abgezielte Werbung durch die Medien und die Vorbildwirkung der Idole sind von entscheidender Rolle. Auf die einzelnen Faktoren möchte ich nun genauer eingehen. 1.3.1. Geschlecht Das Geschlecht beziehungsweise die Geschlechtsidentität spielt im Säuglings- und Kindesalter hinsichtlich des Ernährungsverhaltens noch keine wesentliche Rolle. Erst im Jugendalter entwickeln sich geschlechtsspezifische Unterschiede. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass sich in dieser Zeit weibliche und männliche Identitäten herausbilden, die anschließend auch zu unterschiedlichen Ernährungsmustern führen (Kübler et al. 1994, S.303, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S.23). Es lässt sich erkennen, dass sich weibliche Jugendliche gesünder als männliche, die mehr Snacks, Süßigkeiten, Fleisch, Alkohol und Süßgetränke zu sich nehmen, ernähren (vgl. Gerhards & Rössel 2003, S.68). Diese Unterschiede können daher kommen, dass Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer spezifische Körpervorstellungen haben (Köhler 1991; Roos et al. 1998, S.1526, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S.19). Circa 50% der Mädchen Selbsteinschätzung geben bei an, sich als zu dick Jungen zu fühlen, seltener http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, während auftritt S.27 (31. diese (vgl. 3.2009). Außerdem belegen Gerhards und Rössel (2003, S. 68f) mit ihrer Studie die Arbeiten von Prahl & Setzwein (1999, S.79), wenn sie aufzeigen, dass männliche Jugendliche eher Lebensmittel, die mit Kraft und somit der männlichen Identität verbunden werden wie zum Beispiel Fleisch, bevorzugen, während Mädchen lieber Leichtes und Frisches wie Obst und Gemüse zu sich nehmen, was eher der weiblichen Identität entspricht. So würden wahrscheinlich die meisten eine Schweinshaxe als eine Speise für Männer auffassen. Manchmal deutet sogar schon ein Name wie der des „Holzfällersteaks“ ein geschlechtsbezogenes Image an. Das Nippen an einem Glas oder das schnelle Trinken aus einer Bierflasche sind Verhaltensweisen, die ebenfalls eindeutig einem Geschlecht 9 zugeordnet werden. Das Treffen beim Stammtisch oder der Besuch beim Kaffeekränzchen, das Grillen oder Kochen und Dünsten, das kräftige Zulangen oder die Zurückhaltung beim Essen geben in unserer Gesellschaft oft einen Hinweis auf das Geschlecht der Person, die die Tätigkeit ausführt. Das typisch weibliche Essverhalten wie langsam und zurückhaltend zu essen und das typisch männliche Essverhalten wie „richtig rein hauen“ besteht bereits im Kindesalter (vgl. http://www.talkingfood.de/lehrer_special/gesunde_schule/TitelWarum_essen_M%C3%A4dchen_Salat_und_Jungen_Fleisch%3F,6,28,18.html, (31.3.2009). Eine deutsche Studie führt auch zu dem Ergebnis, dass Jungen aufgrund ihres Ernährungsverhaltens eher zu Übergewicht neigen, während Mädchen häufiger untergewichtig sind (Wittenberg 1999, S.38, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S.23). Auf geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich eines pathologischen Essverhaltens wird jedoch genauer in einem späteren Kapitel eingegangen8. 1.3.2. Ernährungswissen Ein weiterer wesentlicher Faktor, der das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst ist das Ernährungswissen. Gleichsam wie mit dem Einflussfaktor „Geschlecht“ verhält es sich auch hier. Das Ernährungswissen trägt nämlich im Kindesalter noch kaum zum Ernährungsverhalten bei, sondern beginnt erst mit zunehmendem Alter, nämlich dem Jugendalter, auf Verhaltensmuster einzuwirken. Kinder können zum Beispiel den Kaloriengehalt nicht einschätzen und definieren laut Pudel und Westenhöfer (1998, S.44f) „zu viel“ als „das sichtbare Volumen beziehungsweise das spürbare Gewicht“. Folglich verstehen Kinder „wenig Süßigkeiten“ so, als hätten sie wenig konsumiert, während sie viel Kartoffeln auch als viel ansehen, obwohl die Süßigkeiten tatsächlich mehr Kalorien aufweisen. Dieses Beispiel soll veranschaulichen, dass, so wie es Pudel und Westenhöfer nennen, „Energiedichte kein Kinderbegriff ist“ und es kleinen Kindern noch an Ernährungswissen fehlt. Folglich ist es wahrscheinlich auch verständlich, dass das Wissen der Eltern somit auschlaggebend für das Verhalten ihrer Sprösslinge ist und dieses prägen9. Die Übertragung des Verhaltens geschieht vor allem durch Beobachtungs- und Imitationslernen (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, S.45). 8 9 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 3.2. Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.3.5. 10 Im Jugendalter beginnt das Ernährungswissen allmählich das Ernährungsverhalten zu beeinflussen. Mädchen beziehungsweise Frauen weisen ein höheres Ernährungswissen auf und zeigen auch ein größeres Interesse an Ernährungsinformationen als Jungen beziehungsweise Männer. Mögliche Gründe dafür sind traditionelle Rollenverteilungen und Schlankheitsideale von Mädchen und Frauen (DGE, 2000; Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien, 1998, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.130). An der Ernährungsberatung oder Ernährungsfragen sind besonders Frauen in der Schwangerschaft und Personen, vor allem Frauen, mit hoher Schuldbildung oder sozialen Status interessiert (Meyer & Jeanneret, 1996, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.130). 1.3.3. Der sozioökonomische Status Als sozioökonomischen Status bezeichne ich ein Zusammenspiel aus den drei Einflussgrößen Bildung, Einkommen und soziale Schicht oder Klasse, die gemeinsam das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. 1.3.3.1. Bildungsstatus So wie das Wissen des Konsumenten über eine richtige Ernährungsweise, so beeinflusst auch der Bildungsstatus das Ernährungsverhalten. Dies zeigt eine Studie zur „Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen“. Der zufolge gibt es Ernährungsunterschiede zwischen diversen Schultypen. So geben zum Beispiel Schüler und Schülerinnen der Hauptschulen und Polytechnischen Schulen häufiger als GymnasiastInnen an selten oder nie Obst zu essen (vgl. http://www.univie.ac.at/lbimgs/berichte/hbsc17.pdf, S.34, (31.3.2009)). Da sich Kinder und Jugendliche aber erst in der Ausbildungsphase befinden und sich daher noch kein allzu starker Einfluss der Bildung auf das Ernährungsverhalten feststellen lässt, möchte ich den Zusammenhang zwischen Bildungsstatus, Ernährung und Geschlecht anhand von Erwachsenen darstellen. So zeigt es sich, dass sich Personen beiderlei Geschlechtes mit höherem Bildungsstatus gesünder ernähren als solche mit geringerem. Eine Ausnahme sind jedoch männliche Universitätsabsolventen, die verglichen zu Personen mit mittlerer Ausbildung, ein weniger positives Ernährungsverhalten aufweisen. Hinsichtlich der einzelnen Lebensmittelgruppen zeigt sich außerdem, dass mit zunehmender Bildungshöhe weniger an Fett, Zucker, Wurst, Fleisch und Erfrischungsgetränken konsumiert wird, während aber mehr Vollkornprodukte verzehrt 11 werden. Folglich haben Männer und Frauen mit Pflichtschulabschluss den höchsten Konsum an solchen Produkten, während weibliche und männliche Personen mit Universitätsabschluss den niedrigsten aufweisen. Außerdem konsumieren PflichtschulabsolventInnen mehr Süßigkeiten als UniversitätsabsolventInnen. Interessant ist, dass mehr Männer mit Pflichtschulabschluss als Frauen täglich naschen, während es bei Personen mit Universitätsabschluss mehr Frauen sind. Auffällig ist auch, dass Frauen täglich weniger Fleisch, Wurst und Erfrischungsgetränke und mehr gekochtes Gemüse, Rohkost, Salat bzw. rohes Gemüse konsumieren als Männer (vgl. http://www.wien.gv.at/who/lebensstile/pdf/gesamt.pdf, S.99ff, (31.3.2009)). 1.3.3.2. Einkommen Unter der Einflussgröße Einkommen verstehe ich das Einkommen der Eltern, das sich auf das Ernährungsverhalten der ganzen Familie und somit auch auf das der Kinder auswirkt. So kann ein geringes Einkommen der Eltern oder sogar ein fehlendes gesundheitliche Auswirkungen auf die Familie haben. Im Zusammenhang damit wurde festgestellt, dass Familien mit höherem Einkommen mehr an frischem Obst, Gemüse, Topfen, Eier, Vollmilch und Joghurt und weniger an Kartoffeln, Brot und Margarine konsumieren und somit ein positiveres Ernährungsverhalten aufweisen (Köhler 1991, S.7, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S. 21). Kinder und Jugendliche, die in Armut leben, sind am stärksten von den gesundheitlichen Auswirkungen betroffen. Die Ursachen für Armut im Kindes- und Jugendalter sind meistens Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung der Eltern oder kinderreiche Familien und die damit verbundenen Einkommenseinbußen, die bei Müttern sehr viel größer sind als bei Vätern. Durch mangelndes Einkommen ist jedes dritte arme Kind in Deutschland in mehr als einem Lebensbereich benachteiligt. Von diesen Kindern kommen ca. 16% hungrig in die Kindergärten, 15% sind ungepflegt und vernachlässigt, 15% sind oft krank, 11% leiden an einer chronischen Krankheit und 10% sind in ihrer körperlichen Entwicklung zurückgeblieben. Auffällig ist auch, dass arme Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien sich weniger sportlich betätigen und mehr fernsehen als andere. Außerdem haben sie ein ungünstigeres Ernährungsverhalten. Der Lebensmittelkonsum unterscheidet sich sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht von wohlhabenden Familien. So leiden arme Kinder und Jugendliche häufiger an Mangel-, Fehl- oder Überernährung und nehmen mehr kalorien- und fettreiche Speisen und Getränke wie Pommes Frites und Süßgetränke zu sich (vgl. Klocke o.J., S.7ff). 12 Feichtinger (1996, S.34) behauptet auch, wenn sie Graham (1987) und Wilson (1987) zitiert, dass Familienväter oft darüber entscheiden, wie viel und wofür das Einkommen ausgegeben wird und legen somit die Ernährung ihrer Familie fest. Außerdem nehmen Frauen oft nach ihrer Heirat die Ernährungspräferenzen ihres Partners an und stellen dabei ihre eigenen in den Hintergrund (vgl. Graham 1987; Kerr & Charles 1986, zit. nach Feichtinger 1996, S.34). Auch am Tisch benehmen sich Mütter unterwürfig, wenn sich folgende Hierarchie durchsetzt (Charles & Kerr 1987; Fitchen 1988; Graham 1987; Hübinger 1991, zit. nach Feichtinger 1996, S.34f): der Vater beansprucht die statushöheren Lebensmittel wie Fleisch, die Kinder das Obst und die Mutter die Reste und die statusniedrigeren Nahrungsmittel. 1.3.3.3. Soziale Schicht (Klasse) Die soziale Schicht beziehungsweise Klasse ist eng mit der Bildung verbunden und liefert dieselben Ergebnisse wie der Zusammenhang zwischen Bildungsstatus und Ernährung. Vergleicht man unterschiedliche Schultypen miteinander, so erkennt man, dass sich GymnasiastInnen gesünder ernähren als ihre KollegInnen in den Hauptschulen. Dieser Unterschied wird als schichtbedingt interpretiert. So nehmen SchülerInnen auf Gymnasien mehr Joghurt, Milch und Mineralwasser zu sich, während HauptschülerInnen mehr Süßgetränke, Pommes Frites und Schokoriegel verzehren (vgl. Kienzle 1988, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S.21).10 1.3.4. Lebensstile von Jugendlichen Neben dem Geschlecht, dem Ernährungswissen und dem sozioökonomischen Status beeinflussen auch jugendliche Lebensstile das Ernährungsverhalten. Man geht davon aus, dass der Lebensstil grundsätzlich von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben, schließlich von Jugendlichen neu kombiniert und erweitert und durch den Bildungsweg verstärkt wird (Bourdieu 1982; DiMaggio & Mohr 1985, zit. nach Gerhards & Rössel 2003, S. 31). Der Lebensstil legt zum Beispiel fest, wie Menschen und in diesem Fall Jugendliche leben, wie sie ihren Alltag gestalten, wie und welche Speisen sie gerne zu sich nehmen, welche sie ablehnen und ob und wie viel Sport sie betreiben. Da Kinder und Jugendliche in der Regel überwiegend im Elternhaus ihre Mahlzeiten einnehmen, beeinflussen Eltern auch 10 Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 1.3.3.1. 13 das Ernährungsverhalten ihrer Sprösslinge. Dieser Einfluss wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben (vgl. Gerhards & Rössel 2003, S.31f). Die elterlichen Lebensstile beeinflussen aber nur beschränkt die ihrer Kinder. Diese gestalten nämlich größtenteils ihren Lebensstil selbst und haben somit selbst den größten Einfluss auf ihr eigenes Ernährungsverhalten. So zeigt es sich zum Beispiel, dass Jugendliche die viel Zeit außerhalb des Elternhauses verbringen, eher dazu tendieren, Snacks zu konsumieren und Kneipen und Restaurants zu besuchen, als solche, die sich hauptsächlich zuhause aufhalten. Gerhards‘ und Rössels Studie zum Ernährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Lebensstile (2003, S. 54f) zeigt, dass Mädchen und Knaben mit sport- und kulturorientierten Lebensstil, das heißt sich selbst gerne sportlich betätigen, Sportveranstaltungen besuchen, Mitglied in einem Verein sind, gerne Bücher lesen, klassische Musik hören, musizieren oder Theater besuchen, sich mit gesünderen Lebensmitteln ernähren. Im Gegensatz dazu weisen Personen, die ihre Freizeit außerhalb des Hauses verbringen, wie zum Beispiel mit in die Disco zu gehen, Freunde zu treffen, zu bummeln, in die Kneipe zu gehen, Jugendclubs zu besuchen, zum Imbiss bzw. ins Kino zu gehen, Rock-, Pop- oder Technomusik zu hören, ein ungesünderes Ernährungsverhalten auf. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche, die gerne zuhause Musik hören, Videos sehen, Computer spielen, Zeitschriften und Comics lesen und im Internet surfen. Ein starker Zusammenhang konnte zwischen dem Fernsehkonsum und dem Verzehr von Snacks, Alkohol, Süßigkeiten und Süßgetränken hergestellt werden. Je mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht wird, desto mehr ungesunde Nahrungsmittel werden verzehrt. Umgekehrt verhält es sich mit gesunden Lebensmitteln. Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, konsumieren weniger an Milchprodukten, Vollkornbrot und Gemüse und Obst. Kein Zusammenhang besteht zwischen dem jugendlichen Lebensstil und dem Konsum von Butter und Kartoffeln. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass kultur- und sportorientierte Lebensstile von Kindern und Jugendlichen ein positiveres Ernährungsverhalten aufweisen, als solche, die spannungsorientierten Freizeitaktivitäten in und außerhalb des Elternhauses nachgehen. 1.3.5. Einfluss durch Lebensstile der Eltern Wie schon in Kapitel 1.3.4. darauf hingewiesen wurde, beeinflussen die elterlichen Lebensstile die ihrer Kinder und folglich auch deren Ernährungsverhalten. In Gerhards‘ und Rössels Studie (2003, S.51ff) konnte bereits festgestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Lebensstilen beider Generationen gibt, der Einfluss 14 der Eltern jedoch eher ein geringer ist. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern, die in ihrer Freizeit gerne Schlager- und Volksmusik hören, also trivialorientiert sind, leicht dazu tendieren, sich und ihre Kinder eher ungesund zu ernähren. Dies äußert sich darin, dass weniger Vollkornprodukte, jedoch mehr an fettreicheren Speisen, Alkohol und Zigaretten konsumiert werden. Die Eltern, die gerne Sport treiben, Sportveranstaltungen besuchen, klassische Musik hören, Bücher lesen, Museen und Theater besuchen haben auf ihre Nachkommen hinsichtlich der Ernährung eine positivere Auswirkung, was zur Folge hat, dass ihre Kinder häufiger Milchprodukte, Obst und Gemüse und Vollkornbrot verzehren. Kinder von Eltern mit Vorliebe für Rockmusik, Kino-, Kneipen- und Restaurantbesuche tendieren dazu, sich einerseits gesund mit Milch-, Vollkornprodukten und Obst und Gemüse zu ernähren, andererseits nehmen sie auch vermehrt Süßigkeiten und Snacks zu sich. Nur die Freizeitgestaltung „Basteln und Gartengestaltung“ der Eltern scheint keinen relevanten Zusammenhang mit dem Nahrungsmittelkonsum zu haben. So kann zusammenfassend gesagt werden, dass kulturinteressierte und sportorientierte Eltern ihre Kinder gesünder ernähren, als solche, die trivialorientiert sind. Unabhängig von den elterlichen Lebensstilen sind der Kartoffel- und Fleischkonsum. 1.3.6. Werbung In diesem Kapitel möchte ich näher auf die Werbung, auf die Kinder und Jugendlichen als KonsumentInnen und die in der Werbung präsentierten Ernährungsangebote eingehen. Kinder sind in unserer wohlhabenden Gesellschaft zum Marktfaktor geworden. Sie sind nun KonsumentInnen, die selbstständig Kaufentscheidungen treffen können. Laut der KidsVerbraucherAnalyse 2002 in Deutschland haben Kinder und Jugendliche zwischen sechs und dreizehn Jahren circa 18 Euro pro Monat zur Verfügung. Dazu kommen noch Geldgeschenke von den Geburtstagen und Weihnachten und das Sparguthaben. Von den in der Analyse befragten 6- bis 13-Jährigen dürfen 11% der Kinder immer und 29% öfters mit Erlaubnis der Eltern Süßigkeiten kaufen. 36% dürfen nur selten und 24% dürfen nie so viele Naschereien kaufen, wie sie wollen. 77% der Kinder dürfen selten oder nie mit oder selbst entscheiden, welche Lebensmittel gekauft werden, und drei Viertel aller Befragten dürfen auch nicht alleine ein Fast-Food-Restaurant besuchen (vgl. http://www.zaw.de/doc/Positionspapier_Lebensmittel_200805.pdf, S.6ff (11.3.2009)). Kinder und Jugendliche stellen für die Werbung schon früh eine wichtige Zielgruppe dar, denn sie verfügen bereits über ein gewisses Maß an Kaufkraft, können die Eltern in ihren Kaufentscheidungen beeinflussen und wachsen zu zukünftigen KäuferInnen heran. Bereits 15 Kleinkinder können ab dem zweiten Lebensjahr Markennamen und Markensymbole erlernen und werden somit schon früh zur Zielscheibe der Werbeindustrie (vgl. http://www.ernaehrung.de/aktuell/archiv/Kinder-Jugend-Werbung.php, (11.3.2009)). Die Markenorientierung nimmt schließlich mit fortschreitendem Alter zu. Ideal ist es für die HerstellerInnen, wenn ihr Produkt für Kinder zum Synonym der Marke wird, wie zum Beispiel „Nutella“ für Haselnusscreme, „Pago“ für Fruchtsäfte, „Kellog‘s“ für Cornflakes, und sich in den Köpfen der jungen KonsumentInnen verankert (vgl. Lange & Didszuweit 1997, S. 44f). Die Werbung, die auf den Konsument „Kind“ abzielt, muss sich jedoch an gewisse vom Staat vorgeschriebene Richtlinien halten und darf das Kind nicht unmittelbar durch eine Aufforderung zum Kauf verleiten. Außerdem darf sie das kindliche Vertrauen gegenüber den Vertrauenspersonen nicht ausnutzen und sie darf das Kind nicht dazu auffordern, andere zum Kauf zu bewegen. Zudem muss die Fernsehwerbung von der Kindersendung getrennt werden, damit auch kleinere Kinder theoretisch die Werbung auch als solche und nicht als Teil der Sendung verstehen (vgl. http://www.zaw.de/doc/Positionspapier_Lebensmittel_200805.pdf, S.9f (11.3.2009)). Die Werbung darf die Kindersendung auch nicht unterbrechen, weshalb sie nach oder vor dem Kinderprogramm eingefügt wird. Trotz einer Trennung von Werbung und Kinderfilm können die Kleinen vor dem Vorschulalter diese Werbefrequenzen aber nur schwer oder gar nicht von den Fernsehsendungen unterscheiden, da die Werbung, die reich an Zeichentrickfiguren, ActionheldInnen und Abenteuersituationen ist, dem Unterhaltungsprogramm in seiner Aufbereitung und Gestaltung aus Kinderaugen stark ähnelt (vgl. Lange & Didszuweit 1997, S. 47). Obwohl Kinder beim Fernsehen viel an Werbung aufnehmen und Werbefernsehen daher eigentlich einen dementsprechend starken Einfluss haben müsste, wurde durch eine Studie gezeigt, dass die Kleinen viel mehr durch Mundpropaganda ihrer Freunde und durch die Eltern beeinflusst werden. Es heißt auch, dass Kinder, die viel fernsehen, die in der Werbung präsentierten Produkte sehr gut kennen und sie auch als „gesund“ einstufen würden, diese aber dennoch nicht häufiger konsumieren, als diejenigen, die weniger fernsehen. Dies kann möglicherweise daran liegen, dass Kinder Werbung durch Entwicklung einer Werbekompetenz diese als solche erkennen. Das heißt, dass bereits Vorschüler zwischen Sendung und Werbung unterscheiden http://www.zaw.de/doc/Positionspapier_Lebensmittel_200805.pdf, S.14ff können (vgl. (11.3.2009)). Eine Distanz zur Werbung bauen aber erst 11-Jährige richtig auf und verstehen, was sie bezwecken will (vgl. Lange & Didszuweit 1997, S. 113). Die HerstellerInnen haben es 16 übrigens mit ihren Produkten bei Kindern und Jugendlichen nicht allzu leicht. Das Produkt muss sowohl den Tastsinn als auch die Augen ansprechen. Es soll sich im Mund gut anfühlen und mehrere Geschmackskomponenten haben. Weibliche Jugendliche bevorzugen oft die Produkteigenschaft „kalorienarm“, während dies für Knaben und junge Mädchen keine wesentliche Rolle spielt. Kann das Produkt bei seiner jungen Zielgruppe nicht den erwünschten Eindruck hinterlassen, wird es vom Markt genommen. Dies geschieht mit 90% der Waren (vgl. http://www.ernaehrung.de/aktuell/archiv/KinderJugend-Werbung.php, (11.3.2009)). 1.3.7 Idole Idole haben eine große Vorbildwirkung auf Kinder und Jugendliche, sei es aufgrund ihres Kleidungsstils, ihrer Biografie, ihres Lebensstil, ihrer Schönheit oder ihrer Körpermaße. Sie unterscheiden sich jedoch oft von dem, was wir in unserem täglichen Leben sehen. Die Körperformen, die uns auf den Laufstegen der Welt präsentiert werden, haben nichts mehr mit denen zu tun, denen wir jeden Tag auf der Straße begegnen. Aber es sind genau diese, an denen sich Kinder und Jugendliche orientieren, an den Fernsehstars, den Puppen mit übernatürlichen Proportionen, den Trickfilm- und Videospielfiguren und den kaschierten Gesichtern und Körpern in der Werbung und auf den Plakaten. Auch die Mädchen- und Frauenzeitschriften, in denen –wie zum Beispiel in Kindercomics- extrem dünne Gestalten dargestellt werden, tragen wesentlich dazu bei, Körper- und Schönheitsideale in den Köpfen ihrer LeserInnen festzulegen. Dass Fotografien in den Zeitungen nicht ganz der Realität entsprechen, wird kaum beachtet. Tatsächlich sind die abgebildeten Körper und Gesichter nicht so makellos, wie es die Fotos zeigen. Per Mausklick verschwinden lästige Pölsterchen, die Augen strahlen mehr, das Haar bekommt mehr Glanz, die Beine werden länger, der Busen straffer, die Hüfte schmäler. Da die fotografierten Models ohnehin schon unnatürliche Körperformen haben, diese jedoch trotzdem noch nachbearbeitet werden, zeigt schon, welche utopischen Idealvorstellungen in unserer Gesellschaft vorherrschen. Aber nicht nur Models werden immer dünner, sondern auch Kinder und Jugendliche passen sich ihren schmalen Idolen an. Kinderhelden und in Kinderbüchern dargestellte Figuren sind schlank. Dicke Kinder, die uns heute -aufgrund einer anderen Vorstellung von Normalität- auffallen, kommen im Fernsehen besonders in den Sendungen vor, die den besorgten Eltern mit Rat zur Seite stehen sollen. Auch der kleine dicke Frosch im Sandmännchen muss abnehmen, damit das Seerosenblatt ihn noch über Wasser tragen kann. Barbiepuppen und Ritter werden 17 von Kindern zum Vergleich mit der eigenen Figur herangezogen. Ein weiteres Beispiel liefert die weibliche Comicfigur „Sailor Moon“, die mit ihren bis zum Knie reichenden, langen blonden Haaren, ihren dünnen, langen Beinen, den prallen Busen, den großen strahlenden Augen viele Mädchen in den Bann zieht. Sind dann die Kinder zu Jugendlichen herangewachsen, suchen sie sich neue Vorbilder in Filmen, Zeitschriften, Serien, die ebenfalls alle sehr dünn sind. Auch die Figuren in den Schulbüchern unterliegen einer Schlankheitskur und werden immer dünner, so wie dies in den USA bemerkt wurde. Verständlich ist dann wahrscheinlich, dass Mädchen und Knaben mit ihrem Körper immer unzufriedener werden. So wollen weibliche Fans schlanker Idole, auch wenn sie objektive betrachtet bereits dünn sind, schmäler werden und männliche muskulöser (vgl. Pollmer 2006, S.60ff). Denn wer schlank ist und gut aussieht, der ist auch erfolgreich, attraktiv, besitzt sexuelle Ausstrahlung und dem gebührt schließlich auch Anerkennung und Wertschätzung (vgl. Hurrelmann & Kolip 2002, S.359). Der Weg zu diesem Ziel erfolgt für viele über die Diät. So entsteht eine unglückliche Gesellschaft, die glaubt dick zu sein, obwohl sie es gar nicht ist. Und so fragt man sich, wann wir wie das Kind in des Kaisers neue Kleider die tatsächliche Realität bewusst erkennen werden (vgl. Pollmer 2006, S.60ff). 1.4. Ess- und Tischgewohnheiten Für die Entwicklung der Kinder spielen die Mahlzeiten im täglichen Familiengeschehen eine wesentliche Rolle. Am Tisch legen sich nämlich zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr die Ess- und Tischgewohnheiten fest. Diese werden von den Eltern an ihre Sprösslinge weitergegeben. Die Weitergabe erfolgt durch Beobachtungs- und Imitationslernen der Kinder. So wie sich Eltern am Tisch verhalten, so werden es auch ihre Kinder tun, da sie das elterliche Verhalten, das Auftreten und die Eigenarten beobachten und kopieren. Folglich haben auch Auseinandersetzungen der Eltern und Streitigkeiten zwischen den Kindern am Tisch Auswirkungen und können sogar zu Schwierigkeiten führen (vgl. Holtmeier 1995, S. 165ff). Schwierig wird die Nachahmung der beobachteten Gewohnheiten allerdings dann für das Kind, wenn die Familienmitglieder unterschiedliche Essgewohnheiten haben und somit kein einheitliches Modell vorhanden ist. Wahrscheinlich wird das Kind schließlich das Verhalten der Person imitieren, zu der es den größten Bezug hat und mit der es am meisten Zeit verbringt, oder es schaut sich von jedem Familienmitglied ein bisschen ab (vgl. Kiefer, Schoberger & Kunze 1996, S.110). 18 Kinder sollten prinzipiell gemeinsam mit ihren Eltern die Mahlzeiten zu sich nehmen und nicht alleine essen (vgl. Holtmeier 1995, S. 165ff). Wichtig ist es auch, dass die Kleinen ein Regelbewusstsein entwickeln und wissen, dass es bestimmte Mahlzeiten zu gewissen Zeiten gibt (vgl. Kiefer, Schoberger & Kunze 1996, S.109f). Strafen und Belohnungen mittels Essen sind unangebracht. Wenn das Kind nicht mehr essen mag, soll es nicht dazu gezwungen werden, da Kinder unterschiedliche Phasen des Appetits durchleben. So sind lebhafte und unruhige Mädchen und Jungen bessere EsserInnen als geistig rege oder ruhige Kinder. Meistens essen Knaben bereits im Kleinkindalter mehr als Mädchen (vgl. Holtmeier 1995, S. 165ff). 1.5. Die Ernährungserziehung und ihre Grenzen Die Ernährungserziehung richtet sich einerseits auf den familiären Bereich, andrerseits aber auch auf die Umgebung außerhalb der Familie. Die Erziehung innerhalb der Familie erfolgt durch die Eltern und richtet sich an die Zeit bis zum Beginn des Jugendalters. Es ist die Aufgabe der Eltern, das Essverhalten ihrer Kinder nach den sozio-kulturellen Normen, den Traditionen der Familie und eventuell auch nach einer empfohlenen Ernährungsaufklärung zu prägen. Die erzieherischen Maßnahmen erfolgen oft spontan und intuitiv, verlaufen nicht nach Plan und sind nur ein Bestandteil der allgemeinen Erziehungsmaßnahmen (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, S.257). Außerhalb der Familie findet ebenfalls eine Ernährungserziehung statt wie etwa im Kindergarten und in der Schule. Hier wird mit pädagogischen Maßnahmen wie Unterricht, Anordnungen und Verboten gearbeitet. Somit wird dem Kind nicht der Freiraum gelassen, durch Probieren zu lernen (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, S.257). Solche Erziehungsmaßnahmen sollen die Lernenden in eine bestimmte Richtung lenken, ihr Verhalten positiv beeinflussen und fördern. Ein erzieherisches Beispiel wäre eine Aufklärung über Karies und Süßigkeitenkonsum. Nach diesen Erziehungsmaßnahmen können Kinder den Nahrungsmittel bestimmte Funktionen zu weisen, unterscheiden, was dick macht, ungesund ist oder was stark macht und kennen Nahrungsmittelstereotype. Jedoch wurde auch festgestellt, dass Kinder die erlernten Funktionen von Nahrungsmittel nicht begreifen, weil sie den Zukunftsbezug nicht verstehen. So meinen die Kleinen zum Beispiel, dass Süßes den Zähnen nicht schadet, da kein direkter und unmittelbarer Schaden zu erkennen ist (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, S.43). 19 2. Aspekte der Ernährung In diesem Kapitel möchte ich genauer auf den Energiebedarf und das Körpergewicht von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen eingehen. Außerdem werde ich den Aspekt des Körperwachstums und der Gestaltwandlung beschreiben und Daten zum Ess- und Trinkverhalten, zu Sport und Bewegung und der Körperwahrnehmung von Mädchen und Jungen liefern. 2.1 Energiebedarf und Körpergewicht Der Energiebedarf von Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich stark von dem der Erwachsenen, da sich der Körper in einer Wachstumsphase befindet und er die Entwicklung der Organe durch die Versorgung mit hochwertigen Nährstoffen gewährleisten muss. Knaben brachen in einigen Phasen mehr Kalorien als Mädchen und während bei Erwachsenen eine stabile Kalorienzufuhr über die Jahre hinweg vorherrscht, unterliegen Kinder und Jugendlichen Schwankungen im Nahrungsbedarf (vgl. Holtmeier 1995, S. 149f). 2.1.1. Säuglinge und Kinder Verglichen mit seiner Körpermasse benötigt der Säugling die größte Zufuhr an Energie, da er sehr schnell wächst. So hat ein Säugling einen Ruheumsatz von 60kcal/ Tag, während dieser beim Jugendlichen nur noch halb so groß ist. Dazu kommt noch, dass das schnelle Wachstum des Neugeborenen noch weitere 50kcal/ Tag einfordert (vgl. Holtmeier 1995, S. 151). Kinder unterliegen Schwankungen, die dazu führen können, dass sie eine Kalorienzufuhr gleich einer 40-jährige Frau haben können. Knaben essen oft mehr als Mädchen. Diese Geschlechtsunterscheide treten vor allem ab dem 10. Lebensjahr auf (vgl. Holtmeier 1995, S.149). 2.1.2. Jugendliche Ebenso wie Kinder unterliegen auch Jugendliche starken Schwankungen. So kann im Extremfall ein Knabe bei leichter körperlicher Arbeit einen Kalorienbedarf von 5700 Kalorien und ein Mädchen 4400 Kalorien haben kann. Verständlich ist wahrscheinlich, 20 dass sich die Eltern um ihre Kinder sorgen, wenn sie beispielsweise ganze Torten verschlingen oder regelrecht den Kühlschrank plündern. In dieser Situation sollten Eltern nicht überreagieren und ihre Kinder nicht mäßigen, wenn kein tatsächliches Übergewicht vorliegt. Ein Jugendlicher kann nämlich Schwankungen in der Kalorienzufuhr leicht und ohne Schaden verkraften, wenn er sich abgesehen von Phasen mit vermindertem oder verstärktem Energiebedarf ausgewogen ernährt. Die Nahrungszufuhr hängt wesentlich davon ab, wie sehr sich Jugendliche körperlich betätigen oder welchen Anstrengungen sie sich aussetzen. Der Energiebedarf ist außerdem vom Wachstum, dem Körpergewicht und der Körperzusammensetzung abhängig. Weitere Faktoren, die die Nahrungszufuhr beeinflussen, sind die Entwicklungsbeschleunigung und die Geschlechtsreife. Die Pubertät setzt bei Mädchen zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr ein, während sie beim Jungen etwas später, nämlich zwischen 13. und 16. Lebensjahr eintritt. In dieser Zeit haben beide einen erhöhten Proteinbedarf. Bei vielen Mädchen kommt noch ein Eisenmangel aufgrund der Monatsblutungen hinzu, weshalb sich viele der weiblichen Pubertierenden schwach und müde fühlen. Jedoch nicht nur diese physiologischen Faktoren haben Auswirkungen auf den Energiebedarf, sondern auch psychologische wie abwechselnde Gefühlslagen, Freude, Erfolg, Bestätigung und Versagen (vgl. Holtmeier 1995, S.149ff). Körpergewicht Das Normalgewicht bei Kinder und Jugendlichen lässt sich nicht so einfach ermitteln wie beim Erwachsenen, da diese sich noch in einer Wachstums- und Entwicklungsphase befinden. Das Gewicht geht mit der Körpergröße einher und kann trotz einer Abweichung von 10% noch im Normalbereich liegen. Die Gewichtsunterschiede zwischen Mädchen und Knaben sind unter fünfzehn sehr gering, jedoch liegt der der weiblichen Kinder meistens minimal unter dem der männlichen. Im Alter von 10 bis 13 Jahren wiegen Mädchen dann durchschnittlich mehr als Knaben. Im Jugend- und Erwachsenenalter sind es schließlich die Jungen, die mehr Körpergewicht haben (vgl. Holtmeier 1995, S.155). 2.2. Körperwachstum und Gestaltwandlung Kinder und Jugendliche erleben zwei große Wachstumsphasen. Die größte tritt bei Jungen zwischen dem 13. und 14. Lebensjahr ein, jedoch bei Mädchen bereits zwischen dem 11. und 12. In dieser Zeit kommt es zu einem großen Wachstumsschub, auf den eine Gewichtszunahme und eine erhöhte Kalorienzufuhr folgt. Die Verzögerung der 21 Nahrungszufuhr ist der Grund, warum Kinder während der Wachstumsschübe oftmals schlecht und mager aussehen. Das Körperwachstum endet schließlich bei den Mädchen mit dem 16. Lebensjahr, bei Knaben mit dem 17 (vgl. Holtmeier 1995, S.166). Neben den Wachstumsschüben kommt es bei Jugendlichen zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr auch zur Veränderung der Gestalt und des Aussehens. Die sekundären Geschlechtsmerkmale bilden sich aus und die Geschlechtsreife tritt ein. Bei Mädchen beginnt diese um das 12. Lebensjahr. Die Brüste formen sich und es kommt zur ersten Regelblutung (Menarche). Bei Knaben tritt die Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr ein und es kommt zur Samenproduktion. Knaben haben vor der Pubertät einen verstärkten Fettansatz, während Mädchen erst mit der Menarche Fettpolster anlegen, die dem Körper weibliche Rundungen verleihen. Diese Veränderung ist hormonbedingt. Der Pubertät sollte ein gewisses Maß an Vorsicht zugeteilt werden, da vor allem Mädchen zu übermäßigem Nahrungsgenuss und zu daraus resultierenden Gewichtszunahmen neigen. Um nicht zuzunehmen, nehmen sie oft sogar Abführmittel oder wagen andere Versuche, die einer Zunahme entgegen wirken (vgl. Holtmeier 1995, S.166f). 2.3. Essen und Trinken Für Kinder und Jugendliche ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig, da sie die physiologische und kognitive Entwicklung positiv beeinflusst, Krankheiten vorbeugt und Gesundheitsprobleme vermeidet. Im Sinne einer ausgewogenen Ernährung sollte auch auf die Wahl der Lebensmittel geachtet werden. So können einige das Risiko für Übergewicht und Adipositas fördern, während andere den gesunden Körper unterstützen. Dieses Kapitel soll mittels Studienergebnissen darüber Aufschluss geben, welche Nahrungsmittel Kinder und Jugendliche zu sich nehmen (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf (15. 3.2009)): Vergleicht man zwischen den beiden Geschlechtern den Konsum von gesunden Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse und ungesunden Lebensmitteln wie Süßigkeiten und Limonaden, so kann man feststellen, dass sich Mädchen durch erhöhten Obst- und Gemüseverzehr gesünder ernähren als Burschen. Für beide gilt jedoch, dass der Konsum an Obst und Gemüse mit zunehmendem Alter abnimmt. Süßigkeiten und Limonaden haben sowohl männliche als auch weibliche Fans, wobei Knaben lieber naschen und Limonade trinken. Der Konsum von Süßgetränken steigt mit zunehmendem Alter. 22 2.3.1. Alkoholkonsum Alkohol ist ein Risikofaktor für vielerlei Krankheiten und besonders bei jungen Menschen kann er einen erheblichen Schaden anrichten. Neben den körperlichen Schädigungen, die Alkohol hervorruft, leiden Jugendliche zudem unter dem Risiko, sich unter Alkoholeinfluss häufiger vielerlei Gefahren auszusetzen (Perrine et al. 1988; Facy 2000, zit. nach http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.43 (15. 3.2009)). Solche Gefahren, gesundheitsschädlichen oder zumindest die Gesundheit negativ beeinflussenden Verhaltensweisen bei Jugendlichen sind Rauchen, illegale Suchtmittel, riskantes Sexualverhalten, dissoziales Verhalten, Schulversagen, Depressionen und Angststörungen. Alkohol kann entweder der Auslöser selbst oder die Konsequenz dieser Zustände sein (Kandel & Yamaguchi 1993; Johnston et al. 2002; Cooper 2002; Jonston et al. 2002; Wechsler et al. 1994; Rohde et al. 1995; Perkins 2002, zit. nach http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.43 (15. 3.2009)). In Österreich trinken 12,8% der Mädchen und 17,1% der Burschen wöchentlich oder öfters. Mit zunehmendem Alter wird der Alkoholkonsum häufiger, wobei Knaben im Geschlechtervergleich regelmäßiger zum Alkohol greifen. Das beliebteste alkoholische Getränk der männlichen Jugendlichen ist das Bier. Danach folgen andere alkoholische Getränke, dann Spirituosen, Alkopops, Wein und Sekt. Most ist sowohl bei Mädchen als auch bei Knaben am unbeliebtesten. Weibliche Jugendliche bevorzugen Alkopops, dann andere alkoholische Getränke und schließlich Spirituosen, Wein und Sekt. Während Knaben Bier am liebsten trinken, mögen es Mädchen kaum (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.43f (15. 3.2009)). 87,9% der 15-jährigen ÖsterreicherInnen geben an, dass sie in den letzten 30 Tagen nie betrunken gewesen sind. Das trifft vor allem auf Mädchen zu. Die Daten zeigen auch, dass das sogenannte Komatrinken (binge drinking) mit dem Alter zunimmt. So geben 20,1% der 15-jährigen Burschen und 18,9% der Mädchen an, dass sie im letzten Monat ein- bis zweimal betrunken gewesen sind. 18,8% der Jugendlichen war bereits öfters betrunken. Zusammenfassend kann man gemäß der Studie zur Gesundheit der österreichischen SchülerInnen im Lebenszusammenhang behaupten, dass sich ein Drittel der Knaben und ein Viertel der Mädchen mindestens ein- bis zweimal im Monat so betrinken, dass sie auch tatsächlich betrunken sind. Beide, also sowohl junge Männer als auch Frauen, haben ihre erste Alkoholerfahrung mit knapp 13 Jahren und das erste Rauschgefühl mit etwa 14 Jahren (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.45 (15. 3.2009)). 23 2.4. Sport und Bewegung Die Ernährung und das Sport- und Bewegungsverhalten sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Ausreichende körperliche Aktivität beugt Krankheiten vor, erhöht die Lebensqualität und begünstigt die körperliche und geistige Gesundheit. Diese Vorteile treffen nicht nur auf den erwachsenen Menschen zu, sondern auch auf den jungen. Spaß und Freude an Bewegung und Sport sind bei Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ausgeprägt (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.30 (15. 3.2009)). Demnach sind die Motivation und Bestärkung durch die Eltern, Geschwister und FreundInnen wesentlich (Sallis et al. 1999, zit. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.30 nach (15. 3.2009)). Kleinere Kinder üben Sport meistens überwiegend mit ihren Eltern und Geschwistern aus, während ab dem 10. Lebensjahr Freunde und Freundinnen als SportpartnerInnen bevorzugt werden. Es konnte auch festgestellt werden, dass Kinder und Jugendliche aus schlechteren sozialen Lagen sich weniger für Sport interessieren als jene aus günstigeren Verhältnissen (Brinkhoff 1998, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.187). Ergebnisse der Studie zur Gesundheit der österreichischen SchülerInnen im Lebenszusammenhang (2006, S.31) zeigen, dass Mädchen und Burschen an circa vier Tagen körperlich aktiv sind, wobei sich Knaben öfters sportlich betätigen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Begeisterung für körperliche Aktivität bei beiden Geschlechtern ab, wobei sich die Abnahme bei den Schülerinnen drastischer vollzieht. Betrachtet man das Bewegungsverhalten in der Freizeit, so ergeben sich folgende Daten: 25% betätigen sich täglich, wobei es bei den Mädchen nur 15.6% sind. Das zeigt, dass weibliche Jugendliche ein ungünstigeres Bewegungsverhalten aufweisen als männliche. Freizeitliche Aktivitäten nehmen ebenfalls mit dem Alter ab (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.31 (15. 3.2009)). Hinsichtlich der Dauer der Aktivitäten zeigt sich, dass die Mehrheit der Jugendlichen (Burschen 43,4%, Mädchen 58,8%) weniger als zwei Stunden pro Woche Sport treiben. Dass mit zunehmenden Alter die Wochenstunden abnehmen, an denen junge Männer und Frauen körperlich aktiv sind, kann nicht bestätigt werden (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.32 (15. 3.2009)). Mädchen und Knaben haben jedoch nicht nur ein unterschiedliches Interesse an Bewegung, sondern auch unterschiedliche Motivationshintergründe. Junge Frauen betreiben Sport, um ihr Körperbild zu gestalten beziehungsweise aufrechtzuerhalten, ihr 24 Gewicht zu kontrollieren und ihre Attraktivität zu fördern. Junge Männer haben eine andere Sportmotivation. Sie trainieren, um sich körperlich fit zu halten und leistungsfähiger zu werden (Brettschneider & Brandl-Bredenbeck 1997, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.187). Die bisher beschriebenen Daten verdeutlichen, dass Frauen im Sport unterrepräsentiert sind. Sie betreiben jedoch nicht nur weniger Sport, sondern sind auch in Sportvereinen, in den Führungsebenen von Vereinen und Verbänden seltener vertreten. Im Hochleistungssport haben Frauen auch heute noch –verglichen mit den Männernnicht denselben Zugang zu verschiedenen Sportarten (vgl. Baldaszti & Urbas 2006, S.228f). Ein Grund für die geringe körperliche Aktivität von jungen Menschen ist das sitzende Verhalten. Kinder und Jugendliche verbringen den größten Teil des Tages bewegungslos. Sie sitzen in der Schule, zuhause bei den Hausaufgaben und später vor dem Fernseher oder Computer (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.33 (15. 3.2009)). Folglich hat das viele Sitzen im Gegenteil zu ausreichender Bewegung einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. In Kombination mit einer hohen Kalorienzufuhr, kann der Bewegungsmangel schwerwiegende physiologische Folgen haben. Neben körperlichen Folgen treten noch psychologische Konsequenzen wie Unausgeglichenheit, Unruhe, Nervosität, Depression und andere auf (Strong et al. 2005; Lucas & Platts-Mills 2005, zit. nach http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.32 (15. 3.2009)). Der Geschlechtervergleich zeigt, dass Burschen mehr vor dem Fernseher sitzen als Mädchen, die dies an Schultagen rund 2,1 Stunden tun. An schulfreien Tagen fernsehen Kinder und Jugendliche circa eine Stunde mehr. Im Altersvergleich der 11-, 13- und 15-jährigen ÖsterreicherInnen lässt sich erkennen, dass 13-Jährige am meisten Zeit vor dem Fernseher verbringen. Ebenso verhält es sich mit der Zeit, die Kinder und Jugendliche dem Computer und anderen Spielkonsolen opfern. An schulfreien Tagen werden diese Geräte häufiger genutzt als an Schultagen und Burschen verbringen damit mehr Zeit als Mädchen. Im Altersvergleich haben auch bei der Computernutzung die 13-Jährigen die Nase vorne. Computer werden jedoch nicht nur zum spielen verwendet, sondern beispielsweise auch zum chatten, um Emails zu verschicken oder Hausaufgaben zu machen. An Schultagen wird weniger Zeit in diese Art der Computernutzung investiert, während es an schulfreien Tagen mehr ist. Im Vergleich zum Fernsehen oder dem Computerspielen gibt beim Chatten, Email schreiben und Hausaufgaben machen mittels PC keine großen Geschlechtsunterschiede (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.33ff (15. 3.2009)). 25 2.5. Körperwahrnehmung Die Körperwahrnehmung ist ein Teil unseres Körperbildes, das aus den Erfahrungen unserer Sinne mit dem Körper und den damit verbundenen angenehmen oder unangenehmen Empfindungen entsteht. Dieses Bild wird auch von den Reaktionen der Bezugspersonen und durch die Vorstellung und Bewertung des eigenen Leibes, die sich mit der Sprachentwicklung mit bilden, geprägt. Das eigene Körperbild entsteht im zweiten Lebensjahr. In dieser Zeit beginnt sich auch bereits die Geschlechtsidentität zu entwickeln, die sich dann erst am Ende der Pubertät völlig festigt (vgl. Rieder & Lohff 2008, S.95f). In der Adoleszenz ist besonders bei Mädchen die Kluft zwischen ihrem wahrgenommen Selbst und dem erträumten Idealselbst sehr groß. Deshalb haben sie auch ein geringeres Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl als Knaben in diesem Alter (Kearney-Cooke 1999, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.96f). Störungen des Körperbildes oder der Körperwahrnehmung bei Jungen und Mädchen können schließlich zu psychosomatischen Erkrankungen wie Essstörungen führen (Sack et al. 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S. 98). Besonders in der Pubertät werden Jugendliche auf ihren Körper aufmerksam, da nun viele starke körperliche Veränderungen stattfinden. So verändern sich die Größe, die Proportionen und der Aufbau des Körpers. Vor allem Mädchen beobachten das Geschehen kritisch und sind eher unzufrieden mit dem was sie sehen, wobei Knaben eine positivere Einstellung zu den Vorgängen und ihrem Erscheinungsbild haben (Swarr & Richards 1996; O’Dea & Abraham 1999; Ge et al. 2001; Németh et al. 2002, zit. nach http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.25 (16. 3.2009)). Die Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinflusst einerseits unser Ernährungs- und Bewegungsverhalten, andererseits hat es auch einen erheblichen Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden (Siegel et al. 1999; Mendelson et al. 2000; Williams & Currie 2000, Ge et al. 2001, zit. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.25 nach (16. 3.2009)). Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten ihren eigenen Körper richtig einzuschätzen und versuchen Idealmaße durch zu erreichen, die sie objektiv gesehen meistens schon haben (Kilpatrick et al. 1999 http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.25 zit. nach (16. 3.2009)). Dieser Versuch äußert sich bei Knaben im Aufbau von Muskelmasse, um einen muskulösen Körper mit breiten Schultern zu erlangen, bei Mädchen im Diäthalten, die Einnahme von synthetischen Substanzen, einseitiger und unausgewogener Ernährung, 26 um einen schlanken, vorpubertären Körper zu bekommen (McCabe et al. 2002, zit. nach http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.25 (16. 3. 2009)). Obwohl 83,3% der in der Studie zur Gesundheit der österreichischen SchülerInnen im Zusammenhang (2006, S.26f) befragten Burschen und 91,6% der befragten Mädchen normal gewichtig sind, finden sich jedoch circa 50% zu dick, wobei junge Männer ein wenig zufriedener mit ihrem Körpergewicht sind als junge Frauen. Mit zunehmendem Alter nimmt das Gefühl dick zu sein bei beiden Geschlechtern zu, insbesondere aber bei Mädchen. 3. Psychosomatische Störungen Psychosomatische Störungen wie Essstörungen sind oft eine Folge von Störungen des Körperbildes. So schätzen zum Beispiel Personen, die an Anorexie erkrankt sind, ihren Körperumfang und ihr Körpergewicht völlig falsch ein (Sack et al. 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S. 98). Säuglinge und Kleinkinder drücken Missstimmung stets über ihren Körper aus. Auch bei älteren Kindern wird der Körper zum Ausdruckmedium für psychische Probleme wie zum Beispiel durch Appetitlosigkeit (Panhuysen & Lehmkuhl 1997, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.101). Jugendliche nutzen ihren Körper als Instrument, um Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. Mädchen tun dies ab der Pubertät vier Mal mehr als Burschen. Die häufigste psychosomatische Störung bei jungen Frauen ist die Essstörung. Während die Magersucht bereits in der Kindheit oder in der frühen Adoleszenz auftreten kann, entsteht Bulimie meistens erst im späteren Jugendalter und kann sogar eine Folge von Anorexia Nervosa sein. Für Essattacken (Binge Eating Disorder) liegen keine genaueren Angaben zu Entstehungszeitpunkt vor. Knaben leiden in ihrer Kindheit häufiger an Adipositas als Mädchen. Im Jugendalter neigen sie zu intensivem Alkoholkonsum (Bürgin 1993, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S. 101f). Bei jungen Männern kommt außerdem eine Störung vor, die als „reverse anorexia“ bezeichnet wird. Knaben mit dieser Störung behaupten von sich, dass sie einen Mangel an Fett- und Muskelmasse haben (Andersen 1999, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.102). 27 3.1. Diätverhalten Während sich junge Männer wie beim Extremfall „reverse anorexia“ für zu dünn halten, finden junge Frauen, dass sie zu dick sind. Die Lösung für sogenannte überschüssige Pfunde ist die Diät. So haben zum Beispiel bereits 80 Prozent der Frauen unter 18 in Großbritannien schon einmal Diät gehalten (vgl. Giddens 1999, S. 127). Egal ob in Zeitschriften, im Fernsehen, im Internet, per Postsendung, beim Kaffeekränzchen mit den Freundinnen- überall werden die neuesten Produkte oder Methoden, um Überschüssiges loszuwerden, angeboten und diskutiert. Ob bestimmte Verfahren tatsächlich zum Wunschgewicht oder schließlich doch nur zu dem gefürchteten „Jojo-Effekt“ führen, sei dahingestellt. Wichtig ist vor allem, so schnell und viel wie möglich an Gewicht zu verlieren und dem „Ideal“ zu entsprechen. Besonders junge Frauen versuchen Idealmaße mittels Diäten zu erreichen. Mädchen sind unzufriedener mit ihrem Körper als Burschen und machen deshalb auch öfters eine Diät. Mit zunehmendem Alter versuchen junge Frauen schließlich noch öfters mittels Diäthalten ihr Wunschgewicht zu erreichen, während junge Männer mit ihrem Körper zunehmend zufriedener werden. Diese steigende Unzufriedenheit der Mädchen beziehungsweise die Zufriedenheit der Burschen hängt vermutlich damit zusammen, dass männliche Jugendliche mit zunehmendem Alter ihrem Schönheitsideal durch die Zunahme am Muskeln immer mehr entsprechen, während sich weibliche Jugendliche durch die Ausbildung von Rundungen und Kurven sich weiter von ihrem schlanken Idealkörper entfernen. Die subjektiven Idealmaße von Mädchen entsprechen jedoch oft nicht dem Normalgewicht und können daher erste Vorzeichen für Essstörungen sein (vgl. Kolip & Schmidt 1999, S.28f). 3.2. Essstörungen Essstörungen sind psychosomatische Erkrankungen, bei denen der oder die Betroffene versucht durch andauerndes gezügeltes Essverhalten oder durch den Missbrauch von Appetitzüglern und Abführmitteln oder durch selbstinduziertes Erbrechen an Gewicht zu verlieren. Dieses Verhalten führt schließlich zu einer psychischen und physischen Sucht (Gerlinghoff 1996, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.185). Essstörungen treten vor allem in Industrieländern auf, wo die Lebensbedürfnisse gedeckt werden und sogar ein Lebensmittelüberfluss herrscht (Rathner & Rainer 1997, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.135) und betreffen größtenteils die Mittel- und Oberschicht. Sie entstehen aufgrund 28 verschiedener Faktoren wie sozialen, soziokulturellen, psychodynamischen und biologischen und ermöglichen dem Betroffenen seine psychosoziale Probleme oder Konflikte innerhalb der Familie zu verarbeiten (Holtkamp & Herpertz-Dahlmann 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.102). Mögliche Risikofaktoren für Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen sind Selbstzweifel, ein geringes Selbstwertgefühl, Spannungen in der Familie, Trennungserfahrungen, Druck durch Gleichaltrige (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2004, S.11). Bei Jungen ist auch die sexuelle Orientierung ein möglicher Risikofaktor. Circa 20% der betroffenen jungen Männer sind homosexuell (Andersen 1999, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.102). Essstörungen treten außerdem fast immer mit anderen Erkrankungen wie Depressionen, Ängstlichkeit und Zwängen auf (Holtkamp & Herpertz-Dahlmann 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.102) und sind gewöhnlich „die Spitze des Eisbergs von seelischen und zwischenmenschlichen Problemen“ (Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.32). Betroffene schämen sich auch oft für ihr Verhalten und versuchen ihre Störung vor anderen geheim zu halten, was für sie sehr belastend sein kann (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2004, S.10). 3.2.1. Säuglinge und Kinder Wie schon bereits erwähnt, äußern Säuglinge und Kinder, da sie sich noch nicht mittels Worte ausdrücken können, psychische Konflikte mit ihrem Körper. Eine Essstörung, die im Säuglings- und Kindesalter auftritt, ist die Pica. Dabei handelt es sich um eine Störung, bei der Kinder über mindestens einen Monat ungenießbare Materialien wie Abfälle, Schmutz, Kot, Sand, Insekten, Steine und so weiter zu sich nehmen, was schließlich zu Infektionen und Vergiftungen führen kann. Die Pica verschwindet im Laufe der Kindheit wieder und tritt vor allem bei Kindern mit geister Behinderung oder vernachlässigter Erziehung auf (vgl. Kiefer, Schoberger & Kunze 1996, S.139). Eine weitere Essstörung ist die Rumination bei Säuglingen. Diese würgen die Nahrung bewusst herauf, kauen sie anschließende erneut, um sie dann hinterzuschlucken oder auszuspucken. Durch die verminderte Nahrungszufuhr nehmen die Säuglinge nicht an Gewicht zu oder nehmen sogar ab, was im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Meistens klingen Ruminationsstörungen aber spontan ab. Sowohl Pica als auch Rumination werden mit Verhaltenstherapie behandelt. Auch die Mütter werden in die Therapie miteinbezogen, so dass sie ihre Ängste abbauen können und lernen, auf die Bedürfnisse ihrer Sprösslinge einzugehen (vgl. Kiefer, Schoberger & Kunze 1996, S.140). 29 Zu den Essstörungen bei Säuglingen und Kindern zählen auch die Appetitlosigkeit und die Essverweigerung. Beide Störungen treten vor allem bei Kindern zum Zeitpunkt des Schuleintrittes auf und gehen oft mit Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen einher. Um psychologische Ursachen aufdecken zu können, müssen vorerst organische Ursachen ausgeschlossen werden. Eine ärztliche Untersuchung soll Aufschluss über Infektionen, Missbildungen des Verdauungstraktes oder Verletzungen geben, die ebenfalls zu Appetitlosigkeit und Essverweigerung führen können. Können keine organischen Ursachen gefunden werden, so ist anzunehmen, dass die Störung eine Ausdrucksmedium für psychische Belastungen ist. So kann eine ausgeprägte Schulangst oder der Leistungsdruck eine Appetitlosigkeit hervorrufen. Ebenso kann das Gefühl, von – insbesondere- der Mutter nicht genug Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen, der Grund für eine Essverweigerung sein. Durch zum Beispiel Trödeln beim Essen zwingt das Kind die Mutter sich ganz ihm zuzuwenden und erhält somit die ersehnte Aufmerksamkeit. Das Essen sollte jedoch kein erzieherisches Übungsfeld darstellen. Unter Einwirken von Erziehungsmethoden der Eltern kann es geschehen, dass sich das Kind vollstopfen lässt und dick wird, dass es das Essen weiterhin strikt verweigert oder sein Verhalten zwar am Esstisch gebrochen wird, es jedoch dann andere Fehlverhalten wie zum Beispiel Schlafstörungen entwickelt (vgl. Kiefer, Schoberger & Kunze 1996, S.141f). 3.2.2. Jugendliche Das Jugendalter stellt für viele Mädchen und Burschen eine kritische Phase dar, in der sich der Körper sehr stark verändert. Wie schon bereits erwähnt, wirkt sich eine frühe geschlechtliche Reife auf Jugendliche unterschiedlich aus. Während Knaben die Veränderungen als positiv erleben und deshalb mehr Selbstsicherheit erlangen, hat die Geschlechtsreife für die Mädchen oft eher negative Folgen. Nicht selten kommt es bei Mädchen zu Konflikten mit den Eltern und in der Schule, verfrühtem Geschlechtsverkehr und Drogen- und Alkoholabusus (Brooks-Gunn 1987, zit. nach Schwenkmezger & Schmidt 1994, S. 36). Auch die schulischen Anstrengungen hinterlassen im Jugendalter deutliche Spuren, die sich in Schlafstörungen, Appetitmangel, Magenbeschwerde und Kreislaufbeschwerden äußern (Mansel, Hurrelmann & Wlodarek 1991, zit. nach Schwenkmezger & Schmidt 1994, S. 36). Die Essstörungen, die im Jugendalter am häufigsten auftreten, sind die Anorexia Nervosa in der Pubertät und die erst später entstehende Bulimia Nervosa (vgl. Hurrelmann & Kolip 2002, S.362) 30 3.3. Formen von Essstörungen Im folgenden Kapitel „Formen der Essstörungen“ möchte ich näher auf die einzelnen Erkrankungen eingehen. 3.3.1. Magersucht (Anorexia Nervosa) Die Magersucht ist eine Form der Essstörung und wird auch als Anorexia Nervosa bezeichnet, was aus dem Griechischen übersetzt „psychisch bedingte Appetitlosigkeit“ bedeutet (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.18). Magersüchtige haben die höchste Mortalitätsrate unter den psychosomatisch Erkrankten. Circa 10% sterben an den Folgen ihrer Sucht, 30% werden geheilt und 60% weisen eine Komorbidität mit weitern psychischen Störungen auf (Munsch 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Anorexia nervosa und das Geschlecht Die Anorexia Nervosa tritt besonders in der Pubertät und bei 0.7- 1% der 15- bis 35jährigen Frauen aus der Mittel- und Oberschicht auf. Nur 1% der Erkrankten sind Männer (Munsch 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.135). Gründe für diese Verteilung unter den Geschlechtern können folgende Faktoren sein: Ein Einflussfaktor für die Entstehung der Geschlechtsverteilung bei Magersucht ist die geringere Stellung und Rolle der Frau im Vergleich zum Mann (Petzold 1980, S.131, zit. nach Delesen 1997, S. 70). Auch das derzeitige Schönheitsideal veranlasst vor allem Frauen und insbesondere Mädchen zu hungern, um den mageren und von ihnen als schön empfundenen Gestalten nachzueifern (Pflanz 1965, S.148, zit. nach Delesen 1997, S. 71). Der Einflussfaktor Familie spielt im Zusammenhang mit Anorexia Nervosa und der Geschlechtsverteilung der Erkrankung ebenfalls eine wesentliche Rolle. Töchter werden in der Familie in ihrer Autonomie und Selbstständigkeit eher eingeschränkt als Söhne, die meistens mehr Freiheiten genießen (Arz & Kloos 1983, S.149; Mester 1981, S.245 zit. nach Delesen 1997, S. 71). Außerdem sind Mütter, die heiraten und schließlich in Abhängigkeit zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin stehen, für ihre Töchter oft kein nachzueiferndes Vorbild (Bruch 1982, S.45ff; Krebs 1987b; Mester 1981, S.245ff; Winkels 1991, zit. nach Delesen 1997, S. 71). Diese Abhängigkeit betrifft sowohl die Bindung zum Mann als auch die zu einem Kind (Mester 1981, S. 245, zit. nach Delesen 1997, S. 71). 31 Ein weiterer Einflussfaktor ist der sexuelle Missbrauch, der bei 50- 80% der Opfer zu einer Suchterkrankung führt. Mädchen werden häufiger missbraucht als Jungen (Krebs 1987a; Merfert-Diete, S.50, zit. nach Delesen 1997, S. 71). Auch der Faktor Pubertät hat einen entscheidenden Einfluss. Der Körper des Mädchens verändert sich drastischer und früher als der der Knaben, die diesen Wandel eher als angenehm empfinden. Die körperlichen Veränderungen lösen bei jungen Frauen Ängste und Unsicherheiten aus, die zur Flucht in die Magersucht führen können (Mester 1981, S.245, zit. nach Delesen 1997, S. 71). Auch der Umgang mit Stresssituationen unterscheidet sich zwischen Mann und Frau. Weibliche Personen reagieren auf Stress und Belastung eher mit Appetitverlust als männliche (Mester 1981, S. 243, zit. nach Delesen 1997, S. 72). Die Symptome Anorexia Nervosa –Erkrankte haben einerseits starke körperliche Symptome, andererseits auch enorme psychische. Zu den physischen Symptomen gehört ein BMI (Body Mass Index) von weniger als 17,5. Das entspricht einer 15-prozentigen Abweichung von dem normalen Körpergewicht. Außerdem rufen sie durch verschiedenste Methoden wie Vermeidung hochkalorischer Speisen, selbst induziertes Erbrechen, Einnahme von Abführmitteln, Entwässerungsmitteln, Appetitzüglern oder/ und durch übermäßige körperliche Aktivität einen Gewichtsverlust hervor. Magersüchtige haben nicht nur eine Störung des Körperschemas, wonach sie der festen Meinung sind, zu dick zu sein, sondern auch eine hormonbedingte Störung. So kommt es bei weiblichen Erkrankten zum Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhö), bei männlichen zum Verlust der Libido oder Potenz. Tritt die Erkrankung bereits vor der Pubertät ein, kann es auch zu einer Entwicklungs- inklusive Wachstumsstörung kommen (Schek 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.135f). Die Anorexia Nervosa hinterlässt deutliche Spuren auf ihren Opfern. Die Erkrankten leiden an einer Vielzahl von Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel Kreislaufregulations- und Durchblutungsstörungen, Knochenstoffwechselstörungen, Störungen des Säure-Basen-Haushaltes, Polyneuropathien, Elektrolytstörungen und viele mehr und haben oft eine Lanugobehaarung (Munsch 2002, zit. nach Rieder & Lohff (2008), S.136). Neben diesen körperlichen Symptomen und Folgeerscheinungen, treten auch eine Vielzahl psychischer Erkrankungsmerkmale auf. Wie schon bereits erwähnt haben Magersüchtige eine Körperschemastörung. Auffällig sind auch ihr außergewöhnliches Essverhalten und die ständige Beschäftigung mit Nahrung. Zudem streben die Erkrankten 32 ständig mittels verschiedener Methoden danach, Gewicht zu verlieren (Munsch 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Auf den Gewichtsverlust sind sie anschließend sehr stolz (Schmitt 1987, S.129ff; Selvini-Palazzoli 1984, S.48, zit. nach Delesen 1997, S.56). Ein weiteres Symptom ist die Wahrnehmungsstörung hinsichtlich der Körpersignale. So fühlen sich Magersüchtige schon nach einer sehr geringen Menge an Nahrung voll gegessen. Die Erkrankten weisen auch starke Selbstwertprobleme, psychosoziale und sexuelle Probleme, Depressionen und eine ausgeprägte Leistungsorientierung auf (Munsch 2002, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Ebenfalls typisch für Magersüchtige ist die fehlende Krankheitseinsicht, folglich auch die Einsichtslosigkeit für die Schwere ihres Zustandes und die Zurückweisung jeglicher Hilfe (Schmitt 1987; S.129ff, SelviniPalazzoli 1984, S.48, zit. nach Delesen 1997, S.56). Die Ursachen Die Anorexia Nervosa kann wie alle Essstörungen nicht auf eine einzige Ursache zurückgeführt werden, sondern entwickelt sich aufgrund einer Vielzahl von Auslösern. Ursachen sind zumeist kritische Lebensphasen. So können verschiedene Anforderungen wie in etwa die Suche nach der eigenen Identität, die Ablösung von den Eltern, die Übernahme von mehr Verantwortung, der Aufbau von Beziehungen außerhalb der Familie, sexueller Missbrauch in der Kindheit und viele andere Auslöser das Ernährungsverhalten der Jugendlichen so drastisch beeinflussen, dass sie sich in die Magersucht flüchten (Gerlinghoff & Backmund 1989, S.15ff, zit. nach Delesen 1997, S.73). Atypische Anorexia Nervosa Von einer atypischen Anorexia Nervosa spricht man, wenn nicht alle Kriterien der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) erfüllt werden. So haben zum Beispiel Betroffene ein eingeschränktes Essverhalten, eine Körperschemastörung, aber sie unterschreiten den BMI von 17,5 nicht (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.21). 3.3.2. Bulimia Nervosa Die Bulimia Nervosa ist eine weitere Essstörung und wird aus dem Griechischen mit „psychisch bedingter Ochsenhunger“ übersetzt. Oft wird sie Ess-Brech-Sucht genannt, wobei es nicht unbedingt sein muss, dass das Erbrechen ein auch tatsächlich auftretendes 33 Symptom ist (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.22). Die Bulimia Nervosa kann eine Folgeerkrankung der Anorexia Nervosa sein (Schek 2002; De Zwaan & Schüssler 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.137). Bulimia Nervosa und das Geschlecht Die Erkrankungsrate der Bulimia Nervosa ist höher als die der Magersucht. Circa 1- 2% der 15- bis 35- jährigen Frauen leiden an dieser Essstörung, wobei bei den Männern nur 0,1% davon betroffen sind (Zipfer et al. 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Man kann aber von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen, da die Bulimia Nervosa in unserer Gesellschaft tabuisiert wird und auch die Betroffenen stets darum bemüht sind, ihre Erkrankung zu verheimlichen. Außerdem ist diese Form der Essstörung weniger augenscheinlich als die Anorexia Nervosa, was zu einer wahrscheinlich höheren Dunkelziffer als die der Magersucht führt (Rathner & Rainer 1997, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Die Symptome Zu den Symptomen der sogenannten Ess-Brech-Sucht zählen vor allem die ständige Beschäftigung mit Essen und die Heißhungerattacken, bei der in kürzester Zeit riesige Mengen an Nahrung verzehrt werden (Schek 2002; De Zwaan & Schüssler 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Diese Nahrungsmengen werden ohne jegliche Kontrolle und Steuerung, ohne Lust am Essen und im Geheimen beziehungsweise ohne Anwesenheit von Anderen verschlungen. Wenn bulimische Personen mit anderen gemeinsam essen, nehmen sie meistens nur wenig oder normale Mengen zu sich. Die Betroffenen spüren oft kein Gefühl von Hunger und Sättigung und verzehren vor allem hochkalorische Lebensmittel (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.22f). Die Betroffenen haben anschließend eine schreckliche Angst davor zuzunehmen und setzten sich selbst eine Gewichtsgrenze, die oft unter einem gesunden Gewicht liegt. Um einer Zunahme entgegenzuwirken, entwickeln die Erkrankten verschiedene Methoden, um die verschlungenen Mengen wieder loszuwerden. Dazu gehören selbstinduziertes Erbrechen, zeitweilige Hungerperioden, der Missbrauch von Abführmitteln, Appetitzüglern, Entwässerungsmitteln und Schilddrüsenpräparaten. Diabetes mellitus Typ 1- PatientInnen reduzieren sogar ihre Insulindosis (Schek 2002; De Zwaan & Schüssler 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136f). Auch exzessives Sporttreiben gehört zu den Maßnahmen, 34 um Körpergewicht zu verlieren. Nach diesen Maßnahmen fühlen sich BulimikerInnen so, als hätten sie einerseits die Kontrolle über ihr Essverhalten wiedererlangt, aber andererseits schämen sie sich auch für ihr Verhalten. Manchmal wird Gegessenes auch bereits automatisch erbrochen. Bulimische junge Frauen und Männer sind zumeist normalgewichtig, können aber auch leicht unter- oder übergewichtig sein. Betroffene finden sich entweder insgesamt zu dick oder nur an bestimmten Stellen. Jedoch ist die gestörte Körperwahrnehmung nicht so stark ausgeprägt wie die der Magersüchtigen. Die Betroffenen der Bulimia Nervosa leiden aufgrund ihres gestörten Essverhaltens oft an Scham- und Schuldgefühlen, haben ein geringes Selbstwertgefühl, fühlen sich abnorm und ekeln sich vor sich selbst. Oft kommt es auch zu Depressionen (vgl. Reich, GötzKühne & Killius 2004, S.23f). Die Folgeerscheinungen, Elektrolytenentgleisung, die diese Essstörung Herzrhythmusstörungen, mit Karies, sich bringt, sind Komorbidität und Persönlichkeitsstörungen (Zipfel et al. 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.137). Die Ursachen Die Bulimia Nervosa entwickelt sich aufgrund vieler verschiedener Faktoren. Eine wesentliche Rolle spielen biografischen Faktoren wie Trennungserfahrungen, Probleme innerhalb der Familie und sexueller Missbrauch (Zipfel et al. 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.136). Atypische Bulimia Nervosa Von einer atypischen Bulimia Nervosa spricht man, wenn die ersten drei der zehn Kriterien der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (International Classifikation of Diseases, ICD-10) nicht vollständig erfüllt werden. Eine atypische Bulimia Nervosa wäre dann zum Beispiel, wenn sich die Betroffenen nicht ständig oder nur zu bestimmten Zeiten übermäßig mit Essen beschäftigen und auch nicht regelmäßig erbrechen (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.24). 3.3.3. Binge Eating Disorder Bei der Binge-Eating- Störung kommt es zu krankhaften Essanfällen, bei denen in kurzer Zeit enorme Nahrungsmengen verschlungen werden. Die Betroffenen, circa 6% der 35 Bevölkerung (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.27), verlieren dabei das Gefühl von Kontrolle (Zipfel et al. 2000, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.137). Binge Eating Disorder und das Geschlecht Verglichen mit der Anorexia Nervosa und der Bulimia Nervosa gibt es keine starke Geschlechtsverteilung, was bedeutet, dass auch Männer in größerer Zahl davon betroffen sind (Zipfel et al. 2000; Kinzl et al. 1998a, zit. nach Rieder & Lohff 2008, S.137). Insgesamt betrifft die Binge-Eating-Störung 3- 5% der Bevölkerung und unter adipösen Personen ist sie bis zu 30% verbreitet. Die Symptome Die Betroffenen haben enorme Fressattacken mit Kontrollverlust und sind sich unsicher, ob ihr Verhalten normal ist oder nicht. Sie beschäftigen sich sehr stark mit dem Essen und hatten meistens auch schon in der Kindheit Probleme mit der Ernährung. Oft sind sie leicht bis stark übergewichtig. Die Betroffenen hassen ihren Körper und verachten sich selbst. Laut dem diagnostischen und statistischen Handbuch für seelische Störungen (DSM-IV) essen die Erkrankten schneller als normal und solange bis sie ein unangenehmes Völlegefühl erreicht haben. Gegessen wir auch ohne Hungergefühl und meistens alleine, da sich die Betroffenen wegen ihres Verhaltens schämen. Der Fressattacke folgt dann ein Gefühl von Ekel, Deprimiertheit und starker Schuld. Erbrechen oder Fasten kommen bei der Binge-Eating-Störung nicht vor. Die Attacken treten in einem Zeitraum von sechs Monaten mindestens zweimal wöchentlich auf (vgl. Reich, Götz-Kühne & Killius 2004, S.24f). 3.3.4. Sonstige Essstörungen Zu den sonstigen Essstörungen gehören die atypische Bulimia Nervosa sowie die atypische Anorexia Nervosa und alle Essstörungen, bei denen nur einzelne Merkmale der Störungen vorhanden sind, Ein Beispiel wäre in etwa, dass eine normalgewichtige Person nach der Zufuhr von geringen Nahrungsmengen regelmäßig erbricht (vgl. Reich, GötzKühne & Killius 2004, S.26f). 36 3.4. Fettsucht (Adipositas) Als Fettsucht oder Adipositas wird die übermäßige Zunahme von Körperfett bezeichnet. Man nimmt an, dass circa 20 bis 30% der Bevölkerung adipös sind (vgl. Stahr 1999, zit. nach Hurrelmann & Kolip 2002, S.185). Kindern und Jugendliche leiden vor allem im ersten Lebensjahr, zwischen dem 4. und 11. Lebensjahr und in der Pubertät an der Fettsucht (Bray 1992; Dordel et al. 2003; Bös et al. 2002, zit. nach Hensler 2006, S.19). Die eindeutige Definition der Adipositas im Kindes- und Jugendalter fällt jedoch schwer, da die Fettanteile im Zusammenhang mit dem Alter und dem Geschlecht oft schwanken, und orientiert sich deshalb an alters- und geschlechtsspezifischen Perzentilen. Vor allem Mädchen leiden in der Pubertät an der Zunahme der Fettanteile. Knaben verlieren in dieser Phase an Fett (Wirth 2000, S.307, zit. nach Hensler 2006, S.19). Adipositas und das Geschlecht Betrachtet man die Geschlechtsverteilung, so zeigt sich laut der Studie zur Gesundheit der Österreichischen Jugendliche SchülerInnen (7,2%) als im Lebenszusammenhang, weibliche (1,1%) von dass Adipositas mehr betroffen männliche sind (vgl. http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, S.26 (26. 3.2009)). In höheren Altersklassen leiden jedoch mehr Frauen an Adipositas (vgl. Hurrelmann & Kolip 2002, S.253). Die Symptome Charakteristisch für die Fettsucht sind das Übergewicht, eine regelmäßige und übermäßige Nahrungszufuhr, Fressattacken und das häufige Diätverhalten, um den Nahrungsunmengen entgegenzuwirken. Folgeerscheinungen der Adipositas sind sowohl organisch als auch psychosozial (Wirth 2002, zit. nach Hensler 2006, S.32). Adipöse Kinder und Jugendliche haben eine höhere Komorbidität und auch ein erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko im Erwachsenenalter (Treanckner et al. 1997, zit. nach Hensler 2006, S.32). Auffällig ist auch, dass adipöse Jugendliche mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 bis 80% auch als Erwachsenen an Adipositas leiden, während ein Zusammenhang mit dem Erwachsenenalter bei adipösen Säuglingen und Kindern nicht besteht (vgl. Wechsler 2003, S.221). Organische Folgen sind zum Beispiel Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus Typ II, Fettleber, Insulinresistenz und viele mehr (Wabitsch et al. 2002, zit. nach Hensler 2006, 37 S.32). Psychosoziale Konsequenzen sind ein erniedrigtes Selbstwertgefühl und ein verzerrtes Selbstbild, das vor allem bei Mädchen verstärkt auftritt. Auch Depressionen, Isolation und ein gestörtes Verhältnis zum Körper sind mögliche Symptome (Kolbe & Weyrheter 2003, zit. nach Hensler 2006, S.34). Auch die Beeinträchtigung in Schule und Beruf zählt zu den Folgen der Adipositas, da zum Beispiel LehrerInnen dicke SchülerInnen schlechter beurteilen als normalgewichtige Kinder (Wirth 1998; Wirth 2000, zit. nach Hensler 2006, S.35). Außerdem sind übergewichtige Kinder unbeliebter als andere (Kolbe & Weyrheter 2003, zit. nach Hensler 2006, S.34) und negative Eigenschaften wie Dummheit, Faulheit, Vergesslichkeit und so weiter werden mit dem Dicksein assoziiert (Wirth 2000, S.86, zit. nach Hensler 2006, S.35). Die Ursachen Die Entstehung der Fettsucht ist wie bei allen anderen Essstörungen multifaktoriell. Ein wichtiger Einflussfaktor sind die Gene, denn Übergewicht wird zu 30 bis 50% vererbt (Wirth 2000, zit. nach Hensler 2006, S.25). Auch psychologische und psychosoziale Faktoren spielen eine wesentliche Rolle. Kinder und Jugendliche übernehmen nämlich das Ess-, Trink- und Bewegungsverhalten ihrer Eltern. Außerdem sind das Klima innerhalb der Familie und die gemeinsam verbrachte Zeit von großer Bedeutung (Kolbe & Weyrheter 2003, zit. nach Hensler 2006, S.27). So neigen Kinder, die von ihren Eltern weniger Unterstützung erfahren, und die, die in der Schule Lernschwierigkeiten aufweisen und Konflikte mit Gleichaltrigen haben, eher zu Übergewicht als andere (Wirth 2002, zit. nach Hensler 2006, S.27). Nicht zu unterschätzen sind auch Begleiterkrankungen wie Depressionen, die entweder eine Ursache oder eine Folge der Adipositas sein können. So wird das Essen zur Methode, um sich selbst aufzuheitern (Benecke et al. 2003, zit. nach Hensler 2006, S.27). Zudem lässt essen Gefühle wie Langeweile, Frust und Einsamkeit verschwinden (Kolbe et al. 2003, zit. nach Hensler 2006, S.29). Bevorzugte Lebensmittel sind Kohlenhydrate und Schokolade, da sie die Synthese des Glückshormones Serotonin steigern (Wurtman, Growdown & Henry 1981, zit. nach Friedli 2006, S.26). Der sozioökonomische Status spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle. So wurde gezeigt, dass die Mehrheit der adipösen Kinder aus niedriger sozialer Schicht stammen (Ellsäßer et al. 2002, zit. nach Hensler 2006, S.27). Gründe dafür sind, dass Übergewicht in oberen sozialen Schichten stärker abgelehnt wird und dass mehr Aufwand, um schlank zu sein, betrieben wird. Niedrigere soziale Schichten kaufen aufgrund eines Geldmangels eher ungesündere Nahrungsmittel wie Konserven und Fertiggerichte, was 38 ebenfalls zur Entstehung von Adipositas beitragen kann (Benecke et al. 2003, zit. nach Hensler 2006, S.27). Äußere Lebensumstände wie Armut, Arbeitslosigkeit, Instabilität in der Familie, schlechte Wohnverhältnisse, Ausgrenzung und Zugehörigkeit zu einer Minderheit, aber auch ungünstige familiäre Bedingungen wie Unerwünschtheit des Kindes, Vernachlässigung, psychische Erkrankung der Eltern, Gewalt und Missbrauch innerhalb der Familie haben negative Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten des Kindes. Auch gesundheitliche Belastungen, geringe Bewältigungsressourcen und die schlechtere gesundheitliche Versorgung von sozial schwachen Familien führen zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko von Kindern und Jugendlichen (Ellsäßer et al. 2002, zit. nach Hensler 2006, S.28). Ein weiterer Einflussfaktor ist die Überernährung der Kinder und Jugendlichen durch das reichhaltige Nahrungsangebot und die permanente Verfügbarkeit von Lebensmitteln aller Art. Gemeinsame Mahlzeiten am Familientisch werden eher zur Seltenheit und schnelle Imbisse, die zwischen einer Aktivität und der nächsten zu sich genommen werden, nehmen zu. Zudem essen Kinder und Jugendliche sehr kalorienreich. Vor allem Fette werden hierbei zum Problem (Koletzko 2003, zit. nach Hensler 2006, S.29). Auch der Bewegungsmangel und die Inaktivität durch die Verdichtung des Lebensraumes Wohnbereich, durch die langen Schulwege, die nicht mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, und durch den Fernsehkonsum sind eine Ursache für Adipositas (Kolbe et al. 2003; Größing 2002, zit. nach Hensler 2006, S.30). Auch kritische Lebensphasen wie das Kleinkindalter, die frühe Kindheit und die Pubertät haben im Zusammenhang mit dem Appetit Auswirkungen auf die Fettanteile und eine phasenbedingte Adipositas (Wirth 2000, zit. nach Hensler 2006, S.30). 4. Schlusswort Das Ernährungsverhalten von weiblichen und männlichen Kindern und Jugendlichen ist ein komplexes Thema, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Ich habe versucht, die Ernährung aus einer gesundheitspsychologischen Sichtweise zu beleuchten und habe dafür die mir am wichtigsten erscheinenden Einflussfaktoren näher erläutert. Bei diesen Faktoren handelt es sich um das Geschlecht, das Ernährungswissen, der sozioökonomische Status, die jugendlichen und elterlichen Lebensstile, die Werbung und die Idole. Zusätzlich wollte ich auch einen Einblick in das tatsächliche Ernährungsverhalten und dem damit verbundenen Sport- und Bewegungsverhalten liefern. 39 Die einzelnen Aspekte habe ich mit aktuellen Daten untermauert. Für mich war es außerdem wichtig, das krankhafte Ernährungsverhalten dem gesunden überzustellen. In diesem Zusammenhang habe ich die Essstörungen genauer beschrieben. Ich finde, dass eine ausgewogene Ernährung, die mit einem gesunden Maß an Bewegung kombiniert wird, die Voraussetzung für ein gesundes, positives, erfolgreiches, fröhliches und zufriedenes Leben ist. Aus persönlicher Erfahrung weis ich, dass für Kinder und Jugendliche es oftmals nicht leicht ist, ausreichend Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Trotzdem sollte jeder oder jede für sich entscheiden, was dem Körper und vor allem auch der Seele gut tut. 40 Literaturverzeichnis: Bücher Delesen, Pia (1997): Anorexia Nervosa- Möglichkeiten und Probleme der Diagnostik, Ätiologie und Intervention: eine Analyse deutschsprachiger pädagogischer, psychologischer und soziologischer Literatur, Frankfurt 1997. Friedli, Johanna (2006): Übergewicht und Psyche- Inkongruenzniveau und Rückfall bei Adipositas, Konsistenz statt Diät oder was erfolgreiche Abnehmer unterscheidet, Bern 2006. Giddens, Anthony (1999): Soziologie, 2.Aufl., Graz-Wien 1999. Hensler, Nicole (2006): Akzeptanz und Auswirkung körperlich-sportlicher Aktivierung in der interdisziplinären pädiatrischen Adipositas-Nachsorge, Karlsruhe 2006. Holtmeier, Hans-Jürgen (1995): Gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung des Cholesterinstoffwechsels, 2.Aufl., Berlin; Heidelberg [u.a.] 1995. Hurrelmann, Klaus/Kolip, Petra (2002): Geschlecht, Gesundheit und Krankheit: Männer und Frauen im Vergleich, Bern [u.a.] 2002. Kiefer, Ingrid/Schoberberger, Rudolf/Kunze, Michael (1996): Was Kinder wirklich brauchen: Ernährung zwischen Tradition und Fernsehspots, Leoben 1996. Lane, Rainer/Didszuweit, J.Rainer (1997): Kinder, Werbung und Konsum: Theoretische Grundlagen und didaktische Anregungen, Frankfurt am Main 1997. Pollmer, Udo (2006): Esst endlich normal! Wie die Schlankheitsdiktatur die Dünnen dick und die Dicken krank macht, 4.Aufl., München 2006. Pudel, Volker/Westenhöfer, Joachim (1998): Ernährungspsychologie: eine Einführung, 2.Aufl., Göttingen 1998. Reich, Günter/ Götz-Kühne, Cornelia/ Killius, Uta (2004): Essstörungen: Magersucht, Bulimie, Binge eating; wie Sie die Essstörung erkennen und verstehen; Aussteigen: welche Therapien Ihnen helfen; Wege zurück ins normale Leben, Stuttgart 2004. Rieder, Anita/Lohff, Brigitte (2008): Gender Medizin: Geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis, 2.Aufl., Wien 2008. Rost, Brenda/Otten, Albert (1998): Ernährung im Kindesalter: ein Lehrbuch für Kinderkrankenschwestern und -pfleger, Stuttgart 1998. Schwenkmezger, Peter/Schmidt, Lothar R. (1994): Lehrbuch der Gesundheitspsychologie, Stuttgart 1994. 41 Wechsler, Johannes G. (2003): Adipositas- Ursachen und Therapie, Berlin 2003. Internetseiten Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (2006), Die Gesundheit der österreichischen SchülerInnen im Zusammenhang: Ergebnisse des WHO-HBSCSurvey 2006, URL: http://www.bewegung.ac.at/download/22/sub0/22_1585_7492.pdf, Stand: 15.März 2009 Freidl, W./ Stronegger, W.-J/ Neuhold, Ch. (2003): Lebensstile in Wien; URL: http://www.wien.gv.at/who/lebensstile/pdf/gesamt.pdf, Stand: 9. März 2009 Gerhards, Jürgen/Rössel, Jörg (2003): Das Ernährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Lebensstile, URL: http://www.bzga.de/pdf.php?id=8bd63eaa0b63c4d58c43405e2e205d67, Stand: 5. März 2009 Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie (2002): hbsc/ 17 Gesundheit und Gesundheitsverhalten bei Kindern und Jugendlichen: Bericht zur Gesundheit der 11-, 13- und 15-Jährigen in Österreich, URL: http://www.univie.ac.at/lbimgs/berichte/hbsc17.pdf, Stand: 9. März 2009 Institut für Ernährungsinformation (o.J.): Kinder und Jugendliche als Kaufentscheider und –beeinflusser, URL: http://www.ernaehrung.de/aktuell/archiv/Kinder-JugendWerbung.php, Stand: 11.März 2009 Wetzel, Stephanie (2006): Warum essen Mädchen Salat und Jungen Fleisch? Geschlechtsbezogene Verhaltensweisen in der Ernährungserziehung berücksichtigen, URL: http://www.talkingfood.de/lehrer_special/gesunde_schule/TitelWarum_essen_M%C3%A4dchen_Salat_und_Jungen_Fleisch%3F,6,28,18.html, Stand: 31. März 2009 Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft / Organisationen der Lebensmittelindustrie des Handels und der Medienwirtschaft (o.J.), Kinder, Werbung und Ernährung: Fakten zum gesellschaftlichen Diskurs, URL: http://www.zaw.de/doc/Positionspapier_Lebensmittel_200805.pdf, Stand: 11. März 2009 Berichte Baldaszti, Erika/Urbas, Elfriede (2006), Wiener Frauengesundheitsbericht 2006, Wien 2006. Feichtinger, Elfriede (1996), Armut und Ernährung: Literaturanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Konsequenzen für Ernährungs- und Gesundheitsstatus und der Ernährungsweise in der Armut, Berlin 1996 42 Klocke, Andreas (o.J.), Armut bei Kindern und Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Gesundheit, in: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 03/01 Kolip, Petra/Schmidt, Bettina (1999), Gender and health in adolescence, Kopenhagen 1999. Broschüren Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2004): Essstörungen… was ist das?, Köln 2004. 43