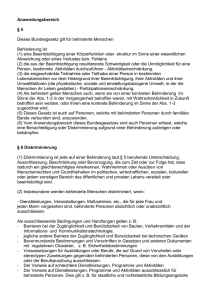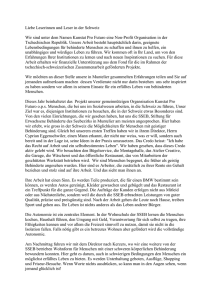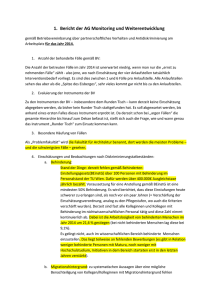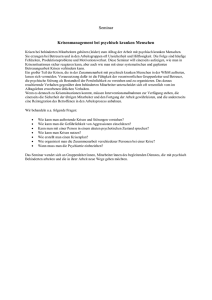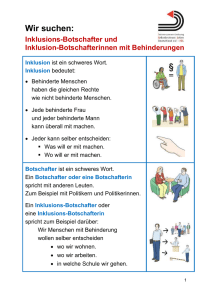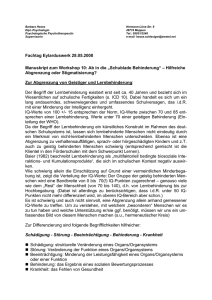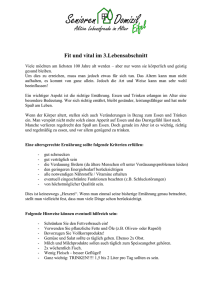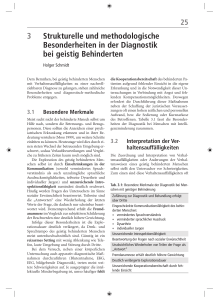Ein „Ort zum Leben"
Werbung
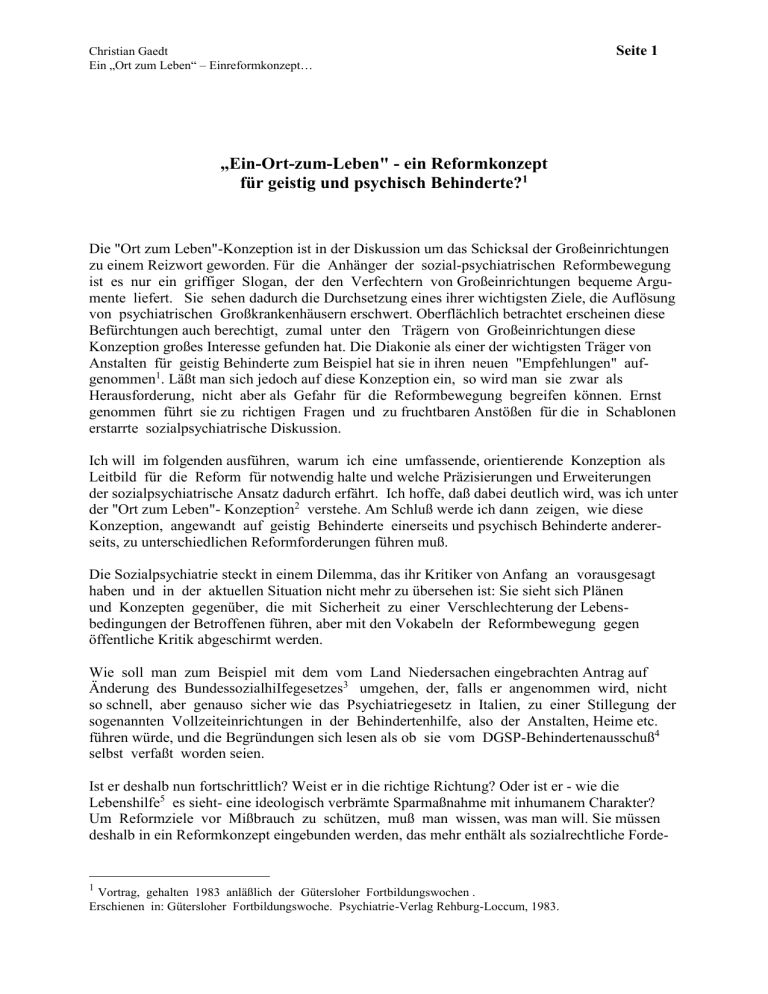
Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 1 „Ein-Ort-zum-Leben" - ein Reformkonzept für geistig und psychisch Behinderte?1 Die "Ort zum Leben"-Konzeption ist in der Diskussion um das Schicksal der Großeinrichtungen zu einem Reizwort geworden. Für die Anhänger der sozial-psychiatrischen Reformbewegung ist es nur ein griffiger Slogan, der den Verfechtern von Großeinrichtungen bequeme Argumente liefert. Sie sehen dadurch die Durchsetzung eines ihrer wichtigsten Ziele, die Auflösung von psychiatrischen Großkrankenhäusern erschwert. Oberflächlich betrachtet erscheinen diese Befürchtungen auch berechtigt, zumal unter den Trägern von Großeinrichtungen diese Konzeption großes Interesse gefunden hat. Die Diakonie als einer der wichtigsten Träger von Anstalten für geistig Behinderte zum Beispiel hat sie in ihren neuen "Empfehlungen" aufgenommen1. Läßt man sich jedoch auf diese Konzeption ein, so wird man sie zwar als Herausforderung, nicht aber als Gefahr für die Reformbewegung begreifen können. Ernst genommen führt sie zu richtigen Fragen und zu fruchtbaren Anstößen für die in Schablonen erstarrte sozialpsychiatrische Diskussion. Ich will im folgenden ausführen, warum ich eine umfassende, orientierende Konzeption als Leitbild für die Reform für notwendig halte und welche Präzisierungen und Erweiterungen der sozialpsychiatrische Ansatz dadurch erfährt. Ich hoffe, daß dabei deutlich wird, was ich unter der "Ort zum Leben"- Konzeption2 verstehe. Am Schluß werde ich dann zeigen, wie diese Konzeption, angewandt auf geistig Behinderte einerseits und psychisch Behinderte andererseits, zu unterschiedlichen Reformforderungen führen muß. Die Sozialpsychiatrie steckt in einem Dilemma, das ihr Kritiker von Anfang an vorausgesagt haben und in der aktuellen Situation nicht mehr zu übersehen ist: Sie sieht sich Plänen und Konzepten gegenüber, die mit Sicherheit zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen der Betroffenen führen, aber mit den Vokabeln der Reformbewegung gegen öffentliche Kritik abgeschirmt werden. Wie soll man zum Beispiel mit dem vom Land Niedersachen eingebrachten Antrag auf Änderung des BundessozialhiIfegesetzes3 umgehen, der, falls er angenommen wird, nicht so schnell, aber genauso sicher wie das Psychiatriegesetz in Italien, zu einer Stillegung der sogenannten Vollzeiteinrichtungen in der Behindertenhilfe, also der Anstalten, Heime etc. führen würde, und die Begründungen sich lesen als ob sie vom DGSP-Behindertenausschuß4 selbst verfaßt worden seien. Ist er deshalb nun fortschrittlich? Weist er in die richtige Richtung? Oder ist er - wie die Lebenshilfe5 es sieht- eine ideologisch verbrämte Sparmaßnahme mit inhumanem Charakter? Um Reformziele vor Mißbrauch zu schützen, muß man wissen, was man will. Sie müssen deshalb in ein Reformkonzept eingebunden werden, das mehr enthält als sozialrechtliche Forde- 1 Vortrag, gehalten 1983 anläßlich der Gütersloher Fortbildungswochen . Erschienen in: Gütersloher Fortbildungswoche. Psychiatrie-Verlag Rehburg-Loccum, 1983. Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 2 rungen und Bestimmungen wie zum Beispiel Personal-Schlüssel, Regionalisierung, gemeindenahe Versorgung, flankierende Maßnahmen, extramurale Dienste, Verbundsystem usw. Aus dem Gesamtkonzept müssen die einzelnen Reformziele ihre inhaltliche Festlegung erfahren, so daß sie nicht, aus dem Zusammenhang herausgerissen und als Schablonen missbraucht werden können. Reformgegnern zur Tarnung dienen können. Aus ihnen müssen sich auch alle konkreten Reform-schritte messen lassen wie an einem Prüfstein. Diese Funktion eines orientierenden Leitbildes hat für mich die "Ort-zum-Leben"-Konzeption. Je mehr man sich in die Frage vertieft, was bei der Aufzählung sozialtechnischer und sozialpsychiatrischer Forderungen nicht erfaßt wird, - was nicht erfaßt werden kann, weil es eine grundsätzlich andere Qualität hat - desto klarer wird, daß es eigentlich nicht nur um eine Präzisierung des sozialpsychiatrischen Ansatzes geht, wenn man ihn vor Mißbrauch schützen will, sondern daß es hierzu einer verändernden Erweiterung bedarf. Die Ausgangsfrage: Wie müssen psychisch Kranke oder wie müssen behinderte Menschen betreut werden, wird zu der Frage: Wie sollen psychisch Kranke oder Behinderte leben, damit sie gesund werden bzw. bleiben können. Auf diese Fragen lenkt die "Ort zum Leben"-Konzeption die Aufmerksamkeit und gibt darauf eine Antwort. Hierin sehe ich den entscheidenden Beitrag dieses Konzeptes. Es ist also kein Programm mit detailliert ausgearbeiteten Reformschritten, sondern vielmehr eine Sichtweise. Ich will dies an einem Beispiel verdeutlichen: Stellen Sie sich vor, Sie müßten sich um einen neu gepflanzten Baum kümmern. Sie werden, falls Sie es nicht selbst machen können, einen Dienst organisieren, der regelmäßig und ausreichend gießt. Sie werden für Düngung sorgen, Sie werden ihn gegen Ungeziefer spritzen und Sie werden ihn festbinden, damit er nicht schon bei dem kleinsten Wind umkippt. All dies ist wichtig, kann aber nicht garantieren, daß der Baum auch wächst und gedeiht. Er selbst muß mit seinen Wurzeln den lebenswichtigen Austausch mit der Erde herstellen und für einen langfristigen sicheren Halt sorgen. Dabei können Sie ihm nicht helfen. Ob es ihm gelingt, hängt von seinen Wurzeln ab, ob sie den Boden, der ihm vorgegeben ist, erschließen und für sich nutzbar machen können. Beginnt der Baum zu kränkeln und droht einzugehen, so ist vielleicht der Boden für die Wurzeln zu hart oder sie können aus anderen Gründen den lebensnotwendigen engen Kontakt mit der Erde nicht herstellen. Man müßte dann den Boden bearbeiten oder, falls dies nicht möglich ist, den Baum verpflanzen. Dieses Beispiel veranschaulicht vereinfachend die Situation des Menschen mit seiner gesellschaftlichen Verwurzelung. Wie der Baum einen Boden braucht, den er mit seinen Wurzeln durchwachsen kann und der ihm Nahrung und Halt gibt, so braucht der Mensch einen gesellschaftlichen Lebensraum, den er sich mit seinen Fähigkeiten erschließen und nutzbar machen kann. Er braucht einen Ort zum Leben. Dies gilt in gleicher Weise für den gesunden wie für den geistig oder psychisch behinderten Menschen. Wie aber verschiedene Bäume unter Umständen verschiedene Erden brauchen, so wird auch der Lebensraum für verschiedene Menschen unterschiedlich sein können bzw. sein müssen. Bevor ich verdeutliche, wie ich mir die "Ort zum Leben"-Konzeption bei geistig Behinderten realisiert vorstelle, um dann zu zeigen, wo ich den Unterschied zu psychisch Behinderten sehe, will ich an einem Beispiel aufzeigen, wo ich das Problem der geistigen Behinderung sehe. Aus Erfahrung weiß ich, daß gerade in medizinisch orientierten Kreisen die Gefahr sehr groß ist, mit dem Stichwort "geistige Behinderung" automatisch die Vorstellung eines schwerst geistig behinderten Menschen mit vielerlei Mißbildungen zu wecken. Dabei würde aber das, was ich meine, nicht so deutlich und ließe sich zudem noch leichter mit einem medizinischen Vokabular verdecken. Ich will daher als Beispiel einen leicht Behinderten nehmen, ein Beispiel aus der Nahtstelle zwischen Normalen .und Unnormalen, dessen Charakteristika sich jedoch Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 3 durch das ganze Spektrum der Behinderung bis hin zum schwerst geistig Behinderten verfolgen lassen. Ich will die Geburt eines geistig Behinderten schildern und dabei deutlich machen, daß dies kein biologischer sondern ein gesellschaftlicher Akt ist. Herr K. ist 35 Jahre alt. Testpsychologische Untersuchungen haben einen IQ von 75 festgestellt. Er war Bote in einer größeren Behörde, das heißt, er verteilte Post und ähnliches. Er hatte oft Schwierigkeiten, die richtigen Adressaten zu finden, in jahrelanger Übung dabei aber eine ausreichende Sicherheit gewonnen. Es kamen kaum Fehler vor. In seiner Freizeit schlief er meist, weil ihn die Arbeit doch sehr anstrengte. Er hatte aus diesem Grund keinen großen Bekanntenkreis: Schwerpunkt seines Lebens waren größere Reisen, auf die er sparte. Seinen privaten Alltag bewältigte er ohne auffällig zu werden. Im Rahmen einer Rationalisierungsmaßnahme in seiner Behörde änderte sich von einem Tag auf den anderen das Verteilersystem und sein Zuständigkeitsbereich wurde gleichzeitig größer. Die Fehlerhäufigkeit bei Herrn K. stieg sofort merklich an. Er wurde gemahnt, getadelt, man wies ihm Nachlässigkeiten nach. Herr K. konnte kaum noch schlafen, während der Arbeit bekam er Herzklopfen und reagierte oft. gereizt und ausfallend. Er entwickelte sich zu einem Störer im Betrieb. Sein Vorgesetzter gab ihm den Rat, einen Nervenarzt aufzusuchen. Dieser behandelte ihn mit Neuroleptika und Herr K. wurde ruhiger, ohne daß die Fehler merklich nachließen. Er zog sich immer mehr zurück. Eines Tages schloß er sich zu Hause ein und drohte mit Selbstmord. Der sozialpsychiatrische Dienst wurde informiert und eine Berentung eingeleitet. Herr K. verlor seinen Arbeitsplatz. Die entstehenden finanziellen Einbußen machten seine üblichen Reisen unmöglich. Das Ersparte reichte dafür nicht mehr aus. Herr K. verlor das Interesse an seiner Lebensplanung, und er wurde in seinen alltäglichen Verrichtungen nachlässig. Den eingeschalteten Sozialdiensten wurden immer mehr Aufgaben übertragen. Sie regelten nicht nur die Rentenangelegenheiten, sie beantragten auch das Wohngeld, sorgten für soziale Kontakte im Patientenclub, organisierten Freizeitaktivitäten und brachten Herrn K. regelmäßig zum Arzt. Nach einem Selbstmordversuch folgte die Einweisung in eine psychiatrische Klinik, die jedoch die Zuständigkeit ablehnte. Bei der klinisch-neurologischen Untersuchung fiel ein kleiner Kopfumfang auf und ein Computertomogramm zeigte eine leichte Erweiterung des dritten Ventrikels. Vom Amtsarzt wurde dann die Diagnose einer frühkindlichen Hirnschädigung mit wesentlicher geistiger Behinderung bestätigt. Der Kostenübernahme für die Unterbringung in einer Behinderteneinrichtung stand nun nichts mehr im Wege. Herr K. war jetzt ein anerkannter Behinderter. Die Behinderung bei Herrn K. ist offensichtlich kein medizinisches Problem. Die Mediziner und ihre Dienste haben nur die Rolle des Geburtshelfers gespielt. Sie ist jedoch auch kein pädagogisches Problem, denn das, was Herr K. gelernt hat, oder was er lernen kann, wird nicht mehr gebraucht. Die Behinderung ist vielmehr Resultat einer sich verändernden gesellschaftlichen Struktur. Bei Herrn K. hat sich der Prozeß der Ent-Vergesellschaftung vollzogen: Er hat seinen gesellschaftlichen Lebensraum, seinen Ort zum Leben, verloren, in dem er sich neben den anderen Menschen als bedeutungsvoll erleben konnte und den er eigenverantwortlich entsprechend seinen Fähigkeiten und seinen Bedürfnissen mitgestaltet hat. Er ist nicht mehr ein den eigenen Lebensbereich kompetent gestaltender Mensch, sondern ein therapeutisch-pädagogisch betreutes Anhängsel der Gesellschaft. Die "Ort zum Leben"Konzeption ist der Widerspruch gegen diese Art von Betreuung. Ich komme noch einmal zurück auf das Beispiel von dem Baum. Wenn man feststellt, daß er trotz aller guten Pflege und Versorgung nicht wächst und gedeiht, wird man den Boden bearbeite-n müssen. Aber wie? Wo liegen die Schwierigkeiten, auf die die Wurzeln stoßen? Um dem Baum gezielt helfen zu können, braucht man Kenntnisse über die Lebens- und Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 4 Wachstumsbedingungen der Wurzeln. Man wird auf Erfahrungen entsprechender Wissenschaften zurückgreifen. Also auf die Biologie, die Biochemie und die physikalische Chemie. Die Beziehungen zwischen Menschen und Gesellschaft sind sicherlich komplizierter und anders als das Verhältnis der Baumwurzeln zur Erde. Sie sind jedoch in gleicher Weise entscheidend für seine Gesundheit. Wenn die "Ort zum Leben"-Konzeption uns auf die Frage lenkt, wie Menschen, also auch geistig behinderte Menschen, leben müssen, damit sie gesund werden und bleiben können, muß sie sich - wenn sie nicht in der Banalität stecken bleiben will - auf eine Theorie menschlicher Entwicklung stützen, aus der die Bedingungen für ein normales Leben auch für den speziellen Fall einer geistigen Behinderung abgeleitet werden können. Ich gehe in meinen Überlegungen von der Persönlichkeitstheorie der Kritischen Psychologie6 aus, ohne daß ich im Rahmen dieses Referates genau darauf eingehen kann. Nur zwei Begriffe, die mir besonders wichtig erscheinen, will ich erläutern. Es sind dies die Begriffe "Aneignung" und "produktive Bedürfnisse". Beide Begriffe sind für das Verständnis des Prozesses wichtig, in dem sich der Mensch, sich dabei selbst verändernd, seinen Lebensraum erschließt. Aneignung ist eine besondere Form des Lernens, die darin besteht, daß der Einzelne im Prozeß der Aneignung die gesellschaftlichen Erfahrungen in sich aufnimmt. Über Aneignung, so sagt man, gewinnt der Mensch Anschluß an das gesellschaftliche Erbe. Gemeint sind damit alle jene Fähigkeiten, Kenntnisse, Einstellungen, Bedürfnisse, Gefühle usw., die der Mensch braucht, um sich in der Gesellschaft, mit der er konfrontiert wird, zurechtzufinden und sie sich für den eigenen Lebensunterhalt nutzbar zu machen. Mit dem Aneignungsprozeß - und dies ist wichtig - werden die Strukturen herausgebildet, die zum Umgang mit dem Anzueignenden notwendig sind. Somit ist der Aneignungsprozeß wesentliche Grundlage menschlicher Entwicklung. Die Aneignung kann nie total sein, daß heißt, jeder Mensch kann nur einen Teil des gesellschaftlichen Erbes übernehmen, wobei die Teile, die individuell übernommen werden, aufeinander abgestimmte, gesellschaftlich notwendige Komplexe von Fähigkeiten und Eigenschaften sind. Hierin ist die objektive Grundlage der gesellschaftlichen Integration in einer differenzierten Gesellschaft zu sehen. Gesellschaftliche Integration in diesem Sinne ist daher immer Integration auf der Basis der Kooperation, also kooperative Integration. Die produktiven Bedürfnisse sind die motivationale Grundlage der kooperativen Integration. Sie sind in ihrem Wesen Kontroll- und Sozialbedürfnisse, die darauf ausgerichtet sind, die Kontrolle über die Umweltbeziehungen zu erweitern. Es geht also im Grunde um das Bedürfnis nach individueller, vorsorgender Absicherung, was jedoch nur über den Einfluß auf die gesellschaftlichen Bedingungen möglich wird. Man muß davon ausgehen, daß unter den Bedingungen einer geistigen Behinderung die Gesetze der Aneignungsprozesse unverändert sind. Nur ihre Kapazität ist beschränkt. Zu den Voraussetzungen der Aneignung gehört, daß damit tatsächlich eine Erweiterung der Lebensmöglichkeiten des betreffenden Menschen gegeben und erkennbar ist. Liegen die Anforderungen zu hoch, fehlen also die notwendigen Anknüpfungsmöglichkeiten an vorhandene Fähigkeiten, dann ist die Antizipation des Erfolges nicht möglich. Angst, Vermeidungsverhalten, Leistungsverweigerung und Resignation sind die Folge, und die darin enthaltene Entwicklungschance bleibt ungenutzt. Es entsteht Isolation als Folge andauernder verweigerter Aneignungsprozesse. Die wachsende Komplexität und Differenziertheit gesellschaftlicher Prozesse läßt eine eingeschränkte Aneignungsfähigkeit zu einem Störfaktor werden, der die betreffenden Menschen immer leichter in die Isolation drängt. Gesellschaftliche Integration im Sinne einer kooperativen Integration wird deshalb für geistig Behinderte immer schwieriger. Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 5 Wie die Fähigkeit zur Aneignung jedem Menschen, also auch dem geistig Behinderten, eigen ist, so verfügt er auch über produktive Bedürfnisse. Auch er strebt nach ständig erweiterter Kontrolle über seine materielle und soziale Umwelt. Er wird dieses Bedürfnis umso eher befriedigen können, je differenzierter seine Aneignungsprozesse verlaufen sind. Dies hängt in entscheidendem Maße von den angebotenen gesellschaftlichen Anforderungen ab. Bietet ihm die Gesellschaft keine Entwicklungsbahnen, die ihm eine angemessene gesellschaftlich bedeutsame Position vermitteln, was in der Regel über die Teilnahme am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß geschieht, dann fehlt die gesellschaftliche Perspektive und damit der Anreiz zur weiteren Entwicklung. Seine charakteristischen Eigenschaften als Behinderter, also mangelnde Selbständigkeit, Unsicherheit sowie die Bedürfnis- und Erlebnisarmut resultieren aus dieser Grunderfahrung. Ein "Ort zum Leben" für den geistig Behinderten wäre also ein gesellschaftlicher Raum, in dem er seinen Fähigkeiten entsprechende Entwicklungsbahnen vorfindet, die ihn zu einem Menschen machen, der kompetent und eigenverantwort1ich in diesem Lebensbereich handeln und sich über seine Tätigkeit als für den ihn betreffenden sozialen Bezugsrahmen bedeutsam erleben kann. Daraus ergeben sich die Definitionen für Normalisierung und Integration. Normalisierung heißt dann die Aufhebung gesellschaftlich bedingter Einschränkung der individuellen Möglichkeit zur Aneignung, und Integration heißt, den geistig behinderten Menschen in kooperative Beziehungen zu seiner sozialen Umwelt zu bringen. Die Gesellschaft bietet hierfür nicht die notwendigen Voraussetzungen. Sie hat den geistig Behinderten ihren Lebensraum entzogen. Sie ist in dieser Hinsicht verstümmelt. Notwendig sind also geplante und bewußt gestaltete, differenzierte gesellschaftliche Ersatzräume, die die verloren gegangene Vielfalt zurückbringen. Keine noch so verfeinerten und ausgeklügelten Therapie- und Förderungsmaßnahmen können ausgleichen, was die Verstümmelung der Gesellschaft bewirkt, Behinderung ist eben kein pädagogisches oder medizinisches Problem. Pädagogische oder medizinische Maßnahmen reichen deshalb nicht aus. Um die Bedeutung der gesellschaftlichen Strukturen für die Entstehung von Behinderungen deutlich zu machen, möchte ich zu einem etwas gewagten Vergleich greifen. Bei dem Verlust eines Armes ist die angemessene Methode, die Behinderung durch eine Armprothese auszugleichen. Niemand würde hier auf die Idee kommen, daß es ausreichen könnte, diesen Menschen durch therapeutische, soziale und pädagogische Dienste zu begleiten. Wenn, wie ausgeführt, dem geistig behinderten Menschen ein ihm angemessener gesellschaftlicher Lebensraum fehlt, das heißt, man müßte es anders ausdrücken: Wenn der Gesellschaft für diesen Menschen ein angemessener Lebensraum fehlt, dann muß ein angemessener gesellschaftlicher Lebensraum geschaffen werden. Die Gesellschaft muß verändert, erweitert und differenziert werden. In diesem Sinne kann man von der Notwendigkeit einer "Gesellschaftsprothese" reden. Die "Ort zum Leben"-Konzeption führt also, angewandt auf geistig Behinderte, zu der Forderung, ihm neue gesellschaftliche Räume zu erschließen, notfalls auch durch die Schaffung von gesellschaftlichen Ersatzräumen. Ich komme nun auf die unterschiedlichen Reformforderungen für geistig Behinderte einerseits und psychisch Behinderte andererseits. Wenn man versucht, aus dem "Ort zum Leben"-Konzept unter Berücksichtiung der gesellschaftlichen Verhältnisse konkrete und realisierbare Reformschritte abzuleiten, wird man, in welche Richtung man auch denkt, auf unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten stoßen. Lösungen wird man nur mit Kompromissen erreichen können. Für geistig Behinderte könnte ein Weg über die Veränderung von Großeinrichtungen führen. Das aus dem "Ort zum Leben"-Konzept abgeleitete Reformbild Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 6 wäre dann die mit der sozialen Umgebung verzahnte und mit ihr über vielfältige Übergänge verbundene "Ortschaft". Die in eine Ortschaft umgewandelte Großeinrichtung wäre dann der geforderte gesellschaftliche Ersatzraum. Mit ihren dort möglichen vielfältigen Berufs- und Arbeitsangeboten und mit ihren differenzierten Kontaktmöglichkeiten zu "Normalen", aber auch zu anderen "behinderten" Menschen, könnten sie für geistig behinderte Menschen eine Erweiterung ihrer Entwicklungs- und Erlebensmöglichkeiten bedeuten. Sie könnten auch Schutz bieten und den behinderten Menschen mit seinen nicht immer ausgleichbaren Unfähigkeiten und Auffälligkeiten abschirmen. Da diese Äußerungen besonders für Fehlinterpretationen anfällig sind und sehr schnell der Vorwurf der Gettosierung gemacht wird, möchte ich mit einigen Beispielen verdeutlichen, was ich damit meine. Ich halte es für wichtig, daß geistig Behinderte selbständig, das heißt ohne Begleitung pädagogisch-therapeutischer Dienste sich in ihrem Lebensraum frei bewegen, können, dass sie keine Angst zu haben brauchen, sich zu verirren oder ein Opfer des Straßenverkehrs zu werden. Ich halte es für wichtig. daß sie genügend Kontaktmöglichkeiten haben, damit sie Partner. Freunde aber auch Geliebte finden können. Ich halte es für wichtig, daß sie, auch wenn sie schwerbehindert sind, sich durch eine "berufliche" Tätigkeit eine Bedeutung geben können, die ihre Persönlichkeit prägt und ihr Verhältnis zu den anderen wichtig werden läßt. Ich halte es für wichtig, daß möglicherweise bestehende psychische Auffälligkeiten nicht ständig zur Konfrontation mit der Ordnungsbehörde oder aber mit Therapeuten führen. Es geht also nicht um diskriminierende Isolierung der Behinderten, sondern um eine Erweiterung ihrer Erlebnismöglichkeiten, wobei die Integration nach außen als angestrebte Perspektive bleibt, aber nicht als einzig mögliche Lebensweise angesehen wird. Damit die Möglichkeiten, die eine Großeinrichtung für Behinderte bieten könnte, nutzbar gemacht werden können, müßten sie sich verändern und zu "Ortschaften" entwickeln. Voraussetzung wäre, dass sie sich in ihrer Struktur einer normalen Gemeinde nähern, also den Umfang der zentralisierten Versorgungseinrichtungen abbauen, die hierarchische Personalführung lockern, vermehrt "echte" Arbeitsplätze für die Behinderten schaffen, das Wohnraumangebot differenzieren, die Zahl der in der Ortschaft lebenden Mitarbeiter vergrößern, Mitsprachemöglichkeiten der Heimbewohner erweitern usw. Wenn diese Entwicklungsmöglichkeiten von Großeinrichtungen nicht gesehen werden, muß die Verknüpfung der "Ort zum Leben"-Konzeption mit Großeinrichtungen mißverständlich sein. Sie hat auch schon zu zahlreichen Kontroversen geführt, auf die ich hier nicht eingehen kann7. So wird insbesondere befürchtet, daß das "Ortschaftsmodell" sich auch als Lösung für das Problem der chronisch psychisch Kranken anbietet. Aus meiner Sicht ist jedoch die Übernahme des Ortschaftskonzeptes in die Psychiatrie nicht berechtigt, weil es den wesentlichen Unterschied zwischen geistiger Behinderung und psychischer Krankheit negiert. Geistig Behinderte sind - vereinfachend gesagt - psychisch gesunde Menschen. Ihr Problem ist ihre Unfähigkeit, mit den immer komplexer werdenden gesellschaftlichen Strukturen zurechtzukommen. Sie brauchen daher eine Vereinfachung ihres gesellschaftlichen Lebensraumes, den ihnen die in eine "Ortschaft" umgewandelte Großeinrichtung bieten könnte. Bei psychisch Kranken liegt das Problem anders. Welche Ursache auch immer psychische Störungen haben mögen, eine verminderte Aneigungskapazität gehört nicht dazu. Psychisch Kranke haben trotz ihrer Erkrankung in der Regel die Fähig keit, mit den für sie relevanten gesellschaftlichen Strukturen kompetent umzugehen. Bis zu ihrer Erkrankung hatten sie Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 7 keine Schwierigkeiten, ihren gesellschaftlichen Raum eigenverantwortlich zu gestalten und auszufüllen. Ihr "Nicht-mehr-Können" ist anders gegründet. Bei den vielfältigen psychischen Störungen kann man nicht erwarten, daß ihre Ursachen auf einen Nenner gebracht werden können. Will man trotzdem eine Verallgemeinerung wagen, um eine in diesem Zusammenhang nützliche Gegenüberstellung zu geistig Behinderten zu ermöglichen, so könnte man sagen, sie scheitern an der Bewältigung emotionaler Probleme, die aus einer widersprüchlichen Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Umwelt resultieren. Sucht man auf dieser Grundlage nach einem Betreuungsmodell für psychisch Kranke, das dem "Ort zum Leben“-Konzept genügt, so wird man keine nach dem Muster "Ortschaft" verallgemeinerbare Lösung finden; ihre individuellen Unfähigkeiten und Verletzbarkeiten sind zu groß und die Ursachen ihrer Kränkung8 zu sehr mit den allgemeinen Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft verwoben. Eine "Ortschaft" für psychisch Kranke zu planen, hieße nichts anderes, als die Veränderung der Gesellschaft ins Visier zu nehmen. Welche Vorteile könnte also eine zur "Ortschaft" veränderte Großeinrichtung psychisch Kranken bringen? Die Vereinfachung der Lebensweise auf das Niveau der geistigen Behinderung würde ihre spezifischen Empfindlichkeiten nicht ausgleichen, sie würde nur als Diskriminierung aufgefaßt werden und damit antitherapeutisch wirken. Bliebe dann das Argument der Abschirmung. Könnten hierbei Großeinrichtungen nützlich sein? In Großeinrichtungen hätte die zur psychischen Entspannung notwendige Entlastung zwangsläufig Isolierung zur Folge; das gebrochene Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt kann nicht durch den Entzug angemessener Alltagskontakte verbessert werden. Nur eine aus der Resignation sich nährende Argumentation könnte dem Ortschaftskonzept bei der Betreuung psychisch Kranker einen Platz einräumen. Angesichts des Notstandes in der ambulanten Behandlung, aber auch angesichts des Ausmaßes der in ihren Ursachen noch nicht ausreichend abgeklärten Persönlichkeitszerstörung bei vielen chronisch Kranken, hat diese Argumentation der Hilflosigkeit ihre Berechtigung; sie kann jedoch nicht mit dem "Ort zum Leben"-Konzept begründet werden. Ich habe bisher den Ausdruck "psychisch Behinderte" vermieden, der mir ja in meinem Thema vorgegeben ist. Ich bestreite den pragmatischen Nutzen der Aufteilung in "akut" und "chronisch" psychisch Kranke (die dann mit psychisch Behinderten gleichgesetzt werden) nicht. Ich kenne aber keine Trennungslinie, an der sich diese Aufteilung vollziehen ließe, ohne ständig Widersprüche hervorzurufen. In diesem Zusammenhang ist es zunächst wichtig, dies zu betonen, denn der Schritt vom psychisch Behinderten oder vom chronisch psychisch Kranken zum psychisch Kranken im allgemeinen Sinne ist leicht getan. Deshalb ist die Diskussion um den "harten Kern" tückisch. Sie hinterläßt bei vielen das Gefühl der Hilflosigkeit und der Resignation und verführt dazu, für diesen Personenkreis das Ortschaftskonzept in Erwägung zu ziehen. Wäre dieses Konzept jedoch erst einmal verwirklicht, würde die Grenzziehung zu einem unlösbaren Problem. Ich teile also die Bedenken aller derjenigen, die in dem Ortschaftskonzept - für psychisch Kranke - nur eine neue Variante gesellschaftlicher Ausgrenzung sehen. Am Ende meines Vertrages kann ich also folgende Antworten auf die in meinem Thema gestellte Frage geben. Das "Ort zum Leben“- Konzept gilt natürlich für geistig Behinderte und für psychisch Behinderte, wie es auch für Gesunde gilt. Es ist eine Sichtweise und kein Reformprogramm. Es soll lediglich auf die für die Betreuung Kranker und Behinderter wichtigen Fragen lenken. Für geistig Behinderte führt das "Ort zum Leben"- Konzept zu dem Reformziel, Großeinrichtungen in "Ortschaften" umzuwandeln, ohne andere Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 8 Reformpläne, also etwa die Reform nach skandinavischem Vorbild, auszuschließen. Eine Übernahme des "Ortschaftskonzeptes" in die Psychiatrie läßt sich aus dem "Ort zum Leben"Konzept nicht begründen . Christian Gaedt Ein „Ort zum Leben“ – Einreformkonzept… Seite 9 Anmerkungen 1 Orientierungshilfen für die Arbeit in der Diakonie. Einrichtungen und Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung. Verband evangelischer Einrichtungen für geistig und seelisch Behinderte e.V. Fachverband des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Stuttgart, 1983. 2 Eine ausführliche Darstellung und Begründung des Konzeptes findet sich in meinen beiden Aufsätzen: "Einrichtungen für Ausgeschlossene oder "Ein Ort zum Leben' - Überlegungen zur Betreuungung Geistigbehinderter": Jahrbuch für Kritische Medizin, Bd. 7, S. 96-109, Argument Verlag-, Berlin, 1981 und "Normalisierung und Integration. Orientierende Begriffe bei der Reform von Einrichtungen für geistig Behinderte" in: Forum Kritische Psychologie, Bd. 7, S. 152-169, Argument Verlag, Berlin, 1983. 3 Gesetzesantrag des Landes Niedersachsen vom 27.6.1983 (Bundesratsdrucksache 293/83) zur Änderung des BundessozialhiIfegesetzes. 4 DGSP ist die Abkürzung für Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. 5 Informationsdienst der Lebenshilfe, Nr. 7, August 1983. 6 Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf die Aufsätze: HOLZKAMP, K.: Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität I. In: Holzkamp, K. (Hrsg.): Forum Kritische Psychologie, Bd. 4, AS 34, Argument Verlag, Berlin, 1979 a. Derselbe: Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität II. In: Forum Kritische Psychologie, Bd. 5, AS. 41, Argument Verlag, Berlin, 1979 b. HOLZKAMP-OSTERKAMP, U.: Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung 1. Campus, Frankfurt/New York, 1975. Derselb.: Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung 2. Campus, Frankfurt/New York, 1976. JANTZEN, W.: Grundriß einer allgemeinen Psychopathologie und Psychotherapie. Studien zur Kritischen Psychologie, Bd. 19, Pahl-Rugenstein, Köln, 1979. 7 Meine Kontroverse mit Michael Wunder, einem Sprecher des DGSP-Behindertenausschusses, in der ich mich nochmals ausführlich mit den Argumenten gegen die Großeinrichtungen auseinandersetze. Veröffentlicht im Jahrbuch für Kritische Medizin, Nr. 9, Argument Verlag, Berlin. 8 Ich gebrauche hier "Kränkung" statt "Krankheit", weil dieser Ausdruck eher auf den Prozeß der Entstehung hinlenkt. Er ist dem Lehrbuch von K. DÖRNER und U. PLOG entnommen: "IRREN ist menschlich oder Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie" Psychiatrie-Verlag, Wunstorf, 1978.