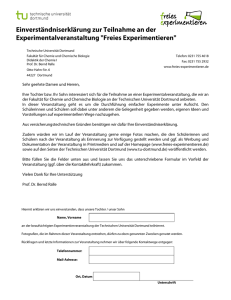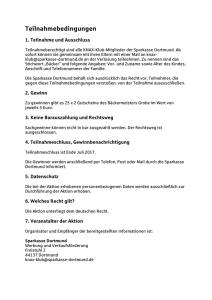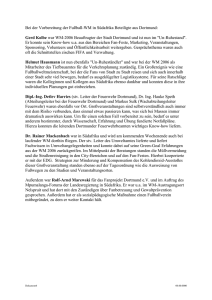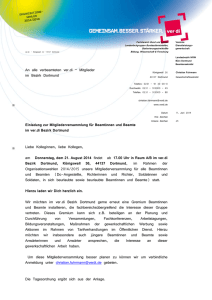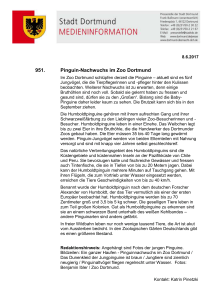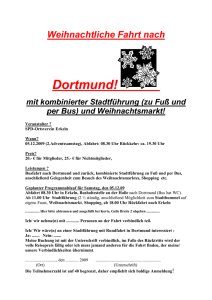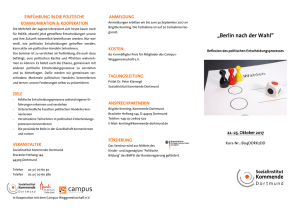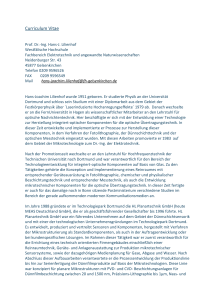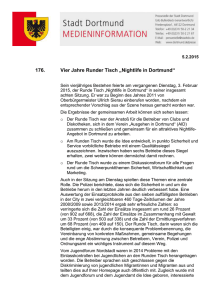Page 1 Drucksache Nr.: 00898-15 öffentlich Fachbereich Dezernent
Werbung

Drucksache Nr.: 00898-15 öffentlich Fachbereich Dezernent(in) / Geschäftsführer Datum 61/2-4 StR Wilde 02.04.2015 verantwortlich Telefon Dringlichkeit Dr. Henriette Brink-Kloke 24299 Beratungsfolge Beratungstermine Zuständigkeit Bezirksvertretung Hombruch Bezirksvertretung Innenstadt-West Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen Hauptausschuss und Ältestenrat Rat der Stadt 28.04.2015 29.04.2015 29.04.2015 07.05.2015 07.05.2015 Kenntnisnahme Kenntnisnahme Kenntnisnahme Kenntnisnahme Kenntnisnahme Tagesordnungspunkt 11. Nachtrag zur Denkmalliste Beschlussvorschlag Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 11. Nachtrag zur Denkmalliste zur Kenntnis. Finanzielle Auswirkungen Mit dem Nachtrag zur Denkmalliste sind keine finanziellen Auswirkungen verbunden. Ullrich Sierau Oberbürgermeister Ludger Wilde Stadtrat Begründung In den Stadtbezirken Hombruch und Innenstadt-West wurde nach der Untersuchung von zwei Bodendenkmälern sowie vier Baudenkmälern deren Denkmaleigenschaft festgestellt. Die Entscheidung erfolgte jeweils in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Zuständigkeit Der Rat der Stadt Dortmund hat am 08.11.2007 die Vorlage „Zuständigkeit für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen“ beschlossen. Danach werden den politischen Gremien Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler vor Eintragung in die Denkmalliste zur Kenntnisnahme vorgelegt. Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 2 Sachverhalt Die Verwaltung wird auf Grundlage des 11. Nachtrages 2 Bodendenkmäler 4 Baudenkmäler in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eintragen. Die zur Eintragung vorgesehenen Objekte wurden unter der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen (Bodendenkmäler) sowie LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (Baudenkmäler) auf den Denkmalwert hin überprüft 1. Nachtrag zur Denkmalliste Lfd. Nr. Straße Hs-Nr. Stadtbezirk Gebäudetyp/ Anlage Bezeichnung 1 Zillestraße Hombruch Bodendenkmal Lichtlöcher der Zeche Christine & Schöndelle Kirche St. Marien und Marienkirchhof ehemaliges Postscheckamt 2 Marienkirchhof 1 In-West Bodendenkmal 3 Hoher Wall 9-11 In-West Baudenkmal 4 Königswall 29 In-West Baudenkmal 5 Lindemannstraße 18 In-West Baudenkmal Verwaltungsgebäude der Emschergenossenschaft Wohnhaus 6 Marienkirchhof 1 In-West Baudenkmal Evangelisches Gemeindehaus 2. Begründung der Denkmaleigenschaft 2.1 Bodendenkmal „Lichtlöcher der Zeche Christine & Schöndelle, Dortmund-Hacheney“, Hombruch In den Waldflächen östlich angrenzend an den Dortmunder Zoo befinden sich vier hohe Erdhügel, bei denen es sich um die Auswurfhalden von Lichtlöchern und die Schächte der Lichtlöcher für den Erbstollen der Stollenzeche Christine & Schöndelle handelt. Sie gehören zum zwischen 1746 und 1800 angelegten, 1,120 km langen und gut 20 m tiefen Erbstollen der Zeche, der unter dem heutigen Zoo, dem östlich angrenzenden Waldstück und der Zillestraße bis zum Schacht Caroline an der Straße Heideblick verlief. Die Lichtlöcher (Luftschächte) dienten der Bewetterung des Stollens, nebenbei auch der Förderung der angetroffenen Kohleschichten. Der Erbstollen wurde an der Schondelle in unmittelbarer Nähe des heutigen Zoohaupteingangs an der Mergelteichstraße angesetzt (Mundloch). Der Vortrieb nach Südosten erfolgte mit leichter Steigung, um den Abfluss des Grubenwassers nach Nordwesten in die Schondelle zu ermöglichen. Der Stollen war noch bis 1893 für die Wellinghofer Tiefbauzeche Crone in Betrieb, sein Mundloch wurde erst um 1955 zugemauert. Der Denkmalumfang orientiert sich am Umfang der vier, heute noch im Gelände sichtbaren Halden nördlich der Zillestraße. Derartig hoch erhaltene Schachthalden des frühen Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 3 Kohlebergbaus entlang der Ruhr sind sehr selten geworden. Nur in Waldgebieten konnten sich überhaupt obertätige Überreste von Pingen und Luftschächten erhalten, die ehemals überall in großer Anzahl vorhanden gewesen sein müssen. Die hoch aufgetürmten Halden zeugen eindrucksvoll für die harte und mühevolle Arbeit der frühen Bergleute, aber auch für die bergmännische Ingenieursleistung, einen derartigen Stollen zielbringend planen und anlegen zu können. Bei den vier Schachthalden um die Lichtlöcher der Stollenzeche Christine & Schöndelle handelt es sich um Bodendenkmäler nach dem Denkmalschutzgesetz NRW. Sie sind bedeutend für die Geschichte des Menschen in der Region. Für die Erhaltung des ortsfesten Bodendenkmals sprechen wissenschaftliche Gründe, denn es stellt eine für die historische Forschung wichtige Urkunde dar. Wie bei anderen vergleichbaren Bergbaurelikten ist auch hier der Hinweis unerlässlich, dass die Halden aufgrund von Einsturzgefahr nicht betreten werden dürfen. 2.2 Bodendenkmal „Kirche St. Marien und Marienkirchhof, Marienkirchhof 1, In-West“ Die Marienkirche am Hellweg wird im 14. Jahrhundert als „capella regis“ (Königskapelle) bezeichnet, später ist sie als Gerichts- bzw. Ratskirche, seit 1232 als Pfarrkirche bezeugt. Das heutige Kirchengebäude St. Marien in Dortmund-Innenstadt entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als romanische Basilika. Archäologische Baubeobachtungen lassen mehrere Vorgängerbauten, darunter ein dreischiffiges Gebäude vermuten. Bislang ungeklärt blieb die Frage nach der ersten Gründung. Die romanische Kirche erfuhr ebenfalls bauliche Veränderungen, die in wesentlichen Teilen in das 14. Jahrhundert zurückgehen. So wurden beispielsweise der romanische Chor und die Apsis des südlichen Seitenschiffes durch eine hochgotische Anlage ersetzt, weitere Umbauten betrafen die Außenwände der Seitenschiffe, die Apsis des nördlichen Seitenschiffes sowie die Westfront. Ein zur Kirche gehöriger Friedhof ist spätestens durch die Stadtansicht von Detmar Mulher aus dem Jahr 1611 bekannt. Sie zeigt nur das südlich der Kirche gelegene Bestattungsareal, während ein Belegungsplan von 1794 die Grabstellen des 18. Jahrhunderts rund um die Kirche mit Friedhofsmauern und Wegeführungen erfasst. Viele Namen der dort bezeichneten Grabstellen gehören bekannten Familien der Mariengemeinde. Sie stellten Ratsmitglieder und zählten zum Kaufmanns- oder gehobenen Handwerkerstand. Genannt seien hier die Namen Overbeck, Bürgermeister Brügmann, Berswordt, Küpfer, Wenker auf dem Markt und die Wirts- und Brauerfamilie der Krone am Markt. Nach dem napoleonischen Dekret Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Friedhof geschlossen, aber nie überbaut, lediglich im Süden und Osten erfolgten in den 60er Jahren Zerstörungen durch die Errichtung eines unterkellerten Gemeindehauses mit Anbindung an das Kirchengebäude und am Nordrand die Einbringung von Versorgungsleitungen in der Straßentrasse des Hellweg. Die Kirche St. Marien ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen. Zusätzlich ist jetzt beabsichtig, die Flächen des Kircheninneren und den Marienfriedhof als Bodendenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz NRW zu schützen. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich im Innern der Kirche Reste weiterer Kirchenbauten und Bestattungen sowie in den nicht überbauten Flächen Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 4 des Friedhofes eine dichte Belegung mit mittelalterlichen und neuzeitlichen Gräbern erhalten hat. Das Bodendenkmal stellt ein bedeutendes Zeugnis für die Geschichte des Menschen in der Region dar. Seine Eintragung als Denkmal soll aus wissenschaftlichen Gründen erfolgen, da es sich um eine für die historische Forschung wichtige Urkunde handelt. 2.3 Baudenkmal Hoher Wall 9 – 11, In-West, ehemaliges Postscheckamt Zwischen 1951 bis 1953 wurde das ehemalige Postscheckamt, das aus einem 8-geschossigen Baukörper quer zur Straße Hoher Wall, einem 5-geschossigen Bauteil parallel zum Hohen Wall und zwei an der Rückseite anschließenden 3- und 4-geschossigen Baukörpern besteht, gebaut. Der rückwärtige Hof wird von einer geschwungenen Mauer abgeschlossen. Auf der Frei- und Grünfläche vor dem Gebäude parallel zur Straße Hoher Wall befindet sich ein 1955 errichtetes Brunnenbecken mit Pferdeskulpturen. Bereits 1921 wurde in Dortmund ein erstes Postscheckamt eingerichtet, das für die Gebiete Dortmund und Münster (ohne Minden) zuständig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Postscheckamt ungefähr an der Stelle der kriegszerstörten Ober-Realschule errichtet. An dieser Stelle bestand bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine platzartige Erweiterung des Walls mit Grünanlagen, die sich parallel zum Wall Richtung Osten ausstreckte und vom Schauspielhaus abgeschlossen wurde. In dem Umlegungsplan der Dortmunder Innenstadt nach dem Zweiten Weltkrieg ist dies - wenn auch in Reduzierung auf den Bereich des Postscheckamtes und der Thierbrauerei - eine seltene Übernahme der Vorkriegssituation. Der Bereich am Hohen Wall wurde nach der Kriegszerstörung sehr schnell wiederaufgebaut. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Postscheckamt entstand wenig später das Verwaltungsgebäude der Thierbrauerei und gegenüber die Landeszentralbank. Die Oberpostdirektion Dortmund als Bauherr beauftragte den Postbaurat Schineis von der Oberpostdirektion Dortmund mit der Planung. Am 18.4.1951 wurden die Baupläne eingereicht und die Grundsteinlegung fand im Juli 1951 statt. Die Gebrauchsabnahme erfolgte am 12.4.1953 sowie die Betriebsaufnahme am 13.4.1953. Der 8-geschossige Hauptbaukörper im rechten Winkel zum Wall wurde als Stahlskelettbau errichtet. Er wurde als letzter Teil der Gesamtanlage innerhalb weniger Wochen aufgebaut und mit Backstein verkleidet. Ebenso wie der Hauptbaukörper sind der 5-geschossige Bauteil parallel zum Wall und die dazu quer gestellten Baukörper auf der Rückseite nach Norden mit flach geneigten Satteldächern überfangen. Trotz des Konstruktionsunterschiedes der Bauteile wurde durch die Verkleidung mit einem lebhaften roten Handstrichziegel und die sich wiederholende Dachform ein einheitliches Erscheinungsbild erzielt. Ebenso tragen die außenbündig in die Fassade eingelassenen Fenster mit weißen Rahmen zu einem homogenen Gesamteindruck bei und geben diesem frühen 1950erJahre-Bau eine moderne, sehr sachliche Gestaltung. Lediglich das leicht profilierte Natursteingesims verweist auf traditionalistischere Tendenzen und lässt Rückschlüsse auf die frühe Entstehungszeit zu. Die zwei Pferde darstellende Skulptur aus Granit mit den Maßen 2,5 x 4 x 2 m wurde 1955 nach Entwurf und Ausführung durch den Künstler Willy Meller in einem Brunnenbecken mit kleiner Fontäne aufgestellt. Auftraggeber war die Bundespost. Die Skulptur besteht aus fünf Granitblöcken. Die parallel zueinander, leicht versetzt stehenden Pferde sind zusammenhängend gearbeitet. Das ehem. Postscheckamt ist durch seine Gestaltung ein Vertreter der modernen, sachlichen Architektur der 1950er Jahre und ist ein seltenes Beispiel innerhalb der Dortmunder Innenstadt für die Wiederaufnahme der städtebaulichen Vorkriegssituation. Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 5 Das Gebäude zeigt für einen frühen 1950er-Jahre-Bau eine sehr moderne und sachliche Gestaltung der Fassaden, die auf die sonst üblichen traditionalistischen Tendenzen fast vollständig verzichtet. Das Objekt wurde in die Publikation „Bauten in Westfalen 1945-1957" (Nr. 145-146) aufgenommen, was erkennen lässt, dass dem Gebäude bereits von zeitgenössischen Fachleuten eine architektonische Qualität zuerkannt wurde. Reine Stahlskelettbauten, wie beim Hauptbaukörper des Postscheckamtes als Hochhaus, sind in Deutschland im Verwaltungsbau dieser Zeit selten. Die Vorteile der Stahlskelettbauweise liegen in der kurzen Bauzeit, dem geringen Eigengewicht, das große Geschosszahlen ermöglicht, und den weitgespannten Geschossdecken über stützenfreien Räumen, die für die Nutzung als Postscheckamt (Buchungssaal, Schalterhalle, Großraumbüros und Lagerräume) günstig waren. Das Dortmunder Postscheckamt ist zudem ein Zeugnis der Geschichte des Postscheckwesens. Nach den ersten Einrichtungen von Postscheckämtern im Rahmen der Eröffnung des Postscheckverkehrs 1909 wurde das Dortmunder Postscheckamt 1921 vor dem Hintergrund der Ausweitung des Postscheckverkehrs eröffnet. Mit dem Postscheckverkehr wurde erstmals flächendeckend ein bargeldloser Zahlungsverkehr eingeführt. Das Dortmunder Postscheckamt war mit den Bereichen Dortmund und Münster (mit Ausnahme des Bereichs Minden) für ganz Westfalen zuständig. Der Eigentümer des Gebäudekomplexes hat einen Antrag auf Eintragung in die Denkmalliste bei der Stadt Dortmund gestellt. 2.4 Baudenkmal Königswall 29, In-West, Verwaltungsgebäude der Emschergenossenschaft Am 30. Juni 1922 wurden die Bauzeichnungen zusammen mit einer Baubeschreibung für den Neubau „eines Bürohauses für die Emschergenossenschaft“ bei der Stadt Dortmund eingereicht. Gefertigt hatte sie der bekannte Essener Architekt Prof. Alfred Fischer. Am 8. November 1922 erhielt die Emschergenossenschaft den Bauschein. Bereits am 16. Februar 1923 erfolgte die Rohbauabnahme. Das Gebäude mit einer fünfgeschossigen, backsteinsichtigen Straßenfassade und einem steilen Satteldach, das expressive Architekturelemente besitzt, wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und in den Folgejahren in mehreren Etappen wieder aufgebaut, wobei man sich sehr eng an die Pläne von Fischer hielt. Besonders auffällig für den Betrachter ist der in der Mittelachse liegende Hauszugang, der von einer Reliefplastik, Poseidon mit dem Dreizack darstellend, bekrönt wird. Insbesondere hier lassen sich die expressiven Züge nachvollziehen. Das Gebäude der Emschergenossenschaft dokumentiert in besonderer Weise zusammen mit dem direkt benachbarten Verwaltungsgebäude der AOK (Königswall 25 - 27, Architeken: Flerus und Konert) die städtebauliche Entwicklung Dortmunds in den 1920er und darüber hinaus in den 1950er Jahren. Die besondere städtebauliche Anlage, die durch die geschwungene Fassade des Emschergenossenschaftsgebäudes im Zusammenspiel mit dem benachbarten AOK-Gebäudes entsteht, geht auf städtebauliche Planungen der 1910er und 1920er Jahre zurück und spiegelt die Bemühungen der Stadtverwaltung wider, Dortmund zu einer modernen Großstadt umzubauen. Der Fassadenschwung der beiden Verwaltungsgebäude am Königswall schafft in diesem Bereich ein geschlossenes, qualitätvolles Stadtbild. Bemerkenswert ist auch, dass dieser Bereich trotz der sehr fortschrittlichen Wiederaufbauplanungen in der Dortmunder Innenstadt nach dem 2. Weltkrieg nahezu unverändert bestehen blieb. Durch den Abriss der Vorkriegsbebauung im Bereich der ehem. Lindenstraße und des ehem. Königswall entstand nach dem 2. Weltkrieg eine völlig neue Quartiersstruktur, die jedoch die Lage des AOK- Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 6 Gebäudes und der Emschergenossenschaft städtebaulich aufwertete und einen Hinweis darauf gibt, dass die Planung der 1920er Jahre auch im Wiederaufbau geschätzt wurde. Die Beibehaltung des Schwungs der Gebäudefassaden und die Umbenennung der Schmiedingstraße in Königswall könnte als formaler Bezug der Wiederaufbauplanung auf die mittelalterliche Wallanlage der Stadt gedeutet werden. 2.5 Baudenkmal Lindemannstraße 18, In-West, Wohnhaus Der Architekt Wilhelm van Koten erwarb von der Stadt Dortmund mehrere Flurstücke an der Lindemannstraße, um sie in der Folgezeit mit Einfamilienhäusern nach eigenen Entwürfen zu bebauen. Als Bauherr trat der Architekt ebenfalls auf. Nach Fertigstellung der Häuser wurden diese dann veräußert. Sowohl in der Ausstattung als auch in der Grundrissaufteilung besitzen die Gebäude starke Übereinstimmungen. In die Denkmalliste der Stadt Dortmund sind die Gebäude Lindemannstraße 20, 22, 24, 28, 30 und 32 eingetragen. Das Haus Nr. 26 ist wegen des Veränderungsgrades hiervon ausgenommen. Van Koten reichte am 1. Oktober 1903 die Unterlagen für den Bau eines Wohnhauses in der Lindemannstraße 18 bei der Stadt Dortmund ein. Geplant war ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Keller und ausgebautem Dachgeschoss. Die Reihenhausbebauung an der Lindemannstraße stellt eine städtebauliche Besonderheit dar. Die umliegende Bebauung an dieser wichtigen Verkehrsachse wurde als drei- bis viergeschossige, geschlossene Blockrandbebauung errichtet. Zeitlich entstanden diese Mietshäuser mit teilweiser Geschäftsunterlagerung nach den kleinen Einfamilienhäusern. Mehrheitlich wurden sie um 1910 in der Formensprache der sogenannten Reformarchitektur gebaut. Dennoch wirken die Einfamilienhäuser nicht wie ein Fremdkörper, sondern stellen eine abwechslungsreiche Spielform im großzügigen Straßenbild dar. Dies wird zudem durch die Anlage der kleinen Vorgärten unterstützt. Obwohl der Architekt die Häuser nahezu typenhaft im Grundriss konzipierte, gab er den Häusern an der Straßenfassade ein abwechslungsreiches, individuelles Gepräge. Das Typenhafte fand auch im Innern der Häuser seinen Niederschlag. Die Verwendung bestimmter Materialien und ihrer gestalterischen Ausprägung wiederholt sich in den Innenräumen. Vermutlich wurden hierfür auch dieselben Handwerker beschäftigt. Der Eigentümer des Wohnhauses hat einen Antrag auf Eintragung in die Denkmalliste bei der Stadt Dortmund gestellt. 2.6 Baudenkmal Marienkirchhof 1, In-West, Evangelisches Gemeindehaus Nach den starken Kriegszerstörungen begannen im August 1948 die Instandsetzungs/Wiederaufbauarbeiten der Marienkirche unter der Leitung des Architekten Hermann Kessemeier. Am 2. Juni 1957 fand die Wiedereinweihung der Kirche statt. Frühzeitig setzte sich die Gemeinde auch mit dem Gedanken zum Bau eines Gemeindehauses auseinander und verband dies mit der Idee, das Gemeindhaus mit einem Geschäftshaus zu kombinieren. Mit der Planung dafür wurde ebenfalls der Architekt Kessemeier beauftragt. Die Planungsüberlegungen wurden begleitet von intensiven Gesprächen mit der Planungsverwaltung und dem Landeskonservator. Am 29. Januar 1960 reichte der Pfarrer Lorenz im Auftrage des Presbyteriums der Kirchengemeinde einen Bauantrag zu Bau eines Gemeindehauses mit Geschäftsunterlagerung und vier Wohnungen ein. Am 7. Februar 1963 Fortsetzung der Vorlage: Drucksache-Nr.: Seite 00898-15 7 wurde die Gebrauchsabnahme des L-förmigen Baukörpers durchgeführt, der südöstlich an die Kirche und nach Süden einen dreigeschossigen, mit Naturstein verkleideten Baukörper ausbildet. Mit der weitreichenden Zerstörung der Dortmunder City im Zweiten Weltkrieg entschlossen sich die Verantwortlichen der Stadt zu einer Neuordnung der Innenstadt. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Marienkirche dicht, insbesondere im Chorbereich, von einer Bebauung umschlossen. Freigehalten davon war lediglich der sich ehemals südlich der Kirche erstreckende hochmittelalterliche Friedhof. Mit der Neuordnung des Citybereiches entsprach Dortmund dem städtebaulichen Leitbild der 50er Jahre nach einer gegliederten und aufgelockerten sowie autogerechten Stadt. Dabei entwickelte sich die Kleppingstraße von einer schmalen, verwundenen Gasse zu einer breiten Magistrale als neue Nord-Südachse in der Innenstadt. Die hochgotischen Choranlagen von St. Reinoldi und St. Marien besaßen mit der Freistellung ein anderes Gewicht im öffentlichen Straßenraum und auch im öffentlichen Bewusstsein. In der Baubeschreibung zu seinem zweiten, deutlich von der ersten Planung abweichenden Entwurf (1960) äußerte sich der Architekt Kessemeier zur städtebaulichen Bedeutung: „Das dreigeschossige Hauptgebäude grenzt an seiner Südseite unmittelbar an den vorgesehenen Parkplatz und an die geplante Nachbarbebauung. Der Marienkirchplatz ist als Einstellfläche für den Zubringerverkehr vom Schuhhof her vorgesehen, soll im Übrigen aber eine Verbindung zwischen dem alten Markt und der Kleppingstraße und ein ruhiger Platz zum Verweilen sein.“ In der architektonischen Durchbildung seines L-förmigen Bauköpers berücksichtigte er diesen Anspruch. Sein Verbindungsbau von der Sakristei zum 3geschossigen Hauptbau wird optisch als eine Art Brückenelement wahrgenommen. Mit der gefundenen Form für das Gemeindehaus erfüllte Kessemeier zugleich die Forderungen nach: Durchlässigkeit vom Markt über den Marienkirchhof zur Kleppingstraße, bei gleichzeitigem Schaffen eines Riegels zur Platzabgrenzung, Schaffung eines ruhigen Platzes zum Verweilen, ohne dabei den Zubringerverkehr auszuschließen, die gute Einsehbarkeit der Marienkirche von der Kleppingstraße. In Würdigung der Zusammenführung von öffentlichen, gemeindlichen und privaten Belangen entwickelte der Architekt Kessemeier eine gelungene städtebauliche Lösung, bei der die gewünschten städtebaulichen Ziele der Stadt Dortmund Berücksichtigung fanden. Es entstand eine kleine, scheinbar in sich geschlossene und doch nach mehreren Seiten offene Platzanlage auf dem geschichtsträchtigen Boden eines hochmittelalterlichen Friedhofes. Für den Bau des Gemeindehauses nutzte er eine angemessene, konsequente und zeittypische Architektursprache.