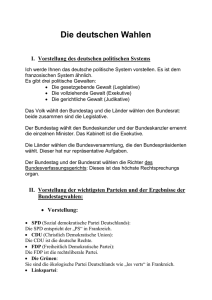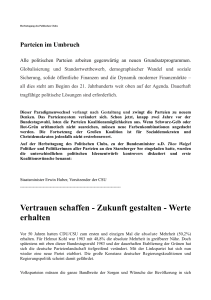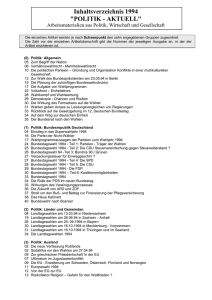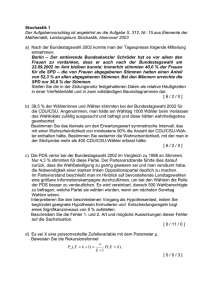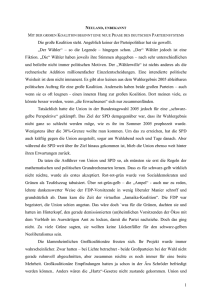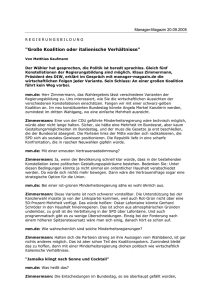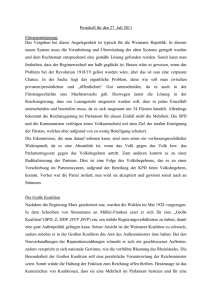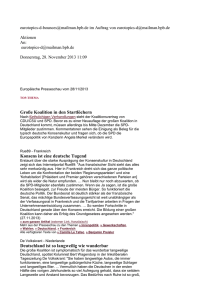Jens Tenscher · Helge Batt (Hrsg.) 100 Tage Schonfrist
Werbung
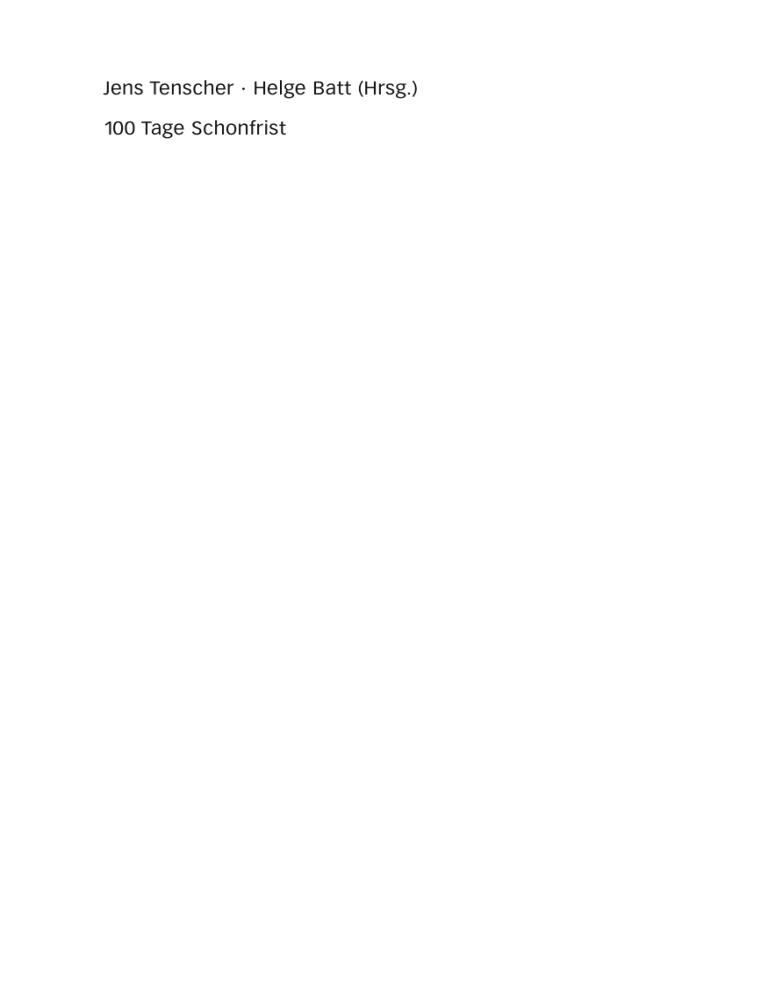
Jens Tenscher · Helge Batt (Hrsg.) 100 Tage Schonfrist Jens Tenscher · Helge Batt (Hrsg.) 100 Tage Schonfrist Bundespolitik und Landtagswahlen im Schatten der Großen Koalition Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. . 1. Auflage 2008 Alle Rechte vorbehalten © VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008 Lektorat: Katrin Emmerich / Marianne Schultheis Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. www.vs-verlag.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Druck und buchbinderische Verarbeitung: Krips b.v., Meppel Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in the Netherlands ISBN 978-3-531-15197-7 Inhalt Helge Batt & Jens Tenscher 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? Mythos und Zwischenbilanz..................................................................................... 7 Nach der Bundestagswahl: Regierung, Medien, öffentliche Meinung Heiner Geißler Zur Schonung gezwungen? Politischer Attentismus nach der Bundestagswahl 2005 ........................................ 23 Uwe Jun Auf dem Weg zur Großen Koalition: Regierungsbildung in Deutschland 2005................................................................ 27 Bernhard Kornelius & Dieter Roth Regierungswechsel = Stimmungswechsel? Pragmatischer Realismus nach der Bundestagswahl .............................................. 55 Frank Brettschneider & Markus Rettich „100 Tage Medien-Schonfrist“? Regierungen in der Medienberichterstattung nach Bundestagswahlen .................. 73 Landtagswahlen in Zeiten der Großen Koalition Richard Hilmer Landtagswahlen 2006 im Zeichen der Großen Koalition: Eine vergleichende Betrachtung............................................................................. 93 Jens Tenscher Große Koalition – kleine Wahlkämpfe? Die Parteienkampagnen zu den Landtagswahlen 2006 im Vergleich................... 107 6 Inhalt Bernd Schlipphak & Ulrich Eith Die baden-württembergische Landtagswahl 2006 im Einflussfeld der Bundespolitik: Auswirkungen und Rückwirkungen ..................................................................... 139 Sigrid Koch-Baumgarten Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2006 und ihre bundespolitische Bedeutung................................................................................. 155 Klaus Detterbeck Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006: Der landespolitische Parteienwettbewerb und der (ungewöhnlich kleine) Schatten der Bundespolitik................................................................................... 177 Nach den Landtagswahlen: Regierung, Parteien, öffentliche Meinung Axel Murswieck Von Schröder zu Merkel – eine Frage des (Regierungs-)Stils? Zu den Machtressourcen der Bundeskanzlerin in einer Großen Koalition ........... 199 Helge Batt Weder stark noch schwach – aber nicht groß: Die Große Koalition und ihre Reformpolitik ....................................................... 215 Matthias Micus & Franz Walter Entkopplung und Schwund: Parteien seit der Bundestagswahl 2005 ................................................................ 247 Richard Meng Das Bündnis der Artgleichen: Eine kritische Zwischenbilanz der Großen Koalition aus journalistischer Sicht.. 283 Autorenverzeichnis .................................................................................. 297 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? Mythos und Zwischenbilanz Helge Batt & Jens Tenscher1 1 Einleitung Das Jahr 2005 stellte in vielerlei Hinsicht eine politische Zäsur für die Bundesrepublik Deutschland dar: Bundeskanzler Gerhard Schröder und SPD-Chef Franz Müntefering kündigten noch am Abend der für die Sozialdemokraten verlorenen gegangenen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen an, die eigentlich für den Herbst 2006 vorgesehene Bundestagswahl um ein Jahr vorziehen zu wollen. Dadurch sollte, so die offizielle Begründung, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, über die Fortführung der von Rot-Grün eingeleiteten Reformen direkt abzustimmen. Gleichzeitig beabsichtigte Gerhard Schröder, sich eine neue, zuverlässige Bundestagsmehrheit zu beschaffen (vgl. u.a. H. Batt 2007: 64ff.). Über den Umweg des geplanten Vertrauensentzugs durch die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages wurde das Parlament – zum dritten Mal nach 1972 und 1983 – durch den Bundespräsidenten aufgelöst. Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 25. August dessen Entscheidung zur Auflösung bestätigt hatte, war der Weg zu vorgezogenen Neuwahlen frei, welche am 18. September 2005 stattfinden sollten; zu einem Zeitpunkt also, als der Wahlkampf bereits auf Hochtouren lief (vgl. hierzu u.a. K.-R. Korte 2005). Dieser zeichnete sich „durch eine besondere Intensität, eine ausgeprägte Bereitschaft zur Konfrontation sowie eine Re-Politisierung“ (J. Tenscher 2007: 65) aus und führte zu einem für viele Beobachter unerwarteten Ergebnis: vergleichsweise geringe Verluste auf Seiten der SPD, aber – überraschenderweise – auch bei den Unionsparteien sowie der klare Einzug von Grünen, FDP und Linken in den Bundestag. Dieses Ergebnis machte eine der erwünschten und in Bund und Ländern vielfach erprobten Regierungskoalitionen entlang der etablierten „Lagergrenzen“ unmöglich, insbesondere weil sich das Wahlbündnis aus PDS und WASG für keine Partei als Koalitionspartner anbot. Die – nahezu logische – Konsequenz war schließlich die Bildung der zweiten Großen Koalition, eines Bündnisses der „Verlierer“ (B. Kornelius/D. Roth 2007), und die Wahl Angela Merkels zur ersten Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Seither sind zwei Jahre vergangen und die Legislaturperiode hat ihre Halbzeit hinter sich gebracht. Diese Phase möchte der vorliegende Band nutzen, um eine 1 Wir danken Matthias Bandtel für seine umfängliche Unterstützung bei der Formatierung der Beiträge dieses Bandes. 8 Helge Batt & Jens Tenscher Zwischenbilanz der zweiten Großen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu ziehen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf deren Startphase gelegt. Schließlich standen Regierungswechsel, Regierungsstil und politischer „Neubeginn“ angesichts der turbulenten bundespolitischen Situation des Jahres 2005 unter besonderer massenmedialer Beobachtung und erhöhter öffentlicher Erwartungshaltung. Dies gilt umso mehr, als die üblicherweise neu gewählten Regierungschefs eingeräumten 100 Tage Schonfrist nahezu zeitgleich mit den Landtagswahlen am 26. März 2006 in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt endeten (vgl. hierzu J. Schmid/U. Zolleis 2007). Diese zeitliche Koinzidenz schien sowohl für die Akteure im Bund als auch in den betroffenen Ländern nachhaltige Folgen zu haben: Auf der einen Seite mündete die bundespolitische Situation – zumindest bei SPD und CDU – in eine Rückbesinnung auf landesspezifische Problemlagen und kam in vergleichsweise „lahmen“, wenig polarisierten Landtagswahlkämpfen zum Ausdruck. Auf der anderen Seite schien das politische „Durchstarten“ im Bund, insbesondere die Auseinandersetzung zwischen den Großkoalitionären auf die Zeit nach den regionalen Frühjahrswahlen verschoben worden zu sein. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der vorliegende Sammelband, die politische Umbruchphase seit dem Ende des rot-grünen Projekts und insbesondere die Phase des Amtsantritts der Regierung der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD zu beleuchten. Dazu werden Perspektiven der Regierungs-, Parlamentarismus-, Parteien-, Medien-, Wahl(kampf)- und Policy-Forschung sowie bundes- und landespolitische Sichtweisen zusammengeführt. Mit dem Blick auf die Phase des Regierungsstarts einerseits und die Wechselwirkungen von bundespolitischer Regierungsbildung und Landtagswahlen im Schatten einer Großen Koalition andererseits wird an dieser Stelle ein neuer Akzent gesetzt. Im Vergleich zu abschließenden Bewertungen bundespolitischer Regierungstätigkeit (vgl. u.a. C. Egle/R. Zohlnhöfer 2007) begeben sich die vorliegenden Diagnosen zur Zeit des „Atemholens“ nach dem Wahlkampf 2005 (vgl. u.a. die Beiträge in E. Jesse/R. Sturm 2006; F. Brettschneider et al. 2007) und die daraus abgeleiteten Prognosen für den politischen Wettbewerb in Bund und Ländern also in besonderer Weise auf den Prüfstand. Zugleich verdeutlichen sie die für den föderalen Bundesstaat charakteristischen, vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Bundes- und Landespolitik, die nicht nur das Wahlverhalten, sondern eben auch den regionalen Wahlkampf, die Regierungsbildung bzw. -findung, die Parteienkonstellationen, das öffentliche „Stimmungsklima“ und – nicht zuletzt – das politische Handeln in Bund und Ländern nachhaltig tangieren (vgl. u.a. G. Lehmbruch 2000; D. Hough/C. Jeffrey 2003; S. Mielke/W. Reutter 2004). 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 2 9 100 Tage Schonfrist – nichts als ein Mythos? Markante Zeitpunkte fordern die Beobachter aus Wissenschaft und Medien in besonderem Maße heraus, das Handeln politischer Akteure zu analysieren. Sie liefern den Anlass, die Arbeit und die Tätigkeit von Regierungschefs, Regierungen, Parlamenten und Parteien zu bilanzieren. Dabei interessiert, wie diese Akteure bei der Bewältigung der anstehenden Probleme eines Landes, bei der Erfüllung eines Regierungsprogramms oder eines Koalitionsvertrages und anderer, von außen an die Akteure herangetragenen Anforderungen abschneiden. Ganz besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Zeitspanne der ersten 100 Tage einer neuen Regierung zu. Es mag willkürlich erscheinen, gerade 100 Tage als Markstein für eine erste Beurteilung einer neuen Regierung heranzuziehen. Mit großer Sicherheit kann nach zwei Jahren oder – wie in Demokratien üblich – zum Ende einer Legislaturperiode mehr darüber gesagt werden, ob neue Führungskräfte in politischen Herrschaftsfunktionen ihre Aufgaben erfolgreich erfüllt haben. Dass schon nach 100 Tagen eine erste Zwischenbilanz gezogen wird, lässt sich historisch erklären.2 Der erste, dem eine entsprechende 100tägige Schonfrist zugebilligt wurde, war der USamerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der diese Zeit nach seinen Wahlerfolgen in den 1930er Jahren als notwendig erachtete, bis der Erfolg der radikalen Wirtschaftsreformen des von ihm initiierten „New Deals“ die damit verbundenen Belastungen und Zumutungen übersteigen würde. In diesen ersten knapp drei Monaten seinen Amtszeit, die in die Geschichte als „The Hundred Days“ (J. Alter 2006) eingegangen sind, setzte Roosevelt zusammen mit dem Kongress mehr Gesetze in Kraft, um die amerikanische Wirtschaftskrise zu bekämpfen, als viele andere US-Präsidenten in ihrer gesamten Präsidentschaft. Ihm nachfolgende USPräsidenten, insbesondere John F. Kennedy, knüpften konsequenterweise an den Mythos der ersten 100 Tage an, der sich auch im Nachkriegsdeutschland zu einer politischen Gepflogenheit entwickelte. So stellen die ersten 100 Tage mittlerweile einen Meilenstein in der Amtszeit der Regierenden dar, eine magische Grenze mit – insbesondere für außen stehende Beobachter – hoher symbolischer, aber – für die politischen Akteure selbst – eben auch politikpraktischer Bedeutung (vgl. u.a. G. Pitronaci 2005; I. von Holly 2006: 155). Zum einen gelten die ersten 100 Tage als Anlauf- und Orientierungsphase für die frisch ins Amt Gewählten. Sie sind eine Schonzeit und eine Periode des „Waffenstillstands“, in der sich die politische Konkurrenten ebenso wie die journalistisch Beobachtenden vergleichsweise „milde“ und zurückhaltend zeigen, in deren Verlauf eine neue Regierung sich in ihre Arbeit einfinden, sich einarbeiten, Routinen entwickeln, den Faden der Regierungstätigkeit aufnehmen, die politische Agenda aufstellen, Personalentscheidungen treffen und erste Entscheidungen auf den 2 Historisch geht der Begriff auf die 100 Tage zwischen dem 1. März 1815 und dem 18. Juni 1815 zurück. Dies war die Zeit zwischen Napoleons Rückkehr aus dem Exil und seiner endgültigen Niederlage bei Waterloo (vgl. St. Coote 2005). 10 Helge Batt & Jens Tenscher Weg bringen kann. Regierungshandeln ist ein komplexer Prozess und Entscheidungen benötigen in aller Regel eine gewisse Vorlaufzeit, um hinsichtlich ihrer Qualität und ihres Erfolgs beurteilt werden zu können. Die ersten 100 Tage sollen diesbezüglich zur weithin „unbedrängten“ personellen wie inhaltlichen Findung und Vorbereitung politischer Vorhaben dienen. So zumindest sieht es das stillschweigende Abkommen zwischen Regierenden, politischen Gegnern, Massenmedien und Wählern vor; wenngleich sich nicht alle und nicht zu jeder Zeit daran zu halten scheinen. Neben dieser politikpraktischen Bedeutung stehen die ersten 100 Tage zum anderen auch für einen symbolischen Zeitraum, mit dessen Ablauf eine erste Bilanz der Tätigkeit einer neuen Regierung durch Medien und Opposition gezogen wird; wohl wissend, dass diese Zeit eigentlich für eine neue politische Führung zu kurz ist, um sich einarbeiten und erste Entscheidungen treffen zu können. Und dennoch muss sich diese nach 100 Tagen, ebenso wie Führungspersönlichkeiten anderer Gesellschaftsbereiche – ob aus Wirtschaft, Kultur oder Sport –, nach den ersten 100 Tagen in ihrer Rolle messen lassen; dies gilt für die Bundeskanzlerin genauso wie für Fußballbundestrainer oder Vorstandsvorsitzende (vgl. M. Trän 2002; T. J. Neff/J. M. Citrin 2005; St. Stern 2007). Nach 100 Tage ist die Findungs- und Schonungsphase beendet und es werden – gerade im politischen Bereich – von Konkurrenten und massenmedialen Beobachtern schwerere „Geschütze aufgefahren“. So sind die ersten 100 Tage im Amt für die Regierenden nicht nur eine Schonzeit, sondern zugleich auch eine für die weitere Legislaturperiode grundlegende Phase, in der sich den Handelnden vergleichsweise große (politische) Gestaltungsmöglichkeiten bieten, die aber auch sehr risikoreich und für das weitere Schicksal entscheidend sein kann. Man denke nur daran, dass mit der Invasion in der kubanischen Schweinebucht am 17. April 1961 ein militärisches und politisches Debakel für die USA just in den ersten 100 Tagen der Regierungsübernahme John F. Kennedys begann. Aber auch jenseits solch dramatischer Ereignisse sind die ersten 100 Tage einer Regierung nicht nur eine beschauliche Einarbeitungszeit. Denn von Beginn an werden – gerade nach einem Wechsel der Regierungsgeschäfte – formale Entscheidungen, informelles Verhalten, symbolische Akte und Entscheidungsstile von den politischen Konkurrenten, den journalistischen Beobachtern und Kommentartoren sowie den Wählern genau beobachtet und im Hinblick auf spätere Vorhaben und Entscheidungen bewertet. Alle Handlungen senden Botschaften aus, geben den Ton vor, wecken Erwartungen für spätere Zeiten und kommunizieren Informationen über Entscheidungsstile, Führungsqualitäten und inhaltliche Präferenzen der neuen Führungskräfte. Aus diesen Gründen können die ersten 100 Tage im Amt ein wichtiges Fundament für den späteren Erfolg – oder auch Misserfolg – von Regierungen und Führungspersonen in anderen gesellschaftlichen Sphären legen (vgl. T. J. Neff/J. M. Citrin 2004). Insoweit ist die Metapher von der „Schonzeit“ irreführend: Der Druck auf neue Führungspersönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport ist vom ersten Tag an vorhanden, 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 11 wenngleich er sich öffentlich nach Überwindung der 100-Tage-Frist in stärkerem Maße manifestiert. In der 100-Tage-Phase des Einarbeitens und des Beobachtetwerdens ist die richtige Balance zwischen Analyse und Handeln entscheidend (vgl. A. Maitland 2005). Richtige Entscheidungen können nach innen integrativ auf die Regierung wirken und nach außen hin Signale der Handlungsfähigkeit und Dynamik setzen. Rasche und tief greifende Entscheidungen bereits in den ersten 100 Tagen können durch krisenhafte Zustände auch erzwungen werden oder sie können deswegen sinnvoll sein, weil zu einem frühen Zeitpunkt „schmerzhafte“ politische Entscheidungen von Bürgern und Wählern leichter toleriert werden als zu späteren Zeiten. Solche Entscheidungen können aber auch die genau entgegengesetzte Wirkung entfalten, wenn sie nicht in die komplexen politisch-institutionellen und politischprozessualen Rahmenbedingen einer neuen Regierung eingebunden sind. In einem solchen Fall kann es durch nicht angemessene Entscheidungen einer neuen Regierung bereits in den ersten 100 Tagen zu Entfremdungsprozessen innerhalb der Regierung und zu erheblichem Vertrauensverlust seitens der Medien und der Wähler kommen. 3 Zum Inhalt des Bandes Ziel des vorliegenden Bandes ist es, die ersten 100 Tage der zweiten Großen Koalition der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren und dabei herauszufinden, in welchem Maße die Chancen einer „Schonfrist“, so diese denn überhaupt eingeräumt wurde, genutzt wurde. Dabei geht der Blick nicht nur auf die Regierenden selbst, sondern auch auf politische Konkurrenten, die Parteien, die Massenmedien sowie die Wählerinnen und Wähler. Die in doppelter Hinsicht besondere Konstellation – die Bildung einer Großen Koalition im Bund sowie die zeitliche Koinzidenz mit den Landtagswahlen im März 2006 – verlangt nach einer umfassenden Betrachtungsweise, die auch mit dem Ablauf der 100-Tage-Schonfrist nicht abbrechen kann. So nehmen die Beiträge dieses Sammelbandes den Regierungsstart und die Politik der Großen Koalition, deren massenmediale Resonanz und öffentliche Wahrnehmung erstens unter der beschriebenen Perspektive der ersten 100 Tage bis hin zum Zeitpunkt der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt in den Blick. Zweitens wird ein Blick auf die Wahlkämpfe und die Wahlen in diesen drei Bundesländern geworfen, der Blick mithin weg von der Bundes- und hin auf die Landesebene gerichtet, nicht zuletzt, um die wechselseitige Durchdringung politischen Handelns und Kommunizierens im föderalen System zu verdeutlichen. Drittens werden, aus der Perspektive des Herbsts 2007, das Zustandekommen der Großen Koalition, deren Findungsphase in den ersten 100 Tagen sowie der weitere Verlauf der Arbeit der Bundesregierung bis zum Ende der ersten Hälfte der Legislaturperiode untersucht. 12 Helge Batt & Jens Tenscher Im Einzelnen ist der Band in drei Teile gegliedert: Der erste Teil widmet sich den politischen Akteuren und der öffentlichen Meinung nach der Bundestagswahl. Im zweiten Teil werden die Wahlkämpfe und die Landespolitik in den drei Bundesländern untersucht, in denen im Frühjahr 2006 Landtagswahlen stattfanden. Im Mittelpunkt des dritten Teils steht schließlich die Analyse der Tätigkeit der Großen Koalition nach dem Ende der ersten 100 Tage bis zum Ende der ersten Hälfte der Legislaturperiode im Herbst 2007. 3.1 Nach der Bundestagswahl: Regierung, Medien und öffentliche Meinung Den Auftakt des Bandes stellen die einführende Beobachtungen Heiner Geißlers dar. Diese beleuchten aus Sicht der politischen Praxis die allenthalben bemängelte Bewegungslosigkeit der politischen Klasse nach der Bundestagswahl 2005. Diese sei vor allem eine Folge der „gefühlten“ Abstrafung durch die Wähler gewesen. Die „Schockstarre“ von Schwarz und Rot nach der Bundestagswahl wurde, so die Annahme Geißlers, weiter dadurch gesteigert, dass weder die Agenda 2010 der alten rot-grünen Regierungsmehrheit noch das neoliberale Wahlprogramm der Unionsparteien eine Mehrheit der Wähler hatte hinter sich vereinigen können. Damit standen die Parteien der neuen Großen Koalition programmatisch mit leeren Händen da, und die Regierungsparteien mussten sich zunächst einmal ein politikinhaltlich neues Regierungsprogramm erarbeiten. Dabei gelang es der CDU unter Führung von Angela Merkel nach Ansicht des Autors recht schnell, sich von der neoliberalen Programmatik des Leipziger Parteitages zu lösen. Dessen ungeachtet scheint die Diskrepanz zwischen den Wahlprogrammen und Wahlkampfaussagen einerseits und der späteren Politik der Regierungsparteien andererseits niemals größer gewesen zu sein als im Falle der zweiten Großen Koalition. Der sich anschließende Beitrag Uwe Juns konzentriert sich insbesondere auf den Prozess der Regierungsbildung. Dieser wird unter einem parteisystematischen Blickwinkel beleuchtet. Der Beitrag analysiert Argumente und Erklärungsansätze für die Bildung der Großen Koalition sowie das Nichtzustandekommen anderer parteipolitischer Regierungskonstellationen. Auf dieser Basis werden Schlussfolgerungen für künftige Koalitionsbildungen sowie die Struktur des Parteiensystems getroffen. Diesbezüglich ist nach Ansicht Juns erstens zu beobachten gewesen, dass die Bildung der Großen Koalition sowohl die wechselseitige programmatische Annäherung von Schwarz und Rot als auch eine politische De-Polarisierung befördert habe. Beides sei durch die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der Koalitionspartner in der alltäglichen Regierungsarbeit noch verstärkt worden. Zweitens sei das Parteiensystem seit der Bundestagswahl 2005 in besonderem Maße durch die Suche von Bündnis 90/Die Grünen nach neuen Koalitionsoptionen gekennzeichnet gewesen. Drittens ist schließlich der Verlust der Orientierungs- und Bindungskraft der Parteien sowie die neue Unübersichtlichkeit der Koalitionsoptionen charakteristisch für die jüngste Entwicklung der Parteien- und Koalitionenland- 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 13 schaft der Bundesrepublik. Die Analyse lässt erwarten, dass künftig in stärkerem Maße situative Entscheidungen die Koalitionsbildung und damit die parteipolitische Zusammensetzung der Regierungen in Bund und Ländern beeinflussen werden. Im anschließenden Beitrag gehen die Wahlforscher Bernhard Kornelius und Dieter Roth auf empirischer Basis der Frage nach, inwieweit der von den Wählerinnen und Wählern „erzwungene“, jedoch nur bedingt gewünschte Regierungswechsel im Jahr 2005 auch zu einem Stimmungswechsel unter den Bürgerinnen und Bürgern führte. Anhand eines Vergleichs repräsentativer Bevölkerungsumfragen zu den „Akklimatisierungsphasen“ nach den Bundestagswahlen 1998, 2002 und 2005 wird nicht nur deutlich, wie stark die anfängliche Skepsis des Wahlvolks gegenüber der zweiten Großen Koalition ausgeprägt war, sondern auch wie schnell sich in der Bevölkerung eine Art Aufbruchstimmung breit machte, von der das neue Regierungsbündnis und vor allem die Bundeskanzlerin zunächst profitieren konnten. Jedoch veränderte sich mit Ablauf der 100 Tage Schonfrist, im Zuge der koalitionären Auseinandersetzungen um ein reformiertes Gesundheitsmodell und dem eigentlich Beginn des politischen Durchstartens, die politische Großwetterlage rapide: Die Zweifel an der Problemlösungsfähigkeit von Schwarz-Rot wurden größer, insbesondere die CDU, aber auch Angela Merkel verloren ab März 2006 dramatisch in der Gunst der Bürgerinnen und Bürger – ein Stimmungstief, aus dem sich die Kanzlerin (nicht jedoch die Regierung) erst durch ihr außenpolitisches Handeln im Jahr 2007 wieder befreien konnte. Wie nach den Regierungswechseln 1982 und 1998 verwandelte sich also innerhalb nur eines Jahres der anfängliche Optimismus in pragmatischen Realismus. Einen wirklichen Stimmungswechsel nach dem Regierungswechsel 2005 gab es demzufolge nicht. Inwieweit dies auch für die Medienberichterstattung zutrifft, inwieweit die „Vierte Gewalt“ den frisch ins Amt Gewählten eine Schonfrist gönnte und in welchem Maße dies nach dem Regierungswechsel 2005 geschah, verdeutlicht der sich anschließende Beitrag Frank Brettschneiders und Markus Rettichs. Dieser stützt sich auf eine umfängliche inhaltsanalytische Auswertung der Nachrichtensendungen der fünf reichweitenstärksten Fernsehanstalten von Oktober 1998 bis Juli 2006; bettet also ebenfalls den Regierungsstart 2005/2006 in einen größeren zeitlichen Kontext ein. Dabei wird deutlich, dass die Medien weder 1998 noch 2002 das (neue) Regierungsbündnis mit Samthandschuhen anfassten: Eine, sogar auf rund 300 Tage ausgedehnte, mediale Schonfrist gab es nur für den 1998 ins Amt gewählten „Medienkanzler“ Gerhard Schröder. Auch seine Nachfolgerin, Angela Merkel, konnte 2005 mit einem Medienbonus starten, von dem dieses Mal aber auch das neue Regierungsbündnis in Gänze profitierte. Dieses kam, zumindest so lange das großkoalitionäre „Stillhalteabkommen“ bis zu den Landtagswahlen im März 2006 noch währte, deutlich besser in der Medienberichterstattung weg als die beiden Vorgängerregierungen. Erst die dann öffentlich werdenden Auseinandersetzungen zwischen den Koalitionären um das weitere politische Vorgehen veränderten die Tonlage, die sich in einer zunehmend kritischer werdenden Medienbericht- 14 Helge Batt & Jens Tenscher erstattung manifestierte. Je mehr es also um konkrete Politik ging und Bruchstellen innerhalb der Großen Koalition im Jahr 2006 zum Vorschein kamen, desto mehr gerieten die Regierenden – und mit ihnen die Kanzlerin – unter medialen Druck und, dem folgend, in ein öffentliches Stimmungstief. Die Massenmedien entpuppten sich hierbei, so die Interpretation der Autoren, eher als Reflektor politischer Auseinandersetzung und weniger als eigenständige Opposition. Sie gewährten keine Schonfrist, sondern spiegelten in hohem Maße die Intensität und Offenheit der politischen Kontroverse wider. 3.2 Landtagswahlen in Zeiten der Großen Koalition Den Auftakt des Perspektivenwechsels weg von der Bundes- und hin zur Landesebene macht der Beitrag Richard Hilmers. Dieser geht der Frage nach, in welchem Maße der viel zitierte „Testcharakter“ von Landtagswahlen auch unter den (seltenen) Bedingungen einer Großen Koalition im Bund Bestätigung findet und welche „Botschaften“ von den Landtagswahlen des Jahres 2006 an die einzelnen Parteien ausgingen. Dabei wird deutlich, dass die Kräfteverhältnisse im Bund zu einer Stärkung des Primats der Landespolitik gegenüber bundespolitischen Aspekten aus Sicht der Wählerinnen und Wähler führten. Dies trifft insbesondere auf diejenigen Wahlen zu, die zum Ende der 100-Tage-Periode in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt stattfanden. Der oben skizzierte Umschwung in der Medienberichterstattung und in der Bevölkerungsmeinung nach dem „Ende des Burgfriedens“ unter den Großkoalitionären führte dann jedoch zu einer – für „Nebenwahlen“ durchaus typischen – Abstrafung von SPD und CDU und einem Erstarken der außerparlamentarischen Parteien bei den Landtagswahlen, die im September 2006 in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern folgten. Doch auch hier wurden alle Ministerpräsidenten im Amt bestätigt. Schließlich setzte sich bei allen fünf Landtagswahlen des Jahres 2006 der Trend sinkender Wahlbeteiligung fort. Diesbezüglich schien von der Großen Koalition im Bund und der dadurch eher gemäßigten parteipolitischen Konfrontation zwischen CDU und SPD auch auf Landesebene – insbesondere bei den März-Wahlen – eine verstärkende, sedative Wirkung auszugehen. Inwieweit das Desinteresse der Wählerinnen und Wähler sowie die geringe Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2006 eine Folge entsprechend „unaufgeregter“, ereignisarmer und gering professionalisierter Parteienkampagnen war, überprüft der Beitrag Jens Tenschers. Dabei geht es weniger um die Tonalität der Kampagnen, sondern vielmehr um die Frage deren struktureller Voraussetzungen und strategischer Ausrichtungen. Insgesamt untermauern die vergleichenden Befunde die Annahme einer Kampagnenprofessionalisierung nach Wahl. Demnach begegneten die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien den Landtagswahlen 2005 – ungeachtet vergleichsweise üppiger Etats – mit geringerer Manpower, organisatorischer Ausdifferenzierung und kommunikativer Intensität 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 15 über verschiedene massenmediale und direktkommunikative Kanäle als den vorangegangenen Bundestagswahlen. Besonders in Sachsen-Anhalt investierten die Parteien scheinbar nicht nur zu wenig Kapital und Personal, sondern auch Energie in den Wahlkampf. Für alle Bundesländer bewahrheitet sich darüber hinaus die Relevanz kontextspezifischer Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung von Wahlkampagnen. So nötigt der dünne massenmediale Resonanzboden in den Ländern die Parteien vor allem dazu, die direkte Kommunikation mit den Wählern zu intensivieren. Der Verdacht, die eher „lautlosen“ Kampagnen von SPD und CDU seien eine Folge von Professionalisierungsdefiziten, erhärtet sich bei näherem Hinsehen jedoch nicht. Vielmehr scheinen diese eine Folge der durch die Große Koalition im Bund bedingten Aufwertung landespolitischer Themen und Kandidaten und geringer Konfrontationen gewesen zu sein. Mit dem Ausmaß der bundespolitischen Durchdringung der Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt beschäftigen sich die drei folgenden Beiträge – aus je spezifischem Blickwinkel – noch intensiver. Den Auftakt machen Bernd Schlipphak und Ulrich Eith, die das Wechselverhältnis von Landes- und Bundespolitik bei den baden-württembergischen Landtagswahlen untersuchen. Beleuchtet werden dabei die Ausgangslage vor den Landtagswahlen, der Wahlkampf und das Wahlergebnis unter besonderer Berücksichtigung der „Dauer-Regierungspartei im Ländle“, der CDU. Nach Auffassung der Autoren verdeutlicht das Beispiel der baden-württembergischen Landtagswahlen in idealtypischer Weise die wechselseitige Durchdringung von Bundes- und Landesebene. Der gelungene Start der Großen Koalition in Berlin unter Angela Merkel bestimmte die Atmosphäre in Baden-Württemberg für die CDU so günstig, dass die Befürchtungen mancher in der CDU widerlegt wurden, diese müsse bei den Landtagswahlen ein Opfer bringen für den holprigen Machtwechsel von Erwin Teufel zu Günther Oettinger. Vielmehr errang die CDU in Baden-Württemberg letztendlich einen glänzenden Wahlsieg. Im Anschluss blickt Sigrid Koch-Baumgarten auf das Stammland des SPDParteivorsitzenden Kurt Beck (Rheinland-Pfalz). Der Stimmungstest für die Große Koalition im Bund fiel dort nicht zu Lasten der regierenden SPD aus, vielmehr bestätigte sich die Funktion der „100 Tage“ als Schonzeit für eine neue Regierung. Für das Wahlverhalten bei der Landtagswahl erwies sich, wie die vergleichende Analyse Hilmers andeutet, die Landespolitik als wirkungsmächtiger als die Bundespolitik. Zudem wirkte sich das Wahlergebnis nicht als nachteilig für die Große Koalition in Berlin aus. Schließlich wurden die Berliner Oppositionsparteien in Mainz geschwächt und die Bundesratsmehrheit der Parteien der Großen Koalition gestärkt. Als Sieger in doppelter Hinsicht konnte der SPD-Parteivorsitzende nicht nur seine Position im Land behaupten, sondern vor allem seine Rolle gegenüber dem Koalitionspartner im Bund deutlich festigen – so zumindest die Momentaufnahme im Anschluss an die Landtagswahlen im Frühjahr 2006. Im Mittelpunkt des darauf folgenden Beitrages von Klaus Detterbeck steht die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Nach dem Scheitern des Magdeburger Modells, 16 Helge Batt & Jens Tenscher der Duldung einer Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD) durch die PDS zwischen 1994 und 2002, wäre nach der Landtagswahl von 2006 rechnerisch auch eine Neuauflage eines rot-roten Bündnisses möglich gewesen. Dennoch kam es 2006 zur Bildung einer Großen Koalition von SPD und CDU unter Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU). Dieses sei jedoch, so der Autor, mehr auf landespolitische Entwicklungen – vor allem die landespolitische Kluft zwischen SPD und Die Linke – zurückzuführen, denn auf eine Imitation der Großen Koalition in Berlin. Der Schatten der Berliner Kräfteverhältnisse erwies sich somit als recht kurz. Für die künftigen Mehrheitsverhältnisse in SachsenAnhalt ist jedoch zuvorderst der Erfolg der kleineren Parteien entscheidend, was eine dauerhafte Fortführung der Großen Koalition in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich erscheinen lässt. Bei allen Zukunftsprognosen bleibt aber zu berücksichtigen, dass das Parteiensystem im Land nur wenig „eingefroren“ ist und die Parteibindungen im Land sehr schwach sind. 3.3 Nach den Landtagswahlen: Regierung, Parteien, öffentliche Meinung Die Beiträge des letzten Teils des Bandes befassen sich mit der Entwicklung der politischen Kräfteverhältnisse auf Bundesebene im Anschluss an die Frühjahrslandtagswahlen 2006 bis hin zur Halbzeit der Legislaturperiode im Herbst 2007. Den Auftakt hierzu macht Axel Murswieck, dessen Beitrag sich bilanzierend mit dem Regierungsstil und den Machtressourcen der Bundeskanzlerin auseinander setzt. Dabei zeigt sich, dass die faktische Machtressourcen des Regierungschefs oder – in diesem Fall – der Regierungschefin in einer Großen Koalition noch stärken Restriktionen unterworfen sind, als dies in Zeiten „normaler“ kleiner Koalitionen bereits der Fall ist. Mit diesen Restriktionen umzugehen, erfordert besondere Fähigkeiten der persönlichen Kanzlerschaft. Diesbezüglich führt die Analyse des Regierungsstils von Angela Merkel im ersten Jahr ihrer Kanzlerschaft zu der Einschätzung, dass es ihr insgesamt recht gut gelungen sei, als stille Moderatorin der Regierungsarbeit zu fungieren, ohne dabei ihre Machtposition als Maklerin widerstreitender Interessen zu beschädigen. Wie sich das koalitionäre Taktieren und (Aus-)Handeln in Bezug auf die Reformpolitik der Großen Koalition ausgewirkt hat, diskutiert der folgende Beitrag Helge Batts. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob und inwiefern die Parteien der Großen Koalition bis zur Halbzeit der Legislaturperiode die ihnen zur Verfügung stehenden Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat zur Politikgestaltung genutzt haben. Hierzu wird die Arbeit der Großen Koalition in zentralen Politikfeldern untersucht und zeitlich in drei Phasen eingeteilt: (1) der überraschend harmonischen Beginn der Regierungsarbeit, der bis Februar/März 2006 dauerte; (2) eine konfliktive Phase (bis zum Frühjahr 2007), in der, wenn auch mühsam einige Reformkompromisse gefunden wurden, sowie (3) die bis zum Ende der ersten Hälfte der Legislaturperiode andauernde dritte Phase der Regierungstätigkeit im Zeichen 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 17 der Sichtachse auf die kommenden Wahlen in Bund und Ländern. In dieser dritten Phase habe die Notwendigkeit der parteipolitischen Profilierung und Identitätssuche im Hinblick auf die zukünftigen Wahlkämpfe zugenommen. Insgesamt kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass die Große Koalition sich nicht als eine blockierte Regierung erwiesen, sondern eine Vielzahl von politischen Entscheidungen aus der Agenda des Koalitionsvertrages abgearbeitet habe. Gleichzeitig aber seien mit Ausnahme der Föderalismusreform die wirklich großen Reformen weitgehend ausgeblieben, weshalb die Bundesrepublik zwar eine Große Koalition habe, aber keine wirklich große im Sinne von „bedeutend“ oder „beachtlich“. Die Parteienforscher Matthias Micus und Franz Walter stellen sich im Anschluss die Frage, welche Folgen sich aus der lagerübergreifende Koalition der beiden Volksparteien für die inhaltliche und strategische „Ortsbestimmung“ nicht nur der Großkoalitionäre selbst, sondern auch der anderen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien seit der Bundestagswahl 2005 ergeben haben. Hierzu blicken sie auf parteienspezifische Entwicklungen, Optionen und Risiken in Bezug auf das jeweilige Führungspersonal, die programmatische und themenbezogene Positionierung und zukünftige Koalitionsmöglichkeiten, aber auch auf Veränderungen der (potenziellen) Wählerschaft, der innerparteilichen Organisation sowie der Binnen- und Außenkommunikation. Deutlich kommt dabei die besonders prekäre Situation der Großparteien zum Ausdruck, die zumal in Zeiten der Großen Koalition an Profilschärfe und Unverwechselbarkeit, aber auch an gesellschaftlicher Verwurzelung dramatisch zu verlieren scheinen. Ihrer gesamtgesellschaftlichen Integrationsfunktion werden sie so immer weniger gerecht. Gleichzeitig fühlen sich immer größer werdende Bevölkerungsgruppen politisch nicht adäquat repräsentiert. Die Folge ist eine grassierende politische Entfremdung und Apathie sowie ein Erstarken von Protestgruppen. Gerade die sich seit 2005 sukzessive neu aufstellende Linkspartei könnte jedoch, nach Ansicht der Autoren, einen Beitrag dazu leisten, die parteienstaatliche Ordnung zu bewahren, auch wenn sie zugleich die Aufsplitterung der Parteienlandschaft befördere. Wie der erste Beitrag des Bandes von Heiner Geißlers so wählt schließlich auch der abschließende Beitrag Richard Mengs in bewusster Abgrenzung von und Ergänzung zu den sonstigen Analysen eine dezidiert nicht-wissenschaftliche Perspektive. An dieser Stelle wird aus journalistischer Warte eine Zwischenbilanz der ersten zwei Jahre der Großen Koalition gezogen. Dabei hilft der Blick hinter die Berliner Kulissen, manch gängige Einschätzung und populäre Beurteilung des Annäherns und Handelns zweier „artgleicher“ Regierungspartner zu überprüfen. Deutlich kommen dabei drei (vom Beitrag Batts leicht abweichende) Entwicklungsphasen in der schwarz-roten Koalitionspartnerschaft zum Vorschein: Erstens eine auf die ersten 100 Tage beschränkte „Harmoniephase“, in der Schnittmengen ausgelotet und potenzielle Problemfelder ausgespart wurden; zweitens eine Phase des politischen Austarierens, der ersten Versuche, sich parteipolitisch neu zu definieren und sich vom Koalitionspartner abzugrenzen; drittens die Phase, beginnend im Januar 2007, der EU-Ratspräsidentschaft und des G8-Vorsitzes Angela Mer- 18 Helge Batt & Jens Tenscher kels, in der die Kanzlerin Profil gewann, zugleich aber die Verschlechterung der Regierungsklimas nur überdeckt wurde. Insgesamt habe die Große Koalition, so das ernüchternde Urteil des Verfassers, in der ersten Hälfte ihrer Regierungstätigkeit nicht die Möglichkeiten genutzt, die sich ihr als „strategische Interessensgemeinschaft“ für grundlegende gesellschaftspolitische Weichenstellungen geboten hätten. Vielmehr habe sich das Regierungsbündnis von Beginn an unter Wert definiert und unter Wert selbst wahrgenommen. In diesem Sinne verkörpere das schwarz-rote Bündnis jedoch den Grundkonsens einer in sich verunsicherten Gesellschaft – es steht weder für ein ambitioniertes Projekt noch für ein politisches Pausenzeichen. 4 Fazit Insgesamt untermauern die an dieser Stelle zusammengeführten Beiträge die symbolische wie politikpraktische Relevanz der ersten 100 Tage nach einem Regierungswechsel. Zumindest nach der Bundestagswahl 2005 nutzten Regierungsakteure, Parteien, Massenmedien und Bürger die Zeit, um sich nach der Aufgeregtheit des vorangegangenen Wahlkampfes neu zu sammeln, zu positionieren und zu orientieren. Dass die Findungsphase und die großkoalitionären Kräfteverhältnisse nicht ohne Folgen für die Landtagswahlen im Frühjahr 2006 blieben und dabei deren originär landespolitische Bedeutung stärkten, wird überdies deutlich. Auch die Vermutung, dass das eigentliche „Durchstarten“, der Beginn des politischen Handelns und Wettbewerbens auf die Zeit nach der Schonfrist verschoben wird, hat sich beim Rückblick auf die Zeit nach dem Regierungswechsel 2005 bestätigt. Ob allerdings die handelnden politischen Akteure, Massenmedien und Öffentlichkeit auch bei „normalen“ Verhältnissen, d.h. beim Start einer „kleinen“ Koalition im Bund und ohne die Zäsur von Landtagswahlen zum Ende der 100-Tage-Frist, dieser Bruchstelle entsprechende Beachtung schenken, bleibt zukünftigen Untersuchungen vorbehalten. 5 Literatur Alter, Jonathan (2006): The Defining Moment. FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope. New York: Simon & Schuster. Batt, Helge (2007): Eine Frage des Vertrauens. Die vorzeitige Parlamentsauflösung zwischen rechtlichem Anspruch und politischem Streit. In: Egle, Christoph/Zohlnhöfer, Reimut (Hrsg.): Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 60-82. Brettschneider, Frank/Niedermayer, Oskar/Weßels, Bernhard (Hrsg.) (2007): Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Coote, Stephen (2005): Napoleon and the Hundred Days. London: Pocket Books. 100 Tage Schonfrist nach der Bundestagswahl 2005? 19 Egle, Christoph/Zohlnhöfer, Reimut (Hrsg.) (2007): Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Holly, Ina von (2006): Die ersten 100 Tage – better quit or loud period? Auf dem Prüfstand: Die ersten Amtstage von Bundesministern. In: Köhler, Miriam Melanie/Schuster, Christian H. (Hrsg.): Handbuch Regierungs-PR. Öffentlichkeitsarbeit von Bundesregierungen und deren Beratern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 153165. Hough, Daniel/Jeffrey, Charlie (2003): Landtagswahlen: Bundestagswahlen oder Regionalwahlen. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 34, H. 1, 79-94. Jesse, Eckhard/Sturm, Roland (Hg.) (2006): Bilanz der Bundestagswahl 2005. Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Korte, Karl-Rudolf (2005): Bundestagswahlen 2005. Die Republik im vorgezogenen Bundestagswahlkampf. In: Balzar, Axel/Geilich, Marvin/Rafat, Shamim (Hrsg.): Politik als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und Inszenierung. Münster: Lit, 150-156. Lehmbruch, Gerhard (2000): Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Maitland, Alison (2005): Perils and prospects in the vital first 100 days. In: Financial Times, 08.08.2005 (online: http://www.paconsulting.com/news/about_pa/2005/by_Perils+and +prospects+in+the+vital+first+100+days.htm; Abruf am: 21.08.2007). Mielke, Siegfried/Reutter, Werner (2004): Länderparlamentarismus in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. In: dies. (Hrsg.): Länderparlamentarismus in Deutschland. Geschichte – Struktur – Funktionen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1951. Neff, Thomas J./Citrin, James M. (2004): Now you're in charge: the first 100 days. In: Chief Executive Officer, 21.08.2007 (online: http://content-spencerstuart.com/sswebsite/pdf/ lib/CEOsFirst100Days4-04-pdf; Abruf am: 21.08.2007). Neff, Thomas J./Citrin, James M. (2005): You're In Charge - Now What? The 8 Point Plan. New York: Crown Business. Pitronaci, Giuseppe (2005): Noch 96 Tage, dann… In: die tageszeitung, 25.11.2005 (online unter: http://taz.de/pt/2005/11/25/a0176.1/textdruck; Abruf am: 22.12.2006). Schmid, Josef/Zolleis, Udo (Hrsg.) (2007): Wahlkampf im Südwesten. Parteien, Kampagnen und Landtagswahlen 2006 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Münster/ Hamburg/London: Lit. Stern, Stefan (2007): First 100 days: a time to act and a time to wait and see. In: Financial Times, 03.07.2007, 14. Tenscher, Jens (2007): Professionalisierung nach Wahl. Ein Vergleich der Parteienkampagnen im Rahmen der jüngsten Bundestags- und Europawahlkämpfe in Deutschland. In: Brettschneider, Frank/Niedermayer, Oskar/Weßels, Bernhard (Hrsg.): Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 65-95. Träm, Michael (2002): Führung braucht Zeit. Der Mythos der ersten 100 Tage. Berlin: Econ . NACH DER BUNDESTAGSWAHL REGIERUNG, MEDIEN, ÖFFENTLICHE MEINUNG Zur Schonung gezwungen? Politischer Attentismus nach der Bundestagswahl 2005 Heiner Geißler Eine Schonfrist von 100 Tagen für die Sieger einer Bundestagswahl hat es als Regel nie gegeben. Die Koalitionsverhandlungen wurden immer von einem vielstimmigen Chor von Presse, Hörfunk und Fernsehen und der nicht beteiligten zukünftigen Oppositionsparteien begleitet. Eine Schonfrist in dem Sinne, dass nach der Regierungsbildung die Regierung 100 Tage Zeit hätte, nichts zu tun oder auch Falsches zu tun, ohne dafür kritisiert werden zu dürfen, war schon aus pragmatischen Gründen des politischen Wettbewerbs unter den Parteien nie möglich gewesen und ist eher als ein publizistisches oder politikwissenschaftliches Phänomen zu betrachten. Nach der Bundestagswahl im September 2005 war allerdings eine bis dahin noch nie da gewesene Situation entstanden. Ein ziemlich lange andauernder politischer Attentismus beherrschte die politische Lage. Dafür gab es im Wesentlichen fünf Gründe. Das politische Berlin verfiel nach der Wahl in eine Art politischer Schockstarre, um einen Begriff aus der Unfallmedizin zu verwenden. Mit dem Wahlgang hatten sich hohe Erwartungen verbunden, die von oberster Stelle aus formuliert worden waren. Der Bundespräsident hatte die verfassungsrechtlich höchst problematische Auflösung des Parlaments mit dem Schreckensgemälde einer heraufziehenden politischen und ökonomischen Katastrophe begründet und kaum verhüllt einen Regierungswechsel propagiert, um den angeblichen Reformstau und die Blockade der Agenda 2010 des Kanzlers durch dessen eigene Partei zu beseitigen. In dieser Intention war er von der überwiegenden Mehrheit der wirtschaftswissenschaftlichen Institute und – von wenigen Ausnahmen abgesehen – der deutschen Presse unterstützt worden. Im Sinne dieser Zielvorgabe war das politische und publizistische Berlin auch bereit, das in den Augen des Wahlvolkes groteske Ansinnen des Bundeskanzlers an das Parlament mitzutragen, ihm das Misstrauen auszusprechen, obwohl er das Gegenteil beantragt hatte, wobei der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der betreffenden Abstimmung sogar noch beteuerte, dass der Bundeskanzler selbstverständlich das Vertrauen seiner Fraktion habe, was die Mitglieder derselben Fraktion dann nicht daran hinderte, gegen den Kanzler zu stimmen. Dieses Lügengebäude geriet zu einer weiteren Grabstätte, um nicht zu sagen einem großen Mausoleum auf dem Zentralfriedhof der politischen Glaubwürdigkeit der Republik. Die beiden großen Parteien hatten also, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, hoch gepokert und im Übrigen schon mit den Wahl- 24 Heiner Geißler kampfvorbereitungen begonnen, bevor das Bundesverfassungsgericht und schließlich der Bundespräsident überhaupt entschieden hatten. Nun kam alles ganz anders. Das Volk holte die gesamte Elite der Berliner Republik, Bundespräsident, Bundeskanzler, Parteiführungen, Fraktionen, Kommentatoren und Leitartikler von ihren überdrehten Expektanzen auf den Boden der demokratischen Realität zurück. Das Volk verwarf die ambitionierte Reformhuberei der politischen Klasse in Berlin. Die SPD bekam nach ihrer Aufholjagd während des Wahlkampfes, in dem der Kanzler die eigene Agenda verleugnete, 34,2 Prozent und die Unionsparteien sackten – gemessen an den Umfrageergebnissen – ab auf 35,2 Prozent, dem schlechtesten Ergebnis seit 1949. Zum dritten Mal seit 1998 waren CDU/CSU im 30-Prozent-Turm gelandet. Setzt man das Wahlergebnis der Union in das Verhältnis zu den Wahlberechtigten, dann war seit 1953 die Zustimmung zur Union nie so gering wie bei der Bundestagswahl 2005. Nur etwas mehr als ein Viertel aller Wahlbürger (26,9 Prozent) gaben der Union ihre Zweitstimme. Mit diesem Wahlergebnis stand für die CDU etwas zur Disposition, was die SPD schon längst verloren hatte, nämlich die strukturelle Mehrheitsfähigkeit als Volkspartei. Von diesem K.O.-Schlag haben sich die Union und die SPD erst wieder erholt, als sie ein Jahr später begannen, neue Grundsatzprogramme zu erarbeiten, die von beiden Parteien auch als Reaktion auf diese Wahlentscheidung gedacht waren. Die Ratlosigkeit war schließlich auch darin begründet, dass die angekündigte Katastrophe gar nicht eintrat, die Deutschen gerade so weiterarbeiteten oder als Arbeitslose nicht arbeiteten wie vorher auch, die deutsche Wirtschaft so gut wie keine Reaktionen zeigte und auch die übrige Welt nicht zusammenbrach. Während die vorgezogene Bundestagswahl von ihren Erfindern mit einer notwendigen politisch-inhaltlichen Erneuerung begründet worden war, mussten sich die Energien der Parteien nach dem ersten Schock darauf konzentrieren, eine regierungsfähige Koalition zu bilden. Denn das Wahlergebnis bestand vor allem in einem Patt zwischen Union und SPD. Die beabsichtigte Koalition der Union mit der FDP scheiterte am mageren Wahlergebnis der FDP von 9,8 Prozent. Dasselbe galt für die rot-grüne Koalition, da auch die Grünen lediglich 8,1 Prozent bekommen hatten. Eine Koalition von Rot-Grün mit der neu erstandenen Linken schied aus personalpolitischen Gründen (Lafontaine) wie auch aus psychologischen (zunächst) einmal aus. Die auch noch mögliche so genannte „Jamaika-Koalition“ Schwarz-Grün-Gelb (Union, Grüne, FDP) scheiterte an den Denkblockaden, die die Betonköpfe bei der CSU und den Grünen errichtet hatten. Dabei hätte diese Koalition die Verkrustung der Berliner Parteipolitik aufreißen können, etwas ganz Neues wäre entstanden, frischer Wind in die parteipolitischen Lager gefahren. Mangelnder Mut und fehlende Risikobereitschaft führten dann zur einzig möglichen Alternative, nämlich zur Großen Koalition, die auch als Folge einer weiteren Fragmentierung des Parteiensystems durch den Aufstieg der Linkspartei gewertet werden muss (vgl. den Beitrag von M. Micus/F. Walter in diesem Band). Das mit dem Anwachsen der Linkspartei einhergehende Abschmelzen des Stim- Zur Schonung gezwungen? 25 menanteils beider großer Parteien wird auch in der Zukunft strukturell die Mehrheitsbildung erschweren. Eine relevante Diskussion über die zukünftigen Inhalte der deutschen Politik konnte auch deswegen nicht stattfinden, weil die Oppositionsparteien personell und inhaltlich zu schwach für einen solchen Diskurs und die beiden Koalitionsparteien nicht willens waren, einen solchen zu führen. Die inhaltliche Bewegungslosigkeit der Berliner Politik in den ersten Monaten hatte einen weiteren Grund darin, dass die Wahlkampfprogramme und Wahlkampfziele der beiden großen Parteien, also die Agenda 2010 der SPD und die neoliberale Reformpolitik der CDU des Leipziger Parteitags, vom Volk abgewählt worden waren. Der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an die Parteien bestand gerade darin, die im Wahlkampf vorgetragenen Programme nicht zu realisieren. Insofern standen beide Parteien zunächst einmal mit leeren Händen da, weil ihre Pläne vom Volk durchkreuzt worden waren. Zwar behalf man sich mit floskelhaften Beteuerungen oder Beschimpfungen des Wahlvolkes („Wir haben versäumt, die Menschen mitzunehmen“, CDU-Bundesvorstand; „Die Wählerinnen und Wähler zeigten sich als deprimierte Knirpse und schlecht gelaunte Destruktivisten“, FAZ) oder mit eigensinniger Rechthaberei („Unser Programm ist richtig“, „Der Reformkurs muss weitergehen“, Matthias Platzeck, damals noch SPD-Bundesvorsitzender). In Wirklichkeit hatten beide Parteien nicht nur ein Marketingproblem, sondern hatten die Wahl verloren, weil sie mit beachtlichen inhaltlichen Schieflagen, eklatanten Widersprüchen und ohne zukunftsweisendes Konzept in den Wahlkampf gegangen waren. Beide großen politischen Parteien, zumindest ihre Führungen, waren davon überzeugt, dass sie den Zielen, zu denen sie sich verpflichtet hatten, voll entsprachen, hatten aber übersehen, dass sie den Erwartungen, die die Menschen an sie stellten, in keiner Weise gerecht geworden waren. Millionen von Menschen hatten angesichts der negativen Auswirkungen der Globalisierung, die deren Chancen überdeckten, begründete Angst um ihre Arbeitsplätze und vor der Zukunft. Perspektivlosigkeit war das schlimmste Defizit beider Parteien. Sie präsentierten eine Politik auf Sicht ohne langfristiges Konzept. Menschen erschienen in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik als reine Kostenfaktoren. Beiden Parteien fehlte eine neue soziale und ökonomische Philosophie, die es den Menschen ermöglicht hätte, für ihr privates und berufliches Leben wieder eine positive Perspektive zu bekommen. Hinzu kam, dass die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung mehr als defizitär war, sie war elitär und anmaßend. War für die Menschen schon die Realität bedrückend genug, so wurde ihnen von beiden Parteien zusätzlich mit Drohbegriffen eingeheizt und Angst gemacht: Kopfpauschale, Agenda 2010, Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV, Fallmanager, Jobcenter, Ich-AG, Personal Service Agenturen – die Bevölkerung wurde Verbalattacken ausgesetzt, die schon von den Fremdworten her vom überwiegenden Teil der Deutschen gar nicht richtig verstanden werden konnten. Von den Begriffen und von den Inhalten her gesehen standen beide Parteien vor einem Scherbenhaufen, der erst einmal zusammengekehrt werden musste. 26 Heiner Geißler Das inhaltliche Desaster führte zu bizarren personalpolitischen Konsequenzen: Edmund Stoiber verließ fluchtartig die Berliner Szene, um in Bayern Ministerpräsident zu bleiben, was dann dort die gesamte CSU durcheinander brachte. Die SPD musste innerhalb kurzer Zeit zweimal den Posten des Parteivorsitzenden neu besetzen. Dies alles nahm Zeit in Anspruch, die für eine inhaltliche Standortbestimmung fehlte. Der politische Attentismus verstärkte sich, weil ein neues Regierungsprogramm erarbeitet werden musste. Die Konfliktfelder hatten sich zwar nicht verändert, aber neue Antworten waren auf dem Hintergrund des Wahlergebnisses gefragt. Am schnellsten hatte die CDU die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen und das Ruder herumgeworfen. Angela Merkel zeigte sich noch nach Monaten vom Schockerlebnis der Wahlnacht betroffen. Von der Modernisierungsmanie des Leipziger Parteitages ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Ihre Politik wird von Parteigegnern heute eher als links-liberal bezeichnet, was manche von ihnen veranlasst, eine Erneuerung des „Konservativen“ in der CDU zu verlangen. Die weite Distanz zwischen der Wahlkampf-Programmatik beider großen Parteien wird am besten sichtbar, wenn man die Kernaussagen der Regierungserklärung sich vor Augen hält, nämlich, dass es jetzt darum gehe, eine Politik der kleinen Schritte zu machen und das politische Bündnis zwischen CDU/CSU und der SPD sei eine „Koalition der neuen Möglichkeiten“. Noch nie in der Geschichte der Republik war die Diskrepanz zwischen Wahlkampfmotivationen und -zielen einerseits und den tatsächlichen politischen Entscheidungen andererseits größer gewesen. Was gemeinhin als politische Todsünde bezeichnet wird, nämlich nach einer Wahl das Gegenteil von dem zu tun, was man vor der Wahl gesagt und versprochen hat, wurde 2005, weil vom Souverän gewollt, zur politischen Tugend. Auf dem Weg zur Großen Koalition: Regierungsbildung in Deutschland 2005 Uwe Jun 1 Einleitung: Regierungsbildung als Koalitionsbildung Regierungsbildung im politischen System der Bundesrepublik bedeutet auf gesamtstaatlicher Ebene in erster Linie Koalitionsbildung von mindestens zwei miteinander konkurrierenden Parteien. Denn mit Ausnahme des Erfolgs der CDU/ CSU im Jahr 1957 gelang es bisher keiner Partei bei einer Bundestagswahl, die absolute Mehrheit der Mandate im Bundestag zu erringen. Die Bildung von Koalitionen soll entsprechend parlamentarische Mehrheiten herstellen, die Stabilität und Handlungsfähigkeit der Regierung gewährleisten sollen. Minderheitenregierungen erfreuen sich bei politischen Akteuren und den Wählerinnen und Wählern geringerer Popularität, sie gelten aufgrund der Funktionslogik des parlamentarischen Regierungssystems (stetiges Abberufungsrecht der Parlamentsmehrheit gegenüber der Regierung), der Ausgestaltung des Grundgesetzes (der Bundeskanzler benötigt in den ersten beiden Wählgängen die absolute Mehrheit der Stimmen der Bundestagsabgeordneten), der historischen Erfahrungen in der Weimarer Republik (große Instabilität der Regierungen), der Akzeptanz der Mehrheitsregel und der Vorstellung, nur eine Mehrheitsregierung habe die Macht und das Durchsetzungsvermögen, politische Entscheidungen auch effektiv durchzusetzen, als weniger legitim und politisch kaum erwünscht. Selbst in den Bundesländern sind Minderheitsregierungen nur in Ausnahmefällen zustande gekommen (so in Sachsen-Anhalt 1994 bis 2002 mit dem so genannten „Magdeburger Modell“, eine von der PDS tolerierte Minderheitenregierung von SPD und Bündnisgrünen bzw. der SPD; vgl. den Beitrag von K. Detterbeck in diesem Band). Das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2005 erschwerte den politischen Parteien die Regierungsbildung, da die im Wahlkampf von den einzelnen Parteien favorisierten Koalitionskonstellationen keine Mehrheiten für sich verbuchen konnten. Weder die damalige Regierungskoalition aus SPD und Bündnisgrünen, noch Union und FDP, die im Wahlkampf durch „eine bisher ungekannte Distanzlosigkeit“ (M. Jung/A. Wolf 2005: 6) auffielen, fanden bei den Wählern ausreichenden Zuspruch für eine Mehrheitsbildung. Erstmals nach 1969 war damit unmittelbar nach der Bundestagswahl die Konstellation der zu bildenden Regierungskoalition unklar. Diese Unklarheit wurde verstärkt durch den seinerzeit amtierenden Bundeskanzler Schröder, der am Wahlabend eine Regierungsbildung der SPD mit der Union unter einer Bundeskanzlerin Merkel explizit ausschloss, obwohl die Union 28 Uwe Jun die größte Fraktion im Bundestag stellte und nach bisheriger Gepflogenheit die Partei der zahlenmäßig stärksten Koalitionsfraktion den Bundeskanzler bestimmen kann. Wie nach keiner anderen Bundestagswahl in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland tauchten 2005 unmittelbar nach der Wahl entsprechend die unterschiedlichsten möglichen Koalitionskonstellationen in der öffentlichen Diskussion auf: Da war von der „Ampel“ (SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen) von „Jamaika“ (CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen) oder í trotz Schröders Absage – eben der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD die Rede. Einzelne Journalisten und führende Parteimitglieder von SPD und Bündnisgrünen wollten selbst die Bildung einer „rot-rot-grünen-Koalition“ mit SPD, Linkspartei/PDS und Bündnis 90/Die Grünen zunächst nicht vollständig ausschließen. Auf welchem Weg und aus welchen Gründen kam es schließlich zur Bildung der Großen Koalition? Welche Auswirkungen hat die Bildung der Koalition von CDU/CSU und SPD auf das deutsche Parteiensystem? Der Beitrag betrachtet den Prozess der Regierungsbildung unter parteiensystematischer Perspektive, analysiert Argumente und Erklärungsansätze für die Bildung der Großen Koalition sowie das Nichtzustandekommen der anderen Optionen und zieht daraus Schlussfolgerungen für zukünftige Koalitionsbildungen sowie für die Strukturen des Parteiensystems auf Bundesebene nach der Bundestagswahl 2005. Der Prozess der Regierungsbildung und die ersten 100 Tage der Großen Koalition sollen dabei ausführlicher dargestellt werden. Zentraler Bezugspunkt der Überlegungen ist die Struktur des deutschen Parteiensystems, da das Parteiensystem als Hauptfaktor für die Erklärung des Zustandekommens von Regierungskoalitionen gilt (vgl. U. Jun 1994; Th. Saalfeld 1997; S. Kropp/R. Sturm 1999). Zunächst gilt es aber, den Zusammenhang von Parteiensystemen und Koalitionsbildungen genauer herauszuarbeiten und zentrale Stationen des Prozesses der Regierungsbildung zu charakterisieren. 2 Regierungsbildung im politischen System Deutschlands1 Da Regierungsbildung im politischen System der Bundesrepublik Deutschland im Regelfall Koalitionsbildung bedeutet, soll im Folgenden zunächst die Bildung von Regierungskoalitionen im Kontext des Parteiensystems kurz skizziert werden (ausführlicher vgl. etwa U. Jun 1994; S. Kropp/R. Sturm 1999: 65ff.; S. Kropp et al. 2002). Charles Lees (2005: 197) definiert Koalitionen als „any combination of separate players í such as political parties í that cooperate in order to win a voting game, or to secure some other strategic goal“ und hebt damit auf zentrale Merkmale von Regierungskoalitionen als spezifischer Koalitionsform in parlamentarischen Demokratien ab. Zum einen dient die Bildung von Regierungskoalitionen, wie schon erwähnt, zur Herstellung und Sicherung von Mehrheiten im Parlament (ohne 1 Vgl. zu diesem Abschnitt auch Jun (2007). Auf dem Weg zur Großen Koalition 29 damit Minderheitskoalitionen grundsätzlich ausschließen zu wollen), zum anderen verweist Lees darauf, dass politische Akteure ihre Wettbewerbsorientierung teilweise aufgeben müssen, um zumindest graduell zu kooperativen Formen des Handelns überzugehen. Hauptakteure in Koalitionsbildungsprozessen sind politische Parteien, denn Regierungskoalitionen werden in den parlamentarischen Demokratien Westeuropas von politischen Parteien gebildet, nicht von individuellen Akteuren oder parlamentarischen Gruppen. Die einer Koalitionsbildung vorangehenden Koalitionsverhandlungen werden entsprechend stets von Parteien geführt, das Ergebnis dieser Verhandlungen wird in Form von Koalitionsvereinbarungen von den Parteien getragen (vgl. E. Schütt-Wetschky 2005: 494). Die Zentralität von Parteien im Koalitionsbildungsprozess wurde im Jahr 2005 in Deutschland etwa daran deutlich, dass die designierten Regierungsparteien abwechselnd in den Besprechungsräumen der jeweiligen Parteizentralen in Berlin, im Konrad-AdenauerHaus (CDU) und im Willy-Brandt-Haus (SPD), tagten. Koalitionen bilden ein Subsystem des gesamten Parteiensystems, das in der Regel nur einen Teil der Parteien des Gesamtsystems umfasst. Unter dem im Vergleich zum Koalitionsbegriff spezifischeren Begriff der Regierungskoalition (vgl. U. Jun 1994: 23f.) soll verstanden werden eine organisierte Kooperation von mindestens zwei voneinander unabhängigen und miteinander konkurrierenden politischen Parteien in einem politischen System, vorwiegend inner-, aber auch außerhalb des Parlaments, mit den primären Zielen der Regierungsbildung und -unterstützung sowie der Durchsetzung von politischen Inhalten, deren zentrale Festlegungen in einem gemeinsamen Regierungsprogramm von den beteiligten Parteien vereinbart werden. Die Kooperation kann jeder Zeit von den beteiligten Parteien ohne juristische Folgewirkung aufgekündigt werden, ist also eine Zusammenarbeit auf Zeit. Das Erfordernis der Mehrheitsbildung ist ein häufiges, aber kein zwingend notwendiges Motiv der Kooperation. Da im politischen System der Bundesrepublik Deutschland Regierungen mit parlamentarischer Mehrheit – aufgrund ihrer sowohl bei Wählern wie politischen Akteuren im Hinblick auf Regierungsbildung funktional bedingten größeren Akzeptanz – angestrebt werden, spielen aus der Struktur des Parteiensystems sich ergebende arithmetische Konstellationen eine erhebliche Rolle bei Koalitionsentscheidungen. In der Regel haben sich in Deutschland „minimal-winning coalitions“ gebildet, also solche Mehrheitskoalitionen, die bei Ausscheiden einer Koalitionspartei die Mehrheit verlieren würde. Nicht selten bildeten sich auch „minimum-winning coalitions“, also solche, die über die kleinstmögliche Mehrheit der Mandate im Parlament verfügen. Die Große Koalition von CDU/CSU und SPD ist eine minimal-, aber keine minimum-winning coalition. Die Koalitionsbildung erfolgt im Rahmen des Parteienwettbewerbs. Nach Peter Mair (1996) ist dieser Wettbewerb um die Regierungsbeteiligung eine zentrale Variable zur Klassifikation der Struktur von Parteiensystemen, womit die wechselseitige Abhängigkeit von Koalitionsbildung und Parteiensystemen ebenso zum Ausdruck kommt wie die zentrale Bedeutung der Struktur des Parteiensystems für 30 Uwe Jun Koalitionsbildungen. Die Struktur des Parteiensystems bildet schließlich den Macht begrenzenden und alternierenden funktionalen Bezugspunkt des Handlungskalküls von politischen Parteien, weil die Wettbewerbssituation in der Einschätzung der Parteien, insbesondere des strategischen Machtzentrums innerhalb von Parteien, wesentlich eine Koalitionsentscheidung, und zwar sowohl in der retrospektiven wie prospektiven Sichtweise bestimmt. In einer strategischen Situation wie der Koalitionsbildung, die in erheblichem Maße durch Unsicherheiten gekennzeichnet ist, müssen die unmittelbaren Konsequenzen und mittel- bis langfristigen Folgen einer zwischenparteilichen Kooperation soweit wie möglich im Hinblick auf die eigene Wettbewerbssituation kalkuliert werden. Bisherige Erfahrungen mit möglichen Koalitionsparteien fließen in die Entscheidung ebenso mit ein wie ein erwartetes Verhalten potenzieller Koalitionspartner und mögliche Auswirkungen einer Koalitionsbildung auf die Wählerschaft. Beeinflusst wird die Bereitschaft zur Koalitionsbildung einer Partei von der zugeschriebenen Koalitionsfähigkeit ebenso wie von der eingeschätzten Koalitionsbereitschaft auf Seiten möglicher Koalitionspartner. Mair unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen geschlossenen Formen des Wettbewerbs einerseits, in der nur bereits erprobte Koalitionen geschlossen werden, und offenen Strukturen andererseits, die Platz für innovative Parteienbündnisse lassen und bei denen (nahezu) alle Parteien einen potenziellen Zugang zur Regierungsbildung besitzen, die Segmentierung also sehr gering ist (vgl. P. Mair 1996; auch F. Müller-Rommel 2005). Drei Formen des Regierungswechsels bei der Neubildung von Regierungskoalitionen (Einparteienregierungen werden also nicht betrachtet) sind demnach zu unterscheiden: der vollständige Austausch von Regierungsparteien, wie in Deutschland erstmalig und bisher einmalig im Jahre 1998 geschehen, der Austausch von einzelnen Koalitionsparteien, wie wir ihn in Deutschland häufiger finden (zuletzt 2005) oder í die zahlenmäßig häufigste Variante in Deutschland í keinerlei Veränderung der Koalitionskonstellation (etwa 1990, 1994 oder 2002). Die zuletzt gewachsene strategische Unsicherheit aufgrund der zunehmenden Volatilität im deutschen Parteiensystem sowie der gestiegenen Fragmentierung erschweren es den Parteien, Mehrheiten für ihre Koalitionspräferenzen zu gewinnen, aber auch mögliche Kosten- oder Nutzenerwartungen von Koalitionsbildungen exakter zu bestimmen. In diesem Kontext haben die Parteien auch die Koalitionspräferenzen ihrer Wählerschaft zentral zu beachten, wollen sie diese nicht verprellen. Dies gilt insbesondere für kleinere Parteien, die auf Zweitstimmen oder Koalitionsstimmen in Folge des „Split-ticket voting“ setzen. Denn unklare Koalitionslagen, das heißt eine fehlende Koalitionsaussage, sind für diesen Teil der kleinen Parteien, die nicht primär die Oppositionsrolle anstreben, nach jüngeren empirischen Erkenntnissen nicht von Vorteil und „werden offensichtlich von den Wählern nicht belohnt“ (Th. Gschwend/F. U. Pappi 2005: 182), was am Beispiel der FDP im Jahr 2002 auch exemplarisch veranschaulicht werden kann. Für alle Parteien im Wettbewerb gilt gleichermaßen die Maxime: Der Stimmenanteil ist im Auf dem Weg zur Großen Koalition 31 Parteienwettbewerb zentraler Ausgangspunkt für machtpolitische Durchsetzungsstrategien mit Blick auf öffentliche Ämter oder politische Inhalte. Im Subsystem Regierungskoalitionen ist im Vergleich zum gesamten Parteiensystem eine Reduzierung des zwischenparteilichen Wettbewerbs grundlegende Voraussetzung für das Zustandekommen und den Bestand einer Regierung. Kooperative Verhaltensmuster ergänzen somit in Regierungskoalitionen kompetitive, ohne letztere vollständig aufzuheben (ausführlicher vgl. S. Kropp 2001). Vorteilhaft für stabile Kooperationsmuster erweist sich eine programmatisch-inhaltliche Nähe der Koalitionsparteien („policy distance“) in zentralen Politikbereichen, wobei in der Forschung zu Koalitionstheorien umstritten ist, inwieweit die programmatische Diversität reichen kann, um überhaupt Koalitionsbildungsprozesse in Gang zu setzen und anschließend ein ausreichendes Maß an Koalitionsstabilität zu gewährleisten (vgl. dazu die Forschungsüberblicke von L. de Winter 2002; W. Müller 2004; Th. Saalfeld 2007: 217ff.). Sowohl für die Bildung als auch für die Stabilität hat es sich aber als vorteilhaft erwiesen, diejenige Partei in die Regierungskoalition zu integrieren, die im Parteienwettbewerb in den für die Regierungspolitik zentralen bzw. entscheidenden Politikfeldern und -dimensionen die zwischen allen Parteien im Wettbewerb vermittelnde Position einnehmen kann und somit die Kompromissfindung nach innen und außen stabilisiert („strong party“). Diese jüngere Erkenntnis erweitert den Medianansatz der Koalitionsforschung, nach dem in Parlamenten diejenige Partei einen erheblichen strategischen Vorteil hat, die in einem Kontinuum der Präferenzen aller Parteien in einzelnen Politikfeldern den Medianabgeordneten oder -wähler stellt (vgl. M. Laver/N. Schofield 1990). Das bedeutet in jedem Fall, programmatisch-inhaltliche Erwägungen auf der Basis der Strukturen des Parteiensystems als einen weithin zu betrachtenden zentralen Faktor von Koalitionsbildungsprozessen mit einzubeziehen. Die genannten Faktoren bilden – je nach einzeln zu betrachtender Konstellation – in unterschiedlichem Maße den Rahmen für Koalitionsentscheidungen. Sie beeinflussen und begrenzen die koalitionspolitischen Aktivitäten der Spitzenakteure in den Parteien, ohne dass negiert werden soll, dass deren Präferenzen völlig außer acht bleiben.2 3 Die Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl 2005 Am Abend der Bundestagswahl reklamierte Gerhard Schröder trotz der Wahlverluste der SPD weiterhin das Amt des Bundeskanzlers für sich, die SPD-Parteiführung sprach „von neuem Vertrauen“ für ihren Bundeskanzler und hob hervor, dass sie noch vor der CDU die stärkste Partei im Bundestag sei, um ihren Anspruch auf das Kanzleramt zu manifestieren (vgl. G. Bannas 2005a) – was für die nachfolgende Regierungsbildung vier zentrale Folgen hatte: 2 Wolfgang Rudzio spricht von einer „guten persönlichen Chemie“ (Rudzio 2002: 49) zwischen den Spitzen der Koalitionspartner als Faktor der Koalitionsbildung. 32 Uwe Jun 1. Verschiedene Koalitionsbildungen wurden diskutiert, da sowohl Union als auch SPD ihre strategische Position für Koalitionsverhandlungen verbessern wollten. Um dennoch das Amt des Bundeskanzlers nach bisheriger parlamentarischer Gepflogenheit (die stärkste Regierungsfraktion stellt den Regierungschef) besetzen zu können, musste die Union den Sozialdemokraten ein relativ teueres Angebot machen. Die Koalitionsverhandlungen wurden ohne Eile geführt und zogen sich über viele Wochen hin, während der Verhandlungen wurde häufiger ein erfolgreicher Abschluss in Frage gestellt. Die Koalitionsvereinbarungen sind äußerst umfangreich und enthalten neben den Spielregeln für die Arbeit der Koalition die programmatischen Festlegungen für die kommende Legislaturperiode sowie personale Besetzungen und wurden insgesamt vor dem Hintergrund geschlossen, über besonders strittige Fragen erst im Verlauf der Legislaturperiode eine Einigung herbeizuführen (etwa Rente, Gesundheit, Pflege, Arbeitsmarkt, Föderalismus). 2. 3. 4. Zum ersten Punkt: In der so genannten „Orientierungsphase“ unmittelbar nach der Bundestagswahl wurde über „Schwampeln“ oder angesichts der farblichen Gestaltung der Nationalflagge des Inselstaats in der Karibik von „Jamaika-Koalitionen“ (Koalition aus CDU/CSU, FDP und Bündnisgrünen) und von „Ampeln“ (Koalition aus SPD, FDP und Bündnisgrünen) öffentlich gesprochen (vgl. etwa G. Bannas 2005a, 2005b).3 Die FDP-Parteiführung brachte selbst eine Minderheitenkoalition mit der CDU/CSU ins Spiel (vgl. o.V. 2005a). Alle diese Optionen wurden jedoch schnell verworfen. Die FDP lehnte unmittelbar nach der Wahl aus inhaltlichen und langfristigen strategischen Gründen jegliche Koalitionsbildung mit der SPD kategorisch ab: Letzteres, weil die Liberalen ihre Imagewerte in punkto Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit nach dem entertainisierten Wahlkampf 2002 wieder erhöhen wollten; aus ihrer Parteigeschichte heraus wollte die FDP keinesfalls wieder dem Vorwurf der „Umfallerpartei“ ausgesetzt sein. Auch hatte die FDP in der Zeit des Parteivorsitzenden Guido Westerwelle ihre Position im Parteiensystem verschoben, insbesondere in der ökonomischen Dimension, in der die FDP betont, „allein eine wirklich marktwirtschaftliche Partei“ (S. Götte/S. Recke 2006: 145) zu sein. Ihr Wahlprogramm trug entsprechend starke wirtschaftsliberale Züge, was schon rein quantitativ zum Ausdruck kommt und durch fast ausschließlich positive Konnotationen der Begriffe „Markt“ und „Wettbewerb“ eindeutig untermauert wird.4 In der ökonomischen Dimension kann die FDP fraglos nicht als Scharnier3 4 Wolfgang Dexheimer (1973) unterscheidet fünf Phasen der Koalitionsbildung, nach der „Orientierungsphase“ als zweite Phase die Vorverhandlungen, anschließend die „Sachverhandlungen“, schließlich die „Personalverhandlungen“ und abschließend die Unterzeichnung der Verhandlungsergebnisse durch die Verhandlungsführungen sowie die formelle Bestätigung der Koalition durch die obersten Parteigremien, in aller Regel Parteitage. Im Wahlprogramm der FDP tauchen die Begriffe „Markt“ (69 Mal) und „Wettbewerb“ (62 Mal) im Vergleich zu allen anderen Parteien überdurchschnittlich häufig auf. Die Vergleichswerte: