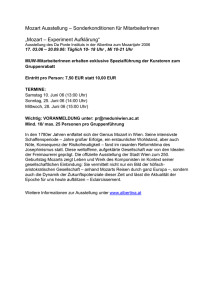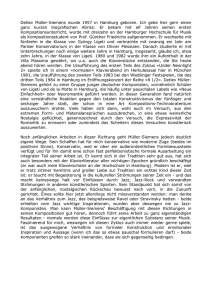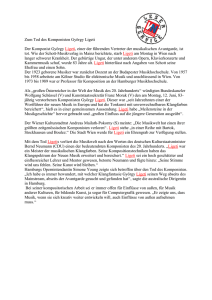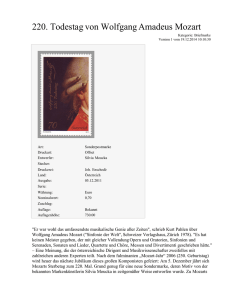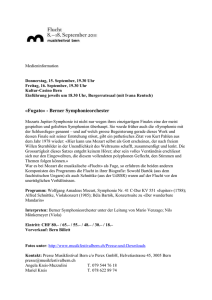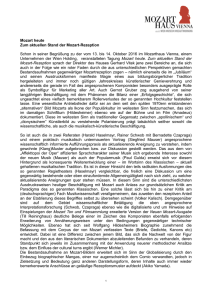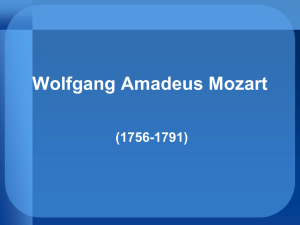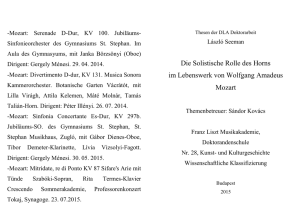Mozart und ich sind gut befreundet
Werbung

DIALOGE 2014 S A M S T A G, 2 2 . N OV EM BER 2 0 14 Genie und Kindskopf in Schrift und Noten Es ist ein typisches Notenblatt aus Mozarts Hand. Scheinbar mühelos ist die Skizze zu einem Kyrie in D hingeworfen. Der obere Rand ist mit Höflichkeitsfloskeln beschrieben und an der rechten Kante sind jede Menge 3er-Ziffern gekritzelt. Das Blatt ist eines von etwa 60 autographen Entwürfen Mozarts, die in der Stiftung Mozarteum Salzburg verwahrt werden und bloß Fragment blieben. Sie dokumentieren, dass es selbst bei einem Genie wie Mozart Brüche, Ungelöstes, Unvollkommenes gibt. Nach Manfred Trojahn und Georg Friedrich Haas erweckt nun Peter Eötvös gleich neun Bruchstücke zu klingendem Leben, darunter auch jenes Kyrie in D KV 166g (Anh. 19), das Mozart vermutlich im Juni 1773 in Salzburg komponiert hat. Eötvös verarbeitet die Fragmente in seinem Werk „da capo“ und tritt in einen Dialog mit Mozart. „Ich gehe von Mozart aus, ich beginne zu wandern und dann kehre ich doch zurück, ich komme und gehe, und dann machen wir die nächste Runde – in diesem Sinne: da capo.“ Bei Führungen im Autographenkeller der Stiftung Mozarteum Salzburg werden handschriftliche Skizzen Mozarts gezeigt, ebenso wie etwa jene Briefe, die Eötvös seiner Komposition „Korrespondenz“ zugrunde legte. So wie Mozart in seinen Kompositionen immer wieder aus dem ästhetischen Korsett ausbrach und in die Zukunft hören ließ, suchte er auch in seinen sprachlichen Äußerungen die Entgrenzung. Mozarts Briefe offenbaren allerdings nicht selten einen recht spielerischen, oft kindischen Charakter, der die Flexibilität der Sprache auszuloten versucht. BILD: SN/STIFTUNG MOZARTEUM SALZBURG Fred Eerdekens, „and a silent voice and a solid space“, 2014, wood, plaster, copper, light source, 62 x 31 cm, collection of the artist. „Mozart und ich sind gut befreundet“ Der ungarische Dirigent und Komponist Peter Eötvös (*1944) erzählt im Interview über seine Beziehung zu Mozart, seine Muttersprache und wie ihm selbst ein Streichquartett zur Oper gerät. Peter Eötvös gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Dirigenten und Komponisten. In den 1970er-Jahren gehörte er dem Kreis der Stockhausen-Schüler an. Von 1978 bis 1991 leitete er das neu gegründete Ensemble intercontemporain. 1998 profilierte er sich mit seiner Oper „Drei Schwestern“ als ein großer Opernkomponist unserer Zeit. SN: Wie erklären Sie sich den Umstand, dass vier der bedeutendsten Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts, nämlich Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtág und Sie, gewissermaßen aus demselben Landstrich stammen? Eötvös: Was den Geburtsort betrifft, ist das reiner Zufall. Aber wie sich das danach entwickelt hat, ist interessant. Bartók hatte eine sehr offene, in seiner Zeit wirklich ungewöhnlich breite Sicht. Er war Ungar und zugleich Weltbürger. Ligeti und Kurtág sind in Transsilvanien, in einer multikulturellen, mehrsprachigen Situation aufgewachsen. Beide kamen nach dem Krieg nach Budapest und wollten bei Bartók studieren, aber Bartók war schon tot. Ligeti ist 1956 nach Österreich gegangen. Kurtág blieb sehr lang in Ungarn . . . Meine Situation ist wieder eine andere, weil ich in Transsilvanien nur geboren wurde. Ein paar Monate nach meiner Geburt kamen die Russen und wir mussten das Land verlassen. Nach dem Krieg kehrten wir nach Ungarn zurück. Als ich in der Schule erzählt habe, dass ich in Transsilvanien geboren bin, war das etwas Spezielles, weil Transsilvanien damals schon zu Rumänien gehörte. Als ich geboren wurde, war es noch Ungarn. Auf diese außergewöhnliche Stellung war ich irgendwie stolz . . . Später, während der Jahre an der Budapester Musikakademie, habe ich schließlich eine transsilvanische Volksmusiksammlung gefunden – instrumentale Volksmusik. Das hat mich überwältigt: so unglaublich schön, wunderbar reich – ich war begeistert. Seither habe ich eine starke „Heimatbeziehung“ zu dieser Musik. Farbe, seinen eigenen Klang, sein eigenes Tempo. Dann kommt noch die Sprache dazu. Die Sprache entscheidet diese Parameter mit. Je mehr bestimmt ich bin, desto freier fühle ich mich. In der Komposition die Noten zu schreiben, das ist die allerletzte Phase. Ich muss zuerst alle anderen Angaben wissen, auch wie viele Proben, welche Kleider, welches Licht . . . Erst dann kann ich die Töne notieren – und nicht umgekehrt. Diese Bestimmtheit gibt mir, auch wenn das anachronistisch klingt, Freiheit. SN: Inwiefern hatten und haben die drei Komponistenkollegen Einfluss auf Ihr Komponieren? Meine Muttersprache ist Bartók. Ich habe Bartók schon als Kind am Klavier gespielt. Ich hatte das Glück, dass mich mein Klavierprofessor damals Mozart, Bach und Bartók spielen ließ. Deswegen war die Musik von Bartók – auch später als Dirigent – für mich immer ganz natürlich. Sehr starke Beziehungen hatte ich auch zu Kurtág und Ligeti. Musikalisch gesehen habe ich bei Ligeti immer darauf geachtet, dass ich möglichst nichts von ihm übernehme. Bei Kurtág war es ein interessantes Hin und Her. Wenn ich etwas komponiert habe, hat er darauf reagiert. Oder er sagte mir, was er komponiert hat, dann habe ich etwas aufgegriffen – nicht übernommen! Dieser permanente musikalische Dialog war sehr bereichernd. Es ist bei Ligeti und bei Kurtág wie bei Bartók: Ihre Musik spreche ich wie meine eigene – oder vielleicht noch besser. SN: Als ein zentrales Werk der Dialoge ist Ligetis „Nouvelles Aventures“ programmiert. Inwiefern war das für Sie von Bedeutung? Ich würde fast sagen, es ist das beste Stück von Ligeti, weil es ein Fenster in der Opernliteratur geöffnet hat. Obwohl Ligeti darin eine Unsinn-Sprache verwendet, kann jeder verstehen, was gesagt wird. Die Instrumentation ist einmalig, die Behandlung der Sänger Peter Eötvös BILD: SN/ISM, MARCO BORGGREVE ist einmalig: Das ist ein Diamant in der Operngeschichte. Für mich bedeutete es eine Befreiung. SN: György Ligeti war Synästhetiker, er verband Bilder, Farben und Formen mit Bewegungen und Musik – ist Ihnen diese Wahrnehmungsgabe auch gegeben? Ja, das empfinde ich auch . . . Wenn ich zu komponieren beginne – besonders in der Oper –, sind das Bilder, optische Gestalten und Farben, die in Klang umgesetzt werden. Bei einem Opernprojekt entscheiden wir zuerst das Sujet, dann schauen wir, welche Charaktere passen. Diese Charaktere werden früh mit bestimmten Sängern besetzt. Dann weiß ich, welche Instrumentation ich mache. Die Instrumentation, die ich ganz am Anfang entscheide, ändert sich später nicht mehr. Das ist der Ausgangspunkt. Ich kann das nur auf ein „malerartiges“ Denken zurückführen. Jedes Sujet hat seine eigene SN: Was reizt den Komponisten Peter Eötvös am Text? Ist es der Wortsinn oder ist es „bloß“ das Klangmaterial, das beim Sprechen eines Textes entsteht? Das ist unterschiedlich. Es gibt zwei, drei Stücke bei mir, die mit Nonsens-Sprache arbeiten. Nonsens zu vertonen ist aber schwierig, weil ich selbst erfinden muss, was passieren soll. Da hilft nur der phonetische Inhalt, in welche Richtung man mit dem Klang gehen kann. Umgekehrt – wenn der Text sehr konkret ist – ist die Gefahr größer, dass man in die Illustration gerät. Gleichzeitig gibt es bei konkreten Texten einen reicheren Inhalt. Da ist das Land, in dem ich zu bauen beginne, weiter. Nonsens ist gut, konkret ist noch besser. SN: In welchen Sprachen fühlen Sie sich musikalisch besonders gut aufgehoben? Dort, wo sich die Sänger wohlfühlen. Ideal sind Russisch und Italienisch, weil beide Sprachen sehr offene Vokale und sehr starke, klare Konsonanten haben. Das Russische ist besonders schön, weil es noch reichere Konsonanten hat als das Italienische, geräusch- Sprache, Material, Licht und Schatten – das sind die Ingredienzien, aus denen der belgische Künstler Fred Eerdekens (*1951) seine charakteristischen skulpturalen Objekte formt. Die kunstvoll verschlungenen Drahtgebilde werden durch das Spiel mit dem Licht zum Leben erweckt: Sie werfen Schatten und verwandeln sich zu Wortfetzen und Textfragmenten. Neben den poetischen Schattenspielen, die die Vieldeutigkeit alles Sprachlichen thematisieren, werden auch Klanginstallationen mit Mozart’schen Sprachspielereien die Dialoge „Wort“ begleiten. Wie die Übersetzung von Wort in Klang gelingen kann, wird auch in Lectures, Filmvorführungen, Einführungsvorträgen u. v. m. erörtert. Und am Freitag- und Samstagabend wird wieder die chillige Lounge im Wiener Saal mit DJane Letizia Renzini eingerichtet. hafte, die sehr charakteristisch sind. Mit deutschen Texten komme ich auch gut zurecht. Mit Englisch ist leicht umzugehen. Jede Sprache hat ihre Farbe, ihr Tempo . . . die Oper, wenn man so will. Ein musikalischer Spaß, der einfach gut funktioniert. SN: Was motiviert Ihr Komponieren? Meine Beziehung zu Mozarts Werken, überhaupt zur Figur Mozarts, begann eigentlich in den 1970er Jahren. Ich glaube, es war Vinko Globokar, der damals in Paris eine Konzertreihe organisiert hat, und ich habe den Auftrag bekommen, für diese Reihe etwas zu schreiben. Ich habe schon damals die Texte der Pariser Korrespondenz der Mozarts für ein Duett für Bratsche und Geige verwendet Vinko Globokar Weil dieser Inhalt so dramatisch ist, habe ich 1992 in „Korrespondenz“ noch einmal damit begonnen. Ich mag ihn einfach! Mozart und ich sind gut befreundet sozusagen. Ich mag den Typ – den Papa übrigens auch, aber sagen Sie das nicht dem Wolfgang! Bei Wolfgang fasziniert mich, dass er das Melos seiner Zeit als Material nimmt, er schreibt so wie die anderen. Aber dann, an einem bestimmten Punkt, bricht er einfach aus, schießt raus und ist ganz verrückt. Nicht lang, dann kehrt er wieder zurück. Das ist wunderbar! Ich glaube, das Theater: Kontraste, Konflikte, Charaktere mit Klang auszudrücken. Ich würde bewusst nicht „Musik“ sagen, Klang ist komplexer. Für mich ist Musik die zweite Sprache. Und dann ist da noch die Gestik – eine eigene Welt. SN: Ihr Streichquartett „Korrespondenz“ basiert auf dem Brief-Dialog, den Wolfgang während seiner Paris-Reise 1778 mit seinem Vater Leopold Mozart führte. Man meint darin die Protagonisten „sprechen“ zu hören. Wie lässt sich Sprache so subtil in Töne fassen? Hier ist der Brief-Text in Musik übersetzt. Das passierte zu einem großen Prozentsatz mechanisch. Mein Interesse war, die Wortinhalte – nicht nur den Sinn, sondern die Vokale und die Konsonanten – wirklich mikroskopisch zu übernehmen, zu bearbeiten. Ich habe damals eine phonetische Reihenfolge festgelegt. Der Ausgangspunkt war also eine Forschungssituation. Durch die Komplexität des Textes entstand eine akzeptable Musik. Dann kam noch die Ebene des Theaters dazu: Das Streichquartett ist so aufgebaut, dass Wolfgang die Bratsche ist, Leopold ist vom Cello verkörpert, die zwei Geigen sind gewissermaßen die Seelen der beiden. Die Situationen kommen aus dem Brief. Den Anfang zum Beispiel habe ich so gestaltet, dass der eine schreibt und der andere liest. Wolfgang schreibt schnell, Papa liest langsam usw. In dem Moment passiert schon eine Interpretation, hier beginnt das Theater, SN: Welche „Beziehung“ haben Sie zu Mozart? SN: Was war für Sie zuerst: das Wort oder die Musik? Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Wenn Sie ein Wort aussprechen . . . es ist so einfach, daraus Musik zu machen. Musik ist ein Kommunikationsmittel wie die Sprache – und Musik muss man genauso lernen, erfahren, verstehen wie eine Sprache. Es ist egal, was zuerst war. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann hat es wohl denselben Ursprung. Mozart gibt dazu vielleicht auch eine Antwort: Musik bitte dann, wenn es nötig ist! Interview: Margarethe Lasinger „2001: Odyssee im Weltraum“ BILD: SN/STIFTUNG MOZARTEUM SALZBURG, WARNER BROS Odyssee der Klänge György Ligeti suchte nach dem Klang im imaginären Raum. In völliger Dunkelheit hebt die Musik an. Drei lange Minuten sind die Zuseher mit einem schwarzen Bild und Ligetis „Atmosphères“ in kosmischer Weite allein gelassen. Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ schrieb Filmgeschichte – und mit dem Film György Ligeti Musikgeschichte. Er ist wohl einer der wenigen Komponisten der Avantgarde, der einem großen Publikum – eben durch Kubricks Film – bekannt ist. Dabei grenzt es – nach Verfolgung, Arbeitsdienst, Gefangenschaft und Flucht – an ein Wunder, dass György Ligeti (1923–2006) seine musikalischen Studien nach dem Krieg in Budapest weiterführen und abschließen konnte. „Irgendwie ist es ein Irrtum, ein Zufall, dass ich noch lebe“, sagte er einmal in einem Interview. Nach der Niederschlagung des Ungarischen Volksaufstands verließ Ligeti 1956 Ungarn aus politischen wie künstlerischen Gründen in Richtung Wien und später Köln. Im Köln der späten 1950er-Jahre, die Pionierstadt der elektronischen Musik, fand er vorerst eine neue musikalische Heimat und Inspiration durch die wichtigen Vertreter der Avantgarde: Karlheinz Stockhausen, Maurizio Kagel, Pierre Boulez . . . Seine von der ungarischen Folklore und Béla Bartók beeinflusste musikalische Sprache erweiterte er durch den Einsatz von Elektronik. Doch Moden, Stilen oder gar Schulen unterwarf sich Ligeti niemals. In seiner unbändigen Neugier suchte er die Verbindung unterschiedlichster Kulturen, experimentierte mit Formen – und eröffnete sich und uns dabei ungeahnte Klangräume und sinnliche Eindrücke. Die Komplexität von Ligetis Musiksprache und seine Virtuosität im Umgang mit Worten und Klängen dokumentieren auch die diesjährigen Dialoge-Konzerte. Dabei ist György Ligeti nicht nur mit seinen kompositorischen Werken präsent. Eine eigene Filmreihe zeigt die visionäre Dimension seines Œuvres in Wort, Bild und Musik. Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker schließlich öffnet für eine Filmvorführung gar den Großen Saal des Mozarteums in ungeahnte Sphären und offenbart damit wohl auch ein besonderes Klangerlebnis. (5. Dezember, 22.00 Uhr)