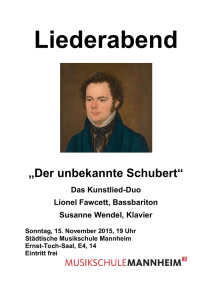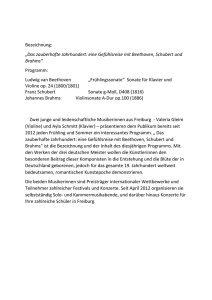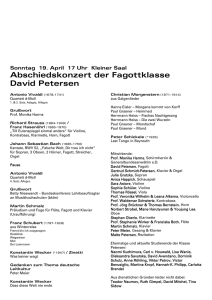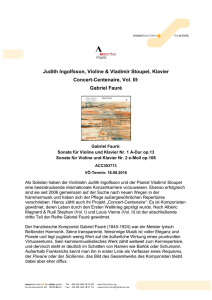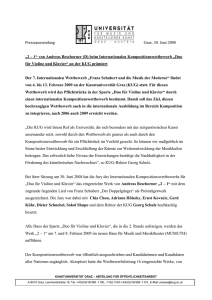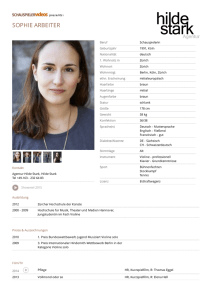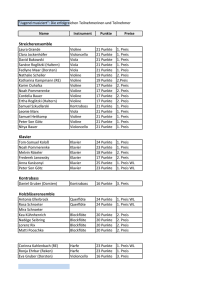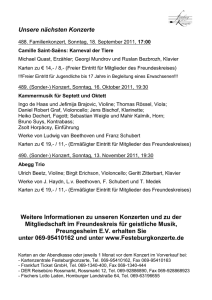Schubert pur
Werbung

Montag, 10. Juli, 20 Uhr Helmut List Halle Schubert pur Franz Schubert (1797–1828) Sonate in a für Violine und Klavier, op. post. 137/2, D 385 Allegro moderato Andante Menuetto: Allegro Allegro Sonate in D für Violine und Klavier, op. post. 137/1, D 384 Allegro molto Andante Allegro vivace Rondo in h für Violine und Klavier, op. 70, D 895 (Rondeau brillant) Andante. Allegro Sonate in A für Violine und Klavier, op. post. 162, D 574 (Grand Duo) Allegro moderato Scherzo: Presto Andantino Allegro vivace Schubert pur Lieder und Tänze – in Schuberts Werken für Violine und Klavier wechseln sich diese beiden Pole beständig ab. Während die ersten Sätze der Sonaten zart und liedhaft singen, legen die Scherzi und ­ Benjamin Schmid, Violine Markus Schirmer, Klavier manchmal auch die Finalsätze beträchtliche tänzerische Energie an den Tag. ­„Allegro“, „Allegro vivace“, „Presto“ lauten die Tempobezeichnungen für diese wilden, Programmdauer: Erster Konzertteil: ca. 55 Minuten Pause: ca. 25 Minuten Zweiter Konzertteil: ca. 25 Minuten stürmischen Sätze, in denen der brodelnde Vulkan unter der ruhigen Oberfläche des genügsamen Wieners zum Vorschein Hörfunk: Dienstag, 18. Juli, 19.30 Uhr, Ö1 kommt. Zum Programm Geiger Schubert Franz Schubert war ein mehr als nur solider Violinist – wie so viele Komponisten in der alten Habsburger-Monarchie, von Mozart und Haydn bis hin zur Strauß-Familie. Schuberts Schulzeugnisse am k. k. Stadtkonvikt in Wien legen von seinen geigerischen Fähigkeiten beredtes Zeugnis ab. Selbstverständlich fungierte er als Konzertmeister im Schulorchester und beteiligte sich an den „Quartettkomiterien“, die dort wöchentlich abgehalten wurden. Nach dem Abgang von der Schule verrichtete er seinen Dienst als Hilfslehrer im heimatlichen Lichten­thal und blieb geigerisch in Übung, indem er mit dem Vater und den Brüdern Trios, Quartette und Quintette spielte. Aus diesem häuslichen Umfeld heraus schrieb er im März und April 1816, also mit neunzehn Jahren, drei Sonaten für Violine und Klavier, die erst spätere Generationen zu „Sonatinen“ degradierten. menten, die kantable Führung der Violine und der durchsichtige Klaviersatz distanzieren sich von jeder virtuosen Attitüde und orientieren sich an jenem vollendeten Dialog zwischen „Pianoforte et Violon“, wie ihn Mozart in seinen Wiener Violinsonaten verwirklicht hatte. In den gleichen Wochen, in denen Schubert an diesen drei Sonaten arbeitete, stellte er das erste Heft mit Goetheliedern zusammen, das er im April 1816 an den Dichterfürsten nach Weimar sandte. Offenbar wollte er damals seine ersten gültigen Werkzyklen vorlegen – hier die Goethelieder, dort die ­Violinsonaten. Sie zeugen vom wachsenden Selbstbewusstsein des jungen Komponisten, der damals auch große Werke in Angriff nahm: Unmittelbar vor den Violinsonaten, Ende Februar 1816, hatte er sein deutsches „Stabat Mater“ nach Klopstock vollendet, ein Oratorium in zwölf Sätzen. Ende April war die Vierte Sinfonie in c-Moll vollendet, die man heute die „Tragische“ nennt. Etwas vom schmerzlichen Grundton dieser beiden Werke liegt auch über der Violinsonate in a. Sonaten in a und D „Sonate II pour le Pianoforte et Violon“ hat Schubert im März 1816 auf seine Handschrift der a-Moll-Sonate D 385 geschrieben. Erst der Verleger Diabelli gab der Sonate und ihren beiden Schwesterwerken zwanzig Jahre später den Titel „Drei Sonatinen“, denn so kurze und relativ leichte Violinsonaten wurden mittlerweile – im Umfeld der Violinvirtuosen alla Paganini oder Spohr – als Übungsstücke angesehen und taugten nicht zum Genre der „Grande Sonate“. Tatsächlich hat sich Schubert hier mit der klassischen Tradition der Violinsonate auseinandergesetzt: Die knappen Formen der drei Werke sind eine Stilisierung im Stile Mozarts. Nicht nur die Melodik mutet oft mozartisch an – bis hin zu regelrechten Zitaten. Auch das ausgewogene Verhältnis zwischen beiden Instru- Zur Musik Im Kopfsatz der a-Moll-Sonate hört man erstmals jenen unverwechselbaren Ton tiefer Melancholie, wie er auch Schuberts drei Klaviersonaten und sein Streichquartett in dieser Tonart kennzeichnet. Das liedhafte Hauptthema mit seinen klagenden Halbenoten in langen Legato-Bögen erinnert an die Tenorarie „Ach, was hätten wir empfunden“ aus dem „Stabat Mater“. Ihm tritt ein Seitenthema gegenüber, das auch aus einem Spätwerk des Komponisten stammen könnte. Die Entwicklung des Satzes beruht eher auf harmonischen und rhythmischen Veränderungen der Themen als auf motivisch-thematischer Arbeit. Im schönen F-Dur-Thema des Andante erinnerte sich Schubert an das Menuett aus Mozarts F-Dur-Violinsonate KV 377. Harmonisch ging er freilich viel weiter als sein Idol, etwa durch auffallende „Molleinbrüche“ im zweiten Thema oder durch die Versetzung der beiden Themen in die weit entfernten Tonarten As-Dur und Des-Dur. Das Menuetto ist eigentlich ein Scherzo im Stile Beethovens – mit einem ruppigen d-Moll-Hauptteil und einem tröstlichen B-Dur-Trio, einer der wildesten Sätze des jungen Schubert. Im Thema des Rondo­ finales kommt wieder der sehnsüchtig singende Schubert zu Wort. Die D-Dur-Sonate beginnt mit einem weich fließenden Thema im Unisono der beiden Instrumente – ganz so wie Mozarts e-Moll-Sonate KV 304. Anschließend wird das Thema in Oktavkanons ausgelotet und bis nach F-Dur geführt. Noch süßer (dolce) kommt das mozartische ­Seitenthema daher. Den einzigen Kontrast im lyrischen Strömen der ­M elodien setzt eine FortissimoVariante des Hauptthemas, das in der Durchführung in immer neuen harmonischen Schattierungen beleuchtet wird. Das schöne A-Dur-Andante klingt an ein bekanntes Mozartlied an („An Chloë“, KV 524). Im a-Moll-Mittelteil hört man Musik des jungen Liedkomponisten Schubert. Obwohl auch das Tanzthema des Finalrondo an diverse Mozart’sche Finali im Sechsachteltakt erinnert, wirkt dieses Allegro vivace unverkennbar schubertisch, gleich mit dem ausdrucksvollen Gis im vierten Takt und dem Akzent im sechsten. Harmonische Ausweichungen und Akzente bleiben für den Satz charakteristisch – neben all dem Fließen herrlicher Tanzthemen. Duo in A Als Schubert im August seine große A-Dur-Violinsonate, D 574, in Angriff nahm, hatte sich die Welt für ihn gründlich verändert: Seine Bewerbung um eine Stelle an der neuen Musikschule in Ljubljana war im September 1816 gescheitert und damit auch jede Aussicht auf eine Eheschließung mit Therese Grob dahin. Er musste die reizende Sopranistin aus der Nachbarschaft ziehen lassen, während er selbst seinem tristen Hilfslehrer-Dasein nachging. Der Dichterfürst zu Weimar hatte die Übersendung des Goethe-Liederheftes ohne jede Antwort gelassen, und auch die Hoffnung, für die drei Violinsonaten von 1816 einen Verleger zu finden, hatte sich zerschlagen. Schubert reagierte auf diese Rückschläge mit einem „Sonatensommer“: Kaum näherte sich das Schuljahr seinem Ende, schon stürzte er sich in die Arbeit. Von Juni bis August 1817 schrieb er vier große Klaviersonaten in e, Es, fis und H, von denen er aber nur die zweite und vierte vollendete. Als fünftes Werk der Serie komponierte er eine Sonate für Klavier mit Violine, die seine drei Sonaten vom Vorjahr in jeder Hinsicht übertraf: Sie ist länger, virtuoser und sehr viel wagemutiger, offenbar eine „Grande Sonate“, mit der sich der Zwanzigjährige vom früheren Vorbild Mozart lösen und den Anschluss an die großen Sonaten Beethovens und Hummels erreichen wollte. Wie die genannten Klaviersonaten vom Sommer 1817 ist auch dieses Werk erst spät aus seinem Nachlass veröffentlicht worden: 1851 erschien es als „Duo (en La) pour Piano e Violon“ Opus 162 bei Diabelli & Co. Zur Musik Die Ausweitung der Form in den vier Sätzen hängt eng mit der neuen Rolle des Klaviers zusammen, die Schubert in den besagten Klaviersonaten entwickelt hatte: Dem Hauptthema des ersten Satzes geht ein Klanggrund des Klaviers in tiefer Lage voraus. Darüber erhebt sich in hoher Lage der Gesang der Geige. Die zwanglose Antithese suggeriert zwei verschiedene Klangwelten, die sich freilich auf geheimnisvolle Weise durchdringen, fast schon wie in Schuberts später C-Dur-Phantasie für Violine und Klavier. Neben diesem klanglichen Aspekt zeugen auch die Melodik und die formale Anlage von Schuberts gereifter Persönlichkeit. Die Themen kreisen um scheinbar volkstümliche Wendungen und scheinen den klassischen Sonatensatz vom Lied her neu zu definieren. Die üblichen Formteile eines Sonatensatzes – die Vorstellung der Themen (Exposition), ihre Durchführung, die Reprise und am Ende eine Coda – werden in einen weiten harmonischen Bogen hineingestellt: von A-Dur über e-Moll und H-Dur bis nach C-Dur. An den Übergängen kommt es zu geheimnisvollen Modulationen, die zu Schuberts Markenzeichen werden sollten – ebenso wie die „himmlischen Längen“ dieses selig vor sich hin singenden Allegro moderato. ganz leise und keck ein hochschießendes Tanzthema vor. Das Klavier übernimmt laut polternd, worauf ein wilder Lauf im Fortissimo die beiden Instrumente zusammenführt. Im permanenten Schlagabtausch der beiden Spieler entstehen Klänge von sensationell neuer, unerhörter Faktur, selbst im Trio mit seinen chromatischen Legatoläufen. Das Andante weicht ins unschuldige C-Dur aus und benutzt den Duktus eines sehr ruhigen Menuetts, das zweimal variiert wiederkehrt. Es wird von wuchtigen Teilen im Forte unterbrochen, die nach Des-Dur, f-Moll und As-Dur modulieren. Die mittlere dieser Episoden ist durchführungsartig erweitert und enthält ein neues, kanta­bles Thema. Das Finale in Sonatenform ist fast ein zweites Scherzo, so ruppig-tänzerisch gibt sich sein Thema mit den Doppelgriffen der Violine. Gerade für Im zweiten Satz bricht sich die diesen Satz konnte Schubert Vorbilaufgestaute Spannung Bahn, und der bei Beethoven finden, etwa im zwar geradezu eruptiv: Die Geige gibt Finalsatz der „Kreutzersonate“. Rondeau in h Erst in seinen letzten Lebensjahren hat sich Schubert wieder der Duobesetzung Violine und Klavier zugewandt. Für den „böhmischen Paganini“ Josef Slawjk schrieb er zwei ausgesprochene Virtuosenstücke: die C-Dur-Fantasie D 934 und das Rondeau brillant in h-Moll D 895. Beide Werke spiegeln einen Geschmackwandel im Wiener Musikleben der 1820er Jahre wider: Die altehrwürdigen Kammermusikgattungen der Wiener Klassik hatten scheinbar ausgedient, die Genres der Virtuosenliteratur traten an ihre Stelle –Variationen, Fantasien und Rondos. Ein Besuch beim Musikalienhändler ließ Schubert ernüchtert feststellen: „Kein Mensch kauft etwas, weder meinige noch andere Sachen, außer miserable Modeware“. Er reagierte auf diese Misere, indem er selbst in zunehmender Zahl Virtuosenstücke komponierte, die dank seiner Freundschaft mit wichtigen Wiener Virtuosen eine reelle Chance hatten, aufgeführt zu werden. Dazu gehörten die Flötenvariationen, die Arpeggione-Sonate und die späten Violinwerke. Es ist kein Zufall, dass gerade diese Werke in Wien noch zu Lebzeiten des Komponisten öffentlich und mit großem Erfolg dargeboten wurden, während fast alle seine späten Quartette und Klaviersonaten erst nach seinem Tod Eingang in den Konzertsaal fanden. Von daher erklärt sich auch, dass sich ausgerechnet zu den beiden virtuosen Spätwerken für Violine zeitgenössische Rezensionen erhalten haben. Diesen Zeitungsartikeln kann man – außer einem etwas zwiespältigen Eindruck von den geigerischen Fähigkeiten des Josef Slawik – ein anschauliches Bild von Schuberts später Musik entnehmen. Über das h-Moll-Rondo schrieb der Rezensent der Wiener Zeitschrift für Kunst folgendes: „Das vorliegende Werk zeigt den kühnen Meister der Harmonie ... Eine feurige Phantasie belebt dieses Tonstück. Obwohl das Ganze brillant ist, verdankt es doch nicht seine Existenz den bloßen Figuren, die uns aus mancher Komposition in tausendfältigen Verrenkungen angrinsen und die Seele ermüden. Der Geist des Erfinders hat hier oft recht kräftig seinen Fittich geschwungen und uns mit ihm erhoben. Der Spieler wird sich durch schönen Harmoniewechsel auf eine interessante Art angezogen fühlen.“ Begriffe wie „begeisterte Ideenfolge“, „schöner Harmoniewechsel“ und „feurige Phantasie“ belegen, was die Zeitgenossen an Schuberts späten Werken anzog. Komponiert im Oktober 1826, erlebte das Rondo seine Uraufführung Anfang 1827 „in einer Gesellschaft bei Artaria, wo auch Schubert gegenwärtig war“, wie dessen Freund Kreißle berichtete. Im Salon des berühmten Wiener Verlegers wurde Schuberts Rondeau brillant tatsächlich zur „Salonmusik“, obwohl es in seinen wilden Klangentladungen alles andere als salonhaft daherkommt. An beide Interpreten der Uraufführung – den Geiger Slawjk und den Klaviervirtuosen Carl Maria von Bocklet – stellte es erhebliche Anforderungen. Zur Musik Auf eine pathetische Einleitung aus doppelt punktierten, wuchtigen Klavierakkorden und wilden Geigenläufen folgt ein süßes Thema der Violine in H-Dur. Dieser Gegensatz zwischen der Grundtonart und ihrer Durvariante bleibt auch für das folgende umfangreiche Rondo charakteristisch. Dessen mürrisches Tanzthema in h-Moll wirkt ungarisch herb und eher hermetisch denn romantisch gefühlvoll – ein Zeugnis jener „Lebensstürme“, denen Schubert in seinen späten Werken allenthalben Ausdruck verlieh. Wie eine himmlische Erscheinung wirkt dagegen die Variante des Rondo-Themas in H-Dur. Dazwischen türmte Schubert immer wieder massive Klavierklänge und Geigenpassagen zu wuchtigen orchestralen Entladungen auf, während die gesanglich weichen Episoden den Satz auf mehr als 700 Takte ausdehnen. Eine Stretta in H-Dur krönt das Stück effektvoll. Josef Beheimb Die Interpreten Markus Schirmer, Klavier, Gleichgültig, ob in Asien, nahezu allen Ländern Europas, Nord- oder Südamerika: Sein Publikum ist stets fasziniert von seinem Charisma und seiner Fähigkeit, auf dem Instrument lebendige Geschichten zu erzählen. Eine seiner Rezensionen bringt es auf den Punkt: „Ein Rattenfänger auf dem Klavier… Musik, die aus Herz, Hirn und Fingerspitzen kommt.“ Schon früh eroberte Markus Schirmer die wichtigsten Konzertserien und Festivals im Sturm: Wiener Musikverein, Suntory Hall/Tokio, Wigmore Hall/London, Gewandhaus/Leipzig, Konzerthaus/Berlin, Bozar/Brüssel, Lucerne Festival, Rheingau Musik Festival, die internationalen Klavierfestivals „La Roque d’Antheron“ oder Ruhr, Kissinger Sommer, Schubertiade, styriarte, Bregenzer Festspiele, Stars of White Nights Festival St. Petersburg u. v. m. Er arbeitet mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten: Wiener Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra London, Tokyo Symphony Orchestra, Mariinsky Orchestra St. Petersburg, Chamber Orchestra of Europe, English Chamber Orchestra unter Valery Gergiev, Sir Neville Marriner, Vladimir Fedoseyev, Lord Yehudi Menuhin, Jukka Pekka Saraste, Sir Charles Mackerras, Michael Gielen, John Axelrod, Fabio Luisi oder Philippe Jordan. In diesem Musiker schlägt allerdings nicht nur ein Herz. Auch jenseits der „etablierten Klassik“ weiß er für Aufsehen erregende Ereignisse zu sorgen: Egal ob mit „Scurdia“, einem Improvisationsprojekt, das außergewöhnliche Musiker aus allen Teilen der Welt auf einer Bühne vereint oder mit eigenwilligen, von Publikum und Presse einhellig gefeierten Programmen mit Schauspielern wie Wolfram Berger oder der US-Sängerin Helen Schneider – Markus Schirmer besticht durch seine ungewöhnliche künstlerische Vielseitigkeit. Seine Einspielungen mit Werken von Schubert, Haydn, Beethoven, Ravel und Mussorgskij sowie seine jüngste CD „The Mozart Sessions“ gemeinsam mit A Far Cry, einem der spannendsten jungen Kammerorchester der USA, mit dem er letztes Jahr auch bei der styriarte auftrat, sind international preisgekrönt worden, u. a. mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik“. Eine der angesehensten Auszeichnungen für einen österreichischen Künstler wurde ihm ebenfalls zuteil: der „Karl-Böhm-Interpretationspreis“. Auftritte bei zahlreichen Festivals und Konzertserien in den USA, Südafrika, Deutschland, der Schweiz, Türkei, Frankreich, Australien, Neuseeland, Qatar, Bahrain, Argentinien, China und Österreich stehen in der nächsten Saison auf seinem Programm. Neben einer Professur für Klavier an der Musikuniversität seiner Heimatstadt Graz wirkt Markus Schirmer auch als gefragter Pädagoge bei internationalen Meisterklassen oder als Juror bei verschiedenen renommierten Klavierwettbewerben. Er ist außerdem künstlerischer Leiter des internationalen Musikfestes ARSONORE, das jährlich im September die Elite der Kammermusik auf die Bühne des Planetensaales im Grazer Schloss Eggenberg bittet. Benjamin Schmid, Violine Benjamin Schmid, aus Wien stammend, gewann unter anderem 1992 den Carl-Flesch-Wettbewerb in London, wo er auch den Mozart-, Beethoven- und Publikumspreis errang. Seither gastiert er auf den wichtigsten Bühnen der Welt mit namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Petersburger Philharmonikern, dem Concertgebouw Orchester Amsterdam oder dem Tonhalle Orchester Zürich. Seine solistische Qualität, die außerordentliche Bandbreite seines Repertoires – neben den üblichen Werken spielt er etwa auch die Violinkonzerte von Hartmann, Gulda, Korngold, Muthspiel, Szymanowski, Weill, Lutosławski oder Reger – und insbesondere auch seine improvisatorischen Fähigkeiten im Jazz machen ihn zu einem Geiger mit unvergleichlichem Profil. Benjamin Schmids rund 50 CDs wurden zum Teil mehrmals mit dem Deutschen Schallplattenpreis (als einziger Geiger in den Kategorien Klassik und Jazz), dem Echo-Klassik-Preis, Grammophone Editor’s Choice oder der Strad Selection ausgezeichnet. Er unterrichtet als Professor am Mozarteum in Salzburg und gibt Meisterklassen an der Hochschule Bern und weltweit in Masterclasses. 2018 wird Benjamin Schmid als künstlerischer Leiter des Internationalen Mozart Wettbewerbs Salzburg fungieren. Über Benjamin Schmid wurden mehrere Dokumentationen und Konzertfilme gedreht, die die herausragende künstlerische Persönlichkeit des Geigers in weltweiter TV-Ausstrahlung festhielten. Benjamin Schmid erhielt den „Internationalen Preis für Kunst und Kultur“ seiner Heimatstadt Salzburg, in der er mit seiner Frau, der Pianistin Ariane Haering, und den gemeinsamen vier Kindern lebt. Benjamin Schmids „Sommernachtskonzert“ mit den Wiener Philharmonikern unter Valery Gergiev 2011 mit dem Violinkonzert von Paganini/Kreisler wurde weltweit im live-TV übertragen und liegt als DVD/CD bei der Deutschen Grammophon Gesellschaft vor. Benjamin Schmid ist als einer der wichtigsten Geiger im Buch „Die Großen Geiger des 20. Jahrhunderts,“ von Jean-Michel Molkou (Verlag Buchet-Chastel, 2014) porträtiert. Er konzertiert auf einer der schönsten Stradivari-Violinen, der „ex Viotti 1718“, die ihm die Österreichische Nationalbank zur Verfügung stellt. Aviso Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Ö1 Club-Mitglieder nützen den Tag und genießen den Abend. Mit ermäßigtem Eintritt zu mehr als 20.000 Kulturveranstaltungen, dem Ö1 Magazin »gehört«, einer kostenlosen Kreditkarte u. v. m. Anmeldung auf oe1.ORF.at Montag, 17. Juli – Stefaniensaal, 20 Uhr Dur und Moll Erste Suite von Tänzen von Bach, Schubert (Ländler), Schumann, Chopin (Walzer) und Bartók, sehnsuchtsvoll und traurig Zweite Suite von Tänzen von Bach, Schubert (Ländler), Schumann, Chopin (Walzer) und Bartók, freudig und lebensfroh Pierre-Laurent Aimard, Klavier Erst Moll, dann Dur. Tänze der Sehnsucht und Trauer im ersten Teil, Tänze der Lebensfreude im zweiten. Pierre-Laurent Aimard hat sich seine beiden großen Tanzsuiten des Lebens selbst zu­ sammengestellt. Beide beginnen bei Bach, mit Auszügen aus den anmutigen „Französischen Suiten“, gefolgt von Schubert-Ländlern und Chopin-Walzern. Auch bei Bartók wird der Tanz auf den 88 Tasten zum Mikrokosmos des Lebens. Aviso Donnerstag, 20. Juli – Helmut List Halle, 20 Uhr Ungarische Tänze Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 1 in g, op. 25 Ungarische Tänze für Violine und Klavier Béla Bartók: Rhapsodie Nr. 1 für Violine und Klavier Zoltán Kodály: Duo, op. 7 Ernö von Dohnányi: Serenade in C für Streichtrio, op. 10 Eszter Haffner, Violine Herbert Kefer, Viola Othmar Müller, Violoncello Stefan Vladar, Klavier Nur ungern ließ sich Brahms daran erinnern, dass seine „Ungarischen Tänze“ Melodien verwendeten, die ungarische Kollegen erfunden hatten, während er sie fälschlich für Volksmelodien hielt. Dieses „Plagiat“ machte er durch jene ungarischen Tänze wett, die sich in seiner Kammermusik verbergen, allen voran im „Zigeunerfinale“ des g-Moll-Quartetts. Neidlos gab sein ungarischer Freund Joseph Joachim zu, dass er den „magyarischen Stil“ perfekt getroffen habe. Keine könnte das heute besser beweisen als die Ungarin Eszter Haffner. Mit Stefan Vladar und handverlesenen Mitspielern lockt sie den Ungarn in Brahms hervor – und den Brahms in Bartók und Dohnányi. Kunsthaus Graz 24.03.-20.08.2017 Erwin Wurm, Ohne Titel, 2016, (unter Verwendung von: Fritz Wotruba, Liegende Figur, 1953), Foto: N.Lackner, UMJ, © Bildrecht, Wien 2017 Fußballgroßer Tonklumpen auf hellblauem Autodach Erwin Wurm Klassik, Jazz, Rock, Pop oder Alternative. Leidenschaftliche Musikberichterstattung eröffnet Perspektiven. Täglich im STANDARD und auf derStandard.at. HAUS DER KUNST Galerie · Andreas Lendl A-8010 GRAZ · JOANNEUMRING 12 Tel +43 /(0)316 / 82 56 96 Fax 82 56 96 - 26 www.kunst-alendl.at [email protected] Ölgemälde · Aquarelle · Zeichnungen Druckgraphik · Skulpturen Reproduktionen · Kunstpostkarten · Künstlerkataloge Exklusive Rahmungen WERNER BERG Mensch und Landschaft 17. Juni bis 27. August 2017 Steirisches Feuerwehrmuseum Kunst & Kultur Marktstraße 1, 8522 Groß St. Florian www.feuerwehrmuseum.at