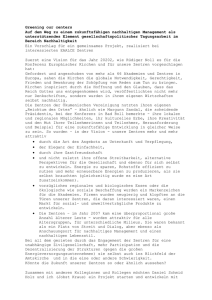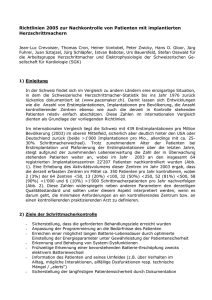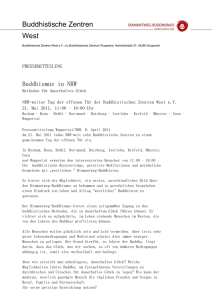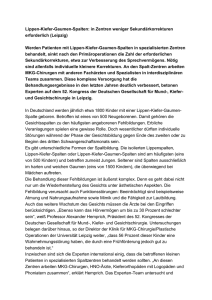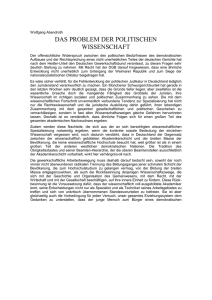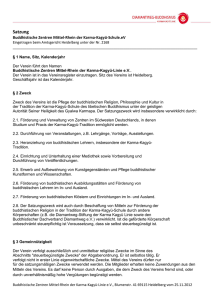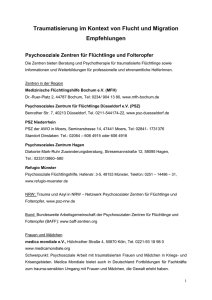1. Definition und Formen von Zentren * Zentren in Krankenhäusern
Werbung

1. Definition und Formen von Zentren Zentren in Krankenhäusern sprießen in Deutschland zur Zeit wie Pilze aus dem Boden. Neue (Fach-)abteilungen, Kliniken oder Institute werden praktisch gar nicht mehr eröffnet. Die Beliebtheit des „neuen“ Konstrukts ist wohl vor allem den positiven Assoziationen mit dem Begriff geschuldet: Mit Zentrum verbindet man zum einen in Anlehnung an das Einkaufszentrum schlicht „Größe“ und damit die Bequemlichkeit, alles, was man benötigt, an einem Ort zu erhalten. Zum anderem - dem etymologischen Ursprung entsprechend – wird mit Zentrum die Vorstellung einer zentralen Institution assoziiert, die quasi den Mittelpunkt des Handelns darstellt. Auch deshalb wird vieles zum Zentrum deklariert, ohne dass damit so recht klar wäre, was dies bedeutet. Der Begriff muss zunächst präzisiert werden: Wir verstehen Zentren in Krankenhäusern als besondere Form der Unternehmenssteuerung. Zentren verkörpern dezentrale Einheiten (von der Unternehmensleitung aus gesehen) und gleichzeitig übergeordnete Strukturen (von den einzelnen Kliniken aus betrachtet). Mit ihnen verfolgt man eine effektive und effizientere Leistungserstellung, in dem man gleichzeitig auf Dezentralisierung und Bildung gewisser Superstrukturen (ggf. nur virtueller Art als Netzwerk) setzt. Zentren können sich als sog. interne Zentren auf einen Standort bzw. ein Haus beziehen, aber auch für mehrere Krankenhäuser, meist eines Trägers, entwickelt werden. Als wichtigen Indikator für die Unterteilung verschiedener Zentrentypen dient uns der Grad der Ausrichtung an der Wertschöpfungskette (ggf. unter mehr oder weniger starker Berücksichtigung anderer Leistungserbringer) mit dem Ziel einer ganzheitlich optimalen Patientenbehandlung. Zentrenbildung ist daher stark verbunden mit der Schaffung ganzheitlicher Versorgungsstrukturen, durch die die funktional fragmentierte Versorgung wieder zu einem sinnvollen Ganzen mit eindeutiger Verantwortung für das erzielte Ergebnis und damit den geschaffenen Wert der Leistung für den Patienten zusammengeführt werden soll. Die Wertorientierung drückt sich in einer möglichst günstigen Relation von Kosten pro gewonnener Nutzeneinheit aus, ganz gleich welche Kriterien den Patienten-Nutzen konkret definieren. Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Zentrentypen. Titel des Beitrags: Formen, Management und Führungsorganisation von Krankenhauszentren Univ.-Prof. Dr. Günther E. Braun, Leiter des Instituts für Betriebswirtschaftslehre des öffentlichen Bereichs und Gesundheitswesens, Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Universität der Bundeswehr München Andreas Greulich, MSc, Krankenhaus-Betriebswirt (VKD), Departementsmanager Schweizer Herz- und Gefäßzentrum, Universitätsspital Bern (Inselspital) Dr. Jan Güssow, Projektmanagement Integrierte Versorgung, Geschäftsführung Strategie und Planung, Städtisches Klinikum München GmbH Karsten Honsel, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer mit dem Geschäftsbereich Finanzen und Infrastruktur der Klinikum Region Hannover GmbH Dr. med. Hermann Stockhorst, MBA, Referent der Geschäftsführung, Klinikum Region Hannover GmbH KompetenzZentren Komplexe Zentren, z.B. Tumorzentren Notfallzentren Organzentren Departemente Dienstleistungszentrum Service / Supportzentrum (z.B. Radiologie) (z.B. DRG-Zentrum) Auf unterster Ebene stehen hinsichtlich der Orientierung an der Wertschöpfung sog. Dienstleistungs- bzw. Service- und Supportzentren. Bei diesen Zentrentypen geht es vornehmlich um die synergetische Zusammenfassung von verschiedenen, den Patientenbehandlungsprozess unterstützenden Tätigkeiten auf medizinischer und administrativer Ebene. Unterstützende, medizinische Dienstleistungen finden sich z.B. häufig im Bereich der Diagnostik, z.B. als übergreifende Zentren für Radiologie, Sonographie und Nuklearmedizin. Daneben gibt es rein administrative Servicezentren, wie z.B. DRG-Zentren. Im Städtischen Klinikum München wurden in einem Medizinischen Dienstleistungszentrum „Medizet“ die Apotheke, die Klinische Chemie, die Mikrobiologie und Pathologie sowie die Sterilgutversorgung, Transfusionsmedizin und Hygiene für fünf Krankenhausstandorte zusammengefasst. Ebenfalls im Medizet untergebracht ist das Institut für Klinische Forschung, welches die Vereinheitlichung und Optimierung der internen administrativen Prozesse zur Prüfung und Abrechnung von Forschungsvorhaben und Studien zur Aufgabe hat. Diese Zentren führen keine eigenen Patienten. Ihre vornehmliche Zielsetzung besteht in der Bündelung von Kompetenzen und der Kosteneinsparungen durch Skalen- und Verbundeffekte. Die meisten Zentren, welche zur Zeit diskutiert werden, befinden sich auf der zweiten Ebene, sei es als Notfallzentren, Organzentren (z.B. Darmzentren, Mammazentren, etc.) oder Departemente, die ebenfalls verschiedene Fachbereiche organisatorisch und teilweise auch räumlich sinnhaft zusammenführen. Hier steht die Reorganisation interner Strukturen entlang des Patientenbehandlungsprozesses im Vordergrund. Organzentren sind dabei häufig eher virtueller Natur. Die Fachbereiche (z.B. Chirurgie, Gastroenterologie und Hämato-/Onkologie) sind nach wie vor organisatorisch getrennt, jedem Fachbereich steht ein Chefarzt vor. Für die Behandlung bestimmter Krankheiten existiert aber eine organisierte interdisziplinäre Zusammenarbeit anhand von leitlinienbasierten Patientenpfaden und institutionalisiert durch verschiedene Instrumente, wie z.B. Qualitätszirkel und Tumorboards. Departemente hingegen sind zumeist organisatorisch stärker zusammengeführte Fachdisziplinen, die einen einheitlichen administrativen Überbau erhalten. Departemente sind daher enger integriert als Organzentren. Komplexe Zentren, wie z.B. Tumor-Zentren, gehen noch einen Schritt weiter. Hier werden Aktivitäten nicht nur entlang der Patientenbehandlung für eine (Tumor-) Erkrankung eines Organs organisiert, sondern für alle (Tumor-)Erkrankungen, was letztlich eine koordinierte Zusammenarbeit praktisch sehr vieler Fachbereiche zur Folge hat. Dabei sind solche übergreifenden Zentrentypen nicht auf Tumorerkrankungen reduziert. Es gibt ebenfalls z.B. „Ernährungszentren“, die alle Aspekte des metabolischen Syndroms umschließen oder Mutter-Kind-Zentren, die alle Aspekte der pränatalen Vorsorge, Geburt und postnatalen Nachbetreuung, z.B. in sog. Perinatalzentren, beinhalten. Hier handelt es sich um eine komplexe Versorgung, die viele verschiedene Fachdisziplinen auf den potentiellen Versorgungsplan ruft. Auf höchster Stufe sehen wir spezielle Kompetenz-Zentren angesiedelt, die aber begrifflich häufig ebenfalls als Tumorzentren etc. gefasst werden. Sie stellen in gewisser Weise noch eine Idealvorstellung dar und sind in Deutschland in der Form bisher nicht vollständig umgesetzt, auch wenn es viele Bestrebungen in diese Richtung gibt. Als konstitutive Merkmale eines Kompetenz-Zentrums scheinen uns die folgenden Aspekte wesentlich: Eine stringente Ausrichtung aller (Behandlungs-)Prozesse am Kundennutzen, daher die gemessene Wertschöpfung für den Patienten als zentrales Merkmal. Eine vollständige, sektorenübergreifende Betreuung von Krankheitsbildern von der Prävention über die Diagnosefindung und Therapie bis zur Rehabilitation und Nachsorge (vertikale Integration). Eine organisierte, interdisziplinäre Zusammenarbeit vormals getrennter Professionalitäten und medizinischer Fachbereiche (horizontale und laterale Integration). Eine ausführliche, den gesamten Krankheitsverlauf umfassende Dokumentation zur kontinuierlichen Verbesserung der Versorgung. Alle diese Aspekte können in den anderen Zentrentypen bereits mehr oder weniger enthalten sein; erst die Verbindung dieser Merkmale machen Zentren jedoch zu Kompetenz-Zentren. Kompetenz-Zentren gehen zumeist aus Organzentren bzw. Departementen hervor. Der Umfang eines Kompetenz-Zentrums kann durchaus variieren. Es ist nicht notwendig, dass ein Zentrum ein riesiger Monolith sein muss, der alle Krankheitsbilder umfasst. Schiere Größe allein ist explizit kein primäres Merkmal eines Kompetenz-Zentrums. Zum Status eines vom Dachverband „Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Tumorzentren e.V.“ anerkannten Tumorzentrums gehört es, ein klinisches Krebsregister zu führen. Eine ausführliche Dokumentation ist nicht nur zur kontinuierlichen Verbesserung notwendig, sondern auch um die Wertschöpfung messund kommunizierbar zu machen. In diesem Zusammenhang ist auch auf den Begriff des Comprehensive Cancer Centers (CCC) nach US-amerikanischem Vorbild hinzuweisen, der insbesondere auf ein Zentrum mit klinischer (Grundlagen-)Forschung abhebt. Ein Kompetenz-Zentrum kann daher durchaus auch als CCC geführt werden, Grundlagenforschung stellt aber kein konstitutives Merkmal von Kompetenz-Zentren dar. Forschung wird in Deutschland vorwiegend an Universitätsklinika betrieben, dennoch können auch andere Krankenhäuser Kompetenz-Zentren errichten, wenn dafür Sorge getragen wird, dass medizinische Erkenntnisse schnell Eingang in die Versorgungsprozesse finden, um Ergebnisse für den Patienten zu verbessern. Kompetenz-Zentren heben sich von den Organzentren und Departementen insbesondere dadurch ab, dass zusätzlich zur inner-organisatorischen Integration auch eine vertikale Integration verschiedener Sektoren des Gesundheitswesens erfolgt, sodass die Versorgung des gesamten Krankheitsverlaufs im Sinne eines Disease Managements gewährleistet ist. Solche Strukturen bieten für den Patienten einen großen Nutzen und damit eine gute Grundlage für ein wertorientiertes Krankheitsmanagement. 2. Beispiele von Zentren Das Städtische Klinikum München fasst seit dem Jahr 2006 medizinische Kompetenz und fachliche Schwerpunktbereiche zu „Medizinischen Zentren“ zusammen. Dabei werden verschiedene Fachabteilungen unter einem Dach vereinigt, um eine schnelle, kompetente, moderne und reibungslose Medizin garantieren zu können. Aufgrund der mannigfaltigen Überschneidungen vieler Krankheitsbilder wurden unterschiedliche Ausprägungen von Zentren institutionalisiert. So existieren organsystembezogene Zentren (z.B. Herzzentrum), entitätsbezogene Zentren (z.B. Tumorzentrum) und patientengruppenbezogene Zentren (z.B. Mutter-Kind-Zentrum). Dabei arbeiten verschiedene Zentren auch standortübergreifend, um den Wissenstransfer und die Interdiziplinarität nicht an örtlichen Grenzen enden zu lassen. (z.B. Unfallchirurgisches Zentrum Süd). Das Städtische Klinikum München hat 2007 in den einzelnen Standorten eine Reihe von Zentren offiziell etabliert, so z.B. am Klinikum Bogenhausen ein Herzzentrum, ein Lungenzentrum und ein Abdominalzentrum. Am Klinikum Harlaching wurde ein Zentrum Süd für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie etabliert, im Klinikum Neuperlach ein Zentrum für Abdominalerkrankungen. Das Klinikum Neuperlach ist darüber hinaus auch am Zentrum Süd beteiligt. Am Klinikum Schwabing wurde ein Zentrum für Unfallchirurgie, Traumatologie und Wiederherstellungschirurgie sowie ein Herz-, Gefäß- und Stoffwechselzentrum eröffnet. Weitere Zentren befinden sich in Planung und sollen in nächster Zeit eröffnet werden. In der Klinikum Region Hannover GmbH stellt sich eine besondere Situation dar, weil das Unternehmen erst im Jahre 2005 gegründet wurde. Auf einer Fläche von der Größe des Saarlandes werden in der Region 13 Krankenhäuser unter einem Dach vereint. Mit den Vorbereitungen zur Unternehmensgründung stellte sich zwangsläufig die Frage auch nach übergeordneten Strukturen im Sinne von Zentren. Denn medizinische Fachspezialisierungen und Kompetenzen waren auf der Ebene der Krankenhäuser verteilt und zum Teil mehrfach vorhanden. Es ist hervorzuheben, dass im Klinikum eine unternehmensweite Definition für Zentrumsstrukturen vorhanden ist. Danach sind Zentren überwiegend krankenhausübergreifende Strukturen, können sich aber auch krankenhausintern abbilden. Einzelne Standorte krankenhausübergreifender Zentren müssen nicht alle Angebote vorhalten. Wichtig ist zunächst die Definition der Ziele und Aufgaben eines Zentrums. Danach kommt die Festlegung der organisatorischen und fachlichen Verantwortung im Rahmen einer Geschäftsordnung. Bedeutungsvoll ist die Prozedurendarstellung zur Klärung allgemeiner und medizinsicher Abläufe z.B. über Standardfestlegungen, SOP’s oder Klinische Pfade. Definierte Qualitätskontrollen spielen eine Rolle. Des Weiteren sind eine Leistungssteuerung und kaufmännische Überlegungen mit Fallzuordnung und –abrechnung notwendig. Das Personalwesen muss darüber hinaus auf die Zentrumsstruktur ausgerichtet sein, um eine adäquate Steuerung der Personalressourcen und der Weiterbildung zu ermöglichen. Im Klinikum Region Hannover konnten in einem schrittweisen Verfahren Zentrumsstrukturen aufgebaut werden. Neben Zentren im Bereich der sekundärmedizinischen Leistungen wurden überwiegend krankenhausübergreifende fachlich-medizinische Zentren konzipiert, die teilweise mit externen Kooperationspartnern und auch sektorübergreifend tätig werden sollen. Die Steuerungsebene für Leistungen, Erlöse und Kosten sind im Klinikum Region Hannover die einzelnen Krankenhäuser. Die gesamtbezogene Unternehmenssteuerung basiert auf der Budgetierung der einzelnen Einrichtungen. Diese Struktur wird behutsam überlagert von ersten zentrumsähnlichen oder zentrumsbezogenen Berichtsstrukturen und Verantwortlichkeiten. Hierzu sind in den nächsten Jahren Steuerungserfahrungen zu sammeln und zu bewerten. Eine eigenen Steuerung auf Zentrumsebene ist aber nicht vorgesehen. Am Beispiel des Herzzentrums kann sehr gut deutlich gemacht werden, welche Potenziale sich hinter einer Zentrumsbildung verbergen. Hier ist ein Weg vom Organzentrum bis zum Kompetenz-Zentrum erkennbar. Das Herzzentrum hat sich aus den kardiologischen Abteilungen in der Klinikum Region Hannover GmbH und damit aus den drei Krankenhäusern Robert-Koch-Krankenhaus Gehrden, Krankenhaus Neustadt und Krankenhaus Siloah in Hannover, unterstützt durch weiter internistische Fachabteilungen, konstituiert. Die Kardiologie bietet sich zur Zentrumsbildung an, da in den Abteilungen Herzkatheterlabore betrieben werden, die hoch standardisierte Leistungen erbringen. Diese orientieren sich an Leitlinien und Standards der Fachgesellschaften und sind untereinander gut vergleichbar. Gleichzeitig sind die Leistungen in der Notfallversorgung der Bevölkerung essentiell. Folgende Maßnahmen wurden schrittweise umgesetzt: Zur Vermeidung einer Fremdvergabe von Leistungen an Krankenhäuser außerhalb der Klinikum Region Hannover GmbH wurde eine Zusammenarbeit mit allen internistischen Abteilungen der Krankenhäuser der Klinikum Region Hannover GmbH vereinbart. Ziel dieser Vereinbarung war die Erbringung sämtlicher Herzkatheteruntersuchungen in den kardiologischen Abteilungen des Klinikums. Die Standardisierung und der gemeinsame Einkauf von Materialen für die Herzkatheteruntersuchungen wurde durch die Abteilungsleitungen erarbeitet und ein Einsparpotential im Sachkostenbereich realisiert. Neben zwei bestehenden 24-Stunden-Bereitschaften in den Herzkatheterlaboren konnte diese auch im dritten Haus eingeführt werden, teilweise durch Unterstützung der vorhandenen Labore. Leistungsplanungen ließen eine Zentralisierung von speziellen und aufwändigen kardiologischen Untersuchungen wie z.B. elektrophysiologischen Untersuchungen zu. Die Implantation von AICD-Defibrillatoren konnte mit den Kostenträgern verhandelt werden. Durch die Arbeiten des Herzzentrums konnten kurzfristig 9 Chest-Pain-Units in allen Akutkrankenhäusern des Unternehmens geschaffen werden. Patienten mit Brustschmerz werden dort nach unternehmensweiten Standards leitliniengerecht behandelt. Zuletzt konnten aus dem Herzzentrum heraus Verträge zur Integrierten Versorgung kardiologischer Patienten geschlossen werden. Ein Beispiel für den Departementsansatz liefert das Universitätsspital Bern (Inselspital). Hier werden die einzelnen Kliniken und Institute seit 1999 unter einer Departementsstruktur geführt. Mit der Grundidee, alle medizinischen und chirurgischen Einheiten auf Basis ihres Organbezuges in eine gemeinsame Struktur zu bringen, existieren dort 9 Departemente, die alle den gleichen organisatorischen Aufbau haben. Dabei stehen 2 Ziele im Vordergrund. Einerseits die stärkere Form der Dezentralisierung bei gleichzeitiger Sicherstellung der administrativen Verantwortungsteilung zwischen zentral und dezentral. Andererseits geht es um die Schaffung einer offeneren Struktur für interdisziplinäre Prozessoptimierung. Der organisatorische Aufbau geht von einem Verbund mehrerer Kliniken, bei Aufrechterhaltung ihrer Kompetenzen und Verantwortungen aus. Klinikgeschäfte werden auch innerhalb der Klinikleitung entschieden. Geschäfte, die mehr als eine Klinik betreffen, werden auf Departementsebene entschieden. Dafür gibt es ein sog. Departementsdirektorium, bestehend aus den Chefärzten/-innen, den LeiterInnen des Pflegedienstes, dem Departementsmanager und Vertretern verschiedener Berufsgruppen. Vorsitz dieses Direktoriums hat einer der Chefärzte/-innen, mit einer StellvertreterIn, die aus dem Kreis der PflegedienstleiterInnen gewählt wird. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Departementsmanager bilden zusammen die Departementsleitung, welche die Geschäfte für die Direktoriumssitzungen aufbereitet und im Rahmen festzulegender Kompetenzen über gewisse Geschäfte entscheidet. Gleichzeitig ist der Departementsvorsitzende auch Mitglied der erweiterten Spitalleitung, welche über die strategischen Themen diskutiert und beschließt. Eine im letzten Jahr durchgeführte Evaluation dieses Departementsansatzes zeigt, dass das erste (administrative) Ziel mit einer breiten Akzeptanz als erreicht gilt, während das Ziel der Prozessoptimierung nur in einzelnen Departementen realisiert werden konnte. 3. Betriebswirtschaftliche Vorteile einer Zentrenbildung im Krankenhaus Grundsätzlich verbinden Zentren die Vorteile dezentraler Leistungserbringung mit solchen einer Bildung größerer Einheiten. Dezentrale Einheiten können „markt- und fachnahe“ agieren und neueste Entwicklungen auf allen Ebenen aufspüren. Das ist der Vorteil gegenüber einer bloßen top-down-Steuerung. Insofern sind Aufgaben, die ursprünglich zentral „ganz oben“ wahrgenommen werden, auf die neu gebildeten Zentren zu übertragen. Welche Aufgaben dies sein werden, kann nicht von vornherein festgelegt werden, sondern ist im Prozess der Bildung und Veränderung von Zentren zu klären. Insofern zeigt sich, dass die Zentrenbildung eine Diskussion über das optimale Verhältnis zwischen zentraler und dezentraler Aufgabenwahrnehmung auslöst. Den Führungspersönlichkeiten der neu gebildeten Zentren werden auf jeden Fall mehr Aufgaben im quantitativen und qualitativen Sinne zuwachsen. Ärzten in der Leitung der Zentren wird ein hohes Maß an Integration von Medizin und Ökonomie abverlangt und Pflegekräften in der Leitung werden sich zum Spezialisten für Fragen der sachorientierten Prozessorganisation erweisen. Betriebswirte in der Leitung werden alle einschlägigen betriebswirtschaftlichen Tools beherrschen müssen. Das neue Selbstverständnis der Ärzte, Pflegekräfte und Betriebswirte in der Zentrumsleitung wird nach unten weiterzugeben sein, um den Erfolg den Zentren sicherzustellen. Auch können neue Aufgaben in den patientennahen Zentren hinzukommen, die bislang keine Rolle gespielt haben. Damit ist eine partielle Reorganisation von Strukturen entlang von Behandlungsprozessen gemeint, die gesamte Krankheitsbilder und –episoden umfassen und die unter eine klare Verantwortung gestellt werden. Auch dazu müssen Krankenhäuser ihre internen Wertschöpfungsstrukturen umbauen. Fachabteilungen sollten im Sinne einer Matrixstruktur um Behandlungsprozessstrukturen ergänzt werden, für die Case Manager die Prozessverantwortung übernehmen. Genauso wichtig wie eine Veränderung der internen Krankenhausstrukturen ist auch eine weitreichende Vorwärtsund Rückwärtsintegration von vor- und nachgelagerten Prozessen. Key Account Manager haben z.B. auf der Basis von statischen und dynamischen ABC-Analysen einen systematischen Kontakt mit herausgehobenen Einweisern zu pflegen. Dabei kann es sein, dass durch die Aufgabenverlagerung zu den Zentren (z.B. in den Bereichen Personal, Controlling, Informatik) und die Wahrnehmung neuer Aufgaben mit einer Ressourcenausweitung vor allem im Personalbereich zu rechnen ist. Auch steigt der Koordinationsaufwand, da die Zentren einen neuen Koordinationsbedarf nach oben (zur Sicherstellung gesamthafter Ziele) und unten (zur Abstimmung in die Kliniken hinein) auslösen. Gemeinsame Richtlinien müssen weitergeleitet und implementiert werden, Projekte müssen mit unterschiedlichen Interessensvertretern bestückt und Prozesse optimiert werden. Auch das hat zur Folge, dass es entsprechend viele Sitzungen und Meetings geben muss, um den Bedarf an Kommunikation zu stillen. Insofern löst die Zentrenbildung unter Berücksichtigung dieser Aspekte zunächst Kosten aus. Langfristig könnte sich aber die Dezentralisierung als hilfreich im betriebswirtschaftlichen Sinne erweisen. Nämlich dann, wenn die Chance genutzt wird, die Leitenden und die Mitarbeiter im Hinblick auf veränderte bzw. neue Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung entsprechend zu schulen und in die strategischen und operativen Entscheide im Zentrum einzubeziehen. Hier könnte das Zauberwort Leistungsvereinbarung (auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen) heißen. Verbunden mit der (Teil-)Autonomie eines Zentrums stellen Leistungsvereinbarungen über Leistungen, Leistungsmengen, Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten einen Basisvertrag für das künftige Geschehen dar. Hier werden Leitplanken gesetzt, um den Handlungsspielraum für die nun stärker unternehmerisch denkende Leitungsebene realistisch umzusetzen. Dabei sind Fragen nach einem gerechten System mit Bonus- und Malus-Komponenten zu beantworten. Diese Fragen müssen in einem Zentrumsansatz früher oder später beantwortet werden, wenn tatsächlich das Ziel besteht, betriebswirtschaftliche Vorteile aus diesem Organisationsansatz zu generieren. Auf der anderen Seite werden sich betriebswirtschaftliche Vorteile ergeben, weil Zentren größere Einheiten darstellen als die Kliniken und Institute der klassischen Krankenhausorganisation. Diese Vorteile bzw. Synergien sind in der Diskussion um krankenhausübergreifende Kooperationen und Konzentration über Jahre hinweg in Theorie und Praxis schon hinreichend erörtert und für standortübergreifende Zentren unmittelbar einsichtig. Und auch bei der internen Zentrenbildung zeigen sich in ähnlicher Weise Vorteile. Aufgrund der Zentrengröße kann man vielfältige Effekte der Kostensenkung pro Leistungseinheit wahrnehmen. Unweigerlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit der Zentrumsgedanke schließlich mit einem betriebswirtschaftlichen Profit-Center-Ansatz verbunden werden kann. In der Form des Profit-Centers sind Teilbereiche des Krankenhauses mit gesondertem Erfolgsausweis vorhanden. Hierzu zählt natürlich auch eine vollständige und nicht angreifbare Datenbasis für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL). Sicherlich ist die IBL in Zeiten der DRGs grundsätzlich ein wichtiges Instrumentarium, doch mit der Verlagerung der Ergebnisverantwortung an die medizinischen Zentren wird diese Datenbasis rasch zur Bedingung für eine erfolgreiche betriebswirtschaftliche Steuerung durch die Zentrumsleitung. Um die beschriebenen betriebswirtschaftlichen Vorteile umzusetzen, ist ein umfassender Managementansatz in der Führungsorganisation von Zentren gefordert, der auch soziologische Aspekte und vor allem Gedanken aus der Organisationsentwicklung aufgreift. Dabei beziehen wir uns in besonderer Weise auf die Rolle des Arztes. 4. Herausforderungen für das Management in der Führungsorganisation von Zentren In unserer Gesellschaft wird dem Krankenhausarzt der Status eines Experten zugeschrieben, der sein Fach zum Wohle des Patienten betreiben soll. Daraus entsteht ein unausgesprochener gesellschaftlicher Auftrag an den Experten, sich so zu verhalten. Der Mediziner unterstellt sich diesem gesellschaftlichen Auftrag. Dabei definiert er aber zunehmend die Erfüllung seines Auftrages selbst und spezialisiert sich in einem bestimmten Themengebiet. Krankenhaus-Organisationen bieten diesen Experten eine mehr oder weniger geeignete Wirkungsstätte. Wirtschaftliche Verantwortung wahrzunehmen gehört nicht zum traditionellen Verständnis des Mediziners und damit nicht zum gesellschaftlichen Auftrag an ihn. Krankenhäuser benötigen aber heute aus wirtschaftlicher Sicht eine professionelle Leitung, um den Erhalt des Hauses sicherzustellen. Faktisch ist es ohnehin so, dass immer mehr Menschen ohne medizinischen Hintergrund in die Leitungsfunktionen des Krankenhauses vordringen. Dies sorgt dafür, dass Medizin und Ökonomie immer stärker in Verbindung treten (müssen). Klassisch sozialisierte Mediziner tun sich damit schwer. Ökonomie kann dann verstanden werden als ein Angriff auf die Autonomie des Experten und gleichzeitig ein Infragestellen der ärztlich determinierten Hierarchien. Deshalb wird ein neues Rollenverständnis des Mediziners, insbesondere des leitenden Arztes, notwendig. Denn eine Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus ist ohne den aktiven Einbezug der Leistungserbringer nicht möglich. Diesem Wunsch stehen allerdings immer noch Vorbehalte und Misstrauen der Mediziner gegenüber Ökonomie, Betriebs- und Managementlehre im Allgemeinen und der Krankenhausadministration im Besonderen im Weg. Krankenhauszentren können nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, den leitenden Arzt – und in Folge auch andere hierarchische Ebenen – in die ökonomische Verantwortung zu nehmen. Wenn wir uns im Vergleich die alt eingesessenen Organisationsstrukturen in Krankenhäusern unter der Bedingung des Selbstkostendeckungsprinzips anschauen, so war die Organisation durch eine stark zentrale und administrative Ausrichtung auf wenige Entscheidungsträger gekennzeichnet. Ressourcenfragen konnten durchaus einmal rasch zwischen Chefarzt und Verwaltungsdirektor geklärt werden, während in einem dezentralen (ergebnisgebundenen) Ansatz unter Beachtung ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen die Entscheidung über Ressourcen von komplexen Faktoren abhängt, die durch Unsicherheit gekennzeichnet sind. Der Einsatz von betriebswirtschaftlichen Tools ist dabei unerlässlich. Für die dezentrale Führung in Zentren spielt auch der bereits erwähnte erhöhte Koordinationsaufwand ein wichtige Rolle, der durch die veränderte Struktur an Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung bedingt ist. Diese neue Struktur ist wesentlich komplizierter als die traditionelle zentrale Führung, die wenige Entscheidungsträger kannte und insofern zu einer gewissen Sicherheit bei der Frage führte, wie man sich als Mitarbeiter in einer solchen Organisation bewegen darf. Bei dezentralen Strukturen ist, auch unter den ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser, ein neues Zusammenspiel zwischen Ökonomie und Medizin gefordert, um wirklich „markt- und fachnah“ agieren zu können. Weitere Fragen sind: Wo genau sind die Schnittstellen? Wer steuert den interdisziplinären Prozess? Welche Koordinationsinstrumente benötigt man in einem (häufig virtuellen) Zentrum, das durch matrixartige Strukturen gekennzeichnet sein kann, die Doppelunterstellungen mit sich bringen. Bereits im klar umrissenen Rahmen der eigenen Klinik ist man vor Eingriffen des Managements nicht mehr sicher! Qualitätsmanagement, CIRS, DRG-Planung und vieles mehr greift auf die internen Ressourcen zu und respektiert die früher so festen Grenzen im Aufgaben-, Kompetenzund Verantwortungsbestand nicht mehr wirklich. Umso höher sind die Anforderungen an die Koordination in einem Zentrum. Bei den Koordinationsinstrumenten unterscheiden wir strukturelle und nichtstrukturelle Koordinationsformen. Strukturelle Formen beziehen sich auf hierarchische Weisungen (wie durch den Zentrumsvorstand), Selbstabstimmung in Gremien (z.B. in Qualitätszirkeln) sowie Koordination durch allgemeine Programme (wie Leitlinien), aber auch konkrete Pläne (z.B. die Festlegung von Budgets für das nächste Jahr). Daneben steht eine nicht-strukturelle Koordination, die sich auf persönliche Beeinflussung, Koordination durch Vertrauen und eine Koordination durch Ideen bzw. Zentrumsvisionen erstrecken kann. Sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Koordination ist für die dezentrale Führung unerlässlich. Gerade ärztliche Führungskräfte müssen befähigt werden, die ganze Palette der Koordinationsformen wahrzunehmen. Hierarchische Weisungen allein sind nicht ausreichend. Nur dann gelingt es in einer dynamischen Organisation verschiedene Leistungserbringer, verschiedenes Know-how, verschiedene Dienstleister zusammenzubringen, um letztlich das Produkt in einer hochstehenden Qualität bereitstellen zu können. Dazu ist das Zentrum als eine lernende Organisation zu begreifen. Ansonsten bleibt das verunsichernde Gefühl, gerade bei der Ärzteschaft, dass sich die Organisation nicht mehr im Gleichgewicht befindet. Doch wir erfahren durch die Diskussion um den Begriff der “Lernenden Organisation“, dass nur durch die Veränderung ein notwendiger Lernprozess initiiert werden kann, der die Organisation zu einer Weiterentwicklung führt. In diesem Umfeld also soll nun Führung wahrgenommen werden. Alle erwähnten Koordinationsinstrumente haben ihre Berechtigung. Diese reichen von Tools wie einer Balanced Scorecard bis zu Management-Informationssystemen, um die Komplexität der Organisation und ihrer Umwelt durch einen Vergleich von Kennzahlen “in den Griff“ zu bekommen. Hierbei wird dann häufig von Balance oder Ausgewogenheit gesprochen, um auch nicht-finanzielle Ergebnisse zu erfassen und zu würdigen. Neben einem Businessplan für die Beurteilung von Chancen und Risiken unter Berücksichtigung von Stärken und Schwächen steht eine klare Zielvorgabe im Rahmen eines Mitarbeitergespräches oder die Diskussion von Missständen im Rahmen einer Morgenbesprechung oder eines Workshops zur Organisationsentwicklung. Wenn wir nochmals den Blick zurück werfen, so ist es uns wichtig zu betonen, dass die Einbindung des verantwortlichen Mediziners in die dezentrale Führung von Zentren unerlässlich ist. Hier gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. So kann es sinnvoll sein, den Mediziner zum alleine verantwortlichen Manager zu machen oder ihm einen Betriebswirtschaftler zur Seite zu stellen. Und auch dabei können unterschiedliche Führungskonzepte greifen, die von einer Gleichberechtigung bis zur Unterstützung in Managementfragen reichen Welche Lösung gewählt wird, hängt von der jeweiligen Einrichtung und ihren (gelebten) Strukturen und Kulturen ab. Die konkrete Gestaltung der Führungsorganisation wird auch davon bestimmt, welche besondere Form von Zentren vorliegt. In einer Departementstruktur oder unter dem Einfluss klarer rechtlicher Rahmenbedingungen (sei es in Rechtsverordnungen oder in Verträgen mit Sozialleistungsträgern) wie z.B. in einem kooperativen Brustzentrum, wird es verbindlichere Regelungen geben als bei Zentren, die stärker als virtuelle Netzwerke innerhalb eines Großkrankenhauses oder gar zwischen mehreren Krankenhäusern angelegt sind. Zentren in der Form krankenhausübergreifender Netzwerke werden in der Klinikum Region Hannover GmbH in der Regel durch leitende Ärzte der medizinischen Einrichtungen repräsentiert. Die Außendarstellung übernimmt in der Regel ein aus der Gruppe heraus benannter Vertreter. Ein formalisiertes Verfahren zur Bestellung eines Sprechers der Gruppe ist nicht implementiert. Andere Berufsgruppen z B. MitarbeiterInnen der Funktionsbereiche nehmen durch deren Leitungskräfte an den koordinierenden Zentrumssitzungen teil, soweit Fragestellungen zu erörtern sind, die diese Berufsgruppen betreffen. Die Geschäftsstelle wird in der Regel durch einen Stabsstellenmitarbeiter aus dem Geschäftsführungsbereich Medizin geführt. Eine Abbildung in der Aufbauorganisation ist nicht vorhanden. Die Leitung verfügt weder über formale Weisungsfunktionen noch ist sie Dienstvorgesetzter der Mitarbeiter. Diese sind den Zentren personalwirtschaftlich auch gar nicht zugeordnet. In krankenhausinternen, in der Regel organbezogenen Zentren werden in der Klinikum Region Hannover GmbH traditionelle Fachabteilungen organisatorisch zusammengefasst. Ziel dieser Ausgestaltung der Aufbauorganisation ist es, die Prozessoptimierung zu stärken und die Aufgabenorganisation an die Behandlungsprozesse zu adaptieren. So wird ein Krankenhausneubau der Klinikum Region Hannover GmbH, der Modellcharakter für die zukünftige Organisationsstruktur aller Häuser des Unternehmens hat, in insgesamt vier Zentren organisiert werden. Abschließend soll nochmals der Gedanke aufgegriffen werden, dass es bislang nicht den Zentrumsansatz gibt, sondern mehrere Formen möglich sind. Im Weiteren wird deshalb der anspruchvollste Ansatz eines Kompetenz-Zentrums ausführlicher vorgestellt. 5. Kompetenz-Zentren als zukunftsweisender Ansatz von Krankenhauszentren Oben haben wir ein medizinisches Kompetenz-Zentrum dadurch ausgezeichnet, dass alle Versorgungsprozesses darauf ausgerichtet sind, den Nutzen für den Patienten bei der Behandlung eines Krankheitsbilds zu optimieren. Obwohl diese Definition auf den ersten Blick banal klingen mag, so hat sie doch verschiedene Implikationen, die in der heutigen Versorgungslandschaft nicht erfüllt sind: Krankheitsbilder, welche im Zentrum behandelt werden, müssen klar und umfassend definiert sein. Der Fokus der Behandlung liegt primär auf der Maximierung des PatientenNutzens, der über entsprechende Ergebnisparameter messbar gemacht werden muss. Zentraler Erfolgsparameter ist die Nutzen-Kosten-Relation. Die Organisationsstrukturen und Koordinationsinstrumente müssen zielführend und auf einander abgestimmt ausgerichtet sein, um die anvisierten Ergebnisse zu erreichen. Hierzu ist eine budgetäre Gesamtverantwortung notwendig. Alle diese Punkte kommen bei der momentanen Versorgung von Patienten höchstens isoliert, nicht aber in Form einer sinnvollen Gesamtkonzeption zum Tragen. Weder wird die Behandlung um Krankheitsbilder herum organisiert, noch gibt es eine institutionalisierte Nutzenmessung und dementsprechend sind auch Organisationsstrukturen und Koordinationsinstrumente häufig nicht zielführend, um einen maximalen Patienten-Nutzen zu erzielen. Im Folgenden wird gezeigt, wie der Zentrumsgedanke einen interessanten Einstieg für eine entsprechende Reorganisation bilden kann. a.) Die Definition des Geschäftsfelds: Versorgungsprodukte für Krankheitsbilder festlegen Ein Zentrum, in dem einzig und allein Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern räumlich zusammengelegt werden, wird zu keiner nennenswerten Verbesserung des Patienten-Nutzens führen. Es ist deshalb essentiell, sich im Vorfeld einer Zentrumsbildung darüber Gedanken zu machen, nach welchen Kriterien Zentren gebildet werden sollen. Für die Etablierung eines Kompetenz-Zentrums im oben beschriebenen Sinne müssen die zu versorgenden und komplexen Krankheitsbilder im Zentrum der Betrachtung stehen. In erster Linie geht es um eine Defragmentierung der Versorgung. Die bestmögliche Versorgung des Patienten über den gesamten Krankheitsverlauf ist das zentrale Ziel der Versorgung, nicht ähnliche Krankheitsbilder räumlich zusammenzuführen. Jede einzelne Aktivität innerhalb dieses Prozesses muss dazu beitragen, den Gesamtnutzen des Patienten zu maximieren. Z.B. können teure Medikamente zu Beginn einer Behandlung den Gesamtnutzen mittelfristig erhöhen, da hierdurch teure und unangenehme Folgeerkrankungen verhindert werden können. Andersherum mag es auch Aktivitäten geben, die zwar aus der Sicht der einzelnen Abteilung bzw. aus der Sicht des momentanen Zustands Nutzen stiften, aber im Sinne des Gesamt-Nutzen kontraproduktiv sind. Der Nutzen ist dabei immer aus der Perspektive des Patienten zu definieren. Die betrachteten Krankheitsbilder sollten deshalb auch alle Krankheitsausprägungen und evtl. Komplikationen mit beinhalten. Sie bestimmen die im Zentrum vorzuhaltenden Behandlungsoptionen. Bei Kompetenz-Zentren handelt es sich somit um Integrierte Versorgungseinrichtungen, in denen Krankheitsbilder über den gesamten Krankheitsverlauf – der betriebswirtschaftlich gesehen die vollständige Wertschöpfungskette bildet – komplett versorgt werden können. Auch der Vergleich (und damit Wettbewerb zwischen verschiedenen Zentren) ist nur auf Grundlage messbarer Indikatoren zum Gesamtnutzen möglich, die zu Grunde liegende individuelle Behandlungsstrategie mag dabei durchaus zwischen den Zentren abweichen. In einer noch weiteren Fassung sollten Kompetenz-Zentren gerade im Bereich chronischer Erkrankungen nicht nur das akute Disease Management, sondern auch für die Prävention von vorab definierten Populationen (z.B. AOK-Patienten in München) Verantwortung übernehmen. Schon anhand der Inzidenz von z.B. Kolorektalkarzinomen von AOK-Patienten in München verglichen mit einer anderen Stadt oder Nicht-AOK Patienten lässt sich dann eine Aussage über die Effektivität des Versorgungs-Zentrums fällen. Durch die heutige Organisation der Versorgung sind Ergebnisse praktisch unmöglich auf die Güte der Behandlung einer verantwortlichen Institution zurückzuführen, weil Ergebnisse im Gesundheitswesen eben nicht partiell behandelnden Institutionen, Fachbereichen, Kliniken oder Akteuren eindeutig zuzuschreiben sind. Die Voraussetzung für eine sinnvolle Zentrumsbildung ist somit eine Geschäftsfelddefinition sowie die Bestimmung von "Behandlungsprodukten" für dieses Geschäftsfeld. Das deutsche Gesundheitswesen ist nach wie vor sehr funktional gegliedert, in Fachärzte und Fachbereiche: z.B. Innere Medizin, Urologie, Chirurgie, etc. Diese Geschäftsfelddefinitionist für eine nachweislich werthaltige Versorgung nicht sinnvoll. Sie ist entweder arztzentriert, institutionenzentriert oder prozedurenzentriert, nicht aber patientenzentriert. Ein relevantes Geschäftsfeld kann z.B. die Versorgung der kongestiven Herzerkrankung oder der Herzinsuffizienz sein, nicht aber die Herzchirurgie, Kardiologie, Angiographie und Anästhesie. Dabei ist es nicht notwendig, dass in einem Zentrum alle Krankheitsbilder z.B. der Orthopädie behandelt werden. Bei einem Kompetenz-Zentrum-Ansatz ist die Maxime, bestimmte Krankheiten als Schwerpunktzentrum zu behandeln, für andere Krankheiten jedoch nicht als Schwerpunkt zu dienen, sondern nur eine Grundversorgung sicherzustellen oder auch bestimmte Versorgungen gar nicht vorzuhalten. Sich auf seine Kernkompetenzen zu beschränken, ist nicht nur ein Credo für die Industrie, sondern gilt ebenso im Gesundheitswesen. Es ist dann eine strategische Entscheidung, mit welchen Krankheitsbilder man sich als Zentrum profilieren will. Diese Entscheidung wird sicherlich von einem Universitätsklinikum anders getroffen als von einem kommunalen Krankenhaus und von einem Krankenhaus der Maximalversorgung anders als von einem Krankenhaus der Grundund Regelversorgung. Auch in den USA zeigt sich diese Entwicklung. So sind z.B. das Memorial SloanKettering Cancer Center in New York und das M.D. Andreson Cancer Center in Houston unter den am Besten „gerateten“ Institutionen im Bereich der Versorgung von Patienten mit spezifischen Krebserkrankungen. Fairview-University Children´s Hospital in Minnesota ist wiederum bekannt für die Behandlung der zystischen Fibrose [vgl. Porter, S. 160]. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, Zentrenbildung hat primär weniger etwas mit Quantität zu tun, sondern mit einer Spezialisierung auf die Gesamtversorgung komplexer und länger andauernder Krankheitsverläufe. Erzielt man bei der Behandlung dieser Patienten bessere messbare Ergebnisse als die relevanten Mitwettbewerber und werden diese Ergebnisse aktiv von unabhängigen Organisationen kommuniziert und verglichen, so wird sich eine Zunahme von Behandlungsfällen ganz von selber einstellen. Diesen Kreislauf zeigt die folgende Abbildung [in Anlehnung an Porter, S 161]. Zunahme an Patienten durch überörtlich hohen Bekanntheitsgrad Spezialisierung auf Krankheitsbilder, höheres Know-How Disease Management über den gesamten Behandlungsprozess Bessere Resultate Schnellere Innovationen Höheres Volumen für die Verrechnung von Gemeinkosten, wie IT, Dokumentation, QM, Prozessmanagement, etc. Kreislauf eines Circulus Virtuosus Kompetenz-Zentrums Weitere Möglichkeiten der Subspezialisierung Höhere Effektivität und höhere Effizienz Bessere Daten über den gesamten Behandlungsprozess Motivierteres Team, Auf Behandlungsprozesse zugeschnittene Infrastruktur b.) Die erzielte Nutzen-Kosten-Relation muss der zentrale Erfolgsparameter eines Kompetenz-Zentrums sein Wenn man für jedes Kompetenz-Zentrum eine Strategie entwickelt hat, die sich auf die Geschäftsfelder richtet, für die man sich als Kompetenz-Zentrum überregional eine Reputation verschaffen möchte, dann muss im Folgenden festgelegt werden, was der Patientennutzen konkret ist, wie er gemessen und kontinuierlich verbessert werden kann. Einer der wichtigsten Aufgaben für Zentren ist daher zum einen die Qualitätsmessung und zum anderen Rückschlüsse zu finden, über deren Einflussfaktoren. Als wichtigste Parameter werden die relevanten Informationen über Ergebnisse zu der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder und als Resultat des gesamten Krankheitsverlaufs benötigt. Diese Ergebnisse stellen (risikoadjustierte) Patienten-Outcomes dar, welche dann in Relation zu den verursachten Kosten gesetzt werden. Auf diese Weise lassen sich Nutzen-Kosten-Relationen erstellen, die auch der Entscheidungsfindung dienen, ob finanzielle Ressourcen durch einen alternativen Einsatz u.U. einen noch höheren Nutzen für den Patienten hätten stiften können. Die Bestimmung und Messung der Ergebnisparameter gehört zu den komplexesten Unterfangen überhaupt. Da sich in den gewählten Indikatoren niederschlägt, was als Erfolg definiert wird, kommt der Festlegung von Erfolgsindikatoren höchste strategische Relevanz zu. Ergebnisse sind immer multidimensional. Für ein Benchmark müssen bestimmte Indikatoren von externen Institutionen vorgegeben sein, andere könnten frei gewählt hinzukommen. Dabei können diese Indikatoren einen Mix aus medizinischen Ergebnisindikatoren, subjektiven Erfolgsindikatoren (empfundene Lebensqualität) und Prozessindikatoren (Zeitdauer von der Erstdiagnose bis zur Genesung) sein. Die Messung des Ergebnisses ist wichtig, aber die Frage nach den Kosten je Ergebniseinheit setzt das Ergebnis erst in Relation zum Aufwand. Kosten werden zur Kalkulation des Preises einer Leistung benötigt. Wenn Preise fix sind, ist die Ergebnisinformation der einzig wichtige Benchmark-Parameter. Wenn Preise aber zunehmend auch in Deutschland einzelvertraglich frei gestalt- und verhandelbar sind, dann sollten Preisen auch Leistungsbündel für die Behandlung einer Krankheit bzw. einer Krankheitsepisode zugeordnet werden. Der relevante Preis für die Behandlung ist dann wiederum der entsprechende Gesamtpreis einer Behandlung, genauso wie das relevante Ergebnis das Gesamtergebnis einer Behandlung über alle Sektoren und Leistungsbereiche hinweg darstellt. Es ist nicht der Preis für einen Besuch beim niedergelassenen Arzt oder einen stationären Aufenthalt relevant, auch nicht der Preis für eine Intervention, eine Behandlung oder eine diagnostische Maßnahmen. Wichtig ist einzig und allein der Gesamtpreis einer Behandlung bzw. kostenrechnerisch gesehen die zu Grunde liegenden Gesamtkosten einer Behandlung. Zur Zeit werden in Deutschland viele einzelne Informationen über Interventionen gesammelt, wie z.B. OPS-Codes sowie Qualitätskriterien einzelner Interventionen (Komplikationsraten, Dekubitusraten, etc.). Für die Frage nach einer erfolgreichen Behandlung wäre es wichtig zu evaluieren, welches Ergebnis Leistungserbringer mit den definierten, zugrunde gelegten und evtl. modifizierten Standards bei Patienten mit bestimmten Attributen über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg erzielt haben. Diese Information wäre die einzig wirklich relevante Information für den Patienten (und die Krankenkasse), sich ein Kompetenz-Zentrum für die Behandlung auszusuchen. Einzelaspekte, wie Leitlinienkonformität, Patienten-Compliance, Wiedereinweisungsrate, Aufenthaltsdauern sind wichtige und interessante Indikatoren, die Ansatzpunkte für Verbesserungspotentiale darstellen können, am Ende zählt aber nur das Gesamtresultat. Hierfür sind unabhängige Non-ProfitInstitutionen notwendig, die die Resultate aufbereiten und kommunizieren. In den USA übernimmt eine solche Aufgabe z.B. „The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations“ (JCAHO) oder das National Quality Forum (NQF). c.) Reorganisation der Organisationsstrukturen und Koordinationsinstrumente durch Budgetverantwortung Anpassung der Wir hatten bereits an anderer Stelle auf die Bedeutung von Matrixstrukturen in Zentren hingewiesen und auf Case-Manager, die Prozessverantwortung übernehmen. In gleicher Weise ist die vertikale Integration von vor- und nachgelagerten Prozessen zu berücksichtigen. Momentan laufen vielfältige Bestrebungen von Krankenhäusern, diese Leistungen selbst in Form von Medizinischen Versorgungszentren oder 116bAmbulanzen anzubieten. Dies mag für einige Krankheitsbilder eine gute Option sein. Dennoch liegen die Kernkompetenzen eines Krankenhauses immer im stationären Bereich. Die Integration des ambulanten Sektors kann auch kooperativ mit ambulanten Leistungserbringern erfolgen. Wichtig ist, dass die Leistungserbringergemeinschaft bzw. eine von dieser Gemeinschaft gegründete Managementgesellschaft für den Gesamterfolg finanzielle und medizinische Ergebnisverantwortung übernimmt. Hierzu muss von den Beteiligten die gesamte Palette der bereits erwähnten betriebswirtschaftlichen Koordinationsinstrumente akzeptiert werden können. Solche integrierten Versorgungssysteme (Integrated Delivery Systems) sind in Deutschland nur in Form einer Integrierten Versorgung nach § 140 a ff. SGB V umsetzbar. Innerhalb der Integrierten Versorgung ist es auch möglich, den oben dargestellten ganzheitlichen Ansatz zur Ergebnisbeurteilung zu implementieren. Datenschutzrechtlich ist es nur im Rahmen der Integrierten Versorgung möglich, Verlaufsdaten eines Patienten aus allen Sektoren zu verbinden und patientenbezogen auszuwerten. Die Kostendaten sind ebenfalls nur von den Krankenkassen erhältlich, sodass auch hier einzelvertragliche Strukturen notwendig sind, um Nutzen-KostenRelationen darstellen zu können. Auch Preise sind im deutschen Gesundheitswesen in der Regelversorgung fix vorgegeben. Die Verhandlung von Preisen, bei denen ein Leistungserbringer oder verschiedene Leistungserbringer zusammen die Budgetverantwortung für die Behandlung eines Patienten mit einem bestimmten Krankheitsbild übernehmen, ist im Rahmen der Integrierten Versorgung aber ebenfalls möglich. Die Integrierte Versorgung bildet somit eine gute Grundlage für die Umsetzung des KompetenzZentrum-Konzepts in Deutschland. Literatur: Porter / Teisberg: Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results, Boston 2006.