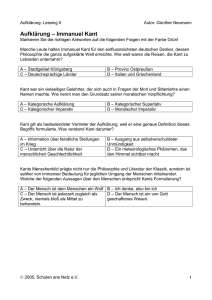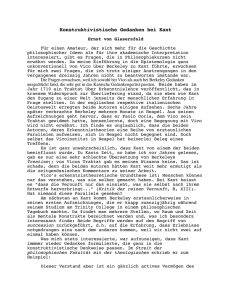Gratis Leseprobe zum
Werbung

Kant-Forschungen 20 KANT-FORSCHUNGEN Begründet von Reinhard Brandt und Werner Stark Band 20 FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Mario Brandhorst / Andree Hahmann / Bernd Ludwig (Hg.) Sind wir Bürger zweier Welten? Freiheit und moralische Verantwortung im transzendentalen Idealismus FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. ISBN 978-3-7873-2280-0 ISBN E-Book: 978-3-7873-2285-5 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Lichtenberg-Kollegs der Georg-August-Universität Göttingen. www.meiner.de © Felix Meiner Verlag GmbH 2012. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. Satz: Type & Buch Kusel, Hamburg. Druck und Bindung: book factory, Bad Münder. Werkduckpapier: alterungsbeständig nach ANSI-Norm resp. DIN-ISO 9706, hergestellt aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Printed in Germany. Inhalt Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dietmar H. Heidemann Über Kants These: »Denn, sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Jochen Bojanowski Ist Kant ein Kompatibilist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tobias Rosefeldt Kants Kompatibilismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Dieter Schönecker Kants Grundlegung über den bösen Willen. Eine kommentarische Interpretation von GMS III, 457.25–458.5 . . . . . 111 Andree Hahmann Ist »Freiheit die Wahrheit der Notwendigkeit«? Das Ding an sich als Grund der Erscheinung bei Kant . . . . . . . . . . 135 Bernd Ludwig Was weiß ich vom Ich? Kants Lehre vom Faktum der reinen praktischen Vernunft, seine Neufassung der Paralogismen und die verborgenen Fortschritte der Kritischen Metaphysik im Jahre 1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Heiner F. Klemme Spontaneität und Selbsterkenntnis Kant über die ursprüngliche Einheit von Natur und Freiheit im Aktus des ›Ich denke‹ (1785–1787) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Geert Keil Kann man nichtzeitliche Verursachung verstehen? Kausalitätstheoretische Anmerkungen zu Kants Freiheitsantinomie . . . 223 6 Inhalt Kenneth R. Westphal Die positive Verteidigung Kants der Urteils- und Handlungsfreiheit, und zwar ohne transzendentalen Idealismus . . . . . . . . . . . . . . 259 Mario Brandhorst Woran scheitert Kants Theorie der Freiheit? . . . . . . . . . . . . . . . 279 Reinhard Brandt »Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive)« – wie das? . . . . . . . . . 311 Susanne Brauer Alternative zu Kant? Freiheit nach Hegel in den Grundlinien zur Philosophie des Rechts . . . 361 Zu den Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Stellenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Einleitung Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Keinem Leser der kritischen Philosophie Kants bleibt verborgen, dass Freiheit und Moral in ihrem Zentrum stehen. In einer Notiz der frühen 90er Jahre schreibt Kant: »Ursprung der critischen Philosophie ist Moral, in Ansehung der Zurechnungsfähigkeit der Handlungen« (XX, 335). – In diesem Satz kommen zwei zentrale Themen zusammen: Freiheit und Moral, die zusammen die Zurechnung des Handelns möglich machen. Sowohl die Annahme des freien Wollens und Handelns als auch die Annahme, dass es moralische Verbindlichkeit gibt, müssen gerechtfertigt sein, wenn jemand für das, was er tut, moralisch verantwortlich sein soll. Kant war außerdem der Meinung, dass nur eine absolute, erstursächliche Freiheit und nur ein kategorisches Moralgesetz dafür genügen. Diese Position wird bis heute von vielen geteilt; sie wird ebenfalls von vielen angegriffen. Das Problem, auf das Kant reagiert, ist damit für uns so aktuell wie es für Kant selbst war. Die Frage, welche Art von Freiheit und welche Art von Moral Bedingungen der moralischen Zurechnung sind, bleibt weiter umstritten. Es ist auch keine Einigkeit in Bezug darauf in Sicht, ob wir über die erforderliche Freiheit verfügen und ob die Moral die geforderte Geltung besitzt. Dementsprechend ist auch kontrovers, ob wir für unser Wollen und Handeln moralisch verantwortlich sind. Und wenn wir es sind, bleibt zu klären, warum wir es sind und wie weit diese Verantwortung reicht. Die Wichtigkeit der Frage steht außer Zweifel: Freiheit, Moral und Verantwortlichkeit sind für uns nicht gleichgültig. Sie geben keine bloßen begrifflichen Rätsel auf, die uns zwar reizen, aber nicht weiter betreffen; sie gehören zu unserem Selbstverständnis und zum Fundament jeder Beziehung zu anderen Menschen. Die Frage ist außerdem weitläufig, unübersichtlich und schwierig; sie fordert die Philosophie in besonderer Weise heraus. Einerseits fällt es uns schwer, der Frage und den Antworten auf sie gerecht zu werden; andererseits können wir der Frage nicht ausweichen: Wenn sie einmal gestellt ist, verlangt sie nach einer Antwort. Dass Kant ebenso empfand, als er in ganz neuer, radikaler Weise auf die Herausforderung reagierte, zeigt seine Rede vom »Ursprung der critischen Philosophie«. Kants Konstruktion hat bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Dieser Band ist daher seiner Theorie der Freiheit und moralischen Zurechenbarkeit gewidmet. Im ersten Teil der Einleitung geben wir einen Überblick der zentralen Fragen und Themen. Im zweiten Teil folgen kurze Zusammenfassungen der einzelnen Beiträge. Dem folgt ein Hinweis auf die Zitierweise der verwendeten Texte. 8 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig 1. Kants Theorie der Freiheit: eine Problemübersicht Kant meint schon 1781, mit der Kritik der reinen Vernunft die Frage der Freiheit so weit gelöst zu haben, wie es für menschliche Einsicht nur möglich und für moralisches Handeln erforderlich ist. Dabei geht es ihm vor allem um den Nachweis der Vereinbarkeit: Kant will zeigen, dass Freiheit und Determiniertheit des Handelns einander nicht notwendig widersprechen, sondern grundsätzlich miteinander vereinbar sind. Kants Begründung dieser These lautet, dass wir uns selbst einmal als ›Ding an sich‹ und einmal als ›Erscheinung‹ beschreiben können. Das ist zugleich der Grundgedanke der Lehre, die Kant als transzendentalen Idealismus bezeichnet und in der ersten Kritik entfaltet. Mit dieser Lehre soll verständlich werden, wie »Freiheit und Natur« menschliches Handeln »zugleich und ohne allen Widerstreit« (A 541 / B 569) bestimmen können. Damit setzt sich Kant ausdrücklich von der Tradition ab, die behauptet, Freiheit sei nichts weiter als eine besondere Art der Determiniertheit und deshalb auch ohne Umschweife mit der These des Determinismus vereinbar – wenn sie diese nicht sogar voraussetzt. Aber Kant setzt sich zugleich von der Tradition ab, die den Determinismus für das menschliche Handeln abstreitet, einschränkt oder relativiert. Kant zufolge sind alle Ereignisse in der Erscheinungswelt Wirkungen. Sie haben Ursachen in der vorherigen Zeit, und das gilt auch für menschliches Denken und Handeln. Anders als viele Verteidiger menschlicher Freiheit gibt Kant den Gedanken der Naturnotwendigkeit menschlichen Handelns also nicht preis. Zugleich hält er an einem Verständnis von Freiheit, von Moral und von moralischer Zurechnung fest, demzufolge Freiheit »absolute Selbstthätigkeit« (A 418 / B 446) ist und deshalb nicht bloßer Teil des Naturnotwendigen sein kann. Weil es der ersten Kritik zufolge eine solche »Selbstthätigkeit« in der Natur nicht nur nicht gibt, sondern auch nicht geben kann, ist die Freiheit, die Moral und Zurechnung des Handelns sichert, keine Freiheit, die sich einfach in die Ordnung der Natur einfügen ließe. Wie Kant zu zeigen versucht, ist eine solche Freiheit dennoch möglich, weil sie dem Determinismus der Natur nicht widerspricht. Die Begründung dafür lautet, dass wir uns als ›Ding an sich‹ betrachten können und uns als ein ›Ding an sich‹ als frei ansehen dürfen. Wenn wir uns als ›Ding an sich‹ betrachten, abstrahieren wir von Raum und Zeit als »reinen Formen der Sinnlichkeit« (A 89 / B 121) – und damit auch von dem Naturgesetz der zeitlichen Abfolge. Zwar können wir von uns als Ding an sich und damit von der Freiheit nichts erkennen; aber wir sind sicher, dass sie nicht unmöglich ist. So »behauptet die Lehre der Sittlichkeit ihren Platz, und die Naturlehre auch den ihrigen, welches aber nicht Statt gefunden hätte, wenn nicht Kritik uns zuvor von unserer unvermeidlichen Unwissenheit in Ansehung der Dinge an sich belehrt, und alles, was wir theoretisch erkennen können, auf bloße Erscheinungen eingeschränkt hätte« (B XXIX). Wie schon diese knappe Skizze zeigt, ist Kants Unterscheidung zwischen dem, was Gegenstand der Erfahrung sein kann und dem, was sich grundsätzlich dem Einleitung 9 Bereich des Erfahrbaren entzieht, nicht nur für die »critische Philosophie« im Allgemeinen, sondern für Kants Theorie der Freiheit, Moral und Verantwortlichkeit im Besonderen von zentraler Bedeutung. In ihrem Mittelpunkt steht die Unterscheidung von ›Ding an sich‹ und ›Erscheinung‹, die ihrerseits der Erklärung bedarf. Mit ihr verbunden ist die Unterscheidung von zwei verschiedenen ›Welten‹ oder ›Standpunkten‹, von denen aus unser Denken, Wollen und Handeln beschrieben und bewertet werden kann. – Wie ist diese Unterscheidung zu verstehen? Wie ermöglicht sie Freiheit? Und wie kann durch sie die Vereinbarkeit von »Freiheit und Natur« aufgewiesen werden? 1.1 Die Frage der Vereinbarkeit Sehen wir für den Moment von Kants Lehre ab, so kann man auf Fragen der Freiheit und moralischen Zurechnung auf mindestens zwei verschiedene Weisen reagieren. Die erste Reaktion besteht darin, die Aussage ›Wir sind frei‹ so zu fassen, dass sie mit der These des Determinismus nicht in Konflikt gerät. Das ist die Vereinbarkeitsthese oder der Kompatibilismus. Die zweite Reaktion besteht darin, die Aussage ›Wir sind frei‹ so zu fassen, dass sie die Falschheit der These des Determinismus einschließt oder voraussetzt. Das ist die Unvereinbarkeitsthese oder der Inkompatibilismus. Die These des Determinismus besagt dabei grob gesprochen, dass jeder Zustand der Welt durch (1) den Weltzustand in der vorherigen Zeit und (2) die Naturgesetze vollständig bestimmt wird. Statt von ›Determinismus‹ können wir deshalb auch von ›Naturnotwendigkeit‹ sprechen: Wenn die These des Determinismus wahr ist, gibt es zu jedem Zeitpunkt nur eine naturgesetzlich mögliche Zukunft.1 Aus dieser Auffassung ergibt sich ein ernstes Problem, das sich nun geradezu aufdrängt: Wie ist unter Voraussetzung der deterministischen These freies und verantwortliches Handeln möglich? Anhänger der Vereinbarkeitsthese argumentieren in der Regel wie folgt: Die Freiheit, auf die es für verantwortliches Handeln ankommt, setzt nicht voraus, dass freies Wollen und Handeln sich grundsätzlich jeder Bestimmung durch die vorherigen Weltzustände und Naturgesetze entzieht. Freiheit setzt vielmehr voraus, dass unser Wollen und Handeln in der richtigen Weise von den gegebenen Absichten, Wünschen, Meinungen und Überlegungsabläufen bestimmt wird. Es geht demzufolge nicht darum, jede Erklärung des Wollens und Handelns auszuschließen, sondern Erklärungen von Fall zu Fall zu unterschei1 Vgl. van Inwagen 1983, 2–8 u. 65. Kant spricht in diesem Zusammenhang von »Prädeterminism«, den er vom »Determinismus« unterscheidet. »Prädeterminism« ist dabei die These, dass »willkürliche Handlungen als Begebenheiten ihre bestimmende Gründe in der vorhergehenden Zeit haben« (VI, 49; vgl. XXVII, 502–504); »Determinismus« dagegen ist die ganz anders gelagerte These, der zufolge die »Willkür durch innere hinreichende Gründe« bestimmt ist (ebd.), was Kants Auffassung nach ebenfalls zutrifft. Kants »Prädeterminism« entspricht also recht genau der Bedeutung des heutigen ›Determinismus‹. 10 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig den. Zwang, Verwirrung, Täuschung, Sucht, Krankheit und manche Formen der Manipulation sind klare Beispiele dafür, wie Freiheit und moralische Zurechnung eingeschränkt oder ganz aufgehoben sein können. Eine Bestimmung des Handelns durch Nachdenken, eigene Wünsche und Gründe dagegen ist frei.2 Das genügt Vertretern der Unvereinbarkeitsthese nicht. Sie leugnen nicht die Freiheit, auf die es Vertretern der Vereinbarkeitsthese ankommt; sie leugnen auch nicht die Unterscheidungen, die mit dem Begriffsinventar der Vereinbarkeitsthese zu treffen sind. Sie bestreiten aber, dass diese Freiheit schon ausreicht, um Freiheit und insbesondere moralische Zurechnung in vollem Umfang beschreiben und rechtfertigen zu können. Die Freiheit, auf die es ankommt, setzt ihrer Meinung nach mehr voraus als nur die Freiheit von dieser und jener Art der Bestimmung. Freiheit in einem moralisch belastbaren Sinn setzt für sie wirkliche Selbstbestimmung, echte Handlungsalternativen und offene Zukunftsverläufe voraus. Dabei haben sie zwei mächtige Intuitionen auf ihrer Seite: die, dass wir unser Handeln nur dann als frei beschreiben und uns selbst zurechnen können, wenn wir selbst es sind, die handeln, womit die Erklärung dieser Handlung endet; und die, dass wir anders handeln können, als wir wirklich handeln und auch das eine Voraussetzung für Freiheit und Verantwortung ist. Mit dieser Art von Forderung legen sich Anhänger der Unvereinbarkeitsthese noch nicht auf die Wirklichkeit der Freiheit fest. Sie legen sich nicht einmal auf deren Möglichkeit fest, wie der Spielraum für radikal skeptische Auffassungen zeigt. Man kann schon als ›harter Determinist‹ bestreiten, dass Freiheit und moralische Zurechnung mit dem Determinismus vereinbar sind, aber zugleich den Determinismus behaupten; wenn beides zutrifft, folgt, dass wir weder frei noch moralisch verantwortlich sind. Man kann aber auch ein »echter moralischer Skeptiker« sein und bestreiten, dass Freiheit und moralische Zurechnung überhaupt klar verständlich gemacht werden können; und man kann das durch den Hinweis ergänzen, dass auch gar nicht einzusehen ist, wie Indeterminiertheit weiterhelfen würde.3 Dementsprechend bleibt bisher noch offen, ob unser Wollen und Handeln frei und der moralischen Zurechnung fähig ist oder nicht. Vertreter der Unvereinbarkeitsthese behaupten ein Konditional: Wenn die These des Determinismus wahr ist, 2 So schreibt etwa Peter Bieri: »Der Unterschied zwischen der Freiheit und der Unfreiheit von Tun und Wollen ist nach dieser Geschichte ein Unterschied in der Art und Weise des Bedingtseins« (Bieri 2001, 166). Der freie Wille wird von ihm entsprechend als ein Wille beschrieben, »der sich unter dem Einfluß von Gründen, also durch Überlegen bildet« (ebd.). 3 Es gibt dementsprechend erstens die Position, dass Freiheit und moralische Zurechnung nicht mit der Wahrheit des Determinismus vereinbar sind und wir tatsächlich weder frei noch moralisch zurechenbar handeln; siehe dazu Pereboom 2001. Hier wird die Möglichkeit von Freiheit und moralischer Zurechnung nicht bestritten. Es gibt zweitens die radikal skeptische Position, dass Freiheit und moralische Zurechnung völlig unmöglich sind, ganz gleich, ob die These des Determinismus nun wahr ist oder falsch; siehe dazu G. Strawson 2010. Den Ausdruck »radikale moralische Skepsis« für diese Haltung prägt P. F. Strawson 1962, 187. Einleitung 11 dann gibt es weder moralisch belastbare Freiheit noch Zurechnung unseres Wollens und Handelns. Also gilt: Wenn es moralisch belastbare Freiheit und Zurechnung gibt, dann muss die These des Determinismus falsch sein. Und nun wird es zur alles entscheidenden Frage, ob es diese Freiheit gibt, oder ob sie eine Illusion ist.4 1.2 Kants Strategie Kants Theorie der Freiheit ist schon deshalb interessant, weil sie nicht ohne Weiteres in dieses traditionelle Raster von Theorien passt. Mithilfe seiner Unterscheidung zwischen ›Ding an sich‹ und ›Erscheinung‹ behauptet Kant im Ergebnis die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit. Tatsächlich geht er noch weiter, indem er behauptet, dass wir uns zugleich als determiniert und als frei ansehen müssen. Zugleich hält er an einem sehr anspruchsvollen Verständnis von Freiheit fest. Das wirft die Frage auf, ob Kant Kompatibilist, Inkompatibilist, oder aber beides oder keines von beiden ist. Kant behauptet die These des Determinismus mit großem Nachdruck. Ihm zufolge sind »alle Handlungen des Menschen in der Erscheinung aus seinem empirischen Charakter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach der Ordnung der Natur bestimmt; und wenn wir alle Erscheinungen seiner Willkür bis auf den Grund erforschen könnten, so würde es keine einzige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewißheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden Bedingungen als nothwendig erkennen könnten.« (A 549 f. / B 577 f.) Nur sieht Kant darin kein Hindernis der Freiheit: Der Mensch kann zugleich völlig determiniert und doch frei sein. Das betont Kant in einer Passage aus der Kritik der praktischen Vernunft, die das Problem wieder aufgreift: »Man kann also einräumen, daß, wenn es für uns möglich wäre, in eines Menschen Denkungsart, so wie sie sich durch innere sowohl als äußere Handlungen zeigt, so tiefe Einsicht zu haben, daß jede, auch die mindeste Triebfeder dazu uns bekannt würde, imgleichen alle auf diese wirkende äußere Veranlassungen, man eines Menschen Verhalten auf die Zukunft mit Gewißheit, so wie eine Mond- oder Sonnenfinsterniß ausrechnen könnte und dennoch dabei behaupten, daß der Mensch frei sei.« (V, 99) Wenn Kant behauptet, dass wir zugleich determiniert und frei sein können, setzt er offenbar voraus, dass Freiheit und Determinismus einander nicht notwendig widersprechen. Vielmehr sind sie vereinbar, und Kant will zeigen, warum sie es sind. 4 Wer (1) die These des Inkompatibilismus für wahr und (2) die Freiheit für wirklich hält, wird heute üblicherweise als ›Libertarianer‹ bezeichnet; vgl. zu dieser Debatte Kane 2002. 12 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Das spricht auf den ersten Blick dafür, Kant als Kompatibilisten zu bezeichnen: Im Ergebnis hält Kant Freiheit und Determinismus für vereinbar. Auf den zweiten Blick jedoch wird diese Zuordnung zweifelhaft. Erstens schränkt Kant die These des Determinismus ausdrücklich auf die »Handlungen des Menschen in der Erscheinung« ein (A 549 / B 577; vgl. A 545 / B 573) und weist der Freiheit so einen ganz anderen Ursprung zu, als die Handlungen des Menschen in der Erscheinungswelt haben. Dieser Ursprung liegt »im Intelligibelen« (A 552 / B 580), dem wir als Dinge an sich durch Vernunft und Sittengesetz angehören. Kant zufolge gilt die These des Determinismus dort nicht, und das ist geradezu die Pointe seiner Freiheitstheorie. Würde die These dort gelten, dann gäbe es nach Kant überhaupt keine moralisch belastbare Freiheit und Zurechnung, und sein Vereinbarkeitsvorhaben wäre gescheitert. Zweitens – und damit zusammenhängend – baut Kant durchweg auf einen Freiheitsbegriff, der jede äußere Ursache ausschließt: Freiheit ist das »Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen« (A 533 / B 561) – nicht mehr und nicht weniger. Das schließt jede Verursachung durch Fremdes aus. Drittens lehnt Kant den Verweis auf den »comparativen«, das heißt lediglich auf die jeweilige »Art der Bestimmungsgründe« bezogenen, Freiheitsbegriff als unzureichend für Zurechnung ab (V, 96). Das ist aber eben der Freiheitsbegriff, auf den die kompatibilistische Tradition sich stützt. Kant dagegen meint, ein solcher Begriff von Freiheit sei eine »Ausflucht« und ein »elender Behelf«: Wenn solche Freiheit nicht »transscendentale, d. i. absolute, zugleich« wäre, »würde sie im Grunde nichts besser, als die Freiheit eines Bratenwenders sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet« (V, 97). Das scheint nun eher dafür zu sprechen, Kant als Inkompatibilisten zu bezeichnen. Eine erste Frage ist also, ob Kant sich überhaupt einem der zwei Lager zuordnen lässt. Eine weitere Frage ist: Welchem, und mit welcher Begründung? Hinter diesen Fragen steht die weitere, wie Kants Theorie gedeutet werden sollte. Kant behauptet im Ergebnis die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit. Aber wie wird sie erklärt und begründet? 1.3 Transzendentaler Idealismus Offenbar will Kant die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit des Wollens und Handelns durch die Lehre des transzendentalen Idealismus begründen. Frei sind wir demzufolge, weil wir uns nicht nur als Erscheinung, sondern auch als Ding an sich denken können und müssen, als Ding an sich aber keiner zeitlichen Ordnung und damit auch keinem Naturgesetz zeitlicher Abfolge unterliegen. Als Erscheinung ist unser Handeln dagegen ein Teil der Natur und als solcher auch naturnotwendig. Die These des Determinismus bleibt somit auf die Erscheinung beschränkt. Das ermöglicht Freiheit und Naturnotwendigkeit derselben Handlung, einmal als Ding an sich, einmal als Erscheinung betrachtet. Einleitung 13 Wie ist aber diese Unterscheidung zwischen ›Erscheinung‹ und ›Ding an sich‹ ihrerseits zu verstehen? Seit mehr als 200 Jahren wird diese Frage sehr kontrovers diskutiert. Mit der Unterscheidung zwischen ›Erscheinung‹ und ›Ding an sich‹, ›Sinnenwelt‹ und ›Verstandeswelt‹, ›Phaenomenon‹ und ›Noumenon‹ steht und fällt Kants »critische Philosophie«, und deren Schicksal ist nicht nur für Fragen der Freiheit bedeutsam. Eine einflussreiche Tradition meint eine bestechend einfache Antwort auf diese Frage gefunden zu haben. Man geht zunächst davon aus, dass es sich bei der Rede vom ›Ding an sich‹ um eine Kurzform der Rede vom ›Ding an sich selbst betrachtet‹ handelt.5 Ein Gegenstand als Ding an sich ist demzufolge derselbe Gegenstand wie dieser Gegenstand in der Erscheinung, nur ohne die Formen der sinnlichen Anschauung – Raum und Zeit – betrachtet. Es gibt also nicht zwei Arten von Dingen: erstens Erscheinungen, zweitens Dinge an sich. Es gibt vielmehr nur eine Art von Dingen, aber zwei Aspekte, unter denen wir diese Dinge betrachten können: einmal bezogen auf unser Erkenntnisvermögen, einmal unabhängig davon. Die entsprechende Lesart wird traditionell als ›Eine-Welt-‹ oder ›Zwei-Aspekte-Theorie‹ bezeichet. Diese in der neueren Zeit von Gerold Prauss und Henry Allison geprägte Lesart ist allerdings in den vergangenen Jahren verstärkt in die Kritik geraten. Einerseits steht sie im klaren Widerspruch zu zahlreichen Formulierungen Kants; andererseits scheint sie zumindest in Allisons Lesart nicht annähernd das leisten zu können, was Kant sich von der Unterscheidung verspricht.6 Das wird nicht zuletzt bei Fragen der Freiheit, Moral und Zurechnung deutlich: Wie kann das Subjekt der Ursache »außer der Reihe« (A 552 / B 580), dessen Tun Wirkungen in der Erscheinung hat, mit dem erscheinenden Subjekt der Wirkung identisch sein? Umgekehrt: Wie kann das Subjekt des Handelns in Raum und Zeit, das erscheint, mehr als eine Vorstellung und damit kein Ding an sich sein, wenn Kant Erscheinungen durchweg als »bloße Vorstellungen« deutet (z. B. A 491 f. / B 519 f., A 537 / B 565 u. ö.)? Auch Allisons Neufassung seiner Verteidigung des transzendentalen Idealismus konnte nicht alle Bedenken ausräumen, sodass die Debatte unentschieden bleibt.7 Was wäre die Alternative? Einerseits kann man an einer ›Zwei-Aspekte-Theorie‹ festhalten, sie aber eher ontologisch als methodologisch wenden.8 Dann wird man Vgl. Prauss 1974, 42 f. Siehe Van Cleve 1999. Passagen, die sich nur schwer mit der Lesart in Einklang bringen lassen, sind zum Beispiel die folgenden: A 494 / B 522; A 544 / B 572; A 358; A 359; A 393; Prolegomena, IV, 289; 315; 344–347, 354; Grundlegung, IV, 459. 7 Allison 2004; die erste Auflage erschien 1983. In Allison 1990 wendet er die Lesart auf die Freiheitsproblematik an. 8 Vgl. dazu Rosefeldt 2007, der selbst eine Variante der ontologischen Lesart der ZweiAspekte-Theorie vertritt. Die methodologische Lesart, die Rosefeldt unter anderem Prauss und Allison zuschreibt, versteht die zwei Aspekte nicht so sehr als einen Unterschied auf Seiten der Objekte, sondern als einen Unterschied in der Weise, diese zu betrachten. Vertre5 6 14 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig dem kantischen Text zwar eher gerecht, hat aber noch immer die Aufgabe zu erklären, wie das Subjekt der Ursache »außer der Reihe« mit dem Subjekt der Wirkung, das Teil der Reihe in Raum und Zeit ist und erscheint, identisch sein kann. Außerdem bleibt zu erklären, warum und in welchem Sinn Kant so oft von der »Sinnenwelt« und »Verstandeswelt« spricht und Erscheinungen durchweg als »Vorstellungen« deutet. Andererseits kann man die ›Eine-Welt-‹ oder ›Zwei-Aspekte-Theorie‹ ganz zugunsten einer ›Zwei-Welten-‹ oder ›Zwei-Objekte-Theorie‹ aufgeben, um sich so von den Paradoxien der Identität zu befreien. Aber auch hier folgen umgehend weitere Fragen: Warum spricht Kant von »zwei Standpunkten«, von denen aus ein vernünftiges Wesen »sich selbst betrachten« kann, wenn er doch eigentlich zwei Welten meint (IV, 452)? Wie kann er unter »Noumenon« nach dieser Lesart »ein Ding verstehen, so fern es nicht Objekt unserer sinnlichen Anschauung ist, indem wir von unserer Anschauungsart desselben abstrahiren« (B 307)? Spricht Kant hier nicht eindeutig von ein und demselben Objekt? Und angenommen, er tut es nicht: Von welcher Art sind die zwei Objekte, die ihnen entsprechenden Welten, und welche Beziehungen haben sie? Auch im Hinblick auf Freiheit und Zurechnung stellen sich schwierige Fragen. In welchem Sinn ist ein Subjekt in Raum und Zeit für sein Wollen und Handeln verantwortlich, wenn dieses Subjekt der neuen Voraussetzung nach nicht mit dem, das »außer der Reihe« frei handelt, identisch ist? Wie Lewis White Beck bemerkt, scheinen wir dann zwar die Freiheit des noumenalen Menschen vorauszusetzen, hängen aber den phänomenalen für ihn an den Galgen.9 – Wie ist jetzt das Verhältnis des freien Subjekts, das Ding an sich ist und nicht erscheint, zum Subjekt, das erscheint und vom freien Subjekt abhängig sein soll, zu interpretieren? Schließlich bleibt noch eine deflationäre Lesart übrig, der zufolge wir uns nicht für eine der zwei alternativen Lesarten entscheiden müssen. Das könnte deshalb der Fall sein, weil Kant sich mehrdeutig ausdrückt und beide Arten von Ausdruck ihre Berechtigung haben, aber auch deshalb, weil Kant kein klares, stabiles Verständnis der Unterscheidung von ›Ding an sich‹ und ›Erscheinung‹ erreicht hat.10 tern der ontologischen Lesart erscheint dies zu schwach. Sie schreiben Kant die Annahme zu, dass es zwei verschiedene Arten von Eigenschaften von Gegenständen gibt, und dass wir nur Eigenschaften einer dieser beiden Arten – nämlich die Eigenschaften der Dinge, wie sie uns erscheinen – erkennen können. Die zwei Aspekte unterscheiden demnach Eigenschaften der Objekte, nicht nur Weisen, sich auf die Objekte zu beziehen. 9 Zitiert bei Allison 1990, 71, 259. 10 So hält Frederick Beiser den Streit zwischen ›Zwei-Aspekte-‹ und ›Zwei-Welten-Theorien‹ für »steril und unlösbar«, weil ihm zufolge die Texte Anhaltspunkte für beide Lesarten bieten und Kant den Begriff der Erscheinung in Abhängigkeit vom dialektischen Kontext mit verschiedenem Sinn benutzt. Beiser sieht darin gleichwohl kein Anzeichen dafür, dass Kants Theorie inkohärent oder widersprüchlich wäre (Beiser 2002, 22). Einleitung 15 Wie auch immer man sie liest, wirft die Theorie schwierige Fragen auf, die ihren Inhalt und ihre Begründung betreffen. Fragen des Inhalts und der Begründung der Theorie sind eng mit Fragen ihrer Relevanz und Überzeugungskraft verbunden: Viele Verteidiger Kants sind dementsprechend bemüht nachzuweisen, dass sie keineswegs die unzumutbaren Annahmen macht oder die extravaganten Ergebnisse hat, die man ihr stets unterstellt hat. In diesem Spannungsfeld stehen die weiteren Fragen, die das Verständnis und die Chancen einer Verteidigung der Freiheitstheorie Kants betreffen. 1.4 Empirischer und intelligibler Charakter Der transzendentale Idealismus ermöglicht die These: Wenn wir frei sind, dann hat diese Freiheit ihren Ort und Ursprung nicht in der Natur, das heißt der ›Welt der Erscheinung‹, sondern in der ›Welt der Dinge an sich‹. Das ›Ding an sich‹ ist dabei so definiert, dass es nicht Gegenstand sinnlicher Anschauung ist und damit kein Teil der ›Welt der Erscheinung‹ sein kann. Dadurch wird es für Kant möglich zu behaupten, dass Dinge an sich deshalb, weil sie keine Erscheinungen sind, auch nicht den subjektiven Bedingungen der Anschauung wie Raum und Zeit und dem Naturgesetz zeitlicher Abfolge unterliegen. Das ist der entscheidende Zug: Er schafft Raum für Freiheit, ohne mit der Naturnotwendigkeit des Handelns in Konflikt zu geraten. Freiheit haben wir demnach als Dinge an sich mit einem »intelligibelen Charakter« (A 539 / B 567), der zugleich als »empirischer Charakter« (ebd.) erscheint und auf diesem Weg unser Handeln in Raum und Zeit, in der Erscheinung, bestimmt. Für die Erscheinungen gilt nun die These des Determinismus uneingeschränkt: Es gibt keine erste Ursache in der Natur, und das gilt auch für das menschliche Denken und Handeln. Doch dieses Handeln in Raum und Zeit ist für Kant nur das »sinnliche Zeichen« der »transscendentalen« Ursache (A 546 / B 574). Diese ist »außer der Reihe der Erscheinungen (im Intelligibelen)« (A 552 / B 580) und absolut frei. Das erst ermöglicht die Vereinbarkeit von Determiniertheit und Freiheit: »So würde denn Freiheit und Natur, jedes in seiner vollständigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen, nachdem man sie mit ihrer intellgibelen oder sensibelen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Widerstreit angetroffen werden« (A 541 / B 569). Zur Erklärung der Möglichkeit einer besonderen »Causalität durch Freiheit« beruft sich Kant also auf die Unterscheidung von zwei Arten der Kausalität, die er dem »intelligibelen« und dem »empirischen Charakter« zuordnet. Wieder stellen sich schwierige Fragen: Wie ist diese Unterscheidung zu verstehen, und wie hilft sie dabei, Freiheit und Zurechnung möglich zu machen? Wie ist die Beziehung des intelligiblen zum empirischen Charakter einerseits und zu anderen Erscheinungen und Ereignisfolgen andererseits zu deuten? Ist der Begriff einer Kausalität, die »im Intelligibelen« angesetzt wird, überhaupt klar verständlich? Steht er Kant selbst zur Verfügung? Wenn ja: Ist der Begriff der Erstursächlichkeit, den Kant in Anspruch 16 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig nimmt, für seine Zwecke geeignet? Setzt Freiheit in dem Sinn, auf den es ankommt, tatsächlich Erstursächlichkeit in diesem Sinn voraus? 1.5 Zurechnung und Handlungsalternativen Freiheit des Wollens und Handelns ist nicht nur eine besondere Art von Kausalität, »absolute Selbstthätigkeit« (A 419 / B 446) und das »Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen« (A 533 / B 561). Mit Freiheit verbinden wir auch die Vorstellung einer gewissen Ergebnisoffenheit des praktischen Überlegens – die Annahme also, es bestünde zum Zeitpunkt der Entscheidung grundsätzlich die Möglichkeit, anders zu handeln, als wir dann tatsächlich handeln. Nun liegt es durchaus nahe, daraus zu schließen, Freiheit setze die Möglichkeit alternativer Weltverläufe voraus. Das scheint wiederum unvereinbar mit der These der Notwendigkeit des tatsächlichen Weltverlaufs zu sein – und damit wiederum unvereinbar mit der These des Determinismus. Wie sich aus den bisherigen Erörterungen ergibt, muss Kant bestreiten, dass dieser Schluss gültig ist: Wenn man die Lehre des transzendentalen Idealismus voraussetzt, sind Freiheit im Sinn von Erstursächlichkeit und strikter Determinismus vereinbar. Und Kant akzeptiert in der Tat auch die zweite Voraussetzung: Freiheit ist die Fähigkeit, anders zu handeln, als wir tatsächlich handeln und setzt die Möglichkeit anderer Weltverläufe voraus. So schreibt Kant in der Grundlegung: »Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei. Daher kommen alle Urtheile über Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind« (IV, 455). Freiheit ermöglicht uns Handlungsspielraum. Handlungsspielraum setzt Möglichkeitsspielraum voraus. Ein solcher Möglichkeitsspielraum setzt Kant zufolge aber nicht voraus, dass die These des Determinismus falsch ist: Eher setzt Möglichkeitsspielraum voraus, dass die These des Determinismus nicht das letzte Wort behält. Besonders deutlich wird das Sollen, von dem Kant spricht, spürbar, wenn es sich dabei um ein moralisches Sollen handelt. Unleugbar und unhintergehbar – so die Lehre vom »Factum« (V, 6) der reinen praktischen Vernunft – sieht sich der Mensch moralischen Forderungen ausgesetzt. Ein Verstoß gegen moralische Pflicht ist insofern ein klarer Fall einer Handlung, ›die nicht hätte geschehen sollen, ob sie gleich geschehen ist‹; das Handeln im Einklang mit der moralischen Pflicht wäre dagegen die Handlung, ›die hätte geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen ist‹. Beide stehen dem Handelnden, der sich des Sollens bewusst ist, zum Zeitpunkt seiner Entscheidung vollkommen frei. Und Kant fügt hinzu: Sie müssen ihm auch in dieser Weise freistehen, wenn der Handelnde verpflichtet sein soll und die Verfehlung, die er begehen mag, ihm selbst moralisch zugerechnet werden können soll. So schreibt Kant in der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft: »Was der Mensch im moralischen Sinne ist oder werden soll, gut oder böse, dazu muß er sich selbst machen oder gemacht haben. Beides muß eine Wirkung seiner freien Willkür sein; denn sonst könnte es ihm nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein« (VI, 44). Einleitung 17 Moralisch gut oder böse ist demnach nur, wem die Beschaffenheit seines Charakters auch zugerechnet werden kann. Zugerechnet werden kann die Beschaffenheit des Charakters ihrerseits nur dann, wenn sich der Handelnde diesen Charakter durch freie Wahl selbst verschafft hat; das setzt wiederum voraus, dass weder der Charakter selbst noch die Wahl des Charakters auf die Wirkungen der gegebenen Dispositionen des Handelnden zurückgeht. Die Freiheit, um die es Kant bei der Zurechnung geht, ist wie zuvor die Freiheit der Urheberschaft, der Selbstbestimmung und der wirklich offenen Handlungsalternativen: Es ist die Freiheit, »nach welcher die Handlung sowohl als ihr Gegentheil in dem Augenblicke des Geschehens in der Gewalt des Subjects sein muß« (VI, 49 f. Anm.). Doch wie ist das möglich? Kant hat hier eine besondere Schwierigkeit, die sich direkt aus dem Determinismus herleitet: Wenn man sie nur in der Dimension von Raum und Zeit betrachtet, kann »die Handlung sowohl als ihr Gegentheil« nicht mehr »in der Gewalt des Subjects sein«, weil das »Subject« der Voraussetzung nach determiniert ist. Im gegebenen Weltverlauf in Raum und Zeit können Handlungen also nie ausbleiben, weil sie »als Begebenheiten ihre bestimmende Gründe in der vorhergehenden Zeit haben« (VI, 49 f. Anm.). Wie kann dann »die Handlung sowohl als ihr Gegentheil in dem Augenblicke des Geschehens in der Gewalt des Subjects sein«, wie Kant es fordert? Kant meint auch dieses Problem mit der Lehre des transzendentalen Idealismus und der damit verbundenen Unterscheidung zwischen »empirischem« und »intelligibelen« Charakter gelöst zu haben. Demzufolge verschafft sich der Handelnde den empirischen Charakter durch die intelligible Tat. Diese Tat ist eine Ursache, die selbst keine Wirkung ist und deren Wirken sich außerhalb von Raum und Zeit vollzieht. Mit dieser Voraussetzung kann auch dem Handelnden in Raum und Zeit zum Zeitpunkt der Handlung transzendentale Freiheit zukommen, obwohl die Handlung als Erscheinung in Raum und Zeit vollkommen determiniert ist. Doch mit dieser Antwort ergibt sich ein zweites ernstes Problem, das Kants Zuordnung des »intelligibelen« Charakters zur »intelligibelen« Welt und dessen Wirkungsweise betrifft. 1.6 Grenzen der Zurechnung Wenn Kants Unterscheidung trägt, können wir das Handeln in Raum und Zeit in zwei verschiedenen Hinsichten als determiniert betrachten. In der ersten Hinsicht wird es vollkommen durch Ursachen in der Erscheinung bestimmt. Wie jemand wirkt, wird von seinem empirischen Charakter bestimmt, der seinerseits eine Wirkung ist, die sich aus anderen, früheren Ursachen herleitet. Insofern kann niemand anders handeln, als er wirklich handelt. In der zweiten Hinsicht dagegen wird Handeln in Raum und Zeit durch eine »transscendentale Ursache« (A 546 / B 574) bestimmt, die »außer der Reihe der Erscheinungen (im Intelligibelen)« (A 552 / B 580) wirkt und diese Reihe selbst festlegt. 18 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Das entspricht dem Bild des Menschen mit einem empirischen und einem intelligiblen Charakter, der ihm die Freiheit des Handelns in Raum und Zeit sichert. Wenn das Bild zutrifft können wir – obwohl es paradox klingt – auch noch in dem Moment über Freiheit und Möglichkeitsspielraum verfügen, in dem unser Handeln schon längst determiniert ist und sich in Raum und Zeit nur noch als Wirkung der Ursachen in der Zeit vor diesem Handeln vollzieht. Die Bedingung der Zurechnung, »nach welcher die Handlung sowohl als ihr Gegentheil in dem Augenblicke des Geschehens in der Gewalt des Subjects sein muß« (VI, 49 f. Anm.), wäre dann selbst in der deterministischen Welt der Erscheinung erfüllt, weil diese deterministische Welt in Bezug auf diese Handlung zugleich durch die Freiheit des Subjekts als Ding an sich mitbestimmt wird. Doch für was genau wäre der Handelnde dann verantwortlich? Für seine Handlungen in Raum und Zeit? Für sich selbst und seinen Charakter? Für all das, was als Bedingung zu diesem Charakter gehört und ihn geformt hat? Folgt am Ende aus der Theorie, dass wir für die ganze Vorgeschichte unserer eigenen Existenz (mit-)verantwortlich sind? Dahinter steht eine skeptische Frage: Wie kann man überhaupt nach diesem Maßstab moralisch urteilen, das eine loben, anderes tadeln? Wäre ein Mensch nach der Theorie nicht für genau das verantwortlich, was der intelligible Charakter in zeitlosem Handeln bewirkt? Wie aber kann man wissen oder auch nur eine Vermutung darüber anstellen, was er bewirkt, wenn wir von diesem intelligiblen Charakter nichts wissen? Kant selbst bleibt an dieser Stelle skeptisch. Wie er selbst bekennt, bleiben der intelligible Charakter und mit ihm der Umfang der Zurechnung uns am Ende unbekannt. Das sagt Kant schon in der Kritik der reinen Vernunft: »Die eigentliche Moralität der Handlungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns daher, selbst die unseres eigenen Verhaltens, gänzlich verborgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter bezogen werden. Wie viel aber davon reine Wirkung der Freiheit, wie viel der bloßen Natur und dem unverschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffenheit (merito fortunae) zuzuschreiben sei, kann niemand ergründen, und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten« (A 551 Anm. / B 579 Anm.). Diese Antwort ist zwar folgerichtig, doch selbst wenn wir uns mit ihr zufriedengeben wollen, wirft sie sofort eine weitere Frage auf. Wie kann die »reine Wirkung der Freiheit«, von der Kant spricht und die wir ihm zufolge als Ding an sich haben, noch dadurch eingeschränkt sein, dass »der bloßen Natur« und dem »unverschuldeten Fehler des Temperaments, oder dessen glücklicher Beschaffenheit« ebenfalls ein möglicher Einfluss auf unser Wollen und Handeln in Raum und Zeit eingeräumt wird? Anders gefragt: Wie kann man jetzt noch – nämlich nachdem man seine Freiheit in einer intelligiblen Welt angesiedelt hat – das, was man sich selbst oder einer bestimmten Person zurechnen kann, von dem unterscheiden, was man einer anderen Person oder niemandem zurechnen kann? Und wenn das alles unklar bleibt: Wie kann man hier überhaupt von Zurechnung sprechen? Einleitung 19 1.7 Freiheit zum Bösen? Auf diese Fragen braucht Kant eine Antwort, wenn die Theorie der Zurechnung nicht aporetisch enden soll. Er braucht aber auch eine Antwort auf die Frage, die sich anschließt. Nehmen wir an, wir bekommen das erste Problem in den Griff: Dann begründet die Freiheit des intelligiblen Charakters die Zurechnung des empirischen Wollens und Handelns – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Weil uns dabei nicht nur die Betrachtungsweise des Subjekts als Erscheinung, sondern auch die Betrachtungsweise des Subjekts als Ding an sich zur Verfügung steht, gilt dann: »In diesem Betracht nun kann das vernünftige Wesen von einer jeden gesetzwidrigen Handlung, die es verübt, ob sie gleich als Erscheinung in dem Vergangenen hinreichend bestimmt und sofern unausbleiblich nothwendig ist, mit Recht sagen, daß er sie hätte unterlassen können; denn sie mit allem Vergangenen, das sie bestimmt, gehört zu einem einzigen Phänomen seines Charakters, den er sich selbst verschafft, und nach welchem er sich als einer von aller Sinnlichkeit unabhängigen Ursache die Causalität jener Erscheinungen selbst zurechnet.« (V, 98) So weit, so gut – doch wie ist es dann überhaupt möglich, frei und zugleich »gesetzwidrig« zu handeln? Wie kann eine »von aller Sinnlichkeit unabhängige Ursache«, die sich selbst zur Verstandeswelt zählt, gegen das Moralgesetz verstoßen, das Gesetz dieser Verstandeswelt ist? Das Problem ist für Kant deshalb besonders ernst, weil er Freiheit in der Verstandeswelt ansetzt, die per definitionem von allem Sinnlichen, das ja der Sinnenwelt angehört, frei ist. Tatsächlich geht Kant noch weiter, indem er den »freien Willen« mit dem Willen, der dem Moralgesetz folgt, gleichsetzt. So schreibt er in der Grundlegung, dass der moralische Wille sich selbst das Gesetz gibt, sich selbst das Gesetz zu geben aber nichts anderes als das Merkmal des freien Willens ist: »Dies ist aber gerade die Formel des kategorischen Imperativs und das Princip der Sittlichkeit: also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei. Wenn also Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit sammt ihrem Princip daraus durch bloße Zergliederung ihres Begriffs.« (IV, 447) Das scheint es nun geradewegs auszuschließen, frei unmoralisch zu handeln. Frei wäre der Wille ja nur insofern als er moralisch ist; wäre er dagegen unmoralisch, so wäre er auch nicht mehr frei. Wenn ein unmoralischer Wille aber nur ein unfreier Wille sein kann, dann wäre auch niemand für dieses unmoralische Wollen und Handeln verantwortlich, ja der Begriff der moralischen Schuld oder Verfehlung hätte dann gar keinen Sinn. In späteren Schriften versucht Kant, dem Problem durch eine Unterscheidung von »Wille« und »Willkür« zu begegnen. So schreibt er in der Metaphysik der Sitten: 20 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig »Das Begehrungsvermögen, dessen innerer Bestimmungsgrund, folglich selbst das Belieben in der Vernunft des Subjects angetroffen wird, heißt der Wille. Der Wille ist also das Begehrungsvermögen, nicht sowohl (wie die Willkür) in Beziehung auf die Handlung, als vielmehr auf den Bestimmungsgrund der Willkür zur Handlung betrachtet, und hat selber vor sich eigentlich keinen Bestimmungsgrund, sondern ist, sofern sie die Willkür bestimmen kann, die praktische Vernunft selbst.« (VI, 213) Hier unterscheidet Kant zwischen Wille und Willkür durch ihren verschiedenen Gegenstand. Gegenstand der Willkür ist die Handlung, die der Vernunft entsprechen oder widersprechen kann. Damit ist der Gegenstand der Willkür auch die freie Wahl der Handlung aus Alternativen, die jeweils durch »Bestimmungsgründe« erfolgt. Gegenstand des Willens selbst dagegen ist nicht die Handlung oder die Wahl, sondern die Willkür im Hinblick auf diesen »Bestimmungsgrund«. Der Wille ist kein Vermögen der Wahl, und er hat und braucht aus diesem Grund seinerseits keinen »Bestimmungsgrund«. Er befähigt eher zur Erkenntnis als zur Entscheidung; er gibt der Willkür den Maßstab und Grund des Richtigen vor. Das kann der Wille genau deshalb tun, weil er nichts anderes als »die praktische Vernunft selbst« ist, die sich selbst gleichbleibt, der Willkür in der Entscheidung den Maßstab des Richtigen vorgibt und zu ihrem Bestimmungsgrund werden »kann«. – Das erlaubt es Kant zu behaupten, dass der Wille dann und nur dann frei ist, wenn er mit dem Moralgesetz übereinstimmt, ohne mit dieser Behauptung die Möglichkeit des unmoralischen Handelns und dessen Zurechnung fragwürdig werden zu lassen. Doch das Problem kehrt gleich wieder. In diesem Bild steht der Wille im Einklang mit dem Moralgesetz, und jede Abweichung ist jetzt begrifflich unmöglich. Ob der Wille dagegen die Willkür und mit ihr das Handeln bestimmt, ist eine offene Frage: Moralisches Handeln wird vom Willen nur gefordert, aber nicht automatisch bewirkt. Unmoralisches Handeln verstößt gegen die Forderung der Vernunft und des Willens, wird aber durch Willkür möglich und zurechenbar. Unmoralisches Handeln ist also möglich und wirklich, weil der Wille zwar die Willkür bestimmen »kann«, das aber nicht immer tut. – Doch jetzt werden wir fragen: Warum bestimmt der Wille die Willkür nicht immer? Warum entscheiden und handeln wir manchmal »gesetzwidrig«, wenn wir als Dinge an sich keinem Zwang unterliegen und mit dem Willen auch transzendentale Freiheit besitzen? Klar ist: Dabei muss es sich um einen Akt der Freiheit handeln, denn sonst wären wir nicht dafür verantwortlich, dass sich der Wille nicht durchsetzt. Aber welcher Akt der Freiheit kann das sein? Wie ist seine Wirkung zu erklären? Auf diese Fragen hat Kant keine Antwort, und er weist sie zuletzt als falsch gestellt zurück. In der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft bringt Kant das abschließend klar zum Ausdruck. Er spricht dort von einer »Verstimmung« der Willkür, die uns zwar zugerechnet, aber nicht erklärt werden kann. Kant akzeptiert, dass die »Verstimmung« uns zugerechnet werden können muss, um ihrerseits frei zu sein; doch den Versuch der Erklärung weist er dann selbst so zurück: Einleitung 21 »Der Vernunftursprung aber dieser Verstimmung unserer Willkür in Ansehung der Art, subordinirte Triebfedern zu oberst in ihre Maximen aufzunehmen, d. i. dieses Hanges zum Bösen, bleibt uns unerforschlich, weil er selbst uns zugerechnet werden muß, folglich jener oberste Grund aller Maximen wiederum die Annehmung einer bösen Maxime erfordern würde.« (VI, 43) Diese erneute »Annehmung einer bösen Maxime« müsste dann ihrerseits frei sein – und so weiter ad infinitum. – Zurechenbares böses Handeln bleibt ein unerklärtes Faktum. Ist das eine gute Antwort? Gibt es eine bessere? 1.8 Freiheit und Vernunft Angenommen, wir sind von der Möglichkeit freien und zugleich bösen Handelns überzeugt: Bleibt es bei der bloßen Möglichkeit der Freiheit, oder ist sie wirklich? Auch hier ist Kants Position komplex. In der ersten Kritik beansprucht Kant nur die Vereinbarkeit von Naturnotwendigkeit und Freiheit aufgezeigt zu haben. Diese wird in der Auflösung der dritten Antinomie durch die Lehre des transzendentalen Idealismus begründet. Doch wenn erstens gilt, dass Freiheit nur die Freiheit als Ding an sich sein kann oder in ihr gründet, und zweitens gilt, dass alles, was wir theoretisch erkennen können, »auf bloße Erscheinungen eingeschränkt« ist, dann folgt daraus, dass wir von Freiheit nichts wissen. Tatsächlich wird Freiheit von Kant »nur als transscendentale Idee behandelt« (A 558 / B 586), deren Wirklichkeit und Wirkungsweise sich unserer Kenntnis entzieht. Dass Freiheit in dem Sinn möglich ist, dass sie nicht der Naturnotwendigkeit widerspricht und außerdem aufgrund der Unterscheidung zwischen der Welt der Erscheinung und der Welt der Dinge an sich einen möglichen Ort hat, zeigt die Lehre des transzendentalen Idealismus – daraus folgt aber weder, dass Freiheit wirklich ist, noch dass wir einsehen können, wie solche Freiheit beschaffen sein würde, und Kant weist ausdrücklich auf beides hin. Der Schluss auf die Wirklichkeit von Freiheit ist deshalb unzulässig, weil wir »aus der Erfahrung niemals auf etwas, was gar nicht nach Erfahrungsgesetzen gedacht werden muß, schließen können« (A 558 / B 586).11 Selbst auf die Möglichkeit der Freiheit zu schließen wäre verfehlt, »weil wir überhaupt von keinem Realgrunde und keiner Kausalität, aus bloßen Begriffen a priori, die Möglichkeit erkennen können« (ebd.). Wie Freiheit möglich ist und ob sie wirklich ist, wissen wir also auf dieser Grundlage noch nicht. Schon in der ersten Kritik gibt es allerdings Anzeichen dafür, dass es nicht bei dieser bloßen Vereinbarkeitsannahme bleibt. Kant verknüpft schon hier die »transscendentale Idee der Freiheit« mit dem Begriff der »Freiheit im praktischen Verstande«, womit »die Unabhängigkeit der Willkür von der Nöthigung durch Antriebe 11 Wie es bei Kant die Regel ist, bedeutet ›muss nicht‹ ›darf nicht‹ (wie im Englischen ›must not‹). 22 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig der Sinnlichkeit« gemeint ist (A 534 / B 562). Wenn diese Verbindung besteht, folgt daraus, dass »die Aufhebung der transscendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit vertilgen« würde (ebd.). Worin besteht der Zusammenhang? In der Kritik der reinen Vernunft wird er durch Kants Bild der Vernunft gestiftet: Anders als allen natürlichen Dingen schreibt Kant dem Menschen »in Ansehung gewisser Vermögen« die Fähigkeit zu, sich selbst »durch bloße Apperception« als »bloß intellgibeler Gegenstand« zu erkennen (A 546 f. / B 574 f.). Diese Vermögen sind »Verstand und Vernunft« (A 547 / B 575). Nun gilt: Nur wenn die Willkür von der »Nöthigung durch Antriebe der Sinnlichkeit« frei ist, haben wir praktische Freiheit. Verstand und Vernunft sind das, was diese praktische Freiheit verbürgt, und beide sind »intelligibel«. Von moralischer Pflicht ist hier noch nicht die Rede: Kant begnügt sich mit dem Hinweis auf die »bloße Apperception«. In der Folge werden Kants Theorien der Freiheit und der Moral immer enger miteinander verzahnt. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785 soll Freiheit die Möglichkeit des katgorischen Imperativs garantieren. Das wirft erneut – und noch dringlicher – die Frage auf, ob wir transzendental frei sind, und was unabhängig von jedem Interesse an der Moral für diese Annahme spricht. Kant meint auch hier noch, in der Vernünftigkeit des Menschen das Merkmal identifiziert zu haben, das uns berechtigt, uns selbst für transzendental frei zu halten. Er schreibt: »Als ein vernünftiges, mithin zur intelligibelen Welt gehöriges Wesen kann der Mensch die Causalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Idee der Freiheit denken; denn Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt (dergleichen die Vernunft jederzeit sich selbst beilegen muß) ist Freiheit« (IV, 452). Das nimmt Kant schon bald darauf zurück. Die endgültige Fassung der Theorie erreicht Kant deshalb erst in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1787, wo er nicht mehr auf die Vernunft im Allgemeinen, sondern auf das Moralgesetz und mit ihm auf das Gesetz der reinen praktischen Vernunft selbst verweist. 1.9 Das »Factum« der Vernunft 1788 hält Kant das »System« der reinen Vernunft für vollendet. Er schreibt zuversichtlich: »Der Begriff der Freiheit, so fern dessen Realität durch ein apodiktisches Gesetz der praktischen Vernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst der speculativen Vernunft aus« (V, 3 f.). Diese Entwicklung kündigt sich schon in der zweiten Auflage der ersten Kritik von 1787 an. – Was hat sich verändert? Wie zuvor sind Freiheit und Moral als Bedingung und Bedingtes aufeinander angewiesen – ab jetzt aber so, dass Freiheit durch Moral bewiesen werden soll. Freiheit wird nun nicht mehr durch »gewisse Vermögen« (A 546 / B 574) – nämlich Verstand und Vernunft –, sondern durch »gewisse Gesetze« (B 430) bewiesen. Da- Einleitung 23 mit ist unser Bewusstsein der Gültigkeit der moralischen Gesetze – und damit des moralischen Gesetzes selbst – gemeint. Kants Begründung lautet, dass wir dieses Bewusstsein nicht hätten, wenn wir nicht wirklich frei wären: »Denn, wäre nicht das moralische Gesetz in unserer Vernunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Freiheit ist (ob diese gleich sich nicht widerspricht), anzunehmen. Wäre aber keine Freiheit, so würde das moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen sein«. (V, 4 Anm.) Freiheit wird so zur »ratio essendi« des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz zur »ratio cognoscendi.« der Freiheit (ebd.) Diese Wirklichkeitsannahme ist nach wie vor nicht dazu geeignet, die theoretische Einsicht über die Welt der Erscheinung hinaus zu erweitern und in die intelligible Welt vordringen zu lassen. Aber »in praktischer Absicht« hält Kant die Annahme transzendentaler Freiheit für richtig und sogar für zwingend (V, 4 f.). Worin besteht der Zusammenhang? Kant scheint so zu schließen: Wir sind uns des Moralgesetzes bewusst. Zu diesem Bewusstsein gehört: Das Moralgesetz gebietet kategorisch. Wenn es aber kategorisch gebietet und alle Menschen betrifft, müssen die Menschen die Fähigkeit haben, dem Moralgesetz unabhängig von Neigung, Empfindung und Wunsch zu folgen. Hier impliziert jedes ›Sollen‹ ein ›Können‹ (vgl. V, 94 u. 159): Wenn der Mensch dem Gesetz nicht nachkommen könnte, wäre es nicht seine Pflicht, ihm nachzukommen. Das würde heißen: Es wäre gar kein Moralgesetz. Wenn der Mensch dem Gesetz nicht unabhängig von Neigung, Empfindung und Wunsch nachkommen könnte, wäre es nicht kategorisch. Das würde heißen: Es wäre dann kein Moralgesetz. Nun ist es Pflicht und kategorisch: Also verfügen wir auch über die Fähigkeit, es zu befolgen, und diese Fähigkeit ist gleichbedeutend mit Freiheit. Kant selbst schlägt die Brücke so: »[D]er Heiligkeit der Pflicht allein alles nachsetzen und sich bewußt werden, daß man es könne, weil unsere eigene Vernunft dieses als ihr Gebot anerkennt und sagt, daß man es thun solle, das heißt sich gleichsam über die Sinnenwelt selbst gänzlich erheben, und ist in demselben Bewußtsein des Gesetzes auch als Triebfeder eines die Sinnlichkeit beherrschenden Vermögens unzertrennlich, wenn gleich nicht immer mit Effect verbunden […].« (V, 159) Das Bewusstsein moralischer Pflicht verbürgt also die Freiheit, weil Freiheit selbst die Bedingung moralischer Pflicht ist. Die Freiheit bleibt zwar »Idee« (V, 4) und ist in Bezug auf ihre Möglichkeit und Wirklichkeit nicht erklärbar. Dennoch ist sie nach Kant die Bedingung des Moralgesetzes, das wir anerkennen. In der Grundlegung sieht Kant in der Freiheit eine »nothwendige Voraussetzung der Vernunft in einem Wesen, das sich eines Willens, d. i. eines vom bloßen Begehrungsvermögen noch verschiedenen Vermögens, (nämlich sich zum Handeln als Intelligenz, mithin nach Gesetzen der Vernunft unabhängig von Naturinstincten zu bestimmen) bewußt zu sein glaubt« (IV, 459). In der Kritik der praktischen Vernunft macht das 24 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Moralgesetz selbst aus diesem Glauben Gewissheit. Es zeigt, dass dem moralischen Sollen, das sich an uns richtet und »apodiktisch gewiß ist« (V, 47), ein freies Können als seine Bedingung entspricht. 1.10 Offene Fragen So wird Freiheit 1788 zum »Schlußstein« (V, 3 f.) des gesamten Systems. Dieses Bild aus der Architektur ist gut gewählt: Es hat eine eigene Pointe und hebt die zentrale Bedeutung der Freiheit für das Unternehmen der »critischen Philosophie« hervor. Diese gleicht einem Gebäude, das Theorie und Praxis überwölbt. Freiheit ist ihre Verbindung: Sie ist die Bedingung des Moralgesetzes, die uns das Moralgesetz verbürgt. So ist auch der Schlussstein mehr als die Verbindung der zwei Teile des Gebäudes, denn beim Bau von Bögen und Gewölben ist der Schlussstein mehr als nur der Stein, der zum Schluss noch fehlt: Erst mit eingesetztem Schlussstein trägt die Konstruktion sich selbst. Alle hier nur knapp skizzierten Punkte werfen viele Fragen auf. Wie begründet Kant die These, dass moralische Verantwortung transzendentale Freiheit voraussetzt? Ist diese These überzeugend? Ist es Kant selbst gelungen, die Voraussetzung einzulösen? Hat er gezeigt, dass wir uns für transzendental frei halten dürfen oder gar müssen, wenn auch nur in praktischer Hinsicht? Was bleibt von der Lehre des transzendentalen Idealismus? Was genau besagt sie, was spricht für und gegen sie? Wie tragfähig Kants Antworten auf diese Fragen sind, ist nach wie vor kontrovers. Es hängt offenbar entscheidend von der Frage der richtigen Lesart der Theorie ab, und auch diese Frage bleibt umstritten. Es hängt aber auch von der Frage ab, welche Annahmen Kants wir heute noch teilen können, und führt so über Kants eigene Texte hinaus. Die Beiträge zu diesem Band werfen ein Licht auf diese und andere Fragen. Manche der Beiträge sind eher historisch oder exegetisch angelegt; andere gehen eher systematisch und problemorientiert vor. Dass sich beides nicht ausschließt, sondern im Gegenteil fest zusammengehört und sich ergänzt und befruchtet, zeigen die Beiträge in der Gesamtschau. Literaturverzeichnis Allison, Henry E.: Kant’s Theory of Freedom. Cambridge 1990. –: Kant’s Transcendental Idealism. An Interpretation and Defense. New Haven, London 22004. Beiser, Frederick C.: German Idealism. The Struggle Against Subjectivism 1781– 1801. Cambridge/Mass. 2002. Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. München 2001. Einleitung 25 Kane, Robert (Hg.): The Oxford Handbook of Free Will. Oxford 2002. Prauss, Gerold: Kant und das Problem der Dinge an sich. Bonn 1974. Strawson, Galen: Freedom and Belief. Oxford 22010. Strawson, Peter F.: Freedom and Resentment. – In: Proceedings of the British Academy 48 (1962), 187–211. Pereboom, Derk: Living Without Free Will. Cambridge 2001. Rosefeldt, Tobias: Dinge an sich und sekundäre Qualitäten. – In: J. Stolzenberg (Hg.): Kant in der Gegenwart. Berlin 2007, 167–209. Van Cleve, James: Problems from Kant. New York 1999. van Inwagen, Peter: An Essay on Free Will. Oxford 1983. 2. Die Beiträge Den Band eröffnet ein Beitrag von Dietmar H. HEIDEMANN, der die Motivation und den Gehalt der These des transzendentalen Idealismus untersucht. Dabei konzentriert sich Heidemann auf einen Satz aus der Kritik der reinen Vernunft: »Denn, sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten« (A 536 / B 564). Mit dieser ›Unrettbarkeitsthese‹ droht Heidemann zufolge ein Dilemma: Da die Moral Freiheit voraussetzt, würde diesem Satz zufolge dann, wenn Dinge an sich Erscheinungen wären, mit der Freiheit auch Moral unmöglich werden; wenn man dagegen mit Kant behauptet, dass Erscheinungen nicht Dinge an sich sind, scheint man sich die große metaphysische Last einer ›Zwei-Welten-Theorie‹ aufzubürden. Demgegenüber will Heidemann zeigen, dass Kant seiner Ethik keine Zwei-WeltenTheorie zugrunde legt, sondern vielmehr transzendentale Freiheit als Bedingung der Möglichkeit des moralischen Handelns im Rahmen einer ›Eine-Welt-Theorie‹ etablieren kann. Heidemann argumentiert, dass die Unrettbarkeitsthese lediglich eine mögliche Welt fingiert, in der die kritische Erkenntnisrestriktion nicht gilt, und dass daraus die Inkompatibilität von Natur und Freiheit mit der Konsequenz der Unrettbarkeit der Freiheit folgen würde. Gegen eine solche metaphysische Bestimmtheitsthese wendet der transzendentale Idealist ihm zufolge ein, dass die Gegenstände der Erfahrung nicht an sich bestimmt, sondern vielmehr an sich unbestimmt, wenn auch durch den Verstand nach subjektiven Erkenntnisbedingungen bestimmbar, seien. Wenn das zutrifft, sind auch Natur und Freiheit vereinbar, ohne dass zwei Welten – eine Welt der Natur und eine Welt der Freiheit – angenommen werden müssten. Wir wären transzendental freie Bürger der einen Welt. – Auch Jochen BOJANOWSKI steht einer Zwei-Welten-Lesart des transzendentalen Idealismus skeptisch gegenüber. In seinem Beitrag versucht er, Kants Position in der Freiheitsdebatte in der gegenwärtigen Debatte zu verorten. Er argumentiert zunächst dafür, Kant einen inkompatibilistischen Freiheitsbegriff zuzuschreiben, von dem er dann zeigt, wie er gegen das Zufallsargument der Kom- 26 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig patibilisten widerspruchsfrei expliziert werden kann. Weil Kant zugleich eine Form des Determinismus behauptet, liegt es dessen ungeachtet nahe, ihn als Kompatibilisten zu bezeichnen. Bojanowski argumentiert gegen diese Zuordnung, indem er Kants Position von den gängigen Formen des Kompatibilismus unterscheidet. Ihm zufolge vertritt Kant weder einen klassischen Kompatibilismus, noch einen Metakompatibilismus, noch einen anomalen Monismus nach dem Vorbild Davidsons. Vielmehr sollten wir Kants Verständnis der deterministischen These genauer beleuchten: Bojanowski zufolge schließt diese These einen inkompatibilistischen Freiheitsbegriff nämlich gar nicht aus. Seine These lautet, dass Kant einen Indeterminismus hinsichtlich der Naturursachen menschlichen Handelns vertritt, wobei Kants Freiheitsbegriff der moralischen Autonomie seine Theorie fundamental von allen gegenwärtigen inkompatibilistischen Freiheitstheorien unterscheidet. Auch nach dieser Lesart sind wir freie Bürger einer Welt. – Tobias ROSEFELDT dagegen liest Kant als einen Deterministen ohne Wenn und Aber. Er schreibt ihm folgende Annahmen zu: erstens die Annahme der Determiniertheit der menschlichen Handlungen durch zeitlich frühere Ereignisse; zweitens die Annahme der Möglichkeit transzendentaler Freiheit; drittens die Annahme der Vereinbarkeit der ersten zwei Annahmen unter der Voraussetzung, dass man den transzendentalen Idealismus als Theorie über Raum und Zeit akzeptiert. Aufgrund dieser Vereinbarkeitsannahme bezeichnet er Kants Position als eine Form des Kompatibilismus. Die Begründung für diese Zuordnung lautet, dass die These des Kompatibilismus die Vereinbarkeit von menschlicher Freiheit und Determinismus behauptet, nicht aber eine bestimmte Auffassung davon beinhaltet, weshalb und unter Inkaufnahme welcher weiteren theoretischen Kosten diese Vereinbarkeit möglich ist. Dabei räumt Rosefeldt ein, dass die theoretischen Kosten von Kants transzendentalem Idealismus tatsächlich hoch sind. Determinismus und Freiheit sind nach seiner Lesart nur dann miteinander vereinbar, wenn man akzeptiert, dass Menschen nur als Erscheinungen, nicht aber an sich selbst in der Zeit existieren, und dass sie als Dinge an sich außerhalb der Zeit handeln können. Rosefeldt verteidigt diese Lesart, die er als die ›Standardinterpretation von Kants Kompatibilismus‹ bezeichnet, und schützt sie gegen einen gewichtigen Einwand. Die Lesart scheint die absurde Konsequenz zu haben, dass unser transzendental freies Handeln nur dann einen Einfluss auf unsere Handlungen in der Zeit haben kann, wenn es auch Einfluss auf die Geltung der Naturgesetze oder auf den bisherigen Weltverlauf hat. Um diesem Einwand zu begegnen, untersucht Rosefeldt in seinem Beitrag, was Kants Kompatibilismus für den Zusammenhang zwischen freiem zeitlosen Handeln, determiniertem zeitlichen Handeln und den dieses Handeln determinierenden Faktoren impliziert. Seine These lautet, dass keine der Konsequenzen sachlich so absurd ist, dass sie einen hinreichenden Grund dafür darstellen würde, diese Form des Kompatibilismus nicht selbst zu vertreten oder sie Kant nicht zuzuschreiben. Sie ist Rosefeldt zufolge zumindest nicht weniger glaubwürdig als der transzendentale Idealismus. – Einleitung 27 Dieter SCHÖNECKER untersucht eine Passage der Grundlegung, die den Zusammenhang von Freiheit und Moralgesetz betrifft. Kant behauptet im dritten Abschnitt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen seien »einerlei«: »Wenn also Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit samt ihrem Prinzip daraus durch bloße Zergliederung ihres Begriffs« (IV, 447). Diese These, die Schönecker Kants ›Analytizitätsthese‹ nennt, besagt, dass der intelligible Wille dann und nur dann frei ist, wenn er ein moralisch guter Wille ist. Doch wie ist dann die Möglichkeit des bösen und auch freien Handelns zu erklären? Wenn eine Person kraft ihres intelligiblen Willens dann und nur dann frei handelt, wenn sie moralisch handelt, dann kann eine solche Person offenbar nicht frei und unmoralisch handeln; das moralisch Böse wird dann schlicht unmöglich. Die Passage aus dem dritten Abschnitt, die Schönecker kommentarisch interpretiert, soll diesen Einwand bekräftigen. Schönecker zufolge zeigt sie, dass Kant zwar vielleicht mit dem Begriff der Freiheit einen Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens haben mag, dass er einen Schlüssel zur Erklärung der Heteronomie des Willens aber nicht anzubieten hat. Das Problem des Bösen in der Grundlegung lässt sich nach Schönecker letztlich auf die Schwierigkeit zurückführen, dass Kant den Menschen sowohl als Glied der Verstandeswelt als auch als Glied der Sinnenwelt versteht, wobei er den freien Willen des Menschen als Glied der Verstandeswelt, seinen bösen Willen dagegen als Glied der Sinnenwelt begreift, aber nicht einmal im Ansatz erklärt, wie das Verhältnis der zwei ›Willen‹ zueinander und zur ganzen Person zu verstehen ist. – Andree HAHMANN untersucht in seinem Beitrag das Verhältnis von Ding an sich und Erscheinung. Er diskutiert es zum einen im Hinblick auf die dritte Antinomie der Kritik der reinen Vernunft, zum andern im Hinblick auf die in der Kritik der praktischen Vernunft eingeführte Lehre vom Faktum der Vernunft. Dabei betont er die ontologische Priorität des Dings an sich, die seiner Lesart zufolge vor allem im Zusammenhang der Lehre vom Faktum hervortritt. Damit wendet Hahmann sich zugleich gegen die Deutung des transzendentalen Idealismus, die er als ›epistemologisch‹ bezeichnet. Dieser Deutung zufolge sind die Gegenstände in mehr als nur der raumzeitlichen Hinsicht bestimmt, sodass sie auch unabhängig von der Tätigkeit des Verstandes als Gegenstände gedacht werden können. Demgegenüber betont Hahmann, dass Kant zufolge die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung zugleich die Bedingung der Gegenstände der Erfahrung darstellt. Eher von exegetischen als systematischen Interessen geleitet, will Hahmann eine kohärente Interpretation des Texts entwickeln, die keine sachlichen Härten vermeidet und dem Ding an sich den Stellenwert einräumt, den Kant ihm in der praktischen Philosophie zuschreibt. Das gelingt Hahmann zufolge nur mit einer ontologischen Lesart des transzendentalen Idealismus. Nach dieser Lesart erweitert das Faktum der Vernunft unsere Erkenntnis in praktischer Hinsicht über den Bereich des Sinnlichen hinaus und ebnet auf diese Weise den Weg zu einer kritischen Metaphysik. – 28 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Bernd LUDWIG geht in seinem Beitrag der Frage nach, wie Kant seine kritische Metaphysik zwischen 1781 und 1788 veränderte, und aus welchen Gründen er das tat. Thematisch konzentriert sich Ludwig dabei auf die Neufassung der Paralogismen der reinen Vernunft und die Lehre vom Faktum der Vernunft, zeitlich auf die Ereignisse des Frühjahres 1786, die Kant zu dieser Neufassung bewegten und den entscheidenden Fortschritt hin zu einer kritischen Metaphysik und Freiheitslehre mit sich brachten. Nach Ludwigs Lesart musste Kant die erste Fassung der Paralogismen von 1781 verwerfen, weil es ihm darin nicht gelungen war, die Fehler der rationalen Psychologie zu vermeiden. In der zweiten Fassung von 1787 dagegen hat Kant in der entscheidenden Hinsicht mit dieser Psychologie brechen müssen, weil ihm im Frühjahr 1786 durch den Rezensenten Pistorius deutlich gemacht worden war, dass erst durch diesen Bruch eine »consequente Denkungsart der speculativen Critik« (V, 6) möglich sein würde. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Kant nach dieser Lesart an der Möglichkeit intelligibler Selbsterkenntnis durch reine Apperzeption festgehalten und sich an zentralem Ort in Abschnitt III der Grundlegung selbst noch darauf berufen. Aus der Sicht von 1787 stellt das einen Irrtum dar, und erst mit diesem Bruch ist eine kritische Freiheitslehre erreicht. Das hat nach Ludwig zur Folge, dass 1781er-Textpassagen zur Möglichkeit der Kausalität aus Freiheit, zur praktischen Freiheit und zum Kanon, die Kant für die zweite Auflage unverändert zum Druck gab, nicht mehr dem Standpunkt der kritischen Philosophie von 1787 entsprechen. – Auch Heiner KLEMME beleuchtet in seinem Beitrag Kants Konzeption der Selbsterkenntnis, die er aus einem wichtigen Satz der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1787 entwickelt. Dort behauptet Kant: »Das Ich denke ist […] ein empirischer Satz, und hält den Satz, Ich existiere, in sich« (B 422, Anm.). Klemme zufolge ist die Erkenntnis der Existenz, die Kant uns mit diesem Satz zuschreibt, keineswegs auf das empirische Ich beschränkt. Vielmehr behauptet Kant schon wenig später, dass das Ich durch Spontaneität so bestimmt sei, dass uns dies in praktischer Hinsicht als noumenale Wesen zu erkennen gebe. Dem folgt im Text ein Hinweis auf »jenes bewundernswerte Vermögen«, das uns das »Bewußtsein des moralischen Gesetzes« offenbart (B 431). So gelesen steht der Satz in enger Verbindung mit den Lehren vom Faktum der reinen praktischen Vernunft und von den Kategorien der Freiheit, die Kant in der Ende 1787 erschienenen Kritik der praktischen Vernunft entwickelt. Klemme zufolge erweisen sich dabei die logischen Funktionen des Denkens als gemeinsamer Grund der Bestimmung unserer selbst als eines Wesens, das zugleich in der Sinnenwelt und der Verstandeswelt existiert. Wir sind Kant zufolge berechtigt, den Kategorien der Freiheit deshalb eine objektive Bedeutung zuzusprechen, weil an die Stelle der Anschauung, die den Kategorien der Natur eine objektive Bedeutung gibt, das Moralgesetz tritt. Diese Interpretation entfaltet er in drei Schritten. Zuerst untersucht Klemme Einleitung 29 Kants Konzeption der Selbsterkenntnis in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und diskutiert Einwände, die der Rezensent Pistorius gegen sie vorgebracht hat. In einem zweiten Schritt erläutert er den Existentialsatz ›Ich denke‹, so wie er in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft erscheint, und bezieht ihn auf die Relation von Natur und Freiheit. In einem dritten Schritt entwickelt er einen Einwand gegen Kants eigene Deutung dieses Existentialsatzes. Dieser lässt Klemme zufolge schon für sich genommen den Schluss auf die Fortdauer nach dem Tod zu, ohne auf den Gedanken der zweckmäßigen Ordnung der Natur angewiesen zu sein. – Geert KEIL kritisiert Kant grundsätzlicher, wobei er dessen kritische Haltung gegenüber dem klassischen Kompatibilismus teilt. Kants Satz »Denn sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten« (A 536 / B 564) stellt Keil einen anderen entgegen: ›Wenn Freiheit noumenale Kausalität erfordert, ist Freiheit nicht zu retten‹. Keil verfolgt zunächst die Frage, wie das Junktim von transzendentalem Idealismus und der Rettung der Freiheit bei Kant motiviert ist. Er hält es für unzureichend begründet und führt fünf Gründe an, die dafür sprechen, das Junktim zu lösen. Kant konstruiert seiner Auffassung nach in der dritten Antinomie ein idiosynkratisches Vereinbarkeitsproblem, das auf angreifbaren kausalitätstheoretischen und metaphysischen Annahmen beruht. Insbesondere versucht Keil zu zeigen, dass die Auflösung der Antinomie durch den transzendentalen Idealismus nur nötig wird, weil Kant (1) für Freiheit Erstverursachung fordert, (2) die Gesetzesauffassung der Kausalität für einen analytischen Bestandteil des Kausalbegriffs hält, (3) das Kausalprinzip mit dem Determinismus identifiziert und (4) mit der Auszeichnung des Kausalprinzips als synthetischem Satz a priori zugleich den deterministischen Charakter der Natur erwiesen zu haben glaubt. Dem folgt eine Diskussion der Frage, ob noumenale Kausalität aus Freiheit als Akteurskausalität oder Substanzkausalität rekonstruiert werden kann, wobei sich Keil vor allem mit Rosefeldt und Watkins auseinandersetzt. Sein Beitrag schließt mit einem Epilog, der einige tentative Überlegungen dazu enthält, ob wenigstens einige Elemente des transzendentalen Idealismus für die Freiheitstheorie fruchtbar gemacht werden können. Im Ausgang von einer Bemerkung Wittgensteins findet er einen Anknüpfungspunkt an der Stelle des Umschlags von der volitiven Vorbereitung einer Handlung zur Handlung selbst. Dieser Umschlagspunkt scheint insofern etwas Nichtempirisches zu sein, als er keine Ausdehnung in der erfahrbaren Welt der Erscheinungen hat. Der Akteur spielt Keil zufolge in diesem Bild eine besondere irreduzible Rolle, die in einer ereigniskausalen Analyse nicht eingefangen wird. – Kenneth WESTPHAL lehnt den transzendentalen Idealismus Kants ausdrücklich ab, will aber auf der Grundlage einer Form des Realismus Kants Freiheitsanspruch verteidigen. Seine These lautet, dass Kant die Möglichkeit der Freiheit des Handelns und Urteilens hinreichend gerechtfertigt hat, ohne den transzendentalen Idealismus 30 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig heranzuziehen. Ihm zufolge ist es Kant hier wie auch andernorts gelungen, eine stärkere und wichtigere philosophische Position zu rechtfertigen als er beabsichtigt hatte. Westphal präsentiert zunächst eine Reihe von Gründen, die an Kants Rechtfertigung des universalen Kausaldeterminismus zweifeln lassen. Selbst wenn man das allgemeine Prinzip, dass jedes Ereignis eine zureichende Ursache hat, akzeptiert, reicht das ihm zufolge für die Grundsätze der Analogien der Erfahrung nicht aus. Diese setzen das spezifische Prinzip, dass jedes physische Ereignis eine äußerliche, physische Ursache hat, voraus, und Kants transzendental-idealistischer Versuch, dieses Prinzip zu beweisen, scheitert. Zwar lässt sich das spezifische Kausalprinzip Westphal zufolge tatsächlich transzendental rechtfertigen, indem man Kants kognitive Semantik der singulären Gegenstandsbezogenheit heranzieht. Aber damit lässt sich nicht mehr der universale Kausaldeterminismus rechtfertigen. Westphal argumentiert weiter, dass Kant den universalen Kausaldeterminismus auch gar nicht zu beweisen brauchte, weil das spezifische Kausalprinzip zur transzendentalen Kategoriendeduktion genügt, aber zur Erklärung einzelner menschlicher Handlungen nur einen regulativen Gebrauch hat. Tatsächlich stellt ihm zufolge schon die These, dass jede menschliche Entscheidung oder Handlung kausal vollkommen bestimmt sein könnte, eine unbegründete, kognitiv leere Anmaßung dar. Kant hat ihm zufolge außerdem gezeigt, dass wir legitime Kausalurteile nur in Bezug auf raumzeitliche, nicht aber ausschließlich zeitliche Ereignisse fällen können. Nur wenn das menschliche Handeln aus der Perspektive der Neurophysiologie oder Psychologie untersucht wird, sind kausale Kategorien ihm angemessen. Daraus kann Westphal zufolge aber nicht auf die Determiniertheit jeder Entscheidung und Handlung geschlossen werden. Tatsächlich gibt es nach Westphal drei kritische Gründe, die für die Annahme der Freiheit sprechen: erstens sind freie Handlungen Ausdruck der Zwecksetzung einer Person und können zwar rational nachvollzogen, aber nur in pathologischen Fällen kausal erklärt werden; zweitens ist die Urteilskraft selbst normativ und so gegenüber kausalen Prozessen der Physiologie oder Psychologie autonom; drittens handeln wir nur dann verantwortlich, wenn wir zu Recht beanspruchen, Gründe für diese Handlung zu haben, und auch das zeigt, dass Entscheiden und Handeln so lange nicht kausal, sondern rational zu verstehen sind, bis sie sich als pathologisch erweisen. – Mario BRANDHORST übt eine Kritik an Kants Freiheitsverständnis. Sein Beitrag zielt darauf ab, Gründe für das Scheitern von Kants Freiheitslehre sichtbar werden zu lassen, die auch dann bestehen bleiben, wenn man Kant die Lehre des transzendentalen Idealismus zugesteht. Auch wenn dieses Ergebnis vor allem negativ ist, hat es ihm zufolge doch eine klärende Wirkung: Es wirft ein Licht auf die Frage, welches Verständnis von Freiheit den Namen verdient und trägt so dazu bei, das verzweigte Begriffsfeld der Freiheit zu klären. Außerdem kann uns die Einsicht in Gründe des Scheiterns vor ähnlichen Träumen und den mit ihnen verbundenen Ängsten bewahren, wenn wir das Muster der Täuschung durchschauen. Einleitung 31 Brandhorst verteidigt zwei Thesen, die dazu betragen sollen. Die erste These lautet, dass es Kant nicht gelingt, die traditionelle Vereinbarkeitsthese zu untergraben. Kant lässt sich ihm zufolge von Bildern und Gedanken leiten, die zwar eine starke assoziative Wirkung auf uns haben, aber der kritischen Prüfung nicht standhalten können. Deshalb schlagen auch Kants Versuche fehl, für die Annahme transzendentaler Freiheit zu argumentieren. Weder Kants Kritik der »comparativen« Freiheit noch seine Verteidigung der »transscendentalen« (V, 96 f.) überzeugen, und beide Einwände hängen zusammen. Die zweite These lautet, dass Kants Freiheitstheorie zwar scheitert, doch dass die tieferen Gründe für dieses Scheitern nicht da zu finden sind, wo man sie zunächst vermutet. Brandhorst zufolge liegen diese Gründe nämlich nicht in Kants Metaphysik des transzendentalen Idealismus, auch wenn dieser zweifellos mit großen Schwierigkeiten behaftet ist und sich nach seiner Auffassung nicht überzeugend verteidigen lässt. Die Gründe für dieses Scheitern liegen vielmehr in Kants Begriff und Konzeption von Freiheit. Der Vorwurf lautet, dass die Konzeption in sich nicht stimmig ist: Sie bietet keinerlei Grundlage dafür, die postulierte Art der Kausalität als Kausalität aus Freiheit anzusehen. Das gilt Brandhorst zufolge zumindest dann, wenn ›Freiheit‹ den moralisch belastbaren Sinn haben soll, den Kant diesem Wort durchgängig zuschreibt. Damit wird zugleich fraglich, ob Kant sein kritisches Ziel erreicht und die Möglichkeit der Freiheit nachweist. – Reinhard BRANDT beleuchtet Kants Freiheitsverständnis aus der Perspektive der Rechtslehre von 1797. In der Schrift formuliert Kant eine erste Rechtspflicht: »Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive)« (VI, 236). »Rechtliche Ehrbarkeit« besteht dem folgenden Satz nach darin, »im Verhältniß zu Anderen seinen Werth als den eines Menschen zu behaupten, welche Pflicht durch den Satz ausgedrückt wird: ›Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck‹«. Kant kündigt auch an, diese Pflicht als »Verbindlichkeit aus dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person« zu erklären. Die Passage gibt dem Leser Rätsel auf. Brandt zufolge nimmt der Satz, der kurz vorher noch der Tugendlehre angehörte, die Empörung gegen die unmenschlichen Despoten in Europa auf und fordert die Bürger auf, aus dem Zustand tyrannischer – wiewohl legaler – Unterjochung in den rechtlichen Zustand der Republik zu wechseln. Damit überschreitet Kant nach Brandt das Konzept seines bisherigen Naturund Vernunftrechts in zweierlei Hinsicht: Erstens macht er den Menschen selbst zum Ursprung seiner Qualität eines Rechtswesens durch die Pflicht, eben dies zu sein; zweitens ergänzt er das duale Schema von Natur- und Zivilzustand und stellt ihm die Alternative von Despotie und Republik an die Seite. Die These des Beitrags lautet: Die erste Rechtspflicht wird von Kant unter der Voraussetzung des kategorischen Imperativs und der Vernunftnotwendigkeit des Rechts eingeführt und dient so als die Grundlage des Rechts, das in den beiden Bereichen des neminem laede und suum cuique als Privat- und Öffentliches Recht abgehandelt wird. Die erste Rechtspflicht ist dabei der Ort der Selbstkonstitution des 32 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Menschen als eines Rechtswesens. Damit erweist sich zugleich die Abhängigkeit der kantischen Rechtslehre von ihrer kritischen und transzendentalphilosophischen Begründung. – Susanne BRAUER öffnet den Horizont des Themas weiter und diskutiert einen Freiheitsbegriff, den Hegel nach Kant und im Gegensatz zu ihm entwickelt. Brauer betrachtet dazu die Grundlinien zur Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse von 1821. Am Beispiel der von Hegel so genannten sittlichen Institution der Familie möchte sie zeigen, inwiefern für Hegel die Freiheit nicht losgelöst von gesellschaftlichen Kerninstitutionen zu denken ist, die zugleich einen Anspruch auf Vernünftigkeit erheben. Diesem Zusammenhang liegt ihr zufolge die allgemeinere These zugrunde, dass Hegel Freiheit nicht ohne Relationalität, das heißt zwischenmenschliche Beziehungen bestimmter Art, für möglich hält. Der freie Wille ist nach Hegel an das Ziel gebunden, seine Freiheit zu wollen. Ein Ziel zu wollen bedeutet für rational Handelnde, auch die Bedingungen für die Verwirklichung des Ziels zu wollen. Diese Bedingungen sieht Hegel in sozialen, politischen, ökonomischen und rechtlichen Einrichtungen, die er unter drei Institutionen zusammenfasst: Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat. So erweist sich Brauer zufolge die Familie als konstitutive Bedingung für Freiheit. In der Familie zu leben heißt so betrachtet, im Sinn vernünftiger Selbstbestimmung frei zu sein. Hier legt sich der Einwand nahe, dass Hegels institutionelle Konzeption der Freiheit die individuelle Freiheit eher gefährdet als sichert. Um diesem Einwand zu begegnen, stützt sich Brauer auf den Hegelschen Begriff der Anerkennung. Er stellt ihr zufolge das begriffliche Scharnier zwischen Freiheit und institutioneller Vernünftigkeit dar. Die Form der Anerkennung, die Hegel für die Familie konzipiert, ist die Liebe. Ein Vergleich der Freiheitskonzeptionen Kants und Hegels, mit dem Brauer ihren Beitrag abschließt, zeigt sowohl viele Kontinuitäten als auch viele Brüche auf. Wie sie ausführt, kann Hegels Freiheitsauffassung als Alternative zu Kant bedenkenswert sein: Erstens kann Hegel nach dieser Lesart erklären, warum ein Mensch motiviert ist, Normen für sich als bindend anzuerkennen: Die Erklärung lautet, dass der Mensch in einer bestimmten Weise sozialisiert wurde und die gemeinschaftlichen Normen internalisiert hat. Zweitens kann Hegel inhaltlich konkrete Pflichten formulieren, weil diese durch die konkrete Gestalt der gesellschaftlichen Institutionen vorgegeben sind. Drittens bietet Hegel eine Lösung für das kantische Paradox an, dass ein Mensch sich zugleich selbst das Gesetz gibt und dem Gesetz unterworfen ist. Die Lösung liegt in Hegels Konzeption der Selbstbestimmung, die sie als ein graduelles, kollektives und historisches Ergebnis, nicht als noumenalen Akt der Wahl versteht. – Einleitung 33 3. Zur Zitierweise Wenn nicht anders angegeben, werden die Werke Kants nach der Akademieausgabe zitiert: Kant’s gesammelte Schriften. Hg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und ihren Nachfolgern. Berlin, 1900 ff. Dabei werden Zitate mit Band, Seite und gegebenenfalls Zeile nachgewiesen: (V, 3.14–15). Zitate aus der Kritik der reinen Vernunft werden ohne Bandzahl nach den Ausgaben A (1781) und B (1787) zitiert. Wenn nicht anders angegeben, liegt auch hier der Text der Akademieausgabe zugrunde. Weitere Literatur wird jeweils am Schluss der Beiträge aufgeführt. In den Texten wird mit einer Sigle (Autor, Jahr, gegebenenfalls Seitenzahl) auf das Literaturverzeichnis des Beitrags verwiesen, wo die Siglen aufgelöst werden. Klassiker, die nach modernen Ausgaben zitiert werden, sind mit (Autor: Titel) aufgeführt. Wenn nicht anders angegeben, sind die Hervorhebungen in längeren Zitaten immer im Original. Wo Hervorhebungen getilgt oder ergänzt wurden, wird das vermerkt. Bei Zitaten einzelner Wörter und wiederkehrender Ausdrücke wurden Hervorhebungen im Original in der Regel getilgt. Die Unterscheidung zwischen wörtlichem Zitat und Markierung eines Wortes wird mit doppelten und einfachen französischen Anführungszeichen wiedergegeben: »Zitat«, ›Markierung‹. *** Die Beiträge in diesem Band gehen auf eine Tagung zurück, die vom 10. bis 13. März 2011 am Lichtenberg-Kolleg der Georg-August-Universität Göttingen stattfand. Wir danken allen Teilnehmern des Workshops für ihren Beitrag zum Gelingen der Tagung und für ihre Beiträge zu diesem Band. Wir bedanken uns außerdem bei der Direktorin des Kollegs, Frau Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen, für die großzügige Förderung durch das Kolleg und die Gewährung eines Druckkostenzuschusses für diesen Band. Für ihre tatkräftige und kompetente Unterstützung bei der Organisation und Durchführung danken wir außerdem den Mitarbeitern des Kollegs, insbesondere Herrn Dr. Dominik Hünniger und Frau Turan Lackschewitz, M.A. 34 Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig Der Fritz-Thyssen-Stiftung danken wir für die finanzielle Förderung der Tagung. Für die Finanzierung einer Hilfskraft danken wir der Abteilung Philosophie der Universität Bielefeld und besonders Herrn Prof. Dr. Martin Carrier. Herrn Florian Pahlke danken wir für das Erstellen des Index. Herrn Armin Schneider, M. A. danken wir für die vorbildliche redaktionelle Begleitung der Publikation. Göttingen, im September 2012 Über Kants These: »Denn, sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten« Dietmar H. Heidemann Einleitung An einer für die Auflösung der Freiheitsantinomie zentralen Stelle behauptet Kant: »Denn, sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten« (A 536 / B 564)1. Diese These, im Folgenden ›Unrettbarkeitsthese‹ genannt, wiederholt Kant in anderen Werken sowie in Briefen und Reflexionen in gleicher oder ähnlicher Form. Wäre die Unrettbarkeitsthese wahr, so hätte dies nach Kant schwerwiegende Konsequenzen. Denn wären Erscheinungen tatsächlich Dinge an sich, so müsste nicht nur Freiheit aufgegeben werden, sondern mit ihr verlören zugleich »die moralischen Ideen und Grundsätze alle Gültigkeit« (A 468 / B 496) und das hieße Moralität würde faktisch unmöglich. In der Kritik der praktischen Vernunft vergleicht Kant eine Welt, in der Erscheinungen Dinge an sich selbst sind, daher auch mit einer ausschließlich nach mechanischen Gesetzen funktionierenden Marionettenwelt. In einer solchen Welt wäre der »Mensch […] Marionette, oder ein Vaucansonsches Automat, gezimmert und aufgezogen von dem obersten Meister aller Kunstwerke«. Selbst wenn man einem solchen »Automat« »Selbstbewußtsein« zuschreiben wollte, so würde man ihn »zwar zu einem denkenden Automate machen, in welchem aber das Bewußtsein seiner Spontaneität, wenn sie für Freiheit gehalten wird, bloße Täuschung wäre«. Denn ein solcher »Automat« wäre, so Kant, nicht wirklich, sondern nur »nur komparativ« frei zu nennen, weil alle Verursachung seiner »Bewegung« »gänzlich in einer fremden Hand angetroffen wird« (V, 101). Der Bedrohung der Moral im Szenario der Vaucansonschen Marionettenwelt begegnet Kant mit der Konzeption transzendentaler Freiheit. Transzendentale oder, wie sie auch heißt, »kosmologische« Freiheit, ist »das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen« (A 533 / B 561) und als solche ist sie Bedingung der Möglichkeit moralischen Handelns. Wirklich frei ist der menschliche Wille nur, wenn er transzendental frei ist und sich als vom »durchgängigen Zusammenhange aller Be1 Die Kritik der reinen Vernunft wird zitiert nach der Ausgabe von Timmermann 1998 (A für die erster Auflage, B für die zweite Auflage). Alle übrigen Werke etc. Kants werden in zum Teil modernisierter Schreibweise mit Angabe der Band- und Seitenzahlen zitiert nach: Gesammelte Schriften. Hg.: Band I–XXII Preußische Akademie der Wissenschaften, Band XXIII Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Band XXIV Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ff. 36 Dietmar H. Heidemann gebenheiten der Sinnenwelt, nach unwandelbaren Naturgesetzen« (A 536 / B 564) unabhängig denkt. Für die Einführung eines von Naturkausalität unabhängigen Spontanvermögens zur Rettung von Freiheit und Moral scheint Kant einen hohen metaphysischen Preis zahlen zu müssen. Denn da für transzendentale Freiheit in der Natur kein Platz ist, bedarf es offensichtlich einer nicht von mechanischen Gesetzen regierten zweiten Welt intelligibler Kausalität, in der dieses Vermögen angesiedelt ist. Zwei Fragen stehen dabei traditionell im Fokus der Debatte: Erstens, ob Kant seine Moralphilosophie nur auf Kosten einer Zweit-Welten-Hypothese verteidigen kann, sowie zweitens, ob die metaphysisch höchst anspruchsvolle Annahme zweier Welten überhaupt haltbar wäre.2 Im Folgenden soll anhand der Analyse der Unrettbarkeitsthese gezeigt werden, dass Kant seiner Ethik keine Zwei-Welten-Lehre zugrunde legt, sondern dass er transzendentale Freiheit als Bedingung der Möglichkeit moralischen Handelns in seiner Moralphilosophie im Rahmen einer Eine-Welt-Theorie etablieren kann. Zunächst wird im ersten Abschnitt der transzendentale Realismus als diejenige Theorie identifiziert, die sich hinter der Unrettbarkeitsthese verbirgt. Denn Kant ist der Auffassung, dass der transzendentale Realismus, demzufolge »Erscheinungen […] Dinge an sich selbst« sind (A 369), die metaphysische Voraussetzung der Antinomien und das heißt auch der Freiheitsantinomie bildet. Der zweite Abschnitt expliziert, dass die Unrettbarkeitsthese dabei keine These über die Erkenntnis von Dingen an sich als Noumena ist, sondern eine mögliche Welt fingiert, in der die kritische Erkenntnisrestriktion nicht gilt, so dass die Inkompatibilität von Natur und Freiheit mit der Konsequenz der Unrettbarkeit der Freiheit notwendig folgt. Wie der dritte Abschnitt darlegt, muss der transzendentale Realist deshalb als Inkompatibilist verstanden werden, weil er gezwungen ist, empirische Dinge und damit auch Handlungen als im physikalischen Sinne an sich bestimmt anzusehen. Gegen die metaphysische Bestimmtheitsthese des transzendentalen Realisten zeigt der transzendentale Idealist, dass die Gegenstände unserer Erfahrung hinsichtlich der ihnen tatsächlich zukommenden Eigenschaften nicht an sich bestimmt, sondern unbestimmt, wenn auch durch den Verstand gemäß subjektiven Erkenntnisbedingungen bestimmbar sind. Handlungen als Ereignisse in der Natur, das heißt als Erscheinungen, sind daher nicht an sich selbst bestimmt, sondern bestimmbar und können als zugleich frei und determiniert gedacht werden. Für diese Möglichkeit der Vereinbarkeit von Natur und Freiheit lässt sich auf der Grundlage einer Welt, nämlich der Welt der Erscheinungen argumentieren. Das heißt, in seiner Moralphilosophie sieht sich Kant nicht gezwungen, zwei Welten vorauszusetzen, die Welt der Freiheit und die Welt der Natur. Im Gegenteil, moralische Agenten sind in transzendentaler Bedeutung freie Bürger einer, nicht zweier Welten. 2 Vgl. zum Beispiel die Diskussion bei Allison 2006, hier 16–18, sowie Allison 1996. Über Kants These: »Denn, sind Erscheinungen Dinge …« 37 1. Vernunftantinomie und transzendentaler Realismus Transzendentale Realisten setzen nach Kant voraus, dass Erscheinungen Dinge an sich selbst sind. Im Abschnitt »Der transzendentale Idealism, als der Schlüssel zur Auflösung der kosmologischen Dialektik« der »Antinomie der reinen Vernunft« heißt es: »Der Realist in transzendentaler Bedeutung macht aus [den] Modifikationen unserer Sinnlichkeit an sich subsistierende Dinge, und daher bloße Vorstellungen zu Sachen an sich selbst« (A 491 / B 519). Dass im Kontext der Antinomienauflösung die Rede auf den transzendentalen Realismus kommt, hat einen guten Grund. Schließlich macht Kant die Generalthese des transzendentalen Realisten, Erscheinungen seien Dinge an sich, als die ausschlaggebende Prämisse aus, unter deren Voraussetzung die reine Vernunft sich überhaupt in Antinomien verstrickt, die dann durch den transzendentalen Idealismus aufgelöst werden. Zwar handelt es sich bei der »Antithetik der reinen Vernunft« um einen »Widerstreit der dem Scheine nach dogmatischen Erkenntnisse«, der auf die »Natur der Vernunft« selbst zurückgeht; doch entsteht dieser »Widerstreit« allein dadurch, dass die Vernunft über die »Grenze« der Erfahrung hinaus nach Erkenntnissen strebt (A 420 f. / B 448 f.). Die Vernunft, in ihrem natürlichen Hang, die »absolute Totalität in der Synthesis der Erscheinungen« (A 407 / B 434) erreichen zu wollen, operiert dabei auf der Grundlage des Prinzips: »wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die Summe der Bedingungen, mithin das schlechthin Unbedingte gegeben« (A 409 / B 436). Gemäß diesem Prinzip geht sie aus von gegebenen Erscheinungen und fordert die absolute Vollständigkeit der Bedingungen des Gegebenen. Die Systematisierung dieser Forderung auf der Folie der Kategorienordnung ergibt dann vier spezifische kosmologische Ideen, denen entsprechend sich vier Antinomien aufstellen lassen. Um nämlich das Bestehen des Bedingten erklären zu können, so konzipiert es Kant, postuliert die Vernunft in diesen Ideen durch die Produktion von Bedingungsreihen das Unbedingte. Bei der Aufstellung dieser Bedingungsreihen im Hinblick auf das jeweils Unbedingte gerät sie jedoch unvermeidlich in einen inneren »Widerstreit«, in die »Antithetik« widerstreitender Behauptungen über das Unbedingte solcher Reihen (A 420 / B 449). Denn bei Bedingungsreihen kann es zwei Arten des Unbedingten geben, nämlich das erste unbedingte Glied der Bedingungsreihe und die selbst unbedingte Totalität aller Bedingungen. So sieht sich die Vernunft schließlich vier »Antinomien« gegenüber, von denen in der dritten die »Thesis« – dass es neben Naturkausalität auch Kausalität aus Freiheit gibt – der »Antithesis« – wonach es in der Welt keine Kausalität aus Freiheit, sondern nur Naturkausalität gibt – entgegengesetzt ist. Hierbei handelt es sich um eine echte Antinomie, weil für »Thesis« und »Antithesis« jeweils scheinbar gleich gute apagogische Beweise geführt werden können, obwohl beide Behauptungen für die dogmatische Vernunft nicht zugleich wahr beziehungsweise falsch sein können. In der dritten, der Freiheitsantinomie, setzt der »Beweis« der Thesis zunächst die Antithesis, nämlich dass es »keine andere Kausalität, als nach Gesetzen der Natur« (A 444 / B 472) gibt. Diese Annahme widerspreche sich selbst, weil sie zu einem unendlichen Regress der Ur- 38 Dietmar H. Heidemann sachen führe, durch den keine Ursache hinreichend bestimmt werden könne, was durch Naturkausalität aber gefordert sei. Die Wahrheit der Thesis sei so indirekt durch Widerlegung des Gegenteils erwiesen. Entsprechend setzt der »Beweis« der Antithesis zunächst die Thesis, derzufolge es Kausalität aus Freiheit, das heißt den Selbstanfang einer »Reihe von Folgen« (A 446 / B 474) in der Natur gebe, voraus. Dies aber widerspreche überhaupt dem Sinn der auch in der Thesis angenommenen Kausalverbindung von Ursache und Wirkung, so dass ihr Gegenteil, die Antithesis, wiederum indirekt erwiesen sei. Obwohl die »kosmologischen Ideen« »Produkt der reinen Vernunft« (IV, 338) sind, treten die Antinomien doch nicht unter beliebigen Bedingungen, sondern allein unter der aus Kants Sicht unhaltbaren Voraussetzung auf, dass Erscheinungen Dinge an sich sind: »Wenn wir, wie es gewöhnlich geschieht, uns die Erscheinungen der Sinnenwelt als Dinge an sich selbst denken; wenn wir die Grundsätze ihrer Verbindung als allgemein von Dingen an sich selbst und nicht bloß von der Erfahrung geltende Grundsätze annehmen, wie denn dieses eben so gewöhnlich, ja ohne unsre Kritik unvermeidlich ist: so tut sich ein nicht vermuteter Widerstreit hervor.« (IV, 339 f.) Die Generalthese des transzendentalen Realismus, Erscheinungen seien Dinge an sich, fungiert folglich als Erklärungsgrundlage für das Zustandekommen des jeweiligen Widerstreits zwischen Thesis und Antithesis in allen vier Antinomien. Unter Voraussetzung des transzendentalen Realismus lassen sich demnach gleich gute Beweise für die Thesis wie für die Antithesis führen, also in der Freiheitsantinomie für die Thesis: ›Einiges geschieht durch Kausalität aus Freiheit‹ sowie für die Antithesis: ›Alles geschieht aus Naturkausalität‹. Dabei kann für den transzendentalen Realisten entweder nur die Thesis oder nur die Antithesis wahr sein. Insofern bildet der transzendentale Realismus die Voraussetzung der Antinomien. In der »Kritischen Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft« streicht Kant ausdrücklich die »Wichtigkeit« der Erkenntnis heraus, dass sich die »Beweise der vierfachen Antinomie« nur ergeben »unter der Voraussetzung nämlich, daß Erscheinungen oder eine Sinnenwelt, die sie insgesamt in sich begreift, Dinge an sich selbst wären« (A 507 / B 535).3 Insofern lässt sich nachvollziehen, warum Kant behauptet, dass die »Antinomie der reinen Vernunft«, die die Konsequenzen des transzendentalen Realismus reflektiert, als indirekter Beweis des transzendentalen Idealismus gelten kann. Denn mit der Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich im transzendentalen Idealismus können Kant zufolge die Antinomien vermieden werden.4 Aus diesem Grund lässt sich der transzendentale Realismus 3 Noch in der Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik heißt es, dass die »Verwechselung der Erscheinungen mit den Dingen an sich selbst« die »Antinomie der reinen Vernunft« »bewirkt« (XX, 311). Vgl. auch Prolegomena IV, 343. 4 Vgl. A 506 / B 534. Kant erachtet den transzendentalen Idealismus indirekt durch Wi-