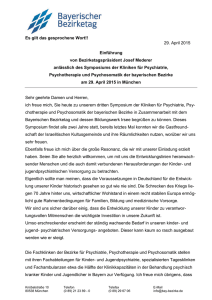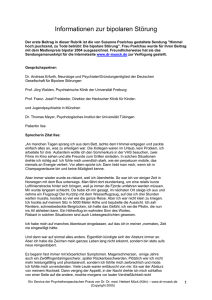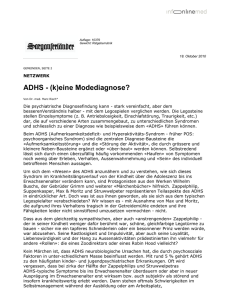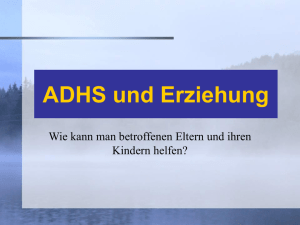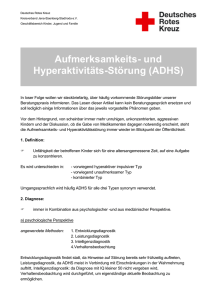Professor Dr. med. Franz Joseph Freisleder Ärztlicher Direktor
Werbung

Sendung vom 26.11.2014, 20.15 Uhr Professor Dr. med. Franz Joseph Freisleder Ärztlicher Direktor Heckscher-Klinikum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Gespräch mit Sabrina Staubitz Staubitz: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim alpha-Forum. Die 13-jährige Martha treibt täglich Sport, kapselt sich ab, hungert, wird immer dünner. Der 14-jährige Mark verbringt jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden am Computer, und zieht sein Papa den Stecker, dann wird er wütend und schlägt um sich. Beide besorgten Eltern fragen sich: "Ist das noch normal? Oder ist unser Kind anders als die anderen?" Antworten auf diese Fragen zu geben, das versucht mein heutiger Gast, Professor Dr. Franz Joseph Freisleder. Er hat zusammen mit Harald Hordych das Buch geschrieben: "Anders als die anderen. Was die Seele unserer Kinder krank macht." Herr Freisleder, Sie sind einer der bekanntesten Kinder- und Jugendpsychiater Deutschlands und außerdem Ärztlicher Direktor der Heckscher-Klinik hier in München mit weiteren Abteilungen in Oberbayern. Herzlich willkommen, Herr Freisleder. Freisleder: Grüß Gott. Staubitz: Herr Professor, Sie sagen, jedes Kind, wirklich jedes Kind kann psychisch erkranken, egal wie glücklich, wie geliebt es aufwächst. Das ist ja zunächst einmal eine relativ niederschmetternde Erkenntnis. Wie reagieren denn die meisten Eltern auf diese Botschaft? Freisleder: Das soll nicht niederschmetternd klingen, sondern einfach ein Bild davon geben, dass es wirklich jedes Kind treffen kann, und zwar deshalb, weil es für die Entwicklung einer psychischen Störung in der Regel nicht nur eine Ursache gibt, sondern weil es dafür zu einem Zusammenwirken von vielen Faktoren kommen muss. Natürlich spielt die Umwelt, spielen die Rahmenbedingungen, in denen ein Kind lebt, eine große Rolle bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Aber es gibt bei vielen Störungsbildern eben auch innere Komponenten, genetische Aspekte. Wir sprechen dann von erhöhter Vulnerabilität für die Entwicklung einer Störung. Da kann also die Umgebung gar nichts dafür. Sie kann vielleicht solche Faktoren ein bisschen abbremsen und nivellieren. Aber es trifft insofern doch zu, dass das jedes Kind irgendwie treffen kann. Staubitz: Das ist also für die Eltern ein bisschen entlastend gemeint, damit sie sich nicht immer selbst die Schuld geben. Denn genau das passiert ja oft. Sie haben soeben von den vielen Faktoren gesprochen. Es gibt Schutzfaktoren, die ein Kind vielleicht eher stärken, und es gibt Risikofaktoren wie z. B. eine Veranlagung, eine genetische Disposition. Können Sie denn die wichtigsten Faktoren kurz nennen, also die Schutzfaktoren und die Risikofaktoren? Und könnten Sie das vielleicht auch jeweils an einem Beispiel festmachen? Freisleder: Die Diskussion darüber, dass es viele Risikofaktoren gibt, die Kinder und Jugendliche psychisch krank werden lassen, haben wir lange geführt. Dabei haben wir aber vergessen, dass es glücklicherweise auf der anderen Seite aber auch eine Menge von Aspekten gibt, die ein Kind, ein möglicherweise gefährdetes Kind bzw. einen gefährdeten Jugendlichen vor der Entwicklung einer psychischen Störung bewahren. Da kommt es eben darauf an, wie die Dinge ineinandergreifen, was überwiegt. Was sind Schutzfaktoren? Nehmen wir als Beispiel ein Kind, das eine gewisse genetische Gefährdung hat für die Entwicklung einer Psychose, einer Sucht. Wenn dieses Kind in einer Umgebung aufwächst, die sehr aufmerksam mit ihm umgeht, die mit einem präventiven Auge seine Entwicklung verfolgt und bei ersten Alarmzeichen mit guten pädagogischen Mitteln dagegensteuert, wenn dieses Kind in einer harmonischen Familie aufwächst, in der es vielleicht sogar noch einen Mehrgenerationenhaushalt gibt, wo also neben den Eltern noch eine engagierte Tante oder Oma da ist, dann ist das ein guter Schutzfaktor. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch bedenken, dass es in der Umwelt, in der Schule, in der nächsten Umgebung, im Freundeskreis eine Menge von schädigenden Aspekten geben kann, die so ein Kind eben doch in eine psychische Störung hineintreiben. So kommt es immer darauf an, wie die Dinge ineinanderwirken. "Multifaktorielle Syndromgenese" ist der entsprechende medizinische Ausdruck an dieser Stelle. Staubitz: Ich bin froh, dass Sie dieses Wort ausgesprochen haben, denn ich hätte es nicht unfallfrei über die Lippen gebracht. Sie haben das jetzt sehr anschaulich klar gemacht. Weil Sie sagen, dass man wachsam sein soll, dass man das eigene Kind sehr genau beobachten soll: Gibt es denn auch viele überbesorgte Eltern, die zu Ihnen kommen, weil ihr Kind einen Tick hat oder sie den Eindruck haben, ihr Kind bekomme überproportional häufig Wutanfälle? Sagen Sie diesen Eltern dann, dass das alles nicht so schlimm sei? Freisleder: Da Sie von überfürsorglichen Eltern sprechen: Eltern können gar nicht fürsorglich genug sein. Sie sollen natürlich keine sogenannten HelikopterEltern sein, die ständig und zwanghaft über ihrem Kind kreisen und jede Bewegung registrieren wollen. Aber lieber einmal zu früh und zu viel gefragt, wenn eine psychische Auffälligkeit Eltern irritiert. Glücklicherweise ist es jedoch so, dass wir Eltern, wenn sie irgendein Problem ihres Kindes skizzieren, gar nicht so selten beruhigen können, dass wir ihnen sagen können: "Wartet mal ab, schaut euch mal diese Auffälligkeit ruhig noch eine Weile an." Sie erwähnten gerade den Tick: So ein Blinzeltick oder ein Zucken des Augenlids kommt gar nicht so selten vor. Gar nicht so wenige Kinder in einer bestimmten Entwicklungsphase haben so einen Tick, der sich dann aber auch wieder verliert. Auch wenn ein Mädchen in der beginnenden Pubertät bzw. mitten in der Pubertät auf einmal sehr auf seine Linie achtet und sich im Freundinnenkreis mit anderen zusammentut und verschiedene Diäten ausprobiert, dann ist das in einem gewissen Umfang alles noch ganz normal. Problematisch wird es dann, wenn dieses Thema immer wichtiger wird, wenn andere Lebensbereiche immer mehr in den Hintergrund geraten. Das ist dann eben manchmal eine regelrechte Gratwanderung: Die Eltern brauchen da ein gutes Gefühl dafür, wann sie wen mal um Rat fragen und ob sie vielleicht auch mal einen Kinder- und Jugendpsychiater oder Kinderarzt zur Rate ziehen, wenn sie selbst nicht mehr weiterwissen. Staubitz: War das für Sie vielleicht auch mit ein Anlass dafür, dieses Buch zu schreiben? Darf man es vielleicht auch so ein bisschen als einen Aufklärungsratgeber für Bezugspersonen, für Eltern, für Lehrer verstehen? Freisleder: Es gibt ja Hunderttausende von Erziehungsratgeber, in denen mal mehr, mal weniger griffige und gute Konzepte den Eltern vorgestellt werden. Die Eltern wissen dann oft gar nicht mehr, an was sie sich eigentlich halten sollen. Ich muss sagen, dass es in diesem Fall die Idee des Verlags gewesen ist, auf mich und Harald Hordych, den Journalisten, der dieses Projekt mit mir zusammen gemacht hat, zuzugehen. Der Verlag hat zu uns gesagt: "Schildert das alles doch mal aus der Perspektive eines in einer großen Versorgungsklinik tätigen Kinder- und Jugendpsychiaters. Schildert eure Arbeit, schildert, wie sich solche Krankheitsfälle entwickeln können. Schildert sie bitte aus dem Alltag heraus, wie sie entstehen, bis so ein Kind dann eines Tages bei euch vor der Tür steht und ihr Ärzte und Psychologen und Pädagogen usw. eine Therapie plant oder andere Ideen habt." So haben wir eben zehn Fälle von Kindern entwickelt, die es so in der Realität aber gar nicht gibt. Staubitz: Das heißt, diese Charaktere sind alle fiktiv? Freisleder: Diese Fälle sind von uns entwickelt und geformt worden, sind also insofern fiktiv. Aber in sie fließt eben auch eine nicht ganz kurze, nämlich mehr als 25 Jahre lange Erfahrung im Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie ein. Der eine oder andere Teilaspekt eines Falls, den wir schildern, hat sich genau so ereignet. Aber es soll sich natürlich in diesem Buch niemand wiedererkennen können. Es gibt also keinen einzigen Jugendlichen so, wie wir ihn geschildert haben. Aber es könnte ihn geben, das darf ich Ihnen wirklich versichern. Staubitz: Sie wollten also sozusagen die Essenz aus Ihren Erfahrungen bündeln, aber Sie wollten auch niemandem zu nahe treten, der sich als echter Patient vielleicht angesprochen fühlen könnte. Freisleder: Zweitens wollten wir mit diesem Buch versuchen, den Eltern auch mal plastische Beispiele zu geben, wie sich so eine psychische Störung im familiären Alltag entwickelt, wie so ein Problem ganz am Anfang auftaucht, sich verdichtet und immer schlimmer wird – oder manchmal auch nur übertriebene Sorgen hervorruft. So haben wir diese Fälle aufgebaut. Staubitz: Ich als Laie fand dieses Buch wirklich sehr gut lesbar. Sie haben die jeweiligen Krankheitsbilder auch jedes mit einer Gliederung klar strukturiert aufgebaut. Da gibt es jeweils einen ersten Teil, in dem das Ganze aus der Sicht der Betroffenen geschildert wird: Hier kommen das Kind, die Eltern und vielleicht auch der Lehrer usw. zu Wort. Danach kommt es zu einer Begegnung mit Ihnen – fiktiv natürlich, aber sie hätte so stattfinden können. Sie stellen dabei auch eine Diagnose. Und im dritten Teil gibt es dann noch eine Zusammenfassung, bei der das Krankheitsbild noch einmal erläutert wird und in der die Ursachen, aber auch die Chancen, die man dabei haben kann, aufgezeigt werden. Für unsere Zuschauer ist es ja, um den Ton in Ihrem Buch auch ein bisschen zu fassen zu kriegen, vielleicht ganz interessant, wenn ich einfach mal ein Beispiel herausgreife, wenn Sie erlauben. Da gibt es "Charlotte", ein Mädchen, das an Magersucht leidet. So befürchtet es jedenfalls die Familie. Dabei kommt es zu folgender Situation. Die Familie sitzt am Frühstückstisch: Charlotte, ihre Schwester Regina und die Mutter. Es kommt dann, nicht zuletzt deswegen, weil Charlotte mal wieder nicht frühstücken möchte, zu diesem Dialog: "Charlotte: 'Ich mache mir ein Müsli, das geht schneller.' Hält inne. 'Ach, wisst ihr was, ich hole mir schnell eine belegte Semmel vor der ersten Stunde, wenn ich noch Zeit habe.' Regina: 'Du hast noch ganz viel Zeit.' Charlotte: 'Pass lieber auf, dass du nicht so ein Pummelchen wirst, wie ich es früher war.' Mutter: 'Wer war denn pummelig?' Charlotte: 'Ich, das hast du doch immer zu mir gesagt: Pummelchen!' Mutter: 'Aber Charlotte!' Es klingt kläglich." Was ist denn jetzt an dieser Familienszene typisch für dieses Krankheitsbild? Freisleder: Diese Szene – aus dem Kontext gegriffen – würde ich noch gar nicht so pathologisieren wollen. Die Szene, die Sie vorgelesen haben, könnte sich ja auch in normalen Familien abspielen. Aber es soll eben ein Hinweis darauf sein, dass hier ein Thema immer mehr in den Mittelpunkt gerät: Es wird permanent über das Essen gesprochen. Staubitz: Genauer gesagt, über das Vermeiden von Essen. Freisleder: Genau, über das Essen und über das Vermeiden von Essen. Die Szene soll zeigen, dass hier eine Mutter besonders irritiert anspringt auf bestimmte Auffälligkeiten ihrer Tochter. Damit sind wir nun genau bei der Stelle, von der Sie vorhin gesprochen haben: am Anfang eines Teufelskreises. Denn wenn man diese Geschichte weiterliest, wird man sehen, wie sich die Geschichte mit Charlotte immer mehr verschlimmert, verdichtet, um dann in diesem Fall in ein schweres Krankheitsbild zu münden. So eine Szene, wie sie sich hier am Frühstückstisch abgespielt hat, treffen wir jedenfalls im Vorfeld einer anorektischen Symptomatik öfter an. Staubitz: In diesem Buch wechseln Sie stilistisch so ein bisschen hin und her und es gibt auch innere Monologe der Betroffenen. Daraus vielleicht eine weitere kleine Passage von Charlotte: "Als sie einmal ein starkes Hungergefühl verspürt, isst sie ein Stück Diätbrot, das noch in ihrer Tasche steckt. Das Hungergefühl ist sofort weg. Stattdessen beschleicht sie ein schlechtes Gewissen. Sie hat sich gehen lassen: 'Naschen wie ein Vorschuldkind!'" Man bekommt auf diese Weise mit, wie hart und unerbittlich Charlotte gegen sich selbst ist. Warum ist denn diese enorme Selbstkontrolle offensichtlich gerade für dieses Krankheitsbild so wichtig? Freisleder: Diese Selbstkontrolle ist nicht so wichtig im Hinblick auf das Krankheitsbild, aber wir treffen diese Charaktereigenschaft oft an: diese Strenge sich selbst gegenüber, dieses Bedürfnis nach Korrektheit, nach Überkorrektheit, nach hohen Anforderungen, die man an sich stellt. Das ist in der Tat ein Wesenszug, den wir bei anorektischen Mädchen öfter feststellen. Es gibt übrigens auch gar nicht so wenige männliche Jugendliche, die diese Problematik haben. Staubitz: Es werden wohl immer mehr, oder? Freisleder: Ja, das werden mehr. Vor 10, 20 Jahren hatten wir die Jungs mit so einer Problematik noch gar nicht so im Blickfeld. Aber diese Strenge im Umgang mit sich selbst, dieser Perfektionismus, diese Zwanghaftigkeit: Das ist etwas, das wir bei vielen Jugendlichen immer wieder feststellen, die eine Essstörung entwickeln oder die in einer bereits manifesten Essstörung stecken. Staubitz: Und die Eltern sind zunächst einmal sogar recht angetan von diesem Perfektionismus, denn das Kind bringt ja hervorragende Noten nach Hause, ist immer so ordentlich und das Zimmer ist immer so aufgeräumt. Aus diesem Grund läuft das erst einmal eine ganze Weile so dahin. Freisleder: Ja, das ist diese Selbsttäuschung, der sich auch Eltern hingeben, wenn bei dem betroffenen Mädchen scheinbar alles klappt. Aber das ist eben nur scheinbar so, auch wenn sie nur beste Noten nach Hause bringt und in der Schule alles wie am Schnürchen klappt. Aber wenn die Eltern, wenn das Umfeld wirklich genau hinschaut, dann merkt man eben doch, dass es trotz dieser äußeren guten Leistungen zu einer Stimmungsverschlechterung und zu einer Gewichtsabnahme kommt, dass sich das Mädchen immer mehr zurückzieht und sich neben dem Körpergewicht nur noch mit der Schule, den schulischen Leistungen und z. B. den eigenen sportlichen Leistungen beschäftigt, während es den Kontakt zu den anderen Jugendlichen im gleichen Alter verliert. Zunächst mag das also ganz toll wirken, aber irgendwann merkt man eben doch: "Oh, da stimmt was nicht mit meiner Tochter!" Staubitz: Selbst in den anstrengendsten Phasen, die man mit Kindern erlebt, gibt es ja normalerweise zwischendurch auch immer wieder mal so ein Leuchten in deren Augen, so einen unglaublichen Ausbruch an Lebensfreude. Wenn das jedoch über längere Zeit nicht mehr vorkommt, dann hat man Grund, ein bisschen besorgt zu sein. Wie reagieren denn Eltern in der Regel auf eine entsprechende Diagnose? Die Eltern wollen ja sicherlich zuerst einmal hören, dass ihr Kind wieder ganz gesund, wieder vollkommen genesen wird. Was können Sie den Eltern da sagen, was müssen Sie da teilweise den Eltern sagen? Freisleder: Gerade wenn wir von Essstörungen, von der Anorexie sprechen, ist es schon wichtig, dass wir diese Diagnose so früh wie möglich stellen, dass wir also dieses Krankheitsbild so früh wie möglich erkennen können. Wir müssen aber auch, und das muss man eben einschränkend immer hinzufügen, berücksichtigen, dass nicht jedes auffällige Essen gleich eine Essstörung ist. Das ist eben ein fließender Übergang und deswegen braucht es da wirklich den Fachmann, die Fachfrau, um das zu erkennen. Wenn diese Diagnose dann gesichert ist, wenn also bestimmte diagnostische Kriterien erfüllt sind, dann ist es vielleicht noch wichtiger, die Patientin, den Patienten zu überzeugen, als das den Eltern klar zu machen. Das gilt auch dann, wenn die oder der Jugendliche erst 14, 15 Jahre alt ist: Sie bzw. ihn müssen wir gewinnen, sie bzw. er muss mit uns zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich klar, dass in dieses therapeutische Arbeitsbündnis auch die Eltern mit aufgenommen werden müssen. Zu dem, was wichtig ist, könnte man natürlich viel sagen. Wichtig bei der Anorexie wie auch bei vielen anderen psychischen Störungen ist vor allem, dass man den Beteiligten, also dem Kind und den Eltern, diese Schuldgefühle nimmt. Es darf vom Arzt oder vom Therapeuten auf keinen Fall die Botschaft kommen: "Das kommt daher, weil du deine Tochter schlecht behandelt hast." Staubitz: "Weil du selbst dauernd Diät machst, da ist es kein Wunder, dass dein Kind magersüchtig wird." Freisleder: Genau. Das darf nicht sein. Denn für eine Krankheit ist niemand irgendwie anzuklagen, sondern sie ist zu erkennen und anzunehmen. Und dann versucht man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das gesamte System um so einen Jugendlichen herum mit einzubeziehen: In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das wirklich ganz besonders wichtig. Im Zentrum steht der Patient, aber sehr nahe am Patienten, am Betroffenen steht seine Familie, stehen seine Eltern – sofern vorhanden – und auch seine Geschwister, die auf keinen Fall aus den Augen gelassen werden dürfen. Das System, das um den Erkrankten herum ist, muss mit einbezogen werden. Und dann überlegt man – wir haben ja am Anfang schon von den multifaktoriellen Ursachen gesprochen –, welche einzelnen Gründe bei genau dieser Patientin, bei diesem Patienten eine maßgebliche Rolle spielen. Diese Gründe versucht man klar zu erkennen und sie auszudifferenzieren. Dann überlegt man, wie man an die Konflikte herankommen kann. Bei der Essstörung besteht nach dem Stellen der Diagnose und der Initiierung therapeutischer Maßnahmen – so banal das auch klingen mag – das Wichtigste darin, das Gewicht langsam zu stabilisieren. Das heißt, das Gewicht darf auch nicht zu schnell wieder nach oben gehen. Man versucht so etwas ja zunächst immer im ambulanten Rahmen zu machen. Aber gerade bei den Fällen, die wir in der Klinik sehen, ist die Krankheitsvorgeschichte bereits länger. Deshalb gebe ich immer den Hinweis: Lieber zu früh als zu spät an die stationäre Aufnahme eines Jugendlichen denken! Neben der Gewichtszunahme geht es dann am Anfang auch um unterschiedliche psychotherapeutische Maßnahmen, die z. B. einem Mädchen und dessen Familie wieder mehr Rückhalt geben und dessen Weg in eine gesunde Entwicklung stützen. Staubitz: Dass Sie nicht nur bei Magersüchtigen mit der ganzen Familie arbeiten, finde ich sehr interessant. Sie ziehen da nicht die Betroffene isoliert heraus, sondern arbeiten auch mit den Eltern und den Geschwistern. Denn für die Geschwister ist es ja u. U. auch nicht so leicht, wenn dieses eine Geschwister permanent derart im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Freisleder: Genau. Staubitz: Die Geschwister müssen also auch erst lernen, mit dieser Situation umzugehen. Was ich mir aber wirklich als sehr schwer vorstelle, ist, bei den betroffenen Heranwachsenden die nötige Einsicht hinzubekommen. Denn es ist ja schon unglaublich schwer, zu "normalen" Pubertierenden einen Zugang zu finden. Ich stelle es mir daher als große Herausforderung vor, dies dann in solch extremen Situationen zu erreichen. Freisleder: Ja, das ist bereits mit den, wie Sie sagen, normalen Pubertierenden – das wissen wir von unseren eigenen Kindern – nicht immer ganz leicht. Da ist man im Alltag u. U. schon auch sehr gefordert. Der Vorteil im Umgang mit Patienten besteht vielleicht in dem gewissen Abstand, den man zu dem betreffenden Jugendlichen vielleicht doch eher hat. Denn das macht es ja Eltern so schwer, wenn ihr Kind eine psychische Erkrankung entwickelt: Irgendwann sind sie dem nicht mehr gewachsen, das nimmt sie selbst so mit, dass sie die Orientierung verlieren. In solchen Situationen brauchen die Eltern dann eine professionelle Hilfe von außen. Und das tut der Situation dann auch gut, denn das entspannt die Situation. Das geschieht beispielsweise durch die Initiierung einer ambulanten Therapie, wenn der auffällige, der problematische Jugendliche meinetwegen einmal in der Woche einen Kinder- und Jugendpsychiater oder einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als Ansprechpartner hat. Wir sprachen ja gerade von schweren anorektischen Patientinnen: Es entspannt die Situation ebenfalls, wenn so eine Jugendliche mal für ein paar Wochen nicht zu Hause ist, wenn die Betreuung, die Therapie andere übernehmen und die Eltern, die Familie dadurch etwas entlasten – und diese trotzdem mit im Boot behalten. Staubitz: Wenn eine kleine halb persönliche Frage erlaubt ist: Sie haben ja deswegen eine gute Übung, weil Sie selbst fünf Kinder haben und ... Freisleder: Nein, nur wir beide, also der Harald Hordych und ich haben zusammen insgesamt fünf Kinder. Diesen Kindern haben wir das Buch gewidmet. Ich selbst habe drei Kinder. Staubitz: Das reicht aber auch schon, wie ich finde. Alle Achtung! Ist es denn von Vorteil, wenn man als Kind einen Vater hat, der jede Regung sofort professionell zu deuten vermag? Freisleder: Das kann manchmal in der Tat ein Nachteil sein. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Déformation professionnelle. Da hört man manchmal vielleicht wirklich zu früh die Flöhe husten. Bei Psychiatern und deren Familien ist es ganz gut, wenn es auch einen Ausgleich gibt. Wenn z. B. beide Eltern Psychiater wären, dann wäre das womöglich wirklich too much. Staubitz: Das wäre dann für ein Kind wirklich zu anstrengend. Freisleder: Aber man wächst ja auch mit seinen Kindern. Ich glaube, dass es auch für einen Kinder- und Jugendpsychiater gut ist, wenn er nicht nur seine Patienten hat, sondern auch zu Hause seine üblichen Konflikte und Herausforderungen. Staubitz: Die gibt es also bei Ihnen auch? Das zu wissen, ist sehr erleichternd für uns "Unprofessionelle". Freisleder: Ja, doch, ganz bestimmt. Staubitz: Welche Momente stellen Sie denn in Ihrer Arbeit besonders zufrieden? Wann können Sie in Ihrer Arbeit zwischendurch vielleicht sogar ein bisschen glücklich sein? Freisleder: Erstens ist es so, dass diese Arbeit unheimlich spannend ist. Das fand ich schon, als ich mich während des Studiums mit Kinder- und Jugendpsychiatrie beschäftigt habe. Ich habe ja auch eine Zeitlang in der Neurologie und in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet: Das war auch interessant und stellte auch eine Herausforderung dar. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist eben irgendwie der Aspekt mit dabei, dass ich das Gefühl entwickle: "Hier kannst du noch was machen!" Das geht im Erwachsenenalter schon auch noch, aber bei Kindern und Jugendlichen liegt die Lebenswegstrecke noch vor ihnen und ... Staubitz: ... je früher man eingreift, umso höher ist die Chance für einen Erfolg. Freisleder: Man kann das freilich nicht generell sagen, denn es gibt manche Störungen, die eben gerade deshalb, weil sie sich sehr früh manifestieren, eher eine problematische Prognose haben. Aber wir sehen bei allem Jammern und Klagen über angeblich so viele psychisch auffällige, psychisch kranke Kinder und Jugendliche – das sehe ich übrigens in diesem Ausmaß nicht so – dann doch auch in unserem schwierigen beruflichen Alltag immer wieder Kinder und Jugendliche, die trotz einer schweren Störung, die trotz einer sehr problematischen Vorgeschichte tolle Lebenswege gehen. Sie haben mich gefragt, wann ich mich in beruflicher Hinsicht freue und wann ich glücklich bin. Das ist dann der Fall, wenn man erfährt, dass ein ehedem schwer erkrankter Jugendlicher seine Erkrankung überwinden oder doch weitgehend überwinden konnte und sein Leben meistert, sein Leben gut hinbekommt. Das freut einen dann sehr. Staubitz: Bekommen Sie das deshalb mit, weil da vielleicht manchmal ein Anruf kommt oder eine Ansichtskarte, sodass Sie erfahren: "Ah, dem geht es jetzt gut"? Freisleder: Genau, da kommt plötzlich und überraschend ein Brief, eine Rückmeldung von jemandem, dem es mal sehr schlecht ging. Und da hört man dann, dass er die Kurve gekriegt hat und jetzt glücklich und zufrieden ist, mit seinem Leben zurechtkommt. Das ist etwas sehr Erfreuliches für uns. Staubitz: Daran nehmen Sie dann also schon auch noch Anteil. Freisleder: Ja, klar. Oder man sieht sich noch einmal, trifft sich. Es ist zwar eher selten, dass es solche Begegnungen gibt, aber wenn das der Fall ist, dann gibt einem das wieder Power. Staubitz: Ja, ich kann mir vorstellen, dass einen so etwas dann wieder eine ganze Weile lang trägt. Ich würde gerne noch einmal auf einen Beispielfall aus Ihrem Buch zu sprechen kommen. In diesem Beispiel geht es um die Krankheit ADHS. Das ist ebenfalls ein sehr komplizierter Begriff, denn ADHS ist die Abkürzung von Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Freisleder: Alleine das auszusprechen, ist bereits eine Herausforderung. Staubitz: Ja, das ist eine große Herausforderung. Als Laie hat man ja den Eindruck, dass das so eine Art Modekrankheit ist, weil die Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen so massiv nach oben schnellt. Sind tatsächlich immer mehr Kinder betroffen oder ist das doch eher ein Zeitgeistphänomen? Freisleder: Von all dem, was Sie sagen, stimmt ein bisschen was. Nur wehre ich mich dagegen zu sagen, ADHS sei schlichtweg nur eine Modekrankheit. Denn diese Symptomkonstellation mit dem Aufmerksamkeitsdefizit, der Hypermotorik bzw. der motorischen Unruhe und einem Zuviel an Impulsivität stellt ein Phänomen dar, das es vor 50 und vor 100 Jahren auch schon gegeben hat. Ich nenne hier nur mal den "Zappelphilipp" als klischeehaftes Beispiel. Diese Kinder gibt es und diesen Kindern muss geholfen werden. Und wir können diesen Kindern auch helfen. Was aber allerdings auch zutrifft, ist, dass in den zurückliegenden Jahren an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu großzügig mit dieser Diagnose umgegangen wurde und eigentlich noch normale Verhaltensvarianten von Kindern zu schnell mit dieser Diagnose etikettiert worden sind. Ich will dieses Krankheitsbild überhaupt nicht herunterspielen, denn es gibt wirklich eine Menge solcher Kinder: Drei bis vier Prozent der Kinder können tatsächlich so diagnostiziert werden. Wobei aber auch hier wieder zu beachten ist, dass es da mildere Ausprägungen gibt, mittelgradige und sehr schwere. Da gibt es Kinder – das betrifft vor allem uns in der Klinik –, die neben dem ADHS noch Begleiterkrankungen haben, die irgendwie zusammenhängen. Ein Stichwort hierbei ist die Komorbidität, wenn mehrere Erkrankungen gleichzeitig existieren. Aber es gibt halt auch nicht ganz wenige unruhige Kinder, bei denen die Ursache für ihre Unruhe, für ihr auffälliges Verhalten wirklich hauptsächlich in ihrer Umgebung verankert ist. Das klassische ADHS ist eine Entwicklungsstörung des Gehirns, wenn ich das mal so einfach ausdrücken darf: Es gibt organische Ursachen, die diese Kernsymptome des ADHS bewirken. Wenn so etwas schwer oder auch mittelgradig ausgeprägt ist, wird man immer ein Behandlungskonzept entwickeln, bei dem viele Maßnahmen gebündelt werden. Bei ausprägten Fällen, die oft sehr erfolgreich behandelt werden können, spielt eben auch die medikamentöse Behandlung eine wichtige Rolle – neben anderen Behandlungsformen wie psychotherapeutischen und pädagogischen Maßnahmen. Staubitz: Die Ursachen für das ADHS sind also weitgehend geklärt. Das gängige Erklärungsmodell ist heute diese ... Freisleder: ... neuronale Entwicklungsstörung. Staubitz: Aber es kann eben auch sein, dass noch eine weitere Belastung von außen mit hinzukommt – ein Umzug, eine Scheidung usw. –, sodass diese Krankheit dann eben ausbricht. Freisleder: Man kann nicht direkt davon sprechen, dass sie dann ausbricht, sondern sie verstärkt sich, wird heftiger. Ganz bestimmte äußere Faktoren können also so ein Störungsbild stärker ausprägen. Aber wie ich das schon zu anderen Krankheitsbildern gesagt habe: Man muss immer den Einzelfall des jeweils betroffenen Kindes anschauen, das bestimmte Auffälligkeiten zeigt. Man muss sich auch den familiären Kontext dieses Kindes genau anschauen, um neben einer Diagnose auch einen Therapieplan entwickeln zu können. Dieser kann eben bei jedem Kind etwas anders ausschauen. Gelegentlich geht das ohne Medikament, in einem anderen Fall empfehlen wir längerfristig oder für eine bestimmte Phase und unter fachärztlicher Begleitung auch mal ein Medikament. Jeder Fall ist wirklich anders gelagert. Staubitz: Weil Sie das Medikament gerade angesprochen haben, würde ich gerne auf dieses Mittel Ritalin zu sprechen kommen. Davor aber noch ein kurzes Zitat aus Ihrem Buch von der Mutter von Leon, einem weiteren Beispielsfall: "Mir scheint es so, als sei unser Junge innerlich immer unterwegs, als würde er nie zur Ruhe kommen." Es ist ja tatsächlich so, dass Jungen überproportional häufig betroffen sind. Liegt das bei den Jungen an einer größeren Anfälligkeit oder ist bei den Jungen der Bedarf nach einem gewünschten Normverhalten etwas größer, weil sie nun einmal etwas unruhiger sind? Freisleder: Hier spielen viele Aspekte mit hinein. Das ADHS sehen wir in der Tat bei Jungen häufiger als bei Mädchen. Von Jungen wissen wir auch, dass sie von ihrem Temperament her oft agiler, aktiver sind. Das Zitat dieser Mutter aus dem Buch gibt eigentlich den klassischen Eindruck eines Jungen mit ADHS wieder. Aber dieser Eindruck, diese Schilderung der Mutter rechtfertigen für sich alleine noch nicht diese Diagnose. Bevor wir ADHS diagnostizieren, machen wir eine sehr gründliche, sehr sorgfältige diagnostische Abklärung, eine Statuserhebung usw. Und dann wird eben für jeden Einzelfall überlegt: "Was machen wir jetzt? Welche Faktoren wirken hier zusammen? Wo können wir eingreifen?" In diesem Fall im Buch spielt auch die Schule eine wichtige Rolle. Ich wollte in diesem Buch überhaupt auf die Tatsache hinweisen, dass psychische Erkrankungen eben auch in der Schule auftreten und von Lehrerinnen und Lehrern auch bemerkt werden: Auch die Lehrer tragen also dazu bei, so ein Kind zu diagnostizieren ... Staubitz: Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die die Lehrer hier in Ihrem Buch noch einmal geschildert bekommen. Freisleder: Genau. Die Lehrer leisten Hilfestellung und sind dann ja auch diejenigen, die so ein Kind wieder mit tragen müssen. Darum geht es also auch. Bevor man zu einer solchen Diagnose kommt, trägt man zuerst einmal viele Informationen zusammen. Dann erst sagt man: "So, was machen wir jetzt? Können wir auf ein Medikament verzichten? Oder müssen wir eben doch ein Medikament geben?" Staubitz: Wir kreisen ja jetzt schon eine ganze Weile um das Ritalin herum: Man hat den Eindruck – so ist zumindest der Medientenor –, dass es immer häufiger verschrieben wird, weil die Kinder in ihrem durchgetakteten Alltag eben "funktionieren" sollen. Ist da wirklich was dran? Freisleder: Ganz so, wie Sie das sagen, stimmt es auch wieder nicht. Die Kritik an der medikamentösen Behandlung mit Ritalin – also mit Methylphenidat, wie diese Substanz heißt, die es eben auch unter verschiedenen Namen gibt – kommt ja immer wieder in Wellen. Nach einem zugegeben deutlichen Anstieg der Verschreibungen gegen Ende der 90er Jahre bis ungefähr 2010, 2011 ist es mittlerweile so, dass wir uns wieder in einem diskreten Rückgang der Verordnungshäufigkeit befinden. Staubitz: Der ist aber nur sehr diskret. Freisleder: Man darf dabei einfach nicht vergessen, dass – und auch das ist ein wichtiger Aspekt bei psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter – zu einem nicht geringen Prozentsatz bestimmte Störungen eben auch ins Erwachsenenalter übergehen. Da gibt es das Problem der Transition, denn der betroffene Jugendliche muss dann im Erwachsenenalter von der Erwachsenenpsychiatrie, von einem Erwachsenenpsychotherapeuten weiter betreut werden. Und das trifft eben auch für einen nicht geringen Prozentsatz der ADHS-Patienten zu. Man muss bedenken, dass diese Substanz mit dem Namen Methylphenidat seit geraumer Zeit auch für Erwachsene mit ADHS zugelassen ist. Das trägt natürlich auch mit dazu bei, dass diese Substanz heute insgesamt häufiger verschrieben werden kann als vor einigen Jahren, als sie nur bei Kindern anwendbar war. Staubitz: Da wir schon bei diesem unschönen Thema sind, ob bei psychischen Erkrankungen zu viel oder zu wenig Medikamente verschrieben werden: In den Medien liest man auch im Zusammenhang mit den Neuroleptika häufiger mal die Überschrift: "Psychopillen für den Nachwuchs!" Es heißt, heute würden Kinder häufiger diese Medikamente verschrieben bekommen, auch wenn die Indikation dafür gar nicht unbedingt gegeben ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Freisleder: Meine Meinung ist, dass Psychopharmaka in der Psychiatrie bei Erwachsenen und auch bei Kindern und Jugendlichen eine gewisse Bedeutung haben. Es gibt Störungsbilder – ich spreche jetzt aber erneut nur von der Kinder- und Jugendpsychiatrie –, bei denen Psychopharmaka ein wichtiger Bestandteil im Rahmen eines mehrdimensionalen Behandlungsansatzes sind. Ich finde dieses Thema auch nicht unschön, sondern das ist ein ernstes Thema, über das wir gerne reden können. Aber summa summarum ist die verantwortungsvolle Verwendung von Psychopharmaka – sei es bei bestimmten Patienten mit ADHS, sei des die Verwendung von Neuroleptika bei Erkrankungen aus dem psychotischen Formenkreis – eine große Hilfe für uns. Aber es ist auch immer eine Herausforderung für uns Ärzte, für uns Kinder- und Jugendpsychiater, wenn wir Medikamente verordnen, den Patienten sehr genau im Blick zu haben und notwendige Begleituntersuchungen zu machen. Denn dann sind Psychopharmaka durchaus berechtigt und haben ihren Stellenwert. Staubitz: Sie selbst haben mal gesagt: "Wird im ADHS-Bereich zu großzügig mit Neuroleptika umgegangen, muss uns das hellhörig machen. Diese Mittel haben Nebenwirkungen, auch langfristige." Das war eine vorsichtige Formulierung von Ihnen: "Wenn und falls dem so sein sollte ..." Freisleder: Neuroleptika bei ADHS? Das soll ich gesagt haben? Staubitz: Oh, Entschuldigung, vielleicht muss man ja auch nicht immer glauben, was in der Zeitung so alles geschrieben wird. Freisleder: Neuroleptika haben in allererster Linie ihre Indikation bei psychotischen Erkrankungen, z. B. im Formenkreis der Schizophrenien. Im ADHSBereich hingegen wird Methylphenidat verabreicht. Aber egal, von welcher Krankheit wir sprechen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie steht uns ein breites Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung. Und ganz im Vordergrund steht hier die Psychotherapie: Da geht es um psychotherapeutische Maßnahmen, schwerpunktmäßig um verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Aber es gibt Patienten mit Störungsbildern, bei denen auch tiefenpsychologische Ansätze verwendet werden. In unserer Klinik gibt es jedenfalls ein sehr, sehr breites Feld an therapeutischen Angeboten: Sprachtherapie, Musiktherapie, Tanz- und Bewegungstherapie, Ergotherapie usw. All das ist eingebettet in eine gute, heilpädagogische Betreuung: Auf unseren Stationen arbeiten zu 50 Prozent Krankenschwestern und Krankenpfleger, aber eben auch Pädagogen. Dieses Umfeld muss stimmen, damit eine Erkrankung, wie auch immer sie heißt und wenn sie stationär behandelt wird, erfolgreich therapiert werden kann. Staubitz: Sie haben sich einen hervorragenden Ruf erworben und sind mit Ihrer Klinik auch immer "ausgebucht", wenn ich diesen flapsigen Ausdruck in diesem Zusammenhang gebrauchen darf. In den letzten 15 Jahren haben sich die Zahlen noch einmal vervielfacht: Ich glaube, im stationären Bereich sind es heute drei Mal mehr Patienten und im ambulanten Bereich sogar zehn Mal mehr. Liegt das an dem Ruf, der Ihnen vorauseilt, dass Sie so viele Patienten bekommen? Oder sind unsere Kinder und Jugendlichen heute tatsächlich gefährdeter? Gibt es heute mehr psychisch kranke Kinder und Jugendliche als früher? Freisleder: Das hat sicherlich weniger mit meinem Ruf zu tun, sondern schlicht damit, dass wir in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik arbeiten, von der man erwartet, dass sie für einen bestimmten Bereich – in meinem Fall des Heckscher-Klinikums ist das der Bezirk Oberbayern – einen Versorgungsauftrag erfüllt. Da gibt es in den letzten Jahren doch diesen wichtigen Trend, dass, aus welchen Gründen auch immer – darüber können wir gerne noch sprechen – immer mehr Zuweiser da sind, die ein problematisches Kind, einen schwierigen, einen wie auch immer auffälligen Jugendlichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorstellen und Hilfe suchen und Hilfe erwarten. Das hängt halt auch damit zusammen, dass unser Fach bekannter geworden ist. Wer sprach denn schon vor 15, 20 Jahren von der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Sehr viel weniger Menschen als heute. Wir unterhalten uns hier in dieser Sendung darüber, es gibt mehr Bücher über dieses Thema usw. Ein anderer Aspekt ist aber auch – dass ist vielleicht die Kehrseite der Medaille –, dass im Zuge des gewachsenen Bekanntheitsgrades die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch manchmal dafür benutzt wird, schwierige Jugendliche aufzunehmen, sie aus dem Verkehr zu ziehen: Man schaut bei diesen Jugendlichen einfach mal, ob sie nicht etwas für die Kinder- und Jugendpsychiatrie sind. Hier muss man aber klar sagen: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dafür da, Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen – oder mit dem Verdacht darauf – weiterzuhelfen, diese Störungen zu erkennen und einen Therapieplan zu entwickeln. Für "den" schwierigen Jugendlichen an sich sind wir nicht zuständig, der meinetwegen irgendwo auf dem Oktoberfest aufgegriffen wird oder am Stachus, weil er dort randaliert. Ja, dieser Trend besteht schon auch ein bisschen. Staubitz: Die Zahlen insgesamt sind also nicht unbedingt gestiegen? Es sind also nicht mehr Kinder, die psychisch krank sind, aber es werden heute teilweise Kinder mit etwas anderen Krankheitsbildern zu Ihnen geschickt, d. h. die Zuweisungen geschehen häufiger? Vielleicht ist auch die Hemmschwelle der Eltern, einen Psychiater aufzusuchen, gesunken. Das sind wohl die Faktoren, die dazu beitragen, dass Sie heute mehr Patienten haben. Freisleder: Die Inanspruchnahme ist aus unterschiedlichen Gründen gestiegen, die reale Zahl von tatsächlich psychisch kranken Kindern und Jugendlichen ist, wenn überhaupt, nur moderat gestiegen. Zur Orientierung können wir da folgende Zahl nennen: Gut 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen kommen im Laufe ihrer Entwicklung – also in statistischer Hinsicht von 0 Jahren bis 18 Jahren – in Situationen, in denen eine psychiatrische Abklärung, ein genaueres Hinschauen sinnvoll und notwendig ist. Recht viel mehr sind das heute auch nicht. Aber während vor 20, 25 Jahren von diesen circa 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen aus der damaligen Sicht nur ein Viertel – also fünf Prozent von allen – eine längerfristige Behandlung brauchten, sind es heute 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die irgendwann einmal irgendwie als auffällig identifiziert worden sind, denen wir Behandlung anbieten zu müssen glauben. Das ist ja vielleicht nicht nur alarmierend, sondern womöglich auch ein Beweis dafür, dass wir heute achtsamer sind, dass wir heute in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Psychotherapie einfach mehr wissen, mehr Erfahrungen haben, mehr Behandlungsangebote machen können. Der Fortschritt der Wissenschaft auf diesem Gebiet ist nicht zu unterschätzen. Wir können heute den betreffenden Kindern und Jugendlichen auch viel besser helfen als früher. Staubitz: Das ist schon mal eine gute Botschaft. Sie haben vorhin die aggressiven Jugendlichen erwähnt, die auch gerne mal in Ihre Richtung geschoben werden. Sie haben ja auch aus einer anderen Perspektive häufiger mit jugendlichen Straftätern zu tun, weil Sie nämlich auch als Gutachter in Strafprozessen tätig sind. Wenn Sie sich Ihre Erfahrungen aus diesem Bereich anschauen, zu welchem Schluss kommen Sie dann? Gibt es tatsächlich so etwas wie eine neue Jugendgewalt? Gibt es eine andere Qualität bei der heutigen Jugendgewalt? Freisleder: Schön, dass Sie das fragen, denn bei dieser Gelegenheit kann man das Publikum auch etwas beruhigen und daran erinnern, dass es Jugendgewalt immer schon gegeben hat: mal wurden in bestimmten Epochen diese Phänomene deutlicher, mal weniger. Nehmen Sie als Stichwort den "bösen Friedrich" im "Struwwelpeter" oder "Max und Moritz": Da flogen auch die Fetzen. Oder nehmen Sie die "Lausbubengeschichten" von Ludwig Thoma. Oder denken Sie an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es gerade hier in München Schlägerbanden von einem Ausmaß gegeben hat, wie wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Das gab es also immer schon und das gibt es immer wieder. Aber es deutete so einiges darauf hin, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Qualität der Aggression, der Gewalt bei manchen Jugendlichen neue Formen angenommen hat. Damit meine ich die gestiegene Brutalität, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt: Ein solcher Aggressionstäter schlägt auch dann noch mit den Fäusten oder mit den Füßen zu, wenn das Opfer bereits erledigt am Boden liegt. Ich meine, da hat man in früheren Zeiten eher aufgehört, wenn das Opfer überwältigt war. Heute gibt es Fallbeispiele, die dann auch durch die Medien gehen, bei denen die Opfer auch dann noch getreten wurden und eben z. T. zu Tode getreten wurden, als sie für den Angreifer schon längst keinerlei Gefahr mehr darstellten. Staubitz: Die meisten von uns haben ja diese furchtbaren Bilder vor Augen; man entkam diesen Bildern ja auch gar nicht. Wie ist das denn für Sie? Was empfinden Sie denn, wenn Sie so einem jugendlichen Straftäter gegenüberstehen und mit ihm zusammenarbeiten müssen und gleichzeitig von seiner Brutalität und der Schwere seiner Tat wissen? Freisleder: Wie es mir dabei geht? Jede Begegnung mit so einem Jugendlichen ist anders. Aber jede dieser Begegnungen ist eigentlich viel harmloser, als man sich das so vorstellt. Diese Jugendlichen sind oft sehr geknickt, sind dankbar dafür, dass mal eine Gelegenheit da ist, sich ausführlich aussprechen zu können. Wenn man so einen jugendlichen Gewalttäter, womöglich sogar nach einem Tötungsdelikt, zum Begutachten trifft, dann wird man ihn dafür viele Male treffen müssen: Das sind vier, fünf Nachmittage ... Staubitz: Da baut man ja auch eine richtige Beziehung auf? Freisleder: Man baut zuerst einmal eine Beziehung auf, um von ihm etwas erfahren zu können. So schlimm die Umstände auch sind, oft ist es auch ein Wendepunkt im Leben eines Täters, dass er mal die Gelegenheit hat, mit jemandem ausführlich über seine Lebensgeschichte zu sprechen und – sofern er dazu bereit ist, denn das muss er ja nicht – seine Tat aus seiner Sicht zu schildern. Das ist eindrucksvoll und oft auch bewegend, aber der Gutachter darf dabei auch nicht vergessen, dass er hier eben nicht als Therapeut kommt, sondern als möglichst objektiver Helfer des Richters oder des Staatsanwalts, von dem man geschickt wird. Als solcher muss ich hier eben auch herausfinden, wie die psychische Situation des Täters im Moment der Tat ausgesehen hat, ob da eine psychische Störung vorlag, ob das Konsequenzen für die Schuldfähigkeit hat und welche Konsequenzen das vielleicht für das Urteil hat, das der Richter fällt, und ob der Täter behandelt werden muss. Da muss man dann schon mit einer wohlwollenden Strenge die Situation beurteilen und angeben, ob hier zum Zeitpunkt der Tat beim Täter eine Störung vorlag oder – wie sehr oft – eben keine forensisch relevante Störung. Das muss man dann auch dem Täter bzw. dem zu Begutachtenden darlegen, damit er weiß, woran er ist. Staubitz: Sie sind ja der Meinung, dass so ein Schuldspruch auch durchaus eine Chance für so einen Straftäter darstellen kann. Wie muss man das verstehen? Freisleder: Dem Schuldspruch geht ja, wie gesagt, eine Begutachtung voraus. Der Gutachter hat sich also mit dem Täter beschäftigt, hat vielleicht ein psychisches Entwicklungsproblem erkannt. Der Richter, der mit seinem Urteil aus seiner juristischen Warte dazu Stellung nimmt, setzt auf diese Weise einem Jugendlichen vielleicht zum ersten Mal in dessen Leben – vor allem, wenn er aus einem dissozialen Umfeld kommt – einen Punkt und signalisiert ihm damit: "So kann es nicht weitergehen. Jetzt muss sich etwas ändern, indem du eine Haftstrafe absitzt oder indem diese oder jene Strafe erfolgt. Du musst dich mit deiner Tat auseinandersetzen." Das heißt, er bekommt damit einen klaren Rahmen vorgegeben. Ich kenne eine Reihe von Fällen, bei denen auch nach einer schweren Straftat so ein jugendlicher Täter eine neue Entwicklung eingeschlagen hat. Das ist nicht immer so, aber es kommt doch häufiger als nur gelegentlich vor. Staubitz: Es ist also ganz wichtig, so einen jugendlichen Täter nicht abzuschreiben. Freisleder: Richtig. Staubitz: Um nun zum Abschluss unseres Gesprächs über psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen den Kreis zum Beginn zu schließen: Ist es denn so, dass frühes Leid oder frühes Leiden ein schlechtes Omen für das ganze restliche Leben sein muss? Oder können Sie uns da doch eine verhalten optimistische Prognose mit auf den Weg geben? Freisleder: Man muss da schon ehrlich sein. Wenn ein Kind frühes Leid erfährt und wenn dann vor allem nicht darauf reagiert wird, wenn sich also schon früh psychische Störungen verfestigen, dann reduziert das die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Kindes sehr wohl. Das ist auch irgendwie logisch. Wenn man jedoch frühes Leid auch früh erkennt und wenn man dann auch früh interveniert, dann kann das durchaus zu einer normalen Entwicklung des Kindes führen. Wir haben ja vorhin auch von den Highlights in meinem Berufsleben gesprochen. Ein Kind, dessen Leiden früh erkannt wird und dem dann mit einer gut etablierten Therapie geholfen wird, das also in glücklichere Lebensumstände gerät, die dafür sorgen, dass auch die Schutzfaktoren in ihm wachsen können, ein solches Kind kann sehr wohl auch eine fantastische Entwicklung nehmen und sein Leiden überwinden. Das soll ja auch so ein bisschen das Signal sein, das von den Geschichten ausgehen soll, die wir da in diesem Buch geschrieben haben: Jedes Kind hat eine Chance, auch wenn es noch so malträtiert erscheint und sein psychisches Problem sehr in den Vordergrund rückt. Deshalb sollte uns auch frühes Leid nicht zum Aufgeben verleiten. Staubitz: Jedes Kind hat also eine echte Chance, wenn man aufmerksam ist, wenn man mit ihm arbeitet und das alles mit ihm zusammen durchsteht. Freisleder: Genau. Staubitz: Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Freisleder: Ich danke auch. Staubitz: Vielen Dank, dass Sie zu uns Studio gekommen sind und weiterhin viel Erfolg für Ihre wichtige Arbeit. Von Ihnen, liebe Zuschauer, darf ich mich an dieser Stelle ebenfalls verabschieden. Das war es für heute mit dem alpha-Forum, zu Gast war bei uns heute Professor Dr. Franz Joseph Freisleder. Wir haben u. a. über sein Buch "Anders als die anderen" gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und für Ihre Aufmerksamkeit, auf ein Wiedersehen. © Bayerischer Rundfunk