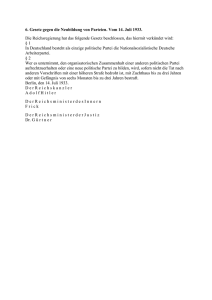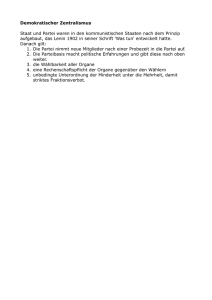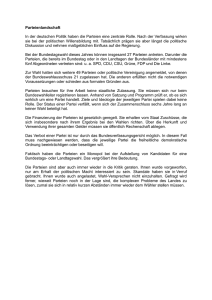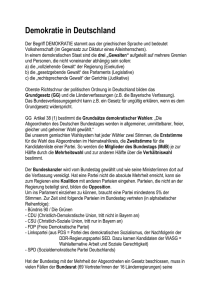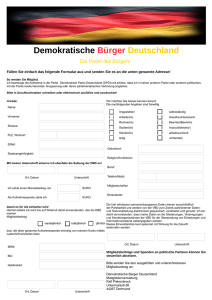Parteienfinanzierung und deren Auswirkun gen auf innerparteiliche
Werbung

Anton Kofler Parteienfinanzierung und deren Auswirkun­ gen auf innerparteiliche Strukturen, darge­ stellt am Beispiel der ÖVP 1. Grundsätzl iches\ Die Behauptung, wonach die Kanäle, durch die das Geld in die Politik fließt, uner­ forschlich seien2) , kann in ihrer ganzen Schärfe zwar nicht mehr aufrechtge­ halten werden; ein weitverbreitetes Unbehagen über die Finanzierung der Par­ teien ist jedoch nicht zu leugnen; inwieweit sie allerdings tatsächlich das größte ungelöste Problem der Demokratie isP), soll die vorliegende Arbeit aufzuzeigen versuchen. In Österreich gibt es bislang keine wissenschaftlichen Untersuchungen, son­ dern lediglich einige Presseberichte, die - vielleicht auch auf Grund parteipoliti­ scherÜberlegungen -zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen4). lnter­ essanterweise sind die durch das Inkrafttreten desParteiengesetzes5) veränder­ ten Finanzstrukturen der Parteien noch nicht untersucht worden, wie überhaupt ein mangelndes Problembewußtsein in der Öffentlich keit und den Parteien fest­ gestellt werden kann. Eine mögliche Begründung dafür kann in der Interessen­ gleich heit der Parteien gesehen werden6), die nach mehreren Wah lkämpfen zu Beginn der 70er Jahre an " chronischem Geldmangel " litten 7). Um zu einer "Theorie der Parteienfinanzierung " zu gelangen, wäre auch eine Untersuchung längerer Zeiträume bei gleichbleibenden äußeren Bedingungen nötig; es steht außer Zweifel, daß verallgemeindernde Aussagen lediglich hypo­ thetischen Charakter besitzen, da sie in der Realität durch Ereignisse wie neue G esetze, Wahlkämpfe oder veränderte Machtstrukturen vielfach überlagert werden. G ründlichere Untersuchungen werden erst dann möglich sein, wenn die Parteien ihren Anspruch auf innerparteiliche Demokratie8) auch bezüglich ihrer Rnanzquellen ernst nehmen würden und damit Zugang zu bislang verbor­ genem Material gefunden werden könnte. Die positiven Auswirkungen auf eine 1) Die vorliegende Arbeit ist die Zusammenfassung einer Diplomarbell, die unterder Betreuung von Unlv. Prof. Dr. AnIon Pelinka Im Oktober 1 979 an der Universitat Innsbruck vorgelegt wurde. 2) Eschenburg, Theodor, Zur politischen Praxis in derBundesrepublik, Band zwei, R. Piper & Co., MOnchen 1961, S.242. 3) Hard, Alexander, The Costs of Democracy, Garden City 1 962, S. 378. 4) s. Feichtlbauer, Von den Betragen der Mitglieder lebt keine Partei, in: KURIER vom 26. 8. 1976, oderBesenbOck, Induslrielle schmieren VP-Wahllokomotive, in: Arbeilerzeilung vom 23. 3. 1974. 5) Parteiengesetz, BGBI. 404/1975. 6) Pelinka, AnIon, Parteienfinanzierung Im Parteienstaat, In: Khol-Stlrnemann ( Hrsg.), Osterr. Jahrbuch fOrPolitik, 1 977, Wien-MOnchen 1 978. 7) s. PRORL, Oktober 1970, S. 23. 8) s.lnterview mit dem damaligen Bundesparteiobmann derOVP, Dr. Schleinzer, in: Osterreichische Zeitschrift fOr Politikwissenschaft, 1 /74, S. 1 7 ff. 361 Demokratie könnten beachtlich sein, wenn dieses Thema nicht mehr den Nimbus des Geheimen und Unergründlichen besäße. Trotz unzähliger Gespräche und I nterviews9) kann diese Arbeit wegen des kurzen Untersuchungszeitraums nur eine situative und z.T. rudimentäre Momentaufnahme des Finanzwesens der ÖVP liefern. Dennoch wurde stets ver­ sucht, einen Zusammenhang zwischen Finanzierungsformen und innerpartei­ lichen Strukturen herzustellen. Wo jedoch derartige Hypothesen formuliert werden, wird stets auf das E m pirieproblem hingewiesen werden, um nicht die Existenz gesicherter wissenschaftlicher Aussagen vorzutäuschen. 2. Defi nition und Fun ktion einer Partei Es muß deutlich gemacht werden, daß etwa die Frage nach der Zweckmäßigkeit von staatlichen Finanzierungsformen oder der (Un)-Bedenklichkeit von Spen­ den völlig untersch iedlich beantwortet werden muß, je nachdem ob man den Parteien eine staatstragende Rolle zuerkennt 1 0 ) oder sie lediglich aisWahlverein betrachtet11 ). Ein Rückzug auf verfassungsrechtliche Positionen dürfte wenig zur Klärung bei­ tragen, da die österreichische Verfassung keine normativen Ansprüche an die Parteien stellt 1 2 ). Es ist daher nach einer Definition zu suchen, die die bedeutende Rolle der Par­ teien in der österreich ischen politischen Realität ausreichend berücksichtigt, ohne sie zugleich als "Träger der Verfassung" schlechthin anzusehen. In einer den Anliegen dieser Arbeit gerecht werdenden Definition wird - unter Berück­ sichtigung neuerer systemtheoretischer und organisatoristheoretischer Arbei­ ten 1 3) - demzufolge eine Partei als Subsystem eines Systems bezeichnet, das versucht, zusammengefaßte individuelle Interessen zweck- und zielgerichtet zum Ausdruck zu bringen 14 ). Diese Vorstellung beinhaltet sowoh l das kurzfristige Motiv der Gewinnung von Macht als auch längerfristige Bestrebungen, mittels gewonnener Macht eigene Interessen durchzusetzen bzw. als Katalysator unterschiedlicher Interessen zu 9) Als Informationsgrundlage der Arbeit sind folgende Untersuchungen und Unterlagen anzusehen: - Befragung der 93 8ezirl(sparteisekretare IROcklaufquote 4 3%) - Befragung der 27 Landessekretare der TeilorganisatIon n der OB9. Ows und OMB (ROckl ulQuot 30%) - Kurzbefragung der Mitglieder des Bundesfinanzausschusses - schriftliches Material der Politischen Akademie der ÖVP - Materialien Offent/lcher Inst,Mionen (Parlament. Ministerien . .. ) . 10) s. Stenographisches Protokoll der 150. Sitzung des Nationalrats, 1 3. Gesetzgebungsperiode. S. 1459511., oder etwa Schulungsunterlage der Politischen Akademie: .Aufbau und Arbeitsweise der ÖVP', o.J. 11) Schleth, Uwe, Parteifinanzen, Eine Studie Ober Kosten und Finanzierung der Parteitatigkeit, zu deren politi­ scher Problematik und zu den MOglichkeiten einer Reform, Verlag Hain, Meisenhelm am Glan, 1973 S 6, oder: Sternberger, Dolt, Wir wollen keinen politischen Klerus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. 11. 1959. 12) Aufdiesen Umstand wurde bereits Ofters hingewiesen, so etwa bei Pelinka/Welan, Demokratie und Verfassung in Österreich, 1 971, S. 1 71 . 13) MOh le,sen, Hans-Dtto, Organisationstheorie und Parteienforschung, in: Jager, Wollgang (Hrsg.), Partei und System, Verlag Kohlhammer, 1 973, S. 59. 14) Diese Definition wurde - auf Parteien abgewandelt - übernommen aus: Hill/Fehlbaum/Ulrich, Organisations­ lehre 1 , Verlag Paul Haupt, Bern 1 976, S. 20 11. 362 wirken. Außerdem ist durch eine derartige Aussage noch keinerlei Präjudizie­ rung getroffen, ob denn eine Partei auf Grund ihrer Aufgaben förderungswürdig erscheint; vielmehr wird davon auszugehen sein, daß einer Partei zwar wichtige Aufgaben im Rahmen einer funktionierenden Demokratie zukommen, sich die Notwendigkeit einer staatlichen Finanzierung aber keinesfalls mit deren staats­ tragenden Charakter begründen läßt. Im Gegenteil, es wird zu prüfen sein, welche Finanzierungsform für die Organisationsstruktur und innerparteiliche Partizipation am ehesten geeignet scheint, ohne sich stetsaufhöhere " demokra­ tische Argumentationsebenen" zurückzuziehen müssen. 3. Die Finanzierung der ÖVP 3.1 . Allgemeines I m Bereich der Finanzierung einer Partei, der " zielentsprechenden Gestaltung des Zahlungsbereiches" 15), wird eine Definition vorgeschlagen, die sowohl theoretischen Mindestansprüchen genügen als auch der Forderung nach ent­ sprechender empirischer Überprüfbarkeit gerecht werden kann. Wir unter­ suchen die Einnahmen monetärer und geldwerter Art, die einer Partei aIsOrgani­ sation zufließen, sowie deren periodische bzw. wahlkampfspezifische Aus­ gabenstruktur; dabei muß betont werden, daß sich lediglich die Kosten der Partei als Gesamtorganisation untersuchen lassen, nicht aber die Kosten, die der Gesellschaft aus der Parteientätigkeit erwachsen, die sog. " costsof democracy" . Um eine Einbeziehung der Finanzierungsformen in politische "Systemüber­ legungen" vorzunehmen, können wir davon ausgehen, daß die Aufgaben der Parteien auch finanzielle Mittel erfordern. Die finanzielle Basis muß so ausgestat­ tet sein, daß sich die Vorhaben realisieren lassen, andererseits muß aber sach­ fremder und undemokratischer Einfluß von außen abgewehrt werden 1 6). Gerade an dieser Überlegung scheitern aber moderne Großparteien: Bedingt durch moderne Management-Methoden, umfassende Public-Relations-Aktio­ nen und eine ständige Aufgabenerweiterung ist eine explosionsartige Kosten­ steigerung erfolgt, der keine entsprechende G estaltung der E innahmenstruktur folgen konnte. Es ist allgemein bekannt, daß die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträ­ gen zur Deckung der Aufwendungen nicht annähernd ausreichen 1 7). Über die Abdeckung der restlichen finanziellen Erfordernisse bestehen große Differenzen, da bislang keine allgemein akzeptierte Lösung gefunden werden konnte. 15) Schneider, Dieter, lnveslition und Finanzierung, Opladen 1 964, unterscheidet auch zwischen interner und ex­ terner Finanzierung, was allerdings für eine Partei irrelevant ist, S. 1 6911. 16) vgl. Wicha, Barbara, Parteienfinanzierung aus öffentlichen Mitteln, Sch riftenreihe derOsterreich ischen Gesell­ schaft fOr Politik, die darin das oberste Ziel jeder Finanzierungsform sieht, Wien, o.J., S. 44. 17) So gelingt es der OVP trotz einer sehr hohen Mitgliederzahl, nurea. 35% ihres Budgets aus Mitgliedsbeitragen aufzubringen; fOr die deutschen Parteien hat Schleth einen Prozentsatz von etwa 25% festgestellt. 363 Auf diese grundsätzliche Problematik muß angesichts der Verharmlosungsver­ suche " in Österreich, wo eine öffentliche Bewußtseinsbildung nicht stattgefun­ den hat und etwa das Parteiengesetz nach einstündiger Diskussion verabschie­ det wurde, aufmerksam gemacht werden'8). � Auch für die Parteien scheintsich lediglich die Frage nach einem Meh ran Finanz­ mitteln zu stellen, ohne daß die schwerwiegenden Einwendungen gegen ver­ " schiedene Quellen beachtet würden. Einem naiven "Wachstumsfetischismus folgend, treten ständigeAusgabensteigerungen ein, ohne daß bislang ernsthafte Reduzierungsüberlegungen angestellt worden sind. Es darf nicht verkanntwerden, daß die Finanzierung einerGroßpartei nicht isoliert betrachtet werden kann; vielmeh r bestehen auch Rückwirkungen auf den politi­ schen Prozeß; so haben etwa Fragen nach Zentralisierungstendezen, dem Machtzuwachs der Verantwortlichen, der Zementierung des innerparteilichen " Status-Quo�, der Chance von Machtwechsel oder der Förderung des Innova­ tionspotentials, die direkt oder indirekt mit Finanzierungsformen zusammenhän­ gen, gerade angesichts gewisser bedenklicher Erscheinungen in modernen Parteiensystemen besondere Bedeutung erlangt'9). Man kann wohl von der Hypothese ausgehen, daß "zu einerdemokratischen Par­ tei auch eine demokratische Finanzierung gehört"20). 3.2. Statutarische Regelung Die sch riftliche statutarische Regelung des Finanzwesens dürfte wohl in umge­ kehrt proportionalem Umfang zur tatsächlichen Bedeutung stehen, da sich das Bundesparteiorganisationsstatut (BPOSt) lediglich in vier Punkten mit dieser Frage beschäftigt: h insichtlich der Wahl des Bundesfinanzreferenten, seiner Aufgaben, der Einnah mekategorien und der Finanzorgane sowie deren Überprü­ fung durch die Bundesfinanzprüfer. Trotz scheinbar exakter Bestimmungen in den Statuten und der Finanz-und Beitragsordnung bietet sich ein unüberschau­ bares und verworrenes Bild. Zum einen sind gewaltige finanzielle Unterschiede zwischen den territorialen und funktionalen Bereichen festzustellen, sowohl was die Höhe der zur Verfügung stehenden Gelder als auch die Behandlung der Ein­ nahmenkategorien anlangt; offensichtlich ist der Bundesfinanzausschuß nicht imstande, einheitliche Regelungen durchzusetzen bzw. individuelle Vorteile zu beseitigen. Weiters sind gerade in entscheidenden Bereichen, wie etwa der Auf­ teilung derEinnahmen, keine klaren schriftlichen Regelungen, sondern lediglich " " Schlüsselvereinbarungen anzutreffen, was zu regelmäßigen beinharten Ver­ handlungen führen muß. 1 8) S o bedauerten zwar alle Redner die spate Stunde und schOttere Parlamentsbeselzung, wobei aber eine Dis­ kussion aber wesenlliehe Problembereiche des Parteiengeselzes unterblieb. Vgl. Protokoll der 150. Sitzung des NR, 13. GG-Periode, S. 14.593-14.607. 1 9) In diesem Zusammenhang erscheint nach wievor die ,Mannheimer-Elite-5tudie'von Relevanz; bei dIeserStu­ die, die von Janner bis Mai 1968 durchgefOhrt wurde und bei der die Inhaber der formal hOchstgestellten POSi­ tionen der BRD befragt wurden, sahen 70% der Befragten ,bedenkliche Erscheinungen im Parteiensystem', 40% davon einen ,Mangel an Innerparteilicher Demokratie'. 20) Duverger. Maurice, Die politiSChen Parteien, herausgegeben und Obersetzl von Siegfried Landshut, TObigen 1959, S. 62. 364 Die Ineffizienz des Finanzwesens der Partei, die sich durch sch riftliche Regelun­ gen ohne flankierende organisatorische und inhaltliche Maßnahmen nicht be­ seitigen wird lassen, wird noch durch ein weiteres Beispiel verdeutlicht: Da über die Zahl der Parteimitglieder zT. erhebliche Differenzen bestehen21 ), scheint die Behauptung zumindest nicht abwegig, daß die Zahl der M itglieder jeweils davon abhängig ist, "ob es um die Nominierung von Delegierten oder die Abführung von Geldern geht". 3.3. Ei n nahmenkategorien 3.3.1. Mitgliedsbeiträge Ein Mitgliedsbeitrag ist zu definieren als Betrag in beschlußmäßig festgesetzter Höhe, der regelmäßig entrichtet werden soll. In derÖVP setzt er sich aus dem Par­ teibeitrag, der von der Bundesparteileitung zu besch ließen ist, und dem Mit­ gliedsbeitrag der Teilorganisationen zusammen, wobei die Einhebung unter " einem" erfolgen muß. Einer problemlosen Auflistung der Mitgliedsbeiträge stehen einige Hindernisse entgegen: Es läßt sich feststellen, daß manche Agenturen die satzungsmäßige Höhe übersteigendeZahlungen als Spenden verbuch en, während andere keine Änderungen vorneh men. Weiters wirkt alszusätzliche Erschwernis die Tatsache, daß 27 Teilorganisationen als Beitragsaufbringer untersc h iedliche Beitrags­ höhen aufweisen. Schließlich muß auch die organisatorische Frage nach der Art des Inkassos und den damit verbundenen Kontroll- und Sanktionsmöglich kei­ ten gestellt werden, die eng mit dem Vorhandensein einer M itgliederevidenz ver­ bunden ist. Die Mitgliederevidenz der Partei ist als sehr schlecht anzusehen, differiert aller­ dings sehr stark: Der Österreichische Bauernbund und seine Landesorganisa­ tionen führen sehr exakte Unterlagen, relativ gut ist auch die Evidenz des Öster­ reichischen Wirtschaftsbundes, wogegen die Aufzeichnungen des ÖAAB allge­ mein als schlecht bezeichnet werden, was sowohl mit der unterschiedlichen Strukturierung in Orts- und Betriebsgruppen als auch fehlenden Kassieraktivitä­ ten auf unterer Ebene zu begründen ist. Diese skizzenhafte Darstellung zeigt be­ reits den Kausalzusammenhang zwischen der Qualität einer M itgliederevidenz und dem Beitragsaufkommen, da die beiden Teilorganisationen mit diesbezüg­ lich ansprechenden Aufzeichnungen über einen G roßteil der Einnah men aus dieser Kategorie verfügen. Grundsätzlich werden in der ÖVP zwei unterschiedliche Inkassoarten ange­ wandt, das persönliche Inkasso und das Erlagscheininkasso. Das persönliche Inkasso wird vom ÖBB bundesweit und vom ÖAAB in manchen Betriebsgruppen angewandt, wobei gerade der ÖBB ein hohes Maß an Perfektionierung erreicht hat. Das Erlagscheininkasso wird in der Regel von den Teilorganisationen auf 21) So schwanken die in den letzten Jahren verOffentlichten Zahlen zwischen 600.000 und 950.000. 365 Landesebene durchgeführt. Auch diese Determinante zeigt den direkten Zu­ sammenhang zwischen der Art des Inkassos und der Höhe der Eingänge auf, da die Einziehung der M itgliedsbeiträge auf Ortsebene durch persönlich bekannte Parteirnitgliederzu einer erheblichen Steigerung der Einnahmen führen kann22). Die Höhe der M itgliedsbeiträge schwankt in Abhängigkeit von Teilorganisation und Bundesland außerordentlich stark: Sie liegt beim ÖAAB zwischen 60,- und 300,- jäh rlich, beim ÖWB um etwa 300,- und beim ÖBB zwischen 150,- und 600,-. Diese Zahlen dürfen allerdings nicht zu falschen Schlüssen verleiten, da beispielsweise seh r viele Ausnahmebestim mungen bestehen und beim ÖWB kau m von verbindlichen Richtlinien gesprochen werden kann, daja " kein Partei­ mitglied um die Ableistung des Beitrages gebeten wird, wenn eine Spende von 100.000,- eingelangt ist" 23). Im ÖBB-Bereich ist weiters zu berücksichtigen, daß in vielen Landesorganisatio­ nen im Mitgliedsbeitrag auch das Abonnement der Parteizeitung oder sonstige Vorteile enthalten sind, Faktoren also, die durchaus geeignet sind, das Interesse an regelmäßigen Zah lungen ansteigen zu lassen. Der ÖBB entscheidet in den meisten Landesorganisationen nach strengen Kriterien über die Beitragshöhe, wobei als Bemessungsgrundlage die Höhe des Einheitswertes herangezogen wird. Im ÖAAB erfolgt eine Art Selbsteinschätzung, wobei h ier auf das Beispiel der bayrischen CSU verwiesen werden kann, wo die Division der E innahmen durch die Zahl der Zah ler eine " Partei von Arbeitslosen" ergeben würde2 4). Der ÖWB führt im G runde keine institutionell fixierte Bindung an bestimmte Bei­ tragshöhen durch, doch spiegelt diese Vorgangsweise die potente finanzielle Einschätzung der Mitglieder und viel weniger eine organisatorisChe Nachlässig­ keit wider. Die differierende Höhe des Mitgliedsbeitrags einerTeilorganisation in den Bun­ desländern kann wohl nur mit deren Finanzbedarf und nicht mit sachlichen Argu­ menten gestützt werden. Bei Betrachtung der Teilorganisationen ist allerdings d ie Hypothese zulässig, daß die Höhe des Mitgliedsbeitrags mit steigender politi­ scher Machtposition steigt; eine politisch nicht exponierte und überdies mitglie­ derschwache Teilorganisation wird - wenn schon nicht durch Macht und damit verbundene Patronagemöglichkeiten - durch niedrige Beiträge ein gewisses Interesse zu wecken versuchen. Damit scheint aber die überaus problematiche Auffassung, daß Geld der Macht folge und damit nicht nur Ursache, sondern vor allem Folge politischer Prozesse ist, erneut bestätigt. Um der bereits angedeuteten Gefahr einer .numerischen Isolierung " zu ent­ gehen, darf eine Erklärung desAufkommensan Mitgliedsbeiträgen nicht nurvon organisatorischen Bedingungen wie Mitgliederevidenz und Art des Inkassos ausgehen. Neben diesen Determinanten spielen Fragen wie die finanzielle 22) s. Feichtlbauer. Von den Beiträgen der Mitglieder lebt keine Partei. 8.a.0., der einen Palte;funklion<'lr zitiert. 23) Diese Aussage wurde von einem Parteifunktionär auf die Frage nach der HOhe des Mitgliedsbeitrages beim 24) Owa getroffen. s. Schleth, a.a.O., der auf die Differenz zwischen Finanzstatut und Realität am Fall der CSU hinweiSt, S. 155. 366 Potenz der Mitglieder, die Stellung der Teilorganisation im politischen Gefüge der Gesamtpartei und die Möglichkeiten politischer Patronage eine wesentliche Rolle. So ist etwa für das hohe Beitragsaufkommen desÖWB die Finanzkraft derMitglie­ der verantwortlich, während der ÖBB dank seines straffen Inkassos und der guten Beitragsmoral über hohe Einnahmen dieser Kategorie verfügt. Da zweifel­ loszu vermuten ist, daß die Leistung desMitgliedsbeitragsauch von der positiven Erfüllung von Erwartungen der Parteibasis abhängt, muß auch die Frage gestellt werden, inwieweit politische Exponenten der jeweiligen Teilorganisation imstan­ de sind, die Wünsche ihrer Mitgliederzu artikulieren und diesen zum Durch bruch zu verhelfen. DaJVP, ÖFB und ÖSB die Anliegen ihrerMitgliederweder innerpar­ teilich noch in der Öffentlichkeit im Ausmaß der anderen Teilorganisationen er­ folgreich durchsetzen können, ist auch die Zah l der Beitragszah len entschei­ dend geringer25 }; diejenigen Parteimitglieder dieser drei Teilorganisationen und vermutlich auch des ÖAAB, dem Protektionsmöglichkeiten durch seine schwä­ chere Stellung in den Organisationen der Arbeitneh mer fehlen, die tatsächlich einen Mitgliedsbeitrag entrichten, können als " ideologische Mäzene" bezeich­ net werden, während vielen Parteimitgliedern von ÖWB und ÖBB bei derZahlung des Beitrags das Motiv des "interessierten indirekten Kaufs" im Sinne Max Webers zugrundeliegen dürfte26}. Es handelt sich also um Parteimitglieder, die eben in Erwartung gegenwärtiger oder zukünftiger individueller Vorteile ihren Beitrag entrichten. Die nachfolgenden Tabellen, denen eine Umfrage unter den Bezirksparteisekre­ tären und den Landessekretären der Teilorganisationen zugrundeliegt, sollen die bisherigen Angaben aufschlüsseln; es ist darauf aufmerksam zu machen, daß die Schwachstellen in den Einnahmen des ÖWB und den Zuwendungen an die Bundeszentralen der Teilorganisationen liegen. Die Leistungen an die Bundes­ parteizentrale sind deshalb relativ exakt feststell bar, da jede der drei TeilorganiTabelle 1 Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen der ÖVP (1978/79) OAAB-Landesorganlsatlonen OBB-Landesorganisationen OWB-Landesorganisationen Bundesparteizentrale OAAB-Ortsorganlsatlonen ÖSS-Ortsorganlsatlonen OAAS-Bundeszentrale OSS-Bundeszentrale OWS-Bundeszentrale 24,200.000,28,1 84.991,43,61 5.384.1 4,000.000.4,840.000,2,81 8.499,5,480.000,4,700.000,3,460.000,- 1 8,4 2 1 ,4 131 ,298.874,- 1 00,0% 33,2 10,6 3,7 2,1 4,2 3,6 2,7 25) Diese Schwache außert sich sowohl in der Vertretung In den wiChtigsten Gremien derGesamtpartei als auch bei einer Betrachtung der von der Partei in der Offentlichkeit ventilierten Themen. 26) Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, 4. Auflage, TObingen 1 956, S. 1 68. 367 sationen 20,- je Mitglied und Jahr an diese abzuführen hat. Die Einnah men der Bundesleitungen sind bewußt vorsichtig angesetzt, sodaß die angagebenen Zahlen m it Gewißheit absolute Untergrenzen darstellen. Tabelle 2 Mitgliedsbeiträge (Beitragsmoral, Durchschnittsbeitrag) Teilorganisation OMB OBB Owe Beitragsmoral Durchschnittsbetrag 78,8% 95% 80% 1 1 3,1 26,300,- 3.3.2. Parteisteuern Bei diesen Sonderbeiträgen der Mandatare und sonstiger von der ÖVP oder " einer ihrer Teilorganisationen in Körperschaften oder andere Einrichtungen im öffentlichen Bereich entsandter Personen"27) handelt es sich um eine Ein­ nahmenkategorie, die sich kontinuierlich seit der Einführung der Politikergehäl­ ter entwickelt hat. Die Parteien haben diese Einnahmequelle in den letzten Jahr­ zehnten entdeckt und seither systematisch auszuschöpfen begonnen. Waren ursprünglich nur die Spitzenpolitiker einer Partei zur Leistung einer Abgabe ver­ pflichtet, so wird heute mit besonderer Akribie daran gearbeitet, jedes Partei­ m itglied als "Ausgleich für die ihm zugewendeten Chancen" zu besteuern. Um die Einnahmenhöhen möglichst genau bestimmen zu können, werden zuerst dieJahresgehälterder ÖVP-Spitzenpolitiker in Bund und Ländern errech­ net und daraus die Höhe der Parteisteuer abgeleitet. Die ÖVP stellt derzeit 363 Mitglieder von Landesregierungen, Landtagsabgeordnete und Abgeordnete im National- und Bundesrat. Diese Parteielite bezieht ein Jahreseinkommen von etwa 200 Millionen; geht man von einer Parteiabgabe von 10% aus, beträgt die der Partei zufließende Summe ca. 20 Millionen jährlich. Zu diesen Abgaben kommt noch ein sogenannter "Klubbeitrag" in der Höhe von 7% des Gesamtbezugs eines jeden Nationalrats- und Bundestagsabgeordneten, den dieser an den Par­ lamentsklub abzuliefern hat; dieser Betrag erreicht die Höhe von 6,135.200,­ jäh rlich. Ein Faktor, der die ÖVP-Einnahmen aus Partei steuern sicherlich ge­ schmälert hat, ist die Nicht-Beteiligung der Partei an der Regierung seit 1970, da ihr dadurch etwa 2 Millionen jährlich entgehen. Auf kommunaler Ebene wird die Einhebung der Parteiabgabe sowohl h insic;:ht­ lich der Höhe als auch des Empfängers sowie des verpflichtenden Charakters seh r unterschiedlich gehandhabt. Während in manchen Bezirken beinahe jeder Gemeinderat einen Beitrag leisten muß, liefern in anderen lediglich die Bürgerm s. § 37, Abs. 1 BPOSt. 368 meister den "Parteizehent" ab. Es dürfte aber keinen österreichischen Bezirk geben, in dem nicht mindestens ein Großteil der Bürgermeister besteuert wird. Geht man von einer jährlichen Bürgermeisterabgabe in der Höhe von 15.000,­ und einerBeitragsmoral von 80% aus, ergäbe sich eine jährliche S umme von an­ nähernd 20 Millionen Schilling; diese Berechnung d ürfte aber den strukturellen und finanziellen Differenzierungen auf kommunaler Ebene entsch ieden zu wenig Rechnung tragen. Vielmehr kann auf Grund der vorliegenden U nterlagen ange­ nommen werden, daß dieBezirke über etwa 9 Millionen an Einnahmen ausdieser Kategorie verfügen, während 4,5 Millionen auf örtlicherEbene abgerechnet wer­ den; diese Summe wirdvon annähernd 8.000Personen aufgebracht. Diese hohe Zahl von Zahlern weist darauf h in, daß sehr viele Bürgermeister lediglich einige Prozentpunkte ihres Gehalts der Partei überweisen, allerdings ein überwiegen­ der Teil der Sitzungsgelder von Gemeinderäten, die jährlich nur einige Hundert Schilling betragen, als Parteiabgabe verbucht wird. Diejenigen Bezirke, die im­ stande sind, dieBürgermeisterabgaben mit 1OO"/oiger Beitragsmoral zu sichern, ersparen sich damit die " lästige Arbeit" des Eintreibens marginaler Beträge. Da die österreichischen Parteien auch im Bereich der verstaatlichten Industrie einen dominanten Einflußausüben, haben diese auch eineBesteuerung derVor­ stands- oder Aufsichtsratsmitglieder dieser Gesellschaften vorgenommen. Während bei der SPÖ die "Besteuerung" dieser Personen perfekt zu funktionie­ ren scheint, dürfte die ÖVP lediglich von einem geringen Teil eine derartige Ab­ gabe beziehen. Man wird davon ausgehen können, daß etwa 500 Aufsichtsrats­ mitglieder und 100 Vorstandsmitglieder betroffen sind, deren Zahlung - bei vor­ sichtiger Schätzung - etwa drei Millionen Schilling betragen würden. 3.3.3. Erträge aus Vermögen und wirtschaftlichen U nterneh mungen Die Behandlung dieser Einnah mekategorie ist - jedenfalls unter finanziellen Gesichtspunkten - unschwer möglich, da es sich weniger um die Bestimmung von Einnahmen als vielmehr die "Abwendung zu hoher Kosten " h andelt. Die ÖVP - soviel scheint festzustehen - hat nie ernsthafte Initiativen im Hinblick auf stärkere unternehmerische Aktivitäten gesetzt, wenn derartige Vorhaben auch von Einzelpersonen forciert worden sein mögen. Vielmehr sind die beste­ h enden Parteiunternehmungen unter den folgenden Aspekten zu betrachten: Eine offiziell im Handelsregister eingetragene Firma ermöglicht einer Parteiagen­ tur eine quasi nach außen orientierte unterneh merische Tätigkeit mit allen damit vebundenen Vorteilen; so können Parteiangestellte unter einem R rmendeck­ mantel operieren oder Inserate alsBetriebsausgaben abgesetzt werden. Wollen Großspender die steuerliche Abzugsfähigkeit einer Spende erhalten, kann durch einen Auftrag an einen Betrieb die Steuer in der Höhe von 35% u mgangen werden. Schließlich dürfte auch der Gedanke an einen Vorsteuerabzug die G ründung einer Firma vorteilhaft erscheinen lassen. 369 Wenn derartige Unternehmungen keine Erträge abwerfen, dann vor allem des­ halb, weil der Partei durch die nicht streng ökonomische Führung ohneh in Kosteneinsparungen entstehen; es werden also nur die Kosten berech net, die zur Wahrung der betrieblichen Substanz nötig sind, womit sich allerdings bun­ desweit nicht unerhebliche Einsparungen für die Partei ergeben. Schließlich ermöglichen eigene Betriebe der Partei auch eine Orientierung an echten Bedürfnissen anstelle von vorhandenen Mitteln, da keine exakten Zah­ lungsfristen oder strenge Sanktionen gegeben sind; gerade in der Endphase eines Wah lkampfs d ürfte dieser Aspekt nicht unbedeutsam sein. Es ist ungemein schwierig, Details über direkte oder indirekte Beteiligungen der Partei oder deren Teilorganisationen zu erfahren. soweit allerdings in Erfahrung gebracht werden konnte, werden die wichtigsten Unte rnehmungen von den Teil­ organisationen auf Bundesebene unterhalten; auch verschiedene Landesorga­ nisationen und Landesparteileitungen verfügen über kleinere Unterneh mungen. Daß die Partei fast ausschließlich über Unternehmungen des Druckereigewer­ bes oder derWerbebranche verfügt, ist ein weiterer Beweisfürderen Kostensen­ kungscharakter. 3.3.4. Öffentliche Zuwendungen Es wäre verfehlt, wenn man annehmen wollte, daß die öffentliche Finanzierung der österreichischen Parteien erst mit dem Inkrafttreten des Parteiengesetzes aktuell geworden wäre; bereits 1970 argwöh nte ein Nachrichtenmagazin, daß der Steuerzahler ungefragt und uninfomiert der größte Gönner der im Nationalrat vertretenen Parteien sei28). So wurde in diesem Jahr eine Summe von 90 Millionen ohne generelle gesetz­ liche Deckung an die Parteien ausgeschüttet. 3.3.4.1. Zuwendungen nach dem Parteiengesetz Das Parteiengesetz 1975 brachte etliche einschneidende Neuerungen für die Parteien; Artikel 1 stellt durch eine Verfassungsbestimmung fest, daß die Exi­ stenz und Vielfalt politischer Parteien ein wesentlicher Bestandteil der demokra­ tischen Ordnung der Republik Österreich ist, und hebt damit die Parteien vom " "luftleeren, rechtlosen Raum in den Verfassungsrang. Artikel 2 gesteht den Parteien Förderungsmittel des Bundes fOr die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zu. Die Höhe dieser Mittel ist zweigeteilt: Jede politische Partei mit mindestens fünf Abgeordneten erhält einen jährlichen G rundbetrag in der Höhe von vier Mil­ lionen. Die Höhe der Zusatzbeiträge wird an das Gesetz zur Förderung der Publi­ zistik geknüpft und nach dem Stimmenverhältnis bei den Nationalratswahlen verteilt. Um die nicht im Nationalrat vertretenen Parteien nicht gänzlich von einer , 23) 3. 370 profil. Nr. 2/1970, S. 28 11. Subventionierung auszusch ließen, erhalten auch diejenigen Parteien einen Z usatzbetrag, die bei der vorangegangenen Wahl mindestans 1% der gültigen Stimmen erreicht h aben. Die Parteien wurden auch gezwungen, die widm ungsgerechte Verwendung die­ serGelder nachzuweisen und über die Art der Einnahmen und Ausgaben öffent­ lich Rechenschaft abzulegen. Leider haben sich die I nformationen trotz dieser Bestimmung nicht erweitert: Die Parteien veröffentlichen dieBerichte m it großer Verspätung und nur unter Einbezug derBundesparteiorganisation. VonNachteil ist auch die Tatsache, daß sie in auflagenschwachen Parteizeitungen veröffent­ licht werden und damit die geforderte Publizität wieder untergraben werden kann. Der Gesetzgeber verknüpfte mit dieser Förderung auch die Vorstellung, daß eine Begrenzung derWahlwerbungskosten erfolgen sollte, die in den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes präzisiert wurde. Demnach muß jede Partei i h re Wahlwerbungs­ kosten fürden Zeitraum von fünf Wochen vorderNationalratswah l einerKommis­ sion mitteilen29), die diese überprüft und im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung " ver­ öffentlicht. Stellt die Kommission fest, daß eine Partei ihren Werbeaufwand u m m e h r als 10% übersch ritten hat, so sind 50% desBetrages, um d e n die Angaben übersch ritten wurden, von der nächsten Zuwendung zur " Förderung derÖffent­ lichkeitsarbeit" abzuziehen. Diese Sanktionsmöglichkeit wurde weder 1975 noch 1979 angewandt, wie überhaupt festgestellt werden kann, daß sich die Wahlwerbungskosten aller drei Parlamentsparteien von 1975 auf 1 979 nicht erhöht haben30). Diese Tatsache und z.T. wesentlich höhere Schätzungen der Wahlwerbungs­ kosten erfordern eine sehr kritischeBeurteilung derveröffentlichten Zahlen, wo­ mit auch die zweite Intention desGesetzgebers, eine längerfristige Senkung der Wahlkampfkosten herbeizuführen, eher als gescheitert anzusehen ist. Wie dem "Amtsblatt zurWienerZeitung " vom 7. 2. 1979 zu entneh men ist, sind der VP 1977 S 25,217.546,40 zur Förderung i h rer Öffentlichkeitsarbeit zugeflos­ n. 3.3.4.2. Zuwendungen an die Klubs DasBundesgesetz, mit dem die Tätigkeit der Klubs erleichtert wird, wurde 1963 beschlossen und zwischenzeitlich dreimal novelliert. Jedem Klub gebührt zur rfüllung seiner Aufgaben ein Sockel betrag; Z usatzbeträge werden für je zehn ngefangene Abgeordnete gewäh rt. Die Höhe dieser Zuwendungen richtet sich flach dem Jahresbruttobezug von Bundesbeamten, sodaß mit jeder Erhöhung erBeamtengehälter eine Erhöhung der Klubzuwendungen quasi mitbesch los­ n wird. ) Diese Kommission Ist aus sieben Parteienvertretern und drei Vertretern der Werbewirtschaft zusammenge­ setzt; den Vorsitz fOhrt der Bundesminister fOr Inneres oder dessen Vertreter. ) Die Summe derWahlwerbungskosten allerdrei Parteien betrug demnach 1 975 ca. 60 Millionen Schilling, 1979 ca. 6 4 MillionenSchilling. Vg1. dazu den .Amtlichen Teil derWienerZeitung" vom 1 8. 3. 1 979 und 28. 1 0. 1 975. 371 Ein Jahresbetrag von ca. 22 M illionen an die drei Klubs kann als relativ beschei­ den bezeich net werden im Vergleich zur wichtigen Funktion vor allem eines Oppositionsklubs für eine funktionierende parlamentarische Dem.okratie. Ob­ wohl die österreichischen Klubs personell und administrativ sehr sch lecht aus­ gestattet sind, ist dieser Zustand bislang kaum beklagt worden; dafür dürfte der hohe Anteil von Beamten und Verbändevertretern ausschlaggebend sein, die im österreich ischen " Lobbyistenparlament" sitzen3 1) und auf den Apparat ihrer Organisation zurückgreifen können. Dadurch entsteht allerdings die Gefahr, eine Elite innerhalb des Parlaments indirekt zu fördern, die deutlich begünstigt ist. lm Jahre 1977 wurde zur Förderung derTätigkeit des KlubsderÖVP an diesen ein Betrag von S 10,275.677,50 überwiesen. 3.3.4.3. Zuwendungen zur staatsbürgerlichen Bildungsarbeit Unter dieser gesetzlichen Bezeich nung ist eine öffentliche Subventionierung der zentralen Bildungseinrichtungen der Parteien zu verstehen. Jede im Parla­ ment vertretene Partei erhält einen Sockelbetrag in der Höhe von vier M illionen, der Restbetrag wird nach der mandatsmäßigen Stärke verteilt. Das Gesetz schreibt den Parteien strenge Richtlinien über die Verwendung die­ ser Gelder und eine Veröffentlichung vor; die Zuwendungen werden also in der Realität für die entsprechenden Zwecke verwendet und sehr pünktlich abge­ rechnet. Wie im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung " vom 13. 3. 1979 zu entnehmen ist, hat die Vereinigung für Politische Bildung (Politische Akademie) im Jah r 1978 Förde­ rungsmittel in der Höhe von S 14,120.218,60 erhalten. 3.3.4. 4. Zuwendungen von Ländern, Städten und Gemeinden Die Aussage, wonach der Bund 1975 nurvollzogen habe, was in den Ländern be­ reits längst gehandhabt wurde, ist richtig32 ). Tatsäch lich besteht in den Bundesländern ein vielschichtiges Förderungs­ system, das sowohl bezüglich der Höhe als auch der inhaltlichen Kriterien stark differiert. Man möchte meinen, daß sich die Höhe dieser Zuwendungen aus den Voranschlägen derländer entnehmen läßt; tatsäChlich sind viele Zahlungen hi n­ ter allgemeinen Aussagen verdeckt ( " Förderung der politischen Bildung " ). Auch die Aussage mancher Länder, wonach derartige Informationen " einen hohen Verwaltungsaufwand erfordern", trug zur Erschwernis bei. Die im folgenden an­ gegebenen Beträge beziehen sich auf untersch iedliche Jahre und differiere n 31) Der Ausdruck stammt von Pelinka/WeJan, Verfassung und Demokratie in Ö sterreich, aa.O.. S. 1 00. Genauere Unterlagen s. Pelinka, Volksvertretung als funktionale Elite, Kholl Stirnemann Österreichisches Jahrbuch fOr Politik 1978, Wien-MDnchen 1979, a.a.O., S. 39 ff. 32) Dieses Faktum wurde anlaßlich der Beratungen Ober das Parteiengeselz vom Klubobmann derSPÖ, Dr. Fischer, hervorgehoben; s. Stcnographiscre PrCltokolle, 8.8.0., S. 14.596. 372 auch bezüglich der Angabe indirekter Zuschüsse; es h andelt sich also um Unter­ grenzen. Die Summe, die sich bei Addition aller unmittelbaren Zuwendungen derBundes­ länder an die ÖVP ergibt, beträgt S 102,910.465,- und wird in Tabelle 3 aufge­ schlüsselt33). Tabelle 3 Zuwendungen der Bundesländer an die ÖVP (1979) 33) Bundesland Vorarlberg Tiral Salzburg Kärnten Burgenland Wien NiederOsterreich OberOsterreich Steiermark Klub 628.517.60 330.000.00 797.875,90 530.000,00 1 , 1 00.000,00 1 ,256.640,00 8,948.800,00 1 ,81 0.000,00 7,000.000,00 Partei 1 .851.420.00 7,035.520,00 4,173.453,00 1,670.000,00 1 4,074.1 55,00 4 ,974. 440,00 16,600.000,00 Sonstiges 1 50.000.001) 1 ,062.330.402) 5,1 78.01 7,00 3) 3,1 40.700,004) 1 4 ,500.000,005) 6,100.000,006) Summe 2.629.937.60 7,365.520,00 6,033.665,30 2,200.000,00 1 , 1 00.000,00 20,509.322,00 1 7,062.020,00 1 6,31 2.000,00 29,700.000,00 1 02,91 0.465,00 1 . . . JVP-Vorarlberg 2 . . . Jugend- und Teilorganisationen 3 . . . Adaptierung und Einrichtung von Parteilokalen 4 . . . Schulung der Gemeindevertreterverbände 5 . . . Schulung der Gemeindevertreterverbände 6 . . Schulung der Gemeindevertreterverbände . Zwei Komponenten verdienen an läßlich dieser Aufsch lüsselung, die alle bisheri­ gen Angaben um etwa 200% übertrifft, noch Erwähnung: Die Parteien haben es verstanden, in den vergangenenJahren immense Beträge " i n eigener Sache " zu budgetieren, die mit Aufgabenweiterungen nicht mehr rational begründet werden können und zudem überproportionale jährliche Wachstumsraten auf­ weisen. Weiters würde eine Umrechnung derZuwendungen auf die Parteiwähler ergeben, daß sich dieser Personenkreis mit einem jäh rlichen indirekten Beitrag von etwa 70,- quasi zu einem Mitgliedsbeitragszah ler entwickelt hat. In Anbe­ tracht dieser Zahlen erscheint die 1970 vom Bundesfinanzreferenten erhobene Forderung " nach etwa zwei bis drei Schilling je Wähler" geradezu als fromme lIIu­ sion 34 ). Die Subventionierung der Parteientätigkeit ist auch im Bereich der Gemeinden Oblich; da eine Befragung sämtlicher Gemeinden nicht möglich ist, wurde inso­ weit eine Auswah l getroffen, als die Landeshauptstädte direkt befragt wurden. DieBefragung derBezirksparteisekretäre ergab, daß etwa 52% derBezirkspartei33) DieZah len stammen durchwegsausAntwortsch reiben derLandtagskanzleien,denen inder Regel auch Gesetze bzw. Jahresvorschläge beigefOgt sind; lediglich in einem Bundesland m ußte die Auskunft der Partei eingeholt werden. Der Befragungszeitraum erstreckte sich vom 2. April bis 24. Juli 1979. 34) s. Aussage des damaligen Bundesfinanzreferenten, Dr. Klauhs, in: Profil, Nr. 2/1970, S. 26. 373 " " Tabelle 4 Zuwendungen der Landeshauptstädte an die ÖVP (1979)3:5) Stadt Bregenz Innsbruck Salzburg Klagenfurt Graz Linz Eisenstadt Klub Partei 850.000,1 ,700.000,260.000,- 400.000,- .lII Sonstiges Summe 1 30.000,- 1 30.000,850.000,1 ,700.000,160.000,400.000,260.000,- 160.000,- 3,500.000,sekretariate über Zuschüsse der Gemeinden verfügen, die sich durchschnittlich auf etwa 80.000,-je Bezirk belaufen. Bei Berücksichtigung dieser Angaben und der Tatsache, daß auch eine Unterstützung der Gemeindeparteien durchaus üblich ist, kann deshalb ein Betrag von 13,5 Millionen auf kommunaler Ebene als absolute Untergrenze angesehen werden. Tabelle 5 Unmittelbare Zusch üsse der öffentlichen Hand zur Förderung der Tätigkeit der ÖVP Zuwendungen 11. Parteiengesetz Klubzuwendungen Bildungsarbeit 8undesländer Landeshauptstlldte Bezirke Gemeinden Parteijugend (Bundesjugendring) 25,200.000,1 0,275.000,14,100.000,1 02,91 0.000,3,500.000,7,000.000,3,000.000,4,1 36.000,170,121.000,- ,3 .3.4.5. Sonstige direkte, indirekte oder unmittelbare Zuwendungen Die bisher angegebenen öffentlichen Subventionierungsmaßnahmen können als unmittelbare Finanzierung der Parteientätigkeit angesehen werden. Soll aber zumindest ein Ansatz zu einer umfassenden Finanzierungsrechnung der öffent­ lichen Hand versucht werden, sind eine Unmenge von weiteren U nterstotzungs­ maßnahmen in die Rechnung einzubeziehen. Dabei muß aber darauf aufmerk­ sam gemacht werden, daß eine exakte monetäre Messung nur in den seltenste n Fällen gelingen kann, weshalb wir uns in manchen Fällen mit einer deskriptiven Beschreibung begnügen werden müssen. Dennoch wird deutlich werden, daß die direkten Zah lungen der öffentlichen Hand nur einen Bruchteil der Beträge ausmachen, die der Staat in die Förderung der Parteientätigkeit investiert. 35) Die Angaben beruhen auf schriftlichen Informationen der Jeweiligen Maglstratsdirektoren; wegen der unklaren An�Nort muß c.<ie Angabe für die Stadt Linz eher als Schätzwert angesehen werden. 374 '. Im Folgenden werden einige Beispiele für m ittelbare, i ndirekte und verdeckte staatliche Finanzierungsmaßnahmen36) angeführt. Als wesentliche direkte Unterstützung einer Partei ist wohl die Bezah lung der Politiker durch die öffentliche Hand anzusehen. Bei Addition der mir zur Verfü­ gung stehenden Unterlagen37 ) zeigte sich, daß die 363 Spitzen politiker derÖVP jährlich etwa 200 M illionen an Gehältern beziehen, was einem durchsc h nitt­ lichen Jahresgehalt von 550.000,- entspricht. In einer zweiten Betrachtungs­ ebene müssen auch die etwa 1.600 Bürgermeister berücksichtigt werden, die der ÖVP angehören. Geht man dabei von einem durchsch n ittlichen Jahres­ gehalt von 150.000,- aus, so errechnet sich eine Höhe der Bezüge der ÖVP­ Komm unalpolitiker von etwa 240 M illionen jäh rlich. Zusätzlich m üssen bei dieser direkten staatlichen Leistung noch zwei Aspekte Berücksichtigung finden: Einerseits gibt es im österreichischen "Beamtenstaat" eine relativ hohe Zahl von Abgeordneten, die alsBeamte ihre Gehälter beziehen, aber auch als Parteipoliti­ ker entschädigt werden, andererseits ermöglicht die Bestimmung, wonach Beamte auf den Kandidatenlisten einer Partei für den Wah Ikampf freigestellt wer­ den müssen, den Wahleinsatz von öffentlich Bediensteten für Parteizwecke38 ). Aus amerikanischen und bundesdeutschen Untersuc h ungen überdie Höhe von Wahlausgaben kann man deutlich erkennen, welchen Vorteil es für Parteien be­ deutet, kostenlose Sendezeiten zur Verfügung gestellt zu erhalten39). In dieser H insicht sind die österreich ischen Parteien sehr gut gestellt, da § 5 des Rundfunkgesetzes bestimmt, daß derÖsterreich ische R u ndfunk 1% seiner Sen­ dezeit a n die im Nationalrat vertretenen Parteien zu vergeben hat. M ü ßte diese Sendezeit bezahlt werden, entstünden der ÖVP jährliche Aufwendungen von etwa 25,5 Millionen. Tabelle 6 Kosten der Organisation und Durchführung der NR-Wahl 1975 Wählerevidenz Ersatz an Gemeinden Leistungen ue, Siaatsdruckerei Druckkosten Werkleistungen Sonstige Ausgaben Postleistungen Amtserfordernisse 17,800.000,8,600.000,1 ,800.000.425.000.900.000.80.000,70.000.45.000.- 59.6 28.6 6.0 1 ,3 3,0 0,2 0.2 0.1 29.72 0.000,- 1 00.0% 36} s. Wicha. Barbara. a.a.O .• O.J .. Wien. S 48. 49 37} Die Zahlenangaben beruhen aufSchreiben derlandtagskanzleien und den Jeweiligen BezOgegesetzen; es war In vielen Fallen allerdings nicht mOglich. Zulagen und sonstige Zahlungen exakt festzustellen. Die Landes­ hauptmAnner sind in dieser Aufstellung nicht enthaJte 'll da sie nach dem BezOgegesetz vom Bund bezahJt wer­ den ( Entlohnung analog einem Minister). Die sechs uVP-Landeshauptieute wOrden Jedoch Kosten von ca. neun Millionen Schilling Jährlich verursachen ( vgl. dazu Profil. Nr. 4 3/1979. S. 24 ). 38} Bei Betrachtung der hinteren Platze auf den Nominierungslisten der Parteien wird man feststellen kOnnen. daß darunter Oberproportional viele Offentllch Bedienstete aufzufinden sind; nAhere I nformationen bietet eine Bro­ schOre des Bundesministers fOr Inneres: "Die Nationalratswahlen 1 979", Wien 1 979, S. 26.,'30. 39) So sollen allein die Fernseh-Werbezeiten des US-PrAsidentschaftskandidaten Humphrey 1968 etwa 5.3 Millio­ nen Dollar gekostet haben; s. Schleth, a.a.O.• S. 84/85. 375 Es ist in entwickelten Demokratien allgemein üblich, die Kosten für die Durchfüh­ rung und Organisation von Wahlen aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten. Wie den Bundesrechnungsabschlüssen zu entneh men ist4 o), betrugen die Kosten der Nationalratswahl 1975 etwa 30 Millionen Schilling, wobei sich diese Ausga­ ben auf einen Dreijahreszeitraum verteilen. Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick verschaffen; bei Umrechnung der Angaben auf die Parteien und ent­ sprechender Aufteilung gelangt man zu einer jährlichen Summe von 3,5 M illio­ nen, die sich die ÖVP durch diese staatlichen Leistungen erspart. UnterBerück­ sichtigung der Landtagswahlen wird allerdings der doppelte Betrag als reali­ stisch anzusehen sein. Es ist bislang keiner Arbeit gelungen, eine systematische Erforschung von indi­ rekten, verdeckten oder getarnten Parteisubventionen auch nur annähernd zu erreichen; diese Intention würde sehr schwierige Untersuchungen und auch ein Eindringen in " informelle Kanäle " e rforderlich machen; jeder Versuch, konkrete Zahlen zu nennen, ist beim derzeitigen Datenmaterial als unwissenschaftlich zu bezeichnen. Als Beispiele dieser verdeckten Subventionierung seien die Gründung von Scheinvereinen, die " Meinungsforsch ung " sowie die Möglichkeit von Manipula­ tionen im Zusammenhang m it der Erteilung öffentlicher Aufträge erwähnt, wobei das " kick-back-Verfahren " hervorgehoben werden m uß, das darin besteht, daß die öffentliche Hand A ufträge zu überhöhten Preisen vergibt, ein Teil dieser Zah­ lungen aber wiederum in eine Parteikasse fließt4 1). Ein beliebter Angriffspunkt ist regelmäßig auch die " Regierungspropaganda", mit der gleichzeitig für eine Partei geworben werde und die damit auf "eine nur in Diktaturen übliche Gleichstellung von Staat und Partei h inausläuft "42). Es dürfte allerdings außer Zweifel stehen, daß ein größerer Teil der den Ministe­ rien alljährlich zur Verfüg ung stehenden Informationsmittel in der Höhe von etwa 120 Millionen für echte Informations- und nicht für Parteizwecke zur Verfügung stehen43). Es h ieße aber wohl den Anspruch einer Partei aufWiedererringung der Meh rheit zu verkennen, wollte man nicht annehmen, daß in vielen Fällen zumindestPositiv­ werbung betrieben würde44). Leider ist es nicht möglich, einen Großteil der indirekten bzw. verdecktenZuwen­ dungen an Parteien exakt festzustellen. Fur die Zwecke dieser Untersuchung ist 40) vgf. BR-Abschluß 1 977, Ansatz 1/1 1 1 27, BR-Abschluß 1 976, Ansatz 1/1 1 1 27, BR-Abschluß 1 975, Ansatz 1/1 1 1 27. 41) Manche derartige Fälle werden Inoffiziell manchmal erwähnt, sind aber nicht zu verifizieren. Vg. etwaProfif. Nr. 20 ff, 1 980, das im Zusammenhang mit dem ,AKH-Skandal' von angeblichen Parteizuwendungen berichtet. 42) vgf. etwa die Aussagen von Dr. Kohlmaier. Stenographische Protokolle, a.a.O., S. 1 4 .599. 43) Die HOhe dieser Mittel lAßt sich aus dem Bundesvoranschlag nur sehr schwerermil1eln, weshalb als Berech­ nungsgrundlage eine Anfrage der Abgeordneten Dr. Lanner und Genossen ,betreffend Ausgaben für Inserate, BroschOrenundsoflstigesWerbematerialderBundesregierungsowieMeinungsumfragen'herangezogenwird. 44) Als 1 96 5 eine Anzeigekampagne der CDU-Regierung in der BRD kritisiert wurde. erklärte ein fahrender Jurist. eine Regierung dOrfe ,sich doch dynamisch dafOreinsetzen, daß siean der Macht bleibt'. s. ,Der Sp,egel' vom 8 9. 1 965. 3 76 es jedoch als ausreichend anzusehen, wen n festgestellt werden kann, daß direk­ e Aufwendungen des Staates zur Förderung der Parteientätigkeit ein Mehrfa­ ches der Zahlungen an die Parteien erreichen. 3.3.5. S enden und deren Problematik Im Rahmen einer ernsthaften Untersuchung sind n icht vordergründige Skan­ dalisierungen von Relevanz, vielmehr geht es um eine Abschätzung desGesamt­ spendenaufkommens, der Motive der Geldgeber u nd eine Beurteilung deren potentiellen politischen Einflusses. Es h at sich als gefährlich erwiesen, nur wegen einigerweniger bedenklicher Einflußversuche zu negativen Aussagen zu gelangen; man kann feststellen, daß die Aussagen u mso vorsichtiger und diffe­ renzierter werden, je tiefer man in informelle Strukturen eindringt45). Vorweg kann festgehalten werden, daß Einnahmen, die knapp 20% derfinanziel­ len Basis der Partei repräsentieren, kaum alleinige Determinanten politischer Entscheidungen sein kön nen. Auch die I nteressengruppenforschung rückt mehr und mehr davon ab, Geld monokausal als entscheidenden Faktor in der Politik anzusehen46), sodaß spezielle politische Situationen anzutreffen sein müssen, damit Geld den Einfluß ausüben kann, der i h m bei oberflächlicher Be­ trachtung gerne zugeschrieben wird. 3.3.5.1. Spenden auf kom mu naler Ebene Die Tatsache, daß genaue U nterlagen über die Spenden auf Orts- u nd Bezirks­ ebene vorliegen, ermöglicht einen exakten Einblick in dahinterstehende Motive und potentiellen politischen Einfluß u nd eine Eingrenzung des "demokratisch bedenklichen Bereichs" . Drei Faktoren sind fürdie Höhe desAufkommens von Relevanz: Die Parteiagentu­ ren sind in untersch iedlichem Ausmaß in der Lage, für einen geregelten Spen­ denfluß zu sorgen bzw. diesen organisatorisch vorzubereiten. Weiters kann man feststellen, daß diejenigen Bezirke stark benacnteiligt sind, in denen wenig Mit­ tel- und Großbetriebe angesiedelt sind. Auch die räum liche Lage innerhalb des Bundesgebietes ist von Bedeutung; so sind beispielsweise bevölkerungsarme Landbezirke in Grenzregionen klar im Rückstand. Die Zahl der Parteimitglieder scheint nicht von Bedeutung für die Höhe des Spendenaufkommens zu sein; es zeigen sich auch keine signifikanten Untersch iede zwischen solchen Bezirken, In denen die ÖVP über die absolute Mehrheit verfügt, und wählerschwachenBe­ zirken. Tabelle 7 zeigt die Wirtschaftssektoren, aus denen Großspenden (über 1.000,-) an die Partei fließen. 45) Beyme, Klaus von, Interessengruppen in der Demokratie, MOnehen 46) s. Beyme, 8.a.0., S. 1 46. 1969, S. 1 46. 377 - Tabelle 7 Großspenden an die ÖVP auf kommunaler Ebene, aufgagliedert nach Wirt­ schaftssektoren47) Sektor Handel und Gewerbe Industrie Bauindustrie Fremdenverkehr Land- und Forstwirtschaft Banken Sonstiges Nennungen % 4 14 30.1 22.3 1 9.0 7.9 6.3 3.2 1 1 .2 1 26 1 00.0 38 28 24 10 8 Vier Aspekte, die teilweise auch auf Bundesebene relevant sind, müssen bei Betrachtung dieser Tabelle hervorgehoben werden : Da die Befragten die Bau­ industrie in der Regel neben der Industrie erwähnen, scheint festzustehen, daß Industriesektoren, die in hohem Ausmaß auf öffentliche Aufträge angewiesen sind, als besonders " spendenanfällig " gelten können. Weiters ist der Bereich " Handel und Gewerbe" als Großspender unterproportional vertreten. Entgegen manchen bisherigen Erwartungen und Aussagen, wonach auf kommunaler Ebene der " edle Privatspender ohne Motive" dominiere, scheint auch eindeutig festzustehen, daß die Wirtschaft auf Orts- und Gemeindeebene 98% der Groß­ spender stellt. Schließlich m u ß auch die Fähigkeitzu individueller Spendenorga­ nisation seitens der Agenturen hervorgehoben werden, die etwa in landwirt­ schaftlichen Bezirken die Landwirtschaft und in Industriebezirken die Industrie zum Spender Nummer eins werden läßt. Die Untersuchungen ergaben eine Zahl von etwa 18 M illionen Schilling, die auf kommunaler Ebene der ÖVP aus dieser Einnahmekategorie zufließt. 3.3.5.2. Spenden bei Teilorganisationen und auf Bundesebene Zwei Unterschiede zu den Spenden auf kommunaler Ebene sind feststellbar: Einerseits dürfte auf dieser Parteiebene ein Ansteigen derZahl derGroßspender und deren Anteil am Spendenaufkommen eintreten, weiters ist auch ein Anstei­ gen der Spenden vonjuristischen Personen gegenüberder kommunalen Ebene zu registrieren. Ein weiteres, politisch nicht gänzlich unbedenkliches Faktum ist der zum Teil krasse Unterschied bezüglich des Spendenautkommens, der zwischen den Teilorganisationen, auch innerhalb einesBundeslandes, besteht; dieser ist allerdings nicht auf die Zah l der Mitglieder als vielmehr die R nanzkraft der Anhänger und auf die politische Rolle derTeilorganisation im jeweiligen Bun­ desland rückfüh rbar. Gerade in jenen Ländern, in denen der Landeshauptmann eine dominante Rolle spielt, verfügt die entsprechende Teilorganisation über ein 47) Diese Tabelle darf nicht als sehrexakt angesehen werden. dadie Kategorisierung von den Partei sekretAren vor­ genommen werden konnte und deshalb gewisse UnschArfen angenommen werden mOssen. 378 sehr hohes Spendenaufkommen. Ähnliche Untersch iede, wie sie für die Einnah­ men aus M itgliedsbeiträgen erarbeitet wurden, dürften also auch für diesen Bereich Gültigkeit besitzen. Auf Grund der Unterlagen gelangt man zu einer Einnahmenhöhe der Teilorgani­ sationen von 15 Millionen Schilling, die jedoch als absolute Untergrenze anzu­ sehen ist. AufBundesebene werden die Einzelspender völlig i n den H intergrund treten; sie werden ersetzt durch Interessenorganisationen und große Unternehmungen. Auch bezüglich der Frage nach den Motiven der Spender wird festgestellt werden können, daß es diesen wohl weniger um persönliche Bekanntschaften geht, sondern daß in diesen Dunkelbereichen Lobbyisten mit allen M itteln ver­ suchen werden, die I nteressen ihrer Mitglieder durchzusetzen. Im Rahmen dieser Betrachtung kann auch keine glaubwürdige Trennung zwischen Spenden an die Bundesparteizentrale und die Bundeszentralen der Teilorganisationen vorgenommen werden. Geht man vom Steueraufkommen, das durch die EStG-Novelie 1975 bedingt ist und 1 978 ca. 22 Millionen betragen hat, aus, so wird wohl die Vereinig ung Öster­ reichischer Industrieller als Hauptspender anzusehen sein; derGeneralsekretär erklärte ausdrücklich die große Bedeutung dieses Gesetzes mit dem Hinweis darauf, daß der "Schwarzenbergplatz" (Sitz der VÖI) außerordentlich stark betroffen sei48). Geht man im Rahmen eines Schätzverfahrens davon aus, daß m it Sicherheit ein größererTeil dero.a. Steuerzahlungen ÖVP-nahen Organisationen zuzurech nen ist, würde man zu einer Spendenhöhe von ca. 43 Millionen Schilling aufBundes­ ebene gelangen49). 3.3.5.3. Motive und Einflußmöglichkeiten von Geldgebern Die bisherige Analyse hat gezeigt, daß strenge Unterscheidungen zwischen nie­ driger und höherer Ebene sowie Massen- und Großspenden notwendig sind, um eine realitätsnahe Beurteilung dieser Einnah menkategoerie zu ermöglichen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß die kleinen Massenbei­ träge als " ideologischer Mäzenatismus" im Sinne Max Webers50) angesehen werden können und deshalb demokratietheoretisch ü berzeugend zu rechtferti­ gen sind. 48) Diese Aussage grOndet sich auf ein Schreiben des Generalsekretars der Vereinigung Osterreichischer Indu­ strieller vom 2 4. 8. 1 979. 49) Geht man vom verlaßlichsten Bericht Ober die Parteifinanzen zu Beginn der 70er Jahre, Profil, Nr. 2/1 970, aus, waren demnach in einem Jahrzehnt die Einnahmen derOVP um mehr als 400% gestiegen. Da auf Grund dieser Arbeit Im Bereich der Spenden nur eine unterproportionale Steigerung von etwa 200% angenommen wird, lst die sehr vorsichtige Schatzung deutlich dokumentiert. Die angegebene SpendenhOhe ist also mit Sicherheit als absolute Untergrenze anzusehen, v.a was die Spenden an dieBundesleitungen derTeilorganisationen an­ gehl 50) Weber, Max, a.aO., S. 168. 379 Im Bereich derGroßspenden wurden die Bezirksparteisekretäre gebeten, deren Motive zu beurteilen; die nachfoigende Tabelle soll dieAntwortllaufigkeit zeigen: Tabelle 8 Ansinnen von Großspendern an die ÖVP auf kommunaler Ebene51 ) Interesse an der Fortsetzung der bisherigen Politik der Partei Interesse an bestimmten ideologischen Leitlinien Wunsch nach U nterlassung bestimmter Maßnahmen oder Gesetzesvorhaben konkreter Wunsch mit monetären Folgen fOr die Allgemeinheit Aufbau pers. Beziehungen 11 12 25,0 22,9 37,5 4 3, 3 7 1 4,8 2 1 ,9 16 2 33,3 42 50,0 48 1 00,0 , 6,2 Während die beiden ersten Antwortkategorien als "Versicherungsprämie " gegen unangenehme und einsch neidende Änderungen angesehen werden können, ist der Bereich persönlicher Patronagemöglichkeiten und individueller Vorteile eindeutig als bedenklich anzusehen. Jedoch ist Schleth zuzustim men, wenn er die Auffassung vertritt, es gäbe keine überzeugende Rechtfertigung für Großspenden; in diesem Pokerspiel gehe es tendenziell um die Interessen von einigen Mächtigen und nicht der großen Masse52), G roßspenden mit der Intention der " Versicherungsprämie" können vielleicht bei einer i nteressenpartei als legitim angesehen werden, aber nichtbei einersich als " " dynamisches Element einstufenden Volkspartei, Die Möglichkeit des politischen Einflusses von Großspendern ist grundsätzlich unter dem "Grenzkostenaspekt" zu betrachten ; kann eine Parteiagentur auf den Ausfall von G roßspenden durch die Umleitung anderer Einnahmen reagieren, besteht eine geringere Gefahr der Abhängigkeit als in Bereichen, die zu beinahe 100% auf Spenden angewiesen sind und in denen eine Kompensation etwa durch öffentliche Gelder nicht möglich ist. 3.3,6, Sonstige Einnahmen Die ÖVP hat sich bislang kaum unkonventioneller Methoden der Mittelaufbrin­ gung bedient, wie sie international durchaus üblich sind53), 5 1 ) Die zweite Spalte gibt die relative Prozentzahl an, die dritte IstaufdieZahl der Antworten -32 - bezogen und damit von grOßerer Bedeutung. 52) S. SChleth, Uwe, a.8.0., S. 321 . 322. 53) So sollen etwa in manchen Wahlkreisen bis zu 80% der Einnahmen der Labour�arty aus dem WettgeschAft stammen. Vor allem die amerikanischen Parteiagenturen haben teilweise erfolgreiche Praktiken der unkonven­ tionellen M ittelaufbri ng ung entwickelt, etwa Lotterien, Golfspiel, Tanzabende, Versteigeru ngen oder Festessen mit politischen Exponenten. S. SChleth, a.a.O., S. 133, oder Shannon, Joseph, Money and POlitics, New York 1 959. Auch in derOVP sollen zu Beginn der 70er Jahre, In einem Zeitraum prekArer Finanzen, Essen mit potentiellen Großspendern Oblich gewesen sein. Vgl. PRORl, Nr. 2/1970, wo ein .Wenger.Jnstitut· angefOhrt wird. 380 Deshalb sind als bedeutendste " Sonstige Einnahmen " die Erlöse aus Veranstal­ tungen, der Verkauf von Zeitschriften und Zeitungen und die E i n nahmen aus dem " Parteischilling " anzusehen, wobei es sich bei diesem um eine institutionali­ sierte Spendenaktion gerade in Wah lkampfzeiten handelt. Es ist sehr schwierig, Determinanten für die Höhe dieser Einnahmen zu finden; die Parteiagenturen scheinen abergerade in Zeiten "chronischer Kassenknappheit " verstärkte Initia­ tiven zu entfalten. DerÖVP dürften jährlich knapp 40 Millionen Schilling aus die­ ser Kategorie zufließen, wobei darin aber völlig u nterschiedliche Einnah men­ arten enthalten sind. Diese Einahmen sind vor allem bei Teilorganisationen auf Landes- und Bundesebene sowie den Landesparteileitungen anzutreffen 54). Abschließend sei eine tabellarische Aufschlüsselung der Einnah men der ÖVP vorgenommen, wobei folgende Feststellungen getroffen werden sollten: Die Par­ teibereiche werden völlig u nterschiedlich finanziert, denn während etwa als Hauptempfänger der Mitgliedsbeiträge die Teilorganisationen auf Landesebene anzusehen sind, fließen öffentliche Zuwendungen primär der B u ndesparteizen­ trale und den Landesparteileitungen, in spezifischer Form dem Parlamentsklub und der Politischen Akademie zu. Die Bezirke u nd Orte sind zu einem Großteil auf das Machtpotential der Partei in der jeweiligen Region und die Phantasie der Funktionäre angewiesen. Tabelle 9 Jährliche Gesamteinnahmen der ÖVP (Ende der 70er Jahre) Öftentliche Zuwendungen MitgliedsbeitrAge Partei steuern Spenden Sonstiges 1 70.000.000,1 3 1 ,000.000,42.500.000,75,000.000,38,000.000,- 37,2 28,7 9,3 1 6,4 8,4 456,500.000,- 1 00,0% Wegen der Unsicherheiten in den Angaben können folgende " Bandbreiten" an­ genommen werden, die eine Revision nach oben oder unten von etwa 20 bis 25 Millionen herbeifüh ren könnten: Mitgliedsbeiträge: 6 Millionen (= 5%) Parteisteuern: 2 Millionen (= 5%) Spenden: 11 Millionen (=15%) Sonstige Einnahmen: 4 Millionen (=10%) 54) Die wesent l ichsten ,Sonstigen Einnahmen' sind ErlOseaus Veranstaltungen, der Verkauf von Zeitschriften und Zeitungen oder die Einnahmen aus dem ,Parteischilling', einer institutionalisierten Spendenaktion gerade in Wahlkampfzeiten. Auf Grund derBefragungen erreichen die ,Sonstigen Einnahmen" je Bezirketwa 25.000,-,je Teilorganisation etwa 290.000,- sowie 7,000.000,- fOr die Bundesparteizentrale. 381 Tabelle 10 Verteilung der Gesamteinnahmen der Ö VP (Ende der 70er Jah re) Orte Bezirke Teilorganisationen - Land Landesparteileitungen Teilorganisationen - Bund Bundesparteizentrale Politische Akademie Parlamentsklub 1 6,1 60.000,37,772,000,1 1 0,000.000,1 50,000.000,62,000.000,50,000.000,1 4, 120.000,1 6,4 10.000,- 3,5 8,3 24,0 32,9 1 3,6 1 1 ,0 3,0 3,6 456,462.000,- 99,9% 3.4. M ittelverwendung Aus u nschwer durchschaubaren G ründen ist die Einnahmenstruktur einer Par­ tei von u ngleich größerer Relevanz; so sind von der Aufbringung der Gelder nahezu alle Parteimitglieder betroffen, von der Entscheidung über gewisse Aus­ gaben ledig lich eine kleine Funktionärsschicht. Die gesamte Aufbringung der Gelder erscheint auch und gerade u nter dem Aspekt der Motive der Geldgeber, deren Einflußmög lichkeiten und potentieller innerorganisatorischer Auswirkun­ gen problematisch zu sein, während im Ausgabenbereich allenfalls durch Auf­ tragsvergaben politischer Ei nfluß ausgeübt werden kann - sieht man von der grundsätzlichen Verteilung der Mittel auf die Parteibereiche ab. Die Tabellen 11 u nd 12 sollen nunmehr die Ausgaben der ÖVP, gegliedert nach Kostenarten und Parteibereichen, feststellen. Tabelle 11 Jährliche durchschnittliche Ausgaben der ÖVP (Kostenarten) 55) Personalkosten Büro und Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen Sonstiges 1 00,000.000,1 40,000.000,1 1 0,000.000,46,000.000,60,000.000,- 2 1 ,9 30,7 24,1 1 0,1 13,2 456,000.000,- 100,004 E i n politisch und ökonomisch völlig andersgearteter Bereich muß allerdings von einer G leichsetzung von Einnahmen und Ausgaben ausgenommen werden: die Wahlkampffinanzierung. Gerade diese Aufwendungen wären u nter dem Aspekt der "G renzkostenbeeinflussung " sorgfältig zu untersuchen, da n icht unbedingt die Höhe der gegebenen Mittel oder deren Geber von großer Bedeutung sind; 55) Die Tabelle muß wegen der unklarenAbgrenzung zwischen Ö ffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Sonsti­ gen Ausgaben vorsichtig beurteilt werden und dürfte lediglich Tendenzen anzeigen. Allerdings ist weniger die Aufteilung nach KostenElrten als vielmehr nach Parteibereichen von Bedeutung. 382 r I, �ielmehr dürften die potentiellen politischen Einflußmöglich keiten von Rnan­ � iers mit derGeldknappheit derPartei, die vorWahlen in derRegel sehrgroß sein �ird, ansteigen. abelle 12 Jährliche durchschnittliche Ausgaben der ÖVP (Parteibereiche) Bezirke eilorganisatIonen - Land elIorganisationen - Bund andesparteizentralen lBundesparteizentrale !t<lub Politische Akademie Orte (soweit erfa6bar) 35,000.000,1 1 4 ,000.000,60,000.000,1 50,000.000,50,000.000,16,000.000,14 ,000.000,1 1 ,000.000,- 7,7 25,0 1 3,1 32,9 1 1 ,0 3,5 3,1 3,7 456,000.000,- 1 00,0% Wah lkampfausgaben sind keine isoliert zu betrachtende Größe, sondern hän­ gen auch von einigen gesamtgesellschaftlichen Faktoren ab; zu erwäh nen sind vor allem die Bedeutung einer Wahl tür das politische System, die Möglichkeit einesMachtwechselsund die miteinemWahlsiegverbundenenMachtpositionen und Patronagemöglichkeiten. Auch regionale u nd gesetzliche Umstände wie etwa die Größe des Landes und das Wahlverfahren sind von Bedeutung 56). Die einzige einigermaßen verläßliche Quelle über die Höhe der Wahlwerbungs­ kosten bietet das Parteiengesetz, das den Parteien vorschreibt, ihre Kosten einer fKommission des Innenministeriums bekanntzugeben. Nach dieser Aufstellung . !Sind der ÖVP bei der Nationalratswah l 1975 folgende Kosten entstanden: �abelle 1 3 iWahlwerbungskosten der Ö VP (1975) 57) , lJIakate �serate .elangsendungen Im ORF tierbefl1m "ublikat,onen Luftfahrzeuge 6,576.233,54 1 5,321 .093,38 1 .1 40.237,00 978.975,54 4,872.383, 86 279.037.59 22,5 52,5 3 ,9 3,4 1 6,7 1 ,0 9 167.960,9 1 1 00,0% 2 , �ür die Richtigkeit dieser Angaben spricht die Tatsache, daß die in der Überprü­ ifungskommission vertretenen Parteifunktionäre als Insider sehr woh l über die �ufwendungen der jeweils anderen Partei Bescheid wissen und deshalb eine [Gegenseitige Kontrolle geWährleistet ist; auch die Sanktionsmöglic h keit des 1f6) Diese u n d andere Determinanten werden von den meisten Autoren genannt, vgl. etwa Schleth, Uwe, aaO., S. 93 11. • oder Heard, Alexander, The Costs of Democracy, a.a.O., S. 337 tf. 17) Diese Kosten beziehen sich nur auf den Zeitraum von fOnf Wochen vor dem Wahltag bis zu diesem. 383 Parteiengesetzes spricht für die Richtigkeit der Angaben. Zu einer skeptischen Beurteilung wird man aus zwei G rOnden gelangen müssen: Einerse;ts k"nme die Fünf-Wochen-Frist dazu verleiten, Aufwendungen in einen früheren Zeitraum LU verlagern, während andererseits von dieser A ufstellung wohl nurdie Bundespar­ teizentrale betroffen sein wird. Plakataktionen oder sonstige Aufwendungen von Ländern oder Teilorganisationen müssen also zusätzlich betrachtet werden. Zu großer Vorsicht bei der Betrachtung derTabelle soll auch die Tatsache verleiten, daß lediglich von tatsächlichen Ausgaben, also ohne Berücksichtigung nicht­ monetärer Finanzierungsformen, ausgeht; welche Dimensionen die Wahlwer­ bungskosten in diesem Fall erreichen würden, soll anhand der freiwilligen Wah l­ helfer gezeigt werden: Wenn jeder der etwa 84.000 Wah lhelferS8) lediglich zehn Stunden für die Partei arbeitet und dafür entlohnt würde, entstünden Kosten in der Höhe von 336 M illionen Schilling. Ebenso müßten nicht-monetäre Unterstüt­ zungen von Unterneh mungen, wie etwa die Bereitstellung von Textverarbei­ tungsanlagen, Fah rzeugen oder auch q ualifizierten Mitarbeitern, einbezogen werden; allein diese skizzenhafte Darstellung zeigt die Schwierigkeit bei der Beurteilung der obigen Tabelle. 4. Finanzierung und i n nerparteiliche Demokratie Im Rahmen derUntersuchung desZusammen hangszwischen Finanzierung und innerparteilicherDemokratie wird als Ebene, auf der beide Aspekte von Relevanz sind, die Masse der " mobilisierungsfähigen Parteimitglieder" 59) herange­ zogen, obwohl diese Auffassu ng nicht zu vorschnellen Schlüssen wie etwa einem "elitären Demokratieverständnis" führen darf. Doch wären zum Zweck einer Aktivierung aller Mitglieder Strategien zu beschreiten, die weit über den Finanzierungsbereich hinausführen, daesfalsch ist, mangelnde innerparteiliche Demokratie monokausal aufFinanzfragen zurückzuführen. Vielmehr liegen wich­ tige Hindernisse etwa im organisatorischen Bereich , wie die Bezeich nung " "Raschheit und "Entscheidungsschnelligkeit" andeuten sollen, in der Verfü­ gung über die Parteipresse, im Informationsflu ß oder derLegitimierungsfunktion von Parteitagen. Als weitere Hemmnisse sind auch die Notwendigkeit eines ge­ schlossenen Auftretens u nd die zunehmende Gefahr der Expertokratie und Außensteuerung anzusehen. Es muß auch bedachtwerden, daß wichtige Macht­ mittel, wie etwa Patronagemög/ichkeiten, Vergabe von Parteipositionen oder Geheiminformationen, eben nur in den Händen einiger weniger liegen60). 58) Diese Zah I errech net sich aus der In einerUmfrage angegebenen durchschnittlichen Zahl von etwa 730 Perso­ nen je Bezirk, die - besonders in Wahlkampfzeiten - zu einem Einsatz fOr die Partei bereit sind. Diese Zahl von ,MobilisierungsfAhigen' zerstOrt wohl manche illusion, es handle sich bel der OVP um eine ,Partei von Akti­ visten'. 59) Eine Reduktion der Frage derinnerparteilichen Demokratie auf ein Eliten�egen-€llten-Modell erscheint weder notwendig noch angebracht; eine Auseinandersetzung mit allen Mitgliedern Ist ebenfalls nicht zweckmäßig, da diese grundsätzlich nur als Zahler des MitgliedSbeitrags in Frage kommen. 60) Zur Vielzaht an Literatur aber diese Fragen siehe etwa: Lohmar, Uirich, lnnerparteiliche Demokratie, Stultgart 1 963, Zeuner, Bodo, lnnerparteiliche Demokratie, Colloquium-Vertag, Berlln 1 969, Wimmer Rudoll, Zur inner­ parteilIchen Demokratie in der OVP, Osterreichische Z eitschrift fOrPolitikwissenschafl, 1/74, S. 28 ft, Pelinka, Anton, Dynamische Demokratie, Stutlgart 1 974, Naschold, Frieder, Organisation und Demokratie. Verlag Kohl­ hammer 1 973,JAger, Wollgang (Hrsg.), lnnerparteilicheDemokratie und Repräsentation, in: Partei und System, Verlag Kohlhammer, 1 973, Stirnemann, Allred, Innerparteiliche Demokratie in der OVP, In: KohVStirnemann (Hrsg.) Osterreichisches Jahrbuch fOr Politik 1 980 a.a.O. 384 ei dieser Fülle von H indernissen spielt die Ausgestaltung des Rnanzierungs­ bereichs nur eine wichtige, nicht aber die allein entscheidende Rolle, sehr wohl ann sie aber bestehende Tendenzen verstärken oder abschwächen. ie Begriffe Partizipation und Demokratie würden umfassende theoretische Dis­ kussionen erfordern, die allerdings in diesem Zusammenhang n icht notwendig erscheinen 6 1 ) ; es ist vielmehr - von einer praxeolog ischen Betrachtungsweise ausgehend - die Frage zu stellen, ob die Finanzierung einer Partei geeignet ist, eine möglichst breite M itbestimmung der Parteimitglieder in wichtigen Fragen u nd eine demokratische Auslese und Kontrolle zu gewährleisten bzw. vorhan­ dene Mängel zu verstärken oder abzubauen. 4 . 1 . I nnerpartei l ich e Willensbildung u nd I nteressenaus­ gleich Soll der E i nfluß von Finanzierungsfragen auf die i n nerparteiliche Willensbildung u ntersucht werden, ist festzustellen, aufwelcher Ebene finanzielle Entscheidun­ gen getroffen werden , ob sie als Einzel- oder G ruppenentscheidungen gefällt werden, u nd wer darüber informiert ist. Damit hängt auch u n mittelbar die Ein­ schätzung der Finanzreferenten als " graue Eminenzen " oder " ökonomische Sachverwalter" zusammen. Es ist auch nötig, die Finanzstärke derTeilorganisa­ tionen zu untersuchen und danach zu fragen, ob finanzielle Erwägungen einen Einfluß auf politische E ntscheidungen haben könnten, eine Frage, die zwartheo­ retisch erörtert, kaum aber empirisch beweisbar ist. Dieses B ü ndel an Fragen vermag sicherlich keine Gesamtschau des E ntwicklungsstandes an innerpartei­ icher Demokratie zu bieten, sehr wohl aber gewisse Hemmnisse und Reform­ nsätze aufzuzeigen . Inanzielle E ntscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung werden von der undesparteileitung bzw. vom Bundesparteivorstand getroffen, die dabei vom u ndesfinanzausschuß beraten werden. Auf E bene der Länder und Teilorgani­ tionen werden - wie U mfrageergebnisse zeigen - derartige E ntscheidungen äufig von eine m sehr kieinen Team getroffen, das aus dem Sekretär, dem jeweili­ en Parteivorsitzenden u nd einigen wenigen M itarbeitern besteht. ir können drei u nterschiedlich sensible Bereiche feststellen, was AIIeinent­ heidungen der Funktionäre betrifft: Für die Erhöh ung von M itgliedsbeiträgen nd die E instellung qualifizierter M itarbeiter ist das entsprechend höchste Par­ igremium i n Bund, Land oder Teilorganisation zuständig; diese beiden Berei­ he sind also für Einzelentscheidungen praktisch tabu. In den Bereichen Öffent­ chkeitsarbeit und Organisation haben die Sekretäre gewisse Kompetenzen; iese hängen von den Kosten und der Dimension der E ntscheidung ab. Es 1 ) Man kOnnte - m i t Stammer - davon ausgehen, daß eine Partei in dem Maße demokratisch ist, wie sie ihre Mitglie­ der zurTeilnahme an derWitlensbildung der Organisation beru<t und befähigt, durch ausreichendetnformation von oben nach unten fOr eine flOssige Meinungsbildung in der Hierarchie von unten nach oben zu sorgen und die FOhrung der KontrotJe der M itgliedschaft mit dem Recht aUlf Abberufung zu unterstellen. s. Stamm er, Otto, Politische Soziologie, In: Gehlen, Schelsky, Soziologie, DOssteldorl-KOln 1 955, S. 29 1 . 385 werden also solche Entscheidungen an höhere Gremien " delegiert" , die entwe­ der die Parteibasis finanziell berühren (Mitgliedsbeitrage) oder Konsequenzen für den politischen Prozeß haben könnten (Mitarbeiterauswah l). Die geringe Zahl von finanzinformierten Mitgliedern62) könnte den Schluß nahe­ legen, bei den Finanzreferenten handle es sich um graue E minenzen in der Par­ teihierarchie. Zwar ist es durchaus möglich, daß bestimmte Finanzreferenten in Zeiten, in denen unumgängliche Ausgaben noch n icht abgedeckt sind, einen Machtzuwachs aufweisen, besonders wen n sie neben dieser Funktion weitere politische Ämter bekleiden. Einer allzu großen Machtausweitung steht vor allem ein technokratisches Argument entgegen: Bedingt durch die Vielfalt der Auf­ gaben eines Parteisekretariats ist es häufig n u r dem Sekretär möglich , einen aus­ reichenden Überblick zu wahren. Machtansprüche von Finanzreferenten dürf­ ten auch durch die Aufmerksamkeit derTeilorganisationen kompensiertwerden, die auf einen sorgfältigen Interessenausgleich achten. Es sind allerdings durch­ aus Situationen denkbar, in denen Finanzreferenten einen Machtzuwachs erfah­ ren, wenn sie etwa in prekärertinanzieller Lage plötzlich die A ufbringung fehlen­ der Mittel garantieren könnten. Um komplexere Fragen wie die Gefahr der "A u ßensteuerung " und die Möglich­ keit des Einflusses von Finanzüberlegungen auf den politischen Prozeß zu beantworten, ist ein Blickaufdie unterschiedliche Rnanzstärke derTeilorganisa­ tionen nötig, deren wichtigste Ursache die I nkassoart, die Zahl und Finanzkraft der Mitglieder und die Möglichkeiten politischer u nd persönliCher Patronage sind. Wenn nun die Teilorganisationen wegen i h rer Rnanzstärke politische Forderungen durchsetzen können, kan n deshalb nicht von einer "Außen­ steuerung ", sondern eher einer Behinderung innerparteilicher Demokratie ge­ sprochen werden. Ein Faktum darf nicht übersehen werden: Die z.T. gewaltigen finanziellen Unter­ schiede zwischen den Teilorganisationen stellen ein Element der Ungleichheit dar, das beispielsweise einer finanzschwachen Organisation eine weniger in­ tensive Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht und damit längerfristig bereits bestehende Untersch iede noch weiter verstärken könnte. Strategien zur Stärkung innerparteilicher Demokratie müßten deshalb auch beim Versuch ansetzen, zumindest eine Abschwäc hung allzu großer Unter­ schiede zu bewirken. Die innerparteiliche und gesamtpolitische Schwächerstei­ lung m an cher Tei l organi satfo n en kann damit als indirekte Folge der Finanzierung bezeichnet werden. Es muß aber betont werden, daß derfinanzielle Einfluß aufden politischen Prozeß keineswegs von den Teilorganisationen allein ausgeht; im Gegenteil, als Einfluß­ mittel ersten Ranges wird sicher der Versuch von verstärkter "Außensteuerung " von Interessenvertretungen, vor allem in Zeiten " unsicherer Einnahmen " , anzu62) Die Fragebogenauswertung ergab etwa 10 Informierte je Bezirk und Informierte Je Teilorganisation. sodaß bur.desweit etwa 1 .500 Per�onen - zumindest Ober ihren eigenen Bereich - finanziell informiert sind. 12 386 sehen sein. Über diesen D unkelbereich der Parteipolitik kann äußerst wenig aus­ gesagt werden, jedoch dürften zwei Arten der Einflußnahme möglich sein: Wäh­ rend auf kommunaler Ebene ein " deutlicher Wink" eines Großspenders aus­ reichen könnte, um ein gewünschtes politisches Verhalten hervorzurufen, werden auf Bundesebene sehr viel subtilere Methoden anzuwenden sein, die etwa in einer kurzfristigen Geldüberweisung, verbunden mit politischen For­ derungen, oderdergezielten Förderung innerparteilicherGruppierungen beste­ hen könnten. Die Rolle des Geldes im politischen Prozeß ist sicherlich zu hoch; Gründe dafür sind die u nterschiedliche Finanzkraft derTeilorganisationen und die vielfältigen Möglichkeiten politischer Einflußnahme von außen. Betrachtet man weiters die Tatsache, daß nur sehrwenige Parteimitglieder überdie Finanzen informiertsind, scheint die Hypothese zulässig, daß die Regelung des Finanzwesens der ÖVP geeignet ist, andere Hindernisse innerparteilicher Demokratie sogar noch zu ver­ stärken. Wenn nun alle theoretischen Konzepte zurHebung derPartizipation der M itglieder beinahe utopisch klingen, sollte doch zumindest versucht werden, den aktivierungsfähigen Teil der Mitglieder zu verstärker Anteilnahme u nd Mit­ sprache anzuspornen. Daß angesichts der obigen Aussagen finanzielle M itspra­ che zwingend in verstärkter Partizipation mitenthalten ist, scheint evident. 4.2. E liten rekrutieru ng Soll die Finanzierung einer Partei demokratisch unbedenklich sein, muß einer­ seits sowohl die Rekrutierung der Spitzenfunktionäre, andererseits auch deren Vertretu ng in Spitzengremien der Partei u nd im Parlament frei von finanziellen Überlegungen sein. Es erscheint jedoch unnotwendig, die Spitzenfunktionäre in dieser Hinsicht zu u ntersuchen, da ein hoher Anteil von ihnen ex offo in diese Gremien entsandt wird63). Die Frage wäre damit auf die Rekrutierung i nnerhalb der Teilorganisationen zu reduzieren, was auf G rund der erforderlichen desaggregierten Untersuchung nur mit sehr komplexen Instrumenten möglich sein dürfte. D ie finanzielle Potenz eines Kandidaten spielt im österreich ischen politischen System, im Unterschied zu anderen Ländern 64), keine wesentliche Rolle. Auf Grund des außerordentlich h ohen Anteils von Verbändefunktionären im Natio­ nalrat kann aber doch vermutet werden , daß die Stärke und das Durchsetzungs­ vermögen von Verbänden eine wichtige Variable darstellen 65) • •3) Vgl. dazu die Untersuch ungen von Stirnemann. Allred • in: Khol-Stirnemann (Hrsg.), OsterrelchischesJ ahrbuch lOrPolitik, 1 980,a.aO., durch die seit 1 . MBrz 1 980 geBnderten Statuten ist allerdings mittellrlstig durchauseine Aulweichung dieser Strukturen möglich. ) Gerade in den USA scheint diese finanzJelie HOrde lOr Kandidaten das größte Problem der Politik Oberhauptzu sein ; so kostete bereits 1 968 der Vorwahlkampl von R. Nixon etwa 14 Millionen D ollar . '5) Pelinka hat festgestellt, daß 1 978 der Abgeordneten zum Nationalrat VerbandefunklionBre waren. Vgl. Pelinka, Anton, Volksvertretung als funktionale Elite, in Khol-Stlrnemann (Hrsg.), Osterreichisches Jahrbuch lOr Politik 1 979, a.8.0. 55.8% 387 Obwohl also die Finanzkraft eines Bewerbers um ein Mandat nicht bedeutsam ist, könnten doch - bedingt durch den "Streit" von I nteressengruppen um die Durchsetzung ihrer Exponenten - finanzielle Überlegu ngen von gewisser Bedeutung sein. Diese Überlegungen sollen lediglich andeuten, daß bei der Erörterung des Komplexes der i nnerpateilichen Demokratie eine " Durchgriffs­ betrachtung " auf innerverbandliehe Demokratie nötig ist. 5. Finanzieru ng und Organ isation Auch 70 Jahre nach R. Michels ist eine gewisse Fixierung auf seine zentralen Thesen, wonach Organisationen eine Tendenz zur Oligarchie beinhalten und diese damit " die M utter der Herrschaft der Gewählten über die Wähler sei " , nicht zu leugnen66). Auf diese grundsätzliche Problematik kann n icht weiter eingegangen werden, n u r bleibt festzuhalten, daß die zuneh mende Verfeinerung der organisatori­ schen Mechanismen einer Partei, die Statusdiskrepanz oder die Mitglieder­ apathie Faktoren sind, die Oligarch ietendenzen weiterh in fördern könnten. Deshalb ist bei der Festlegung von Zielen einer Organisation stets zu beachten, daß neben einem instrumentalen Ziel stets sozio-emotionale Faktoren zu beach­ ten sind; Leistungsziele sind also nur bei entsprechender Befriedigung der Fu nktionäre und Mitglieder einer Partei erreichbar67). Werden n unmehr Reformbestrebungen angesprochen, ist eine Verbindung zwischen einer möglichst großen Effektivität der Partei bzw. ihrer Subsysteme und einer größtmöglichen Handlungsautonomie anzustreben. Dabei sind im Finanzbereich zwei Varianten möglich: E inerseits könnte ein sehr kleines G remium geschaffen werden, das sämtliche zur Verfügung stehenden Gelder zentral vergibt, andererseits wäre eine finanzielle Gebarung in der bisherigen Form - m it ungleicher Verteilung und rein quantitativen Kriterien - denkbar. Die bestehende Variante mit ihren vielfältigen Nachteilen ist ausreichend bekannt, doch wären auch von einer zentralen Geldvergabe erhebliche Nachteile in sozio­ emotionaler Hinsicht, wie etwa eine Verstärkung von Oligarchietendenzen, zu erwarten. Eine mögliche Verknüpfung von Effektivitätsansprüchen u nd autonomen Hand­ l u ngsspielräumen bestünde in einer zentralen Rxkostenabdeckung und einer dezentralen Abwicklung u nd Rnanzierung von Aktivitäten für Öffentlich keits­ arbeit oder Veranstaltungen. 66) Michels, Robert, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Nachdruck der zweiten Auf· lage, Alfred-KrOner-Verlag, Stuttgart. C7) Zuden Fragen n3ch den ZiAle'leinarOrganisatlon s.H/ff/FehlbaumlUlrich.Organlsationslehre 1 ,a.a.O.• S. 1 4 1 11. 388 Diese Variante bedeutet also. daß sämtliche Fixkosten zentral bestritten werden; für die Verwendung der variablen Ausgaben sollten Kriterien wie Zahl der zu betreuenden Mitglieder. politische Situation im jeweiligen Parteibereich u nd prioritätenorientierte Aktionen herangezogen werden. 389