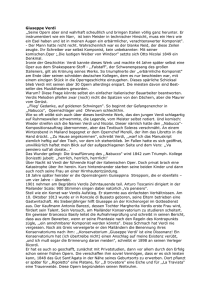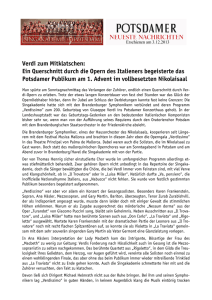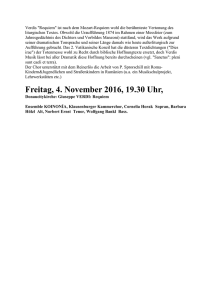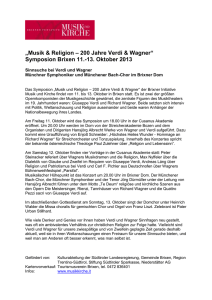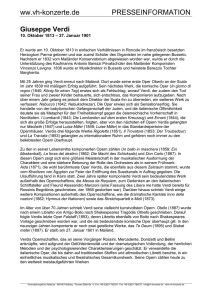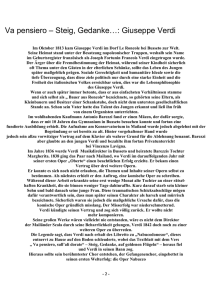„Schließlich ist im Leben doch alles Tod?“
Werbung

Der folgende Artikel ist in Heft 5 des 83. Jahrgangs (2013) der Zeitschrift Musik & Kirche erschienen (http://www.musikundkirche.de). Er wird hier mit freundlicher Genehmigung des Verfassers veröffentlicht. Als Mitherausgeber des „Verdi-Handbuches“ ist Uwe Schweikert eine der renommiertesten Verdi-Experten. Uwe Schweikert „Schließlich ist im Leben doch alles Tod?“ Verdi, die Kirche und die Religion Nach der Uraufführung des „Falstaff“ 1893 hatte Verdi mit dem Theater abgeschlossen. Nur mit der im August 1894 nachkomponierten Ballettmusik für die französische Premiere des „Otello“ ist er noch einmal zur Bühne zurückgekehrt. Seine letzten Werke, die 1896/97 entstandenen und 1898 in Paris uraufgeführten „Pezzi sacri“ – „Stabat mater“, „Lauda alla Vergine Maria“ und das machtvolle „Te Deum“ – sind geistliche Kompositionen. Man hat über die Gründe dieser Rückkehr des greisen Verdi zur Welt der Kirchenmusik seit jeher gerätselt, sollte allerdings nicht vergessen, dass sie, wie schon die „Messa da Requiem“ und die ebenfalls in den 1870er Jahren entstandenen kleineren Vertonungen des „Pater noster“ sowie des „Ave Maria“ nicht für den Gottesdienst bestimmt waren. Vor allem die beiden rein vokal besetzten Stücke („Pater noster“ und „Lauda alle Vergine Maria“) knüpfen trotz vieler Freiheiten in der Stimmführung wie in der Harmonik deutlich an die Polyphonie des Palestrina-Stils an, für dessen Bewahrung sich Verdi in Abgrenzung zur deutschen sinfonischen Musik nach 1870 mehrfach ausgesprochen hat. Mehr als fraglich jedoch ist, ob man dieses Bekenntnis zur nationalen musikalischen Tradition Italiens auch als ein Bekenntnis zur Religion werten darf. Die Frage, ob Verdi im Sinne der katholischen Religion gläubig, ja ob er überhaupt gläubig war, lässt sich nicht beantworten. Der in privaten Dingen notorisch verschlossene und sich hinter einen undurchdringlichen Schutzwall zurückziehende Verdi hat sich in seinen zahllosen Briefen nie dazu geäußert. Aufgewachsen ist er, wie damals in den ländlichen Regionen Italiens selbstverständlich, im katholischen Glauben. Auch seine musikalische Sozialisation und Ausbildung, erst in seinem Geburtsort Le Roncole bei dem Geistlichen Pietro Baistrocchi, den er schon als Siebenjähriger bisweilen an der Orgel vertrat, ab 1825 in Busseto beim städtischen Musikdirektor und Organisten Ferdinando Provesi, war von der Kirche und ihrem musikalischen Ritus geprägt. Von den damals entstandenen, teils eigenen, teils in Zusammenarbeit mit Provesi geschriebenen Gebrauchskompositionen ist wenig überliefert. Noch 1835 bewarb Verdi sich, allerdings vergeblich, um das Amt des 1 Domkapellmeisters und Organisten an der Kathedrale der lombardischen Stadt Monza. Später scheint er, wie viele liberale Intellektuelle der städtischen Oberschicht, Agnostiker, Äußerungen seiner Frau Giuseppina aus dem Jahre 1872 zufolge, zumindest zeitweise, sogar Atheist gewesen zu sein: „Er ist kein Arzt, er ist Künstler, alle stimmen darin überein, ihm die göttliche Gabe des Genies zuzuerkennen; er ist das Prachtstück eines Gentleman, versteht und empfindet jedes feine und erhabene Gefühl. Mit all dem erlaubt sich dieser Gauner, ich werde nicht sagen ein Atheist, aber gewiss doch alles andere als ein gläubiger Mensch zu sein, und das mit einem Starrsinn und einer Ruhe, für die man ihn verprügeln möchte.“ Deutliche Worte der ihm am nächsten stehenden Lebenspartnerin, bei denen Giuseppina sich bereits selbst zensiert hatte, denn in ihrem Briefbuch lautet der entscheidende Satz im Entwurf noch: „Dieser Gauner erlaubt es sich, ein Atheist zu sein, und das mit einem Starrsinn und einer Ruhe, für die man ihn verprügeln möchte.“ Am nächsten kommt der Wahrheit wohl Arrigo Boito, der seit 1880 zu Verdis engstem Freundeskreis gehörte, wenn er rückblickend in einem Brief an den französischen Verdi-Biographen Camille Bellaigue schreibt: „Im idealen, moralischen und sozialen Sinn war er ein großer Christ, aber man muss sich sehr wohl hüten, ihn in politischer und im strengen Wortsinn theologischer Hinsicht als Katholik hinzustellen; nichts stünde in größerem Widerspruch zur Wahrheit.“ Anders als der von ihm hochverehrte Schriftsteller Alessandro Manzoni, zu dessen erstem Todestag er 1874 sein bedeutendstes und monumentalstes geistliches Werk, die „Messa da Requiem“ komponierte, dürfte Verdi auch im Alter nicht zum katholischen Glauben zurückgefunden haben. Die Bibellektüre hat ihn zeit seines Lebens begleitet. Zumindest in seinen letzten Lebensjahren scheint er wieder die Messe besucht zu haben und sowohl in dem von ihm gestifteten Krankenhaus von Villanova d’Arda als auch in der Mailänder „Casa di Riposo“ wie auf seinem Gut Sant‘Agata ließ er Kapellen errichten. Eine „verinnerlichte Religion“ (Martina Grempler) spricht aus vielen der späten Kompositionen, nicht zuletzt aus der Tatsache, dass er sich das Autograph des „Te Deum“ in den Sarg legen ließ. Der Institution der katholischen Kirche und ihren Würdenträgern stand Verdi zumindest seit der niedergeschlagenen Revolution 1848/49 und der antiliberalen Politik von Papst Pius IX. ablehnend gegenüber. So vergeblich man in seinen Briefen nach einem religiösen Bekenntnis sucht, so entschieden äußert sich dort seine Kirchenfeindlichkeit. Als italienische Truppen im Gefolge des deutsch-französischen Kriegs im September 1870 Rom besetzten und damit die bis dahin bestehende 2 weltliche Herrschaft des Papstes über den Kirchenstaat beendeten, schrieb Verdi in einem Brief an Clara Maffei, dass er an keine Versöhnung von Kirche und Demokratie, an keine Verbindung von Papsttum und Nationalstaat glaube: „Deshalb kann ich Parlament und Kardinalskollegium, Pressefreiheit und Inquisition, das Bürgerliche Gesetzbuch und den Syllabus [den 1864 gegen alle Irrlehren des Liberalismus veröffentlichten „Syllabus errorum“ von Papst Pius IX.] nicht miteinander vereinbaren […]. Papst und König von Italien mag ich nicht einmal in diesem Brief nebeneinander sehen.“ Dennoch hatte er 1878, als Pius IX. nach 32jährigem Pontifikat starb, Nachsicht für den „armen Kerl mit wenig Verstand“. Es ist sicher nicht zufällig, dass sich Verdis Antiklerikalismus am schärfsten in den beiden zu jener Zeit entstandenen Opern äußert. Der greise, blinde katholische Großinquisitor in „Don Carlos“ (1867) wie der machthungrige ägyptische Oberpriester Ramfis in „Aida“ vertreten ein starres, lebensfeindliches Prinzip, das die bedingungslose Unterwerfung des Individuums unter den religiös verbrämten Machtanspruch der Kirche fordert und diesen selbst gegen die eigenen Herrscher, den spanischen König Philipp wie gegen den namenlosen ägyptischen König durchsetzt. Beide Male, in der Autodafé-Szene von „Don Carlos“ wie in der Triumphszene von „Aida“, inszeniert Verdi das Machtkartell von Staat und Kirche mit allem musikalischen Pomp und Schrecken. Nicht weniger erschreckend ist der machtpolitische Diskurs, den der Großinquisitor in „Don Carlos“ mit dem König führt. Bei Schiller treffen die beiden erst ganz gegen Ende des Stücks aufeinander. Verdi verlegt die Begegnung, bei der der Kirchenfürst – und nicht, wie bei Schiller, der König – den Tod Posas fordert, ins Zentrum der Oper und gibt ihr damit ein weit größeres Gewicht, umso mehr als es ihm gelingt, die Eiseskälte und Menschenverachtung des Großinquisitors mit größter kompositorischer Phantasie und Kühnheit Klang werden zu lassen. Ähnliches gilt für das von Ramfis vertretene Gesetz, das Verdi kaum zufällig in die strengste musikalische Form, den Kanon, fasst und das im transzendenten Terror der scena del giudizio, dem Todesurteil der Priester an Radamès, kulminiert. Am Ende steht dann der kultische verbrämte Tod des Liebespaars auf der zweigeteilten Szene – oben das Innere des Vulkan-Tempels mit den rituellen Priestergesängen (die bei aller exotischen Koloristik der Musik europäisch sind und der Praxis des responsorialen Wechselgesangs des katholischen Ritus folgen), unten ein unterirdisches Gewölbe, in das Aida und Radamès lebendig eingemauert werden – unerbittlicher Vollzug eines Kults, der die Menschen dem lebensverneinenden, ja Leben vernichtenden Ritual der Religion unterwirft. 3 Verdis Opernkosmos schildert aber auch andere Facetten und Spielarten von Religion, andere Priester, denen sogar Vorbildfunktion zukommt. Das trifft vor allem auf Zaccaria, den Hohenpriester der Hebräer in „Nabucco“ (1843), sowie auf Padre Guardiano, den Franziskanerpater in „La forza del destino“ (1862) zu. Zaccaria ist zugleich der politische Führer seines Volkes, das er in der babylonischen Gefangenschaft zum Widerstand aufruft. Verdi zeigt ihn aber auch im Gebet. Tiefe Streicher – sechs Celli, zu denen noch ein Kontrabass hinzutritt – fangen in der Begleitung die nächtliche Stimmung dieses Zwiegesprächs ein, das Zaccaria mit seinem Gott hält. Padre Guardiano wiederum – und damit die von ihm vertretene Religion – ist es, der der vor der Rache ihres Bruders fliehenden Leonora als Einsiedlerin in einer Höhle in der Nähe des Klosters Schutz gewährt. In der Urfassung kann Guardiano den Selbstmord des Gott verfluchenden Alvaro nicht verhindern – eine Tat, die für den Verdiforscher Julian Budden die „Botschaft eines reinen Atheismus“ erfüllt. Als Verdi die Oper 1869 für Mailand überarbeitet hat, strich er dies fatalistische Ende und ersetzte es durch einen versöhnlichen Schluss, der Alvaro zur Demut ermahnt, sodass dieser über der sterbenden Leonora Frieden mit dem Himmel schließt und damit dem blindwütigen Walten des Schicksals ein Ende setzt. Man hat in dieser Milderung eine Reverenz Verdis gegenüber dem verehrten Manzoni gesehen, an dessen Romangestalt des Paters Cristofero in den „Promessi sposi“ Guardiano in der Tat erinnert. Heutige Inszenierungen zeigen allerdings auch Guardiano oft als Vertreter eines starren, harten Glaubens – eine Lesart, die das Libretto, aber auch Verdis strenge Musik durchaus erlaubt. Kann man, darf man vom Opernwerk des Komponisten Verdi Rückschlüsse auf den Menschen Verdi ziehen? Verdis Theater ist eine Welt der Schmerzen. Erst mit dem Tod ende „die Qual des Herzens“, singt der Mönch am Beginn wie am Ende der vieraktigen Fassung von „Don Carlos“. In Verdis Opern werden alle Hoffnungen als Wahn, alles Glück als Trug entlarvt. Seine Figuren sind Scheiternde, ja Verlorene in einem Theater des Todes, der nicht erst am Ende triumphiert, sondern sich fast stets schon von Beginn an ankündigt. Im Gegensatz zu Wagner, dessen Opern alle in erlösendem Dur schließen, kennt Verdi, jedenfalls bis zur überarbeiteten Fassung von „La forza del destino“, keine Verklärung. Seine Opern enden in erbarmungsloser Härte wie der „Trovatore“, fahl auf der leeren Quinte wie „Simon Boccanegra", in schaurig-brutalem Dur wie „Stiffelio“ und die Zweitfassung von „Macbeth“ oder in abrupten Moll-Schlüssen wie „Rigoletto“, „La traviata“ und „Un ballo in maschera“. 4 Abgründige Melancholie, ja unüberhörbarer Pessimismus ist auch ein bezeichnendes Charakteristikum seiner beiden großen geistlichen Spätwerke, der „Messa da Requiem“ (1874) und des „Te Deum“ aus den „Pezzi sacri“ (1898). Das Menschheitsdrama der „Messa da Requiem“ schließt mit der Vertonung des traditionellerweise nicht zur Liturgie des Totengottesdienstes gehörigen „Responsorium ad absolutionem“ „Libera me“, in dem das furchteinflößende „Dies irae“ erinnert wird, ehe der Satz in einer schroff sich steigernden Chorfuge gipfelt und abbricht. Aus der ersterbenden Musik löst sich ein letztes Mal der Solo-Sopran, um tonlos seinen Erlösungswunsch zu stammeln. Kein Heilsversprechen, sondern Unsicherheit, nicht Glaubensgewissheit, sondern kraftlose Verzweiflung steht am Ende dieser Totenmesse. Verdis Musik spendet keinen Lichtschein in die Finsternis, breitet kein verklärendes Amen über die Trostlosigkeit des Todes. Gott schweigt in einer Welt der Ungewissheit und der Finsternis. Ähnliches wiederholt sich am Ende des „Te Deum“, der Vertonung des ambrosianischen Lobgesangs, wenn sich aus dem emphatischen Bekenntnis „In te speravi, Domine, non confundar in aeternum“ die zaghafte Stimme einer einzelnen Chorsopranistin herauslöst. „Das ist die [Stimme der] Menschheit, die Angst vor der Hölle hat“, soll Verdi gesagt haben. Wie das „Libera me dominum“ der Totenmesse verklingt auch das „Te Deum“ mit seinen plagalen Schlussakkorden in fahler Kraftlosigkeit – als wollte der Agnostiker Verdi hinter die Hoffnung ein großes Fragezeichen setzen, „das einem Angst machen kann“. So endet auch Verdis musikalisches Vermächtnis nicht in triumphaler Heilsgewissheit, sondern im Zweifel. „Man sagt" – so schließt Verdis Brief vom 29. Januar 1853, in dem er seiner Freundin Clara Maffei von der Premiere des „Trovatore“ berichtet –, "diese Oper sei zu traurig sei und es gäbe zu viel Tote darin. Aber schließlich ist im Leben doch alles Tod? Was lebt schon?“ Angeblich soll Verdi – so kolportierten es die Religiösen, die ihn zum nationalen Heiligen stilisieren wollten – bei der letzten Ölung am 24. Januar 1901 gelächelt und dem Priester kräftig die Hand gedrückt haben. Boito, dem auch hier die größte Vertrauenswürdigkeit zukommt, wusste jedoch zu berichten, dass Verdi an diesem Tag nur kurz das Bewusstsein wiedererlangte, als der Doktor kam und seine goldene Uhr, die die Stunden mit einer kleinen Melodie schlug, an das Ohr des Sterbenden hielt. Verdi öffnete die Augen, lächelte und fiel wieder in Bewusstlosigkeit. 5 6