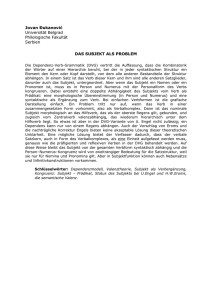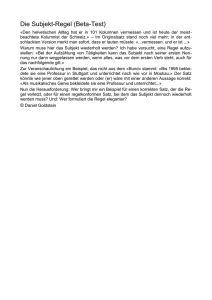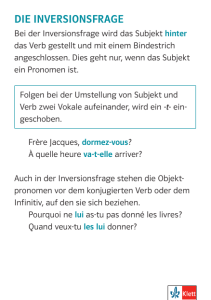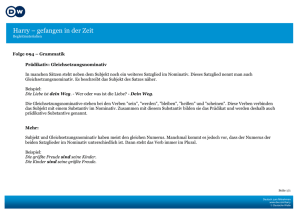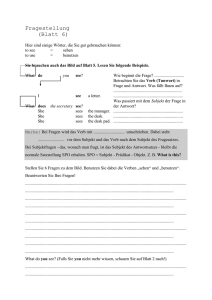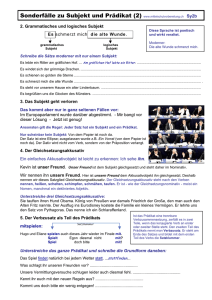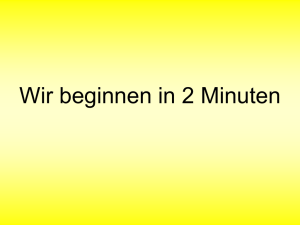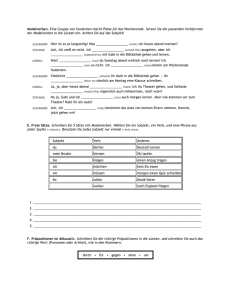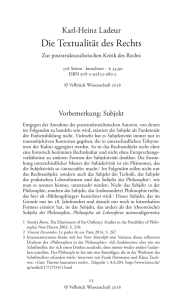Widerspruch Nr. 16/17 Ich - Subjekt - Individuum(1989), S.117
Werbung

Widerspruch Nr. 16/17 Ich - Subjekt - Individuum(1989), S.117159 Bücher zum Thema Rezensionen Besprechungen Bücher zum Thema Karl Otto Apel: Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp), 488 S., geb. 68.Der neueste Band Karl Otto Apels versammelt Aufsätze und Vorträge, die zum überwiegenden Teil erstmals zwischen 1986 und 1988 erschienen sind. Obwohl die meisten unter ihnen wohl zufälligen Anlässen ihre Entstehung verdanken, machen sie doch in ihrer Bündelung das neue Anliegen Apels und die dabei zugrunde gelegte konzeptionelle Einheit deutlich. Gerade im Vergleich zwischen den ersten drei Aufsätzen, die ihre Entstehung in den siebziger und den frühen achtziger Jahren deutlich verraten, und den seit 1986 erschienenen Aufsätzen wird der Sprung, um nicht zu sagen der Neuansatz in der von Apel vertretenen Diskursethik klar erkennbar. Das bisher vorgetragene Konzept einer transzendentalpragmatischen Normenbegründung soll in deutlicher Absetzung von Habermas und aufgrund der Kritik ihrer Verkürzung und Mängel in Richtung einer Verantwortungsethik erweitert werden. Das Problem, so Apel, das die Erweiterung der deontologisch-universalistischen Prinzipienethik um eine Interimsethik der Verantwortung herausforderte, entsprang dem im bisherigen Konzept ungenügend reflektierten Versuch, zwischen abstrakter Normenethik auf der einen und geschichtlicher Lebenswelt auf der anderen Seite zu vermitteln. Dieser Schritt, zwischen einer postkonventionellen Moral Kantischen Typus’ und den realen Anwendungsbedingungen jeder Ethik in der sozialkulturellen Wirklichkeit eine Vermittlungsstufe einzuführen, wird nötig durch die auf die Geschichte bezogene Anwen- Bücher zum Thema dung des zugrunde gelegten Moralprinzips. Daß dazu die Phronesis, die moralische Urteilskompetenz, die bisher die Aufgabe übernahm, im Rahmen konkreter situationsbedingter Kontexte die Moral und ihre in der kontrafaktisch antizipierten idealen Kommunikationsgemeinschaft legitimierten Normen anzuwenden, allein nicht hinreicht, ist der Haupteinwand, den Apel gegenüber Habermas erhebt. Das Neue an diesem diskursethischen Ansatz liegt darin, die in dieser Problemlage geforderte Ergänzungsethik auf der obersten Prinzipienebene selbst mitzubegründen. Das soll nach Apel dadurch geschehen, daß das bisher allein genügende oberste Universalisierungsprinzip einer konsensuell-kommunikativen Ethik durch ein moralischstrategisches Ergänzungsprinzip erweitert werden soll. Die bisher von Apel im Einklang mit Habermas geteilte Auffassung, daß zwischen strategischer Zweckrationalität und zur Begründung ethischer und politischer Normen allein zureichender konsensuell-kommunikativer Rationalität strikt zu trennen ist, wird dadurch teilweise revidiert, wenn nicht sogar ganz aufgehoben. Die sozialen Selbstbehauptungssystemen inhärente strategische Systemrationalität und, um mit Hegel zu sprechen, die in ihnen generierte sittliche Substanzialität und Geschichtlichkeit macht es erforderlich, die Differenz zwischen den idealen normativen Bedingungen der Möglichkeit einer idealen Kommunikationsgemeinschaft und den real vorfindbaren, sozialkulturellen und geschichtlich geformten Bedingungen realer Kommunikationsgemeinschaften anzuerkennen und zu thematisieren. Um diese spannungsvolle Differenz zwischen idealtypisch begründeten ethischen Normen und schlechter Wirklichkeit einer endlichen Welt, in der die Menschen, wie Apel zugibt, zwar nicht schlecht, aber den jeweiligen strategischen Erfordernissen gemäß handeln, nicht riesengroß werden zu lassen, muß eine zweistufig konzipierte Ethik einen Weg öffnen, diesen Hiatus zu schließen. Einerseits soll diese, wie Apel von jeder postkonventionellen Moral fordert, dem Anspruch, universal gültig zu sein, der mit jeder Letztbegründung erfüllt ist, genügen und andererseits schon vom Prinzip her darauf Rücksicht nehmen, daß die kontingent-geschichtlichen Bedingungen, unter denen Menschen konkret handeln, selbst jene realen Bedingungen sind, die von einer Emanzipationsmoral erst einmal anerkannt werden müssen, um progressiv, den idealen Normen gemäß, umgewandelt werden zu können. Diese von Apel gestellte Aufgabe, zwischen Utopismus und Regression einen dritten Weg zu finden, um sowohl die Rücknahme und Einplanierung moralischer Sollensforderungen durch die Faktizität der bestehenden, tendenziell sittlichen Bücher zum Thema Welt zu verhindern (was er dem Neoaristotelismus vorwirft) wie andererseits, gegen jeden moralischen oder gesellschaftlichen Utopismus gewendet, Rücksicht darauf zu nehmen, daß die Glücksinteressen jedes Einzelnen nach dem individuell erfüllten guten Leben wie die funktionalen Erfordernisse bestehender Sozialsysteme erst anerkannt sein müssen, um darauf basierend Chancen der Emanzipation erkennen und aktivieren zu können, scheint durchaus bedenkenswert und als philosophisches Konzept, das die Tradition abendländischer Aufklärung fortsetzen und bereits erreichte Standards moralischen Menschheitsfortschritts nicht preisgeben möchte, auch politisch relevant. Die von dieser Position aus vorgeführte Kritik an postmodernistischen und neoaristotelischen Strömungen, wie sie zur Zeit in der Bundesrepublik vorherrschen, durchzieht wie ein roter Faden alle in diesem Band versammelten Aufsätze. Wie weit Apel dabei die von ihm angegriffenen konkurrierenden philosophischen Positionen versteht, wie weit er die von ihnen implizit gegen seinen Leztbegründungsansatz vorgetragenen Einwände berücksichtigt und in seiner Argumentation aufnimmt, wird entscheidend dafür sein, ob das von ihm vorgelegte Programm einer Transformation der Transzendentalphilosophie in der gegenwärtigen Diskussion wieder stärkeres Gewicht zu- fällt. Daß der Weg, um zu diesem Ziel zu gelangen, nur über eine ernsthafte Thematisierung des Problems „Geschichte“ und nicht nur auf der Ebene der Anwendung abstrakter moralischer Normen auf Konflikte der Alltagswelt führen kann, scheint gewiß. Fraglich ist nur, ob der von Apel noch vertretene traditionelle Gegensatz zwischen apriorischer Moral und historischer Weltsicht dabei überwunden werden kann. Ob die Hereinnahme der Geschichte in die Ethik nicht doch einen modifizierten Historismus zum Ziel haben muß, und ob dann nicht die gerade in der deutschen Philosophie so unfruchtbare Polemik zwischen Historismus und apriorischer Moral beseitigt werden und einem fruchtbaren Miteinander weichen muß, wird die Zukunft der Philosophie, auch gerade die von Apel vertretene, zeigen. Ralph Marks Gernot Böhme: Der Typ Sokrates, Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp-Verlag), geb., 38.Es sind oftmals die „verrückten“ Menschen oder Forscher gewesen, verrückt im Sinne von außerhalb des Konsenses stehend, die neue „Geschichten“ erzählt bzw. sogar gemacht, die sich kreativ und innovativ mit den vorhandenen Erwartungen auseinandergesetzt und da- Bücher zum Thema nach gestrebt haben, den Konsens zu verändern. Diese haben, wie z.B. Bacon, Thomas Morus, Feuerbach, Fichte und Marx, das „abendländische Gespräch“ bereichert, teils haben sie ihren Worten sogar durch den Aufbau und die Unterstützung von Organisationen Nachdruck verliehen. Sie taten das aber nicht mit Blick auf den tatsächlichen Konsens, sondern mit Blick auf die Wahrheit und Realität. Sicher könnte man diese Vorgehensweise so interpretieren, als bezögen sich diese „Denker“ auf eine imaginäre Forscheroder „Heiligen“Gemeinschaft. Aber, ganz pragmatisch, von imaginären Bezügen geht keine Unterstützung aus, von der praktischen Abweichung dagegen u.U. Verleumdung, Berufsverbot, Scheiterhaufen und Tod. Bei der Wahrheit geht es um das stärkere Argument zugunsten derjenigen, die für ihre Überzeugung keine materiellen Hilfsmittel zur Verfügung haben. Hier zeigt sich, wie interessant der „Typ Sokrates“ ist, dieser außergewöhnliche Mensch, der noch nichts für sich zur Geltung bringen kann und noch nicht in den anerkannten sozialen Rechtfertigungspraktiken eingebunden ist. G. Böhme stellt einen „Abweichler“ der Geschichte dar, den die athenische Gesellschaft ausgegrenzt hat bis zum Tode, weil es dem herrschenden Konsens in der praktischen Politik und in der „Forscher- gemeinschaft“ nicht entsprochen hat. Sokrates ist noch ganz der vernunftund sprachbegabte Mensch, die Vollendung eines Bildes, in dem Aristoteles das „Wesen des Menschen“ bestimmt. Sokrates’ Philosophie ist ein Fragen, in dem Theorie und Praxis noch unmittelbar verbunden sind, eine praktizierte Weltanschauung, noch ohne Parteilichkeit, wohl aber mit Hingabe, mit Liebe zum Menschen, distanziert und erotisch. Sokrates repräsentiert einen Typ von Menschsein, den wir uns nur noch in abschätzigen Bildern von Künstlern und Literaten vorstellen können. Warum das Buch von G. Böhme heute? Nach allen Rollenzwängen aus Beruf und Bindungen kann mit Sokrates dem „Personsystem“ wieder zu seinem Recht verholfen werden. Mit ihm kann man aus den Zwängen ausbrechen und eine „zynische“ Existenz führen. Sokrates betreibt echte Ideologiekritik, wenn man den Baconschen Begriff verwendet. Sokrates distanziert sich ironisch, nicht zynisch, nicht abfällig, nicht mit der mephistophelischen Maßgabe, alles was entstehe sei wert, auch wieder zugrundezugehen. Er ist auch nicht faustisch verbissen. Sokrates zielt nicht auf Erlösung, er folgt lediglich seinem Stimmchen. Dies Buch ist laut Klappentext in einer Zeit der Abenddämmerung der Vernunftphilosophie geschrie- Bücher zum Thema ben worden. Man tut gut daran zu erinnern, daß Philosophie nicht nur auf Lehrstühlen zu Hause ist, daß Philosophie mehr ist als nur Wissenschaft und Theorie von Wissenschaft. Heute würde sich Sokrates sicher von den gespreizten wissenschaftlichen „Diskursen“ ironisch distanzieren und würde die berufstätigen Philosophen energisch fragen, was sie denn tun, um die Menschen besser zu machen. Sein fast schon existentialistisch zu nennendes Leben diente nicht der Verwaltung von Traditionsgütern, von Kulturgütern. Er zielt auf Wahrheit ohne Besitzanspruch, bei ihm ist Wahrheit noch nicht im Privatbesitz der Wissenschaftler. Er geht mit seinen Schülern auf die Allmende zum Weiden. Fast religiöse Momente leuchten bei Sokrates auf, man könnte in ihm einen „Bettelmönchen“ sehen, der so herrlich unangreifbar geworden ist, weil er schließlich noch ohne Furcht vor dem Tode seinen Richtern die Schau stiehlt. Sokrates drängt auf Objektivität, auf den allgemeinen Begriff im Gespräch, hervorgebracht durch das dialogische Prinzip. Das Gespräch verbleibt aber nicht auf der einfachen Ebene der intersubjektiven Übereinstimmung oder eben NichtÜbereinstimmung; er will einen Bildungsprozeß einleiten, den er als Hebammenkunst begreift. Erst nach einem solchen Bildungsprozeß soll Objektivität möglich sein, seine Lie- be bleibt nicht bei der „Solidarität“ stehen, sie geht über Ironie bis zur Verachtung des eigenen Lebens. Bei Sokrates ist das Wahre und damit das wahrhaft „Nützliche“ nicht im ersten und zweiten Anlauf zu erreichen. Er fährt fort, sog. Wissende zu verunsichern, bis sein „Daimonium“ keinen Widerstand mehr leistet. Sokrates würde heute im Widerspruch stehen zur liberalen Demokratie der herrschenden Meinung. Dank an G. Böhme, diesen „Typ Sokrates“ aus der Versenkung geholt zu haben, überdies angenehm lesbar. Wolfgang Teune Hartmut Böhme: Natur und Subjekt, Frankfurt/M. 1988 (Suhrkamp), 400 S., 22.Die in dem vorliegenden Sammelband von H. Böhme publizierten Aufsätze kreisen um das Phänomen der Verdrängung. War diese bei S. Freud noch als neurotischer Abwehrmechanismus des einzelnen Individuums gekennzeichnet, so unternimmt es Böhme, dadurch die Entwicklung und das Verhältnis von Natur und Subjekt im aktuellen Weltzustand generell zu charakterisieren. Analog der von Hegel dargestellten „Dialektik von Herr und Knecht“, tendiert die, auf Ausschluß der Naturbasis gegründete Ratio, zur Auflösung ihrer selbst: Der reine planende Geist der Bücher zum Thema (kapitalistischen) Moderne läßt weder die qualitativen Seiten der Natur noch ein leibhaft gebundenes Subjekt zu und wird dergestalt zu einer „Furie des Verschwindens“ (Hegel). Der Autor bleibt sich thematisch insoweit treu, als er bereits in dem gemeinsam mit seinem Bruder G. Böhme verfaßten Buch „Das Andere der Vernunft“ (1981) die Gestehungskosten neuzeitlicher Rationalität aufzuweisen versuchte. Gegen die auch in diesem neuen Band bekräftigte Kritik an der Aufklärung und der in ihr involvierten Vernunft könnte der Einwand vorgebracht werden, daß dieser, vierzig Jahre nach Horkheimer/Adornos bahnbrechender Studie zur „Dialektik der Aufklärung“, die Aura des Antquierten anhaftet. Zu Recht entgegnet Böhme darauf mit dem Hinweis, daß die Prozesse der Subsumtion des Einzelnen unter das Allgemeine bis heute nicht nur ungebrochen fortschreiten, sondern sich potenzieren. So macht es durchaus Sinn, wenn er feststellt, daß es die zeitgenössische kulturkritische Diagnostik mit (be)drängenderen Aussichten und Zukunfts-Horizonten zu tun hat, als dies selbst noch für die Klassiker des Neo-Marxismus zutraf. Insofern dient das Aufbrechen der Phalanx des Verdrängten mittels der Erinnerung an das, was in den Begriffen „Natur“ und „Subjekt“ einmal mitbedeutet war, einer zeitgemäßen Aufklärung über die Aufklärung. Man würde die Intentionen Böhmes falsch verstehen, wenn man seine Essays als den Versuch interpretieren würde, verlorengegangene Naivität wiederzugewinnen. Nicht um eine konservative Retrospektion ist es ihm zu tun, sondern um ein eingedenken angesichts des universalen und universellen Verschleißes von Natur und Subjekt: „Jedes Erinnern, das dem Vergangenen das Unabgegoltene ebenso abgewinnt wie es das Erinnerte als niemals Wiederkehrendes, vielleicht niemals gewesenes Leben zu verabschieden weiß, ist ein Gewinn an Zeit: offenerem Horizont.“ (S.10) H. Böhme ist Literaturwissenschaftler. Darum konzentriert sich sein Interesse auf die Entzifferung jener Spuren, welche sich ihm in Zeichensystemen mitteilen. Daraus resultiert, meiner Ansicht nach, der problematische Zug seiner Arbeiten: Nicht nur gewinnt der Leser den Eindruck, daß die Entqualifizierung von Subjekt und Natur ein primär geistesgeschichtlicher Prozeß war, sondern die Argumentation insgesamt verliert an Kraft. Die mit philologischer Akribie vorgenommene Zuordnung von Signifikaten und Signifikanten vermag deren erst zu beweisende Evidenz nicht zu begründen. Darüber hinaus wird die Stringenz der Argumentation insgesamt durch den anthologischen Charakter des Buches gebrochen. Zu vieles wird in ihm angetippt, was Bücher zum Thema beim Lesen das Gefühl der Beliebigkeit des Sujets hinterläßt. Die Stärke des Bandes liegt darin, daß er konsequent das an Subjekt und Natur Zerstreute und im kulturellen Prozeß Abgespaltene ins Zentrum rückt. Mittels dieser Perspektive werden qualitative Ansichten von Subjekt und Natur sichtbar, die bislang bestenfalls in ästhetischen Diskursen benannt wurden. Dementsprechend bildet die Kunst den Mittelpunkt der Aufsatzsammlung, wie ein Blick auf die in ihr behandelten Themen zeigt: Sie reichen von einer Interpretation der „Melancholia II“ Dürers über Goethes Kritik an der rein quantitativen (Natur)Wissenschaft bis zur Ikonographie der Ruine in den Filmen A. Tarkowskijs. In den von H. Böhme ausgewählten Themen zeichnet sich die Disparatheit des gegenwärtigen Zustandes von Subjekt und Natur exakter ab, als dies uns die Fortschrittsoptimisten in Ost und West glauben machen wollen. In seinem Buch insgesamt bleibt H. Böhme einer Haltung verpflichtet, die Brecht wie folgt ausdrückte: „Außer diesem Stern, dachte ich, ist nichts und er Ist so verwüstet Er allein ist unsere Zukunft und die Sieht so aus.“ Thomas Wimmer Hanns-Georg Brose / Bruno Hildenbrand (Hrsg.): Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende. Opladen 1988 (Leske + Budrich), Paperback, 286 S., 44.Auch die Soziologie interessiert sich - neben der Geschichtswissenschaft - seit geraumer Zeit für das Verhältnis von Lebenslauf, Biographie und Gesellschaft, da sie sich aus der Thematisierung der je eigenen Individualität Aufschlüsse über den sich vollziehenden sozialen Wandel verspricht. Diesem Projekt dient die Buchreihe „Biographie und Gesellschaft“ (hrsg. von Werner Fuchs, Martin Kohli und Fritz Schütze), in der der vorliegende Band erschienen ist. Er vereinigt Forschungsberichte unterschiedlicher Theorieansätze - wie der Kritischen Theorie, dem Poststrukturalismus oder der Systemtheorie - mit dem Ziel, „die auseinanderfallenden Makro- und Mikro-Ansätze“ (5) zusammenzubringen sowie „die Zäune zwischen dem qualitativen und dem quantitativen Lager“ (6) Im Abschnitt „Theoretische Koneinzureißen. zepte“ entwirft M. Kohli das Verhältnis von Normalbiographie und Individualität als „institutionelle Dynamik des gegenwärtigen Lebenslaufregimes“, U. Schimank versucht eine systemtheoretische Rekonstruktion von Individualität und T. Luckmann geht den gesellschaft- Bücher zum Thema lichen Voraussetzungen von Identität und Lebenslauf nach. A. Hahn und H.-G. Soeffner beschäftigen sich anschließend mit der „Entwicklung der Semantik von Individualität und Selbstthematisierung“, wobei Soeffner am Fall Martin Luther den Übergang „von der Kollektivität des Glaubens zu einem lutherischprotestantischen Individualitätstypus“ demonstriert. Während im 4.Teil dem Problem der Nutzung von Individualität und Biographie in Therapieformen und sozialen Organisationen (z.B. an Hand von Interviews mit Psychotherapeuten) nachgegangen wird, schließt der 5.Teil mit einem Aufsatz von U. Oevermann, der an einem exemplarischen Fall aufzeigt, wie sehr sich sozialwissenschaftliche Kategorien selbst wieder in Identitätsentwürfe einschreiben und durch ihren subsumtorischen Charakter Gefahr laufen, statt über die Entfremdung aufzuklären, sie zu potenzieren. Philosophisch interessant ist vor allem der Einleitungsaufsatz von Brose und Hildenbrand. Sie konstatieren als Ausgangslage eine Zunahme autobiographischer Selbstdarstellungen, die mit einem Prozeß der Individualisierung und einer Erosion kollektiver Lebensformen in Zusammenhang stehen. „Das Phänomen dieses neuen Individualisierungsschubes widerlegt die These vom Ende des Individuums nur vordergründig ... Die Vorstellung einer in der individuellen Lebensge- schichte gelingenden Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem wird zurückgenommen auf die in der jeweiligen Biographie immer neu herzustellende Einheit der individuellen Lebensgeschichte. Biographie würde damit in doppeltem Sinne zu einem ‘Fluchtpunkt’ soziokultureller Synthesis.“ (11) Der Moderne kommt das Verdienst zu, den Menschen aus ständischen und lokalen Bindungen emanzipiert und durch die Pluralisierung der Lebensverhältnisse einen Geltungsverlust traditioneller Orientierungen herbeigeführt zu haben. Moderne wird also als Prozeß der Subjektivierung und Individualisierung verstanden, wobei allerdings inzwischen die bürgerliche Konzeption von Individualität als überholt gelten kann und einer neuen weichen muß: der „Individualisierung als Vergesellschaftungsform“ (17). A.E. Imhof hat in seiner Untersuchung des bäuerlichen Milieus der Vormoderne („Die verlorenen Welten“, München 1984) gezeigt, daß der einzelne stark in „ständische, lokale und häusliche Zusammenhänge eingebunden war“ (12) und die Reproduktion des Lebens nur im Ganzen (des Hofes), unabhängig vom einzelnen, garantiert werden konnte. Die Identität bestimmte sich aus der Geschlechterfolge und der Religion, nicht in bezug auf sich selbst. „Die Entwicklung des (städtischen) Bürgertums aber treibt erst jene Gestalt des autonomen Indivi- Bücher zum Thema duums hervor, dessen doppelte Selbständigkeit als Produzent und Eigentümer von Waren auf dem Markt und als Individuum in der Familie Bezugspunkt der Rede vom Aufstieg bzw. Ende des Individuums ist.“ (13) Die mit der sozialen Differenzierung der Gesellschaft einhergehende Trennung von öffentlicher und privater Sphäre sowie der Abbau einer „verbindlichen Kosmologie“ zwingen das Subjekt zu „ständigen eigenen Orientierungsleistungen zur Selbstvergewisserung und zur Bestimmung seines sozialen Ortes, den ihm seine ‘Identität’ nun nicht mehr fraglos gibt.“ (13) (Der Geniekult als Heroisierung und die Melancholie als Leiden an der Subjektivität bestimmen als konträre Pole die bildungsbürgerliche Variante der Individualitätskonzeption.) Die Kehrseite der Individualisierung liegt in der gesellschaftlichen Dissoziation des einzelnen, der Diremtion von Ich und Welt, deren erneute Synthese nun allein das autonome, verantwortungsbewußte, moralische Individuum leisten soll, wobei ihm allerdings das zentrale Motiv bürgerlicher Individuation diametral entgegensteht: das der Konkurrenz. Dieser Widerspruch war immer einer der Gründe, warum die Kritische Theorie nicht nur den Verfall des Individuums konstatierte, sondern im Gegenteil offensiv auf der Aufhebung des individuierenden Prinzips bestanden hat: „Gebot einmal die Freiheit des Subjekts dem Mythos Einhalt, so befreite es sich, als vom letzten Mythos, von sich selbst. Utopie wäre die opferlose Nichtidentität des Subjekts.“ (Th.W. Adorno, Negative Dialektik, Ffm. 1975, 277) In einer historischen Situation, in der die Orientierungslosigkeit bis in die philosophischen Entwürfe eines ‘anything goes’-Denkens hinein sich spiegelt, wird die Rolle der Biographisierung von Erleben und Handeln deutlich: „An die Stelle der Identität, deren Herausbildung infolge der Abschwächung identitätssichernder Lebenswelten und Milieus und mangels trag- und kopierfähiger realer Identitätsfiguren erschwert wird, treten Selbstbeschreibungen und -darstellungen; Selbststeuerungen und vergewisserungen in bezug auf lebensgeschichtlich relevante Vorgänge. Diese ‘Biographisierungsprozesse’ überdecken die Frage nach der eigenen Identität.“ (18) Es sind die gesellschaftlichen Krisen und Widersprüche - Arbeitslosigkeit, Anonymisierung und Atomisierung, Auflösung von festen Lebensformen zugunsten von Mobilität (fürs Kapital) -, die, da sie das Individuum ständig mit Auslöschung bedrohen, es zu verstärkten Biographisierungsanstrengungen nötigen: Die Selbstvergewisserung steht im Zeichen des Untergangs des Selbst. Manuela Günter Bücher zum Thema Konrad Cramer, Hans Friedrich Fulda, Rolf-Peter Horstmann, Ulrich Pothast (Hrsg), Theorie der Subjektivität, Frankfurt 1987 (Suhrkamp-Verlag) 479 S., 38.Der Band - Festschrift für Dieter Henrich zum 60. Geburtstag - versammelt Artikel zu einem Thema, dessen sich Henrich bekanntermaßen besonders angenommen hat, und bietet in der Fülle seiner Beiträge ein recht getreues Abbild unserer gegenwärtigen Situation: der „Subjektivität“ zu mißtrauen, und doch von ihr nicht lassen zu können. Thematisiert oder nicht - Kants „Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können“ ist der Angelpunkt, in dem sich auch noch die unterschiedlichsten Geister aufeinander beziehen. Konrad Cramer widmet diesem Satz eine subtile Interpretation, die herausarbeitet, daß die systematische Pointe von Kants Satz darin besteht, im „Ich denke“ sei das „Ich“ nicht nur ein notwendiger Gedanke, sondern ein solcher, „in dessen Inhalt etwas gedacht wird, was nur gedacht, aber nicht angeschaut werden kann“. Das in diesem Begriff von ‘mir’ Gedachte sei also notwendig zu denken und könne doch niemals Gegenstand werden. Dieses Kantische „Ich“ markiert gewissermaßen die vorderste Front, an der die Beiträge sich abarbeiten. Wenn das „Ich“ notwendig zu denken ist, aber nicht Gegenstand werden kann, wie läßt sich dann sinnvoll von einem solchen Ich reden? In seinem Beitrag „Kants Paralogisms: Self-Consciousness and ‘Outside Observer’“ nimmt Peter Strawson zunächst einmal Kant vor dem psychologistischen Mißverständnis in Schutz, Kant habe mit „Ich denke“ nur jene Instanz gemeint, die eine Vorstellung, trotz möglichen Irrtums, als die ihrige habe. Und Roderick Chisholm macht die These von der notwendigen Bewußtseinsidentität auch unter den Bedingungen neuerer physiologischer Experimente stark, die auf eine geteilte, duale Organisation des menschlichen Gehirns hinweisen. Eine andere, an die Transzendentalphilosophie Kants anknüpfende, Problematik stellt H.F. Fulda in den Mittelpunkt. Hegel habe Kants Gedanken der transzendentalen Apperzeption in der Weise weitergeführt, daß er jenes „Ich denke“ zu einem Verfahren der tätigen Aufklärung des reinen Denkens, der Vernunft, über sich selbst und ihre Gehalte entwickelt und zur systematischen Erkenntnis des All-Einen geführt habe. Ob dabei das je einzelne Bewußtseinssubjekt, an das Kant sein „Ich denke“ zweifellos gebunden hatte, in Hegels Philosophie im Gang der Phänomenologie des Bewußtseins ‘aufgehoben’ oder aber ‘herausgefallen’ ist, ist für Fulda eine offene Frage, die letztlich Bücher zum Thema über den Status von Hegels Philosophie entscheidet. Reiner Wiehl geht in seinem Beitrag diesem Problem von Vernunft und Individuum nach. Auf der Grundlage des Satzes „Individuum ineffabile est“ sieht er in Hegels spekulativer Philosophie die Vollendung des Prinzips, daß das Wahre und die Vernunft das nicht-individuell Allgemeine ist; ein Grundsatz, gegen den vor allem Heidegger im Rückgang auf das „Selbstsein“ rebelliert hat. Dessen Darstellung im Rahmen der Existenzphilosophie konnte aber nur, so Wiehl, bei Preisgabe der objektiven Gültigkeit zugunsten subjektiver Willkür geschehen. Wiehl zieht daraus die Konsequenz, daß Subjektivität sich nur in der „Komplementarität von Bewußtsein und Selbstsein“ entfalten könne. Die phänomenologische Selbstauslegung des Bewußtseins und das Verstehen der vorgegebenen Subjektivität in Emotionen und Gefühlen bilden „den elementaren Spielraum für menschliche Vernunft und Unvernunft“. Dieser ‘Ausgewogenheit’ von rationaler Selbsterfassung und emotionalem Selbst-Sein dürfte Ulrich Pothast allerdings widersprechen. Sein Beitrag zielt darauf ab, jeglichen Versuch der Thematisierung und Selbsterhellung des Bewußtseins als vergeblich nachzuweisen. Da der „Innengrund“ unseres Bewußtseins sich jeglicher Vergegenständlichung entzieht, können wir Zugang zu un- serem Inneren nur in der Aufmerksamkeit auf unseren Organismus gewinnen, der im Weltbezug sich je schon „spürend“ orientiert, ohne daß dies „Spüren“ je zum Bewußtsein gebracht werden könne. Auch Hermann Schmitz sieht in seinem Beitrag den Zugang zur Subjektivität nicht in der philosophischen Rekonstruktion eines Fichteschen „Ich bin“ oder Kantischen „Ich denke“, sondern „in umgekehrter Richtung: an Hand der personalen Regression im affektiven Betroffensein“: durch die Selbstverstrickung des Menschen in die Welt der Tatsachen verhalte sich „der Betroffene zu sich selbst .. in seinem gegenwärtigen Sosein“ (360). Entgegen solch dezidierter Ablehnung der Theoriefähigkeit von Subjektivität unternimmt es HectorNeri Castaneda in seinem äußerst elaborierten Beitrag, die Semantik der Begriffe „Bewußtsein“, „Ich“, „Selbst“ und „Selbstbewußtsein“, in der Tradition der analytischen Philosophie, wieder umfassend in ihren sprachlichen Kontexten zu untersuchen und ihre epistemischen Bezüge zu analysieren. Kreisen alle diese Versuche darum, die Subjektivität irgendwie philosophisch zu fassen, so bleibt es den amerikanischen Philosophen Hilary Putnam und vor allem Richard Rorty vorbehalten, das Problem in erfrischender Naivität aus der Philosophie zu eskamotieren. So erläutert Rorty in seinem Beitrag, daß die Bücher zum Thema amerikanische Philosophie den ihr nachgesagten reduktiven Physikalismus, der die mentalen Vorgänge auf physikalisch beschreibbare Ereignisse zurückführen wollte, weitgehend überwunden habe, daß sie gleichermaßen aber nichts mit jenem „inneren, wahren Ich“ anfangen könne, das die „nachkantische Zeit“ geprägt habe. Die Situation heute sei in den USA durch das nicht-reduktive materialistische Modell von D. Davidson geprägt, nach dem der menschliche Organismus als Komplex physikalischchemischer und psychologischer Ereignisse verstanden wird, die wechselseitig aufeinander einwirken, die aber nicht aufeinander rückführbar sind. Das „Selbst“, so Rortys antikantische Pointe, sei nichts, was Überzeugungen und Wünsche hat, sondern bilde ein Netzwerk von Überzeugungen und Wünschen, das sich in steter Veränderung und Neuformierung befindet. Putnams Beitrag besteht im wesentlichen darin, daß er zwischen die psychologische und physikalischchemische Ebene noch eine Bewußtseinsebene („computational state“) einschiebt, die physikalischchemische Zustände unterschiedlich abzubilden vermag. Angesichts solcher Position der amerikanischen Philosophie wird denn auch der Seufzer verständlich, mit dem R.-P. Horstmann die Frage aufwirft, ob das Selbstbewußtsein nicht doch ein philosophisches Pro- blem sei. Sein Beitrag will darauf verweisen, daß Kant mit jenem wissenskonstituierenden „Ich denke“ dem Selbstbewußtsein eine Funktion zugesprochen hat, die nicht mit empirisch-psychologischen Mitteln eingeholt werden kann. Die Antwort auf die Frage nach diesem Selbstbewußtsein hinge eng mit der Frage zusammen, welche Leistung wir heute überhaupt noch von der Philosophie erwarten, bzw. welche ihr zugemutet werden kann; ob man sie auf „die Verfolgung von übergreifenden Erkenntniszielen verpflichtet“ (246) sehen will, die nicht durch die Vorgabe einzelwissenschaftlicher Beschränkungen definiert sind. Ein interessantes Beispiel für solche Ziele gibt in praktischer Absicht Hans Ebelings Beitrag „Das Subjekt im Dasein“. Er unterscheidet zunächst in Anlehnung an Henrich die drei „Ebenen“ der „Selbsterhaltung“, der „Selbstverwirklichung“ und des „Selbstbewußtseins“. Auf der ersten Ebene der Selbsterhaltung bestimme sich das Subjekt, das Ebeling sogleich als Gattungssubjekt faßt, als dasjenige, das angesichts des Todes seiner Vernichtung widerstrebt, als Existenzsubjekt. Damit dieses Interesse an Selbsterhaltung nicht ziellos und Selbstzweck im Luhmannschen Sinne bleibt, sondern sich bestimmen und vermitteln kann, bedürfe es der intersubjektiven Vernunft, in der das Subjekt sein Interesse an Selbstver- Bücher zum Thema wirklichung thematisiert und legitimiert. Auf dieser Ebene ist es das kommunikative Sprachsubjekt. Das Selbstbewußtsein aber konstituiert sich, indem es mittels des „transsubjektiven Intellekts“ das Interesse des Existenzsubjekts an Selbsterhaltung intersubjektiv einklagt. „Das Interesse des Existenzsubjekts muß sich vor dem Intersubjekt des Sprachsubjekts bewähren. Das kann es aber nur, wenn das Bewußtseinssubjekt als je einzelnes Widerstandsbewußtsein auch noch dem falschen Konsens widersteht“ (91). Dieses Selbstbewußtsein als Widerstandsbewußtsein sei heute angesichts des möglichen Tods der Gattung zu fordern. Diese These vom „transsubjektiven Intellekt“ des Widerstandsbewußtseins scheint gegen Habermas gerichtet zu sein. Dessen Beitrag „Metaphysik nach Kant“ konzentriert sich allerdings auf die Kritik solch subjektivitätstheoretischer Positionen, wie sie Henrich vertritt, von denen schwer abzuschätzen sei, ob sie in der Lage sind, den rationalen Standards der Moderne zu genügen. Für Habermas jedenfalls findet die Bildung jeglicher Subjektivität nie für sich, sondern immer schon im Rahmen sprachlicher Intersubjektivität statt; Individuierung sei nicht ohne Vergesellschaftung und Sozialisierung nicht ohne Vereinzelung möglich. Ob Habermas damit allerdings das Thema, das Ebeling mit dem Widerstandsbewußtsein einer „transsubjektiven Vernunft“ angeschnitten hat, seinem System der kommunikativen Vernunft zwanglos einzufügen vermag, bleibt offen. Ein solcher von Verantwortung gespeister Widerstand jedenfalls läßt sich m.E. nicht in die Schublade: „was landläufig Rousseauismus heißt“ (443) schieben. So verweist der Band, der darüberhinaus noch Beiträge von Andreas Kemmerling, Paul Guyer, Ernst Tugendhat und Hans-Georg Gadamer enthält, fast durchgängig auf das Problem der Moderne, die demokratischen Ansprüche auf Öffentlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Konsensfähigkeit mit dem liberalen Recht zu vereinbaren, nur das zu akzeptieren, dem ich aufgrund meines Subjektseins, als zurechnungsfähige Person, wie Tugendhat sie in seinem Beitrag erörtert, beistimme. Ohne unmittelbar politisch zu sein, repräsentiert dieser Band in hervorragender Weise den aktuellen Konflikt zwischen postkonventionellen Moralvorstellungen und den unhintergehbaren Moralansprüchen des Ich. Alexander von Pechmann Herta Nagl-Docekal und Helmuth Vetter (Hg): Tod des Subjekts? Wien; München: Oldenbourg 1987, 234 S. Bücher zum Thema Seit Foucault in dem unbetitelten Schlußstück von Les mots et les choses (1966) den „Tod des Menschen“ ausgerufen hatte, wurde die Debatte um den Ausgang neuzeitlicher Subjektsphilosophie - zuerst in Frankreich, später auch bei uns - von jenen Diskurstheoretikern bestimmt, die herausfordernd als „Antihumanisten“ auftraten. Das „humanistische“ Beharren auf der Souveränität des Subjekts, so lautete einer der Vorbehalte, vollende die Selbstentmächtigung der Menschen gerade dadurch, daß es ihre Potenzen herausstreiche. Die vielen Tode des Subjekts bei Autoren wie Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze und Lyotard lasen sich streckenweise wie Seitenstücke zur Dialektik der Aufklärung, besonders aber zur Negativen Dialektik Adornos, neu waren sie deshalb nicht. Immer lautete das Konzentrat: Das Individuum für sich selbst genommen sei eine Fiktion, das Subjekt nur eine Hypothese, der Humanismus daher bloßes Postulat. Die Resonanz war außerordentlich und ist es noch. Auch die Herausgeber des als Band 2 in der Wiener Reihe ‘Themen der Philosophie’ erschienenen Sammelbandes zeigen sich vom Programm des französischen Strukturalismus bzw. Neostrukturalismus sichtlich mehr beeindruckt, als von den Bemühungen jener, die sich in der Nachfolge der Kritischen Theorie am neuzeitlichen Subjektbegriff abarbeiten. Herta Nagl-Docekal sagt es einleitend ganz offen: „Wo die französische Neuformulierung der Subjektkritik rezipiert wurde, geschah es zunächst überwiegend auf affirmative Weise.“ So zeichnet Helmuth Vetter in seinem Beitrag „Welches Subjekt stirbt?’ nur die bekannten Positionen Derridas und Lacans nach, die sich ihrerseits an Nietzsche und Heidegger orientieren. Etwas anders sieht es mit dem Beitrag Manfred Franks (‘Subjekt, Person, Individuum’) aus, der mit seinem 1983 erschienen Buch „Was ist Neostrukturalismus?“ als einer der ersten den Versuch einer umfassenden, kritischen Rezeption dieser Richtung unternahm. Zwar finden sich auch bei Frank Parallelen zum Programm der Strukturalisten - etwa zu Lyotard, aber er nimmt es nicht widerstandslos hin. Das Problem des Subjekts verweist für ihn auf dasjenige des Bewußtseins, „durch das wir uns als einzigartige Einzelwesen kennen“. Im Zeichen dieser Problemstellung entwickelt er eine dreigliedrige Differenzierung, wobei er zwischen Subjekten als allgemeinen, Personen als besonderen und Individuen als einzelnen Selbstbewußtseinen unterscheidet. Hinzu kommt zum erkenntnistheoretischen Modell der Selbstwahrnehmung für ihn die spezifische Zeitlichkeit der Person. Sehr deutlich gerät bei Frank die Abgrenzung zu strukturalistischen Modellen wie der „semantischen Identität“ Derridas, Bücher zum Thema dessen Versuch, Bewußtsein und Selbstbewußtsein aus dem differenziellen Verweis zwischen Zeichen abzuleiten, sich als zirkulär erweist. Frank selbst greift dagegen auf das hermeneutische Modell von Individualität zurück, demzufolge sich das Individuum „eingefügt in einen intersubjektiven Verständigungsrahmen, sprechend auf den Sinn seiner Welt hin entwirft“. Frank sieht darin den Ausweg aus den diagnostizierten Aporien; Individualität ist ihm die einzige Instanz, „die der rigorosen Idealisierung des Zeichensinnes zu einem instantanen und identischen Widerstand entgegenbringt“. Einen entscheidenden Vorzug dieser Konzeption sieht Frank darin, daß das Individuum, insofern es sich in der Zeit je und je neu entwirft, „gerade kein Einheitsprinzip ist“. Den Versuch das Subjekt als Prinzip von Gestaltung und Veränderung einer Binnendifferenzierung zuzuführen, unternimmt Hans Ebeling in seinem Beitrag ‘Das Subjekt des Widerstandes. Über das Praktischwerden der Vernunft’. Ebeling geht davon aus, daß die Vertreter der These vom Tod des Subjekts in der Tat „Verächter des Lebens“ sind. Ihnen gegenüber will er klarstellen, daß das Subjekt als Widerstand gegen den Tod immer schon vorausgesetzt ist, und zwar auf dreifache Weise. Demnach ist es jeweils ein Subjekt als „Zugrundeliegendes“, welches „1. das sterbliche Leben, 2. das sittlich-rechtliche Leben, 3. das moralische Leben produziert“. Ebeling unterscheidet also ein „Existenzsubjekt“, welches sich dem Tod durch Produktion des sterblichen Lebens widersetzt, andererseits ein vernünftiges Subjekt, welches verlangt, „dem Tod gar zu entgehen“. Letzteres wiederum auf zweifache Weise, nämlich als „Sprachsubjekt“, indem es „die sprachliche Sedimentierung der Intersubjektivitätsverhältnisse als Verständigungsverhältnisse“ fundiert, zum anderen als „Bewußtseinssubjekt“, d.h. als moralisch-praktisches. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Wenn Ebeling etwa dem „moralisch-praktischen Subjekt des bewußten Seins als des bewußten Sollens“ den Primat zuspricht, also auf Kantsche Sollensethik rekuriert, fällt er hinter die Erkenntnisse der Negativen Dialektik zurück: „Daß nämlich das Subjekt in weitem Maße zur Ideologie wurde, den objektiven Funktionszusammenhang der Gesellschaft verdeckend und das Leiden der Subjekte unter ihr beschwichtigend. Insofern ist, und nicht erst heute, das Nicht-Ich dem Ich drastisch vorgeordnet“, hat nicht das Bewußtseinssubjekt Ebelings, sondern die Geschichte das Primat (ND, Frankf.a.M. 1967, S.76). Da liest sich Volker Gerhardts Schlußbetrachtung („Politische Subjekte. Zur Stellung des Subjekts in der Politik“) wie ein Kommentar zum Bisherigen: „unverkennbar ist Bücher zum Thema es das Subjekt selbst, das sich hier in Nachrufen auf sich selbst versucht“. Gerhardt sieht nicht in der Begründung, sondern in der Analyse des Subjekts die eigentliche Aufgabe. Was die Konstitutions- und Funktionsbedingungen politischer Subjekte betrifft, lautet sein Resüm‚e: „Subjekte gibt es mindestens noch solange, wie es politische Ansprüche gibt.“ Michael Basse Norbert Elias „Die Gesellschaft der Individuen“, Frankfurt a.M. 1987 (Suhrkamp) 37.Der erste europäische Soziologiepreis (Premio Europeo Amalfi) für ein besonders wertvoll für die Sozialwissenschaft eingeschätztes Werk wurde im Mai 1988 dem 90Äjährigen Nestor der deutschen Soziologie Norbert Elias für sein 1987 erschienenes Werk „Die Gesellschaft der Individuen“ verliehen. Das Werk gliedert sich in drei Teile. Die beiden ersten wurden bereits in den dreißiger bis fünfziger Jahren konzipiert. Der hier untersuchte dritte Teil wurde als „Wandlungen der Wir-Ich-Balance“ 1987 erstmals veröffentlicht. Er kann als Erweiterung und Zusammenfassung der jahrzehntelangen Denkarbeit an soziologischen Grundproblemen verstanden werden. Das Denken Elias’ über den Prozeß der Zivilisation entwickelt ein eigenes Profil und entzieht sich einer Einordnung eher als andere. Auf Grund des breit konzipierten Ansatzes eröffnet sich jedoch auch für den Nicht-Soziologen die Möglichkeit, der Entwicklung der Begriffe Individuum und Gesellschaft in ihrer sozialen Bedingtheit zu folgen und einigen Gewinn aus dem Versuch eines „interdisziplinären“ Ansatzes zu ziehen. In den „Wandlungen der Wir-IchBalance“ fordert Elias die Entwicklung eines Modells interdisziplinär kommunizierbarer Begriffe zur Erfassung von Entwicklungsprozessen dynamischer Natur, die den sich schnell wandelnden Beziehungen von Menschen zueinander entsprechen. Methodisch repräsentiert ein solch prozeß-soziologischer Zugang (233) eine Synthese von Erklärungen, die sich nach Elias wesentlich von einem Abstraktionsbegriff individueller Natur unterscheidet. Begründet wird dies mit der Notwendigkeit, bestimmte Merkmale oder Beziehungen des zu untersuchenden konkreten Gegenstandes abstrakt zu erweitern, um zu allgemeinen Bestimmungen zu kommen. Hierzu dient die Einführung des nach Elias noch zu rezipierenden Begriffs der Ich-Wir-Identität, der an Hand einer etymologischen und philosophiegeschichtlichen Begriffsbestimmung Bücher zum Thema von Individuum und Gesellschaft ableitbar ist. Wesentliches Ergebnis ist der Gebrauch von „individuell“ und „sozial“ als Gegensatzpaar in neuerer Zeit wie folgt: Elias zeigt eine Entwicklung von der Wir-Identität (das, was Menschen miteinander zu tun haben) zu einer modernen Ich-Identität (das, was sie voneinander unterscheidet). Dies wird mit einer Fülle von Beispielen von der Antike bis zur Neuzeit belegt. Während noch im klassischen Latein das Wort Individuum unbekannt ist, zeigen in der Renaissance Humanisten, Kaufleute und Künstler Beispiele individuellen Aufstiegs. Im 17. Jahrhundert kommt es nach Elias möglicherweise erstmals zu einer Unterscheidung zwischen dem, was individuell und dem, was kollektiv getan wird. Bestimmend für die Entwicklung einer modernen Gesellschaft ist eine eigentümliche Verschiebung der Wir-Identität zu einer Ich-Identität. Begründet wird dies mit der Wandelbarkeit des Zusammenlebens eines Menschen mit anderen, mit der ständigen Bewegung menschlicher Gesellschaften. Eine solche Dynamik läßt nach Elias die gewohnten sozial- und naturwissenschaftlichen Problemstellungen nicht mehr als realitätskongruent erscheinen. Die traditionell philosophische Diskussion wird hier im einen soziologischen Aspekt des Zusammenlebens einerseits erweitert und andererseits als idealisierend in Frage gestellt. Es wird betont, daß Menschenwissen nicht aufgrund sachbezogener Denkprozesse, sondern ein Lernen durch bittere Erfahrung ist. Beispiele der Gründung von UNO und Weltbank belegen dies. In Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition der europäischen Neuzeit beschreibt Elias eine Schwergewichtsverschiebung der Balance von Wir-Identität zur IchIdentität mit Descartes’ Cogito als entschiedenem Akzent auf dem Ich. Um zu einer vergleichbaren Bestimmung der Grundzüge einer sozialen Persönlichkeitsstruktur in zeitgenössischer sozialer Gegebenheit zu kommen, führt Elias den Begriff des sozialen Habitus ein (269). Bezugsrahmen ist hier der Integrationsprozeß der Menschheit zu immer komplexeren Formen des Zusammenlebens. Der soziale Habitus der Individuen als verschiedene Ausprägung der Persönlichkeitsstruktur beschleunigt oder verlangsamt je nach dem Wir-Bild und dem Wir-Ideal die Transformation von Nationalstaaten zu supranationalen Gebilden. Die Fixierung individuellen Empfindens und individueller Verhaltensweisen ist nicht allein ein Problem des Denkens, sondern auch gefühlsstarker Vorstellungen, Emotionen, Affekte oder Triebe. Eigentümlich ist für Elias dabei, daß die Wir-Identität der meisten Menschen hinter der Realität des tat- Bücher zum Thema sächlichen Integrationsniveaus herhinkt. Das Wir-Bild bleibt weit hinter der Realität der globalen Interdependenz. Das Verantwortungsgefühl für die bedrohte Menschheit ist minimal. Die Identifizierung mit begrenzten Teilgruppen bleibt hinter der Realität der Menschheit als übergreifender Lebenseinheit zurück. Eine gewisse Hoffnung bezieht Elias aus dem möglichen Aufstieg der Menschheit zur dominanten Überlebenseinheit. Dies könnte einen Individualisierungsschub bedeuten ähnlich dem des Übergangs zum Primat des Staates im Verhältnis zu Sippe und Stamm. Nino Pricoco Manfred Frank / Gerard Raulet / Willem van Reijen (Hrsg.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp) 434 S., 22.Die in diesem Band versammelten Beiträge gehen zurück auf Vorträge, die in den Jahren 1984 und 1985 in Wien und Amsterdam anläßlich zweier Kolloquien zum Thema gehalten wurden. Manfred Frank geht in seinem Aufsatz „Subjekt, Person, Individuum“ der Frage nach, welche Beziehung die Begriffe `Subjekt` und `Individuum` untereinander und zum Begriff `Person` haben. Er verfolgt die- se Problematik unter erkenntnistheoretischer, semantischer und hermeneutischer Perspektive. Seiner Vorstellung nach sollen die jeweiligen Mängel eines Paradigmas durch die Vorzüge des nachfolgenden behoben sein. `Subjektivität` in erkenntnistheoretischer Perspektive sei ein Allgemeines, ein allen selbstbewußten Wesen gemeinsames Strukturmerkmal, die semantische Perspektive (Strawson/Tugendhat) geht zwar der Individualisierungsleistung des `ich` in der ersten Person singularis nach und kommt zum `Selbst` und zur `Person`, aber erst das hermeneutische Verfahren ist offen für die „welterschließende Innovativität selbstbewußten In-der-Welt-Seins“. Einer Hermeneutik des Selbstverständnisses, die die Kategorie der Individualität aufnimmt, sei es vorbehalten, die Unableitbarkeit singulärer Sinnentwürfe (auch im Rahmen einer Lebensgeschichte) zu bewahren und trotzdem ein synthetisches Einheitsprinzip nicht auszuschließen. Der Autor bezeichnet seine Darlegungen als tentativ und ihre Ausarbeitung soll das Werk zukünftiger Generationen sein! Willem van Reijen propagiert in seinem Aufsatz die Unrettbarkeit des „monopolistischen Ichs“ des Cartesianismus, der Aufklärungsphilosophie und des Deutschen Idealismus: „Es gibt keinen archimedischen Punkt mehr, keine Grundlage, von der aus alles geordnet, gedacht oder Bücher zum Thema durch meßbare Effekte beeinflußt werden könnte. Es gibt keine feststehenden Kriterien mehr für die Wahrheit von Urteilen, die Rechtfertigung des Handelns, die Aufrichtigkeit von Intentionen ...“ Das alte `Ich` habe dem Terror der Vernunft gedient mit all seinen historisch-politischen Folgen einschließlich den Greueln der Geschichte. Der Versuch, alles in den Griff zu kriegen, habe zur Vergewaltigung des Besonderen durch das Allgemeine geführt. Das Neuartige, das neue Element der aktuellen Situation besteht für van Reijen darin, daß beides nebeneinander existiert: der alte Sinn, die alten Sicherheiten und die Liquidation der symbolischen Ordnung, die Auflösung in Allegorien. Die neue (alte Negativ-) Utopie Gerard Raulets setzt in erster Linie auf Baudrillards Medienphilosophie. Raulets „positive Barbarei“ verstärkt den totalen Verlust der Bezüge und Kriterien und er glaubt tatsächlich „jede zielstrebige Prozeßhaftigkeit ist zu Ende“. Fiktion und Realität seien nicht mehr trennbar, die Anomiepotentiale, durch die neuen Technologien in Gang gesetzt, unüberwindbar. Ihm dient das Kreditkartensystem als Beispiel: „Was bedeutet noch der Buchungstag, wenn mit der weitverbreiteten Kreditkarte das Geld systematisch mit Lichtgeschwindigkeit von einem Ort zum Anderen wandert ...“ Und wohl ebenso die Subjekte, sie seien nur noch „operativ“. Was dem Geld als allgemeinem Äquivalent widerfährt, geschieht auch schicksalhaft mit dem menschlichen Individuum: Seine Stellung im „Rhizom“ sei gleichermaßen austauschbar wie arbiträr. Raulet mit den Worten Baudrillards: „Wir nehmen nicht mehr am Drama der Entfremdung, sondern an der Ekstase der Kommunikation teil.“ Hier hofft der Rezensent, diese Ekstase und die zugehörige „weiße Obszönität“ im Universum medialer Transparenz möge den Leser bei der Lektüre von Raulet / Baudrillard nicht zu sehr aus der Bahn werfen. Raulet kommt zu dem Ergebnis, daß wir mit dem Verschwinden der Unterschiede zwischen Realem und Fiktivem in den Animismus zurückkehren und er schließt, ehrlicherweise, seinen eigenen Diskurs über die potentiellen Wirkungen der neuen Technologien nicht aus. In dem spannend zu lesenden Aufsatz von Friedrich Kittler wird der „Tod des Subjekts als Beamter“ wissensoziologisch bearbeitet. Alle Wiederbelebungsversuche scheinen überflüssig, wenn die Neudefinitionen von Subjektivität fortführen, was Kittler als die „Philosophie simultaner Bildungsreformen und das heißt Sozialsteuerungsprozesse“ um 1800 und später aufzeigt. Indem er die sozialhistorischen Räume, z.B. die Strategien, nach denen deutsche Staaten ihre Schulen, zumal ihre höheren reformierten, erforscht, Bücher zum Thema und belegt, wie hier das Subjekt als Erziehungsbeamter eines Bildungsstaates - einerseits unterworfen, andererseits frei - entsteht, bezeichnet er auch den historischen und gesellschaftlichen Ort des Deutschen Idealismus. Der Typus des Subjekts als universaler Beamter kommt mit dem „Zerbrechen des Schriftmonopols an technischen Medien“ zu seinem Ende. Die Frage nach diesem Subjekt wird obsolet. Denken, das an der Zeit ist, beschäftigt sich offensichtlich auf sehr unterschiedliche Weise mit der Frage nach dem Subjekt, wie schon die hier getroffene Auswahl aus der Aufsatzsammlung verdeutlichen mag. Allen alten und neuen Fragestellern ist dieses Buch zu empfehlen. Udo Wieschebrink Manfred Frank/ Anselm Haverkamp (Hrsg.): Individualität (Poetik und Hermeneutik XIII), München 1988 (Fink Verlag), XX, 678 S., 7ÿAbb., kart., 68.„Ende des Individuums - Anfang des Individuums?“ lautete das Thema, dem sich die Arbeitsgruppe Poetik und Hermeneutik auf ihrem Kolloquium im Jahre 1986 widmete und dessen Vorträge und Diskussionen als 13. Veröffentlichung der gleichnamigen Reihe nun vorliegen. Der traditionsgemäß voluminöse Band, der in inhaltlich lockerer Beziehung zu „Poetik und Hermeneutik VIII: Identität“ steht, versammelt Beiträge philosophischer, theologischer, psychoanalytischer und literaturwissenschaftlicher Provenienz und schließt mit zwei Aufsätzen zur Individualität in der Porträtmalerei. Motiviert wird die Themenstellung durch die Herausforderung des französischen Poststrukturalismus, der die Inhalte dessen, was traditionell mit dem Begriff Individualität bezeichnet wird, grundsätzlich in Frage stellt; so spricht M. Foucault vom Menschen als einer „Erfindung, deren junges Datum die Archäologie unseres Denkens ganz offen zeigt. Vielleicht auch das baldige Ende.“ Für J. Derrida ist das selbstbewußte Individuum immer nur in der anwesenden Abwesenheit seiner selbst faßbar: Subjektivität als „Auto-Affektion konstituiert das Selbst (auto), indem sie es teilt. Der Entzug der Präsenz ist die Bedingung der Erfahrung, das heißt der Präsenz.“ - Die Teilnehmer des Kolloquiums sind hauptsächlich damit beschäftigt, in positiver wie negativer Kritik der französischen Kritiker den Wandel von Individualitätskonzepten nachzuzeichnen und im Anschluß daran aktuelle Ansätze auszuarbeiten. Das zugrundeliegende Paradigma vieler Beiträge, das M. Frank und A. Haverkamp in ihrer Einleitung anführen und das die Diskussion wie Bücher zum Thema ein Subtext begleitet, ist Foucaults Beschreibung des „Erscheinens“ des Individuums nach dem Zerfall der klassischen episteme am Ende des 18.Jahrhunderts. In „Les mots et les choses“ (1966) leitet Foucault die Entstehung der Humanwissenschaften im 19.Jahrhundert aus der Möglichkeit der Selbstthematisierung des Menschen her, die so vorher nicht gegeben war. Diese Selbstthematisierung vollzieht nach Foucault erstmalig die Transzendentalphilosophie Kants und in der Folge alle Entwürfe der Bewußtseinsphilosophie, die das Individuum wesentlich als Selbstbewußtsein fassen. Gerade diese Konzeptionen des Individuums als mit sich selbst identischem Einzelsubjekt werden nun aber von den französischen Theoretikern hinterfragt. Bereits Foucault wies darauf hin, daß Kants Ansatz eine unüberbrückbare Kluft aufreißt zwischen einem transzendentalen und einem empirischen Subjekt, so daß die Identität des selbstbewußten Ich durch eine irreduzible Differenz allererst ermöglicht wird und zugleich eine beständige Kritik provoziert, angefangen bei den Frühromantikern und andauernd bis in die Gegenwart. Die Abkehr von den „Identitätsmodellen“ der Bewußtseinsphilosophie und die Hinwendung zu einem hermeneutisch oder sprachphilosophisch begründeten Individualitätsbegriff ist die Argumentationsbasis der Diskutanten - gestützt auf Entwürfe von Schleiermacher und Humboldt sowie auf die „Differenzmodelle“ von Lacan, Derrida und de Man. Es bilden sich im wesentlichen zwei Ansätze von Individualität jenseits der Identität heraus, die freilich auch miteinander verbunden werden: Zum einen wird Individualität als Unverfügbarkeit gefaßt. Bei M. Frank ist es die Unverfügbarkeit des Individuums der Sprache als Allgemeinheit gegenüber, durch die es im hermeneutischen Prozeß des Verstehens und in der Möglichkeit zu semantischen Innovationen im Sprechakt seine Freiheit und Eigenheit bewahrt. R. Warning versteht Individualität mit Derrida als eine Logik der Supplementarität, die in einer ständigen Bewegung von Substitution und Ergänzung ein Individuum zu restituieren sucht, das es als völlig gegenwärtiges nie gegeben hat. Wo Frank meint, noch einen Kern von Individualität festhalten zu können, entgeht sie bei Warning jeder Fixierung und mündet in eine unendliche Folge von Supplementen einer Individualität, die selbst keinen Ort mehr beanspruchen kann. In ähnlicher Weise spricht W.Iser vom Individuellen als einer „Quelle kognitiver Mythen“, die von der produktiven Illusion gespeist werden, des Wesen der Individualität benennen zu können, während diese selbst sich auf den Status einer Ermöglichung von Dis- Bücher zum Thema kursen über Individualität zurückzieht. Eine andere Diskussionslinie betrachtet Individualität als Ergebnis eines - im weitesten Sinne - Bildungsprozesses, der indessen nicht mehr, wie in der Klassik, als ein prinzipiell abschließbarer gedacht wird. „Individualität ist etwas, das aus der sozialen Genese entspringt“ und sich über das Medium der Sprachlichkeit konstituiert, so L. Jäger mit Humboldt; im ständigen Austausch mit dem Allgemeinen gewinnt das Individuum die Unverwechselbarkeit einer Biographie. Auch J. Küchenhoff betont in seinem auf die Psychoanalyse Lacans rekurrierenden Beitrag das prozessuale Moment der Individualität. Die imaginären, statischen Identiätsentwürfe des Ich werden von der sprachlich-symbolischen Ordnung, in der sie sich artikulieren müssen, destruiert, so daß die individuelle Freiheit gerade in der Beweglichkeit zu immer neuen, jedoch auch notwendig immer wieder imaginären und illusorischen Ichentwürfen besteht. Individualität wäre demnach anzusiedeln im „Realen“, das Lacan als „Fuge“ zwischen dem Imaginären und dem Symbolischen beschreibt. „Aus psychoanalytischer Sicht scheint Individualität nur als Prozeß zu retten, als Rhythmus in einer offenen Bewegung, deren Kontinuität nur in der Erinnerung erzeugt wird, die Identität erst schafft; darum ist das Futurum II die Zeit psychoanalytischer Erkenntnis: Ich werde erst im Nachhinein sagen können, wer ich gewesen sein werde. Identität ist immer Ergebnis der Konstruktion vom gegenwärtigen Standpunkt aus, die immer schon überholt ist, die aber auch als Illusion wirkmächtig wird.“ (Küchenhoff, 647-648) Billiger als mit derart gewiß nicht simplen Konstruktionen scheint das Individuum der Moderne nicht zu haben zu sein. Doch wird damit nicht ein wesentlicher Bestandteil der klassischen IndividualitätsVorstellung, die Autonomie nämlich, preisgegeben? Wenn Frank die Freiheit des Individuums als eine semantische, nicht aber als eine in die Welt eingreifende, mithin praktische Freiheit gelten läßt, unterliegt dann dieses Individuum nicht der Gefahr, ein verinnerlichter, dem drohenden Solipsismus ausgelieferter Mensch zu sein? Frank, der seinen Individualitätsbegriff fernab von jeglichem „bürgerlichen Individualismus“ rückt, würde diese Konsequenz sicherlich nicht zugestehen. Doch O. Marquard beschreibt gerade diesen Individualismus als weitgehende Kontingenz der Individuums, das sich gegenüber dem allgegenwärtigen Konformismus durch Originalität, die sich vom Usuellen abhebt, auszeichnet. Diese Reduktion des Individuellen auf die unwesentliche Abweichung - die gerade den Inhalt der konformitätsfördernden Ideologie der westlichen Bücher zum Thema Freizeitgesellschaft ausmacht - ergibt sich für Marquard zwingend aus seiner Absage an jedwede „Totalitätsillusion der Universalgeschichte“ (24). Denn wenn die bestehende Ordnung das letzte Wort ist - und bei Marquard ist sie es -, dann wird das Individuum tatsächlich nur mehr als das Originelle sichtbar. Wird jedoch das gegenwärtige Gesellschaftssystem als ein zu überwindendes begriffen, in dem bereits die Spuren des Neuen wirken, so muß auch an der praktischen Komponente der Individualität festgehalten werden. Foucault hat das Zeitalter des Menschen zugleich als das der Geschichte benannt. Jenseits des Relativismus, den er mit dieser Bestimmung verbindet und der sich aus seiner epochenimmanenten Betrachtungsweise ergibt, wäre gerade am Individuum als einem wesentlich historischen festzuhalten, das als Grundlage und - mehr oder weniger bewußtes - Subjekt dieser Geschichte zu verstehen ist. Denn ohne das tätige Individuum kann eine Zukunft, die Individualität als - wie auch immer vermittelte - Identität faßt, nicht gedacht werden. Insofern bleibt die idealistische Konzeption der Individualität als Identität eine Aufgabe, deren Verwirklichung noch aussteht - und die zu leisten ist von unvollständigen, beschädigten und entfremdeten Menschen. Möglich ist dies jedoch nur, wenn weder das transzendentale noch das empi- rische Subjekt zugunsten des jeweils anderen aufgegeben wird, sondern der Mensch als Ganzheit sowohl den theoretischen Ausgangspunkt als auch das praktische Ziel darstellt. In der Gegenwart meint Individualität weder eine „Zwangsvorstellung“ (A.M. Haas), von der es sich zu befreien gilt, noch ein Alibi, dessen Ort bislang noch nicht gefunden wurde, sondern eine Utopie, der ein Ort allererst zu schaffen ist. Günter Butzer Hiltrud Gnüg: Kult der Kälte. Der klassische Dandy im Spiegel der Weltliteratur, Stuttgart 1988 (Metzler) 348 S. geb., 36,Zufällig sah ich dieser Tage wieder einmal Jean-Pierre Melvilles Film „Der eiskalte Engel“. Der Typ, den Alain Delon hier darstellt, wie die ästhetische Konzeption des Films scheinen prototypisch die Attribute des dandyistischen Schönheitsideals zu vereinen: Eleganz, impassibilit‚, den immoralischen beobachtenden Blick, die Ästhetisierung des Verbrechens, die Ablehnung der herrschenden Moral und das Handeln nach einem inneren undurchschaubaren Gesetz, die erotische Aura von Macht, die den melancholischen solitaire umgibt, die vollkommene Künstlichkeit und Stilisierung, die sogar die Inszenierung des eigenen Todes einschließt. Der Film Bücher zum Thema zog Generationen von Cineasten in seinen Bann. Die Permanenz der Faszination des Dandyismus fragt nach einer Erklärung. Die vorliegende Untersuchung der Literaturwissenschaftlerin Hiltrud Gnüg bietet dazu einen wichtigen Ansatz. Ihr Erkenntnisinteresse gilt dem klassischen Dandyismus. Zurecht weist die Autorin darauf hin, daß der Dandy als Sozialtypus des 19. Jahrhunderts sich von neumodischen Imitatoren durch den Habitus eines geistigen und ästhetischen Aristokratismus, durch den er sich der Menge, in der er sich incognito aufhält, unsichtbar entzieht, unterscheide. Dem entspricht sein Modestil einer unauffälligen Eleganz. Ch. Baudelaires Maxime - „Der Dandy muß sich bestreben, sublim zu sein ohne Unterbrechung. Er muß leben und schlafen vor einem Spiegel“ weist ins Zentrum dandyistischen Selbstverständnisses: Affektkontrolle und Überwachheit des Bewußtseins, die durch permanente (Selbst)-Beobachtung und Agilität des Intellekts konstituierte Überlegenheit des Subjekts, die Leben als selbstvergessenen, erfüllten Augenblick nicht zuläßt. Beim modischen Narziß der Gegenwart, der sich in den Spiegeln des New Wave Caf‚s betrachtet, habe sich dieser Habitus zur äußerlichen Attitüde verkehrt. Die Kultivierung einer ästhetischen Lebenshaltung als Charakteristikum des Dandyismus ermöglicht H. Gnüg, ihn nicht nur sozialgeschicht- lich, sondern als folgenreiches ästhetisches Paradigma des 19. Jahrhunderts zu begreifen. Diese These bestimmt die Gliederung des Buchs in einen begrifflichsystematischen Teil und einen Teil konkreter Werkanalysen, in dem die Autorin die verschiedenen Facetten und die innere Verfallslinie des Dandyismus, wie sie sich in der Literaturgeschichte spiegeln, nachDie Metaphorik der Kälte, die ihre zeichnet. polare Entsprechung in der „Wärme- und Glutmetaphorik der Romantik“ hat, zeigt den entscheidenden Bruch der dandyistischen mit der traditionellen Ästhetik an: die Absage an das idealistische Paradigma einer Versöhnung von Intellekt und Natur, die Aufhebung der Entzweiung des Subjekts, die noch in der Ästhetik der Romantik wenn auch gebrochen - den utopischen Fluchtpunkt bildet. Für den Dandyismus ist der unauflösliche Widerspruch von Geist (spiritualit‚) und sinnlich-triebhafter Natur (animalit‚) existentielle Bedingung. Dandyistische Ironie ist die Reflexion der eigenen naturbedingten Unfreiheit, der Wille zur absoluten Künstlichkeit und Selbststilisierung Ausdruck des Triumphs der Form über die Materie. Dem Dandy ist die äußere und innere Natur suspekt. Sein Domizil ist der Salon und die moderne Großstadt als erweitertes Interieur. Konsequent lehnt der Dandy das romantische Ideal sublimierter Sinnes- Bücher zum Thema liebe ab. Gnüg zeigt, leitmotivisch in der erotischen Sphäre, die innere Spannung der dandyistischen impassibilit‚ zwischen Langeweile und selbstzerstörerischer Passion auf. Diese Spannung prägt auch das Bild der Frau, die als „animalit‚“ für den Dandy Gefahr wie Verlockung darstellt: evident in der schillernden Metapher der „Wildkatze“, die zugleich auch dandyistische Attribute der Erhabenheit und Eleganz verkörpert - Phantombild einer „femme dandy“, als Produkt einer „literarisch stilisierten Männerphantasie“. Changierend zwischen leidenschaftslosem Beobachter und „Dompteur“, sei der Dandy, so Gnüg, unbewußter Träger der „Überlistmentalität“ „bürgerlicher Technik“ (Bloch). Diese These illustriert die Autorin eindrucksvoll in einer Analyse von Balzacs Erzählung „La fille aux yeux d’or“. Die dem dandyistischen Subjektentwurf zugrundeliegende Naturverachtung verlangt in ihrer Widersprüchlichkeit gesehen zu werden. In ihr gelangt eine Revolte zum Ausdruck gegen das herrschende Bewußtsein gesellschaftlicher und künstlerischer Naturwüchsigkeit, gegen Utilitarismus, Philistertum, Konformität und moralische Bigotterie der bürgerlich-kapitalistischen Leistungsgesellschaft. In der Ablehnung aller bürgerlichen Wertvorstellungen, die die Authentizität des Subjekts, die Einheit des Lebens nur noch in der Sphäre des ästhetischen Scheins, „jenseits von Gut und Böse“ zulassen - als Sphäre der „Prostitution“, des „mal“, des Satanischen, des schönen Verbrechens zeigt sich der Dandyismus als Vexierbild des schlechten Bestehenden. Gnüg weist auf die Parallelen zur Philosophie Nietzsches hin. Sein elitärer Anarchismus, der den Dandy außerhalb der Gesellschaft stellt, ist politisch-ideologisch zwiespältig. Potentiell ist er ein Sympathisant der „Entrechteten“ (Baudelaire, Walter Serner), wie eines rechtsextremen Putschismus (Ernst Jünger). Obwohl Gnüg zuzustimmen ist, daß mit der Durchsetzung der bürgerlichen Massengesellschaft, der Kultur- und Bewußtseinsindustrie der Dandy von der Bildfläche verschwunden ist, ist doch zu entgegnen, daß die dandyistische Vision als ästhetischer Topos in der Kunst des 20. Jahrhunderts bis heute präsent geblieben ist. So sieht z. B. S. Neumeister (Der Dichter als Dandy, München 1973), in Thomas Bernhard (!) einen zeitgenössischen literarischen Repräsentanten des Dandy. Georg Koch Werner van Haren: Grundrisse einer Theorie der Intellektuellen. Zu Funktion, Geschichte und Bewußtsein von Intellektuellen, Bücher zum Thema Köln 1988 (Pahl-Rugenstein) 297 S., 35.Mit seiner Arbeit greift van Haren die - zwischenzeitlich liegengebliebene - „Intelligenzdebatte“ zu Beginn der 70er Jahre in der Linken wieder auf. Damals ging die Diskussion um die sozialökonomische Charakterisierung der Intelligenz, die sich durch den Ausbau der Hochschulen sprunghaft vermehrt hatte: werden die „geistigen Lohnarbeiter“ ein Teil der Arbeiterklasse sein oder eine eigene „Mittelschicht“ bilden, und wohin werden sie sich gesellschaftlich orientieren zur Arbeiterklasse oder zur Bourgeoisie? Auch wenn diese Auseinandersetzung in der Praxis heute keineswegs abgeschlossen ist, wie die Schwierigkeiten der Gewerkschaften mit der Organisierung dieser „neuen Mittelschichten“ demonstrieren, - van Haren stellt sich mit seiner Arbeit einem damals verdrängten Problem: dem Unterschied zwischen der „Intelligenz“ und den „Intellektuellen“. Wie schon der Titel andeutet, tritt er für eine eigenständige Behandlung des Begriffs „Intellektueller“ ein. Dieser sei nicht auf die sozialökonomische Kategorie der „Intelligenz“ zurückführbar, wenngleich Intellektuelle evidenterweise auch geistige Tätigkeiten ausführen. In einer historischen Skizze zeigt er, daß das Wort Ende des 19. Jahrhunderts in der Sphäre des politischen Kampfes entstanden und als Selbstbezeichnung französischer Aufklärer und Republikaner verwandt worden ist, und daß in diesem Sinne der Begriff weit zurück auf die Humanisten der Renaissance-Zeit weist. Ja, van Haren geht soweit, auch die Priester, Philosophen und Geschichtsschreiber der Antike und des Mittelalters unter dem Begriff „Intellektuelle“ zu fassen. In Übernahme des Politik-Konzepts des italienischen Marxisten Gramsci definiert er dabei den Begriff funktional in bezug auf diejenigen geistigen Tätigkeiten, die der Eroberung und der Erhaltung der politischideologischen Hegemonie einer Klasse über die anderen dienen. Kleriker und Aufklärer, „Linksintellektuelle“ wie konservative Ideologen gelten als „Intellektuelle“, weil und insofern sie durch ihre geistig-konzeptionelle Tätigkeit Einfluß auf eine Öffentlichkeit nehmen, in der sich politischideologisch die Hegemonie einer Klasse herstellt. Interessant und m.E. ausbaufähig sind seine Ausführungen über die soziale Psychologie des Intellektuellen, die er ausgehend von den Arbeiten des sowjetischen Psychologen Leontjew und des französischen Philosophen SÜve entwickelt. Die spezifische Tätigkeit des Intellektuellen bringe einen Typus hervor, der einen besonderen - über Theorien statt durch unmittelbare Erfahrung vermittelten - Wirklichkeitsbezug besitzt, durch geistige Bedürfnisse Bücher zum Thema bestimmt ist und daher einen für Außenstehende oft befremdlichen weltanschaulichen und ethischen Rigorismus vertritt, und der sich über eine relativ homogene, exklusive soziale Umwelt definiert. Eine Politik, so van Haren, die Intellektuelle ansprechen und integrieren möchte, muß diese sozialen Faktoren berücksichtigen. Weniger gelungen erscheinen mir die Teile seines Buches, die das Verhältnis von Intellektuellen zu den beiden großen Klassen, der Bourgeoisie und der Arbeiterbewegung, beinhalten. Dies weniger, weil etwa die Sozialdemokratie recht umstandslos der Bourgeoisie zugeschlagen wird, sondern weil hier die theoretische Analyse des Verhältnisses sich allzusehr mit den eigenen moralischen Wertungen und politischen Zielsetzungen vermengt: zugespitzt gilt ihm als „schlechter“ Intellektueller der Apologet des Bestehenden; als „guter“ derjenige, der sich in die Reihen der Partei der Arbeiterklasse einreiht, weil diese die allgemeinmenschlichen Werte der Erkenntnis, der Moral und der Humanität vertritt. Zwar verhehlt er keineswegs das durchaus spannungsreiche Verhältnis, das zwischen der Arbeiterbewegung und den Intellektuellen bestanden hat; als Maßstab gilt ihm, in der Tradition Gramscis, jedoch der „organische Intellektuelle“, der durch seine konzeptionelle Tätigkeit sich als Teil der organisierten Arbeiterbewegung einfügt. Was gänzlich fehlt, ist eine Darstellung der Stellung des Intellektuellen im realen Sozialismus, für die nach über 70 Jahren genügend Material vorhanden sein müßte. So wird man beim Lesen den Eindruck nicht los, daß weite Passagen noch vor der Zeit des „neuen Denkens“ im Marxismus konzipiert worden sind. Ein ganz anderer, neuer Wind weht dann auch im letzten Kapitel, wo van Haren eindrucksvoll die neue „intellektuelle Verantwortung“ für die Menschheit angesichts der globalen, menschheitsgefährdenden Probleme beschwört und den Intellektuellen nicht weniger als die Aufgabe zuschreibt, unsere Grundbegriffe von Natur, Mensch und Gesellschaft einer Überprüfung zu unterziehen. „Für die Zukunft“, schreibt er hier, „braucht die Menschheit den ihr verpflichteten Intellektuellen.“ Ob sich allerdings diese Bestimmung des Intellektuellen nahtlos mit jenem von ihm zuvor entwickelten Typ des „organischen Intellektuellen“ der Arbeiterbewegung deckt, bleibt im Buch eine offene Frage. Der Impuls van Harens Arbeit liegt denn auch darin, einen theoretischen Ansatz im Rahmen des Marxismus entwickelt zu haben, der aufhört, den „Intellektuellen“ auf die sozialökonomischen Kategorie der „Intelligenz“ zu reduzieren und ihm seinen Platz dort anweist, wo er aufgrund seiner Tätigkeit hingehört: Bücher zum Thema in den politisch-ideologischen Bereich. Darüberhinaus ist die Lektüre seines flüssig geschriebenen und kenntnis- und ideenreichen Buches ein Anlaß zur Selbstreflexion und eine Quelle der produktiven Auseinandersetzung jedes Intellektuellen mit sich selbst, mit seiner Psyche und seinen Konflikten, mit seiner sozialen Stellung und Funktion. Alexander von Pechmann Albert O. Hirschman: Engagement und Enttäuschung - Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl, Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp) 170 S., 16.Nach seinem 1977 veröffentlichten Buch „Leidenschaften und Interessen“ legt der amerikanische Soziologe Albert O. Hirschman mit „Engagement und Enttäuschung“ einen weiteren Versuch vor, den „gesellschaftlichen Wandel“ (7) zu erklären. Ein Aspekt dieses Wandels ist, daß sich „die Bürger“ manchmal vermehrt privaten Interessen „zuwenden“, zu anderen Zeiten wieder vermehrt öffentlichen Fragen (Hirschman nennt hier z.B. die „öffentlichen Aktionen“ von 1968). Die Beschreibung dieses „Schwankens zwischen Privatwohl und Gemeinwohl“, seine Ursachen und die Art und Weise, wie aus einer Vielzahl privater Akte eine gesellschaft- lich relevante Bewegung entsteht, bilden die Themen des Buchs. Im Mittelpunkt des Versuchs steht „der Bürger“ als Subjekt des gesellschaftlichen Wandels. Seine „wirtschaftliche Ratio“ bestimmt als Teil seiner Natur den Weltlauf. Das gesellschaftliche Ganze ist dann die Bündelung der in freier Konkurrenz ablaufenden Handlungen der Subjekte, ein Bild, das erklärtermaßen in der Tradition der Grenznutzenlehre von J.A. Schumpeter steht (siehe dazu Alfred Sohn-Rethel, der diese Theorie in seiner Dissertation widerlegte). Der Kreis der Bürger, für die sich Hirschman interessiert, ist allerdings eingeschränkt: Berufspolitiker und Parteifunktionäre sind ebensowenig gemeint wie Bürger, deren politische Tätigkeit sich auf das Ankreuzen von Wahlzetteln beschränkt. Es bleiben Revolutionäre, die irgendwann die Lust an der Revolution verlieren, oder Menschen, die irgendwann auf die Straße gehen und sich irgendwann wieder ins Privatleben zurückziehen. Wie sieht nun das Erklärungsmodell für diese Bewegungen zwischen privater und öffentlicher Sphäre aus? Gegenüber dem „begrenzten exogenen Blickwinkel bisheriger Erklärungsansätze“ (13) - er nennt dafür neben Naturkatastrophen auch Kriege - will Hirschman sich ganz auf die „inneren Triebkräfte“, also auf endogene Ursachen des Wandels konzentrieren. Für diese endogenen Ursachen hat Hirschman den Bücher zum Thema Schlüsselbegriff gefunden: Es ist die Enttäuschung, die den Übergang von der privaten zur öffentlichen Sphäre ebenso steuert wie den Übergang in umgekehrter Richtung. Beginnen wir mit der Privatsphäre. Den Produktionsbereich klammert Hirschman von vorneherein aus, denn die „Unzufriedenheit im Beruf“ erklärt sich für ihn „nicht so sehr, wie allgemein angenommen wird, aus den Merkmalen des Berufs oder Arbeitsplatzes selbst, sondern hängt eher mit dem Grad der allgemeinen Zufriedenheit zusammen“ (33). Privates Handeln ist für den Autor in erster Linie Konsum. Nun beinhalten alle Güter und Dienstleistungen ein mehr oder weniger großes „Enttäuschungspotential“, und so führt der Konsum zwangsläufig zur Enttäuschung, denn „der Mensch ist im Gegensatz zum Tier niemals wirklich zufrieden“ (19). Der Mensch reagiert auf diese Enttäuschungen letzten Endes mit einem Präferenzwandel: Er wechselt „in die politische Arena“ (69) und beteiligt sich „an irgendwelchen (!) Formen politischen oder kollektiven Handelns“ (85). Dieser Wechsel wird folgendermaßen beschrieben: Es ist, wie wenn jemand sowohl Äpfel als auch Apfelsinen kauft, die Apfelsinen weniger zufriedenstellend als die Äpfel findet und deshalb das nächste Mal mehr Äpfel kauft. Wie die Geschichte weitergeht, kann man schon ahnen: Auch in der politischen Arena wird der „ruhelose, seinen Leidenschaften ausgelieferte Mensch“ enttäuscht. Und zwar aus zwei Gründen: Einmal aus Über-Engagement (dazu wird der dumme Satz von Oscar Wilde zitiert, wonach der Sozialismus nicht funktioniere, weil er zuviele freie Abende kostet), zum anderen aus Unter-Beanspruchung. So erklärt Hirschman in einem kleinen Exkurs (116 ff.), warum gerade Demokratien so langweilig sind (was unter anderem auch zum Terrorismus führe): Bei demokratischen Wahlen hat jede Stimme gleiches Gewicht, damit findet die Intensität der politischen Überzeugungen des einzelnen Wählers keinen angemessenen Ausdruck, die Enttäuschung ist institutionell garantiert. Ganz anders in repressiven Staaten, wo sorgfältig abgestufte Strafsanktionen einen getreuen Maßstab für die Intensität des politischen Willens darstellen. Der nächste Schritt leuchtet sofort ein: Nach dem Ausflug in die politische Arena treibt die Enttäuschung den Bürger zurück an den Start - in den privaten Konsum. Auf diesem Weg macht der eine oder andere noch einen kleinen Abstecher: Die häufig auftretende Korruption im öffentlichen Bereich erklärt der Autor, ganz nebenbei, ebenfalls aus der Frustration blauäugiger Politneulinge. Hirschmans erster Programmpunkt war es, eine Phänomenologie des Schwankens zwischen privater und Bücher zum Thema öffentlicher Sphäre zu entwerfen. Schon auf dieser Ebene des bloßen Beschreibens merkt man allerdings, daß Enttäuschung bestenfalls beim Wechsel ins Private eine wesentliche Rolle spielt, kaum aber beim Wechsel in die Öffentlichkeit: Niemand, der auf die Straße geht, macht dies aus Enttäuschung am Konsum, eher schon, weil er von diesem ausgeschlossen ist. Ebensowenig hat Konsumkritik als Teil von Gesellschaftskritik ihre Wurzel in der Enttäuschung am Konsum. Mit der Entdeckung eines begleitenden Gefühls „Enttäuschung“ ist natürlich noch nichts erklärt. Es bleibt die Frage nach den Ursachen dieser Enttäuschung und vor allem nach den Gründen ihres simultanen Auftretens. Hier muß Hirschman sehr schnell sein ursprüngliches Vorhaben aufgeben, sich ganz auf endogene Ursachen zu konzentrieren; er nähert sich wieder dem Bereich, den er eigentlich abtrennen wollte: dem gesellschaftlichen Sein. Die „äußeren Ereignisse Vietnamkrieg oder eine individuelle Neurose“ (81) werden als letzte Auslöser wieder eingeführt (inwieweit allerdings individuelle Neurosen äußere Ereignisse sind, bleibt ein Geheimnis des Verfassers). Die Rückführung der Enttäuschung auf „die ökonomische Struktur und Entwicklung“ (20) wird zwar angekündigt, die Ergebnisse bleiben aber widersprüchlich und erklären damit nichts. So führt nach Hirschman einerseits wirtschaftliches Wachstum zu besonders starken Konsumenttäuschungen und damit zu einem Wechsel in den öffentlichen Bereich, andererseits vergrößern aber auch „wirtschaftliche Wachstumsschwierigkeiten“ das Interesse an der öffentlichen Sphäre und staatliche Repression führt einerseits zu stärkerem politischem Engagement, andererseits aber zu vermehrtem Rückzug Was kannins man Private auch(11). von einer Theorie erwarten, die mit der Rede von „dem Menschen“ alle politischen Unterschiede unterschlägt (siehe dazu Günther Anders in „Ketzereien“), die jede inhaltliche Diskussion vermeidet und etwa den Ausbruch eines Krieges u.a. mit „irgendeinem (!) Bedürfnis der Bevölkerung, sich in größerem Maße als zuvor, für öffentliche Angelegenheiten zu begeistern“ (12) begründet? Es bleibt die Frage, warum sich Hirschman in die Öffentlichkeit begeben und das vorliegende Buch geschrieben hat. Die Schlüsse, die er am Ende seiner „Fabel“ zieht, machen es deutlich: 1) Es gibt auch Konsum ohne Enttäuschung: den Konsum von Geld (34). Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, oder denen dieser Weg mangels Geldes versperrt ist, gilt: 2) Die Wechsel zwischen privater und öffentlicher Sphäre sind nicht in sich schlecht, sie können sogar der Gesellschaft zugute kommen (Hier müssen neben Kierkegaard Bücher zum Thema der Hinduismus und die Heilige Schrift herhalten: „Alles zu seiner Zeit“ (146). 3) Von Übel ist allerdings ein zu starkes Schwanken, z.B. „erregte Anfälle von Öffentlichkeitsseligkeit“ (146), deshalb sollte man 4) die „Abspaltung des Privaten vom Öffentlichen“ (oder auch die „Dissoziation von Arbeit und Liebe“) verringern. Tritt nun, etwas überraschend, doch die Arbeit ins Blickfeld, so ist auch Hirschmans Vorschlag zur „Versöhnung“ nicht gerade originell: „mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz könnte z.B. ein Schritt zur Überwindung der Spaltung sein“. Sie „würde die Arbeitszufriedenheit steigern“ (147). Ziel ist offensichtlich der konsumfähige, kontrolliert-politische Bürger in einem modernisierten Kapitalismus, wo im Zeichen der Beliebigkeit aller Inhalte Sphärenwechsel zur Sphärenharmonie führen. Der Autor leistet mit seinem Buch einen Beitrag zur Rechtfertigung dieses Ziels. Es bleibt als Fazit: Das Buch ist eine Enttäuschung - das könnte nach Hirschman dazu führen, das Bücherlesen zu lassen, um statt dessen z.B. wieder mehr Äpfel zu kaufen, es könnte aber auch den Leser ärgern und ihm damit einen Anstoß geben, den Dingen ohne dieses Buch auf den Grund zu gehen - und dann hätte Hirschman ja doch recht, wenn er der Enttäuschung eine so große Bedeutung als Triebkraft gesellschaftlicher Prozesse beimißt. Carl Freytag Georg Kohler, Handeln und Rechtfertigen. Untersuchungen zur Struktur der praktischen Rationalität, Frankfurt/Main 1988 (Athenäum), 256 S., 78.Georg Kohler, Philosophiedozent in Zürich, bietet in seinem Buch eine aktuelle Zusammenschau der Ergebnisse der analytischen Handlungstheorien des angelsächsischen Raums mit den bundesdeutschen Diskussionen über Diskurs und Dezision, die vor allem von Habermas und Lübbe als Antipoden geführt worden sind. Ins Zentrum stellt Kohler einen Begriff von Handeln, der sich gleichermaßen von seiner behavioristischen Auflösung in Verhalten wie von seiner vorschnellen Bindung an moralische Postulate distanziert. Er versucht die beiden Begriffe, die dem Buch den Titel geben, definitorisch aufeinander zu beziehen: Handeln bedeute ein Verhalten, das prinzipiell rechtfertigungs- und damit diskursfähig ist, für das also prinzipiell Gründe angebbar sind. Handeln, so Kohler, sei aber immer auch die Antwort auf die praktische Frage: Was tun? und sei als solches das Resultat von (impliziten oder Bücher zum Thema expliten) Entschlüssen. Die Diskursfähigkeit und die Dezisionsnotwendigkeit seien, so Kohlers Pointe, keine Gegensätze, sondern notwendige Elemente der Handlungsstruktur. Die mit dem Wort „prinzipiell diskursfähig“ angegebene Breite des Handlungsbegriffes ermöglicht es Kohler, auch die Phänomene der Lüge bzw. Verstellung der „wahren“ sowie der Unsicherheiten und Korrekturen der eigenen Handlungsmotive in sein Konzept zu integrieren. Entscheidend für ihn ist, daß sie als im Prinzip rechtfertigungsfähig und -bedürftig angesehen werden. Die Grenzen der Beliebigkeit zieht Kohler, indem er die Formen der Selbstlüge - wenigstens auf Dauer - als ausgeschlossen erachtet. „Wer auf die Frage: ‘Warum tust du das?’ antwortete: ‘Weil ich es selbst für unrichtig halte’ ... verlöre die Einheit mit sich, noch bevor er an der Welt scheitern müßte. Man kann sich, ohne seinen Selbst-erhalt zu gefährden, nur auf das hin entwerfen, was man selbst für wahr, für rechtfertigbar hält“ (181). Wenngleich dies keinesfalls bedeute, daß jede Handlung - nicht einmal die meisten - der faktischen Rechtfertigung bedürfe. Die Stärke von Kohlers Arbeit liegt in der Breite seines Handlungsbegriffs, die es ihm erlaubt, die unterschiedlichen Diskussionen über Normenbegründungen, über die Intentionalität, die Richtigkeit und die Begründbarkeit von Handlungen ohne vorschnelle Ausgrenzungen zu integrieren. Unproblematisch erscheint es mir auch, wenn Kohler das Handeln mit der Existenzweise der Menschen in der Weise verknüpft, daß es eben dem Menschen - im Unterschied zum Tier - zukommt, den „Hiat zwischen Motivleben und Handlungsvollzug“ durch den Einsatz von Rationalität, zu überwinden, d.h. zu handeln. Kaum zu bestreiten ist ebenfalls seine These, daß die Menschen aufgrund ihres Instinktverlustes zum Handeln gezwungen sind. Keineswegs ausgewiesen ist jedoch seine Annahme, daß diese Unausweichlichkeit zu handeln die „existentielle Notwendigkeit“ des Menschen sei, die sich nicht weiter erklären oder begründen ließe. Kohler springt hier recht unverhofft von der Analyse des Handlungsbegriffs in den Bereich der Fundamentalontologie bzw. der philosophischen Anthropologie und nimmt unproblematisiert Anleihen bei Heidegger und Tugendhat. M.E. besteht keine Notwendigkeit, das Handeln als existentiellen Zwang zu bestimmen, sondern kann mit gleich guten (wenn nicht besseren) Gründen, z.B. evolutionstheoretisch, als geschichtliche Tat der Befreiung des Menschen von den natürlichen Schranken oder als treibende Kraft der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft interpretiert werden. Bücher zum Thema Kohlers philosophischer Blickwinkel führt ihn denn auch dazu, zugunsten der Handlungsgründe bzw. -begründungen die objektiven Resultate menschlicher Handlungen wie Zivilisation oder Kultur sowie die Probleme der Konflikte zwischen den Motiven und den Resultaten der Handlungen, die mit dem Problem der „Entfremdung“ verbunden sind, zu vernachlässigen. Ein Mangel, der jedoch nicht nur diese Arbeit charakterisiert. Bei aller Detail- und Diskussionsfreude, die das Buch auf den thematisierten Feldern auszeichnet, scheint mir diesem Ansatz doch ein zu enges Verständnis des menschlichen Handelns zugrunde zu liegen. Alexander von Pechmann Richard Rorty: Solidarität oder Objektivität? Stuttgart 1988 (Reclams Universalbibliothek), 125 S., DM 5,20. Wer heutzutage linker Theorie anhängt, ist gewohnt, von alten, liebgewordenen Bekannten Abschied zu nehmen: vom Glauben z.B., daß alles schon irgendwie seinen sozialistischen Gang gehen werde. Den zu beschleunigen, hätten sich die Produktivkräfte in diesem Jahrhundert doch gewiß ausreichend entwickelt, doch statt des Kapitalismus kam nur die Natur aus dem Gleichgewicht. Natürlich, wir sind mit der Vernunft im Bunde, aber die ist ins Gerede gekommen, spätestens seit sie in ihrer Gestalt als Zweckrationalität für den Fortschritt bei der Ausbeutung von Mensch und Natur verantwortlich gemacht werden konnte. Womöglich ist die Vernunft auch noch der Diktatur verdächtig, der Gewaltherrschaft über Gefühle, Triebe und sonstige Regungen, welche auszuleben dem Vernunftwesen Mensch häufig versagt bleibt. Manche Denkfigur linker Theorie ist brüchig geworden, manches ist nicht mehr zu retten - was Wunder, daß andere aus der Misere Kapital schlagen. Der amerikanische Philosoph Richard Rorty ist so einer: ein kluger Pragmatiker, der in seinem Essayband „Solidarität oder Objektivität?“ die Fragwürdigkeit so hehrer Begriffe wie Wahrheit, Objektivität, Vernunft und Individuum für seine Zwecke nutzt. Das Ergebnis ist ein bemerkenswertes Gemisch aus Biederkeit und Geistesgegenwart, dem eine Apologie der, wie Rorty es nennt, „liberalen Demokratie“ (Vorbild sind die USA) entsteigt. Und das alles auf dem aktuellen Stand der Philosophie - mal mit Habermas, mal mit Foucault, mal mit Derrida. Richard Rorty steht in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus eines Charles Sanders Peirce oder William James, besonders aber wandelt er in den Spuren John Deweys, dessen Denken er „mit den Gedanken Wittgensteins, Davidsons, Bücher zum Thema Rawls’ einerseits und Freuds sowie der postnietzschischen Philosophie Europas andererseits“ aufzumöbeln trachtet. Gemäß dem pragmatischen Credo, Denken und Erkennen nach dem Maßstab der Nützlichkeit für das menschliche Handeln zu beurteilen, grübelt Rorty im Titelessay über der Frage, ob es denn zweckmäßig sei, die Organisation menschlicher Gesellschaften auf „objektiven Erkenntnissen“ der Natur des Menschen zu gründen. Zu diesem Behufe, schließt er messerscharf, müsse man in der Lage sein, letzte Wahrheiten über das menschliche Wesen zu formulieren, was leider nur zum Preis des Abgleitens in die Metaphysik zu haben sei. Weil die Philosophie „nur Hypothesen aufstellen“ (Dewey) könne, weil ihre Urteile „durch historische Zufälligkeit bedingt sind, weil es auch keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Wissen und Meinung gebe, dürfe man auch bei der Frage nach der rechten Organisation menschlicher Gemeinschaft den Ruf nach Objektivität getrost überhören. „...wir sollten uns den menschlichen Fortschritt nicht als das Zusteuern auf einen für die Menschheit irgendwie im voraus eingerichteten Ort denken.“ Für die „liberale Demokratie“ sprächen dann auch nicht letzte Gründe oder ewige Wahrheiten: „Die einzige Gestalt, die eine pragmatische Rechtfertigung der Toleranz, der Forschungsfreiheit und des Strebens nach unverzerrter Kommunikation annehmen kann, ist ein Vergleich zwischen Gesellschaften, die diese Gewohnheiten aufweisen, und Gesellschaften, in denen sie nicht existieren.“ Schön gesagt - und wer liefert den Maßstab? Über das Individuum oder das Ich emphatisch zu reden, vermag der einigermaßen Sensible heutzutage nicht ohne Bauchgrimmen. Liefert die Konzeption des Individuums als mit sich selbst identischem Ich nicht schon den Strick, der dem empirischen Ich zur Fessel wird? Birgt nicht die Mahnung, Individuum zu sein, mit sich identisch zu werden, sein Selbst zu finden, den Appell zur Fügsamkeit, zur Einfügung in gesellschaftlich sanktionierte Muster, zur Disziplin gegenüber einer sozial oder moralisch vorformulierten Rolle? Mit Freud als Kronzeugen empfiehlt Rorty, Theorien zu begraben, die von einem „wahren Ich“, einem Ich mit einem Zentrum ausgehen. In seinem Aufsatz „Freud und die moralische Reflexion“ attestiert er dem Altvater der Psychoanalyse, mit seiner Theorie das traditionelle Bild des einen Intellekts, der sich mit einer Schar irrationaler Bestien herumschlägt, durch ein Bild komplizierter Transaktionen zwischen zwei und mehr „Intellekten“ ersetzt zu haben. Damit habe Freud der Illusion eines transzendentalen Subjekts, dem Wunschbild von einem ahistorischen Wesen des Menschen den Bücher zum Thema Garaus gemacht. Es erübrigt sich folglich, dem Vorwurf eines festgefügten Selbst hinterherzuhecheln; stattdessen liegt das Heil im „ästhetischen Leben“, einem Leben „der nie endenden Neugierde ... das seine Grenzen zu erweitern strebt, anstatt sein Zentrum zu finden“. So unhaltbar es sei, die Organisation menschlicher Gesellschaften mit der Autorität letzter Wahrheiten auszustatten, so widersinnig seien Bemühungen, die gesellschaftlichen Individuen auf ein „kohärentes Selbstbild“ zu verpflichten, „das der ganzen Gattung gemäß ist“. Der Konsequenz seiner Konzeption folgt Rorty bis zum bitteren Ende dem Ende jeglicher Philosophie, die noch irgendetwas Wesentliches für die gesellschaftliche Praxis zu formulieren beansprucht. Wenn alle Theorie der Gesellschaft und des Individuums schlußendlich nur Meinung, nicht aber Wahrheit liefern kann, darf man ruhig darauf pfeifen, wenn es um die politische Ordnung geht. „Wird die Wahrheit platonisch gesehen, nämlich als Erfassen einer vorgängigen Ordnung ..., dann ist sie schlicht belanglos für die demokratische Politik, heißt es im Essay mit dem programmatischen Titel „Der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie“. In Frage stellt Rorty mancherlei - nur nicht die „liberale Demokratie“ nach amerikanischem Muster. Sie ist da, sie ist erstrebenswert, sie ist nützlich; und weil sie sich ebensowenig philoso- phisch begründen läßt wie jedes andere System, sollen die Philosophen halt gleich die Finger davon lassen. Die demokratische Politik kommt „an erster Stelle, die Philosophie erst an zweiter“. Und wehe dem, der sich nicht daran hält! Wehe beispielsweise dem im Freud-Aufsatz als Anwalt des Spielerischen gefeierten Nietzsche: „Wir Erben der Aufklärung halten Feinde der liberalen Demokratie wie Nietzsche und Ignatius von Loyola gewissermaßen für verrückt, denn es besteht keine Möglichkeit, sie als Mitbürger unserer konstitutionellen Demokratie zu sehen, als Personen, deren geplante Lebensläufe durch Scharfsinn und guten Willen mit denen der anderen Bürger in Einklang gebracht werden können.“ Punktum. Wenn es um die liberale Demokratie geht, kennt Rorty keinen Spaß. Im Zweifelsfall hat die Philosophie das Feld zu räumen, damit es die demokratischen Politiker nach Gutdünken bestellen können. Wer das bedauerlich findet, mag sich mit dem Hinweis trösten, daß ein übertriebener Einfluß der Philosophie auf die Politik gegenwärtig ohnehin nicht zu beklagen ist. Die Politiker lassen sich eben nicht ins Handwerk pfuschen - diesem Faktum verleiht Rorty die philosophischen Weihen. Seine scheinbar spielerische, ästhetische Attitüde, mit der er zur „philosophischen Oberflächlichkeit und Leichtigkeit“ aufruft, ist ohne Charme. Sie hat nichts vom Leicht- Bücher zum Thema sinn des Dandys, aber alles vom Ernst des Verantwortungsträgers. Sie ist der Schleier der Furcht, die Theorie könnte der liberalen Demokratie schaden, wenn sie allzu tief schürft. Soll das wirklich das letzte Wort zum Kapitalismus amerikanischer Prägung sein: daß er „die Menschen in Ruhe ... (läßt) und ihnen die Möglichkeit ...(gibt), ihre privaten Vollkommenheitsträume in Frieden auszuprobieren“? Als gäbe es nicht die handfesten ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse, als gäbe es nicht das Räderwerk der industriellen Maschinerie, das zu einem ganz anderen Takt als dem des ästhetischen Lebens zwingt. Es hat schon seinen Sinn, wenn Rorty eine vom „‘reichen Ästheten, dem Manager und dem Therapeuten’ dominierte Kultur“ gutheißen würde: Wer nicht gerade Manager, Therapeut oder Ästhet ist, kann wenigstens als Opfer des einen auf der Couch des anderen mit den Poemen des dritten getröstet werden. Wolfgang Görl Gunzelin Schmid Noerr (Hrsg.): Metamorphosen der Aufklärung. Vernunftkritik heute, Tübingen 1988 (edition diskord) In 11 Aufsätzen und einer Collage untersuchen die AutorInnen, ob die Aufklärung noch für sich selbst und andere Philosophien verwendbar sei. Vernunft sei, so G. Schmid Noerr in der Einleitung, als Nachfahrin des göttlichen Lichtgedankens Ursache des heutigen Zustands der Welt. Dieser mißfällt nicht nur den AutorInnen. Vernunft und Aufklärung - etwa nach der Kant’schen Formulierung verwerfen oder untersuchen, ob das, was als Vernunft gefeiert oder geschmäht wird, diese Bezeichnung verdient, heißt das Programm der AutorInnen. Gesucht wird die vernünftige Vernunft. Für die Beibehaltung der „Struktur“ der Aufklärung plädiert H. Schnädelbach in seinem Beitrag „Was ist Aufklärung?“. Die Theorie der eigenen Rationalität sei ihr bester Schutz vor der Liquidation durch sie selbst oder andere. Wieso wir sie noch brauchen? G. Böhme (in seinem Essay „Permanente Aufklärung“) ist sich sicher: Die Kant’sche Aufforderung, doch bitteschön den eigenen Verstand zu gebrauchen (und nicht den des vorliegenden Buches), habe seine Gültigkeit. Und aufzuklären gäbe es noch so vieles. Er denkt an den „wissenschaftlich-militärischindustriellen“, den „medizinischpharmazeutischversicherungswahnsinnigen“ und „arbeitsadministrativen“ Block. Sein Programm der heutigen Aufklärung enthielte die Punkte: Kritik der Sicherheit, Arbeit und Natur. Näher zum Thema der Vernunftkritik kommt G. Gamm in „Die Wie- Bücher zum Thema derkehr des Verdrängten. Über einige Motive der Aufklärungskritik“. Aufklärung über Aufklärung heißt, die Motive hinter deklarierter Vernunft aufzuspüren. Die Vernunft der klassischen Aufklärung könne nicht vernünftig sein, könne keine rationale Begründung der Zwecke erstellen, zu deren Verwirklichung sie eingesetzt wird. Vernunft als übergelaufene Rebellin gegen Herrschaft oder immer schon Doppelagentin für Herrschaft ist die Frage. Gamm würdigt Nietzsche als Relativierer der Aufklärung und hält dieser klar vor: Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht. In ähnlicher Richtung stellt Ph. Rippel in „Giacomo Leopardis vernunftkritische Aktualität in der italienischen Postmoderne“ Leopardi als vernünftigen, Vernunft kritisierenden Schriftsteller vor. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheint sich Leopardi in ähnlicher Situation gefühlt zu haben wie Horkheimer und Adorno mit ihrem Satz über die vollends aufgeklärte Erde, die in vollendetem Unheil erstrahle. Ohne mythisch-religiöses Denken zu bemühen, beharrt L. auf der Konstruktion eines paradoxen Wahrheitsbegriffes unter Einschluß alogischer Komponenten. Der Kritik der Aufklärung, wie sie Horkheimer/Adorno formulierten, widmet sich G. Schmid Noerr in „Das Eingedenken der Natur im Subjekt: Jenseits der Aufklärung?“ Ein neuer Mythos sei mit dieser Schrift entstanden. Mit dem „Eingedenken der Natur im Subjekt“ als dem Argumentationstrick gedachten sich die Autoren von den fürchterlichen Folgen der Aufklärung abzusetzen, ohne in romantische Naturphilosophie zu verfallen. Geist als Inbegriff der Macht aufgefaßt, gebildet aus einem ominösen Schrecken vor Natur und deren trickreicher Unterwerfung, bedürfe (so G.S.N.) einer weiteren Begründung durch Lust, um seiner instrumentellen Verfügbarkeit zu entgehen. Ein wertvolles Fragment Aufklärungsskepsis sei dieser Rettungsversuch der Aufklärung. Doch sehr widersprüchlich seien auch einige in ihm verwendeten zentralen Definitionen, wie „Natur“ und „Arbeit“. H. Kimmerle bezeichnet in seinem Beitrag „Die Dialektik der Aufklärung als Ausgangspunkt einer Bifurkation der philosophischen Denkwege? Zu Habermas’ Deutungsschema der Philosophie der Moderne“ die Bifurkation philosophischer Denkwege nach Adorno als Wiederholung der Bifurkation in Links- und Rechtshegelianer. Beide Richtungen hätten gleich Unrecht, seien falsche Interpretationen, für die es keine ausreichende Begründung mehr gäbe. Und somit: Keine Bufurkation nach Adorno. G. Raulet beschäftigt sich mit dem Anwendungsversuch Habermas’ einer kritischen (Aufklärungs)Theorie auf die veränderte sozioökonomische Situation und postmoderne Bücher zum Thema Philosophien. Je konsequenter dessen Theorien des kommunikativen Handelns angewendet würden, desto anfälliger würde sie für pragmatisch-beliebige Standpunkte. Für die Selbstaufklärung der Aufklärung zu gebrauchen ist Luhmanns Systemtheorie nach Ansicht von Ch. Bender im gleichnamigen Beitrag nicht. Abklärung statt Aufklärung lautet dessen eigene Schlagzeile zu seinem Vorhaben der Vernunftkritik. Als Vernunftkritik sieht er funktionales Wissen zur Wirklichkeitsbewältigung an. Im Grunde doch wieder instrumentelle Vernunft? Kritisch ablehnend stellt sich B. Brick in „Die Aufgabe des Leibes zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung. Eine Kontroverse in der bürgerlichen Frauenbewegung des deutschen Kaiserreiches“ zu einer integrativen Frauenpolitik. Sie sieht dies in ähnlicher Weise sich heute ereignen und führt diese Diskussion anhand der alten Debatte zwischen H. Lange („Institutionelle Einbindung von Mütterlichkeit in staatliche Maßnahmen“) und H. Stöcker („Radikaldemokratische Maßnahmen“) aus. Nach Auffassung Stöckers könne nur ein umfassender Aufklärungsbegriff der Funktionalisierung einer bürgerlichen Frauenbewegung entgegenwirken. Licht richten J. Belgrad et al. auf die Rede Richard von Weizsäckers in ihrem Beitrag „Von unschuldigen Deutschen und ihren Opfern. Über die Wirkungsformen einer ‘großen Rede’: Richard von Weizsäcker und der 8. Mai 1945“ und akzentuieren so manche dunkle Figur in dessen Rede. Mehr Tabuisierung, süßes Einlullen in nationalistische Rauschgedanken als intellektuell redliche Stellungnahme sehen die Autoren. Die Opfer nochmals zu opfern um die Täter zu entlasten sowie alte Predigerrituale weisen die Autoren nach. Diesen Beitrag zum Zeitpunkt der Rede zu veröffentlichen wäre praktische Aufklärung gewesen. Dem steht wohl der publizistische Presseblock entgegen. Mit diebischer Freude frozzelt Ch. Türcke in „Ausverkauf der Radikalität“ an den modernen Theologen herum. Scheibchenweiser Ausverkauf des zentralen Dogmas sei der Versuch moderner Theologen (wie Uta Ranke-Heinemann), die Leute noch bei der Kirchenstange zu halten. Man möchte meinen, moderne theologische Rebellionen kämen direkt aus der Public Relations Abteilung der Fa. Ratzinger & Co. Ein lesenswertes Buch mit Beiträgen für philosophische Amateure ebenso wie professionelle Begriffsbastler. Michael Krug Oswald Schwemmer, Ethische Untersuchungen. Rückfragen zu einigen Grundbegriffen, Frank- Bücher zum Thema furt/Main 221 S., 16.- (Suhrkamp-Verlag), „Wer in angemessener Weise nach der besten Staatsverfassung suchen will, muß zuerst bestimmen, welche Lebensform die wünschenswerteste ist; denn solange man das nicht weiß, kann man auch nicht dahinterkommen, was die beste Verfassung ist.“ Mit diesen Worten vom Beginn des 7. Buches seiner „Politik“ stellt Aristoteles einen Zusammenhang zwischen Ethik und Politik her, der für das europäische staatsphilosophische Denken weitgehend verbindlich war, wie auch die praktische Philosophie des Aristoteles bis zur französischen Revolution und der Entstehung der modernen bürgerlichen Gesellschaft überhaupt als gültig betrachtet wurde. In unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft, in der jedem seine persönlichen Präferenzen zugebilligt werden, können Ethik und Staat nicht mehr in so direkter Abhängigkeit stehen. Folgerichtig wird in der Philosophie der letzten Jahrzehnte zwischen Ethiken verschiedener Reichweite unterschieden: der Ethik im weiteren Sinn, welche die Prinzipien für das Handeln der Individuen enthält, und der Ethik im engeren Sinn, welche als Sozialmoral das Zusammenleben der Menschen regeln soll. In diesem Rahmen sind Schwemmers „Ethische Untersuchungen“ angesiedelt. Sie enthalten in syste- matischer (nicht chronologischer) Anordnung acht Aufsätze bzw. Vorträge, die zwischen 1978 und 1986 entstanden sind. Bei der Analyse von Kants kategorischem Imperativ kommt er zu einem paradoxen Ergebnis: Indem Kant Handlung auf die Gesinnung des Handelnden reduziert, durch Zusammenfassen von Handlungen zu Maximen eine bloß gedachte rationale Welt, in der diese Maximen eine Rolle spielen, konstruiert und durch die Unteilbarkeit der Vernunft, die in dieser Überwelt waltet, alle Vernunftwesen (Menschen) gleichschaltet, entfaltet seine Philosophie eine emanzipatorische Wirkung, da der „Anspruch auf Anerkennung der allgemeinen Vernunftfähigkeit“ (172) zur Einforderung politischer Grundrechte führt. Insofern als Folge davon jedes Individuum den Anspruch auf Vernünftigkeit seiner Einsichten erheben kann, entsteht das Problem. wie über die konkurrierenden Meinungen entschieden werden soll, das nun, als der realen Welt angehörig, nicht mit Methoden der Welt der reinen Vernunft gelöst werden kann. Damit hat Kants Ethik eine Entwicklung befördert, die ihr selbst (wie der des Aristoteles) den Boden entzieht. Schwemmer sieht daher das Heil in der Entwicklung einer „Ethik des wirklichen Gesprächs“ (180). Einen Ansatz dazu bringt die Marburger Antrittsvorlesung von 1984 Bücher zum Thema (57ff); hier untersucht Schwemmer den Unterschied von „gut“ und „recht“ und von theoretischen (d.h. naturwissenschaftlichen) und praktischen Erfahrungen und legt dar, daß individuelle ethische Einsichten kein verallgemeinerbares Wissen, daß intersubjektive Verständlichkeit einer Argumentation nicht schon Verbindlichkeit erzeugt, daß also ein gesetzlicher Rahmen allgemein anerkannt werden muß, innerhalb dessen individuelle ethische Entwürfe eines „guten“ Lebens verwirklicht werden können. Ein anderer Ausgangspunkt führt zu einem ähnlichen Ergebnis: Praktische Vernunft muß empirisch nachgewiesen werden (77ff). Da nun menschliches Handeln als eine Geschichte bestimmt werden kann, die erst nach ihrem Abschluß die Identität des Handelns erkennen läßt, zweckrationales Handeln mithin eine Legendenbildung ex eventu ist, kann praktische Rationalität, wenn überhaupt, nur in der „Anerkennung fremder Subjektivität“ (73, 94, 122) liegen. Damit ist aber gleichzeitig wieder eine rationale Begründung für normative staatliche Bestimmungen gegeben, die „dem Kampf der Überzeugungen“ (96, vgl. 74) vorbeugen. Schwemmer schneidet gewiß zentrale Fragen heutiger ethischer Reflexion an und wendet sich mit Recht gegen Szientismus und Positivismus. Ich vermisse bei ihm allerdings eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Spielarten des Utilitarismus, der sich jetzt mit weit subtileren Methoden als zu Mills Zeiten der von Schwemmer aufgezeigten Probleme annimmt (z.B. P. Singer, G. Patzig). Ich teile auch nicht Schwemmers Abneigung gegen normative Ethiken, die ja den, der sich mit ihnen beschäftigt, nicht wie Religionsgemeinschaften gängeln müssen, sondern gerade dem in einer pluralistischen Gesellschaft orientierungslos gewordenen Individuum eine Hilfe bieten können, den Entwurf eines guten Lebens rational auszugestalten. Hartmut Längin G. Vattimo: Jenseits vom Subjekt, Graz-Wien 1986 (BöhlauVerlag). Vattimos Buch muß als Dokument gelesen werden und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. Es bezeugt nämlich erstens, daß sich das „postmoderne Denken“ nicht auf Frankfreich allein beschränkt und belegt zum zweiten nachdrücklich die mögliche Verbindungen jenes Denkens zu kulturkonservativen Positionen. Irritierend bis provokant dürfte für speziell die deutschen Leser sein, daß der Verfasser, vom linken politischen Spektrum her, seine Thesen auf zwei Philosophen stützt, die - mehr oder minder berechtigt - dem Verdacht der Be- Bücher zum Thema gründung faschistischer Ideologie ausgesetzt sind: F. Nietzsche und M. Heidegger. Die Stelle, an der sich nach Vattimos Interpretation die Denkbewegungen Heideggers und Nietzsches berühren, ist die „Ontologie des Verfalls“. Damit verbindet der Verfasser keine „dekadente Beschreibung“ des gegenwärtigen Zustandes, wie dies beispielsweise in Adornos Formel von der „Logik des Zerfalls“ intendiert war, sondern wertet sie als den „Verweis auf eine Konzeption von Sein, die sich nicht an der unbeweglichen Objektivität der Wissenschaftsobjekte orientiert ..., sondern am Leben, das Auslegungsspiel, Wachstum und Sterblichkeit, Geschichte ist“(33). Jenes „verfallene“ Seins, welches sich jeder soziologischen, psychologischen oder historisch-kulturellen Lektüre entziehen soll, ist, der Prämisse und dem Resultat des Autors gemäß, „reines Ereignis“ und insofern Gegenstand der hermeneutischen Interpretation von überlieferter Tradition. Aus dem von Nietzsche notierten „Zerfall der Werte“ heraus, glaubt Vattimo in der Unendlichkeit des hermeneutischen Zirkels ein angemessenes methodisches Konzept zu besitzen, welches ihm erlaubt, eine Konzeption von Sein darzulegen, die er als „schwach“ bezeichnet: Nicht das durch (metaphysische) Wertsetzungen begründete „starke“ Sein ist der Gegenstand seiner Spekulationen, sondern eine „schwaches Sein“, welches sich durch seinen „schwingenden Charakter“ auszeichnet. - Die vorgetragene Skizze der Argumentationslinie Vattimos zeigt mehreres an: Sie teilt mit Heidegger die kontemplativaffirmative Orientierung von Theorie und vermag deshalb über die reale Zersetzung von Mensch und Natur keinerlei Aussage zu machen. Einer der Hauptgesichtspunkte der Kritik an Vattimos Buch muß deshalb sein, daß es zu Heidegger keine Distanz gefunden hat. Es übernimmt die existential-ontologische Position völlig unvermittelt. Was der Verfasser dergestalt theoretisch anzubieten hat, erinnert mehr an den Geist der Geisteswissenschaften der 50er Jahre, als an die gegenwärtig virulente Frage nach dem, was nach „dem Ende der Moderne“ kommen kann oder soll. Somit bleibt an der vorliegenden Textsammlung primär die Tatsache interessant, daß sie von einem Autor verfaßt wurde, der sich selbst der politischen Linken zurechnet. Es wäre, auch für die bundesdeutsche Linke, eine lohnende Aufgabe, einmal zu prüfen, inwieweit sie mit einem theoretischen Instrumentarium operiert, das auch Prämissen von „Eigentlichkeit“ fußt. Vielleicht bedarf es dazu solcher Anregungen aus dem Ausland, wie sie diejenige G. Vattimos darstellt. Thomas Wimmer Bücher zum Thema Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Weinheim 1988, 3.Aufl. (Acta humaniora) 344 S. Wolfgang Welsch (Hrsg.), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988 (Acta humaniora) 264 S. Peter Koslowski, Reinhard Löw, Robert Spaemann (Hrsg.), Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters, Weinheim 1986 (Civitas Resultate Bd.10) 292 S. Die theoretische Verantwortung ernstnehmend werden in den philosophischen Feldern ständig neue Denkformen entwickelt. „Das völlig Neue, das von uns gefordert wird“ (K.O.Apel), wird zu seinem Antriebselement - „das Entzogene, das Nicht-Artikulierte, auch das nicht Artikulierbare oder Dunkle“ (D.Henrich) ist nicht nur seine Grenze, vielmehr auch eine innere Bedingung für Klarheit: der akademische Diskurs der philosophischen Suche hat immer einen menschheitlichen Sinn das Ganze der Strukturen als Ziel und kann an sich das ganze „Projekt der Menschheit“ für sich in Anspruch nehmen/repräsentieren: „Wenn es ein Projekt gibt, das für alle und für alle Epochen, die Moderne und Post- moderne, verbindlich sein könnte, dann ist es das Projekt der Menschheit.“ (P.Koslowski) Der menschheitliche Sinn verlangt nach einem ewigen Streben, d.h. nach einem „System der unendlichen Vervollkommnung“ (F.Schlegel). Dieses unendliche Streben bedarf natürlich der Variation und ab und zu eines Neuen - so anything goes? Der kritische Diskurs entwickelt solch notwendige Signaturen (wenn auch nicht nur fürs philosophische Seminar, nein gleich für das ganze Zeitalter) und verwickelt einen „jeden Begriff in eine unendliche Kette von Differenzen“ (J.Derrida) .. ... .... Bei diesem ewigen Streben zeigen sich entsprechende Kuriositäten, Kontroversen, Abgrenzungen und Ausgrenzungen. Das ganze Firmament des Sinnes leuchtet - doch welcher Stern ist nun der einzige, welcher uns zum ersehnten Neuen leitet? Solange diese Frage ungeklärt, macht sich der moderne, der postmoderne als auch der postmoderne moderne Theoretiker das Leben über hunderte von Seiten hinweg schwer mit seiner Schreibweise. Alltägliche Textproduktion ist vielfach sicherlich auch mühsam, allerdings erst die philosophische Verfahrensweise verbindet gerade das Wesentliche mit dem Zufälligen und Transitorischen - benötigt Identität, Präsenz, Ontisches für Ihre Verschiedenheit: Bücher zum Thema Vive la différance - oder reicht auch: vive la difference! Bemüht sich der Theoretiker um seine Schreibweise, setzt er sich und seinen Diskurs ins Werk. „Der Text, den er schreibt, das Werk, das er schafft, sind grundsätzlich nicht durch bereits fest stehende Regeln geleitet. ... Diese Regeln und Kategorien sind vielmehr das, was der Text oder das Werk suchen.“ (Lyotard: Post- moderne für Kinder) Die hier zu besprechenden Texte der oben angezeigten Buchtitel sind über weite Strecken nicht nur Suche, auch recht lesbar, demonstrieren Vielfalt, beleuchten Übergänge, Randgänge, Bruchstellen mit argumentativer Klarheit. Die Suche nach den Formen der Vernunft und des Denkens und der Lebenswelten versucht, aus der Vielzahl der Diskussionen und Beiträge eine Schnittlinie (Transversale) zu entwickeln. Die Beleuchtung der Gedanken sei immer Eigenlicht. „Das alte SonnenModell - die eine Sonne für alles und über allem - gilt nicht mehr, es hat sich als unzutreffend erwiesen. Wenn man diese Erfahrung nicht verdrängt, sondern wirksam werden läßt, gerät man in die `Postmoderne’. Fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit im Plural.“ (Welsch, 5) W. Welsch geht davon aus, daß unsere Moderne die „postmodern“ geprägte sei. „Wir leben noch in der Moderne, aber wir tun es genau in dem Maße, in dem wir `Postmoder- nes’ realisieren.“ (Welsch, 6, vgl. 101ff) Dies sei strikt `nachneuzeitlich’, sofern die Moderne sich gegenüber der vorausgegangenen Neuzeit profiliere. Mit der Orientierung an der Moderne des 20.ÿJahrhunderts sei die Postmoderne als `radikal-modern’ zu bezeichnen. Diese neue Blüte der Moderne verabschiedet den Modernismus und öffnet sich der Pluralität und dem Reichtum der Formen. Um den Kontroversen, Kuriositäten, Klischees und Reichweiten der Termini beizukommen untersucht W. Welsch die Genealogie der Ausdrücke Postmoderne und Posthistoire in der Kunst und Architektur, in der Soziologie und Literaturwissenschaft. Anschließend werden die Begriffe Neuzeit, Moderne ... differenziert. Anhand des „prominentesten Artikulationssektors“ - der Architektur - wird der Absolutismus der Moderne sowie Chancen und Gefahren von Postmodernität dargestellt. Der genuin philosophische Disput liefert ein zeitgemäßes Panorama philosophischer Positionen. Alle Edlen, Tugendhaften und Lasterhaften erscheinen auf der Leinwand der akademischen Diskurse. Die Einstellungen reichen von der „Verwindung der Moderne“ über „Plötzlich diese Übersicht“ bis zum „essentialistischen Postmodernismus prämoderner Inspiration“ (über R. Spaemann). Danach wird die Leinwand zum Ultraschallmonitor: Bücher zum Thema der Protagonist und Kontrahent Lyotard wird vom Ganzen her aufgelöst und seine Legitimation überprüft und variiert. In bester philosophischer Tradition setzt das Ganze bei Hegel an, führt über mancherlei Einlösungs- und Auflösungsformen durch „GanzheitsMelancholie“ zur anderen Utopie. Die Leinwandbilder folgen dem Gang des Neuen durch die Moderne von der Sensation zur Selbstverständlichkeit. Nach einem ersten Intermezzo über das „Geviert“ und Heideggers Bezüge zu postmodernen Gedankengängen folgt sogleich ein zweites über ein „Kooperationsmodell von Postmoderne und Technologie“. Aus dem bisherigen Gang der Darstellung, ihren Konvergenzen und Kontroversen wird eine postmoderne Version von Aufklärung entwickelt anhand der Schärfen von Lyotards Widerstreit-Konzeption (Le Diff’erend, Paris 1983, dt.: München 1987). Im weiteren Fortschritt auf dem „Königsweg der Vernunft“ wird im Vollzug der Übergänge ein Mittelweg als Ausweg aus den Thesen von Moderne und Postmoderne gesucht (Welsch, 296ff). Eine solche „transversale Vernunft“ ziele auf einen Modus von Verbindungen und Übergängen, der durch seine Pluralität sowohl Habermas’sche als auch Lyotard’sche Intentionen vermitteln könne (Welsch, 313f). Eine solche Vision eines philosophischen ISDN-Netzwerks ermöglicht eine Breitbandkommunikation von wahrlich zukunftsweisenden Ausmaßen. Die interdisziplinäre und wortreiche Gelehrsamkeit führt zur Synthese aus These und Antithese im quasi klassischen Dreischritt. Das informations- und facettenreiche Werk differenziert und synthetisiert die Differenzen unserer Gegenwart und führt in seiner Pluralität über das „postmoderne Wissen“ hinaus zur neuesten Variation des Neuen. Ohne postmodernes Flair werden in interdisziplinären Übergängen Diagnose- und Therapiemuster untersucht. Aus diesen Übergängen können Überschreitungen entwickelt werden aus standardisierten, fachspezifischen Mustern. Die Offenheit und Vielheit der Muster ermöglicht dem denkenden und handelnden Individuum, über Schnittstellen die Bruchstücke von Diskursen zu einem realisierbaren, wenn auch schwierigen Ganzen zu formen. „Ganzheit - die alte und unverzichtbare Aufgabe philosophischer Reflexion - ist gerade postmodern aktuell. Wirkliche Ganzheit kann aus Strukturgründen einzig durch ein Denken der Pluralität eingelöst werden (allerdings eines, das nicht nur auf Vielheit setzt, sondern auch Übergänge kennt). Die holistische und die plurale Option ... sind postmodern eigentlich in einer ungewohnten Form zu verbinden: Die holistische Intention wird genau Bücher zum Thema durch die plurale Option eingelöst“ (Welsch, 63, vgl.297ff). Wenn eine Offenheit und Vielheit der Lebensformen gegeben ist, bleibt doch zu fragen, unter welchen Bedingungen sich das schwierige Ganze realisiert bzw. realisieren könnte - ist dieses allein auf den ökonomischen Diskurs zu beziehen oder auf ein „Projekt der Menschheit“ als Einheit unserer Kulturen? Werden durch ein solches Projekt nicht Subjekt und Substanz zum alleinigen Mittelpunkt, wobei die Realität der umgebenden Natursysteme vernachlässigt wird? (siehe P. Koslowski: Die postmoderne Kultur. München 1987, 27ff; vgl. Koslowski u.a. (Hrsg), 79ff). In der sichtbaren Realität erscheint mit Architektur, Kino, Literatur, Werbung, Computertechnologie u.a. eine wirkliche Pluralität als Nebeneinander von Verschiedenem, als Dialog der Diskurse und Sprachen, als multikulturelle Semantisierung ohne allgemeinverbindliche Metasprache. In der Realität der EDVLandschaften herrscht eine Pluralität von Standards, Sprachen und Systemen. Die Softwaremarktentwicklung geht von den Individuallösungen hin zu Standardsoftwareanwendungen, die mit ihren einheitlichen Musterlösungen gleichwohl eine Anpassung an individuelle Anwenderproblemstellungen ermöglicht - also eine Konfiguration von Vielheit und einheitlichem Ganzen. An der Neuen Staatsgalerie in Stuttgart oder dem Salisbury Wing der Tate Gallery in London oder dem Kunstmuseum Abteiberg in Mönchengladbach werden die pluralen Möglichkeiten postmodernen Bauens erleb- und sichtbar. Diese Bauwerke integrieren unterschiedliche Wirklichkeitsentwürfe und Lebensformen. Schon 1966 plädierte R. Venturi für eine „komplexe und widerspruchsreiche Architektur..., die von dem Reichtum und der Vieldeutigkeit moderner Lebenserfahrung zehrt.“ Die Differenzen und Widersprüche der Diskurse und Lebensformen werden sichtbar und Basis für ein neues Ganzes. „Eine Architektur der Komplexität und des Widerspruchs hat aber auch eine besondere Verpflichtung für das Ganze ... Sie muß eher eine Verwirklichung der schwer erreichbaren Einheit in Mannigfaltigen sein als die leicht reproduzierbare Einheitlichkeit durch die Elimination des Mannigfachen.“ (Robert Venturi: Complexity and Contradiction in Architecture. New York 1966, dt. Braunschweig 1978, 23f; siehe Welsch, 119). Zwischen der scheinbaren Alternative von strukturierter Komplexität und funktionaler Einheit geht es dem Architekten um die Verpflichtung „auf das schwierige Ganze“, um eine offene Einheit von verschiedenen Diskurselementen. Ihre Realisation wird nicht durch ein ekklektisches Puzzle oder die willkür- Bücher zum Thema liche Deformation umgesetzt, durch eine spannungsreich-agonale, vielschichtige, oftmals auch irritierende Komplexität wird die Realisation zu einem „prekären Ganzen“ (siehe Welsch, 120ff; vgl. Heinrich Klotz: Moderne u. Postmoderne, Architektur der Gegenwart 1960 - 1980. Braunschweig 1984; siehe auch die Beiträge von Jencks, Klotz u. Venturi in: Welsch (Hrsg.)). Die Gebäudesegmente und einzelne Bauelemente können zurückhaltend oder auch konventionell schön sein, doch sie sind durch ihr modernes Material und ihre Variationen keine einfachen Nachahmungen. „Sie sagen: `Wir sind schön wie die Akropolis oder das Pantheon, aber wir sind aus Beton und Betrug gebaut.’“ (Ch.Jenks: Post-Modern und SpätModern. in: Koslowski u.a. (Hrsg), 212; zur Genealogie der postmodernen Architektur vgl. Koslowski u.a. (Hrsg), 217). Das postmoderne Projekt als eine Geschichte der Geschichten der Welt wird als eine Serie von vielfältigen Perspektiven in dem CivitasResultate-Band „Zur Signatur des gegenwärtigem Zeitalters“ dargestellt und diskutiert. Neben dem oben zitierten Beitrag von Jencks zu Architektur und Kunst der Postmoderne finden sich Beiträge von den Herausgebern R. Spaemann, P. Koslowski und R.ÿLöw sowie von O.ÿMarquard, K.ÿHübner, H.ÿKrings, C.ÿOffe, H.G.ÿVester u.a. Neben den verwischten Spuren des Subjekts in Kultur, Kunst und Literatur wird in sehr lesenswerten Darstellungen und Diskussionen die Krise der gesellschaftlichen Modernisierung, `Modernität` als politisches Gütekriterium sowie das Verhältnis von Kirche und modernem Bewußtsein, die Modernitätskritik der Kirchen thematisiert. In den Beiträgen von Hübner und Löw wird das Verhältnis von Wissenschaft, Mythos und postmoderner Theorie aufgearbeitet. Die Differenz von formaler Begriffsbildung und wissenschaftlicher Theoriebildung vermische sich im Diskurs der Wissenschaften selbst mit Wahrheit und Mythos. Diese Differenz weise auf den Zwiespalt hin, welcher in den Zusammenhang von Lebensformen und dem wissenschaftlichen Wissen hierüber einfließe. Wissenschaftliche Erfahrungen und Selbstentfaltung der Rationalität können Handlungsanweisungen hervorbringen und über den wissenschaftlichen Diskurs weit hinausreichen, dies könnten ebenso mythologische Aussagesysteme leisten. Wer eine Einführung oder eine Übersicht sowie eine sehr gute Bibliographie zu den vielfältigen Möglichkeiten der Postmoderne sucht, dem kann der Band „Wege aus der Moderne“ weiterhelfen. Die von Welsch zusammengestellten Texte reichen von A. Gehlen und D. Bell über J. Habermas und A. Wellmer bis zu U. Eco und J.F. Lyotard. Daß Texte oder Darstellungen von Ser- Bücher zum Thema res, Foucault, Deleuze, Baudrillard fehlen, hat sicher eher was mit den Möglichkeiten des Umfangs zu tun als mit der Ausgrenzung solcher Autoren aus dem Diskurs über Moderne und Postmoderne. Rüdiger Brede