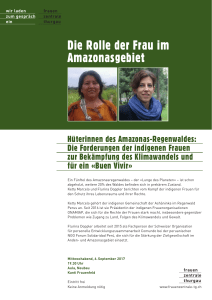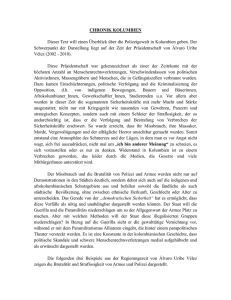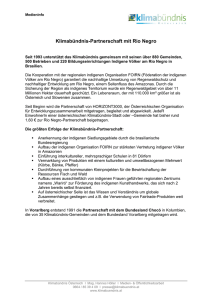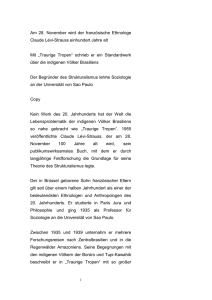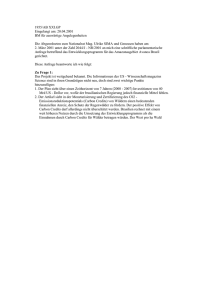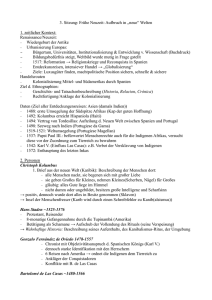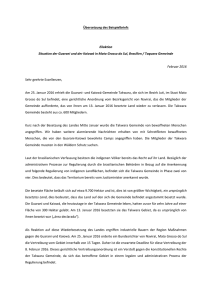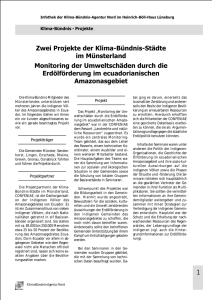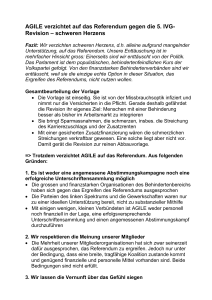Kolumbien:neue Kriegsgesetzgebung gegen die Zivilbevölkerung
Werbung
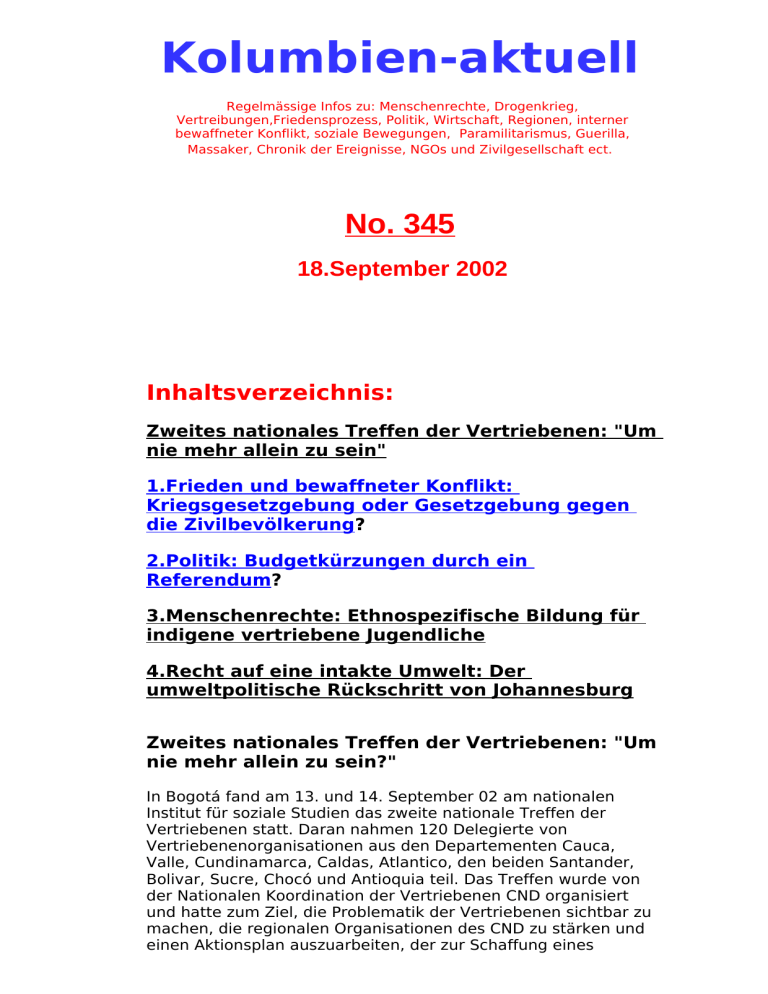
Kolumbien-aktuell Regelmässige Infos zu: Menschenrechte, Drogenkrieg, Vertreibungen,Friedensprozess, Politik, Wirtschaft, Regionen, interner bewaffneter Konflikt, soziale Bewegungen, Paramilitarismus, Guerilla, Massaker, Chronik der Ereignisse, NGOs und Zivilgesellschaft ect. No. 345 18.September 2002 Inhaltsverzeichnis: Zweites nationales Treffen der Vertriebenen: "Um nie mehr allein zu sein" 1.Frieden und bewaffneter Konflikt: Kriegsgesetzgebung oder Gesetzgebung gegen die Zivilbevölkerung? 2.Politik: Budgetkürzungen durch ein Referendum? 3.Menschenrechte: Ethnospezifische Bildung für indigene vertriebene Jugendliche 4.Recht auf eine intakte Umwelt: Der umweltpolitische Rückschritt von Johannesburg Zweites nationales Treffen der Vertriebenen: "Um nie mehr allein zu sein?" In Bogotá fand am 13. und 14. September 02 am nationalen Institut für soziale Studien das zweite nationale Treffen der Vertriebenen statt. Daran nahmen 120 Delegierte von Vertriebenenorganisationen aus den Departementen Cauca, Valle, Cundinamarca, Caldas, Atlantico, den beiden Santander, Bolivar, Sucre, Chocó und Antioquia teil. Das Treffen wurde von der Nationalen Koordination der Vertriebenen CND organisiert und hatte zum Ziel, die Problematik der Vertriebenen sichtbar zu machen, die regionalen Organisationen des CND zu stärken und einen Aktionsplan auszuarbeiten, der zur Schaffung eines Verhandlungstisches mit der Nationalregierung führen soll. "Diesen Verhandlungstisch und diese politische Artikulierung der Vertriebenenorganisationen zu schaffen, ist eine dringliche Aufgabe, die an diesem 2. Treffen deutlich wurde", meinte Lorelis Osorio, Führungsmitglied des CND. Das 2. Nationale Treffen der Vertriebenen hatte auch zum Ziel, eine politische Lösung des sozialen und bewaffneten Konfliktes zu suchen, um so die andauernden Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht zu vermeiden. Weiter hatte das Treffen zum Ziel, dass die ländlichen Regionen zum sozio-ökonomischen Notstandsgebiet erklärt werden; weiter sollten die am 1. Treffen formulierten Forderungen zur Prävention von gewaltsamen Vertreibungen und für eine Rückkehr mit Garantien und in Sicherheit; die Bestrafung von Militärs, die Menschenrechtsverletzungen verübt haben und die Auflösung der paramilitärischen Gruppen; die wirtschaftliche und soziale Entschädigung gegenüber allen Betroffenen der politischen Gewalt eingefordert und die Ablehnung des Plan Colombia zum Ausdruck gebracht werden. Aus dem Treffen resultierten folgende Vorschläge: Es soll ein internationales Beobachtungszentrum über Vertreibung geschaffen werden, dass die wirklichen Resultate des Gesetzes 387 und dessen Reglementierung evaluiert, eine transparente und wirkungsvolle Kontrolle der verschiedenen Programme zugunsten von Vertriebenen ausübt und über die physische und moralische Integrität der Führungspersonen von Vertriebenengemeinschaften wacht und ein Kataster erstellt, in dem der Zustand des Bodens zur Zeit der Vertreibung festgehalten wird. Für die rechtliche Vertreterin des Familienverbandes von Nordsantander und Departementskoordinatorin des CND erlaubte die Beteiligung am Treffen "gemeinsame regionale Erfahrungen auszutauschen und die Organisationen intern zu stärken, denn wir wissen, dass die Massnahmen, welche Präsident Uribe getroffen hat, auf die Zerstörung der sozialen Organisationen abzielen. Wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, dann wird es sehr schwierig sein, dass diese Vorschläge vorankommen". Samuel, eine Person der 350 Familien, welche vor sechs Monaten nach Salado im Dep. Cauca zurückgekehrt sind, meinte: "Die Beteiligung an diesem Treffen ist sehr wichtig, denn es ist das Forum der Vertriebenen. So kann man das zerstörte soziale Netz der Bauerngemeinschaften, die heute vertrieben sind, wieder neu aufbauen." Die 120 Delegierten des Treffens sind Teil von 2,7 Millionen Vertriebenen. Diese Zahl registrierte die Fachstelle für Menschenrechte und Vertreibung Codhes im letzten Bericht. Die Delegierten am Treffen erwarten, dass sie durch dieses Treffen eine Hoffnung dafür finden, um "nie mehr allein zu sein". 1.Frieden und bewaffneter Konflikt: Kriegsgesetzgebung oder Gesetzgebung gegen die Zivilbevölkerung? Mit dem Dekret 2002/2002 nehmen die Ankündigungen der verschiedenen Regierungsfunktionäre von Uribe in Bezug auf die Notwendigkeit über eine besondere Gesetzgebung im Rahmen des Zustandes innerer Unruhe zu verfügen, Gestalt an. Diese Ankündigungen tauchten stets in Reden auf, in denen offen die Möglichkeit von rechtlichen Kontrollen über die Massnahmen im Bereich der öffentlichen Ordnung verunglimpft wurden (so durch Innen- und Justizminister Londoño Hoyos am 22.6.02), die dringende Notwendigkeit, die fundamentalen Rechte "zeitlich begrenzt zu beschneiden" (so die kolumbianische Botschafterin in Kanada, Frau Kertzman am 18.7.02) oder sie gar uneingeschränkt zu begrenzen (so Londoño) vertreten wurde. Auffallend ist, dass bei dem Erlass des Dekrets Präsident Uribe, die Verteidigungsministerin und der Armeekommandant sich beeilten zu versichern, dass die Ausnahmebestimmungen in keiner Weise die Gesamtheit der Menschenrechte der Bevölkerung Kolumbiens bedrohten. Die dissidente Stimme war jene des Generals i.R.. Adolfo Clavijo, Präsident der Generäle und Admiräle im Ruhestand, welcher meinte, wenn auch die Massnahmen die Freiheiten einschränken würden, spiele dies keine Rolle, denn das Wichtigste sei, über ein effizientes Instrument zur Bekämpfung des Terrorismus zu verfügen. Das Dekret 2002/2002 besteht aus 26 Gesetzesartikeln, unterteilt in drei Kapitel. Das 1. Kapitel enthält 10 Artikel über Massnahmen zur Kontrolle der öffentlichen Ordnung. Darin werden der Armee richterliche Funktion übergeben, d.h. Armee und Polizei werden in Zukunft aufgrund von Hinweisen Verhaftungen und Hausdurchsuchungen durchführen und die Kommunikation abhören können. Die so ermittelten Daten können in Gerichtsverfahren als Beweismittel eingebracht werden. Sie können auch die Ausschaffung von Ausländern anordnen. Das 2. Kapitel umfasst 13 Artikel und definiert die "Rehabilitations- und Konsolidationszonen". Damit werden dem Gouverneur, mehr aber noch dem Militärkommandanten der betreffenden Zonen, fast absolute Vollmachten eingeräumt zur Beschränkung (bis zum Verbot) der Bewegungsfreiheit und der freien Wohnortwahl, zur Beschaffung von Informationen und um Private dazu zu zwingen, ihre Dienstleistungen oder ihre Güter zur Verfügung zu stellen, "um Grundrechte zu schützen". Das 3. Kapitel umfasst zwei Artikel mit Schlussbestimmungen, in denen festgehalten wird, dass Funktionäre, welche diese Befugnisse missbrauchen, zivilrechtlich, disziplinarisch und strafrechtlich belangt werden können und es wird die Dauer des neuen Dekrets geregelt. Im Dekret selber führt die Regierung Uribe zwei grundsätzliche Argumente für den Erlass des Dekretes an: "Die kriminellen Gruppen haben ihre Angriffe auf die Infrastruktur multipliziert und verüben Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Als zweiter Grund wird angegeben, dass die grundlegenden Faktoren, aufgrund derer "die delinquenten Aktionen" ansteigen, "einerseits das Verstecken ihrer Mitglieder in der Zivilbevölkerung und das Verbergen ihrer Telekommunikationsmittel, Waffen und Munition in den Dörfern ist, wie auch die andauernde Versorgung, welche in den Orten funktioniert, in denen sie sich aufhalten". Das erste Argument besagt nur, dass wir uns im Krieg befinden und das Panorama bezüglich Menschenrechtsverletzungen und Verstössen gegen das humanitäre Völkerrecht kritisch ist. Das zweite Argument sagt etwas aus über die Art des Krieges, in dem wir uns befinden. Der militärische Vorteil der Delinquenten ist dabei ihre Fähigkeit, sich als Zivilbevölkerung auszugeben. "Es scheint daher, dass das Dekret gegen die Zivilbevölkerung gerichtet ist", kommentierte der Direktor der Kolumbianischen Juristenkommission. Im Gesetzestext und den Erläuterungen wird stets von "Delinquenten- und Kriminellengruppen" gesprochen, nie wird in irgendeiner Form der Begriff "Kämpfende" verwendet. Paradoxerweise führen die Verfechter des Dekrets ein Argument ins Feld, das in einem kürzlichen Leitartikel der Zeitung El Tiempo erschienen ist. Darin hiess es: "Die seit der Verfassung von 1991 gültigen Gesetze, erlassen für eine Situation des Friedens, haben klar ihre Untauglichkeit gezeigt, um einem Konflikt mit den Dimensionen und Charakteristiken gegenüber zu treten, wie wir ihn erleiden." In Friedenszeiten wäre es angebracht, ein Strafrecht zu erlassen, das gegen Delinquenten und Kriminelle gerichtet ist. In Zeiten eines bewaffneten Konflikts könnte man erwarten, dass eine Kriegsgesetzgebung grundsätzlich gegen den "bewaffneten Feind", der klar definiert ist, und nur in Ergänzung dazu gegen jene, die mit diesem Feind kollaborieren, gerichtet ist. Die Lektüre des Dekrets führt zum völlig gegenteiligen Schluss: Der "Feind" ist der "getarnte Kollaborateur". Das bedeutet, dass die Friedensgesetzgebung kritisiert wird, um den Krieg zu führen, doch um den Krieg zu machen, wird die Friedensgesetzgebung instrumentalisiert. Die gesamte Zivilbevölkerung wird verdächtigt, mit den Delinquenten zu kollaborieren. Das Hauptproblem des Dekrets 2002 besteht daher nicht darin, dass es für den Krieg konzipiert wurde, sondern für welche Art des Krieges. In diesem Kontext muss auch die tatsächliche Diskussion über die Respektierung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts gesehen werden. Das zweite Problem ist, dass die Legalität der Ausnahmebestimmungen (mit einem mündlichen richterlichen Befehl oder selbst ohne jeglichen richterlichen Befehl) von den Interpretationen von konkreten Umständen abhängt, die mit den Begriffen "unüberwindbare Notwendigkeit" oder "unmittelbare Gefahr" umschrieben werden. Das dritte Problem liegt darin, dass eine enorme Machtfülle auf dem Militärkommandanten der Rehabilitations- und Konsolidationszonen liegt, die keinerlei wirksamer Kontrolle unterworfen ist. Besonders zu erwähnen ist der Artikel 23 über den Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen von Privaten. Obwohl vorgesehen ist, einen Informationsmechanismus gegenüber der Aufsichtsbehörde einzurichten, worin über den Gebrauch von privaten Gütern oder die Einforderung einer technischen oder professionellen Dienstleistung "zum Schutz von Grundrechten oder wenn dies dringlich ist, um das Leben und die Gesundheit von Personen zu garantieren" informiert wird, drängt sich die Frage auf: Verkennt diese Anordnung innerhalb eines Kontextes des Krieges nicht die wesentliche Unterscheidung zwischen Kämpfenden und Zivilen und zwischen zivilen und militärischen Gütern, eine Unterscheidung, welche der kolumbianische Staat respektieren müsste? Hoffentlich geschieht in Kolumbien nicht das, wovor die Anwältin Marie-Claire Chouinard in Bezug auf die Erfahrungen in Kanada im Jahr 1970 gewarnt hat: "Von den 480 Personen, welche unter dem Verdacht festgenommen wurden, Verbindungen zur Befreiungsfront von Quebec zu haben, musste der Staat 435 Personen (90%) ohne Anschuldigung freilassen. 435 waren also unschuldig. Sie waren willkürlich ihrer Freiheit beraubt worden, da die richterliche Kontrolle über Verhaftungen suspendiert war." 2.Politik: Budgetkürzungen durch ein Referendum? Von Marco Romero, Professor für Politikwissenschaften an der Nationaluniversität Während der Wahlkampagne versprach Präsident Uribe Vélez eine politische Reform, um mit der Korruption und der Politiquería aufzuräumen. Er kündigte eine Reihe von polemischen Themen an, so u.a. die Durchführung einer Reform über das Volksreferendum, die Einführung eines Einkammerparlaments mit 150 Abgeordneten, die Abschaffung der Kontrollinstanzen, die Aufhebung von Departementen und die Regionalisierung des Landes. Doch der am 7. August 02 beim Kongress eingereichte Referendumsvorschlag, liess praktisch die Territorialreform auf der Seite und schlägt keinerlei Strategie vor, um die Probleme im Zusammenhang mit den politischen Parteien, dem Wahlsystem und den Bedingungen zur Durchführung politischer Kampagnen anzugehen. Die Abgeordnete Ginna Parody erinnerte kürzlich daran, dass die Reform nicht die Organisierung der traditionellen politischen Parteien anstrebe, sondern eine politische Reform zugunsten neuer Meinungszirkel sei. Uribe sei nicht bereit, sich der Dynamik der politischen Parteien zu unterwerfen, noch neue Parteien zu schaffen. Es tauche die Frage auf, ob er versucht ist, eine plebiszitäre Regierung aufzubauen, welche ihre Legitimität durch Meinungsmache aufbaut, statt die politische Gesellschaft durch eine demokratische Organisation in politischen Parteien zu organisieren und den gleichberechtigten, öffentlichen Zugang zu den notwendigen Mitteln für die politische Mitbestimmung zu sichern und die Wahlkampf-Kleinstunternehmen zu kontrollieren. Tatsache ist, dass die Regierung in vielen ihrer Initiativen den Rückzug angetreten hat. Es wird kein Einkammerparlament geben, das Repräsentantenhaus behält seinen territorialen Ursprung und der Senat wird ein wenig reduziert, wobei die Sonderwahlbezirke für ethnische Gruppen beibehalten werden. Die Auflösung des Senats steht nicht unmittelbar bevor, verschwindet aber auch nicht von der politischen Agenda. Die Gemeindeombudsstellen werden nur dort aufgehoben, wo die nationale Ombudsstelle präsent ist. Präsident Uribe widerruft seine grundlegenden politischen Initiativen, setzt aber mit Kraft die Budgetkürzungen durch: Einfrieren der Auslagen im Gesundheits- und Bildungsbereich; Haushaltskürzungen bei einigen Institutionen und Auflösung des nationalen Fonds für Abgaben aus der Erdölförderung und dem Bergbau. Die damit freiwerdenden Mittel sollen u.a. für die Bildung und sanitarische Infrastruktur bereitgestellt werden. Bei diesem Stand der Dinge scheint die politische Reform von Tag zu Tag mehr zu einem Budgetreferendum zu werden. Dies wirft neue Fragen auf. Der Miteinbezug von Budgetkürzungen als Teil des Referendums führt zu einem schwer lösbaren Widerspruch: Es ist sehr unpopulär, die KolumbianerInnen zu einer Kürzung der staatlichen Mittel an die Departemente und Gemeinden für die Bereiche Gesundheit und Bildung zu befragen. Dies zeigt auch die soziale Mobilisierung gegen die Gesetzesbestimmung 01 von 2001. Damals konnte die Regierung den Kongress in Bezug auf die Budgetkürzungen überzeugen, obwohl dies die Wahlchancen der Parlamentarier in ihren Regionen schmälerte. Die Regierung bediente sich dabei der Geldmittel für Absprachen zwischen den Ministerien. Aufgrund der Angst und der Unterwürfigkeit, welche ein Grossteil der jetzigen Abgeordneten zeigen, ist es wahrscheinlich, dass sich diese Geschichte wiederholt und die Budgetkürzungen ins Referendum aufgenommen werden. Im Gegensatz jedoch zum Vorjahr, wo die Regierung Geldmittel zur Überzeugung der Parlamentarier einsetzte, bietet die jetzige Regierung drei sehr lukrative Dinge für die regionalen politischen Strukturen an: Die Absage an die Auflösung des Kongresses als Belohnung für sein gutes Benehmen; die Verlängerung der Amtszeit der territorialen Behörden und die Absage an eine politisch-demokratische Reform. Mit anderen Worten: Eine Form von zeitlich begrenzter parlamentarischer und regionaler Unterstützung, um eine unpopuläre Agenda voranzutreiben. Wie auch früher lässt sich nicht ausschliessen, dass aufgrund des Fallenlassens der politischen Reform zugunsten von Budgetkürzungen sich eine Zeit der Flitterwochen zwischen Regierung und Kongress einstellt. Doch eine Sache ist die Abstimmung im Kongress, eine andere aber die Budgetkürzungen im Gesundheits- und Bildungsbereich dem Volk zu unterbreiten, das bereits durch solche Massnahmen geschädigt ist. Die KolumbianerInnen verteidigen die Dezentralisierung, trotz des Modells über staatliche Subventionierungen, das von der Verfassung von 1991 gutgeheissen wurde, und eine fortschreitende Kürzung der staatlichen Subventionierung vorsieht. Haupteinnahmequelle der staatlichen Mittel bildet dabei die Mehrwertsteuer. Die Regierung hat zudem ein Massnahmenpaket angekündigt - abgesehen vom Referendum - das eine Steuerreform vorsieht, die Mehrwertsteuer auf weitere Produkte ausdehnt und Steuern festschreibt, die im Rahmen des Zustandes innerer Unruhe zur Finanzierung des Krieges erlassen wurden. Der nationale Fonds für Abgaben aus der Erdölförderung und dem Bergbau soll in ein präsidiales Konto umgewandelt werden, das für Investitionen im Bildungsbereich und für sanitarische Infrastruktur genutzt werden soll. Auf regionaler Ebene sollen Kontrollinstanzen reduziert werden, ohne dass eine ernsthafte Analyse über die Kostenfolgen und die Funktionsweise alternativer Modelle, d.h. zentralisierter und privater Modelle, gemacht worden ist. Stimmt das kolumbianische Volk dieser Art von Reformen zu, so würden wir einmal mehr zu einem lateinamerikanischen Sonderfall, denn wir wären das einzige Land, das neoliberale Strukturanpassungen im neuen Jahrtausend mittels eines Referendums gutheissen würde. In den 90er Jahren war dies im Fall Menem, Collor de Melo, Salinas de Gortari, Carlos Andrés Pérez (mit dem Aufstand von Caracas) oder im Fall von Cesar Gaviria in Kolumbien häufig der Fall. Doch im heutigen Argentinien, ganz zu schweigen von Uruguay und Brasilien, haben sich die Dinge drastisch verändert und obwohl in Kolumbien die Wirtschaft in den Händen von Rudolf Hommes und seinen Leuten bleibt, ist es unwahrscheinlich - jedoch nicht unmöglich - , dass in einem Land mit 64% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze einem derartigen Paket zugestimmt wird. Am 7. August 02 wurden wir uns bewusst, dass das Referendum von Präsident Uribe darauf ausgelegt ist, den Kongress unter dem Damoklesschwert der Androhung seiner Auflösung zu halten und das Referendum kein grösseres Interesse an den Inhalten zeigte, welche das Land während zehn Jahren in Bezug auf politische und territoriale Reformen diskutiert hat. Die Drohung gegenüber dem Kongress hat Wirkung gezeigt und es ist zu beobachten, dass einige Initiativen Uribes an Kraft verlieren und neue Vorschläge an die erste Stelle treten, womit dem Referendum ein wesentlicher wirtschaftlicher und regressiver Inhalt gegeben wird. Das Referendum ist Anlass für Verwirrung und vor allem eine Wundertüte im Dienste der Umorientierung der öffentlichen Mittel zugunsten der Sicherheit, dies auf Kosten sozialer Investitionen. Doch das Referendum verliert auch als politische Initiative selbst bei der Wahlgemeinde von Uribe an Bedeutung. Ex-Präsident Lopez Michelsen beeilte sich daher auf das Spannungsverhältnis aufmerksam zu machen, sich auf die Forderungen der Verfassung über die Volksabstimmung zu berufen und dem zwiespältigen Charakter des Referendums selber. Je konfuser, polemischer und widersprüchlicher die Inhalte des Referendums den BürgerInnen erscheinen, desto stärker wird die Opposition oder die Apathie gegenüber dem Referendum sein. 3.Menschenrechte: Ethnospezifische Bildung für indigene vertriebene Jugendliche In den letzten drei Jahren sind 36 indigene Führungspersonen aus scheinbar unbekannten Gründen und von angeblich unbekannten Tätern ermordet worden. In diesem Zeitraum mussten mehr als 10'000 Indigene verschiedener Ethnien - u.a. Emberá, Katío, Chamí, Wounaan, Tule, Paez und der Gemeindschaften von Caldono - ihre angestammten Gebiete verlassen und in nahe gelegene Städte fliehen. Als Vertriebene werden sie gleich wie alle anderen behandelt, ohne dabei ihre ethnische Herkunft, ihre kulturelle Verschiedenheit, ihre andere Kosmovision und Sprache zu berücksichtigen. Damit übergeht man nationale wie internationale Rechtsnormen, zumal die Beziehung zum Boden und das Konzept der Territorialität der Indigenen anders sind, wie bei den übrigen Vertriebenen, da die Verankerung in der Territorialität für sie wesentlicher Bestandteil ihres sozialen Netzes ist. Zu den wichtigsten Ursachen der Vertreibung indigener Volksgruppen gehört die Absicht, in deren Territorium Megaprojekte zu realisieren. Damit werden sie zu Kriegszielen und zu einem Teil der militärischen Konfrontation zwischen den verschiedenen legalen und illegalen Kriegsakteuren. Von den illegalen Kriegsakteuren verfolgt, informieren viele Betroffene nicht über die Vorfälle, nehmen die Unterstützung des Sozialen Sicherheitsnetzes nicht in Anspruch und lassen sich nicht als Vertriebene registrieren. Andere wiederum suchen Unterschlupf bei anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft und einige wenige ziehen bettelnd durch die Strassen. Vor ihrer Vertreibung besuchten die Kinder und Jugendliche der indigenen Gemeinschaften in ihren Weilern die Schule, andere wiederum hatten in ihren Gemeinschaften ihre eigenen Lehrpersonen, die sie in den Traditionen, der Sprache und der Arbeit zur Erhaltung der Umwelt und der eigenen Kultur unterrichteten. Nach Angaben der nationalen Indigenenorganisation ONIC haben rund 150 Gemeinschaften keinen Zugang zu ethnospezifischer Bildung und besuchen nur die traditionelle Schule. Eine Schule, die ihnen nicht mehr als Mathematik, offizielle Geschichte, Englisch und Geografie bietet, jedoch nichts über ihre Traditionen und ihre Vorfahren lehrt. Zudem werden sie damit in ihrem Muttersprachgebrauch und in der Ausübung ihrer Gebräuche geschwächt, was dazu führt, dass sie sich ihrer Herkunft schämen. Glücklicherweise bleiben viele indigene Kinder und Jugendliche ihrer Herkunft treu und fordern früher oder später ihre Rechte ein und kehren zu ihren Wurzeln zurück, dies trotz des kulturellen Drucks oder der Assimilation, der sie durch die westliche Welt ausgesetzt sind. "Ich besuche die 7. Klasse in der Schule Kanada. Sie behandeln mich dort normal. Ich bin die einzige Indigene in meiner Klasse und in der ganzen Schule sind wir bloss zu zweit. Eigentlich werde ich normal behandelt, doch manchmal, wenn ich ihnen Geschichten erzähle, wie sie mir meine Eltern erzählen, schauen sie mich komisch an, glauben mir nicht oder machen sich über mich lustig. In meiner Schule wird nichts über die Indigenen gelehrt. Manchmal machen sich meine Kolleginnen über meine Namen lustig, geben mir Übernamen oder sprechen meine Namen schlecht aus. Dann möchte ich ganz normale Namen haben, wie Rodriguez oder Fernandez. Wenn ich dann nach Hause komme, schimpft mein Vater mit mir und sagt mir, statt mich zu schämen sollte ich stolz auf meine Namen sein." Die vertriebenen indigenen Jugendlichen üben verschiedene Arbeiten aus, die Teil ihrer Kultur sind, so stellen sie traditionelles Kunsthandwerk her oder Goldschmuck. Andere arbeiten aufgrund der wirtschaftlichen Situation ihrer Familie u.a. als Botengänger, als Bürohilfskräfte, Bäcker und Tellerwäscher. Einige studieren in staatlichen Schulen. Von 100 indigenen Kindern gehen 20 zur Schule, nur 7 beenden das Bachillerato (gilt als Mittelschulabschluss) und nur 2 beginnen ein Universitätsstudium. "Ich heisse Jeraldinn und gehöre der Ethnie der Huitoto an, die im Amazonasgebiet lebt. Ich bin 14 Jahre alt, habe lange, glatte Haare und eine eher dunkle Haut. Ich weiss nicht viel über das Amazonasgebiet, denn ich war sehr klein, als wir von dort weggingen und ich bin nie mehr dorthin zurückgekehrt. Meine Mutter arbeitet als Schneiderin, mein Vater als Händler und wir leben seit acht Jahren in Bogotá. Zuhause haben die Eltern viele Sachen aus dem Amazonasgebiet: Halsschmuck, Schüsseln, Taschen. An der Wand hängt eine Landkarte von Kolumbien. Der Vater zeigt mir, wie weit weg der Ort liegt, wo er wohnte. Er sagt, dort zu leben wäre gut, denn es sei eine saubere Umwelt und es gäbe keinen Grund herumzuhetzen und sich um die Zeit zu sorgen." Die indigenen Gemeinschaften befinden sich heute in einer schweren kulturellen, sozialen und politischen Krise. Vom Staat und der Gesellschaft ist verlangt, dass die Indigenen als sozialer Akteur anerkannt werden, vor allem aber, dass der Heiligkeit ihres ursprünglichen Territoriums Rechnung getragen und ihr Land respektiert wird. Die neoliberale Politik muss gestoppt und die Respektierung und Garantierung ihrer Menschenrechte gewährleistet werden; das aktuelle Entwicklungsmodell, das ausgrenzend, gleichmacherisch und umweltzerstörend ist, muss grundlegend überarbeitet werden. Dieses Entwicklungsmodell entspricht in keiner Weise den Absichten und Interessen der indigenen Völker und führt im Gegenteil zu einem Ethnozid und einem Ökozid. (Treffen der indigenen Völker im Jahr 2001) Im Bildungsbereich werden die indigenen Kinder in der Regel in die vorhandenen Schulen in Bogotá verwiesen. Es gibt kein spezielles Schulungszentrum für indigene Kinder und Jugendliche. Der Besuch von Schulen, die kein besonderes ethnisches Curriculum haben, schwächt die kulturelle Identität der indigenen Schülerschaft sehr. Ein indigenes Kind oder ein indigener Jugendlicher sieht sich in Bogotá einer völlig fremden Welt gegenüber und es werden an alle SchülerInnen die gleichen Anforderungen - die nicht gerade indigenen Vorstellungen entsprechen - gestellt. "Die rechtliche Regelung ist klar: Wir haben das Recht auf eine ethnospezifische Bildung, also eine eigene, uns angepasste Bildung mit einem eigenen Curriculum, eigenen Programmen und Inhalten. Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht differenziert zu behandeln, ist rassistisch, verstösst gegen die Menschenrechte und das Recht auf eine differenzierte Behandlung und selbst gegen die politischen und rechtlichen Pflichten des kolumbianischen Staates selber", meinte Gabriel Muyui, Delegierter für Indigene und ethnische Minderheiten bei der Ombudsstelle. "Mit meiner Mutter habe ich manchmal Probleme, denn mir gefällt es, Jeans zu tragen und mit meinen KollegInnen am Abend auszugehen. Sie sagt dann, ich hätte alles vergessen, ich würde glauben, ich sei eine Weisse. In Wirklichkeit fühle ich mich wie geteilt, ich fühle mich dort und hier zugehörig. Manchmal möchte ich, dass wir in das Amazonasgebiet zurückkehren würden, doch mein Vater sagt, dass dies im Moment nicht möglich sei. Manchmal gefällt es mir auch hier zu leben, mit dem Lärm, den Autos, dem Fernsehen und den FreundInnen. Ich fühle mich dann schlecht, wie gespalten, weder von hier noch von dort." Jeraldinn ist eine von Tausenden von vertriebenen indigenen Jugendlichen, die ihre kulturellen Referenzpunkte verlieren, weil sie gezwungen sind, von ihrem Land zu fliehen und ihre Bräuche, Traditionen und Rituale hinter sich zu lassen. Zudem konzentriert sich der Staat auf die unmittelbare Hilfe, die er halbwegs leistet, zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und zieht das Bildungsproblem der ethnischen Minderheiten nicht in Betracht. 4.Recht auf eine intakte Umwelt: Der umweltpolitische Rückschritt von Johannesburg Die Diskussion über das Umweltmanifest aus der Sicht des Südens ist in Lateinamerika eröffnet Rio +10, diese Formel, mit der der Umweltgipfel von Johannesburg in Südafrika umschrieben wurde, blieb ohne Inhalt. Bei Abschluss des Gipfeltreffens am 6. September 02 waren sich alle VertreterInnen einig, dass es richtigerweise eher Rio -10 heissen sollte. Regierungen, NGO, UmweltaktivistInnen, Delegierte verschiedener internationaler Wirtschaftsverbände, ethnische VertreterInnen und andere Teilnehmende geben übereinstimmend zu, dass seit dem letzten Umweltgipfel in Rio de Janeiro sich die Umweltsituation verschlechtert hat. Die Umweltaktivistin der kolumbianischen Organisation Censat Agua Viva, Tatiana Roa, meinte denn auch: "Selbst die Regierungen ziehen eine negative Bilanz, denn die Ziele über nachhaltige Entwicklung wurden nicht erfüllt in Bezug auf die Zerstörung der Wälder, die Wasserqualität und den Klimawandel. Die Überschwemmungen in Europa sind die Folge davon." Die Spezialistin hebt drei Aspekte des Umweltgipfels hervor: In den letzten 10 Jahren verschlechterte sich der Zustand der Umwelt und die Lebensbedingungen der Menschen; der Umweltgipfel stärkte die Wirtschaftsverbände und multinationalen Unternehmen und es gab eine interessante Dynamik bei den sozialen Organisationen. In Bezug auf den ersten Punkt wurde klar, dass die 1992 festgelegten Ziele nicht erreicht wurden. Bezüglich des zweiten Punktes, erklärt Roa, hätten die Regierungen und die UNO den Schluss gezogen, dass sie allein die Umwelt nicht zu schützen vermögen, weshalb sie die Gruppe "Partnership-Tipp 2" schufen. Darin vereinigt sind internationale Wirtschaftsverbände und multinationale Unternehmen mit dem Ziel, bis 2015 50% mehr Menschen mit Wasser zu versorgen. Die Wirtschaftsverbände übten Druck aus, damit keine konkreten Ziele über die Verminderung des Verbrauchs an umweltverschmutzenden Energien vereinbart wurden. Drittens entwickelten die sozialen Organisationen eine interessante Dynamik, denn trotz der Differenzen zeigte der Marsch vom 31. August 02, an dem alle teilnahmen, dass der Wille da ist, sich zu stärken. In diesem Sinne wird es wichtig sein, was am Weltsozialforum gemacht werden wird. In diesem Panorama spielte das Umweltmanifest des Südens, das in Kolumbien während sechs Monaten unter den verschiedenen Organisationen und sozialen Sektoren diskutiert worden war mit dem Ziel, einen lateinamerikanischen Vorschlag am Gipfeltreffen zu präsentieren, eine bescheidene Rolle. Doch zirkuliert es jetzt unter den lateinamerikanischen Organisationen mit dem Ziel, weiter diskutiert und vertieft zu werden. Das Manifest macht folgende Vorschläge: Der Aufbau einer alternativen Globalisierung, die auf Ausgewogenheit, sozialer Gerechtigkeit und der Solidarität unter den Völkern beruht. Es sollen multilaterale alternative Szenarien unterstützt werden, welche zur Entwicklung des ökologischen Landbaus, zur Verteidigung der Artenvielfalt, zum Widerstand gegen die sozialen und ökologischen Folgen der Erdölförderung und der Megaprojekte allgemein, zur Einforderung der ökologischen Schuld, zur gemeinschaftlichen Nutzung der Wälder und Flüsse und zur Hinterfragung der Rolle des Finanzkapitals beitragen. Zur Lösung der Umweltkrise wird ein holistischer Ansatz vorgeschlagen, welcher politische, wirtschaftliche, kulturelle, technologische und ökosystemische Aspekte umfasst und auf die Wiederherstellung der Ernährungssicherheit ausgerichtet ist. Der wirkliche Friede geht über die Abwesenheit von Krieg hinaus und regelt die sozialen Beziehungen und die Beziehungen zur Umwelt neu. Das Manifest empfiehlt auch die völlige Streichung der Auslandschulden der Länder des Südens und schlägt vor, dass die biologische und kulturelle Artenvielfalt von den Völkern und lokalen Gemeinschaften in Übereinstimmung mit ihrem kulturellen Kontext selber verwaltet werden soll. Es wird darauf insistiert, dass der Planet frei von genveränderten Lebewesen sein soll. Es wird ein neues Entwicklungsmodell vorgeschlagen, das die Rückkehr auf das Land ermöglichen und das Entstehen neuer Megastädte verhindern soll, welche die noch vorhandenen natürlichen Rohstoffe dahinraffen werden. Die auf militärischen Mitteln beruhende Sicherheit soll durch ein Sicherheitskonzept ersetzt werden, das eine umweltrelevante, soziale, ernährungssichernde und kulturelle Dimension in sich vereint. Zuletzt schlägt das Manifest vor, einen Übergang zur Produktion und dem Konsum von Energie aus sauberen, angepassten, demokratischen und souveränen Energiequellen zu beginnen.