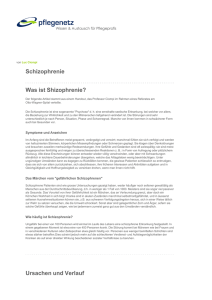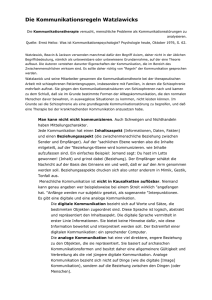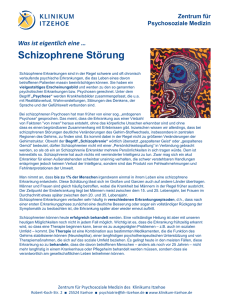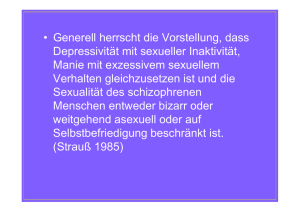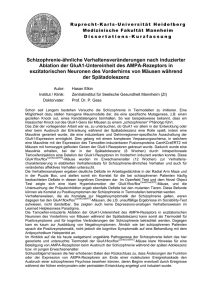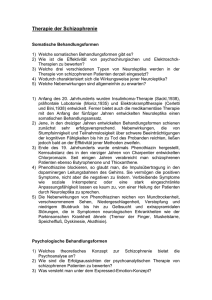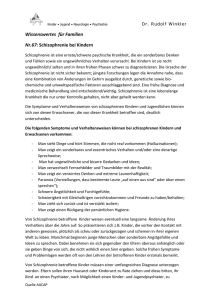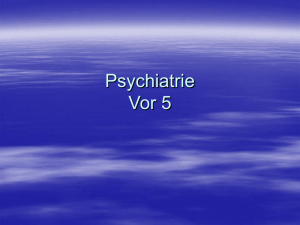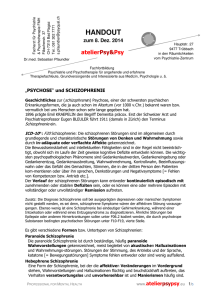Aggression und Sexualität bei Patienten mit Schizophrenie
Werbung

Diplomarbeit Aggression und Sexualität bei Patienten mit Schizophrenie eingereicht von Patricia Kunz Geb. Dat.: 28.8.1979 zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.) an der Medizinischen Universität Graz ausgeführt an der Universitätsklinik für Psychiatrie unter der Anleitung von Univ. Prof. Dr.med.univ. Dr.phil. Kapfhammer Univ.-Ass. Dr.med.univ. Reisinger Ort, Datum ………………………….. (Unterschrift) Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am …… Unterschrift Anmerkung Auf eine geschlechtsspezifische Formulierung wurde in dieser Diplomarbeit aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet. Die bei Personen verwendete maskuline Form ist für beide Geschlechter zu verstehen. i Danksagungen Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner gesamten Familie und bei meinen Freunden bedanken, die mich während meines Studiums und bei der Erstellung dieser Diplomarbeit immer unterstützt haben. Besonderer Dank gilt: Univ. Prof. Dr.med.univ. Dr.phil. Hans-Peter Kapfhammer für die Betreuung der Diplomarbeit. Univ. Ass. Dr.med.univ. Karin Reisinger, die mich als Zweitbetreuerin unterstützt hat und an die ich mich jederzeit wenden konnte. ii Zusammenfassung In allen Kulturen war und ist Aggression schon immer ein bedeutendes gesellschaftliches Problem. Psychologisch betrachtet finden sich verschiedene Erklärungsmodelle für Aggression (Instinkt- und Triebtheorie, Frustrations-Aggressions-Theorie und lerntheoretische Ansätze). Die Entstehung von Aggressionen kann durch verschiedenste Ursachen und deren Kombinationen erfolgen, wobei neurobiologische Einflüsse einen Prädiktor darstellen. Die Sexualität eines Menschen äußert sich in verschiedenen Komponenten, wie dem sexuellen Handeln und Erleben sowie erotischen Vorstellungen. Sie ist laufend Veränderungen unterworfen. Störungen des Sexuallebens sind vielfältig und haben zumeist einen großen Einfluss auf die Betroffenen. Sexualstörungen kann man in sexuelle Funktionsstörungen (sexuelle Dysfunktionen) und weitere Störungsbilder, die mit anderen psychischen Erkrankungen assoziiert oder medikamentös induziert sind, einteilen. Die Schizophrenie ist ein komplexes psychiatrisches Krankheitsbild, das großen Einfluss auf das soziale Miteinander und das familiäre Umfeld der Betroffenen hat. Das Auftreten der Positiv- und Negativsymptomatik wie Wahn, Halluzination, formale Denkstörungen, Ich-Störungen, Affektstörungen und psychomotorische Störungen prägen das Krankheitsbild. In dieser Arbeit wurde anhand aktueller wissenschaftlicher Literatur versucht, relevante Zusammenhänge zwischen Aggression, Sexualität und Schizophrenie zu finden. iii Abstract In all kinds of cultures aggression is and always has been a major social problem. Psychologically, there are various explanations for aggression (instinct and drive theory, frustration-aggression hypothesis and learning theory approaches). The origin of aggression can have various reasons and combinations of them, whereas neurobiological influences represent a predictor. The sexuality of a person expresses itself in different components, such as sexual behavior and experience as well as erotic ideas. It constantly is in change. Disorders of the sexual life are varied and usually have a big impact on those concerned. Sexual disorders can engage in sexual function problems (sexual dysfunction) and other disorders that occur frequently with other mental illnesses or are drug-induced. Schizophrenia is a complex psychiatric disease, that has great influence on the social interaction and the family environment of those who are affected. The occurrence of positive and negative symptoms such as delusions, hallucinations, formal thought disorder, I disorders, mood disorders and psychomotor disturbances dominate the clinical picture. In this work it was tried to find relevant links between aggression, sexuality and schizophrenia, based on current scientific literature. iv Inhaltsverzeichnis Danksagungen ....................................................................................................................... ii Zusammenfassung ................................................................................................................ iii Abstract ................................................................................................................................. iv Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................. v Abkürzungen ........................................................................................................................ vi Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ vii 1 Einleitung ........................................................................................................................ 1 2 Aggression ....................................................................................................................... 2 2.1 Definition, Begriffserklärung.................................................................................. 2 2.2 Arten der Aggression .............................................................................................. 4 2.3 Aggressionstheorien ................................................................................................ 5 2.3.1 Triebtheorien ................................................................................................... 6 2.3.2 Frustrations-Aggressions-Theorie ................................................................... 8 2.3.3 Katharsishypothese ........................................................................................ 10 2.3.4 Lernpsychologische Theorien über aggressives Verhalten ........................... 10 2.4 Biologische Einflüsse auf Aggressionen .............................................................. 15 2.5 Abschlussbemerkung ............................................................................................ 17 3 Sexualität ....................................................................................................................... 18 3.1 Definition, Begriffserklärung................................................................................ 18 3.2 Veränderung sexueller Wertvorstellungen ........................................................... 19 3.3 Geschichte der Sexualforschung ........................................................................... 20 3.4 Biologie der Sexualität.......................................................................................... 24 3.4.1 Neurobiologie der Sexualität ......................................................................... 24 3.5 Sexualstörungen und ihre Einteilung .................................................................... 25 3.5.1 Sexuelle Funktionsstörungen ......................................................................... 25 4 Schizophrenie ................................................................................................................ 27 4.1 Epidemiologie ....................................................................................................... 27 4.2 Ätiologie und Pathogenese ................................................................................... 27 4.3 Klinik .................................................................................................................... 28 4.4 Diagnostik und Differentialdiagnose .................................................................... 32 4.5 Therapie ................................................................................................................ 33 4.6 Verlauf .................................................................................................................. 34 5 Aggression und Sexualität bei Patienten mit Schizophrenie ......................................... 37 5.1 Komorbiditäten ..................................................................................................... 37 5.2 Aggression ............................................................................................................ 39 5.2.1 Risikofaktoren für aggressives Verhalten bei schizophrenen Patienten ........ 39 5.2.2 Schizophrenie und Aggression ...................................................................... 41 5.2.3 Schizophrenie, Aggression und Neuropathologie ......................................... 43 5.2.4 Schizophrenie, Aggression und Komorbiditäten ........................................... 44 5.3 Sexualität .............................................................................................................. 48 5.3.1 Sexualität und Schizophrenie ........................................................................ 48 5.3.2 Gender Identity bei schizophrenen Patienten ................................................ 50 5.3.3 Sexualität, Partnerschaft und Familie bei Schizophrenie .............................. 53 5.3.4 Sexuelle Gewalt und Traumen bei schizophrenen Patienten......................... 56 5.3.5 Sexuelle Funktionsstörungen, Medikamente und Schizophrenie .................. 57 5.3.6 Schizophrenie und Sexualdelinquenz ............................................................ 61 6 Resümee ........................................................................................................................ 65 7 Literaturverzeichnis ....................................................................................................... 67 v Abkürzungen Abb. Abbildung CBF Cerebral blood flow CCT craniale Computertomographie DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision EP evozierte Potentiale FSH Follikelstimulierendes Hormon FSH-RH Follikelstimulierendes Hormon Releasing Hormon GID Gender Identity Disorder HIV Humaner Immundefizienz-Virus IC-SOHO study Intercontinental Schizophrenia outpatient Health Outcomes study ICD-10 Internationale Klassifikation der Krankheiten 10 LH Luteinisierendes Hormon LH-RH Luteinisierendes Hormon Releasing Hormon MAO-A Monoaminooxidase A MAO-B Monoaminooxidase B MRI Magnetic Resonance Imaging MRT Magnetresonanztomographie PET Positronen-Emissions-Tomographie SPECT single photon emission computed tomography u.a. unter anderem USA United States of America z.B. zum Beispiel vi Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Multifaktorielle Ätiopathogenese der Schizophrenie [34].......................................28 Abb. 2 Positive und negative Symptome schizophrener Psychosen [41]............................29 Abb. 3 Klassifikation der Subtypen schizophrener Erkrankungen [34]...............................31 Abb. 4 Schizophrene Erkrankungen nach ICD-10 und DSM-IV [34].................................32 Abb. 5 Die Entwicklungsstadien der Schizophrenie – Die Entwicklung psychotischer Störungen [34]..........................................................................................................35 Abb. 6 Übersicht über wichtige Prognosemerkmale [34]....................................................35 vii 1 Einleitung Die Schizophrenie ist ein komplexes psychiatrisches Krankheitsbild, das großen Einfluss auf das soziale Miteinander und das familiäre Umfeld der Betroffenen hat. Schizophrene Patienten leiden unter einer Stigmatisierung und werden dadurch oft in eine soziale Isolation gedrängt, welche nicht selten mit Alkohol- und Drogenabusus einhergeht. [1] Aggressionen sind und waren schon immer in den verschiedensten Kulturen ein bedeutsames gesellschaftliches Problem, mit dem jeder Einzelne immer wieder in Berührung kommt. Da die sozialen Lebensumstände in verstärktem Maße Veränderungen unterworfen sind, wie zum Beispiel dem immer enger werdenden Zusammenleben vieler Menschen und dem Verschwinden von Freiräumen insbesondere in Großstädten, haben sich die Aggressionsbereitschaft der Menschen und auch die Folgen von Aggressionen stark erhöht. Auch die Anonymität des Einzelnen in diesen Ballungsräumen trägt zu einer Verminderung der Hemmschwelle bei. [2][3][4] Neben der Aggression ist die Sexualität ein typisch menschlicher Aspekt, der das Leben maßgeblich prägt und das gesellschaftliche Zusammenleben beeinflusst. Bereits 1948 meint Alfred C. Kinsey zum Thema Sexualität: „Im Sexualverhalten des Menschen sind biologische, psychologische und soziologische Faktoren beteiligt, aber sie alle wirken gleichzeitig, und das Endergebnis ist ein einziges zur Einheit verschmolzenes Phänomen, das seiner Natur nach nicht nur biologisch, psychologisch oder soziologisch ist.“ (Kockott 1995, 7) [5] Im Lauf eines Lebens ändern sich nicht nur die sexuellen Anschauungen, sondern auch die Bedeutsamkeit und der Stellenwert der Sexualität an sich. [6] In dieser Arbeit wird in den ersten Kapiteln theoretisch auf die Themen Aggression, Sexualität und Schizophrenie eingegangen. Das letzte Kapitel widmet sich der aktuellen wissenschaftlichen Literatur bezüglich des Zusammenspiels von Aggression und Sexualität mit der Schizophrenie und ihren Komorbiditäten. 1 2 Aggression 2.1 Definition, Begriffserklärung Es haben sich über die Jahre unterschiedlichste Erklärungsversuche und -ideen zu dem Begriff Aggression gefunden. In diesen Definitionen wird zum Teil von einer genauen Vorstellung der Aggressionsentstehung, aber andererseits auch von einer Vielfalt von Erklärungsmodellen ausgegangen. Im Folgenden werden einige Definitionen von Aggression vorgestellt: In einer Theorie von Dollard et al. (1970) wird Aggression als „jede Verhaltenssequenz, deren Zielreaktion die Verletzung der Person ist, auf die sie gerichtet ist“ erklärt. (Dollard et al. 1970, 17-18) [7] „Eine Aggression besteht in einem gegen einen Organismus oder ein Organismussurrogat gerichteten Austeilen schädigender Reize.“ (Selg et al. 1997, 4) [8] Mit Aggression ist „jedes Verhalten gemeint, das im wesentlichen das Gegenteil von Passivität und Zurückhaltung darstellt." (Bach et al. 1974, 14) [9] Albert Bandura (1979) beschreibt die Aggression als ein Verhalten, durch das es "zur persönlichen Schädigung und zur Zerstörung von Eigentum" kommen kann. (Bandura 1979, 18) Diese Schädigung kann psychischer aber auch physischer Natur sein, also verbal oder durch körperliche Gewaltanwendung geschehen. Er weist aber auch auf etwas hin, was er "soziale Etikettierung" nennt und was bedeutet, dass die sozialen Beurteilungen einer Gesellschaft einen wesentlichen Einfluss darauf haben, welches Verhalten als aggressiv verstanden wird. [2] Zusammenfassend kann man sagen, dass mit dem Begriff Aggression ein Angriffsimpuls und Angriffsverhalten gemeint ist, welches sich gegen Personen, Einrichtungen und 2 Objekte wenden kann. Die Intention aggressiven Handelns ist, zum Nachteil von Anderen Macht zu demonstrieren und die eigene Stellung zu stärken und zu festigen. Aggression dient aber nicht nur der Äußerung eines Machttriebs. Es ist im Verlauf der Entwicklung der Persönlichkeit durchaus auch als ein Ausdruck von Lebendigkeit und eines Erreichen-Wollens von Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstvertrauen zu verstehen. [10] Wichtig ist klarzustellen, dass der Begriff Aggression ein Verhalten und keine Gefühlsregung oder eine innere Anspannung beschreibt. [8] Ein Mensch, der immer wieder zu aggressivem Verhalten neigt, wird im Allgemeinen als aggressiv bezeichnet und auf einer sogenannten Aggressivitätsskala weiter oben eingestuft. Wesentlich ist hervorzuheben, dass jemand mit einer hohen Aggressivität nicht immer aggressiv handeln muss. [8] Bestimmte Erlebnisse können die Aggressivität erhöhen, andere sie wiederum vermindern oder sogar hemmen. Je höher die Aggressivität eines Menschen ist, desto eher finden sich aggressionsauslösende Situationen, aus denen heraus dieser dann aggressiv handeln wird. Es ist von einer Vielfalt von Aggressivitäten, die sich höchstwahrscheinlich unabhängig voneinander entwickeln, und nicht von einer einheitlichen Aggressivität auszugehen. Jemand der verbal aggressiv ist, muss nicht auch körperlich aggressiv sein und jemand der sich gegenüber ihm hierarchisch unterstellten Personen aggressiv verhält, muss sich seinen Vorgesetzten gegenüber nicht auch so verhalten. [8][11] Jeder Mensch hat, was Aggressionen anbelangt, seine individuelle Lerngeschichte. Das ist auch der Grund, warum eine bestimmte Situation bei einer Person eine Aggression auslösen kann, bei einer Anderen aber nicht. [2] Erwähnenswert ist auch, dass Aggression und Angst in einem sehr engen Zusammenhang zueinander stehen. Bewusst oder unbewusst kann Aggression bei der Bewältigung von Angst eine Rolle spielen. Kindern gelingt es zum Beispiel bei aggressiven und waghalsigen Spielen eine „Angstlust“ (M. Balint 1960) zu erzeugen, die sie dazu verwenden innere Spannungen abzubauen. [10] 3 Im Zuge von psychischen Erkrankungen können aggressive Handlungen gegen die eigene Person selbst, aber auch gegen Mitmenschen getätigt werden. [10] 2.2 Arten der Aggression Es gibt, wie im vorigen Kapitel schon angedeutet, verschiedene Arten von Aggressionen. Eine mögliche Unterteilung kann nach Selg (1997) in äußerlich-formale und inhaltlichmotivationale Ansätze mit jeweils weiteren Unterteilungen erfolgen. Äußerlich-formale Ansätze: Offene (körperliche oder verbale Aggressionen) versus verdeckte Aggressionen (Phantasie-Aggressionen, die durch ausgesprochene Bedürfnisse und Gedanken oder gemalte Bilder ans Tageslicht kommen können) Direkte (sich direkt auf eine anwesende Person beziehende) versus indirekte Aggressionen (im Sinne von Verleumdung einer oft nicht präsenten Person und Sachbeschädigung) beziehungsweise verschobene Aggressionen (die Form und auch das Objekt der Aggression können sich verschieben, zum Beispiel von einer körperlicher zu einer verbaler Aggression) Individuelle versus kollektive Aggressionen (bei rivalisierenden Banden oder in Kriegshandlungen) Fremdaggressionen versus Selbstaggressionen (zum Beispiel Suizid) Inhaltlich-motivationale Ansätze: Positive (von der Gesellschaft geforderte) versus negative (missbilligte) Aggressionen Expressive (aus einer Gefühlsregung heraus entstehende) versus feindselige (mit welchen jemandem geschadet werden soll) versus instrumentelle Aggressionen (vor allem aus Berechnung eingesetzt) Spontane versus reaktive (durch Provokation ausgelöste Aggressionen) versus Aggressionen auf Befehl (zum Beispiel bei Soldaten im Krieg) Ernste versus spielerische Aggressionen (oft bei Kindern zu beobachten) [8] 4 Zur instrumentellen Aggression ist zu sagen, dass hier in erster Linie ein angestrebter Nutzen (demonstriertes Durchsetzungsvermögen, Respekt, Gewinn, Schutz...) und nicht aggressive Stimuli, die durch aggressives Verhalten verarbeitet werden, im Vordergrund stehen. Instrumentelle Aggression kann in einer reinen Form, aber auch vermischt mit anderen Aggressionen vorkommen. [12] Eine weitere Einteilung von Aggressionen kann auch über die Aggressionsstärke erfolgen, wobei der Stärkegrad der Aggression nach der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung und deren Schweregrad beurteilt wird. [8] 2.3 Aggressionstheorien In der Psychologie gibt es verschieden Erklärungsmodelle für Aggressionen. Zum einen gibt es die Instinkt- und Triebtheorien, bei denen davon ausgegangen wird, dass Aggressionen nicht ausgeschalten oder vermindert werden können, sondern nur in halbwegs akzeptable Richtungen geleitet werden oder in Form von kleineren, nicht ins Gewicht fallenden, aggressiven Taten aufgebraucht werden können. Des Weiteren gibt es die Frustrations-Aggressions-Theorie, deren Vertreter der Meinung sind, dass Frustrationen Aggressionen auslösen und deshalb die Anzahl und die Intensität von Frustrationen so weit wie möglich reduziert werden sollen. Als drittes Modell gibt es unterschiedliche lerntheoretische Ansätze, die sich damit beschäftigen, wie es zu schaffen ist, menschliche Aggressivität von Anfang an nur in einem reduzierten Ausmaß entstehen zu lassen oder durch Lernprozesse zu minimieren. [8] Die Konzepte der Triebtheorien und auch der Frustrations-Aggressions-Theorie basieren auf einem „hydraulischen Energiemodell“, bei dem Aggressionen in einer Form von aggressivem Verhalten abgebaut werden müssen. [12] Laut Sigmund Freud finden sich um Aggressionen zu erklären drei theoretische Ansätze: der ethologische Ansatz, bei dem eine genetischen Vorprogrammierung angenommen wird, der politologisch-soziologische Ansatz, bei dem alte Anlagen von Interessen und Prozessen betrachtet werden, und der psychoanalytischen Ansatz, bei welchem die 5 Beobachtungen von aggressivem Handeln im persönlich-privaten und im gemeinschaftlichem Raum miteinander verbunden werden. [4] 2.3.1 Triebtheorien Zu Beginn der sozialwissenschaftlichen Forschung wurde bei fast allen Verhaltensweisen von einem Trieb oder einem Instinkt als Ursprung für eben dieses Verhalten ausgegangen. Psychoanalytische Triebtheorien: Die Anfänge der Aggressionsforschung um 1900 sind auf Sigmund Freud und Alfred Adler zurückzuführen. Adler geht erst von einem Aggressionstrieb aus, erklärt aber später die Aggression als ein reaktives Verhalten, dem ein bedeutsamerer Machttrieb übergeordnet ist. Freud sieht die Aggressivität lange Zeit nur als einen Teil der Sexualität (1905) oder der Ich-Triebe (1915) an. Um 1920 veröffentlicht er schließlich die dualistische Theorie zweier sich gegenüberstehender Haupttriebe, dem Todestrieb (Thanatos), den Freud unter anderem auch Aggression oder Zerstörungswut nennt, und dem Lebenstrieb (Eros). Laut dieser Theorie kann der Lebenstrieb dem Todestrieb, dessen Ziel es ist, alles Lebendige zum Tod zu führen, dadurch gegensteuern, indem der Todestrieb gegen Gegenstände in der Außenwelt und nicht nach innen gerichtet wird. [8][11] Sigmund Freud (1933) meint dazu: „Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, dass es fremdes zerstört.“ (Selg et al. 1997, 19) [8] Im Optimalfall entsteht nach Freud zwischen den beiden Trieben eine Art Wechselwirkung, so dass die Energie des Destruktionstriebes für die Ziele des Eros verwendet werden kann. Freuds Theorien und Spekulationen sind empirisch nicht überprüfbar und haben heutzutage in erster Linie eine historische Bedeutung. [4][8] Ein weiterer Psychoanalytiker und Psychiater, der eine Triebtheorie entwickelt hat, ist Friedrich Hacker (1971). Er vertritt die Meinung, dass Aggressionen psychische Energien sind, die entweder ungehindert und ungezügelt als Gewalttätigkeiten oder durch das eigene Bewusstsein oder gesellschaftliche Regeln gebunden durch die Gesellschaft fließen und dadurch abgeschwächt und „kontrolliert“ auftreten können. [13] 6 Ethologische Triebtheorie: Konrad Lorenz, ein Biologe, der sich mit dem Verhalten von Tieren beschäftigte, veröffentlicht 1963 eine von ihm entwickelte Trieblehre, in der er auch beim Menschen von vier Haupttrieben, dem Nahrungs-, Fortpflanzungs-, Flucht- und Aggressionstrieb, ausgeht. Seiner Meinung nach ist der Aggressionstrieb wichtig im Sinne der Arterhaltung, wie zum Beispiel der Selektion durch Konkurrenzkämpfe unter Rivalen, der Verteilung des Lebensraums und der Nahrung sowie des Beschützens seiner Nachkommen. [3][11] Nach seiner Theorie erneuert sich die Aggressionsenergie immer wieder und wird nach einer Stimulierung durch auslösende Reize abgebaut. Laut Lorenz gibt es in der heutigen Gesellschaft nicht genug Möglichkeiten die Aggressionsenergie sinnvoll abzubauen, und er vertritt die Meinung, dass es dadurch zu Störungen des körperlichen und geistigen Wohlbefindens kommen kann. Lorenz rät, die Aggressionsenergie in eine andere Richtung zu lenken und zum Beispiel auf sportlicher, intellektueller oder künstlerische Ebene abzuführen. [3][8] Kritik an den Triebtheorien: Wenn das Verhalten von Menschen in erster Linie anhand von Trieben und Instinkten erklärt wird, dann lässt man die kulturelle Prägung einer Gesellschaft und das Gefühl für Ethik des Einzelnen außer Acht. Albert Schweitzer (1923) sagt dazu: „Ethik besteht darin, dass das Naturgeschehen in dem Menschen, auf Grund bewusster Überlegungen, mit sich selbst in Widerspruch tritt. Je mehr dieser Widerspruch in das instinktmäßig Ablaufende verlegt wird, desto schwächer wird die Ethik.“ (Selg et al. 1997, 21-22) [8] Ein Grund für die Beliebtheit von Trieb- und Instinkttheorien ist, dass diese schnelle, vereinfachte und generalisierte Erklärungsmodelle und somit auch Entschuldigungen für aggressives Verhalten anbieten. Diese simplen Konzepte entstehen unter anderem so, dass nicht zur Theorie passende Ereignisse einfach ignoriert und nicht mit einbezogen werden. Empirische Untersuchungen der Aggressionsforschung (Bandura, Berkowitz, Buss) werden nicht integriert und diese Theorien widerlegende empirische Untersuchungen werden nicht zur Kenntnis genommen. [8][11] 7 2.3.2 Frustrations-Aggressions-Theorie Diese Aggressionstheorie wird von Dollard et al. (1939) vorgestellt. Sie basiert unter anderem auf einer früheren Frustrations-Aggressions-Hypothese Freuds und auf dem "Kommunistischen Manifest" von Karl Marx (1848). [7][8][11] In dieser Theorie wird ganz klar festgehalten: „1. Aggression ist immer eine Folge von Frustration 2. Frustration führt immer zu einer Form von Aggression“ (Selg et al. 1997, 23) [8] Gerade bei so prägnanten Aussagen ist eine genaue Begriffsdefinition notwendig, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Es gibt Frustrationen im engeren und im weiteren Sinn. Mit Frustration im engeren Sinn ist eine akute Beeinträchtigung einer auf ein Ziel ausgerichteten Tätigkeit gemeint (Hindernisfrustration), und unter Frustrationen im weiteren Sinn werden Einschränkungen bei Bedürfniserfüllungen, aber auch Anfeindungen, Provokationen und andere Stressoren verstanden. [11][12] Mit Frustration ist in der Frustrations-Aggressions-Theorie eine Frustration im engeren Sinn gemeint und nicht das Frustrationserlebnis selbst. Unter Aggression versteht man das Verhalten, mit dem der Schaden einer Person oder eines Ersatzsurrogats bezweckt wird. Viele Untersuchungen dieser Theorie zeigen ihren hohen empirischen Stellenwert, aber für sich alleine genommen hat diese These keinen Bestand. Obwohl erwiesener Maßen auf Frustrationen oft Aggressionen folgen, ist dem aber nicht immer so. Es ist zum Beispiel durchaus möglich, Kindern eine konstruktive Reaktion auf Frustrationen zu lernen (Davitz 1952). [2][8][11][12] Würde die ursprüngliche Frustrations-Aggressions-Theorie zutreffen, dann müsste man, um Aggressionen zu vermeiden, bereits Kinder vor sämtlichen Frustrationen bewahren, anstatt ihnen einen konstruktiven Umgang mit diesen zu lernen. Es ist davon auszugehen, dass eine Erziehung, in der man Kinder vor allen Frustrationen bewahren will, durch übertriebene Nachgiebigkeit gegenüber kindlichem Verhalten und falsch interpretierter Nachsicht, was aufkeimende Aggressionen betrifft, ein höheres Maß an Aggressivität zur Folge hat. [8] 8 Empirisch betrachtet ist eine Frustrations-Erregungs-Hypothese, die Berkowitz (1962) aus der Frustrations-Aggressions-Theorie entwickelt, am stimmigsten. Laut dieser löst eine Frustration eine messbare Erregung aus, welche die Heftigkeit der Reaktion auf diese Frustration bestimmt. Was für eine Art von Erregung ausgelöst wird (Wut, Ärger oder eine andere Emotion) ist individuell vollkommen unterschiedlich, genauso wie das das Gefühl begleitende oder darauf folgende Verhalten. Nach der von Berkowitz (1989) weiterentwickelten Theorie können diese negativen Erregungen auch durch andere Faktoren als eine Frustration, wie zum Beispiel durch provokantes Verhalten oder andere äußere Reize (Gerüche, Geräusche, als unangenehm empfundene Temperaturen) hervorgerufen werden. [2][8][11][14] Auch Bandura et al. (1973) veröffentlichen basierend auf der Frustrations-AggressionsTheorie ihren Ansatz einer Frustrations-Antriebs-Hypothese („arousal-prepotent- response“), in der sie davon ausgehen, dass man mit dem Verhalten auf Frustrationen reagiert, das einem für diese Situationen von klein auf antrainiert worden ist. Kinder lernen von ihren Eltern und übernehmen deren vorgelebte Verhaltensweisen und auch ihren Umgang mit Frustrationen. Wenn also Eltern auf bestimmte Situationen mit Wut, Ärger oder Aggressionen reagieren, lernen sie ihren Kindern in solche Situationen genau so zu handeln. [8][12] Die verschiedensten Aspekte haben einen Einfluss auf die Folgen von Frustrationen. Wie eine Situation wahrgenommen wird, welche Gefühle sie in der betroffenen Person auslöst und wozu ein Mensch motiviert ist, ist ausschlaggebend dafür, ob es zu einem aggressiven Verhalten kommt. Nach Untersuchungen von Buss (1961) und Averill (1982) scheinen ungerechtfertigte oder wahllos erscheinende Frustrationen, aber auch im speziellen Frustrationen im weiteren Sinn, wie Beleidigungen oder persönliche Angriffe, wesentlich mehr Ärger auszulösen, als gerechtfertigt erscheinende Frustrationen oder Frustrationen im engeren Sinn. Auch der Status der die Frustration auslösenden Person dürfte bei der Bewertung einer frustrierenden Situation eine Rolle spielen. [2][8][11][12] 9 2.3.3 Katharsishypothese Unter dem Begriff Katharsis, der auf Aristoteles zurückgeht, versteht man eine Reinigung oder Erlösung von aggressiven Neigungen. Die Katharsishypothese hat einen wichtigen Platz im Bereich der Triebtheorien inne. Laut dieser Hypothese wird die durch die Stimulation des Aggressionstriebs entstehende Aggression nur dann abgebaut, wenn man eine Form von aggressivem Verhalten ausübt. Es wird von einer Gleichwertigkeit aller aggressiven Handlungsweisen untereinander und daher auch von einer gegenseitigen Ersetzbarkeit ausgegangen. [2][8][11][12] Wenn also jemand zum Beispiel davon abgehalten wird einen Menschen, der ihn provoziert hat, tätlich anzugreifen, dann kann er laut dieser Hypothese seine Aggressionen abbauen, indem er Gewalttätigkeiten beobachtet (Fernsehen) oder sich den nicht stattgefundenen körperlichen Angriff in seiner Phantasie ausmalt. Viele Untersuchungen haben ergeben, dass die Katharsishypothese nicht haltbar ist und Aggressionen durch aggressives Verhalten oder das Beobachten davon nicht abgebaut, sondern sehr wahrscheinlich sogar noch verstärkt werden. Weiters hat man mittlerweile festgestellt, dass sich neutrale Ablenkungen oft besser, in jedem Fall nicht schlechter, in einer aggressionsbeladenen Situation auswirken. [2][8][11][12] 2.3.4 Lernpsychologische Theorien über aggressives Verhalten Lernpsychologisch werden Aggressionen im Gegensatz zu den Triebtheorien und zur Frustrations-Aggressions-Theorie als ein erlerntes Verhalten, wie auch Reden, Klavierspielen und Autofahren angesehen. Es existiert aus lernpsychologischer Sicht also gar keine explizite Aggressionstheorie, sondern es gibt nur allgemeine lernpsychologische Erkenntnisse, die auch die Entstehung von aggressivem Verhalten darlegen. In der Lernpsychologie wird davon ausgegangen, dass die Aggressionsbereitschaft, das Bedürfnis nach Aggression und die manchmal vorkommende Lust daran, erlernt sind und dementsprechend wahrscheinlich wieder verlernt werden können, und dass es keinen 10 Aggressionstrieb oder einen bestimmten Impuls gibt, der ein aggressives Verhalten zwingend erfordert. [8] Es gibt drei wesentliche Lerntheorien: 1. Klassisches Konditionieren: Das bekannteste Beispiel für eine klassische Konditionierung ist mit Sicherheit das Hundeexperiment von Pawlow (1905), in welchem eine unbedingte Reaktion auf einen unbedingten Reiz (der Hund reagiert mit Speichelbildung auf das Futter im Maul) mit einem neutralen Reiz (Glockenton) gekoppelt wird und so einen bedingten Reflex (Speichelbildung bei Glockenton, auch ohne Futter) entstehen lässt. Die Voraussetzung für das klassische Konditionieren sind natürliche, bedingungslose Reizantworten oder reflexartige Handlungen. [8][15] Dieses Modell bietet Erklärungsansätze bezüglich einiger Ärger/Wut-Reaktionen, zum Beispiel warum manchmal das Sehen einer Person oder das Reden über einen Menschen, der einen schon des Öfteren geärgert hat, bereits eine negative Stimmung aufkommen lässt. Durch klassische Konditionierung lernt man die Übertragung gefühlsmäßiger Reaktionen auf neutrale Reize. Laut Untersuchungen von Buss (1961) können so auch negative Betrachtungsweisen gegenüber bestimmten Gegenständen entstehen. Wichtig ist zu erwähnen, dass durch diese Form der Konditionierung keine neuen Verhaltensweisen in dem Sinne gelernt werden - dafür werden die beiden folgenden Lernmodelle benötigt. [8][15] 2. Operantes Konditionieren (Lernen durch Erfolg): Dieses Lernkonzept, auch "instrumentelle Konditionierung" genannt, beschreibt, wie aggressives Verhalten durch Erfolgserlebnisse verstärkt und deswegen von der ausübenden Person immer wieder angewandt und verfeinert wird. [8] Es gibt drei verschiedene Formen der Verstärkung. Bei der positiven Verstärkung bringt der handelnden Person das aggressive Verhalten einen Benefit, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit einer Bezugsperson. Negative Verstärkung bedeutet, dass man durch aggressives Verhalten einen unangenehmen Reiz entfernt, zum Beispiel einem 11 angstauslösendes Ereignis entkommt, und Selbstverstärkung heißt, dass das aggressive Verhalten keine Reaktion hervorgerufen hat und deshalb als positiv erlebt und verstärkt wird. [8] Als Beispiel für dieses Lernmodell wählt Selg (1997) in seinem Buch „Psychologie der Aggressivität“ einen hungrigen Buben, der am Markt einen Apfel stiehlt (aggressives Verhalten), vom Händler nicht bemerkt wird (selbstverstärkend) und mit diesem Apfel seinen Hunger stillen kann (positive Verstärkung). Das Verhalten des Buben ist ein voller Erfolg für ihn und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zukünftig in solchen Situationen ähnlich verhalten wird, ist groß. Wenn er auf diese Art und Weise öfter erfolgreich ist, dann wird er auch beginnen, in anderen für ihn unangenehmen Situationen so zu handeln. Das nennt man das Prinzip der „Selbstwirksamkeit“. [8] Negative Erlebnisse, also zum Beispiel Bestrafungen, führen nur wenn sie fortlaufend vorkommen oder ein besonders schockierender Misserfolg eintritt zu einem Abebben der Aggressionsbereitschaft. Wenn sie aber im Wechsel mit positiven Erfolgen auftreten, führen sie sogar zu einer besonders wirkungsvollen Bestätigung des aggressiven Verhaltens (intermittierende partielle Verstärkung). [8] Herrscht zwischen Kindern und ihren Erziehern ein normales Verhältnis, dann wird das aggressive Verhalten von Kindern häufig positiv verstärkt. Das kann so wie in dem oben genannten Beispiel des Apfeldiebstahls von statten gehen, oder dadurch, dass Kinder, wenn sie ein aggressives Verhalten an den Tag legen, von Erwachsenen oft vermehrt Aufmerksamkeit positiver (noch mehr positiv verstärkend) oder negativer Natur (auch positiv verstärkend) erhalten. [8] Anhand einer Untersuchung von Patterson (1982) fällt auf, dass im speziellen Eltern von sozial auffälligen Kindern große Probleme damit haben, ihre Kinder, wenn nötig, angemessen zu bestrafen. Des Weiteren Eltern-Kind-Beziehungen häufig zu kommt es in Familien mit problematischen einer Serie von positiven Verstärkungen unerwünschten kindlichen Verhaltens, zum Beispiel wenn eine Mutter ihre Ruhe (das Kind quengelt nicht mehr) durch die Gabe der vom Kind geforderten, aber ursprünglich verweigerten, Süßigkeit bekommt. [8] 12 In der Lernpsychologie geht man von einem Vorkommen angeborener (primärer) und erlernter (sekundärer) Triebe aus. So kann zum Beispiel aggressives Verhalten zu einem erlernten Trieb werden, weil jemand gelernt hat, dass er mit Aggressionen mehr erreicht als ohne sie. Aggressionen können in emotionalen Situationen aber auch spannungsabbauend erscheinen, und dadurch kann es in zukünftigen angespannten Begebenheiten zu einem Bedürfnis nach erlösenden aggressiven Handlungen kommen. Solche Lernprozesse spielen sich im Lauf des gesamten Lebens ab. [8][11][15] Untermauert wird die Theorie der operanten Konditionierung in Bezug auf die Aggressionen unter anderem durch Untersuchungen von Geen et al. (1970). Sie stellen fest, dass eine erhöhte Aggressionsbereitschaft zu physischer Aggression im Vergleich zu einer Kontrollgruppe besteht, wenn aggressives Verhalten bestätigt wird, und finden bei der in ihrer physischen Aggression bestärkten Gruppe auch eine erhöhte Neigung zu verbaler Aggression. [8][11][15] Abschließend ist zu sagen, dass man durch operante Konditionierung nur sehr schwer neue Verhaltensweisen erlernen kann, weil man in erster Linie lernt, bei bestimmten Gelegenheiten ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen oder zu vermeiden. Für die Entwicklung neuer Verhaltensweisen muss man, wie der nächste Ansatz zeigen wird, andere Menschen beobachten, sie können sich aber auch spontan ausbilden. [8][11][15][16] 3. Lernen am Modell (Lernen durch Beobachtung): Dass mit den beiden Konzepten der klassischen und operanten Konditionierung vielschichtige menschliche Verhaltensweisen nicht ausreichend veranschaulicht werden können, und der wichtige Aspekt des Beobachtens bisher gänzlich außer Acht gelassen worden ist, wird von Bandura et al. (1964) aufgezeigt. Das Konzept des Lernens am Modell beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Lernen anhand verschiedener Modelle, mit dem Lernen durch Beobachtung und unmittelbare Erfahrung. [2][8][15] Einen Versuch mit einer sehr hohen Beweiskraft erbringt Hicks (1965). Er lässt Kindern im Alter von ungefähr 5 Jahren einen Kurzfilm mit aggressiven Inhalten zeigen, in denen Schauspieler körperliche und verbale Aggressionen darstellen, die den Kindern mit hoher 13 Wahrscheinlichkeit noch nicht bekannt sind. Die Kinder sind in fünf Gruppen eingeteilt, in denen jeweils ein anderer Darsteller (ein Mann, eine Frau, ein weibliches Kind, ein männliches Kind) im Film aggressiv agiert. In der fünften Gruppe, der Kontrollgruppe, werden gar keine Aggressionen dargestellt. Nach der Vorführung des Filmes erfolgt eine kleine Frustration der Kinder. Daran wird eine zwanzig minütige Beobachtungszeit angeschlossen, in welcher den Kinder die Möglichkeit gegeben wird, mit verschiedensten Gegenständen zu spielen, unter anderem auch mit den Gegenständen, die Teil der aggressiven Handlungen im Film gewesen sind. Während dieser Beobachtungszeit kommt es unter den Kindern, denen Aggressionen gezeigt worden sind, zu einer großen Anzahl nachgeahmter aggressiver Handlungen. Die Kinder der Kontrollgruppe spielen keine Aggressionen nach. Ein halbes Jahr später wird der Versuch mit den gleichen Kindern wiederholt, aber ohne ihnen den Kurzfilm noch einmal zu zeigen. Nach der Frustration zeigt sich in der Beobachtungszeit, dass die als nachgeahmt zu bewertenden Aggressionen zwar wesentlich niedriger, aber immer noch vorhanden sind. Des Weiteren zeigt sich, dass vor allem von Männern ausgeübte aggressive Handlungen imitiert werden. [8][11][15] Das Phänomen, dass bei gesellschaftlich höher gestellten Vorbildern beziehungsweise bei aggressiven Personen, die für ihr Verhalten gelobt werden, der Nachahmungseffekt von aggressiven Handlungen bei Kindern besonders groß ist, bestätigt sich in mehreren Studien, unter anderem von Bandura et al. (1963). [2][11][17] Wenn Menschen mehrere Modelle mit verschiedenen Verhaltensweisen präsentiert werden, dann zeigt sich beim nachgeahmten Verhalten fast immer eine Mischung von Aspekten aus allen beobachteten Verhaltensweisen. [2][17] Generell sollte man immer von einem gemeinsamen Einfluss aller drei Lernkonzepte auf ein Verhalten ausgehen. 14 2.4 Biologische Einflüsse auf Aggressionen Die Entstehung von Aggressionen kann, wie schon in den vorhergehenden Kapiteln dargelegt, durch verschiedenste Ursachen und deren Kombinationen erfolgen, unter anderem auch durch neurobiologische Einflüsse. Die seit den 1960er Jahren bestehende Vermutung, dass an der Steuerung von aggressivem Verhalten im Gehirn verschiedene Hirnareale, wie der Hypothalamus, das limbische System mit den Amygdalae und dem Hippocampus, das Frontalhirn, hier besonders der prä- und orbitofrontale Bereich, sowie der temporale Kortex beteiligt sind, hat sich mittlerweile anhand bildgebender Verfahren bestätigt. [11][18][19] In einer von Teicher et al. (2002) veröffentlichten Studie wird festgestellt, dass Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt oder missbraucht werden, einen kleineren Hippocampus und kleinere Amygdalae haben, als Menschen in einer Kontrollgruppe. In dieser Untersuchung geht man von einer Entwicklungsstörung dieser Hirnareale infolge von Stress aus, welche unter anderem eine Veränderung des Aufbaus der Rezeptoren für den Neurotransmitter Gamma-Amino-Buttersäure zur Folge hat. [16][20] Die Gamma-Amino-Buttersäure ist einer der wichtigsten hemmenden Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Eine hohe Konzentration in den Synapsen wirkt einerseits entkrampfend und lösend auf die Skelettmuskulatur und andererseits beruhigend und dämpfend bei Störungen des Verhaltens und nervöser Überreizbarkeit. [21][22] Die erwähnten anatomischen Fehlentwicklungen im orbitofrontalen Kortex stehen auch in engem Zusammenhang mit im Erwachsenenalter gehäuft auftretendem asozialem Verhalten. [18] Die Funktionsweise vieler limbischer Hirnregionen, der Amygdalae und der orbitofrontalen Großhirnrinde steht in einem engen Zusammenhang mit der Konzentration des Neurotransmitters Serotonin im Zentralnervensystem. Eine Dysbalance im Serotoninhaushalt kann zu einer verminderten Impulskontrolle und einer höheren Neigung zu aggressivem Verhalten führen. [16][18][19] Auch chronischer Stress kann zu einer Störung im Serotoninhaushalt führen, in diesem Fall 15 zu einer verminderten Serotoninkonzentration durch bei Stress ausgeschüttete Kortikosteroide. [18] Die Hypothese, genetische Faktoren würden bei der Gewaltentstehung eine Rolle spielen, besteht bereits länger. Caspi et al. (2002) haben einen Zusammenhang zwischen genetischen Veränderungen des MAO-A-Gens und dem Ausmaß an aggressivem Verhalten festgestellt. (Monoaminooxidase A ist ein Enzym, das für den Abbau von Neurotransmittern wie Serotonin zuständig ist.) In dieser Studie zeigen männliche Teilnehmer eine erhöhte Neigung zu asozialem und aggressivem Verhalten, wenn sie als Kinder schlechtere Behandlungen erfahren haben, als eine männliche Kontrollgruppe. In diesem Zusammenhang untersuchen Capsi et al. die Ausprägung des MAO-A-Gens der Studienteilnehmer und stellen fest, dass sich eine weniger aktive Version des MAO-A-Gens auf traumatische Erlebnisse in der Kindheit erheblich verstärkend auswirkt. Jedoch gibt es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Vorliegen der weniger aktiven Gen-Variante alleine ohne vorangegangene Stressoren (Kindheitstraumata). Im Laufe des weiteren Lebens wird ein ähnliches Gen, nämlich das MAO-B-Gen aktiv, wohingegen die Aktivität des MAO-A-Gens vor allem in der Kindheit vorherrscht. [16][23] Eine besondere Rolle bezüglich der Aggression spielt das männliche Sexualhormon Testosteron, welches das Statusbewusstsein des Mannes erhöht. Testosteron allein kann jedoch nicht für ein aggressives Verhalten verantwortlich gemacht werden, da die meisten Männer ihr Statusbewusstsein in fairen Verhaltensmustern ausleben. [16] Besonders die Konzentration bestimmter Hormone, wie zum Beispiel Serotonin, die Stresshormone Kortisol, Noradrenalin und Adrenalin sowie deren Neurotransmitter dürften nach neueren Untersuchungen einen wesentlichen Einfluss auf die Aggressivität haben. [24] Die genaueren Hintergründe und Zusammenhänge diesbezüglich sind noch nicht ausreichend erforscht. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Studienergebnisse über biologische Faktoren, genetische Merkmale und Veranlagungen der Aggressionsgenese immer im sozialen 16 Zusammenhang gesehen werden müssen. Ihre alleinige Bedeutung für die Entstehung und vor allem für die Aufrechterhaltung von Aggressionen ist eher gering. [16][18][25] 2.5 Abschlussbemerkung Man kann also sagen, dass für die Aggressivität eines Menschen eine Kombination aus seiner persönlichen Entwicklung, seinem erlernten Verhalten (Lerngeschichte) und seiner Bewertung der die aktuelle Frustration auslösenden Situation ausschlaggebend ist. [8][12] Alkohol, Drogen, sexuelle Reizung, Belastungen körperlicher und seelischer Art können die Herz- und Atmungstätigkeit beschleunigen, was unter anderem eine physiologische Vorrausetzung für aggressives Verhalten ist. [8] Heute hält man sich in der Aggressionsforschung vor allem an multifaktorielle Erklärungsmodelle, weil mittlerweile klar ist, dass man mit einer Theorie alleine die Entstehung von Aggressionen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit nicht erfassen kann. 17 3 Sexualität 3.1 Definition, Begriffserklärung Die Sexualität eines Menschen äußert sich in verschiedenen Komponenten: dem sexuellen Handeln und Erleben sowie erotischen Vorstellungen. Über diesen drei Komponenten (Verhalten, Fühlen und Denken) existieren laut Claus Buddeberg (2005) sogenannte „subjektive Sexualitätskonzepte“ oder „sexuelle Skripte“. Darunter sind Grundeinstellungen gegenüber der Sexualität zu verstehen, die im Lauf eines Lebens (unter anderem durch Partner) entstehen und sich laufend weiter verändern. Diese individuellen Sexualitätskonzepte wirken auf sexuelle Vorstellungen und Wünsche sowie das sexuelle Erleben und Verhalten ein. Sie basieren nicht nur auf der individuellen Biographie jedes Einzelnen, sondern beruhen auch auf religiös, kulturell und ethisch beeinflussten Prinzipien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Meinung, wobei die Gewichtung dieser Komponenten individuell unterschiedlich ist. Zum einen gibt es „individuellintrapsychische Skripte“, die einen Einfluss auf die Sexualität eines Individuums haben, und zum anderen gibt es „interpersonelle Skripte“, die sich auf zwischenmenschliches sexuelles Handeln und Erleben beziehen. [6] Wie schon in der Einleitung erwähnt ändern sich im Lauf eines Lebens nicht nur die sexuellen Anschauungen, sondern auch die Bedeutsamkeit und der Stellenwert der Sexualität an sich. Durch sexuelle Handlungen können einerseits Lust und Vergnügen geäußert werden, andererseits können sie manchmal bei Problemen als Hilfsmittel zu deren Bewältigung dienen. Sexuelle Aktivitäten können durch die Ausbildung von Symptomen gestört werden und dadurch selber zu einer Beeinträchtigung werden. Claus Buddeberg (2005) fragt Teilnehmer und Teilnehmerinnen seiner sexualmedizinischen Fortbildungsseminare nach ihren Sexualitätskonzepten und stellt dabei fest, dass die Antworten abhängig von Geschlecht, Alter und individuellem soziokulturellem Hintergrund unterschiedlich ausfallen. [6] 18 3.2 Veränderung sexueller Wertvorstellungen Die althergebrachten sexuellen Normen, die vor allem durch äußere Organisationen wie Kirche und Staat bestimmt wurden, werden immer mehr von einer „Verhandlungs- und Konsensmoral“ verdrängt. Im Sinne einer Verhandlungs- und Konsensmoral wird die Sexualität moralisch nicht bewertet, egal auf welche Weise sie gelebt wird. Wichtig ist nur, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind. [6] Diese Veränderung der sexuellen Wertvorstellungen um 1950 wird von Gunther Schmidt als „Demokratisierung der sexuellen Moral“ und von Volkmar Sigusch als „sexueller Liberalisierungsprozess“ bezeichnet. [5][6] Dadurch ergibt sich für beide Geschlechter die Möglichkeit, aus alten und traditionellen Rollen auszubrechen und sich neu zu positionieren. Diesen Wandel der sexuellen Wertvorstellungen nennt Volkmar Sigusch eine „neosexuelle Revolution“, in der die herkömmliche Sexualität zerfällt und wieder neu zusammengefügt wird. Hierbei können Aspekte der Sexualität entstehen, die bis zu diesem Zeitpunkt namenlos oder gar nicht da waren (Neosexualitäten). [6][26] Die Veränderung der Sexualmoral bewirkt einerseits, dass der Zugang zur Sexualität in der heutigen Zeit wesentlich entspannter, sexualfreundlicher, freier und gleichberechtigter ist, als er es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Im Zuge dessen gewinnen ethisch geprägte Grundprinzipien wie „Autonomie“, „Gutes tun und nicht schaden“ sowie „Gerechtigkeit“ auch in sexuellen Beziehungen immer mehr an Bedeutung. Die zunehmende Verminderung von Schuldgefühlen und Ängsten in Bezug auf Sexualität senkt auch die Hemmschwelle, sexuelle Probleme als solche bewusst anzuerkennen und sich Hilfe zu suchen. [5][6] Andererseits führt diese Befreiung der Sexualität aus herkömmlichen Vorstellungen dazu, dass den individuellen sexuellen Möglichkeiten nahezu keine Grenzen gesetzt sind und daher oft alles, was diesbezüglich als alltäglich oder „normal“ empfunden wird, nicht ausreichend zu sein scheint. Das und die hinzukommende ständige Präsenz und Vermarktung von Sexualität in den diversen Medien führen zu einem erhöhten sexuellen Leistungsdruck. [5][6][27] 19 Man kann auch beobachten, dass Sex heutzutage zu einem Teil nur als Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse verwendet wird. Daraus kann eine oberflächliche Sexualität entstehen, die in ihrer Interaktion nur auf die körperlichen Aspekte reduziert wird und dadurch wiederum einen großen sexuellen Leistungsdruck erzeugt. [6] Pessimistisch wird das Prinzip der Verhandlungs- und Konsensmoral in Bezug auf die Sexualität von Volkmar Sigusch gesehen. Seiner Meinung nach basiert eine so entstehende Sexualität nur mehr auf Kommunikation und Nüchternheit. Die Spontanität, die Leidenschaft und die Ungezwungenheit der Sexualität bleiben dabei auf der Strecke. Für ihn „ist Sexualität heute weithin nur noch eine Installation, Vollzug statt Ekstase, Physik statt Metaphysik“. (Sigusch et al. 1996, 29) [26] Auch Gunther Schmidt (2004) ist der Meinung, dass neben den vielen Vorteilen der Liberalisierung der Sexualität das Überhandnehmen der Kommunikation als Basis für jegliches sexuelles Handeln ein Nachteil ist. [6] Bezugnehmend auf den Wandel sexueller Normen haben britische Soziologen wie Ken Plummer (1997) und Jeffrey Wecks (2003) ein sexualpolitisches Zukunftsbild geschaffen. Sie nennen dieses Zukunftsbild „Intimate citizenship“, was so viel bedeutet wie „Bürgerrechte in der Intimsphäre“. [6] In der heutigen Zeit gibt es also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man seine Beziehungen individuell gestalten kann. Aber gerade diese Vielfältigkeit von Alternativen führt dazu, dass die einzelnen Personen immer mehr Entscheidungen bezüglich ihrer privaten Lebensplanung treffen müssen und sich dadurch in ihrer Partnerschaft sexuell oft überfordert fühlen, und es so zu Konflikten kommen kann. [6] 3.3 Geschichte der Sexualforschung Bereits um 1900 schrieben Schriftsteller wie Marquis de Sade und der Österreicher SacherMasoch in ihren Werken über sexuelle Verhaltensweisen, die heute noch ihre Namen tragen. Die Anfänge der wissenschaftlichen Sexualforschung liegen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit erschienen erstmals Abhandlungen von Ärzten über sexuelles 20 Verhalten. Dem Thema Exhibitionismus widmete sich Lasègue, über den Fetischismus schrieb Binet und über den Transvestitismus Westphal. Im Jahr 1886 wurde das Buch „Psychopathia Sexualis“ des Gerichtspsychiaters Krafft-Ebing veröffentlicht. Er berichtete mittels einer Auswahl von Fällen über von der damaligen Norm abweichende sexuelle Verhaltensweisen. Viele seiner in seinem Buch verwendeten Bezeichnungen werden noch heute gebraucht, wie die oben erwähnten Begriffe Exhibitionismus, Fetischismus und Transvestitismus. Sein Werk kann als erste sexualmedizinische Beschreibung in seiner damaligen Gesamtheit bezeichnet werden. Bevor diese Abhandlungen publiziert wurden, wurde sexuelles Handeln in der Gesellschaft generell als Sünde und als triebhaft empfunden und sexuelle Verhaltensweisen, die nicht der gängigen Norm entsprachen, als moralisch anrüchig und kriminell angesehen. Nach diesen Veröffentlichungen wurde sexuelle Andersartigkeit immer mehr als eine krankhafte Störung verstanden, für deren Aufkommen die entsprechende Person nicht verantwortlich zu machen war. Diese neue Sichtweise half, gegenüber der Sexualität bestehende Ressentiments zu verringern. [5] Unter dem Einfluss von Sigmund Freud und seinen psychoanalytische Theorien änderten sich die Ansichten über Sexualität erneut. Freud war ein österreichischer Neurologe, der seine Karriere mit der Behandlung von sogenannten hysterischen Patienten begann und als Begründer der Psychoanalyse gilt. Er schrieb vor allem der kindlichen Sexualität eine große Bedeutung zu und entdeckte anhand der Behandlung seiner Patienten einen Zusammenhang ihrer „merkwürdigen Störungen“ mit unbewussten sexuellen Konflikten. Weiters versuchte er mit seinen Theorien von der damaligen Norm abweichende sexuelle Handlungen psychologisch nachvollziehbar zu machen. Die Sexualität und die individuelle psychosexuelle Entwicklung waren für ihn ein wesentliches Kernstück, um die Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen verstehen zu können. Obwohl viele seiner Ansichten heute als überholt gelten, hat Sigmund Freud unbestritten wertvolle Pionierarbeit im Bereich der Sexualforschung geleistet. Zu einer Zeit, in der nur sehr gehemmt und unaufrichtig über Sexualität gesprochen wurde, gelang es ihm, durch eine wissenschaftlich-nüchterne Betrachtungsweise eine Basis für eine zukünftige objektive und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität zu schaffen. [5][28] Bis in die 1930er hinein wurde im Bereich der Sexualwissenschaft trotzdem über Abweichungen von üblichen sexuellen Verhaltensnormen geforscht. [5] 21 Nur ein kleiner Teil der Sexualforscher beschäftigte sich mit der Sexualität als Faktor zur Erhaltung der seelischen Gesundheit. Darunter waren abgesehen von Sigmund Freud zum Beispiel Iwan Bloch, der zusammen mit Max Marcuse und Helene Stöcker im Jahr 1911 den „Internationalen Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ gründete. Ziel dieses Bundes war, dass nichtehelichen Kindern gegenüber ehelichen Kindern die gleichen Rechte zugestanden werden, deren Mütter nicht mehr diskriminiert werden und eine Reformierung der Sexualerziehung an öffentlichen Schulen zu erreichen. Weitere Pioniere waren Albert Moll, der wesentliche Studien zu den Themen Homosexualität, „Sexualtrieb“ und kindlicher Sexualität veröffentlichte und im Jahr 1913 die „Internationale Gesellschaft für Sexualforschung“ gründete, und Magnus Hirschfeld, der 1928 mit Havelock Ellis, Helene Stöcker und anderen Sexualreformern die „Weltliga für Sexualreform“ gründete und außerdem die erste Organisation für die Rechte von Homosexuellen ins Leben rief. Die „Weltliga für Sexualreform“ stellt auch gegenwärtig nach wie vor wichtige sexualpolitische Ansprüche: die politische, wirtschaftliche und sexuelle Gleichstellung beider Geschlechter, eine Verminderung des kirchlichen Einflusses bezüglich sexueller Normen, Empfängnisverhütung, planmäßige Sexualerziehung und Aufklärung so wie das Vermitteln einer gesunden Sexualität ohne Schuldgefühle. [5][27] Wesentlich radikalere Veränderungen forderte Wilhelm Reich in seinem 1936 erschienenen Buch „Die sexuelle Revolution“. Er vertrat die Auffassung, dass eine entscheidende Änderung bezüglich der Sichtweise der Sexualität erst durch wesentliche gesellschaftspolitische Veränderungen möglich wäre. [5] Durch den nationalsozialistischen Einfluss ab 1933 fanden sexualwissenschaftliche Betrachtungen in Deutschland ein jähes Ende und auch im Rest von Europa reagierte man auf sexuelle Reformbewegungen verhalten. [5][27] Währenddessen dehnten sich in den USA sexualwissenschaftliche Untersuchungen auf den Bereich des allgemeinen Sexualverhaltens aus. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind Alfred C. Kinsey und William H. Masters mit Virginia E. Johnson. [5] Kinsey war ursprünglich Zoologe und wurde 1938 von seiner Universität gebeten, im Zuge einer Vorlesung über die biologische Komponente von Sexualität und Ehe zu referieren. Während seiner Vorbereitungen stellte er fest, dass sämtliche veröffentlichte Arbeiten dazu 22 relativ spekulativ und statistisch nicht valide waren. Er begann also sexuelle Lebensgeschichten zu sammeln und auszuwerten. In dem von ihm gegründeten „Institut für Sexualforschung“ wurden bis 1959 über 18 000 persönlich interviewte sexuelle Fälle gesammelt. Diese umfangreichen Untersuchungen „enthielten detaillierte Statistiken über das Sexualverhalten der durchschnittlichen Nordamerikaner aller Altersklassen, aller Bildungsgrade und aus allen Teilen des Landes“ und „zeigten eine erstaunliche Vielfalt von Verhaltensnormen“. Auf diesen Studien basieren auch seine beiden Bücher „Das sexuelle Verhalten des Mannes“ (1948) und „Das sexuelle Verhalten der Frau“ (1953). [27] Anhand dieser Studien stellte Kinsey unter anderem das wahre Ausmaß homosexuellen Verhaltens in der Bevölkerung und in der Sexualität von Jugendlichen fest, das im völligen Widerspruch zur bisherigen öffentlichen Meinung stand, nämlich, dass homosexuelle Handlungen die Ausnahme seien. [27] Der Gynäkologe William Masters begann im Jahr 1954 die sexuellen Reaktionen von Männern und Frauen direkt zu beobachten. Freiwillige Versuchspersonen wurden während verschiedener sexuellen Tätigkeiten in einem Labor beobachtet und mithilfe von speziellen Messgeräten wurden ihre körperlichen Reaktionen gemessen und dokumentiert. [27][29] Diese umfassende Studie über die Physiologie der Sexualität des Menschen, die in dem Buch „Die sexuelle Reaktion “ (1967) veröffentlicht wurde, entkräftete und revolutionierte herkömmliche Thesen und Anschauungen zu diesem Thema. Unter anderem wurden die bisherigen psychoanalytischen Annahmen über die weibliche Sexualität durch physiologische Tatsachen widerlegt. [5][27][29] Im Jahr 1959 fing das Ehepaar Masters und Johnson an ein Therapieprogramm zu entwickeln, um die sexuellen Probleme von Ehepaaren, später auch von nichtverheirateten Paaren, zu behandeln. Diese Sexualtherapie war sehr erfolgreich. Die daraus gewonnen Erkenntnisse wurden in dem Buch „Impotenz und Anorgasmie - zur Therapie funktioneller Sexualstörungen“ (1970) publiziert. [29] 23 3.4 Biologie der Sexualität 3.4.1 Neurobiologie der Sexualität Im Gehirn haben der Hypothalamus, die Amygdalae, das Septum, das ventrale Striatum und die kortikalen Komponenten in Hippocampus, Gyrus Cinguli und orbitofrontalem Kortex großen Einfluss auf die Sexualität. [30] Das endokrine System spielt in der Sexualität die wichtigste Rolle, allen voran das Hypothalamus-Hypophysenvorderlappen-Gonaden-System. Die Hormone FSH-RH (follikelstimulierendes Hormon Releasing-Hormon) und LH-RH (luteinisierendes Hormon Releasing-Hormon), welche vom Hypothalamus ausgeschüttet werden, bewirken in weiterer Folge im Hypophysenvorderlappen die Freisetzung von FSH und LH. Je nach Geschlecht haben FSH und LH spezifische Wirkungen. Das FSH regt beim Mann die Spermiogenese und bei der Frau das Wachstum und die Reifung der Follikel im Eierstock an. Das LH ist beim Mann essentiell für die Produktion von Testosteron und bei der Frau für die Produktion von Progesteron und Östrogen sowie für den Eisprung. Für den Menstruationszyklus der Frau sind die Hormone FSH und LH ebenfalls maßgebend. [31] Weiters werden Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, Prolaktin und Oxytocin eine Beteiligung an der Steuerung des Sexualverhaltens zugesprochen. [30] Die pränatale Geschlechtsdifferenzierung bei Pubertätsbeginn und die spätere Entwicklung der Sexualität wird durch die Sexualhormone (Östrogen, Progesteron, Testosteron) gesteuert. [31] Neurotransmitter im Zentralnervensystem (Serotonin, Noradrenalin und Dopamin) können durch Psychopharmaka in ihrer Aktivität beeinflusst werden. [32] Psychopharmaka und deren mögliche Teratogenität implizieren eine exakte Verhütung, wobei Interaktionen zwischen oralen Verhütungsmitteln und Psychopharmaka bestehen. [32] 24 3.5 Sexualstörungen und ihre Einteilung Es gibt eine Vielfalt von Sexualstörungen, die in sexuelle Funktionsstörungen (sexuelle Dysfunktionen) und weitere Störungsbilder, die mit anderen psychischen Erkrankungen gehäuft vorkommen oder medikamentös induziert sind, eingeteilt werden. [6] 3.5.1 Sexuelle Funktionsstörungen Laut Beier et al. (2005) werden sexuelle Funktionsstörungen wie folgt definiert: „Sexuelle Funktionsstörungen manifestieren sich in Beeinträchtigungen des sexuellen Erlebens und Verhaltens in Form von ausbleibenden, reduzierten oder unerwünschten genitalphysiologischen Reaktionen. Zu den sexuellen Funktionsstörungen werden auch Störungen der sexuellen Appetenz und Befriedigung sowie Schmerzen im Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr gezählt.“ (Beier et al. 2005, 162) [33] Die Einteilung der sexuellen Funktionsstörungen erfolgt üblicherweise nach dem „triphasischen“ Konzept der amerikanische Sexualtherapeutin Helen S. Kaplan (1981, 1995). Dieses Dreiphasen-Modell basiert auf den zwei Hauptphasen des nur die physiologischen Abläufe berücksichtigenden „sexuellen Reaktionszyklus“ von Masters und Johnson, der Erregungs- und der Orgasmusphase, und ist um eine Lust-AppetenzPhase zu Beginn einer sexuellen Interaktion erweitert, wodurch es auch dem biopsychosozialen Gedanken gerecht wird. [6][33] Ist die Lust-Appetenz-Phase (das erotische Verlangen) beeinträchtigt, kann es bei Männern und Frauen zu Libidomangel oder sexueller Aversion kommen. Bei einer gehemmten Erregungsphase kann bei Frauen die Lubrikation vermindert sowie die Schwellreaktion gestört sein und sich bei Männern eine erektile Dysfunktion zeigen. Diese Störungen können in Folge zu einem Vaginismus der Frau und zu einer Dyspareunie bei beiden Geschlechtern führen. Kommt es zu Störungen in der Orgasmusphase, kann es für die Frau schwierig sein, einen Orgasmus zu erreichen, oder der Orgasmus bleibt überhaupt aus. Beim Mann können sich 25 Störungen in dieser Phase mit einem vorzeitigen, verzögerten oder ausbleibenden Samenerguss zeigen. Postkoital kann es nach dem Orgasmus auch zu negativen psychischen Wahrnehmungen, die sich in unangenehmen Empfindungen in der Genitalregion, Heulkrämpfen und anderen Phänomenen äußern können, kommen. Weiters gibt es Phobien, welche die Sexualität betreffen, wie zum Beispiel Ekel vor den eigenen Körperflüssigkeiten, vor Masturbation oder anderen Praktiken. [6] Kriterien um sexuelle Funktionsstörungen einzuteilen sind zum Beispiel, ob die Störung schon früher bestanden hat, erst später aufgetreten ist, alle sexuellen Praktiken umfasst oder spezifisch ist, und inwieweit andere als psychische Aspekte (zum Beispiel intrapsychische Konflikte) eine Rolle spielen. [6] Psychopharmaka können eine sexuelle Funktionsstörung auslösen. Vor allem bei schizophrenen Störungen stehen die Psychopharmaka in Verdacht Sexualstörungen (zum Beispiel durch eine Hyperprolaktinämie hervorgerufen) zu verursachen. Oft ist schwer zu differenzieren, ob eine Sexualstörung durch die medikamentöse Therapie oder durch Alkohol- oder Drogenabusus, welcher bei schizophrenen Patienten öfter vorkommt, ausgelöst wird. [6] 26 4 Schizophrenie Charakterisierend für diese Erkrankung ist das Auftreten von Positiv- und Negativsymptomatik wie Wahn, Halluzinationen, formale Denkstörungen, Ich-Störungen, Affektstörungen und psychomotorische Störungen, welches über einen gewissen Zeitraum bestehen muss. Ist dies nicht der Fall, wird die Erkrankung dem schizophreniformen Krankheitsbild zugeordnet. [34] 4.1 Epidemiologie Laut Literatur werden die Prävalenz mit 0,4 bis 1,4 % und die Inzidenzrate mit 0,05% angegeben. [1][34] Bei Männern liegt das höchste Risiko an Schizophrenie zu erkranken bei ungefähr 21 Jahren, bei Frauen im Schnitt bei 26 Jahren. [34] Des Weiteren zeigt sich bei Frauen ein zweiter niedrigerer Erkrankungsgipfel um die Menopause. [35] [36] Schizophrene Patienten leiden häufig unter psychiatrischen Komorbiditäten. Einen besonderen Stellenwert nimmt der komorbide Substanzmissbrauch (Alkohol, Stimulantien, illegale Drogen und Nikotin) ein. [34] [35][36][37][38] Bedeutend ist auch eine hohe Bereitschaft zum Suizid, wobei die Suizidrate etwa 10% beträgt. [34] [35] Die Sterblichkeit bei schizophrenen Patienten ist um ungefähr 50% höher als bei der Normalbevölkerung, was neben der erhöhten Suizidrate auf Lifestyle-Erkrankungen (Adipositas, Diabetes mellitus, Rauchen), der sich daraus ergebenden kardiovaskulären Probleme und der mangelnden Bereitschaft, diese behandeln zu lassen, zurückzuführen ist. [1][39][40] 4.2 Ätiologie und Pathogenese Bezüglich der Ätiopathogenese werden multifaktorielle Aspekte angenommen, wobei die genetische Disposition im Vordergrund steht. [34] 27 Abb. 1 Multifaktorielle Ätiopathogenese der Schizophrenie [34] Das Stress-Vulnerabilitäts-Modell beschreibt unterschiedliche Ebenen der individuellen Verletzlichkeit und der Reaktionen auf Stress, welche von biopsychosozialen Faktoren geprägt sind. Eine hohen Vulnerabilität kann, wenn bestimmte Bedingungen (Umweltstressoren) erfüllt sind, schon bei einem niedrigen Stresslevel zu spezifischen Problemen führen. [1] [35] 4.3 Klinik Die Symptome wurden lange nach Bleuler (1911) in sogenannte Grundsymptome und akzessorische Symptome eingeteilt. Laut Schneider (1938) gibt es eine Einteilung der Symptome in Symptome 1. und 2. Ranges, wobei diese Einteilungen mit dem heutigen 28 Wissenstand angezweifelt werden. Die aktuelle Einteilung der Symptome wird mithilfe der Begriffe Positiv- und Negativsymptomatik vorgenommen. [41] Abb. 2 Positive und negative Symptome schizophrener Psychosen [41] Die genaue Einteilung der Symptome variiert je nach Lehrbuch. [34][42] Symptomgruppen wie Wahn, Halluzinationen, Ich-Störungen, formale Denkstörungen, affektive Störungen und katatone Symptome sind zwar typisch für die Schizophrenie, aber sie deuten nicht zwingend auf das Vorliegen einer Schizophrenie hin. [34] Obwohl eine deutliche Mehrzahl der Patienten mit Schizophrenie mindestens einmal an einer Wahnsymptomatik leidet, ist der Wahn nicht pathognomisch. Es gibt unterschiedlichste Wahntypen, wie zum Beispiel den Beeinträchtigungs-, den Verfolgungs-, Beziehungs- und Größenwahn, die sich später auch zu einem Wahnsystem entwickeln können. Meist zieht der Wahn Veränderungen von Verhaltensweisen mit sich und unterscheidet sich in Antrieb und Ausprägung. [41] Ein Wahn kann sich in Form eines Wahneinfalls, also ohne Sinneseindrücke von Außen, einer Wahnwahrnehmung, die sich auf die Sinneseindrücke der äußeren Umwelt bezieht, 29 und eines mit Halluzinationen gekoppelten Erklärungswahns, mit dem versucht wird sich unerklärliche Halluzinationen zu erklären, zeigen. [34] Charakteristisch für den Wahn schizophrener Genese ist, dass dieser für andere nicht nachfühlbar ist, da diese Wahnideen meist sehr phantasmagorisch sind. [34] Das Hören von imperativen, kommentierenden oder dialogisierenden Stimmen ist kennzeichnend für schizophrene Halluzinationen. Es können aber auch andere Halluzinationen, wie Geschmacks-, Geruchs- und Körperempfindungshalluzinationen sowie optische Halluzinationen auftreten. [34] Zu den Ich-Störungen zählen die Depersonalisation (eigene Emotionen, Gedanken und Körperempfindungen wirken nicht vertraut) und die Derealisation (die Umwelt erscheint unwirklich), bei denen die Barriere zwischen dem Ich und dem äußeren Umfeld verschwimmt. [34] Die Gedankeneingebung, die Gedankenausbreitung und der Gedankenentzug gehören zu den Fremdbeeinflussungserlebnissen, bei denen die Betroffenen glauben, dass ihre Gedanken sich ungewollt ausdehnen und belauscht oder ihnen entzogen werden können. [41] Die formalen Denkstörungen beschreiben Beeinträchtigungen in den Denkvorgängen. Auch diese sind nicht pathognomisch. Bei schizophrenen Patienten ist die Zerfahrenheit jedoch nicht selten. Die Gedankenvorgänge sind dabei nicht linear und Zusammenhänge werden unlogisch verarbeitet. Das Vorbeireden sowie die Bildung neuer Wortschöpfungen können weitere sprachliche Auswirkungen der Schizophrenie sein. Im subjektiven Bereich des Denkens kommen das Gedankenabreißen und das Gedankendrängen vor. [41] Oft beschrieben werden Störungen der Affektivität. Diese sind in der Praxis in den nicht akuten Phasen der Erkrankung von Bedeutung, aber nicht zwingend, da beispielsweise auch andere Krankheiten diese Symptome zeigen können. Die Patienten geben im Gespräch meist innere Unruhe, die mit einer starken Angespanntheit gekoppelt ist, an. Unter anderem wird Ängstlichkeit, Affektarmut, Ratlosigkeit, Ambivalenz, Störung der Vitalgefühle und Parathymie von den Patienten empfunden. Eine Besonderheit vor allem bei hebephrenen Syndromen ist der läppische Affekt, bei dem es hauptsächlich zu infantilen Verhaltensweisen im Affekt kommt. [41] 30 Eine psychomotorische (katatone) Symptomatik kann sich in Stupor, Mutismus und Katalepsie äußern. All diese Symptome haben ihre Gemeinsamkeit in der unwillkürlichen Erstarrung der Muskulatur in verschiedenen Ausprägungen. Hingegen kommt es beim katatonen Raptus zu einer heftigen motorischen Hyperaktivität (zum Beispiel schreien, um sich schlagen). Ebenfalls zu dieser Gruppe der Symptome gehören Auffälligkeiten im zwischenmenschlichen Bereich. Diese äußern sich in Negativismus, Befehlsautonomie, Echolalie, Echopraxie und so weiter. Auch sich immer wiederholende Bewegungs- und Haltungsstereotypien treten auf. [34] Störungen des Antriebs zeigen sich in einer Antriebsarmut oder in einer Antriebsteigerung, wobei ersteres wesentlich häufiger, in circa 50% der Fälle, auftritt. [41] Anhand der Klinik werden verschiedene Subtypen unterschieden: Abb. 3 Klassifikation der Subtypen schizophrener Erkrankungen [34] Der paranoid-halluzinatorische Typ wird charakterisiert durch das Vorherrschen von Wahn und Halluzinationen, wobei andere Symptome, falls überhaupt bestehend, sich im Hintergrund halten. Der katatone Subtyp ist selten und geprägt von einer katatonen Symptomatik, die unter Umständen auch lebensbedrohend sein kann (vegetative Entgleisungen). Der hebephrene Subtyp tritt meistens in der Adoleszenz auf und wird hauptsächlich von affektiven Störungen und läppischem Affekt bestimmt. Charakteristisch für den Residualtyp ist eine auffällige Veränderung der Persönlichkeit, begleitet von Antriebsarmut, Affektarmut und Asozialität. Dieser Typ kann sich in Folge mehrerer schizophrener Psychosen entwickeln. Die Schizophrenia simplex ist ein Sonderfall, da dieser Typ sehr arm an Symptomen ist. Vor allem Wahn und Halluzinationen sind häufig nicht vorhanden. Im weiteren Verlauf 31 dieses langsam fortschreitenden Subtyps kann sich eine Negativsymptomatik im Sinne eines Residualsyndroms ausbilden. [34] 4.4 Diagnostik und Differentialdiagnose Die Diagnosestellung der Schizophrenie ist äußerst komplex und verlangt nach einer exakten Anamnese und präzisen Erfragung der Symptome sowie einer genauen körperlichen, laborchemischen und apparativen (CCT, MRT, CBF, EP) Abklärung. Die zeitliche Komponente ist für die Diagnosestellung von äußerster Wichtigkeit und wird in den aktuellen Klassifikationen (ICD-10, DSM-IV) unterschiedlich, aber ähnlich, berücksichtigt. [34] Abb. 4 Schizophrene Erkrankungen nach ICD-10 und DSM-IV [34] 32 Als Differentialdiagnosen kommen alle organisch verursachten Psychosen jeglicher Genese (entzündlich, neoplastisch, toxisch, hirnorganisch) sowie schizoaffektive und affektive Störungen oder Persönlichkeitsstörungen (schizotypische, schizoide, paranoide oder Borderline-Typ) in Frage. Eine schizophreniforme Erkrankung liegt vor, wenn der im ICD-10 oder im DSM-IV für die Diagnose Schizophrenie verlangte Zeitraum unterschritten wird. [34] 4.5 Therapie Die Therapie besteht im Wesentlichen aus psychopharmakologischen sowie psycho- und soziotherapeutischen Lösungsansätzen. Dabei ist meist ein stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik notwendig. In den akuten Phasen der Krankheit hat sich der Einsatz von Psychopharmaka bewährt, da in dieser Phase die Voraussetzung für die psycho- und soziotherapeutischen Maßnahmen nicht gegeben ist (fehlende Krankheitseinsicht). Die Medikation mit Neuroleptika geschieht normalerweise als Monotherapie und wird nur in speziellen Fällen mit anderen Medikamenten kombiniert. Bei einem akuten Schub der Erkrankung werden die Neuroleptika hochdosiert gegeben, während sie sonst einschleichend verabreicht werden. Eine weitere wichtige Rolle neben den klassischen (typischen) Neuroleptika spielen die neuen (atypischen) Neuroleptika, welche besser auf die Negativsymptomatik wirken und kaum extrapyramidalmotorische Störungen (Akathisie, Parkinsonoid, Dystonie, Dyskinesie) hervorrufen. [1][34] Neuroleptika im Allgemeinen können die verschiedensten Nebenwirkungen auslösen, wie zum Beispiel endokrine, neurologische und kardiovaskuläre Störungen sowie Stoffwechselerkrankungen. [1] Es kann unter Umständen nötig sein, dass Neuroleptikum bei nicht zufriedenstellendem Therapieerfolg zu wechseln. Nach Abklingen einer akut-psychotischen Phase werden für mindestens 6 Monate die Neuroleptika nach Bedarf vermindert um Rückfällen vorzubeugen, wobei spätestens in dieser Phase auf atypische Neuroleptika umgestellt werden sollte. In der Langzeittherapie und Prophylaxe eines Rezidivs wird das Augenmerk sehr auf das Auftreten und Reduzieren von medikamentösen Nebenwirkungen (Vermeidung von Spätdyskinesien) gelegt. Prinzipiell gilt, soviel wie nötig, so wenig wie möglich. 33 In besonderen Fällen von Compliance-Problemen können Depotneuroleptika verabreicht werden. Liegen chronische produktive Psychosen vor, ist eine lebenslange symptomunterdrückende Therapie indiziert. [34] Ein wichtiger Teil der Therapie ist der psychotherapeutische Ansatz, bei dem der Therapeut in unterstützender Form agiert. Dies geschieht durch genaue Aufklärung über die Erkrankung und gute Zusprache. Diese Psychoedukation soll dem Betroffenen im Alltag und in Krisensituationen (zum Beispiel durch Verhaltenstherapie) helfen. Der soziotherapeutische Ansatz hat als Ziel, die soziale Kompetenz der Patienten aufrecht zu erhalten. Die Arbeits- und Beschäftigungstherapie sowie berufsrehabilitative Maßnahmen und das Training sozialer Fertigkeiten werden Stück für Stück gefördert und trainiert. Die Behandlung erfolgt dabei total- und in weiterer Folge teilstationär (Tag- oder Nachtkliniken, Psychosoziale Zentren), um den Patienten die Gelegenheit für den Weg in die wiedererlangte Eigenständigkeit zu bieten. [34] 4.6 Verlauf Die Erkrankung beginnt entweder mit einem akuten Schub oder schleichend. Von einer Phase spricht man bei völliger Remission, während bei Schüben eine Restsymptomatik bestehen bleibt. Bevor die für die Schizophrenie typischen Symptome auftreten, zeigen sich oft im Prodromalstadium sogenannte Prodromalerscheinungen, welche sich zum Beispiel in depressivem Verhalten, rascher Ermüdbarkeit und Erschöpfung oder in Stimmungsschwankungen äußern. In vielen Fällen kommt es zur Ausbildung von Residualzuständen, bei denen suizidale Krisen ein großes Problem darstellen, ebenso wie während dem akuten Stadium der Erkrankung und in der Remission. Nur in wenigen Fällen kommt es zu chronischen produktiv-schizophrenen Symptomen, die lebenslang persistieren. Postpsychotische Depressionen und Erschöpfungszustände (postremissive Zustände) kommen nach einem akuten Auftreten vor und müssen klar von der Negativsymptomatik eines Residualzustandes unterschieden werden. [34] 34 Abb. 5 Die Entwicklungsstadien der Schizophrenie – Die Entwicklung psychotischer Störungen [34] Des Weiteren können sich die Verläufe sehr unterschiedlich darstellen und können beispielsweise nach ICD-10 oder der Verlaufstypologie nach Bleuler (1983) eingeteilt werden. [34] In Langzeitstudien ist das Outcome bei Schizophrenie im Vergleich mit anderen psychiatrischen Erkrankungen schlecht. Die Prognose der Schizophrenie ist sehr individuell und man kann versuchen, sie anhand von Merkmalen zu bestimmen. [34][39] Abb. 6 Übersicht über wichtige Prognosemerkmale [34] 35 Prinzipiell gilt, die Prognose wird günstiger, je schneller der Ausbruch der Schizophrenie erkannt und behandelt wird und je konkreter die situationsbezogenen auslösenden Faktoren sind. [34] 36 5 Aggression und Sexualität bei Patienten mit Schizophrenie 5.1 Komorbiditäten Eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit Aggressionen und dem sexuellem Verhalten spielen bei der schizophrenen Erkrankung vor allem zwei komorbide psychiatrische Störungen: der Substanzmissbrauch und die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Auf die thematischen Zusammenhänge der Komorbiditäten und der Schizophrenie wird in den jeweiligen Kapiteln eingegangen. Substanzmissbrauch: Substanzabusus stellt ein häufiges Problem unter schizophrenen Patienten dar. [38][43] Nach einer Arbeit von Wobrock (2005) liegt bei etwa 15–65% aller schizophrenen Patienten gleichzeitig ein komorbider Substanzmissbrauch bzw. eine Substanzabhängigkeit vor. [44] Laut Steinert (1998) neigen schizophrene Patienten vor allem zum episodischen Substanzabusus. [38] Unter anderem zählt laut Nedopil et al. (2000) der Alkohol mit Sicherheit zu den bedeutendsten pharmakogenen Substanzen, die Aggressionen auslösen. [43][45] Eine Studie von Tiihonen et al. (1997) zeigte, dass mehr als die Hälfte der untersuchten schizophrenen Straftäter Probleme mit Alkohol hatten. [47] Laut Walsh et al. (2004) ist der Einfluss von Alkohol auf das Verüben von aggressiven Handlungen signifikant höher, als der Einfluss von illegalen Drogen. [48] Auch andere enthemmende und den Antrieb steigernde Substanzen wie zum Beispiel Kokain und Amphetamine dürften aggressives Verhalten fördern, während dämpfende Substanzen wie Opiate in diesem Zusammenhang in erster Linie durch kriminelle Handlungen zur Beschaffung der Drogen und im Rahmen von Entzügen auffallen. [38][45] 37 Unter anderem laut Steinert et al. (1996) findet sich bei schizophrenen Patientinnen signifikant weniger Alkohol- und Drogenabusus als bei männlichen Schizophreniepatienten. (Diese Geschlechterverteilung entspricht dem Substanzabusus der Normalbevölkerung.) Bei gewalttätigen Patientinnen zeigt sich in 27% ein Substanzabusus, während bei nicht aggressiven Schizophreniepatientinnen nur die Hälfte von ihnen Alkohol oder Drogen missbräuchlich verwenden. [37][38] Antisoziale Persönlichkeitsstörung: Mehrere Studien berichten auch von einem möglichen Zusammenhang zwischen Schizophrenie, Gewalt und komorbider antisozialer Persönlichkeitsstörung. [49][50] Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch das Ignorieren gesellschaftlicher Regeln, Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen, mangelndes Einfühlungsvermögen, Reizbarkeit und Impulsivität aus. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung tendieren zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten, um sich abzureagieren oder durchzusetzen. [45] Moran et al. (2004) vertreten die Hypothese, dass mit der Schizophrenie in Zusammenhang stehende genetische Faktoren auch das Auftreten von antisozialem Verhalten fördern. [49] Unter anderem tritt laut Wobrock (2005) Substanzmissbrauch auch bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung als Komorbidität auf. [44][45][49] 38 5.2 Aggression 5.2.1 Risikofaktoren für aggressives Verhalten bei schizophrenen Patienten Laut Nedopil et al. (2000) kommt Aggression symptomatisch bei diversen psychiatrischen Erkrankungen vor. Im DSM-IV wird aggressives Verhalten unter anderem bei Substanzabusus, antisozialen Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie beschrieben. [45][46] In der aktuellen Literatur wird von multiplen und komplexen Ursachen für die Entstehung von gewalttätigem Verhalten bei schizophrenen Patienten ausgegangen. Es finden sich Komorbiditäten mit Substanzabusus oder antisozialer Persönlichkeitsstörung, Wahn mit hoher Wahndynamik (zum Beispiel Verfolgungs- oder Beeinträchtigungswahn), IchStörungen mit dem Gefühl der Fremdbeeinflussung, neuropsychologische Defizite, niedriger sozioökonomischer Status und frühere kriminelle Handlungen als Risikofaktoren für Gewaltdelikte und aggressive Handlungen schizophrener Patienten. [38][45][48][51][52][53][54] Laut Steinert (1998) finden sich Wahnvorstellungen mit einer hohen Wahndynamik vor allem bei schweren Gewalttätigkeiten schizophrener Patienten. [38] Nach Fazel et al. (2009) ist eine Erklärung für das Auftreten von Gewalt bei schizophrenen Patienten, dass das gewalttätige Verhalten das Ergebnis der Positivsymptomatik der Erkrankung (Wahnideen, Halluzinationen) oder des komorbiden Substanzmissbrauchs ist. Eine weitere Hypothese für das gemeinsame Vorkommen von Aggressionen und Schizophrenie geht von ähnlichen genetischen Faktoren oder frühen Umweltfaktoren aus, die damit in Zusammenhang stehen. [55] Neben den eingangs erwähnten Risikofaktoren zeigt sich in einer weiteren Studie von Fazel et al. (2009) auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen elterlichen Gewalttätigkeiten und späteren Gewaltdelikten schizophrener Patienten beiderlei Geschlechts. Die Studienautoren stellen fest, dass mütterliches gewalttätiges Verhalten 39 einen größeren Einfluss auf spätere Gewalttätigkeiten bei männlichen Schizophreniepatienten hat als väterliches. [56] Nedopil et al. (2000) sehen die Häufigkeit von Gewaltdelinquenz bei schizophrenen Patienten nicht nur im Zusammenhang mit der Erkrankung oder zusätzlichen Komorbiditäten, sondern auch mit der Qualität der Versorgung schizophrener Patienten. Laut den Autoren sinkt die Häufigkeit aggressiver Gewalttaten bei schizophrenen Patienten mit qualitativ hochwertiger Betreuung. [45] 40 5.2.2 Schizophrenie und Aggression Das Ziel der psychiatrischen Aggressionsforschung ist in erster Linie, klar identifizierbare Faktoren und Motive für das aggressive Verhalten in Zusammenhang mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen zu finden. [38] Laut Steinert et al. (2008) sind die psychopathologischen Symptome der Erkrankung alleine kein ausreichender Grund für die Entstehung von aggressivem Verhalten. Bei psychiatrischen Patienten stehen ebenso wie in der gesunden Allgemeinbevölkerung Aggressionen meist im Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Ereignissen. Spontane impulsive Gewalttätigkeiten ereignen sich kaum. [57] Steinert (1998) untersucht in einer Studie aggressionsauslösende Faktoren bei schizophrenen Patienten und kommt zu dem Ergebnis, dass die aggressive Motivation von Schizophreniepatienten mit jener der psychisch gesunden Normalbevölkerung zu vergleichen ist (56% Frustration, 50% soziales Lernen, 44% instrumentelles Lernen, 31% Wegfall von Hemmungen, 25% Angst, 19% verschobene Aggression, 19% Aggression als Kontaktaufnahme, 6% Rivalität). [38] Laut einer Studie von Krakowski et al. (1999) gibt es zwei unterschiedliche Gruppen gewalttätiger schizophrener Patienten. Die eine Gruppe sind vorübergehend aggressive schizophrene Patienten, die im Rahmen einer akuten Exazerbation der Erkrankung gewalttätiges Verhalten an den Tag legen, aber nach entsprechender Behandlung nicht mehr aggressiv sind. Die andere Gruppe besteht aus Schizophreniepatienten mit persistierendem aggressivem Verhalten, die häufiger unter Negativsymptomatik, Misstrauen und neurologischen Symptomen leiden und trotz Behandlung aggressiv bleiben. [58] Unter anderem laut Walsh et al. (2004) sind schizophrene Menschen zwar statistisch betrachtet gewalttätiger als die gesunde Normalbevölkerung, aber die so signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit ist nur einer kleinen Gruppe schizophrener Patienten zuzuschreiben. [48][51] 41 Lindqvist et al. (1990) stellen in einer Studie fest, dass die Kriminalitätsrate schizophrener männlicher Patienten und der männlichen Normalbevölkerung annähernd gleich ist, während sie bei den weiblichen schizophrenen Patientinnen im Vergleich mit der weiblichen Normalbevölkerung um das 2-fache erhöht ist. [59] Im Gegensatz dazu hat laut einer Studie von Fazel et al. (2009) ein schizophrener männlicher Patient ein 4- bis 5-fach höheres Risiko eine Gewalttat zu verüben, als ein Mann aus der gesunden Normalbevölkerung. [60] Eronen et al. (1996) gehen in einer Studie davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit als männlicher und weiblicher schizophrener Patient jemanden zu töten 10 mal höher ist als in der gesunden Normalbevölkerung. [61] Laut Steinert (1998) kommen aggressive Handlungen ohne Verletzungen bei schizophrenen Patienten wesentlich öfter vor als Gewalttätigkeiten mit forensischen Belangen. [52] Auch Nedopil et al. (2000) sind der Meinung, dass es wahrscheinlicher ist von einem gesunden Menschen gewalttätig angegriffen zu werden, als von einem Schizophrenen. [45] Eine Studie von Arango et al. (1999) ergibt, dass die meisten aggressiven Handlungen im Zuhause schizophrener Patienten passieren (92,5%) und sich entweder gegen deren Eltern (34,6%), andere Familienmitglieder (17,2%) oder gegen sich selbst (13,7%) richten. [62] Steinert (1998) stellt fest, dass schizophrene Patienten mit aggressivem Verhalten länger als friedliche Schizophreniepatienten stationär betreut werden, häufiger rezidivieren und auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen chronischen Krankheitsverlauf haben. [38] Es finden sich nur wenige Studien über Schizophrenie und Aggressionen, die auch Frauen mit einbeziehen. Ein Grund ist, dass in den untersuchten Statistiken mehr Männer als Frauen vorkommen. [63] 42 5.2.3 Schizophrenie, Aggression und Neuropathologie Es gibt derzeit keine neurobiologische Theorie, die gewalttätiges und aggressives Verhalten bei schizophrenen Patienten eindeutig erklären kann. Bei aggressiven schizophrenen Patienten dürfte laut Studien von Soyka (2011) und Hoptman et al. (2011) ein Zusammenhang mit Abnormitäten der Frontal- und Temporallappen des Gehirns bestehen. [64][65] Bei PET- und SPECT- Untersuchungen finden sich unter neuropsychologischem Stress Ausfälle im orbitofrontalen und temporalen Kortex. [64] Eine Studie von Puri et al. (2008), die strukturelle Veränderungen der Gehirne schizophrener Patienten mit und ohne gewalttätigem Verhalten mittels MRI einander gegenüberstellt, ergibt bei gewalttätigen schizophrenen Patienten eine Verminderung der grauen Substanz, besonders im Cerebellum, die neuronale Abläufe und parietotemporale Verknüpfungen stören kann. [66] Hoptman et al. (2005) sehen in einer Studie im Gegensatz zu der von Puri et al. (2008) behaupteten Verminderung von grauer Substanz einen Zusammenhang zwischen einer Vermehrung von grauer und weißer Substanz im orbitofrontalen Kortex und einem erhöhten aggressiven Verhalten der Patienten. [66][67] In einer weiteren Untersuchung stellten Hoptman et al. (2002) Anzeichen einer gestörten Verbindung zwischen den Amygdalae und dem orbitofrontalen Kortex fest. [68] In einer Studie von Amoo et al. (2010), für die 305 Patienten rekrutiert werden, fallen 43 Patienten (13,8%) durch aggressives Verhalten auf. 21 (48,8%) von ihnen haben die Diagnose Schizophrenie. Die Aggression ist hauptsächlich gegen das Klinikpersonal gerichtet. Die Ursachen sind Halluzinationen, impulsives Verhalten, der Wunsch nach Entlassung, nicht erfüllte Forderungen der Patienten und Konfrontationen. Der einzige sozial-demographische Faktor ist Arbeitslosigkeit. [69] 43 5.2.4 Schizophrenie, Aggression und Komorbiditäten Wie schon im Kapitel Komorbiditäten erwähnt besteht ein enger Zusammenhang zwischen komorbiden psychiatrischen Erkrankungen und dem aggressivem Verhalten von schizophrenen Patienten. Wallace et al. (1998) kommen in einer Studie zu dem Schluss, dass bei Patienten mit psychotischen Störungen Komorbiditäten wie Persönlichkeitsstörungen und Substanzmissbrauch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Gewalttätigkeiten und aggressivem Verhalten erhöhen. [50] In einer Untersuchung stellt Steinert (1998) fest, dass es laut seinen Ergebnissen zwei verschiedene Arten von schizophrenen Gewaltdelinquenten gibt. Bei einem kleineren Teil der schizophrenen Patienten, die vorwiegend aus gestörten familiären Verhältnissen kommen, zeigen sich schon in der Adoleszenz vor dem Ausbruch der Schizophrenie antisoziale Verhaltensweisen mit aggressiven Handlungen und Alkoholund Drogenabusus. Im anderen, größeren Teil der Schizophreniepatienten finden sich kaum antisoziale Verhaltensstörungen. Die Patienten tendieren dazu, sich vor dem Auftreten der Schizophrenie aus ihrem sozialen Umfeld zurückzuziehen. Diese Tendenz verschlimmert sich während des Verlaufs der Erkrankung und führt häufig zum sozioökonomischen Abstieg und komorbidem sekundären Alkoholabusus. Im Zuge des sozioökonomischen Abstiegs kommt es gehäuft zu Gewalttätigkeiten. Wahnideen, wie zum Beispiel Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn, scheinen bei dieser Patientengruppe eine wesentlich größere Bedeutung zu haben als beim ersten, kleineren Teil der Schizophreniepatienten. [38] Auch Mueser et al. (1997) kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass schizophrene Patienten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung anfälliger für schweren Substanzmissbrauch und gewalttätiges Verhalten sind. [70] Laut Brennan et al. (2000) kann das signifikant erhöhte gewalttätige und aggressive Verhalten schizophrener Patienten aber nicht alleine durch diese Komorbiditäten erklärt 44 werden, sondern es muss zusätzlich die eigenständige erhöhte Wahrscheinlichkeit, die schizophrene Patienten für dieses Verhalten haben, beachtet werden. [71] Substanzmissbrauch: Es finden sich in einer Studie von Fazel et al. (2009) verschiedene Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Schizophrenie, komorbidem Substanzmissbrauch und Gewalttaten. Eine Theorie ist, dass die Schizophrenie durch eine vorherrschende genetische Komponente zu Substanzmissbrauch führt und das wiederum die Wahrscheinlichkeit für Gewalttaten erhöht. Eine zweite Hypothese lautet, dass eine genetisch bedingte Anfälligkeit für Substanzmissbrauch zu Schizophrenie und dadurch zu erhöhter Gewaltbereitschaft führen kann. Eine dritte Möglichkeit ist eine genetisch bedingte Empfindlichkeit für Schizophrenie und Substanzmissbrauch und ein daraus resultierender Zusammenhang mit aggressivem Verhalten. Ein weiterer Denkansatz wäre eine geteilte genetisch bedingte Disposition für Schizophrenie, Substanzmissbrauch und gewalttätige kriminelle Handlungen. [55] Die Studienergebnisse der Studie von Fazel et al. (2009) ergeben auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass schizophrene Patienten mit komorbidem Substanzmissbrauch gewalttätige Verbrechen begehen, signifikant höher (27,6%) ist, als bei schizophrenen Patienten ohne diese Komorbidität (8,5%). [55] Unter anderem haben auch Grann et al. (2004) in ihrer Studie festgestellt, dass komorbider Substanzmissbrauch das aggressive Verhalten schizophrener Patienten erhöht. [43][72][73] Es herrscht Unklarheit darüber, ob zwischen gewalttätigem Verhalten und Schizophrenie ohne komorbidem Substanzmissbrauch ein Zusammenhang besteht. [55] Nach einer weiteren Untersuchung von Fazel et al. (2009) entspricht die Wahrscheinlichkeit, dass schizophrene Patienten mit komorbidem Substanzmissbrauch Gewalttaten verüben annähernd der Wahrscheinlichkeit, mit der nur Substanzmissbrauch betreibende Menschen Gewalttaten verüben. [60] Cohen (1996) kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Bedeutung von Alkoholund Drogenabusus bei schizophrenen Patienten, die Straftaten begehen, bisher unterschätzt wird. [74] 45 Eine Untersuchung von Steinert et al. (1996) an männlichen schizophrenen Patienten mit aggressivem Verhalten stellt in etwa bei 70% einen komorbiden Alkohol- und Drogenabusus fest. Bei Patienten ohne bekannte aggressive Handlungen in der Vergangenheit zeigt sich nur bei 14% ein komorbider Substanzmissbrauch. [38] Räsänen et al. (1998) stellen in einer Geburtskohortenstudie fest, dass schizophrene Männer mit komorbidem Alkoholabusus 25,2 mal häufiger kriminelle Gewalttaten begehen, als eine gesunde männliche Vergleichsgruppe. [75] Schizophrene männliche Patienten ohne komorbiden Alkoholabusus verüben 3,6 mal häufiger als die gesunde Vergleichsgruppe gewalttätige Straftaten. In dieser Studie zeigt sich auch, dass die Wahrscheinlichkeit für das Begehen weiterer Straftaten (mehr als 2) bei schizophrenen Patienten mit komorbidem Alkoholabusus um das 9,5-fache erhöht ist. [75] In einer Studie von Swanson et al. (2006) über gewalttätiges Verhalten bei schizophrenen Patienten wird zwischen leichten (ohne Verletzungen und ohne Waffe) und schweren (Verletzungen, Gebrauch tödlicher Waffen, sexuelle Übergriffe) Gewalttätigkeiten unterschieden. Es zeigt sich, dass das Auftreten schizophrener Positivsymptomatik, wie zum Beispiel Verfolgungswahn, die Wahrscheinlichkeit für leichte und schwere Gewalttätigkeiten erhöht und das Vorkommen von Negativsymptomatik, wie zum Beispiel sozialer Rückzug, die Wahrscheinlichkeit für schwere Gewalttätigkeiten senkt. Laut dieser Studie stehen leichte Gewalttätigkeiten eher im Zusammenhang mit komorbidem Substanzmissbrauch sowie zwischenmenschlichen und sozialen Faktoren, während schwere Gewalttätigkeiten vor allem mit schizophrener und depressiver Symptomatik, schon in der Kindheit auffälligem Verhalten und ungerechter Behandlung in Zusammenhang stehen. [51] Auch laut einer Studie von Nijman et al. (2003) zeigt sich bei psychotischen Straftätern, deren Verbrechen einen tödlichen Ausgang genommen haben, seltener eine Substanzabhängigkeit zum Zeitpunkt der Tat, als bei psychotischen Gewalttätern, die im Verlauf ihrer Tat niemanden getötet haben. [76] 46 Im Gegensatz dazu kommen Eronen et al. (1996) in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit jemanden zu töten bei männlichen schizophrenen Patienten mit komorbidem Alkoholabusus um das 17-fache und ohne Alkoholabusus um das 7-fache sowie bei weiblichen schizophrenen Patientinnen mit komorbidem Alkoholabusus um das 8-fache und ohne begleitenden Alokoholabusus um das 5-fache erhöht ist. [61] Antisoziale Persönlichkeitsstörung: Eine Studie von Moran et al. (2004) untersucht anhand von 232 schizophrenen Männern, von denen 3/4 mindestens eine kriminelle Tat begangen haben, ob ein Zusammenhang zwischen Schizophrenie und antisozialer Persönlichkeitsstörung besteht. Bei einem Vergleich der schizophrenen Männer mit und ohne antisoziale Persönlichkeitsstörung finden sich im Krankheitsverlauf der Schizophrenie keine Unterschiede in der Symptomatik. [49] Es zeigen sich aber Relationen zwischen komorbiden antisozialen Persönlichkeitsstörungen und Substanzmissbrauch, Problemen mit der Aufmerksamkeit und Konzentration, mangelnder Affektivität sowie schlechten schulischen Leistungen in der Kindheit. Die verminderte Affektfähigkeit scheint die Wahrscheinlichkeit für aggressive Handlungen gegenüber Anderen zu erhöhen. [49] In einer weiteren Untersuchung von Moran et al. (2003) an 186 schizophrenen Patienten mit komorbider antisozialer Persönlichkeitsstörung über einen Zeitraum von 2 Jahren, stellen die Studienautoren eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit für gewalttätiges Verhalten fest. [77] 47 5.3 Sexualität 5.3.1 Sexualität und Schizophrenie Es gibt nur wenige Studien, die sich mit dem sexuellen Verhalten schizophrener Patienten beschäftigen und über sexuelle Funktionsstörungen hinausgehen. [78] Laut Scharfetter (1990) entspricht das sexuelle Verhalten schizophrener Patienten dem durchschnittlichen Sexualverhalten der gesunden Normalbevölkerung. Es kann jedoch durch eine Beeinträchtigung der Beziehung zu sich selbst und zu den Mitmenschen auch zu einem gestörten Sexualverhalten kommen. [79] In einer Studie von Miller et al. (1996) findet sich bei Patientinnen mit Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises ein geringeres sexuelles Verlangen als in der gesunden weiblichen Kontrollgruppe. Die Patientinnen schätzen auch ihre körperliche und seelische Zufriedenheit in Bezug auf Sex geringer ein. [80] Das sexuelle Erleben psychotischer Patienten ist mannigfaltig. Es kann über Schuldgefühle, Sorge der eigenen Unzulänglichkeit, impulsive sexuelle Aktivitäten und erotische Wahnvorstellungen alles beinhalten. [81][82] Während einer akuten psychotischen Episode kann Sexualität als wahnhaft, erzwungen oder mit Wahnvorstellungen erlebt werden. Unter wahnhafter Sexualität versteht man erotischen Beziehungswahn, Liebes- und Eifersuchtswahn, Schwangerschaftswahn und erotische Ideen. Sexualität mit Wahnvorstellungen zeichnet sich durch Wahnvorstellungen über sich verändernde Genitalien oder überhaupt Veränderungen des Geschlechts sowie akustische oder körperliche Halluzinationen aus. [81][82] Cournos et al. (1994) untersuchen 95 schizophrene Patienten bezüglich ihrer sexuellen Aktivität. 44 % der Befragten geben an, im letzten halben Jahr sexuell aktiv gewesen zu sein. Häufig wechselnde Partner haben 62% der sexuell aktiven schizophrenen Patienten, 48 was laut dieser Studie mit den Faktoren junges Alter, Wahnvorstellungen und anderer Positivsymptomatik in Zusammenhang steht. [83] Von mindestens einem Partner, der entweder HIV-positiv, i.v.-drogenabhängig oder beides ist, berichten 12% der sexuell aktiven Schizophreniepatienten. 50% der sexuell aktiven schizophrenen Patienten geben an, sexuelle Handlungen gegen Geldbeträge oder andere Güter eingetauscht zu haben. Weiters ist es unter den Befragten unüblich Kondome zu verwenden. [83] Laut einer Studie von Ramrakha et al. (2000) haben schizophrene Patienten im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe eher riskanten Geschlechtsverkehr und auch vermehrt sexuell übertragene Krankheiten. [84] Auch in anderen Untersuchungen wird festgestellt, dass schizophrene Patienten durch ihr sexuelles Verhalten ein höheres Risiko haben, an HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen zu erkranken. [80][91][92] Škodlar et al. (2009) stellen fest, dass bei schizophrenen Patienten impulsives sexuelles Verhalten beziehungsweise mangelnde sexuelle Selbstkontrolle selten vorkommen, aber von Relevanz sind. Patienten können gegenüber Mitpatienten und Pflegepersonal sexuell übergriffig werden, ein promiskuitives Sexualverhalten an den Tag legen oder an öffentlichen Plätzen sexuell aktiv sein. Dieses Verhalten ist ein Zeichen mangelnder Fähigkeit, seine Impulse kontrollieren zu können, und eines gestörten Beziehungsverhaltens. [82] Es kann vorkommen, dass schizophrene Patienten im Lauf der Therapie ihre erotischen Bedürfnisse und Phantasien auf den Therapeuten übertragen. [81] 49 5.3.2 Gender Identity bei schizophrenen Patienten Gender bezieht sich laut Definition nach den Guidelines der American Psychological Association „auf die Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, die eine bestimmte Kultur mit dem biologischen Geschlecht einer Person assoziiert.“ [87] Der Ausdruck „Gender Identity“ beschreibt „das Gefühl für sich selbst als männlich, weiblich oder transgender“. [87] „Geschlechtsidentität (gender identity) beginnt mit dem Wissen und dem Bewusstsein, ob bewusst oder unbewusst, dass man einem Geschlecht (sex) angehört und nicht dem anderen. Geschlechtsrolle (gender role) ist das äußerliche Verhalten, welches man in der Gesellschaft zeigt, die Rolle, die man spielt, insbesondere mit anderen Menschen.“ (Robert Stoller, 1968) [88] Biologische, psychologische, soziale und kulturelle Komponenten haben einen Anteil an der Entwicklung der Geschlechtsidentität. [89] Laut La Torre (1976) hängt die Entwicklung der Gender Identität zu einem großen Teil mit der Entwicklung des eigenen Körperbildes zusammen. Diese Wahrnehmung des körpereigenen Selbstbildes ist nach seinen Untersuchungen bei schizophrenen Patienten oft gestört. Auch Schwierigkeiten die eigene Geschlechterrolle anzunehmen finden sich bei Schizophreniepatienten häufig. [90] In einer Studie von Planansky et al. (1962) findet sich bei 150 untersuchten schizophrenen Patienten kein spezifischer Zusammenhang zwischen Homosexualität und dem Schweregrad der Schizophrenie. [91] Durch die bei Schizophrenie oft schwach ausgeprägte Geschlechtsidentität kommt es aber häufig zu Ängsten und Unsicherheiten der Patienten eventuell homosexuell zu sein. [82] Škodlar et al. (2009) stellen in ihrer Studie fest, dass es Schizophreniepatienten schwer fällt, ein stabiles Selbstwertgefühl und eine stabile Identität zu entwickeln. [82] 50 Wahnvorstellungen über das äußere Erscheinungsbild und das dringende Bedürfnis dieses zu verändern, treten bei schizophrenen Patienten öfter auf. Das kann über das erhöhte Bedürfnis die Frisur zu verändern bis hin zur Selbstkastration führen. [92][93][94][95][96][97][98] In einer Untersuchung von Connolly et al. (1971) wird von einem signifikanten Zusammenhang zwischen Wahnvorstellungen der Geschlechtsänderung und olfaktorischen sowie gustatorischen Halluzinationen berichtet. [99] Dass Patienten Schwierigkeiten mit ihrer geschlechtsspezifischen Identität haben, kommt nicht allein bei schizophrenen Patienten vor, sondern wird auch bei anderen psychiatrischen Krankheitsbildern beobachtet. [89] Schizophrenie und Gender Identity Disorder (GID): Die Bezeichnung Gender Identity Disorder (GID) wird im DSM-IV erklärt als „eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, die durch eine starke und persistente Cross-GenderIdentifikation und anhaltende Beschwerden mit dem aktuellen Geschlecht gekennzeichnet sind“. [46] Die Erhebung der Prävalenz von Gender Identity Disorders gestaltet sich als besonders schwierig. Die Prävalenzraten sind von Land zu Land und von Epoche zu Epoche unterschiedlich. [100] Es kommt bei etwa 1/4 aller schizophrenen Patienten vor, dass während des Krankheitsverlaufs sexuelle Wahnvorstellungen, unter anderem die Wahnvorstellung zum anderen Geschlecht zu gehören, vorliegen. Die Unterscheidung zwischen einer wirklichen GID und einer Wahnvorstellung, zum anderen Geschlecht zu gehören, ist schwer zu treffen. [92][101][102][103] Es ist wichtig vor hormonellen und chirurgischen Eingriffen zur Behandlung der GID andere psychiatrische Erkrankungen auszuschließen. [93] Selten können diese beiden Störungen auch gemeinsam auftreten. [92][93][104][105] Der Unterschied zwischen GID und Schizophrenie ist, dass bei einer Wahnvorstellung der Patient glaubt anderen Geschlechts zu sein (manchmal sogar durch eine „spontane“ 51 Geschlechtsumkehr [10]), während der Patient, der an einer GID leidet, sich als Angehöriger des anderen Geschlechts, aber im falschen Körper gefangen, empfindet. [104] Die Studienlage über Schizophrenie und GID ist dünn. Einen großen Teil machen Fallberichte aus. [92][106] In der Literatur wird immer wieder über Fälle berichtet, bei denen eine vermeintliche GID nach antipsychotischer Therapie nicht mehr vorhanden ist. [107][108] In dem Fallbericht von Manderson et al. (2001) kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die GID als eine seltene Manifestation von Schizophrenie imponiert. [93] In einem Fallbericht von Caldwell et al. (1991) tritt bei einem schizophrenen Patienten eine sekundäre GID auf. [109] Bhargava et al. (2002) berichten von einem Patienten, bei dem eine GID und eine Schizophrenie gleichzeitig vorliegen. [105] Von einem GID-Patienten berichten Campo et al. (2001), der bereits seit Jahren mit Hormontherapie behandelt worden ist und bei dem spontan eine akute schizophrene Episode aufgetreten ist. Im Zuge der darauf folgenden antipsychotischen Therapie verschwinden die psychotischen Merkmale und auch die vermeintliche GID. [103][110] Laut einer Untersuchung von La Torre (1976) gibt es eine Korrelation zwischen der Schwere der Schizophrenie und der GID. Bei ambulanten Patienten treten diese Störungen seltener auf, als bei akuten oder chronischen schizophrenen Patienten. [90] 52 5.3.3 Sexualität, Partnerschaft und Familie bei Schizophrenie Durch die beginnende Deinstitutionalisierung in den 1970er Jahren sind für schizophrene Patienten auch außerhalb von psychiatrischen Anstalten Lebensräume geschaffen worden, was ihnen ein freieres Ausleben ihrer Sexualität ermöglicht hat. [1][86] Es kommt nicht selten vor, dass schizophrene Patienten sexuelle Beziehungen haben. Manchmal entwickeln sich sexuelle Partnerschaften zwischen Patienten während Krankenhausaufenthalten, häufiger entstehen sie aber in ambulanten Betreuungseinrichtungen. Die in einer Beziehung entstehende Nähe kann, gerade bei schizophrenen Patienten, zu Exazerbationen der Erkrankung führen. [10] Unter anderem das Ergebnis einer Untersuchung von Miller et al. (1996), die Patientinnen mit Diagnosen aus dem schizophrenen Formenkreis und Frauen ohne psychiatrische Erkrankungen einander gegenüberstellt, ist, dass Patientinnen mit schizophrenen Störungen während ihres Lebens mehr Sexpartner, aber eher keine aktuellen Partner haben. [80][111][112] Laut Miller et al. (1996) planen schizophrene Patientinnen im Vergleich zu der Kontrollgruppe seltener Schwangerschaften und haben mehr unbeabsichtigte Schwangerschaften, was auch mehr Abtreibungen zur Folge hat. [80] McNeil et al. (1983) untersuchen 88 Patientinnen mit nicht-organischen psychotischen Störungen während ihrer Schwangerschaft. Im Verlauf der Schwangerschaft tendieren schizophrene Patientinnen häufiger zu großen Zweifeln an ihren mütterlichen Fähigkeiten als eine gesunde Kontrollgruppe und Patientinnen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Schizophrene schwangere Patientinnen berichten weiters von mangelnder Unterstützung ihrer Partner und Familien, Nervosität, Panik- und Angstzuständen vor der Geburt und Sorgen über ihren eigenen zukünftigen psychischen Zustand. [113] Bezüglich einer antipsychotischen Behandlung während einer Schwangerschaft herrscht bei Patientinnen und behandelnden Ärzten Unsicherheit. Laut Einarson (2009) wird in einem Großteil der Studien zu diesem Thema die Einnahme von Antipsychotika während der Schwangerschaft als relativ ungefährlich beschrieben. 53 Eine schwangere schizophrene Patientin weiter antipsychotisch zu behandeln, ist laut ihm eine Entscheidung, die individuell zwischen der betroffenen Patientin und ihrem betreuenden Arzt getroffen werden sollte. [114] Frieder et al. (2008) stellen in einer Studie fest, dass schwangere schizophrene Patientinnen ohne medikamentöse Behandlung ein hohes Risiko haben, während ihrer Schwangerschaft einen Rückfall zu erleiden und dadurch die Gesundheit des Kindes (unter anderem durch mangelnde Schwangerenvorsorge) und ihre eigene Gesundheit zu gefährden. [115] Eine Verleugnung der Schwangerschaft in der Psychose kann dazu führen, dass Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere nicht wahrgenommen werden und zum Beispiel die Wehen nicht als solche erkannt werden, wodurch es zu überstürzten Geburten ohne professionelle Unterstützung kommen kann. Das kann im schlimmsten Fall auch zu einer Überforderung schizophrener Gebärender und dadurch zu Neonatiziden führen. [115] [116] In einer Studie von McNeil (1987) werden in einer Gruppe von 88 schizophrenen Müttern 25 von ihnen innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt akut psychotisch. Die Wahrscheinlichkeit einer postpartalen Verschlimmerung der Schizophrenie steht im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Schweregrad der Erkrankung und somit den vorangegangen Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen. 44% der schizophrenen Mütter, die sich über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten in psychiatrischen Kliniken aufgehalten haben, neigen zu einer Exazerbation der Erkrankung. [117] Auch laut einer Untersuchung von Miller (1997) sind schizophrene Patientinnen postpartal besonders anfällig für Exazerbationen der Erkrankung. [86] Bei schizophrenen Müttern können laut Solari et al. (2009) die schizophrene Positivsymptomatik (zum Beispiel Halluzinationen und Wahnvorstellungen die Kinder betreffend) und die Negativsymptomatik (zum Beispiel das nicht erkennen nonverbaler Bedürfnisäußerungen eines Säuglings) der Erkrankung große Herausforderungen für die Erfüllung der elterlichen Pflichten darstellen. [116] 54 Schizophrene Mütter verlieren nach einer Studie von Miller et al. (1996) wesentlich häufiger die Erziehungsberechtigung für ihre Kinder als die Frauen einer gesunden Kontrollgruppe. Die schizophrenen Patientinnen berichten auch eher das Gefühl zu haben, die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erfüllen zu können und beim Aufziehen der Kinder keine Unterstützung zu haben. [80] Solari et al. (2009) sind der Meinung, dass durch einen umfassenden Betreuungsplan, der Familienplanung, Psychoedukation, Psychotherapie und Unterstützung bei der Erziehung beinhaltet, die Prognose für schizophrene Mütter und ihre Kinder wesentlich verbessert werden kann. [116] Schizophrenie, Komorbiditäten und Schwangerschaft: Miller et al. (1996) stellen fest, dass 78,1% der von ihnen befragten schizophrenen Mütter während ihrer Schwangerschaft Substanzmissbrauch betreiben. [80] 55 5.3.4 Sexuelle Gewalt und Traumen bei schizophrenen Patienten Es gibt wenige Studien über schizophrene Patienten als Opfer von Gewalttätigkeiten. [118] Miller et al. (1996) stellen in einer Studie fest, dass schizophrene Patientinnen häufiger Opfer von Vergewaltigungen und Prostitution werden als die psychisch gesunden Frauen einer Kontrollgruppe, und dass sie auch öfter Gewalt während ihrer Schwangerschaft erfahren als diese. [80] In einer Studie von Darves-Bornoz et al. (1995) werden unter anderem 64 schizophrene Patientinnen zum Thema sexuelle Übergriffe und deren Auswirkungen untersucht. 36% der schizophrenen Frauen berichten, Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. Diese sexuellen Übergriffe werden mit Substanzbhängigkeiten, Suizidversuchen und frühem Kontakt zu psychiatrischen Einrichtungen in Verbindung gebracht. Die lebenslange Prävalenz vergewaltigt zu werden liegt bei schizophrenen Patientinnen bei 23%. Eine Vergewaltigung hat bei schizophrenen Patientinnen häufig einen schwereren Krankheitsverlauf und Substanzbhängigkeiten zur Folge. [112] Eine Studie von Elklit et al. (2010) ergiebt, dass sexueller Missbrauch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Psychose signifikant erhöht. [119] Auch in einer Untersuchung von Shevlin et al. (2007) wird festgestellt, dass körperlicher Missbrauch in der Kindheit zu einer gestörten neurobiologischen Entwicklung und somit zu einer psychotischen Erkrankung führen kann, wobei bei männlichen Opfern einer Vergewaltigung eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit an einer Psychose zu erkranken festgestellt wird. [120] 56 5.3.5 Sexuelle Funktionsstörungen, Medikamente und Schizophrenie Psychopharmaka sind wesentlich an der Ausprägung sexueller Störungen (vor allem Libido- und Potenzstörungen) bei psychiatrischen Krankheiten beteiligt. [5][10][121][122][123] Die Dosis der Medikamente scheint auf das Auftreten der Sexualstörungen keinen relevanten Einfluss zu haben. [5][10][127] Generell ist zu sagen, dass Psychopharmaka eine äußerst komplexe Wirkungsweise haben, wobei kaum zu unterscheiden ist, ob die sexuelle Störung durch die Krankheit selbst oder die Therapie bedingt ist. [5][124] Eine prospektive, internationale 27 Länder und 7 655 schizophrene Patienten umfassende Studie von Dossenbach et al. (2005) über die Prävalenz sexueller Funktionsstörungen bei Schizophrenie ergibt, dass laut Patientenberichten 50% von ihnen an sexuellen Funktionsstörungen leiden. [125] Sexuelle Störungen bei schizophrenen Patienten entstehen unter anderem laut Cohen et al. (2010) aufgrund mehrerer Faktoren, häufig einer Mischung aus medikamentöser Therapie und psychiatrischer Erkrankung. [124][126][127][128] Laut einer Studie von Kockott et al. (1996) ist von 37% der Sexualstörungen in nur 19% der Fälle die Schizophrenie allein und in 16% die psychopharmakologische Therapie der alleinige Auslöser. 52,3% der Patienten in medikamentöser Behandlung leiden unter sexuellen Funktionsstörungen, aber nur 25% der Patienten ohne Medikation. Es kann in der prophylaktischen Therapie kein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Auftretens sexueller Funktionsstörungen und der Art und Dosierung der Neuroleptika festgestellt werden. Weiters zeigt sich, dass Psychopharmaka in der akuten und subakuten Phase der Erkrankung auch einen positiven Effekt auf die durch die Krankheit hervorgerufene sexuelle Funktionsstörung haben können. [127] Circa 80% der Patienten, bei denen eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis diagnostiziert worden ist und die nicht medikamentös behandelt werden, leiden an einer sexuellen Funktionsstörung. Im Gegensatz zu mit Psychopharmaka behandelten Patienten, 57 die eher an Erregungs- und Orgasmusstörungen leiden, haben die nicht medikamentös Behandelten meistens Libidostörungen. [127][129][130] Männliche Patienten leiden häufig unter einem verminderten sexuellen Verlangen, erektiler Dysfunktion und unter einer geringeren Orgasmusintensität. [131][132] Weibliche Patientinnen klagen vor allem über eine verminderte Libido, reduzierte Lubrikation und Orgasmusstörungen. [121][133][134] Eine Untersuchung von Aizenberg et al. (1995) vergleicht schizophrene männliche Patienten mit medikamentöser Therapie, ohne medikamentöse Therapie und eine gesunde männliche Kontrollgruppe miteinander, die sich alle in einer festen heterosexuellen Beziehung befinden. Bei den schizophrenen Patienten finden sich generell vermehrt Sexualstörungen und eine Tendenz zu häufigerer Masturbation. Eine Verminderung des Auftretens sexueller Gedanken zeigt sich nur bei der unbehandelten Gruppe. Des Weiteren klagen medikamentös behandelte Patienten darüber, mit ihrem Sexualleben unzufrieden zu sein. [135] In einer Studie von Kockott et al. (1996) über die sexuelle Vergangenheit von Patienten zeigt sich in einer Gruppe von 100 schizophrenen Patienten bei 49% eine sexuelle Störung. (In der gesunden Bevölkerung leiden 10 -15% daran.) Bei Patienten, die mit Neuroleptika therapiert werden, treten sexuelle Störungen wesentlich häufiger auf als bei schizophrenen Patienten ohne Medikation. [127] Eine Untersuchung von Uçok et al. (2007), in der die Prävalenz sexueller Funktionsstörungen anhand von 827 stabilen schizophrenen Patienten, die antipsychotisch therapiert worden sind, erforscht wird, findet bei 52,6% von ihnen sexuelle Funktionsstörungen, bei 54,2% eine verminderte Libido und 41,7% der Patienten klagen über Orgasmusprobleme. [136] Eine Untersuchung von Macdonald et al. (2003) ergibt jedoch keinen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen sexuellen Funktionsstörungen und den eingenommenen Psychopharmaka. [131] Neben der multifaktoriellen Genese der Sexualstörungen wirken Neuroleptika, indem sie die Dopamin-2-Rezeptoren blockieren. Da Dopamin eine sexuell anregende Wirkung hat, kommt es zu einer Verminderung der Libido. [121][126][137][138] 58 Für eine Studie von Zhang et al. (2011) werden 100 männliche schizophrene Patienten, die in einer sexuellen Beziehung leben und über mindestens 6 Monate mit einem Neuroleptikum behandelt worden sind, rekrutiert. In dieser Untersuchung findet sich ein Zusammenhang von Sequenzvariationen des D2-Dopaminrezeptor-Gens mit sexuellen Funktionsstörungen. Der Prolaktinspiegel zeigt sich zwar bei Patienten mit erektiler Dysfunktion bedeutend erhöht, ist aber bei Patienten mit anderen sexuellen Funktionsstörungen unauffällig. Bei Patienten, denen typische Neuroleptika verschrieben worden sind, finden sich häufiger schwerwiegende Sexualstörungen als bei Patienten, die atypische Neuroleptika erhalten haben. [139] Einen bedeutenden Einfluss auf sexuelle Funktionsstörungen durch eine medikamentöse Therapie mit Neuroleptika hat eine daraus folgende Erhöhung des Prolaktins. [1][121] [130] [132] [140] Ein Zuviel an Prolaktin kann in allen Bereichen des sexuellen Reaktionszyklus störend wirken und kann im weiteren Verlauf zu einer Reduzierung von Gonadotropinen, Östrogen und Testosteron führen. [130] In weiterer Folge können sich daraus Menstruationsstörungen und eine Verminderung der Knochendichte entwickeln. [133][141][142] Sexuelle Funktionsstörungen kommen laut einer Studie von Dossenbach et al. (2005) bei schizophrenen Patienten mit einer prolaktinerhöhenden Psychopharmakatherapie wesentlich öfter vor als bei Schizophreniepatienten, die mit Neuroleptika therapiert werden, die den Prolaktinspiegel nicht beeinflussen. [125] Laut einer Studie von Hummer et al. (2004) können die typischen Neuroleptika einen Prolaktinanstieg nach sich ziehen, wobei dieser nicht zwangsläufig mit klinischen Symptomen korreliert. Sollte sich aber eine Gynäkomastie, Galaktorrhoe oder Störungen der Sexualität entwickeln, wird empfohlen, die medikamentöse Therapie zu wechseln. [143][144] Es wird versucht mit neueren Neuroleptika (zum Beispiel Quetiapin, Aripripazol), die eine prolaktinsparende Wirkung haben, dem Problem der Hyperprolaktinämie entgegenzuwirken. [145] 59 Es ist von großer Bedeutung, dass der betreuende Arzt das Thema sexueller Funktionsstörungen bewusst anspricht, weil Patienten selten von sich aus über Probleme in diesem intimen Bereich berichten. Des Weiteren leiden ambulant betreute Patienten wesentlich häufiger unter Sexualstörungen als stationär aufgenommene. [130] Aus einem gestörten Sexualleben können eine subjektive Reduzierung der Lebensqualität und des Selbstwertgefühls sowie Probleme in der partnerschaftlichen Beziehung erfolgen. [121][124][125][140][146][147] Oft resultiert daraus eine mangelnde Compliance der Patienten bezüglich der Medikamenteneinnahme. [124][125][128][147][148] Das Vorkommen von Sexualstörungen bei Schizophreniepatienten wird häufig unterbewertet. [130][140] Bei etwas weniger als der Hälfte der Patienten (40%) wird laut der IC-SOHO study (Intercontinental Schizophrenia outpatient Health Outcomes study) erst nach intensiverer Anamnese eine sexuelle Dysfunktion durch die Medikation festgestellt. [130][140] Sexuelle Funktionsstörungen, Medikamente, Schizophrenie und Komorbiditäten: Da Alkohol- und Drogenabusus bei psychotischen Patienten nicht selten vorkommt, ist unklar, ob Sexualstörungen nicht eher dadurch bestehen und nicht medikamentös induziert sind. [6] 60 5.3.6 Schizophrenie und Sexualdelinquenz Laut einer Untersuchung von Pitum et al. (2008) zeigt sich, dass schizophrene Patienten häufig Probleme damit haben, ihr Begehren auf passende Weise zu formulieren. Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen erhoffter und erreichter intimer Nähe führen und dadurch ein aggressives Sexualverhalten unterstützen. [149] Auch Škodlar et al. (2009) stellen bezüglich des Sexualverhaltens schizophrener Patienten fest, dass diese Probleme damit haben, Nähe und Distanz zu ihren Mitmenschen zu regulieren. [82] Phillips et al. (1999) berichten, dass schizophrene Sexualstraftäter Schwierigkeiten haben, engere persönliche Beziehungen einzugehen. [150] Unter anderem nach einer Studie von Alden et al. (2007) besteht bei schizophrenen Patienten ohne psychiatrische Komorbiditäten keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Sexualstraftaten mit oder ohne aggressive Handlungen. [76][79][151] Auch in einer Studie, die sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstreckt hat, kommen Yaakov et al. (2007) zu dem Schluss, dass die Zahl von durch schizophrenen Menschen ausgeübten Sexualstraftaten im Vergleich zur Normalbevölkerung relativ gering ist. [152] Im Gegensatz dazu besteht unter anderem den Ergebnissen einer Studie von Drake et al. (2004) zufolge möglicherweise ein relevanter Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Sexualdelinquenz. [149][150][153][154] In einer von Fazel et al. (2007) untersuchten Gruppe von Sexualstraftätern (8 495) finden sich bei 4,8% (413) psychiatrische Erkrankungen (Schizophrenie, bipolare Störung, andere Psychosen, organische Störungen) während sich in der Vergleichsgruppe (19 935), die aus der Normalbevölkerung zusammengestellt wird, 1,3% (252) Personen mit psychiatrischen Erkrankungen finden. Von den 4,8% der Sexualstraftäter mit psychiatrischer Diagnose haben 1,5% (130) Schizophrenie, während in der Vergleichsgruppe nur 0,3% (51) Männer an Schizophrenie leiden. [153] Craissati et al. (1992) stellen in ihrer Untersuchung von 11 psychiatrisch kranken Sexualstraftätern einen multidimensionalen Zusammenhang zwischen der Krankheit 61 Schizophrenie und Sexualstraftaten fest. Sie beschreiben, dass die meisten dieser Sexualverbrechen aus einem Impuls heraus erfolgen und mit Gefühlen sexueller Enthemmung verbunden sind. [155] Auch in einer Studie von Pitum et al. (2008) in der von 32 untersuchten schizophrenen Sexualverbrechern 11 von ihnen zum Tatzeitpunkt akut psychotisch sind und sich 13 der Sexualstraftäter in der Prodromalphase der Erkrankung befinden, zeigen sich unterschiedliche Variablen für sexuell übergriffiges Verhalten. Es kann also nicht von einer homogenen Gruppe schizophrener Sexualverbrecher ausgegangen werden. [149] Die Studienautoren gehen ursprünglich davon aus, dass das hohe Maß an sozialer Vereinsamung bei schizophrenen Sexualstraftätern auf die Negativsymptomatik der Erkrankung zurückzuführen ist. Für diese Annahme finden sich in der Studie aber keine signifikanten Daten. [149] Es zeigen sich bei schizophrenen und nicht schizophrenen Sexualstraftätern gleichermaßen Faktoren wie negative Erlebnisse in der Kindheit, soziale Vereinsamung sowie psychosexuelle Aspekte. [149] Diese Studie ergiebt auch, dass die Positivsymptomatik der Schizophrenie nicht mit dem aggressiven Verhalten, sondern in erster Linie mit absonderlichem Verhalten in Verbindung stehen dürfte. Die Autoren berichten von signifikant öfter auftretendem absonderlichen Verhalten schizophrener Sexualstraftäter im Vergleich zur Kontrollgruppe, wie auch von einem wesentlich häufiger vorkommenden Anwenden unmäßiger Gewalt. [148] Es finden sich in der Untersuchung von Pitum et al. (2008) bei schizophrenen Sexualverbrechern weiters neurokognitive Defizite, die zu einem Verlust der Impulskontrolle und Enthemmung sowie zu einer verminderten Aufmerksamkeit und Antriebsverlust führen können. Diese Faktoren können unter Umständen zu einer falschen Auslegung des Verhaltens von Mitmenschen und so zu sexuell übergriffigen Verhaltensweisen führen. [149] Auch in einer Studie von Phillips et al. (1999) findet sich eine neuropsychologische Verschlechterung bei Schizophreniepatienten. Signifikanten Unterschiede zwischen 62 Patienten mit sexuell aggressivem beziehungsweise sexuell unsozialem Verhalten und schizophrenen Patienten, die zu reinen Gewalttätigkeiten neigen, zeigen sich nicht. [150] In einer Studie von Yaakov et al. (2007) werden schizophrene Sexualstraftäter, schizophrene Patienten, die für andere kriminelle Handlungen verhaftet worden sind, und nicht schizophrene Sexualstraftäter miteinander verglichen. Schizophrene Sexualverbrecher sind im Vergleich zur anderen schizophrenen Studiengruppe häufiger verheiratet, haben eher homosexuelle und bisexuelle Neigungen, stehen öfter in einem Arbeitsverhältnis, sind seltener in psychiatrischen Einrichtungen, zeigen mehr Negativsymptomatik und überhaupt einen schwereren Krankheitsverlauf. [152] Weiters zeigen schizophrene Sexualstraftäter in ihrem Verhalten größere Ähnlichkeit mit der Persönlichkeit von Sexualstraftätern als der von schizophrenen Patienten. Von den 36 Sexualstraftaten steht eine in Zusammenhang mit den Symptomen einer akuten psychotischen Episode. In den anderen Fällen wird kein direkter Zusammenhang gefunden. [152] Im Gegensatz zu den schizophrenen Sexualstraftätern, die eher an weiblichen Opfern interessiert sind (83,3%), wählen laut Pitum et al. (2008) die nicht schizophrenen Sexualstraftäter häufiger Männer als Opfer aus (57,9%). Bei nicht schizophrenen Sexualstraftätern findet sich eine größere sexuelle Neigung zu Kindern und Jugendlichen als bei schizophrenen Sexualstraftäter. Bei beiden Sexualstraftätergruppen zeigt sich ein ähnlich hohes Auftreten von Paraphilien. [152] In einer Studie von Smith (2000) über 80 schizophrene Sexualverbrecher, die die Straftaten in psychotischem Zustand begangen haben, wird festgestellt, dass in 49 (61%) der sexuellen Übergriffe die Opfer den Tätern nicht bekannt sind und davor auch kein sozialer Kontakt zwischen ihnen stattgefunden hat. [156] Laut Pitum et al. (2008) sind mit den sexuellen Straftaten in Zusammenhang stehende Wahnvorstellungen und Halluzinationen selten. [149] Im Gegensatz dazu stellen Smith et al. (1999) in einer Studie über 80 schizophrene Sexualstraftäter fest, dass die Hälfte von ihnen Wahnvorstellungen oder Halluzinationen im Zusammenhang mit den Übergriffen haben. [157] 63 In einer Studie von Jones et al. (1992) werden 4 junge männliche schizophrene Patienten untersucht, die versucht haben, Frauen sexuell anzugreifen. Die Studienautoren beschreiben, dass diese Angriffe in einem direkten Zusammenhang mit befehlenden oder auffordernden akustischen Halluzinationen gestanden haben. [158] Schizophrenie, Sexualdelinquenz und Komorbiditäten: Alden et al. (2007) stellen fest, dass bei Patienten mit psychotischen Erkrankungen und komorbiden psychiatrischen Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen oder Substanzmissbrauch eine 6-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie körperlich gewalttätige Sexualverbrechen begehen und ein 3- bis 5-fach großes Risiko, dass sie ohne aggressive Handlungen Sexualstraftaten begehen. [151] In einer Studie von Pitum et al. (2008) imponieren schizophrene Patienten mit komorbidem Substanzmissbrauch bei ihren Straftaten durch Gewaltlosigkeit und impulsive sowie ungeplante Handlungen. Bei schizophrenen Sexualverbrechern mit einer komorbiden antisozialen Persönlichkeitsstörung finden sich signifikant mehr unmäßige Gewaltanwendungen während der Taten. Sie sind weniger empathisch und vor den Übergriffen weniger sexuell gehemmt. [149] Laut einer Studie von Yaakov et al. (2007) zeigen sich bei untersuchten schizophrenen Sexualstraftätern um die Hälfte weniger antisoziale Persönlichkeitsstörungen als bei den schizophrenen Nicht-Sexualverbrechern. [152] 64 6 Resümee Psychiatrische Komorbiditäten wie der Substanzmissbrauch (vor allem Alkohol) und die antisoziale Persönlichkeitsstörung haben einen großen Einfluss auf das aggressive und sexuelle Verhalten schizophrener Patienten. Aggressionen dürften bei schizophrenen Patienten, wie auch in der Normalbevölkerung, durch multifaktorielle Ursachen und komplexe Zusammenhänge entstehen. Es gibt keine neurobiologischen Erkenntnisse, die aggressives Verhalten bei schizophrenen Patienten eindeutig erklären können. Schizophrene Menschen haben häufig Probleme, ein passendes Maß von Nähe und Distanz zu ihren Mitmenschen zu finden. Das kann zu Zurückweisungen und aggressivem Verhalten führen. Ein wesentlicher Grund für die Aggressionen bei schizophrenen Patienten ist, dass diese, weil sie sich durch ihre eigenen Halluzinationen, Psychosen und das Klinikpersonal bedroht fühlen, teilweise aus Panik übertrieben aggressiv handeln um sich selbst zu schützen. Generell dürfte die Qualität der Betreuung schizophrener Patienten bei der Entstehung von Aggressionen eine Rolle spielen. Das Sexualverhalten schizophrener Patienten ist mit dem durchschnittlichen sexuellen Verhalten der gesunden Allgemeinbevölkerung zu vergleichen. Bei der schizophrenen Erkrankung kann es zu einer mangelhaften Ausbildung von Körperbild und Geschlechtsidentität kommen, was bei den Betroffenen zu Unsicherheiten führen kann. Auffallend oft kommt es bei schizophrenen Patienten zu häufigem Partnerwechsel und riskantem Geschlechtsverkehr im Sinne sexuell übertragbarer Erkrankungen. 65 Schizophreniepatientinnen schützen sich kaum vor Schwangerschaften und werden häufig Opfer sexueller Nötigungen, Vergewaltigungen und Prostitution. Die Sexualität psychisch Kranker wird von Ärzten und Patienten noch immer häufig tabuisiert und ist schwer zu erforschen, weil zuerst die Patienten zum Untersucher Vertrauen aufbauen müssen, was einerseits zeitlich sehr aufwendig ist und andererseits sehr von den klinischen Phasen, in denen sich die Patienten gerade befinden, abhängig ist. Schizophrene Patienten leiden häufig unter sexuellen Funktionsstörungen, die zu einem Teil Folgen der Erkrankung sind und zum anderen Teil durch antipsychotische Medikamente induziert werden. Sexuelle Funktionsstörungen sowie ein gestörtes sexuelles Erleben oder Verhalten während einer akuten psychotischen Episode können auch in Partnerschaften zu einem Problem werden. Es muss bei der Behandlung schizophrener Patienten darauf geachtet werden, eher Medikamente mit geringeren sexuellen Nebenwirkungen (zum Beispiel prolaktinsparende Neuroleptika) zu verschreiben, um die Lebensqualität der Patienten sowie deren Compliance zu erhalten. Es ist, wie es in der Psychiatrie häufig vorkommt, ein schmaler Grat zwischen dem Finden der richtigen Dauermedikation und dem Vermeiden von Nebenwirkungen, da jeder Patient unterschiedlich auf die Medikamente reagiert. 66 7 Literaturverzeichnis [1] Schizophrenia: Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in primary and secondary care (update); National Clinical Practice Guideline Number 82 (March 2009) http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG82NICEGuideline.pdf (16.1.2012) [2] Bandura A. (1979) Aggression: Eine sozial-lerntheoretische Analyse. 1. Auflage. Stuttgart [u.a.]: Klett-Cotta [3] Lorenz K. (1995) Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Augsburg: Weltbildverlag [4] Binion R. (1995) Freud über Aggression und Krieg: Einerlei oder Zweierlei? Wiener Vorlesungen im Rathaus, Band 33. Wien: Picus [5] Kockott G. (1995) Sexualität des Menschen. München: Beck [6] Buddeberg C. (2005) Sexualberatung. Eine Einführung für Ärzte, Therapeuten und Familienberater. 4. Auflage. Stuttgart [u.a.]: Thieme [7] Dollard J, Dammschneider W. (1970) Frustration und Aggression. Weinheim [u.a.]: Beltz [8] Selg H, Mees U, Berg D. (1997) Psychologie der Aggressivität. 2. Auflage. Göttingen [u.a.]: Hogrefe [9] Bach GR, Goldberg H. (1974) Keine Angst vor Aggression: wie lerne ich mit Aggression kreativ umzugehen und durch offene Auseinandersetzung meine Partnerprobleme neu zu klären. 2. Auflage. München: Diederichs 67 [10] Tölle R, Windgassen K. (2009) Psychiatrie. Einschließlich Psychotherapie. 15. Auflage. Berlin: Springer [11] Selg H. (Hg.) (1971) Zur Aggression verdammt? : Ein Überblick über die Psychologie der Aggression. Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer [12] Nolting HP. (1989) Lernfall Aggression: Wie sie entsteht – wie sie zu vermindern ist; ein Überblick mit Praxisschwerpunkt Alltag und Erziehung. Hamburg: Rowohlt [13] Hacker F. (1971) Aggression. Die Brutalisierung der modernen Welt. Wien: Molden [14] Berkowitz L. (1989) Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. Psychological Bulletin 106: 59-73. [15] Lischke G. (1972) Aggression und Aggressionsbewältigung: Theorie und Praxis, Diagnose und Therapie. Freiburg [u.a.]: Alber [16] http://downloads.dialoggentechnik.at/Science_Parliament/Info_Aggressive%20Gene.pdf (16.1.2012) [17] Bandura A, Ross D, Ross SA. (1963) Imitation of film-mediated aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology 66: 3-11 [18] http://www.bvdn.de/main/img_neuro.php?SID&datei_id=2969 (16.1.2012) [19] Müller JL. (2006) Neurobiologie der Aggressionsgenese. Psychoneuro 32(1): 16-21 [20] Teicher MH. (2002) Scars that won’t heal: the neurobiology of child abuse. Scientific American 286(3): 68-75 [21] Karlson P, Doenecke D, Koolmann J. (1994) Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler. 14. Auflage. Stuttgart [u.a.]: Thieme 68 [22] Horn F. (2005) Biochemie des Menschen. Das Lehrbuch für das Medizinstudium. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme [23] Caspi A et al. (2002) Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children. Science 297: 851-854 [24] Gerra G et al. (1997) Neurotransmitter - neuroendocrine responses to experimentally induces aggression in humans: influence of personality variable. Psychiatr Res 66: 33-43 [25] Müller JL et al. (2004) Neurobiologie der Aggressionsgenese: Empirische und experimentelle Befunde zu reaktiven Formen der Gewalt. Psychiat Prax 31: 50-51 [26] Sigusch V. (Hg.) (1996) Sexuelle Störungen und ihre Behandlung. Stuttgart: Thieme [27] Haeberle EJ. (2000) Die Sexualität des Menschen. Handbuch und Atlas. 2. Auflage, Hamburg: Nikol [28] Selg H, Glombitza C, Lischke G. (1979) Psychologie des Sexualverhaltens. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer [29] Masters WH, Johnson VE. (1967) Die sexuelle Reaktion. Frankfurt am Main: Akademische Verlagsgesellschaft [30] Förstl H. (Hg.) (2006) Neurobiologie psychischer Störungen. Heidelberg: Springer [31] Bräutigam W, Clement U. (1989) Sexualmedizin im Grundriß. Eine Einführung in Klinik, Theorie und Therapie der sexuellen Konflikte und Störungen. 3. Auflage. Stuttgart [u.a.]: Thieme [32] Kuhl H. (Hg.) (2002) Sexualhormone und Psyche. Grundlagen, Symptomatik, Erkrankungen, Therapie. Stuttgart [u.a.]: Thieme [33] Beier KM, Bosinski HAG, Loewit K. (2005) Sexualmedizin. Grundlagen und Praxis. 2. Auflage. München [u.a.]: Urban und Fischer 69 [34] Möller HJ, Laux G, Deister A. (2009) Psychiatrie und Psychotherapie. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme [35] Naber D (Hg.), Lambert M. (Hg.) (2004) Schizophrenie. Stuttgart [u.a.]: Thieme [36] Falkei P. (2003) Schizophrenie auf einen Blick. Berlin; Wien: Blackwell-Verlag [37] Gaebel W, Wölwer W. (2010) Schizophrenie [Gesundheitsberichterstattung Themenhefte, Mai 2010] Heft 50 – Schizophrenie. http://www.gbebund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gastg&p_aid=&p_knoten=FID&p_ sprache=D&p_suchstring=13064 (17.7.2012) [38] Steinert T. (1998) Aggression und Gewalt bei Schizophrenie: Häufigkeit, Prädiktoren und Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf. Münster [u.a.]: Waxmann [39] Jobe TH, Harrow M. (2005) Long-Term Outcome of Patients With Schizophrenia: A Review. Can J Psychiatry 50: 892-900 [40] Saha S, Chant D, McGrath J. (2007) A Systematic Review of Mortality in Schizophrenia. Is the Differential Mortality Gap Worsening Over Time? Arch Gen Psychiatry 64(10): 1123-1131 [41] Möller HJ, Laux G, Kapfhammer HP. (2005) Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Medizin Verlag Heidelberg [42] Gastpar M. (Hg.) (2003) Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage. Wien [u.a.]: Springer [43] Soyka M et al. (1993) Prevalence of alcohol and drug abuse in schizophrenic inpatients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, January 1; 242(6): 362-72 [44] Wobrock T. (2005) Schizophrenie und Sucht. psychoneuro 31(9): 433–440 70 [45] Nedopil N, Dittmann V, Freisleder EJ, Haller R. (2000) Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung, und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. 2. Aktualisierte und erweiterte Auflage. Thieme [46] DSM-IV: http://allpsych.com/disorders/dsm.html (18.4.2012) [47] Tiihonen J et al. (1997) Specific Major Mental Disorders and Criminality: A 26-Year Prospective Study of the 1966 Northern Finland Birth Cohort. Am J Psychiatry 154: 840– 845 [48] Walsh E et al. (2004) Predicting violence in schizophrenia: a prospective study. Schizophrenia Research 67: 247–252 [49] Moran P, Hodgins S. (2004) The correlates of comorbid antisocial personality disorder in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 30(4):791-802. [50] Wallace C et al. (1998) Serious criminal offending and mental disorder. Case linkage Study. Br J Psychiatry 172: 477–484 [51] Swanson J et al. (2006) A national study of violent behavior in persons with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 63(5): 490-499 [52] Steinert T. (1998) Schizophrenie und Gewalttätigkeit. Epidemiologische, forensische und klinische Aspekte. Fortschr Neurol Psychiat 66: 391 – 401 [53] Haller R et al. (2001) Schizophrenie und Gewalttätigkeit. Ergebnisse einer Gesamterhebung in einem österreichischen Bundesland. Nervenarzt 72: 859 – 866 [54] Lindqvist P, Allebeck P. (1990) Schizophrenia and assaultive behaviour: the role of alcohol and drug abuse. Acta Psychiatrica Scandinavica 82(3): 191–195 [55] Fazel S. (2009) Schizophrenia, Substance Abuse, and Violent Crime. JAMA 301(19): 2016-2023 71 [56] Fazel S. (2009) Risk Factors for Violent Crime in Schizophrenia: A National Cohort Study of 13,806 Patients. J Clin Psychiatry 70(3): 362-369 [57] Steinert T, Bergk J. (2008) Aggressives und gewalttätiges Verhalten. Diagnostik, Prävention, Behandlung. Nervenarzt 79: 359-370 [58] Krakowski M et al. (1999) Course of Violence in Patients With Schizophrenia: Relationship to Clinical Symptoms. Schizophrenia Bulletin 25(3): 505-517 [59] Lindqvist P, Allebeck P. (1990) Schizophrenia and crime. A longitudinal follow-up of 644 schizophrenics in Stockholm. Br J Psychiatry 157: 345-50 [60] Fazel S et al. (2009) Schizophrenia and Violence: Systematic Review and MetaAnalysis. PLoS Med 6(8): e1000120. doi:10.1371/journal.pmed.1000120 (27.7.) [61] Eronen M et al. (1996) Schizophrenia and homicidal behavior. Schizophrenia Bulletin 22(l): 83-89 [62] Arango C et al. (1999) Violence in Inpatients With Schizophrenia: A Prospective Study Schizophrenia Bulletin 25(3): 493-503 [63] Taylor PJ, Bragado-Jimenez MD. (2009) Women, psychosis and violence. International Journal of Law and Psychiatry 32: 56-64 [64] Soyka M. (2011) Neurobiology of Aggression and Violence in Schizophrenia. Schizophr Bull 37(5): 913-920 [65] Hoptman MJ, Antonius D. (2011) Neuroimaging correlates of aggression in schizophrenia: an update. Current Opinion in Psychiatry 24: 100-106 [66] Puri BK et al. (2008) Regional grey matter volumetric changes in forensic schizophrenia patients: an MRI study comparing the brain structure of patients who have seriously and violently offended with that of patients who have not. BMC Psychiatry 8(1): 6 72 [67] Hoptman MJ et al. (2005) Quantitative MRI measures of orbitofrontal cortex in patients with chronic schizophrenia or schizoaffective disorder. Psychiatry Res 140: 133145 [68] Hoptman MJ et al. (2002) Frontal white matter microstructure, aggression, and impulsivity in men with schizophrenia: a preliminary study. Biol Psychiatry 52: 9-14 [69] Amoo G, Fatoye FO. (2010) Aggressive Behaviour and Mental Ilness: A Study of Inpatients at Aro Neuropsychiatric Hospital, Abeokuta. Nigerian Journal of Clinical Practice 13(2): 351-355 [70] Mueser KT et al. (1997) Antisocial personality disorder, conduct disorder, and substance abuse in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology 106(3) :473-47 [71] Brennan PA et al. (2000) Major mental disorders and criminal violence in a Danish birth cohort. Arch Gen Psychiatry 57(5): 494-500 [72] Grann M, Fazel S. (2004) Substance misuse and violent crime: Swedish population study. BMJ 328(7450):1233-1234 [73] Wallace C et al. (2004) Criminal offending in schizophrenia over a 25-year period marked by deinstitutionalization and increasing prevalence of comorbid substance use disorders. Am J Psychiatry 161(4): 716-727 [74] Cohen SI. (1995) Overdiagnosis of schizophrenia: Role of alcohol and drug misuse. Lancet 346: 1541-1542 [75] Räsänen P. (1998) Schizophrenia, Alcohol Abuse, and Violent Behavior: A 26-Year Followup Study of an Unselected Birth Cohort. Schizophrenia Bulletin 24(3): 437-441 [76] Nijman H et al. (2003) Nature and antecedents of psychotic patients’ crimes. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 14(3): 542-553 73 [77] Moran P et al. (2003) The impact of co-morbid personality disorder on violence in psychosis-data from the UK700 trial. British Journal of Psychiatry 182: 129-134 [78] Kelly DL, Conley RR. (2004) Sexuality and Schizophrenia: A Review. Schizophrenia Bulletin 30(4): 767-779 [79] Scharfetter C. (1990) Schizophrene Menschen : Krankheitskonzepte, Geschichte, Diagnostik, Bewußtseinsbereiche und Psychopathologie, Ich-Psychopathologie des schizophrenen Syndroms, Forschungsansätze und Deutungen, Therapiegrundsätze. 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage. München: Psychologie-Verl.-Union [80] Miller MJ, Finnerty M. (1996) Sexuality, pregnancy, and childrearing among women with schizophrenia-spectrum disorders. Psychiatric Services 47: 502-506 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8740491 (25.11.2011) [81] http://www.lsf-graz.at/cms/dokumente/10077889_2172212/42dde092/Karin_Haas.pdf [82] Škodlar B, Nagy MZ. (2009) Sexuality and Psychosis. Psychiatria Danubina 21 (Suppl. 1): 111–116 [83] Cournos F et al. (1994) Sexual activity and risk of HIV infection among patients with schizophrenia. The American Journal of Psychiatry 151(2): 228-232. [84] Ramrakha S et al. (2000) Psychiatric disorders and risky sexual behaviour in young adulthood: cross sectional study in birth cohort. British Medical Journal 321: 263-6 [85] Coverdale JH, Turbott SH. (2000) Risk Behaviors for Sexually Transmitted Infections Among Men With Mental Disorders. Psychiatric Services 51: 234-238 [86] Miller MJ. (1997) Sexuality, Reproduction, and Family Planning in Women With Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 23(4): 623-635 74 [87] Excerpt from: The Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients, adopted by the APA Council of Representatives, February 18-20, 2011. http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines.aspx?item=2 (28.4.2012) [88] http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller (30.4.2012) [89] Štrkalj-Ivezic S, John N. (2009) Gender and Schizophrenia. Psychiatria Danubina 21 (Suppl. 1): 106-110 [90] LaTorre RA. (1976) the psychological assessment of gender identity and gender role in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 2, NO. 2, 1976 [91] Planansky K, Johnston R. (1962) The Incidence and Relationship of Homosexual and Paranoid Features in Schizophrenia. The British Journal of Psychiatry 108: 604-615 [92] Borras L et al. (2007) Delusional "Pseudotranssexualism" in Schizophrenia. Psychiatry 70(2): 175-179 [93] Manderson L, Kumar S. (2001) Gender identity disorder as a rare manifestation of schizophrenia. Aust N Z J Psychiatry 35: 546 [94] Duggal HS et al. (2002) Acute Onset of Schizophrenia Following Autocastration. The Canadian Journal of Psychiatry, Letters to the editor, April 2002 [95] Novak-Grubic V, Tavcar R. (2002) Autocastration and Schizophrenia. Psychiatric Services 2002, April 2002, Letters to the editor [96] Myers WC, Nguyen M. (2001) Autocastration as a Presenting Sign of Incipient Schizophrenia. Psychiatric Services 52: 685-686 [97] Matthew Large et al. (2009) Major Self-mutilation in the First Episode of Psychosis. Schizophrenia Bulletin 35(5): 1012-1021 75 [98] Campo J, Merckelbach H. (2001) Schizophrenia and drastic changes in hairstyle. Decker Ned Tijdschr Geneeskd. 145(39): 1876-80 [99] Connolly FH, Gittleson NL. (1971) The Relationship Between Delusions of Sexual Change and Olfactory and Gustatory Hallucinations in Schizophrenia. BJP 119: 443-444 [100] Michel A et al. (2001) A psycho-endocrinological overview of transsexualism. European Journal of Endocrinology 145: 365-376 [101] Gittleson NL, Levine S. (1966) Subjective Ideas of Sexual Change in Male Schizophrenics. The British Journal of Psychiatry 112: 779-782 [102] Gittleson NL, Dawson-Buttersworth K. (1967) Subjective Ideas of Sexual Change in Female Schizophrenics. The British Journal of Psychiatry 113: 491-494 [103] Commander M, Dean C. (1990) Symptomatic trans-sexualism. The British Journal of Psychiatry 156: 894-896 [104] American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) (pp. 532-538) Washington, DC [105] Bhargava SC, Sethi S. (2002) Transsexualism and Schizophrenia: A case report. Indian Journal of Psychiatry 44(2): 177-178 [106] Mayer C, Kapfhammer HP. (1995) Koinzidenz von Transsexualität und Psychose. Nervenarzt 66: 225-230 [107] Campo J et al. (2003) Psychiatric Comorbidity of Gender Identity Disorders: A Survey Among Dutch Psychiatrists. Am J Psychiatry 160: 1332–1336 [108] Zafar R. (2008) Schizophrenia and gender identity disorder. Psychiatric Bulletin 32: 316-317 76 [109] Caldwell C, Keshavan MS. (1991) Schizophrenia with secondary transsexualism. Can J Psychiatry 36(4): 300-301 [110] Campo J. (2001) Gender identity disorders as a symptom of psychosis. Decker Ned Tijdschr Geneeskd. 145(39): 1876-80 [111] Hariri AG et al. (2011) Risky sexual behavior among patients in turkey with bipolar disorder, schizophrenia, and heroin addiction. J Sex Med 8(8): 2284-91 [112] Darves-Bornoz JM et al. (1995) Sexual victimization in women with schizophrenia and bipolar disorder. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 30: 78-84 [113] McNeil TF et al. (1983) Pregnant women with nonorganic psychosis: Life situation and experience of pregnancy. Acta Psychiatrica Scandinavica, 68: 445-457 [114] Einarson A. (2009) Risks / Safety of Psychotropic Medication use during Pregnancy. Can J Clin Pharmacol 16 (1):e58-e65; [115] Frieder A et al. (2008) The clinical content of preconception care: women with psychiatric conditions. American Journal of Obstetrics & Gynecology suppl. to december 2008: 328-332 [116] Solari H et al. (2009) Understanding and Treating Women with Schizophrenia during Pregnancy and Postpartum. Can J Clin Pharmacol 16 (1) Winter 2009:e23-e32 [117] McNeil TF. (1987) A prospective study of postpartum psychoses in a high-risk group: 2. Relationships to demographic and psychiatric history characteristics. Acta Psychiatrica Scandinavica 75: 35-43 [118] Fitzgerald PB et al. (2005) Victimization of patients with schizophrenia and related disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 39: 169-174 [119] Eklit A, Shevlin M. (2010) Female Sexual Victimization Predicts Psychosis: A CaseControl Study Based on the Danish Registry System. Schizophrenia Bulletin advance Access published May 20, 2010 77 [120] Shevlin M et al. (2007) Trauma and Psychosis: An Analysis of the National Comorbidity Survey (2007). Am J Psychiatry 164: 166-169 [121] Schäfer C. (2007) Psychopharmaka und sexuelle Nebenwirkungen. Riehener Seminar 2007 [122] Westheide J et al. (2007) Sexuality in Male Psychiatric Inpatients. A Descriptive Comparison of Psychiatric Patients, Patients with Epilepsy and Healthy Volunteers. Pharmacopsychiatry 40: 183-190 [123] Hummer M et al. (1999) Sexual disturbances during clozapine and haloperidol treatment for schizophrenia. Am J Psychiatry 156(4): 631-633 [124] Cohen S et al. (2010) Beeinträchtigung der Sexualfunktion durch Psychopharmaka und psychotrope Substanzen. Nervenarzt 81(9): 1129-1139 [125] Dossenbach M et al. (2005) Prevalence of sexual dysfunction in patients with schizophrenia: international variation and underestimation. The International Journal of Neuropsychopharmacology 8: 195-20 [126] Assem-Hilger E, Kasper S. (2005) Psychopharmaka und sexuelle Dysfunktion; Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 6(2): 30-36 [127] Kockott G, Pfeiffer W. (1996) Sexual Disorders in Nonacute Psychiatric Outpatients. Comprehensive Psychiatry 37(1): 56-61 [128] Gabay PM, Fernándes BM, Roldán E. (2006) Sexual behavior in patients with schizophrenia: a review of the literature and survey in patients attending a rehabilitation program. Vertex 17(66): 136-44 [129] Raja M, Azzoni A. (2003) Sexual behavior and sexual problems among patients with severe chronic psychoses. European Psychiatry 18: 70-76 78 [130] Egger C. (2008) Sexuelle Dysfunktionen unter Psychopharmaka. CliniCum neuropsy 3/2008 http://www.clinicum.at/dynasite.cfm?dsmid=94159&dspaid=715665 (25.11.2011) [131] Macdonald S et al. (2003) Nithsdale Schizophrenia Surveys 24: sexual dysfunction. Case-control study. British Journal of Psychiatry 182: 50-56 [132] Smith S, O’Keane V, Murray R. (2002) Sexual dysfunction in patients taking conventional antipsychotic medication. British Journal of Psychiatry 181: 49-55 [133] Kammerahl D, Schöttle D, Huber CG. (2008) Sexualität und Schizophrenie. Eine Übersicht. Z Sexualforsch 21: 165-180 [134] Schöttle D et al. (2009) Sexuelle Störungen bei Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung. Psychiat Prax 36: 160-168 [135] Aizenberg D et al. (1995) Sexual dysfunction in male schizophrenic patients. J Clin Psychiatry 56(4): 137-141 http://psycnet.apa.org/psycinfo/1995-40592-001 (25.11.2011) [136] Üçok A et al. (2007) Sexual dysfunction in patients with schizophrenia on antipsychotic medication. European Psychiatry 22: 328-333 [137] Malik P. (2007) Sexual dysfunction in schizophrenia; Curr Opin Psychiatry 20: 138142 [138] Hartmann U, Rüffer-Hesse C. (2007) Sexualität und Pharmakotherapie. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 50: 19-32 [139] Zhang XR et al. (2011) Sexual dysfunction in male schizophrenia: influence of antipsychotic drugs, prolactin and polymorphisms of the dopamine D2 receptor genes. Pharmacogenomics 12(8): 1127-36 [Epub 2011 Jul 12.] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749219 (25.11.2011) 79 [140] Dossenbach M et al. (2006) Effects of atypical and typical antipsychotic treatments on sexual function in patients with schizophrenia: 12-month results from the Intercontinental Schizophrenia Outpatient Health Outcomes (IC-SOHO) study. European Psychiatry 21: 251-258 [141] Haddad PM, Wieck A. (2004) Antipsychotic-induced hyperprolactinaemia: mechanisms, clinical features and management. Drugs 64: 2291-2314. [142] Meaney AM et al. (2004) Effects of long-term prolactin-raising antipsychotic medication on bone mineral density in patients with schizophrenia. British Journal of Psychiatry 184: 503-508 [143] Hummer M, Huber J. (2004) Hyperprolactinaemia and antipsychotic therapy in schizophrenia. Curr Med Res Opin 20: 189-197 [144] Voderholzer U, Hohagen F. (Hg.) (2009) Therapie psychischer Erkrankungen: State of the Art [2008, 2009 ; DGPPN-Kongress 2008]. 4. Auflage. München [u.a.]: Urban und Fischer [145] Baggaley M. (2008) Sexual dysfunction in schizophrenia: focus on recent evidence. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 23(3): 201-209 [146] Olfson M et al. (2005) Male sexual dysfunction and quality of life in schizophrenia. J Clin Psychiatry 66: 331-338 [147] Cutler AJ. (2003) Sexual dysfunction and antipsychotic treatment. Psychoneuroendocrinology 28(1): 69-82 [148] Rittmannsberger H, Wancata J. (2008) Österreichischer Schizophreniebericht 2008. Linz: Buchplus [149] Pitum SV, Konrad N. (2008) Sexualdelinquenz bei Schizophrenie – eine Vergleichsstudie. Fortschr Neurol Psychiat; 76: 655-661 80 [150] Phillips SL et al. (1999) Sexual Offending and Antisocial Sexual Behavior Among Patients With Schizophrenia. J Clin Psychiatry 60: 170-175 [151] Alden A et al. (2007). Psychotic Disorders and Sex Offending in a Danish Birth Cohort. Arch Gen Psychiatry 64(11): 1251-1258 [152] Yaakov A et al. (2007) Schizophrenia sex offenders: A clinical and epidemiological comparison study. International Journal of Law and Psychiatry 30: 459-466 [153] Fazel S et al. (2007) Severe Mental Illness and Risk of Sexual Offending in Men: A Case-Control Study Based on Swedish National Registers. J Clin Psychiatry 68: 588–596 [154] Drake CR, Pathé M. (2004) Understanding sexual offending in schizophrenia. Criminal Behaviour and Mental Health 14(2): 108-120 [155] Craissati J, Hodes P. (1992) Mentally ill sex offenders: the experience of regional secure unit. Br J Psychiatry 161: 846-849 [156] Smith AD. (2000) Offence characteristics of psychotic men who sexually assault women. Medical Science and Law 40(3): 223-228 [157] Smith AD, Taylor PJ. (1999) Serious sex offending against women by men with schizophrenia: the relationship of illness and psychotic symptoms to offending. British Journal of Psychiatry 174: 233-237 [158] Jones G et al. (1992). Command hallucinations, schizophrenia and sexual assaults. Ir J Psychol Med 9: 47-49 81