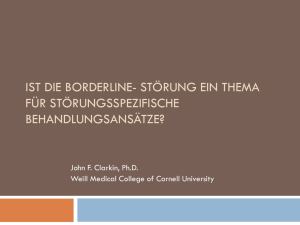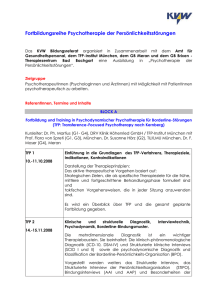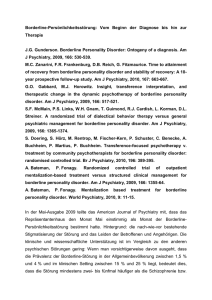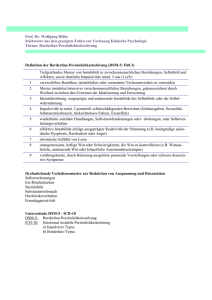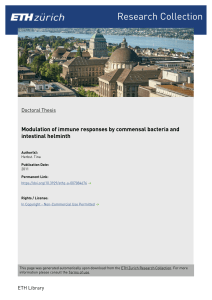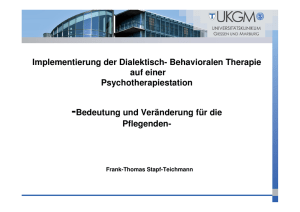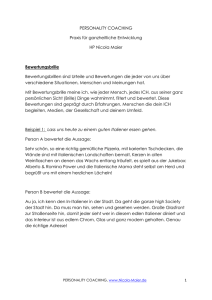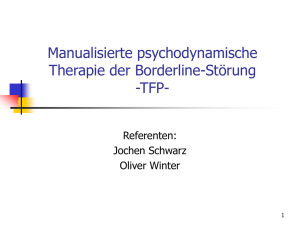Persönlichkeitsstörungen und „Sucht“
Werbung

Psychiatrie Persönlichkeitsstörungen und „Sucht“ Dr. Sven Ringelhahn Rund 9,4 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden an einer Persönlichkeitsstörung.[1] Behandlungsbedürftig werden Persönlichkeitsstörungen allerdings weitaus seltener. Die Altersverteilung lässt eine Tendenz zur Abnahme im Alter erkennen, Stadtbevölkerung und sozial schwächere Schichten sind stärker betroffen.[2] 30 bis 40 Prozent der Poliklinikpatienten und 40 bis 50 Prozent der stationären Patienten erfüllen unter anderem die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung.[3] Starke spezifische Zusammenhänge bestehen zwischen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen (Antisoziale, Borderline-, Histrionische oder Narzisstische Persönlichkeitsstörung) und Alkohol-/Drogenmissbrauch bzw. -abhängigkeit.[4] Das Wort „Sucht“ (germ. suhti-, ahd. suht, suft, mhd. suht) ist nicht verwandt mit „suchen“. Es geht auf „siechen“ (ahd. siechen, mhd. siuchan) zurück, also das Leiden an einer Krankheit. Im offiziellen Sprachgebrauch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) existierte der Begriff Sucht von 1957 bis 1963, bevor er durch Missbrauch und Abhängigkeit ersetzt wurde.[5] Sucht ist nach der WHO ein Zustand periodischer oder chronischer Intoxikation, verursacht durch wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Substanz, der für das Individuum oder die Gemeinschaft schädlich ist.[6] Dem umgangssprachlichen Begriff der Sucht bzw. Suchterkrankung am nächsten kommt der Begriff der stoffgebundenen (legale und illegale Drogen) und nicht-stoffgebundenen Abhängigkeit. Die Diagnose Abhängigkeit soll nach ICD10 gestellt werden, wenn bei einem Patienten irgendwann während der vergangenen Jahre mindestens drei von sechs der folgenden Kriterien vorhanden waren: ■ starker Wunsch oder Zwang, Substanzen oder Alkohol zu konsumieren ■ verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Substanz- oder Alkoholkonsums ■ körperliches Entzugssyndrom ■ Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten Wirkungen der Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich. ■ fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums ■ anhaltender Substanz- oder Alkoholkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (körperlicher, sozialer oder psychischer Art) Der Anteil der Abhängigen in der deutschen Bevölkerung beträgt fünf bis sieben Prozent. Die größte Bedeutung hat mit drei bis fünf Prozent der Bevölkerung, also rund 2,5 Millionen Betroffenen, die Alkoholabhängigkeit. Die Zahl der Drogenab- hängigen beträgt etwa 150.000, die Zahl der Medikamentenabhängigen etwa eine Million. In Kliniken ist mit etwa 15 Prozent ein nicht unerheblicher Teil der Patienten alkoholkrank. Mehr als zehn Prozent aller Patienten in Allgemeinarztpraxen haben ein Alkoholproblem. Persönlichkeitsstörungen und Sucht Menschen mit z. B. einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigen typische Symptome wie frei flottierende Ängste, Zwangssymptome im Sinne überwertiger Ideen, Depressionen, Psychosomatosen, psychotische Symptome, geminderte Impulskontrolle, dissoziatives Verhalten, riskantes Sexualverhalten, Selbstverletzungen, Substanzkonsum und Delinquenz. Diese Merkmale sind eng assoziiert mit (polyvalentem) Substanzkonsum und gehen mit einer erhöhten Suizidrate (fast zehn Prozent) einher. Jeder zweite Patient mit BorderlinePersönlichkeitsstörung hat ein Alkoholproblem und nahezu 40 Prozent weisen ein Drogenproblem auf. Umgekehrt findet sich 751 Medtropole | Ausgabe 20 | Januar 2010 bei fast 15 Prozent der alkoholabhängigen Patienten eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, diese Quote beträgt bei Patienten mit Drogenproblemen 18 Prozent. Historisch nutzten schon die Menschen vor etwa 8.000 Jahren die berauschende Wirkung des Alkohols durch die Zubereitung von Bier oder Wein. Auch die Verwendung von Rauschdrogen existierte im arabischasiatischen Kulturkreis und im mittel- und südamerikanischen Raum (z. B. Opium). Heute gehören Drogen zum Alltag unserer Gesellschaft. So gibt es bei den 15-Jährigen in Hinblick auf Cannabis eine international vorhandene Baseline der Prävalenz von etwa 30 Prozent mit Probierkonsum.[7] In dieser Hinsicht bietet die aktuelle Musikszene mit Amy Winehouse ein instruktives klinisches Beispiel mit mutmaßlichem Borderline-Verhalten und Drogen- und Alkoholexzessen, kombiniert mit einer Magersucht oder Bulimie.[8] Drogen als Mittel der Selbstbehandlung Drogenkonsum hat also grundlegend mit der erlebten Diskrepanz von realem und idealem Lebensgefühl zu tun, die vor allem in der Adoleszenz weit verbreitet ist. Erwünschte Effekte des Drogenkonsums sind unter anderen Entspannung, Euphorisierung, soziale Zuwendung, Stressminderung, allgemeine Anregung oder Minde- 752 rung von Ängsten, das Gefühl, produktiver oder kreativer zu sein, ein gehobenes Selbstwertgefühl. Daher ist es verständlich, dass Drogen bei Persönlichkeitsstörungshintergrund zur Befindens- bzw. Affektregulation genutzt werden. Dabei steht der Schutz vor inneren und äußeren Reizen im Vordergrund. Vor allem die hohe Impulsivität wird durch Substanzkonsum als Form der Selbstbehandlung gedämpft, was ein exzessives Konsumverhalten, sowohl Hochdosis-Konsum als auch riskanten Konsum, begünstigt. Im Verlauf der Suchtentwicklung bekommen mit dem Suchtmittel assoziierte Reize gemäß der klassischen Konditionierung eine Auslöserqualität für das süchtige Konsumverhalten. Zusätzlich kommen allmählich Entzugssymptome auf, die den Drogenkonsum steigern. Die zwei Lernprinzipien – das Lernen am Erfolg (operantes Konditionieren) und das klassische Konditionieren – sind daher auch Leitkonzepte der klassischen verhaltenstherapeutisch orientierten Suchttherapie. Psychodynamisch betrachtet, beruht die BorderlineSymptomatik im Wesentlichen auf unreifen Abwehrmechanismen in Form einer IchSchwäche mit primitiver Idealisierung und Spaltung (Es gibt nur Gut oder Böse). Periodische Omnipotenzgefühle wechseln sich rasch mit Ohnmachtsgefühlen ab. Diese bizarre Erlebnis- und Verhaltensweise beruht auf desintegrierten Selbst- und Objektrepräsentanzen. Das „harmonische“ Selbst-Erleben im Intoxikationszustand ist deshalb der wesentliche Treiber in die Sucht. Der Drogenkonsum kann also als eine spannungsreduzierende, aber auch aktivierende Selbstmedikation verstanden werden. Bei ängstlich akzentuierten Syndromen wird häufiger Cannabis konsumiert, in seltenen Fällen auch Opioide, bei Selbstwertkrisen häufiger Kokain und Amphetamine. Ecstasy, wenngleich an Bedeutung verlierend, wird gelegentlich eingenommen, um das Gefühl der Nähe zu anderen Menschen zu bekommen. LSD wird selten eingenommen und hat dann häufig die Funktion, die Dissoziation des Erlebens zu steigern, d. h. einfach in eine andere, bunte Welt einzutreten. Benzodiazepine und Alkohol werden am häufigsten eingenommen und zum Großteil episodisch konsumiert. Psychiatrie Die Drogeneffekte lassen sich in Wirkungsbereiche unterteilen: ■ Sedierung (wie sie z. B. Opiate und Opioide, insbesondere aber GABA-erge Substanzen wie Benzodiazepine vermitteln) mit dem Ziel der Stressvermeidung ■ Stimulation (z. B. Amphetamine, Kokain) als Steigerung des Selbstkompetenzerlebens ■ „Psycholyse“ im Sinne der psychotischen Dissoziation des Erlebens auf der Suche nach einer anderen Welt (Effekte, die vor allem Halluzinogene wie LSD oder Meskalin bewirken können) In therapeutischer Hinsicht erfordert die komplexe Erlebens- und Verhaltensdynamik von Menschen mit Suchtproblemen vor dem Hintergrund der Borderline-Persönlichkeitsstörung ein besonders umsichtiges therapeutisches Vorgehen. Die Komplexität und Dynamik des komorbiden Störungsbildes erfordern es, die Beziehung zu den Patienten flexibler zu gestalten, als es beim Umgang mit Suchtpatienten ohne diese Störung üblich ist. Spezifisches Therapieangebot Die Therapie einer Störung soll an den Ursachen ausgerichtet sein. Für Persönlichkeitsstörung und Sucht gibt es ein solch spezifisches Behandlungsangebot in Deutschland sehr selten. Deshalb hat die II. psychiatrische Fachabteilung Persönlichkeitsstörungen/Trauma der Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll im Dezember 2009 eine weitere spezifische Station für Patienten mit den Diagnosen „Persönlichkeitsstörung und Sucht“ (PSY 45) eröffnet. Hier kommen in einem multiprofessionellen Team tiefenpsychologische sowie verhaltenstherapeutische Elemente zum Einsatz, um individuell dem Patienten, seinen Problemen und Krisen gerecht zu werden. Ein spezifisches Behandlungskonzept dieser Klientel beinhaltet neben einer Entzugstherapie auch spezifische Therapieverfahren wie Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP), Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) oder Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT). Der motivationale Aspekt der DBT erscheint vor dem Hintergrund häufiger Therapieabbrüche unter spezifischen Therapiebedingungen von besonderer Bedeutung. Übereinstimmend zeigen alle bislang publizierten Studien zur Wirksamkeit der DBT im Vergleich mit anderen Behandlun- gen eine hochsignifikant bessere TherapieCompliance.[10] Neben strukturellen Aspekten (Einbindung in Gruppen- und Einzeltherapie) spielt sicherlich die therapeutische Haltung auch bei diesem Aspekt eine wesentliche Rolle. In der TFP werden die Wahrnehmungsverzerrungen im Hier und Jetzt der therapeutischen Übertragungsbeziehung in Form typischer internalisierter dominanter Objektdyaden identifiziert und bearbeitet. Durch intensives Klären, wiederholtes Aufzeigen von Widersprüchen und metaphorische Deutungen gewinnt der Patient in der Interaktion mit dem Therapeuten an Reflektionsvermögen und Fähigkeiten zur Integration des Selbstkonzepts und des Konzepts von Anderen sowie zur Integration abgespaltener Affekte. Clarkin et al. verglichen in einer randomisierten und kontrollierten Studie an 90 Borderline-Patienten TFP mit der DBT und supportiven Therapie nach Rockland (STP).[11] Alle drei Therapien zeigten Verbesserungen in vielen Bereichen (Depression, Angst, allgemeines Funktionieren, soziale Anpassung). TFP und DBT bewirkten signifikante Verbesserungen der Suizidalität, TFP und STP erreichten Verbesserungen in Teilbereichen von Wut und Impulsivität und nur durch TFP kam es zu einer Verminderung von Reizbarkeit sowie 753 Medtropole | Ausgabe 20 | Januar 2010 von verbalen und indirekten Angriffen. Nur unter TFP ließen sich signifikante positive Veränderungen im Bereich des „reflective functioning“ und des Bindungsstils von einer unsicheren zur sicheren Bindung erreichen.[12] Ein direkter statistischer Vergleich der Therapiearme erfolgte nicht. Die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen und Sucht sollte folgende Aspekte berücksichtigen: ■ Aufklärung über das Störungsbild ■ Klärung der gemeinsamen Behandlungsziele ■ Individueller Behandlungsvertrag ■ Klärung der Behandlungsfoki und Methodik (DBT, TFP etc.) ■ Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Therapeut und Patient für die Therapie ■ Hierarchisierung von Problemen ■ Verbesserung der Überlebensstrategien (Umgang mit Krisen) ■ Verbesserung der Therapiecompliance ■ Verbesserung der Lebensqualität (Sucht, Depressionen, Ängste usw.) ■ Verbesserung der Verhaltensfertigkeiten (Skills) ■ Verbesserung von Erlebens- und Verhaltensweisen, die mit dysfunktionalen Schemata und emotionaler Aktivierung zusammenhängen 754 In den vergangenen Jahren hat sich die Auffassung stabilisiert, dass es zunächst um die Sicherung des Überlebens geht. Wenngleich das oberste Ziel der Suchtbehandlung in der zufriedenen Abstinenz besteht, ist doch je nach Struktur des Patienten und Chronifizierung der Erkrankung eine Modifikation des Therapieziels angezeigt. Dabei sollten psychiatrische/ psychotherapeutische Einzelgespräche und gegebenenfalls Paar- oder Angehörigengespräche erfolgen. Durch enge Zusammenarbeit mit Abteilungen für Abhängigkeitserkrankungen und dem Suchthilfesystem lässt sich die Häufung kontraproduktiver Querüberweisungen verhindern.[12] Kontakt Dr. Sven Ringelhahn II. Fachabteilung Psychiatrie Persönlichkeitsstörungen/Trauma Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll Langenhorner Chaussee 560 22419 Hamburg Tel. (0 40) 18 18-87 19 55 Fax (0 40) 18 18-87 15 36 E-Mail: [email protected] [6] Möller HJ, Laux G, Deister A. Duale Reihe: Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Thieme [7] EBDD 2008: Jahresbericht 2008. Literatur http://ar2005.emcdda.europa.eu/de/ [1] Maier W, Lichtermann D, Klingler T, Heun R. Prevalen- [8] Bandelow B. Celebrities: Vom schwierigen Glück, ces of personality disorders (DSM-III-R) in the community. berühmt zu sein. Reinbek Rowohlt 2007. J. Person. Disord. 1992; 6: 187-96. [9] Koerner K, Dimeff LA. Further data on dialectical beha- [2] Bohus M, Stieglitz RD, Fiedler P, Hecht H, Berger M. vioral therapy. Clin. Psychol. 2000; 7: 104-13. Persönlichkeitsstörungen, Psychische Erkrankungen: Klinik [10] Clarkin JF, Levy KN, Lenzenweger MF, Kernberg OF. und Therapie. München, Jena: Urban & Fischer. Evaluating three treatments for borderline personality [3] Casey PR. The epidemiology of personality disorder. In: disorder: A multiwave study. Am J Psychiatry. 2007; 164: Tyrer P. (ed.). Personality disorders: diagnosis, management 922-8. and course. Wright, London, Boston, Singapore, Sydney, [11] Levy KN, Clarkin JF, Kernberg OF. Change in attach- Toronto, Wellington 1989: 74-81. ment and reflective function in the treatment of borderline [4] Tyrer P, Gunderson J, Lyons M, Tohen M. Extent of personality disorder with transference focused psychothe- comorbidity between mental state und personality disor- rapy. J Cons Clin Psychol. 2006; 74(6): 1027-40. ders. J. Person. Disord. 1997; 11: 242-59. [12] Tretter F. Drogenkonsum und -abhängigkeit bei Bor- [5] Stieglitz RD, Freyberger HJ, Schneider W. Kompen- derline-Störungen. In: Handbuch der Borderline-Störun- dium. Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische gen. Dulz B, Herpertz SC, Kernberg OF, Sachsse U (Hrsg). Medizin. Basel: Karger 2002. Stuttgart, New York: Schattauer (im Druck).