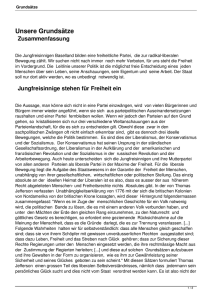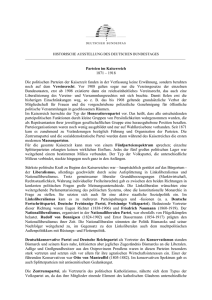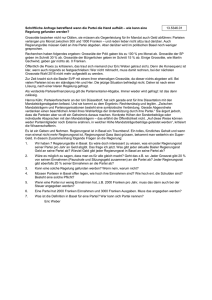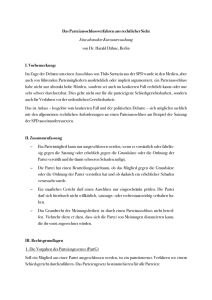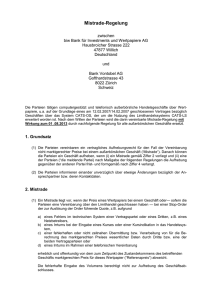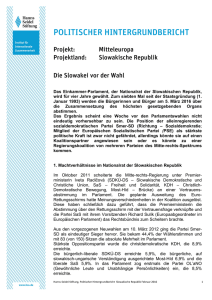Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im
Werbung

Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel: Eine Einführung Uwe Jun 1. Einleitung: Parteienverständnis Da dieser Band die unterschiedlichsten Facetten der Organisationsstrukturen politischer Parteien zum zentralen Gegenstand hat, ist der hier verwendete Parteienbegriff zunächst eindeutig zu bestimmen.1 Dies ist umso mehr erforderlich, als in der Politikwissenschaft unterschiedliche Parteienbegriffe existieren, die von differenten Sichtweisen über Demokratie, Staat, Repräsentation, Konflikt und Konsens oder Legitimität von politischer Herrschaft herrühren (siehe die unterschiedlichen Definitionen bei Katz 2008: 293-297). In jüngerer Zeit ist es gelungen durch Reduktion auf zentrale Merkmale den Parteienbegriff zu vereinheitlichen, wie es etwa in der Definition von Ulrich von Alemann (1995: 9) vorgenommen wird. Dieser charakterisiert politische Parteien als „auf Dauer angelegte gesellschaftliche Organisationen, die Interessen ihrer Anhänger mobilisieren, artikulieren und bündeln und diese in politische Macht umsetzen suchen – durch Übernahme von Ämtern in Parlamenten und Regierungen“. Mit dem Hinweis auf die Verankerung in der Gesellschaft soll zum Ausdruck gebracht werden, dass politische Parteien nicht primär staatliche Akteure sind, sondern als Vermittlungsagenturen neben anderen Organisationen wie Interessenverbänden, Massenmedien, Bürgerinitiativen, Kirchen oder sozialen Bewegungen zwischen Bürgern und dem staatlichen Bereich agieren und somit primär als gesellschaftliche Organisationen zu verstehen sind. Von Interessenverbänden oder sozialen Bewegungen unterscheiden sich politische Parteien durch das Privileg, den institutionellen Kontext selbst bestimmen und damit auf die Handlungsmöglichkeiten eigener und anderer nach politischer Macht strebender Gruppen oder Organisationen einwirken zu können, das heißt nur politische Parteien können als gesellschaftliche Organisationen direkt politische Macht ausüben. Diese resultiert aus der Legitimation, die sie aus der Teilnahme an Wahlen gewinnen. Die Begriffsdefinition von Alemanns soll für den Typus der westlichen Demokratien etwas erweitert werden: Politische Parteien sind hier politische 1 Diese Abhandlung versteht sich insgesamt als eine grundlegende Einführung in allgemeine Merkmale von Parteiorganisationen und soll den nachfolgenden Abhandlungen lediglich einen Rahmen verleihen. Die Überlegungen gehen zurück auf Jun (2004: 58ff.) und sind vollständig aktualisiert worden. 12 Uwe Jun Organisationen, die die Selektion und Rekrutierung des politischen Personals vornehmen, Ziele und Programme zur Durchsetzung im politischen Willensbildungsprozess formulieren, Kommunikation zwischen den politischen Akteuren auf der staatlichen Ebene und den Wählern herstellen, an der staatlichen und gesellschaftlichen Meinungsbildung mitwirken und Entscheidungen im staatlichen Bereich möglichst zu steuern und zu koordinieren, zumindest aber zu beeinflussen versuchen. Gegenüber den Wählern suchen sie nach Unterstützung, ihre Organisationsstruktur dient der Artikulation, Aggregation und Repräsentation von Interessen, Meinungen und Werten womit sie die Funktion der Systemintegration von Gruppen und Individuen erfüllen. Ziel von politischen Parteien ist es, im politischen Wettbewerb ein Machtfaktor zu sein, um auf politische Entscheidungen Einfluss ausüben zu können. Für ein politisches System kommt ihnen auch die Aufgabe zu, Legitimität herzustellen und zu sichern. Das jeweilige politische System bestimmt denn auch ihre Handlungsmöglichkeiten, wobei politische Parteien die Strukturen des politischen Systems mitbestimmen können. Der Wettbewerbsrahmen des Parteiensystems stellt in demokratischen Systemen den machtbegrenzenden und auch machtalternierenden funktionalen Bezugspunkt des Handelns von politischen Parteien dar. Auf der Basis dieses Parteienverständnisses sollen im Folgenden einführend die Grundstrukturen von Parteiorganisationen und die Möglichkeiten des Wandels politischer Parteien skizziert werden. Weitergehende Forschungsansätze zu dieser Thematik behandelt Elmar Wiesendahl im zweiten Beitrag dieses Bandes. An dieser Stelle soll lediglich zunächst ein Rahmen für die unterschiedlichen Ansätze und Facetten der Organisationsforschung zu Parteien, die in diesem Buch zu finden sind, aufgespannt werden. 2. Grundstrukturen von Parteiorganisationen Politische Parteien gelten als spezifische Organisationsform, die sich von anderen Organisationen erkennbar unterscheiden. Als Organisationsstrukturen gelten in der Forschung „Instrumente zur Steuerung des Verhaltens der Organisationsmitglieder“ (Kieser/Kubicek 1992: 10). Das Besondere an politischen Organisationen wie Parteien ist, dass sie Zusammenschlüsse von handelnden Personen sind, die politische Interessen verfolgen und die Durchsetzung von politischen Zielen anstreben. Politische Parteien bilden ein kollektives Denk- und Handlungssystem, welches das Handeln in der Organisation zugleich ermöglicht und begrenzt. Als komplexe Organisation mit unterschiedlichen Handlungs- und Wirkungslogiken (siehe weiter unten) sind die Interessen und Ziele einer Partei in ihrer Komplexität schwer eindeutig bestimmbar und selten homogen (Deeg/Weibler 2005). Diese Komplexität folgt neben der Vielschichtigkeit des Wirkens einer Partei auf mehreren gesell- Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 13 schaftlichen und staatlichen Ebenen und in differenten Institutionen sowie der arbeitsteiligen Aufgabendifferenzierung wesentlich dem Aspekt der Freiwilligkeit. Die Mitgliedschaft beruht weder auf Zwang, noch nur auf berechnendem Engagement oder auf einer auf materiellen Belohnungen basierenden Herrschaftsorganisation; vielmehr wird bei politischen Parteien – zumindest in Demokratien – ein Mindestmaß an ideellen Beweggründen für das Eintreten und die Mitarbeit in Rechnung gestellt. Freiwillige Mitglieder lassen sich nur begrenzt nach rationalen Effizienzkriterien, Leistungsmaßstäben oder zweckrationalen Überlegungen steuern und in ihrem Handeln bestimmen. Die organisatorische Struktur von politischen Parteien ist per se keineswegs gleichförmig, sondern abhängig von organisationsexternen und -internen Faktoren (vgl. Ware 1996: 93ff.; Panebianco 1988: 163ff.). Organisationsexterne Faktoren sind etwa die rechtlichen Grundlagen für das Agieren von politischen Parteien, das Ausmaß und die Ausgestaltung demokratischer Beteiligungsrechte in einem politischen System, das Wahlrecht, die politische Kultur eines Landes, die Struktur des Parteienwettbewerbs, die Finanzierung von politischen Organisationen, das Mediensystem mit seinen Auswirkungen auf die Struktur politischer Vermittlung oder die Bedeutung von ideologischen Konfliktlinien. Als organisationsinterne Faktoren zu nennen sind die Größe der Mitgliederzahl und deren Interessen, innerparteiliche Werte und Normen, formale Regeln, Prioritätensetzungen bei Zielbestimmungen, das innerparteiliche Verständnis von Machtverhältnissen, das Rollenverständnis von Führung, Mitgliedern und Sympathisanten oder die Ausgestaltung der innerparteilichen Kommunikationskanäle. Die interne Struktur wird darüber hinaus bestimmt durch die formalen Verbindungslinien von lokalen, gegebenenfalls regionalen und nationalen Verbänden, durch die Verteilung von Machtzentren, durch das Vorhandensein von vertikalen und horizontalen Subeinheiten und informellen Gruppierungen oder durch das Ausmaß der Bürokratisierung der Organisation. 2.1 Die Komplexität der Strukturen Doch wie sind diese unterschiedlichen Gruppen in einer Partei miteinander verbunden? Entgegen den frühen Studien der Organisationssoziologie, welche sich auf Robert Michels’ „ehernes Gesetz der Oligarchie“ bei der Beschreibung der Organisationsstrukturen von politischen Parteien beziehen, herrscht in der moderneren Parteienforschung ein anderes Bild von der Struktur von Parteien vor: es dominieren Vorstellungen von der „lose verkoppelten Anarchie“ (Lösche 1993) oder von einem „pluralistischen Stratarchiemodell mit mehreren Machtzentren und wechselseitigen Abhängigkeitsstrukturen“ (Niedermayer 1993: 234).2 Parteien konstituieren sich demnach aus einer 2 Samuel Eldersveld (1964: 8) hat das Stratarchiemodell einer Partei ausführlicher entwickelt. Er verweist dabei ausdrücklich darauf, dass Machtdiffusion das wesentlichste Cha- 14 Uwe Jun Vielzahl von Gruppen und Subeinheiten, die nur lose miteinander verbunden sind. Vielfältige, heterogene, partiell sogar möglicherweise sich diametral gegenüberstehende Interessen, widersprüchliche und eigensinnige Rationalitäten und Handlungen lassen Parteien als ein Konglomerat von differenten Organisationseinheiten erscheinen, als ein buntes Kaleidoskop an Organisationswirklichkeiten. Politische Parteien zerfallen diesen Modellen zufolge in eine Vielzahl von unterschiedlichen Gruppen, Flügeln, Faktionen und Subeinheiten, die partiell rivalisieren oder Koalitionen schmieden, um ihre innerparteiliche Durchsetzungsfähigkeit zu erhöhen. Dieses Patchwork von unterschiedlichen Elementen, die zu großen Teilen unverbunden nebeneinander stehen, gibt zusammen mit den nur lückenhaft vorhandenen innerparteilichen Informations- und Kommunikationsnetzwerken den Einzelteilen eine relativ große Autonomie, so dass auch im Hinblick auf Machtverteilungsstruktur und Kontrollspanne eine Partei nicht hierarchisch strukturiert ist, sondern eher einer Stratarchie gleicht, die nur begrenzt von oben steuerbar ist: „The important insight here is that organisational units within parties can possess a significant degree of autonomy, and that simple hierarchical paradigms no longer represent the reality of party structures“ (Carty 2004: 7). Der Stratarchiebegriff lässt deutlich werden, dass sich die innerparteilichen Einflusspotentiale über verschiedene Stufen und Zentren streuen, wodurch Machtkonzentration kaum durchsetzbar ist, denn in diesem pluralistischen Parteienmodell gibt es verschiedene und autonome Subeinheiten, die aufgrund ihrer Autonomie und ihrer Vielfältigkeit eher eine Machtdiffusion begünstigen. Das Stratarchiemodell soll gleichzeitig die Komplexität von politischen Parteien ausdrücken und die komplexen Strukturen der Netzwerke innerhalb der Parteien anschaulich machen. Politische Parteien sind also insgesamt nur begrenzt dazu in der Lage, die auftretenden Ungereimtheiten, Spannungen und Widersprüche organisatorisch aufzuheben. Vier Prinzipien lassen sich ausmachen, welche die Organisation von politischen Parteien strukturieren: Unbestimmtheit, Fragmentierung, lose Koppelung und Hypokrisie. Die Unbestimmtheit zeigt sich unter anderem daran, dass Organisationsziele nur vergleichsweise selten in konkretes Handeln umgesetzt werden, sondern zumeist dem Symbolbereich zugeordnet werden können. Fragmentierung führt zu einer Verselbständigung und Abschottung von Organisationsteilen, die sich in nur geringem Ausmaß in Kooperation niederschlägt. Der Ortsverband gilt als wichtigster Ort des Mitgliederengagements, mit der Folge, dass für den Großteil der Mitglieder die Interaktionsbeziehungen zur übrigen Partei an der Grenze des Ortsverbandes enden. Folge ist eine Zweiteilung von Parteien: Auf Orts- und Kreisebene wird Kommunalpolitik betrieben, in föderativen Systemen wie dem Deutschlands mit Einwirkunrakteristikum des Stratarchiemodells ist: „The general characteristics of stratarchy are the proliferation of the ruling group and the diffusion of power prerogatives and power exercise“ . Vgl. auch Eldersveld (1971) und Wiesendahl in diesem Band. Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 15 gen auf die Landespolitik. Doch die nationale Ebene bleibt das Geschäft der professionellen Politiker, die vergleichsweise abgeschottet von den übrigen Mitgliedern agieren: „Parteien tragen strukturell weiterhin ein Doppelgesicht, insoweit unter einem gemeinsamen Dach die elektoral-professionelle Profipartei und die vereinsartige Mitgliederpartei lose verkoppelt nebeneinander herleben“ (Wiesendahl 2001: 615; vgl. auch Sarcinelli 2007: 132; Schroeder/Neumann in diesem Band). Berufspolitikerpartei und Freiwilligenpartei verfolgen unterschiedliche Organisationsrationalitäten. Wolfgang Schroeder und Arijana Neumann verdeutlichen in ihrem Beitrag, dass innerhalb der Parteien neben der vereinsartigen Mitgliederpartei eine „zweite Säule“ bedeutsam ist, die professionalisiert und effizienzorientiert ist. Die zunehmende Professionalisierung (Borchert 2003; Jun 2009; siehe Sönmez/Probst und Bukow in diesem Band) und Medialisierung (Schulz 2008: 21ff.; Donges 2008 und in diesem Band) und damit einhergehende Prozesse der innerparteilichen Abschottung und Entfremdung der Berufspolitikerpartei (Spitzen der party central office bzw. party in public office) von anderen Segmenten der Organisation hat zur Zentralisierung innerparteilicher Entscheidungsprozesse erheblich beigetragen, zugleich aber Verselbständigungstendenzen unterschiedlicher Gruppen und Ebenen begünstigt. Die lose Kopplung bewirkt einen autonomen Handlungsspielraum der Parteispitzen, den diese für sich nutzen können und in der jüngeren Vergangenheit auch genutzt haben: „The weight of power within the party, as measured by changes in the locus of decision-making, as well as by the distribution of internal ressources – finance, staff, etc. – has moved much more firmly into the hands of the party in public office“ (Katz/Mair 2009: 756; vgl. auch Feser in diesem Band). Die kommunikative Vernetzung der verschiedenen Organisationsteile ist relativ schwach, was Abschottungstendenzen verstärkt. Die kommunikativen Verbindungslinien sind oftmals zu dünn, um unterschiedliche Ideen, Meinungen, Werthaltungen und Interessen der einzelnen Organisationssegmente zu vermitteln und an die Parteiführung zu übermitteln. Die Parteiführung dagegen genießt den Vorteil des leichteren Zugangs zu den Massenmedien, um ihre Informationen an die anderen Organisationsteile weiterzuleiten. Neuere Kommunikationstechniken bieten zwar die Möglichkeiten dieses Gefälle zu verringern, sind aber bislang nur verhalten von den Parteien in dieser Hinsicht genutzt worden: „To date however, there has been more evidence of people at the grass roots using the internet to send messages to those in position of authority than there has been evidence of those in authority actually listening (...) real power will continue to rest with those who frame the questions“ (Katz 2008: 315). Damit verfügt die Parteiführung im Organisationsgefüge einer politischen Partei – insbesondere in Mediendemokratien – über einen erheblichen Vorteil, den sie als Machtressource einsetzen kann. Hypokrisie bringt das ebenfalls zum Ausdruck: die innerparteiliche Diskussion mit ihrer Entscheidungsfindung und praktisches Handeln in Parteien laufen in 16 Uwe Jun nicht wenigen Fällen auseinander. „Hypokrisie heißt für Parteien, nicht nur mit gespaltenen bzw. vielen Zungen zu reden, sondern darüber hinaus auch noch auf die eine Weise zu reden und sich zu entscheiden und auf die andere Weise zu handeln“ (Wiesendahl 1998: 234). Die disparaten Ansprüche, die an Parteien herangetragen werden und die sie insgesamt in ihre Strukturen aufnehmen müssen, bringen die Organisation in Spannungszustände, die sie nicht vollständig lösen können, sondern mit denen sie leben müssen. Modelle, welche die Organisationsstruktur von politischen Parteien ausschließlich zweckgerichtet zum Erreichen bestimmter Ziele verstehen, gehen an der Organisationswirklichkeit vorbei. Weder sind die Ziele von Parteien a priori eindeutig bestimmbar, noch verfolgen alle Akteure innerhalb einer Partei die gleichen Ziele. Das schließt jedoch keineswegs aus, dass primäre Zwecke beziehungsweise Ziele existieren. Häufig genannt werden (siehe beispielhaft Müller/Strom 1999): 1. ein möglichst erfolgreiches Abschneiden bei Wahlen oder Stimmenmaximierung (vote-seeking), 2. bestimmte politische Ziele durchsetzen oder zumindest erhöhte Aufmerksamkeit für einzelne politische Inhalte gewinnen (policy-seeking), 3. Personen in Machtpositionen bringen, das heißt die Übernahme von öffentlichen Ämtern und/oder Patronage zu betreiben (office-seeking). Daher ist bei politischen Parteien eher von einem Zielbündel zu sprechen als von einer eindeutigen Zielgerichtetheit. Welche Ziele dabei durchgesetzt werden können, hängt vom Parteientyp, dem Selbstverständnis einer Partei, von Machtkonstellationen innerhalb der Organisationsstruktur und von der jeweiligen Situation der Partei im Parteienwettbewerb ab. Zielkonflikte sind aufgrund der Heterogenität der Struktur keine Seltenheit. Stimmenmaximierung bzw. das Erreichen eines Wahlsieges hat sich bei den meisten Parteien aber als wichtigste Zielgröße herausgeschält. Bei den wählerorientierten Gruppen innerhalb von Parteien gilt die Organisation primär als funktionale Größe zur Mobilisierung von Wählern und zur Herbeiführung von Wahlerfolgen. 2.2 Der Charakter der Freiwilligkeit Parteien konstituieren eine Struktur ihrer Organisation, um ein Mindestmaß an formellen Regelungen durchzusetzen, welche die Interaktionen ihrer Sympathisanten zumindest partiell regulieren und eine überindividuelle Kontinuität gewährleisten sollen. Die Organisation soll Wirksamkeit im Sinne der Zweckerfüllung und Leistungsfähigkeit im Sinne einer Mitwirkung von potenziellen Sympathisanten gewährleisten. Nicht zuletzt soll die Organisationsstruktur politischer Parteien dazu beitragen Aufgaben wie Zielfindung, Interessenartikulation und -aggregation, Legitimationsbeschaffung, Regierungsbildung und Rekrutierung von politischen Eliten wahrzunehmen, die Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 17 Ansprüche ihrer Sympathisanten zu befriedigen, diese zu integrieren und für jeweils zu bestimmende Zwecke zu mobilisieren. Ist es für den Bestand einer Organisation im Allgemeinen notwendig, Anreize zu entwickeln und diese mit Beiträgen der Individuen in Einklang zu bringen (siehe Bogumil/Schmid 2001: 39), so besteht aufgrund des Aspektes der Freiwilligkeit für politische Parteien die Notwendigkeit ein spezifisches Anreiz- und Gratifikationssystem zu entwickeln, um Sympathisanten für sich zu gewinnen und möglichst dauerhaft an sich zu binden. Schließlich bringen Parteimitglieder Ressourcen wie Zeit, Beitragszahlungen und ihr Sachwissen ein und erwarten entsprechende Gratifikationen dafür (vgl. Heidar 2006: 304; Niedermayer 2009: 95). Bei den Anreizstrukturen ist zwischen kollektiven Anreizen, die sich an alle potenziellen Sympathisanten gleichermaßen richten, und selektiven Anreizen, die nur bestimmte Gruppen von Sympathisanten ansprechen sollen, zu unterscheiden (vgl. Panebianco 1988: 9f.). Unter kollektiven Anreizen zu verstehen sind immaterielle, wie sinnstiftende oder kollektive Identität verleihende, Solidarität und ideologische Gemeinsamkeiten; unter selektive Anreize fallen die materiellen, wobei Macht und Status etwa durch innerparteiliche Ämter oder öffentliche Mandate hierin eingeschlossen sind. Im Idealfall sollte eine politische Partei die Anreizstruktur sorgfältig ausbalancieren: Die Befriedigung individueller Interessen erfolgt primär durch selektive und die Bewahrung organisatorischer Loyalität durch kollektive Anreize. Insgesamt sollen Anreize das Funktionieren der Organisation sichern helfen. Bei der Analyse von Parteiorganisationen sollte also nicht vergessen werden, dass es primär jene Anreize oder individuellen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung sind, die Parteisympathisanten dazu bewegen, sich zur Partei ihrer Wahl zu bekennen. Die ebenfalls organisationsbildenden gesetzten Regeln und Normen, welche die Organisation zumindest partiell strukturieren, können dagegen aufgrund der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft nur eine bedingte Bindungskraft entfalten. Entsprechend können Handlungen der Parteien nur verstanden werden, wenn die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse der Sympathisanten in Rechnung gestellt werden. Eine reine Abarbeitung statutarischer Grundlagen führt meist nicht sehr weit, um die Organisationswirklichkeit von Parteien genauer zu analysieren. Parteien solchermaßen verstanden als organisierte Erfüllungsinstrumente von individuellen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen ihrer Sympathisanten bedürfen einer kollektiven Identität, um die Organisation zusammenhaltende Identifikationsangebote bieten zu können, auf dem Wählermarkt identifizierbar zu sein und überindividuelle politische Ziele nach außen vertreten zu können. Dazu dienen etwa gemeinsame Wertvorstellungen und Ziele, Programme und Symbole, die zwei Funktionen erfüllen: sie konturieren eine Partei für Außenstehende und sie wirken integrierend nach innen, sie binden den einzelnen Sympathisanten in den Aufgabenzusammenhang der Organisation ein. 18 Uwe Jun Sie bieten zudem Wählern Orientierungshilfen zur Strukturierung der Komplexität politischer Erscheinungen an, in besonderer Weise, um eine Wahlentscheidung zugunsten einer einzelnen Partei treffen zu können. Nicht zuletzt aus diesem Grund versprechen Parteien, die Interessen ihrer Sympathisanten zu repräsentieren und in politische Ziele zu transformieren. Dabei berücksichtigen sie überindividuelle Interpretationsmuster, Erfahrungen und Deutungen der Sympathisanten, ohne die das organisatorische Funktionieren von politischen Parteien unvorstellbar ist (vgl. Wiesendahl 1998: 125). Wer aber nun sind die Sympathisanten einer Partei? Grob zu unterscheiden sind Mitglieder und Wähler. Das heißt Parteien repräsentieren sowohl die Interessen, Werte und Meinungen ihrer Mitglieder als auch die ihrer Wähler. Daraus können zwei unterschiedliche Organisationslogiken folgen, nämlich die Prinzipien- oder Mitgliedschaftslogik, die allgemein die Interessen der Mitglieder in den Vordergrund stellt, aber zumeist nur vom Kern der aktiven Mitglieder verfolgt wird, und die Stimmengewinnlogik, nach der möglichst viele Sympathisanten im Sinne von Wählern für eine Partei zu gewinnen sind. Aktive Mitglieder galten als ideologischer als einfache Mitglieder oder Wähler in dem Sinne der Vertretung der Prinzipien und Werte einer Partei. Seitdem instrumentelle Motive beim Beitritt überhand gewinnen, scheint sich diese Differenz abzuschwächen (Spier in diesem Band). Auf der Ebene der Mitglieder können übrigens verschiedene Formen der Mitgliedschaft unterschieden werden: korporative, affiliierte und direkte Mitgliedschaft sowie die Mitgliedschaft in Unterorganisationen (Einzelheiten bei Poguntke 2000: 216). Innerhalb der verschiedenen Mitgliedsformen kann nochmals unterschieden werden zwischen einfachen Mitgliedern, den Aktivisten und der Führung. 2.3 Parteien als Mitgliederorganisationen Mitgliedschaft in einer Organisation bedeutet zunächst das Eingehen einer Beziehung mit dieser Organisation, häufig durch Integration oder Einbindung; bei politischen Parteien wird von Mitgliedern formell der Eintritt erklärt. Mitglieder bekennen im Vergleich zu den Wählern einer Partei nach außen hin eindeutiger ihre politische Haltung. Sie erklären mit ihrem Beitritt ein gewisses Maß an Übereinstimmung mit den Werten und politischen Zielen der von ihnen präferierten Partei. In Westeuropa herrscht bei politischen Parteien das Selbstverständnis der Mitgliederpartei vor mit einem festen und dauerhaften Mitgliederstamm, der als Ressource der Organisation dient (ausführlicher zur Mitgliederpartei Wiesendahl 2006). In Abgrenzung zu Sympathisanten oder Wählern bieten europäische Parteien formell eingeschriebenen Mitgliedern ein größeres innerparteiliches Betätigungsfeld. Nur diese haben die Rechte zur Teilnahme am Auswahlprozess für Kandidaten für öffentliche Ämter (siehe Höhne in diesem Band) und zur Mitbestimmung programmatischer Grundsatzentscheidungen. Die Pflichten Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 19 sind äußerst gering: jeder hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten und darf keiner konkurrierenden Partei angehören. Man kann von einer weitgehenden Voraussetzungslosigkeit der Parteimitgliedschaft sprechen. Das innerparteiliche Betätigungsfeld kann von den Mitgliedern ganz unterschiedlich genutzt werden: mancher sucht eine politische Heimat und eine politische Sinnerfüllung, ein anderer strebt danach, politische Karriereinteressen zu verwirklichen, ein dritter erhofft sich persönliche Vorteile. Manche wollen einfach nur mit dabei sein. Diese Differenzen spiegeln sich in den unterschiedlichsten Ansätzen zur Erklärung der Motivation der Mitglieder, sich an eine Partei zu binden, wider. Oskar Niedermayer (1989: 110ff.; 2009: 97ff.) unterscheidet zwischen expressiven und instrumentellen Bindungsmotiven zu einer Partei. Unter expressiven könnten solche affektiven Bedürfnisse wie Gesinnung, Freundschaft, Status- und Prestigebedürfnisse sowie normative Identifikationsbedürfnisse subsumiert werden. Die Parteizugehörigkeit an sich hat einen „intrinsischen Belohnungscharakter“ (Niedermayer 2009: 97). Das Gemeinschaftserleben steht im Vordergrund ihrer Parteiaktivitäten: Schwerpunkt des Mitgliederengagements bildet der Besuch von Parteiversammlungen, aber auch die Teilnahme an Festen und geselligen Runden. Diese Seite der Parteiorganisation hat einen Vereinscharakter und kann daher als die Vereinsseite des Parteilebens bezeichnet werden. Die in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmenden instrumentellen Bindungsmotive (Klein 2006) dagegen betonen den Mittelcharakter (siehe auch Spier in diesem Band). Die Mitgliedschaft dient als Instrument zur Erreichung bestimmter individueller Zwecke und Ziele, wobei diese in politischinstrumentelle und materielle zu unterscheiden wären. Von materiellen kann dann gesprochen werden, wenn der Einzelne mit der Parteibindung eigene materielle Vorteile verbindet. Politisch-instrumentelle Bindungsmotive sind auf Ziele und Prozesse des politischen Systems bezogen. Zielbezogen ist eine Parteibindung, wenn das Individuum diese zur Unterstützung bzw. Durchsetzung von allgemeinen politischen Anliegen oder gesellschaftlichen Interessen nutzt. Der Einzelne will mit seinem Engagement deutlich machen, welche gesellschaftlichen Zielverwirklichungen er als zentral ansieht und versucht seinen Beitrag zur Lösung der Probleme einzubringen. Wer aus zielbezogenen politisch-instrumentellen Bindungsmotiven einer Partei beitritt, der hat konkret Mitwirkung an der Politikgestaltung im Sinn. Wer eher prozessbezogene Bindungsmotive hat, der will Politik kognitiv verarbeiten, der sucht nach Information, Einsicht und bloßer Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess. Die politisch-instrumentellen Bindungsmotive zielen insgesamt auf Partizipation ab, auf die Übernahme politischer Ämter inner- und außerhalb der Partei, auf den Wunsch nach Mitwirkung bei politischen Entscheidungen, darüber hinaus nach Gestaltung von Politik. Für diese Gruppe der Mitglieder hat eine systematische Aus- und Weiterbildung hohe Rele- 20 Uwe Jun vanz, sichert sie ihnen doch Informations- und erweiterte Handlungsmöglichkeiten (siehe Sönmez/Probst in diesem Band). Entsprechend der unterschiedlichen Beitritts- und Bindungsmotive können die Mitglieder in mehrere Gruppen unterschieden werden, zunächst grob zwischen den einfachen Mitgliedern und den Aktivisten, letztere sind die ehrenamtlich und hauptamtlich Aktiven. Innerhalb der Aktiven kann noch zwischen Idealisten, Karriereristen und Lobbyisten unterschieden werden (siehe auch Wiesendahl 1998). Während erstere häufig prinzipienfeste Anhänger der Ideologie, Programmatik und Konzepte der Partei sind und für diese eintreten, ohne primäres Interesse an einer politischen Karriere zu haben, sind zweite zumindest auch daran orientiert, politische Macht zu erringen, um eine Laufbahn in der Politik mit entsprechender materieller Absicherung einschlagen bzw. fortführen zu können. Diese Unterscheidung ist nicht gänzlich deckungsgleich mit der zwischen Ideologen oder Fundamentalisten – im Sinne einer relativ strikten Bindung dieser an Parteiprogramme und -beschlüsse – und Pragmatikern, da ein Pragmatiker durchaus auch idealistische Werthaltungen im Sinne einer – wenn auch eher pragmatischen orientierten – Durchsetzung der Parteiziele haben und ein Ideologe zumindest partiell auch Karriereinteressen verfolgen kann. Allerdings verlangt Karriere in der Politik größere Anpassungsleistungen, Kompromisse, Konsensorientierung und – insbesondere bei mit einer öffentlichen Wahl verbundenen Ämtern – Mehrheitsfindung, während der an Durchsetzung programmatischer Ziele orientierte Akteur sich diesen Zwängen kaum ausgesetzt sieht. Der Karriererist strebt nach öffentlichen Ämtern, hegt innerparteiliche Aufstiegsambitionen und sieht die Partei als Ausgangspunkt, Handlungsraum und gegebenenfalls Auffangbecken seiner persönlichen Karriereinteressen. Er ist weit mehr ein Einzelkämpfer als der Idealist, der seine Befriedigung im gemeinschaftlichen Erleben und der daraus erwachsenen Sinnstiftung seines Handelns findet. Der Idealist sieht die Partei als Raum für Geselligkeit und Gemeinschaft, er will mit Gleichgesonnenen für seine Ideen, für Parteikonzepte und Programme, für die „gute Sache“ eintreten, die zuallererst seine eigene ist, ohne dass er notwendigerweise unmittelbare persönliche Vorteile daraus ziehen kann. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die kollektive Identität bilden für ihn Basiswerte. Die Idealisten gelten daher bei Verstoß gegen diese Basiswerte als besonders anfällig für Enttäuschungen, bei dauerhaft als frustrierend wahrgenommenen Erfahrungen schwindet ihre Mitarbeitsbereitschaft: „Sie sind soweit loyal, wie sich die Partei in Beschlüssen und Auftreten ihrer Wortführer in Wort und Tat loyal gegenüber Parteizielen erweist“ (Wiesendahl 1998: 166). Ihre Empfindlichkeiten können so weit gehen, dass sie bei abweichendem Verhalten der Parteiführung nicht nur die Mitarbeit verweigern, sondern bei Wahlen auch der eigenen Partei nicht die Stimme geben. Denn ihre Hauptmotivation für ihre Mitarbeit beziehen sie aus dem Einstehen für „ihre“ Politikkonzeption. Daher will der Idealist seine Vorstellungen und die der Partei weitgehend in Einklang sehen oder zumindest die Chance ver- Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 21 spüren, diese in Einklang zu bringen. Ist das nicht der Fall, kann sich die Motivation gegen die eigene Führung wenden. Zurückzuführen ist diese Haltung auch auf ein dezidiert vorhandenes politisches Gegnerverständnis: Zwischenparteiliche Auseinandersetzungen üben eine stark mobilisierende Wirkung auf ihn aus, die noch übertroffen werden kann von innerparteilichen Streitigkeiten um inhaltliche Fragen. Ein Abrücken von der Programmatik oder Konzeption der bisherigen Parteilinie kann als „Verrat an der eigenen Sache“ wahrgenommen werden, was die emotionale Enttäuschung nur größer werden lässt. Da das Gemeinschafts- und das Solidaritätsgefühl der Idealisten Gemeinsamkeiten betonen, interaktive Formen der Verständigung und Vergewisserung bevorzugen, bilden sich häufig enge Beziehungs- und Kontaktnetzwerke zwischen den unterschiedlichen Aktivistengruppen heraus, die mit Abschottungs- und Isolationstendenzen einhergehen. Denn persönliche Vertrautheit und inhaltliche Nähe stärken das Gemeinschaftsgefühl, während fehlende Vertrautheit, das Unbekannte und die Unbestimmtheit sowie die Austragung von Konflikten Gemeinschaftsgefühl untergraben können. Temporär und quantitativ befristet wirken die sogenannten Lobbyisten an der Parteiarbeit mit: Sie sind auf ein berufliches und/oder geschäftliches Fortkommen außerhalb der Politik orientiert und nutzen die Kontaktstrukturen innerhalb der Parteien, um materielle oder sonstige persönliche Vorteile für sich zu erlangen. Sie sind zumeist Interessenvertreter in eigener Sache, können aber auch im Einvernehmen mit Verbänden oder Unternehmen handeln. Deutlich geworden ist, dass die unterschiedlichen Aktivistengruppen ganz unterschiedliche Ziele verfolgen und entsprechend jeweils eigenen Handlungslogiken folgen. Am deutlichsten kann diese Differenz zwischen Idealisten und Karriereristen darin hervortreten, dass die einen mehr Legitimität im Sinne parteiinterner Demokratie einfordern, während die anderen elektorale Effektivität zum primärem Maßstab des Parteihandelns deklarieren. Jedoch unabhängig davon, ob das Ziel sich eher an Inhalten, Karriere oder Patronage orientiert, so sind sie außerhalb der eigenen Organisationsgrenzen realisierbar, wenn die Partei öffentliche Ämter zu vergeben hat. Die Bekleidung öffentlicher Ämter ist in demokratischen Systemen wiederum abhängig von einem Mindestmaß an Wählerstimmen. Um politisch Einfluss entfalten, Inhalte gesamtgesellschaftlich durchsetzen und Karriere in staatlichen Institutionen machen zu können, sind Wahlerfolge erforderlich. Nur mit Hilfe politischer Macht lassen sich weitergehende politische Ziele umsetzen, sie schaffen die Voraussetzungen für die Zielverwirklichung außerhalb der eigenen Partei. In dieser Hinsicht sind politische Parteien „externe Zielverfolgungsorganisationen“ (Wiesendahl 1998: 210). Um Erfolg an der Wahlurne zu haben, sind die unterschiedlichen innerparteilichen Gruppen darauf angewiesen, zumindest bei grundsätzlichen Fragen Kompromisse zu erzielen, Konsensmöglichkeiten auszuloten, sich gegenseitig zu unterstützen und miteinander vor den Wähler zu treten. Die Notwendigkeit von Wahlerfolgen zur Durchsetzung von außerparteilichen Zielen zwingt zu einem 22 Uwe Jun Mindestmaß an Einheit, die zumindest so groß sein sollte, dass nach außen für die Wählerschaft ein konturiertes Bild der Partei erkennbar wird. Neben diesen beiden Hauptgruppen von Aktivisten existiert im Organisationsgefüge einer politischen Partei die weitaus größere Zahl der einfachen Mitglieder, die mit nur einem geringen Aktivismus am Parteileben teilnehmen. Sie unterstützen die Partei finanziell durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden, zeigen aber ansonsten relativ wenig Interesse, sich im Kommunikations- und Interaktionsnetzwerk der Partei zu engagieren. Ihr Aktivitätsgrad kann als nicht nennenswert hoch eingestuft werden. Diese Kategorisierung der Aktivitäten der Mitglieder ist nicht als ein Gegenüber, sondern als ein Kontinuum zu verstehen, mit den lediglich in der Kartei auftauchenden, aber ansonsten nicht am Parteileben teilnehmenden Mitgliedern am einen Ende, über die aktiven, einen erheblichen Teil ihrer Freizeit in der Partei verbringenden Mitglieder bis hin zu den hauptberuflich in der Politik Tätigen am anderen Ende der Skala. Wesentlich ist der Teil der Mitgliedschaft, der aus politisch-instrumentellen Bindungsmotiven heraus Mitglied einer Partei ist, er erfüllt die Funktion der Politikgestaltung als eine der normativ zugeschriebenen Aufgaben von Parteimitgliedern. Weitere Aufgaben von Parteimitgliedern in westlichen Demokratien sollen kurz benannt werden: Funktionswahrnehmungen im Bereich der Parteiorganisation, programmatische Arbeit, Auswahl von Kandidaten für öffentliche Ämter und Wahlkampfunterstützung. Mit ihrer freiwilligen Mitarbeit beschaffen sie Legitimität für die Demokratie und gewährleisten ihre Funktionsfähigkeit, halten sie den Prozess der permanenten politischen Kommunikation zwischen Wählern und Gewählten aufrecht, sind sie verantwortlich für die Rekrutierung und Sozialisation politischen Führungspersonals, beeinflussen sie innerparteiliche Kommunikationsprozesse, insbesondere bei der Programmgestaltung, und mobilisieren die Anhänger der Partei bei Wahlkämpfen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben sichern die Mitglieder der Partei beträchtliche Ressourcen. Als Gegenleistung dafür erwartet zumindest der aktive Teil der Mitglieder die zumindest partielle Berücksichtigung seiner politischen Präferenzen. 2.4 Die Führung von Parteien Die Parteiführung besteht im Wesentlichen aus dem engeren Kreis der Parteieliten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie gegenüber ihrer Partei primär entweder politisch-instrumentelle oder materielle Bindungsmotive im Sinn haben. Innerhalb der Parteielite kann zwischen der Partei in öffentlichen Ämtern („party in public office“) und den Führungsgremien der politischen Parteien in den zentralen Geschäftsstellen und Führungsstäben („party central office“) unterschieden werden, wobei es zwischen beiden Ebenen zumeist starke personelle Verflechtungen gibt (Katz/Mair 2002: 122ff.) Unter der Partei in öffentlichen Ämtern werden die Mandatsträger und gegebenenfalls die Regierungsmitglie- Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 23 der einer Partei subsumiert. Die Führungsgremien der Partei bestehen aus von der Gesamtpartei oder von Parteirepräsentanten gewählten Vertretern. Dazu kommen die leitenden Mitarbeiter in den Parteizentralen, also das hauptamtliche Personal (siehe dazu Bukow in diesem Band). Das primäre Interesse beider Ebenen im Hinblick auf die Parteiorganisation ist durchaus unterschiedlich, was sich aus den differenten Rekrutierungsmechanismen ergibt (vgl. Bukow 2010). Während Mandatsträger und die gewählte Parteiführung durch Wahlen in ihr Amt gelangen, ist das hauptamtliche Personal durch Arbeitsverträge an die Partei gebunden. Bei dieser Gruppe der Parteiangestellten handelt es sich um einen durch längerfristige weisungsgebundene Tätigkeit im dauerhaften Geschäftsbetrieb der Parteiorganisation tätigen Teil der gesamten Funktionärsschaft der Partei. Letztere streben daher primär die Sicherung der organisatorischen Ressourcen an, um ihre Position im Apparat nicht gefährdet zu sehen (siehe aber zu deren Gestaltungsanspruch Bukow 2010). Für die durch Wahlen ins Amt gelangte Parteiführung, für Mandatsträger und Regierungsmitglieder geht es zwar ebenfalls um die Sicherung ihrer politischen Karrieren, sie sind dabei aber auf Wahlen angewiesen und betrachten die Organisation in erster Linie als ein Instrument zur Führung von Wahlkämpfen. Nun greift es entschieden zu weit, sämtliche Personen, die als Parteieliten zu verstehen sind, zur Parteiführung zu rechnen. Für unser Verständnis von Parteiführung sollte ein engerer Führungskreis innerhalb der Parteieliten in Frage kommen, nämlich jener Kreis, der bei innerparteilichen Entscheidungsprozessen im politischen Alltag eine herausgehobene Position inne hat und die Ressourcen besitzt, kurzfristig Entscheidungen zu implementieren, um mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln politische Führung auszuüben. Auf welchen Kreis trifft diese Charakterisierung zu? Wohl nur eingeschränkt auf die hauptamtlich Aktiven, die Parteiangestellten, die fast ausnahmslos der Gruppe der Aktivisten zuzurechnen sind, und nicht selten neben ihrem Beruf in der Partei ehrenamtliche Funktionen ausüben (siehe Bukow 2010). Ihren Beeinflussungsmöglichkeiten im Entscheidungsprozess über das tagtägliche Management der Partei hinaus sind enge Grenzen gesetzt, denn sie sind gegenüber der gewählten Führung weisungsgebunden und können schon allein aus dieser Erwägung heraus nicht als zentrale Entscheidungsträger fungieren. Ausgenommen davon sind lediglich die Spitzenpositionen der Verwaltungsseite einer politischen Partei, etwa die zumeist durch innerparteiliche Wahlen legitimierten Generalsekretäre oder Geschäftsführer, die aufgrund ihrer Wahl und ihrer herausgehobenen Stellung dem engeren Kreis der Parteiführung zuzurechnen sind. Auch die meisten Mandatsträger nehmen im innerparteilichen Entscheidungsprozess eher eine Nebenrolle ein, sie sind zumeist eher in einer Beratungs- denn in der Entscheidungsfunktion. Für einzelne Politikbereiche etwa fungieren sie als Experten, oder sie vermitteln eigene Interessen, Werthaltungen und Meinungen oder die ihrer Wähler- 24 Uwe Jun schaft an die Parteiführung. Auch hier gilt, dass nur Funktionsträger herausgehobener Positionen, wie etwa Fraktionsvorsitzende im nationalen Parlament, direkt zur Parteiführung gezählt werden können. Um aber die Parteiführung exakter bestimmen zu können, kommen wir letztlich nicht ohne die Skizzierung der formalen Struktur einer Partei aus. Komplexe Organisationen benötigen wegen ihrer funktionalen Differenzierung ein Regelungsorgan, das verbindliche Entscheidungen für die Gesamtorganisation fällt. Dieses Regelungsorgan kommt bei auf Freiwilligkeit der Mitglieder beruhenden, demokratischen Organisationen durch Wahl zustande, wie es überhaupt für eine derartige Organisation, wenn sie weitverzweigt und ausdifferenziert ist, notwendig ist, Gremien zu bilden, deren Zusammensetzung bei demokratischen Organisationen im Regelfall durch eine Wahl entschieden wird. Der Bildung von Organen und Gremien liegt in demokratisch verfassten Organisationen das Prinzip der Repräsentation zugrunde, bei politischen Parteien kann unterschieden werden zwischen funktionaler und territorialer Repräsentation. Die politischen Parteien gliedern sich zumeist auf in Orts-, Regionalund nationale Verbände. Der organisatorische Aufbau der Parteien orientiert sich in der Regel am staatlichen und verwaltungsmäßigen Aufbau des jeweiligen politischen Systems, wobei in föderativen Systemen durch die Länder eine zusätzliche formal garantierte Strukturierungsebene hinzukommt (vgl. van Houten 2009). Die Finanzierung der einzelnen Ebenen wird in Gesetzen und den Parteistatuten geregelt (siehe Feser in diesem Band). Der Aufbau der demokratischen Mitgliederpartei ist so organisiert, dass die jeweils untere Ebene Delegierte in die jeweils übergeordnete territoriale Ebene entsendet. Diese sind auf Parteitagen oder in Delegiertenversammlungen vertreten. Um das tagespolitische Management zu gewährleisten und kurzfristige Politikentscheidungen treffen zu können, wird auf jeder Ebene ein Exekutivorgan gewählt, der Vorstand, aus dem unter Umständen noch ein Präsidium hervorgeht. Das Präsidium auf nationaler Ebene kann formal als das oberste Leitungsgremium einer politischen Partei angesehen werden, zumeist geht es aus dem Parteivorstand hervor und ihm gehören in der Regel zwischen 15 und 20 Mitglieder an. Der Parteivorstand auf nationaler Ebene ist das erweiterte Führungsgremium, es ist stärker mit grundsätzlichen Fragen der Politik beschäftigt und überlässt das Tagesgeschäft häufig dem jeweiligen Präsidium. Gewählt wird der Vorstand in vielen Fällen vom Parteitag oder seltener einer Mitgliedervollversammlung, noch seltener von einem dazwischen geschalteten Gremium, wie etwa dem Parteirat. In den Parteistatuten ist in aller Regel der Parteitag oder die Mitgliederversammlung formal der Souverän, der alle grundsätzlichen politischen Entscheidungen einer Partei zu treffen hat. Die Parteiführung erhält vom Parteitag ihre notwendige Legitimation, sowohl was ihre personelle Zusammensetzung als auch ihre inhaltliche Politik betrifft. Um eine größere Repräsentation zwischen den Parteitagen zu gewährleisten, wird bei einzelnen Parteien noch ein Gremium eingerichtet, in Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 25 dem alle relevanten innerparteilichen Gruppierungen (siehe funktionale Repräsentation) sowie die maßgeblichen regionalen Gliederungen vertreten sind, häufig Parteirat oder nationaler Ausschuss genannt. Es dient der Koordination der verschiedenen Organisationsebenen und der Festlegung der Grundlinien der Politik im Sinne einer Beratung der Parteiführung. Dessen Mitglieder werden nach territorialen und funktionalen Kriterien ausgewählt. Eine politische Partei ist nicht nur vertikal in verschiedene regionale Gliederungen aufgeteilt, sondern auch horizontal durch formelle und informelle Gruppierungen. Formelle Gruppierungen sind zumeist in einzelnen Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen oder Vereinigungen organisiert, sie artikulieren und aggregieren in der Regel einzelne Interessen innerhalb der Partei, wie die von Arbeitnehmern, Selbständigen, Frauen, ethnischen Minderheiten, jungen Menschen, Senioren oder einzelnen Berufsgruppen. Diese Gruppierungen sind in den meisten Fällen formal in den Statuten der Parteien verankert, haben Rechte und nehmen Pflichten wahr; ihre Repräsentation in den verschiedenen Leitungsgremien wird meist sichergestellt. Daneben gibt es informelle Strömungen innerhalb einer politischen Partei, sogenannte Faktionen (siehe Trefs 2006; Köllner/Basedau 2006; Boucek 2009), die sich um Personen, politische Positionen oder gesamtgesellschaftliche Konzeptionen gruppieren. Ihre Repräsentation in den Leitungsgremien hängt von ihrer Stärke (gemessen etwa am Einfluss zur Parteiführung, Mitgliedergröße, Durchsetzungschancen eigener Positionen oder Konzeptionen) in der Partei ab. Formale Repräsentationsgarantien haben sie in der Regel nicht, sie haben sich aber in der Vergangenheit durch eigene Stärke, Absprachen oder gegenseitige Vereinbarungen mit anderen Gruppierungen Leitungspositionen gesichert. Der informelle Charakter besagt keineswegs, dass die Mitglieder nur lose miteinander verbunden sind. Vielmehr haben auch diese Strömungen gelegentlich klar herausgebildete, zum Teil komplexe Strukturen mit unterschiedlichen Machtzentren bis hin zu Führungsansprüchen in der Gesamtpartei. Weiterhin existieren bei politischen Parteien mehr oder minder enge Verbindungen zu Vorfeldorganisationen, die mit der Partei assoziiert sind und die in einzelnen Fällen auch in der Partei auf der Basis funktionaler Repräsentation vertreten sind (siehe dazu ausführlicher Poguntke 2006). Beispielhaft für einen vergleichsweise starken Einfluss einer solchen Organisation stehen die Gewerkschaften in der britischen Labour Party, die bis in die 1990er Jahre hinein den Parteitag dominierten und auf den Vorstand der Partei erheblichen Einfluss ausübten. Die Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, dass Parteien aufgrund ihrer Heterogenität, Fragmentierung und der an sie gestellten innerparteilichen Repräsentativitätsanforderungen vor keiner leichten Aufgabe stehen, ein Führungsgremium zu etablieren, das einerseits effizient arbeiten kann, andererseits dem Gedanken der angemessenen Repräsentation der unter- 26 Uwe Jun schiedlichen regionalen und funktionalen Gruppierungen nachkommt. Denn – wie schon erwähnt – sollte ein Führungsorgan von der Anzahl der Personen her betrachtet klein genug sein, um effiziente Entscheidungsprozesse durchführen und die daraus hervorgehenden Entscheidungen durchsetzen zu können. Daher ist „die Zusammensetzung des Präsidiums (...) normalerweise nicht durch Repräsentationsgarantien eingeengt“ (Poguntke 2000: 110) und eher als ein Forum für Aushandlungsprozesse der unterschiedlichen Strömungen der Parteieliten (vertikal wie horizontal) anzusehen. Dies wiederum kann zur Folge haben, dass nicht alle Führungspolitiker einer politischen Partei im Präsidium zu finden sein müssen und nicht alle Präsidiumsmitglieder zum engen Kreis der Führungselite zählen. Im Präsidium werden tagespolitische Aktivitäten formal bestimmt und die Parteigeschäfte koordiniert. Die Bedeutung eines Gremiums im innerparteilichen Machtgefüge ist demnach nicht nur an seinen formalen Kompetenzen festzumachen, sondern auch nach der Machtposition der in diesem Gremium vertretenen Personen. Zudem können demokratische Mitgliederparteien schwerlich zentral beherrscht werden. Die genaue Lokalisierung der Macht in Parteien ist daher im Einzelfall vorzunehmen. Um dennoch begründet einen engeren Kreis benennen zu können, werden zur Parteiführung neben dem Parteivorsitzenden, das Präsidium, wichtige Vorstandsmitglieder und einflussreiche Berater des Parteivorsitzenden gezählt, sofern sie der Partei angehören. Letztere aufgrund der Beobachtung, „dass gerade auf der Leitungsebene auf der Basis von ausgewählten Kontakten und nicht auf der Basis komplexer, ausgearbeiteter Vorlagen der Informationsverarbeitung entschieden wird“ (Luhmann 2000: 254). Als enger Kreis der Führungselite, diejenigen, die in politischen Parteien zentrale Entscheidungen vordeterminieren, kann bei Parteien als lose verkoppelten Anarchien analog ein strategisches Zentrum einer Partei, das die Personen umfasst, die strategisch relevante Positionen im Parteiapparat oder in staatlichen Institutionen besetzen, identifiziert werden. Dieses besteht idealiter aus drei bis fünf Personen, die „mit einem gestaffelten System verbunden (sind), von dem die ihnen unmittelbar zugeordnete Ebene („Vertraute“) von besonderer Bedeutung ist“ (Raschke 2001: 25f.). 2.5 Wer wählt eine Partei? Bei den Wählern einer Partei lässt sich grob zwischen zwei Gruppen unterscheiden: den Stammwählern und den Wechselwählern. Für beide Begriffe existieren in der Politikwissenschaft keine eindeutigen (Stammwähler) beziehungsweise mehrdeutige Definitionen (Wechselwähler), was auch auf die wenig vorhandene Literatur zum Thema zurückzuführen ist. Einigkeit herrscht darin, dass sich der Stammwähler im Gegensatz zum Wechselwähler durch eine relativ starke Loyalität gegenüber seiner Partei beim Wahlakt auszeichnet. Der makrosoziologische Ansatz der „Columbia-School“ proklamiert eine enge Bin- Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 27 dung zwischen der Mitgliedschaft in sozialen Großgruppen und der Parteiloyalität: Bestimmte soziale Gruppen fühlen sich durch eine politische Partei repräsentiert und orientieren sich daran beim Aufbau von Loyalitäten. Durch die Mitgliedschaft in sozialen Milieus erfolgt eine Anlehnung des Individuums an politische Konfliktlinien, in dessen Gefolge sich langfristige Loyalitäten der einzelnen Milieus zu einer politischen Partei ergeben. Nach dem sozialpsychologischen Konzept der Parteiidentifikation hat der Stammwähler eine stabile, positive psychische Beziehung zu seiner Partei, die mit einem hohen Grad an Parteiidentifikation gekennzeichnet werden kann und bei Wahlen in der Stimmabgabe zugunsten seiner Partei ihren Ausdruck findet. Parteiidentifikation ist also eine längerfristige, gefühlsmäßige Bindung des Individuums an eine bestimmte Partei. Sie konturiert in einem Individuum Kontinuität und Konsistenz politischer Einstellungen und Verhaltensweisen. Je stärker die Einstellungen und Werthaltungen des Individuums subjektiv mit den von ihm seiner Partei zugeschriebenen Positionen, Konzepten und Argumenten korrelieren, desto höher ist seine Parteiidentifikation. Im stärksten Fall liegt Deckungsgleichheit vor: der Wähler übernimmt die Positionen und Argumente der Partei und entwickelt so ein zwischen ihm und der Partei konsistentes und kohärentes Einstellungssystem. Parteiidentifikation bewirkt somit eine Reduktion politischer Komplexität und eine symbolische Orientierung in der komplexen politischen Struktur: „Für den einzelnen Wähler wirkt die Identifikation mit einer politischen Partei, die einen Bezugspunkt für sein politisches Denken, Fühlen und Handeln liefert, nicht nur als ein Mittel zur Senkung von Informationskosten, sondern auch als eine Art Leuchtfeuer auf politischer See“ (Falter 1977: 478). Die Identifikation mit und Loyalität gegenüber einer politischen Partei kann also als „simplified decisions and information shortcuts“ (Norris 1997: 77) betrachtet werden. Abhängig ist die Identifikation vom Grad des Vertrauens in die Partei, das heißt Parteiidentifikation ist auch als Vertrauensvorschuss zu verstehen, eine Art Kapital der Parteien, das ihre politische Handlungsfreiheit erhöht, da nicht jede Fehlleistung vom Wähler mit Sanktionen belegt wird. Allerdings ist das Vertrauen dauerhaften Erwartungsenttäuschungen gegenüber nicht resistent. Auch können externe Einflüsse Parteiidentifikation unterminieren und Loyalitätsentzüge bewirken oder Umorientierungen stimulieren. Die Basis für Parteiidentifikation entfällt, wenn die präferierte Partei in der subjektiven Bewertung des Wählers nicht besser abschneidet als andere Parteien (Alt 1984: 310f.). Folge einer Unzufriedenheit mit oder Entfremdung gegenüber seiner Stammpartei ist die Wahl einer anderen Partei oder das Fernbleiben von der Wahlurne, er wird somit zum Wechsel- oder Nichtwähler. An die Stelle von Parteiidentifikation können dem sozialpsychologischen Modell zufolge dann beim Wahlverhalten die Issue- oder Kandidatenorientierung treten. Rational-Choice Ansätze weisen zu Recht darauf hin, dass die Wahlentscheidung des rationalen Wählers sich am perzipierten oder antizipierten Er- 28 Uwe Jun gebnis der Politik bestimmter Parteien oder Kandidaten orientiert. Dem Aspekt der zugeschriebenen Problemlösungskompetenz von Parteien und Kandidaten kommt demnach eine besondere Bedeutung zu, zumal bei sinkender Parteiidentifikation. Der typische Wechselwähler verfügt über ein relativ geringes Maß an Parteiidentifikation, die Wahlentscheidung wird stets zur Disposition gestellt. Kandidaten- und Issue-Orientierung spielen eine größere Rolle als beim Stammwähler. Er ist bereit, seine einmal getroffene Wahlentscheidung stets zu revidieren. Einhellig festgestellt wird jedoch, dass es in den letzten 15 Jahren aufgrund sozialstruktureller und medialer Wandlungsprozesse in westlichen Demokratien zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Wechselwähler und zu einem erheblichen Rückgang von Stammwählern einer Partei gekommen ist (siehe beispielhaft Katz/Mair 2009: 758). Die Parteiidentifikation ist in nahezu allen etablierten Demokratien erkennbar deutlich zurückgegangen und nicht wenige Wähler betrachten politische Parteien nicht mehr als Repräsentanten ihrer Meiningen, Interessen und Werte (siehe z.B. Siavelis 2006; Katz/Mair 2009). 3. Wandel und Erfolgsbedingungen von Parteien Die Fragen, warum und mit welchen Mitteln politische Parteien ihre Organisationsstruktur, ihre programmatische Ausrichtung oder ihre Strategien verändern, um weiterhin als relevanter Akteur im Parteienwettbewerb zu gelten, sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Hervorzuheben sind dabei im Wesentlichen zwei sich eher ergänzende, denn widersprechende Ansätze: der aggregierte entwicklungsgeschichtlich-parteiensystematische Ansatz (siehe beispielhaft Kirchheimer 1965; Panebianco 1988; Katz/Mair 1995 bzw. 2009; Jun 2004) und der individuell-konzeptionelle, organisationstheoretische Ansatz (Kitschelt 1994; Harmel/Janda 1994; Harmel et al. 1995; Harmel 2002; Wiesendahl in diesem Band). Während der erste Ansatz Parteihandeln in den Gesamtkontext der Entwicklung sozialer und politischer Systeme stellt, hebt letzterer primär auf die Autonomie von Parteien als Organisationen ab. Von einem Wandel wird dann gesprochen, wenn das öffentliche Erscheinungsbild einer politischen Partei erkennbar verändert worden ist, sichtbar etwa an programmatischen Entwürfen, politischen Zielen, organisatorischen Strukturen oder Kommunikationsstrategien. Für den Wandel werden entweder parteiinterne oder -externe Erwägungen und Argumente in den Mittelpunkt der Suche nach Gründen des Parteienwandels gestellt, wobei externe Einflüsse häufig als Katalysator für Parteienwandel wirken (vgl. Lawson/Poguntke 2004). Unter externen Ursachen werden solche subsumiert, die außerhalb der Parteien, also in deren Umwelten zu finden sind; als interne gelten Veränderungen innerhalb der Parteien selbst, wie der Wechsel der Par- Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 29 teiführung oder eine Verschiebung der innerparteilichen Mehrheitsverhältnisse zugunsten einer parteiinternen Koalition (sogenannte dominante Koalition). Zumindest drei zentrale Ursachen für Parteienwandel haben sich als besonders bedeutsam erwiesen: der Wechsel der Parteiführung, der Wechsel der dominanten Koalition innerhalb einer Partei oder externe Stimuli in Form von Veränderungen der Umwelten von Parteien (siehe Harmel/Tan 2003; siehe auch Stroh in diesem Band). Parteiinterne Akteure können Initiatoren von Wandlungsprozessen sein, ohne dass Umwelteinflüsse unmittelbar ihr Handeln leiten. Veränderungen der Umwelten wirken sich dagegen auf Parteien nur aus, wenn sie von innerparteilichen Gruppierungen oder der Parteiführung rezipiert, aufgenommen und verarbeitet werden. Die parteiinternen Akteure fungieren in diesem Fall als Gestalter des primär von Umwelteinflüssen ausgehenden Wandels. Die Wahrscheinlichkeit eines Parteienwandels ist dann am höchsten, wenn externe Ursachen zusammenfallen mit internen Wandlungsprozessen. In den meisten Fällen ist der Parteienwandel zurückzuführen auf die interne Rezeption und Bearbeitung der Veränderungen der Umwelten. Abbildung 1: Strategiefähigkeit politischer Parteien Programmatische Orientierung Inhaltliches Profil Identität Strategiefähigkeit Strategisches Zentrum Organisation Kommunikation Quelle: in Anlehnung an Raschke (2001). Image 30 Uwe Jun Aufgrund der Parteienkonkurrenz und der öffentlichen Rechenschaftspflicht ihres Handelns kommen politische Parteien nicht umhin, zentralen Veränderungen ihrer Umwelten aufgeschlossen gegenüber zu sein und als lernende Organisationen Beweglichkeit und Veränderungswillen zu demonstrieren, um nicht erheblichen Legitimationsverlust zu erleiden oder im Konkurrenzkampf deutlich an Boden zu verlieren. Insbesondere langfristigen Trends können sich Parteien nicht entziehen, wenn sie auf dem Wählermarkt oder als Politikgestalter erfolgreich agieren wollen. Voraussetzung von intentionalen Wandlungsprozessen politischer Parteien ist ihre Fähigkeit, Strategien zu entwickeln und zu implementieren. Strategien sind mittel- oder langfristig angelegte, situationsübergreifende Regelsysteme oder Kalküle, bei denen eine zweckrationale Beziehung zwischen Zielen und Mitteln angenommen wird und deren Zugrundelegung auf einer Erfolgsorientierung basiert (zum Strategiebegriff Raschke/Tils 2007: 127ff.). Mit der Entwicklung von Strategien und ihrer Implementierung versuchen politische Parteien, Wandlungsprozessen in ihren Umwelten erfolgreich zu begegnen und ihre komplexen Beziehungen zu ihren Umwelten im Hinblick auf ihre Zielverwirklichung zu steuern. Sie sind auch als Management von Ungewissheiten zu charakterisieren, da die Organisationsumwelten von Parteien für diese prinzipiell durch Unsicherheit gekennzeichnet sind. Politische Parteien können nur dann als strategiefähig gelten, wenn sie ein strategisches Zentrum aufbauen, da sie als Gesamtorganisationen aufgrund der fragmentierten Organisationsstrukturen ansonsten kaum steuerungsfähig sind und strategisch betrachtet in einzelne Strategieelemente zerfallen. Ein solches informelles strategisches Zentrum besteht idealiter aus drei bis fünf individuellen Akteuren, die aus strategisch relevanten Positionen in Regierung, Parteioder Fraktionsführung heraus agieren. Dieses strategische Zentrum ist eingebunden in ein System von Beratern und umgeben von den Spitzengremien der Partei. Sie beraten, diskutieren und beschließen die Reaktionen der Partei auf Umweltveränderungen, legen gemeinsam Strategien fest, aus denen sich der jeweilige politische Standort der Partei im Parteienwettbewerb und die Ziele näher bestimmen lassen. Jedoch agiert das strategische Zentrum nicht im luftleeren Raum. Strategiefähigkeit wurzelt in der Partei als Gesamtorganisation, wenn sie auch in ihrer letztlichen Ausprägung sehr häufig ein Produkt von Parteieliten ist. Diese bestimmen zunächst aufgrund ihrer formalen Position innerhalb der Partei und als Hauptverantwortungsträger gegenüber den Medien und gegenüber der Wählerschaft das Handeln der Partei. Durch die Medialisierung und Professionalisierung von Politik wachsen ihnen aufgrund der äußerlich sichtbaren Vertretungsmacht nach außen, aber auch nach innen, die sie gegenüber der Gesamtorganisation eingenommen haben, Machtressourcen zu. Schließlich erbringen sie gegenüber der (Medien-)Öffentlichkeit eine Orientierungsfunktion mit unverkennbaren Wirkungen auf das Außenbild der Partei und organisieren in öffentlichen Institutionen und Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 31 den Geschäftsstellen das alltägliche Politikgeschäft oberhalb der lokalen Ebene. Die Partei als Gesamtorganisation kann daher die jeweiligen Entscheidungen des strategischen Zentrums nur unter Inkaufnahme der Reduktion von Erfolgschancen im Parteienwettbewerb in Frage stellen, da von politischen Parteien ein recht hohes Maß an Kohärenz des Auftretens erwartet wird, wie zahlreiche Beispiele von Misserfolgen bei Wahlen von in sich uneinigen Parteien aufzeigen. Bislang haben Wähler und Öffentlichkeiten höchst selten öffentlich ausgetragene innerparteiliche Kontroversen belohnt. Die Parteiorganisation sollte also gegenüber dem strategischen Zentrum ihre vorhandenen Blockier- und Kontrollmöglichkeiten mit Bedacht und Vorsicht nutzen, um nicht Erfolgsaussichten zu gefährden. Wiederum gilt auch für Parteiführungen, dass Entscheidungen nur dann auf Dauer tragfähig sind und Wahlerfolge versprechen oder Gestaltungsansprüche durchsetzbar werden, wenn bei dem Prozess dahin sowohl Effizienzkriterien beachtet wie bestimmte Grundsätze innerparteilicher Willensbildungsprozesse nicht ständig verletzt werden. Zur Strategiefähigkeit gehört es also auch, innerparteiliche Verfahren zu wählen, die sicher stellen, dass die Inhalte und Ziele zumindest nicht auf aktiven Widerstand bei Mitgliedern und Sympathisanten stoßen. Reaktionen, Strategien und Wandlungsprozesse können die Identität der Partei, die Wahrnehmung von Mitgliedern und Sympathisanten nicht unbeachtet lassen, weil sich die Partei ansonsten ihr Fundament unter den Füßen wegzöge und an inner- wie außerparteilicher Legitimität deutlich verlöre. Die Vernachlässigung der Werte, Ideen und Ressourcen der Parteibasis führt langfristig zu Entfremdung und gesellschaftlicher Entleerung der Partei, was zumeist negative Konsequenzen auf Wahlergebnisse und Legitimation des Parteihandelns hat (siehe Poguntke 2006: 402; Mair 2008). Des Weiteren sollte bei sich wandelnden Wählerschaften hin zu mehr situativ entscheidenden Wechselwählern und angesichts der Großorganisation mit Skepsis betrachtenden jüngeren Generationen für potenzielle Wähler und Mitglieder der Nutzen ihres Handelns erkennbar sein. Dieser Nutzen kann affektiv oder rational begründet sein. Da bei potenziellen Mitgliedern eine instrumentelle Sichtweise auf die Zugehörigkeit zu einer Partei überwiegt, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass persönliche Vorteile offenkundig gemacht werden sollten. Nach dem Zerfall der sozial-moralischen Milieus ist ein Beitritt zu einer Partei aus traditioneller Verbundenheit eine Rarität; ähnliches lässt sich über die Wahlentscheidung des Individuums bei jüngeren Generationen sagen. Daraus folgt, dass politische Parteien zur erfolgreichen Mitgliedergewinnung ihr Anreiz- und Gratifikationssystem überdenken müssen, hin zu nutzenorientierter Partizipation und weg von den auf kollektiven Identitäten beruhenden Organisationstraditionen und -ritualen. Die zumeist temporäre, kontextabhängige und auf punktuellen Anlässen beruhende Herangehenswei- 32 Uwe Jun se jüngerer Generationen an Politik ist mit „Vereinsmeierei“ und Gremiensitzungen nach festgefügten Normen und Ritualen kaum vereinbar. Kurzfristige, punktuelle und erlebnisorientierte politische Handlungen, die direkt erfahrbar sind, werden von diesen Bevölkerungsgruppen mehr nachgefragt. Literatur Alemann, Ulrich von (1995): Parteien. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Alt, J. E. (1984): Dealignment and the Dynamics of Partisanship in Britain. In: Dalton, Russell J./ Flanagan, Scott C./Beck, Paul Allen (Hrsg.): Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Realignment or Dealignment? Princeton: Princeton University Press, S. 298-329. Bogumil, Jörg/Schmid, Josef (2001): Politik in Organisationen. Organisationstheoretische Ansätze und praxisbezogene Anwendungsbeispiele. Opladen: Leske + Budrich. Borchert, Jens (2003): Die Professionalisierung der Politik. Zur Notwendigkeit eines Ärgernisses. Frankfurt am Main: Campus. Boucek, Francoise (2009): Rethinking Factionalism. Typologies, Intra-party Dynamics and Three Faces of Factionalism. In: Party Politics 15, 4, S. 455-485. Bukow, Sebastian (2010): Die professionalisierte Mitgliederpartei. Politische Parteien zwischen institutionellen Erwartungen und organisationaler Wirklichkeit. Berlin: Humboldt Universität (unveröffentlichte Dissertation). Carty, Kenneth R. (2004): Parties as Franchise Systems. The Stratarchical Organizational Imperative. In: Party Politics 10,1, S. 5-24. Deeg, Jürgen/Weibler, Jürgen (2005): Politische Steuerungsfähigkeit von Parteien. In: Schmid, Josef/Zolleis, Udo (Hrsg.): Zwischen Anarchie und Strategie. Der Erfolg von Parteiorganisationen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 22-42. Donges, Patrick (2008): Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Mediengesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Eldersveld, Samuel J. (1964): Political Parties: A Behavioral Analysis. Chicago: Rand McNally and Company. Eldersveld, Samuel J. (1971): A Theory of the Political Party. In: Wright, William E. (Hrsg.): A Comparative Study of Party Organization. Columbus: Charles E. Merrill, S. 73-83. Falter, Jürgen W. (1977): Einmal mehr: Läßt sich das Konzept der Parteiidentifikation auf deutsche Verhältnisse übertragen? In: Politische Vierteljahresschrift 18, 4, S. 476-500. Harmel, Robert (2002): Party Organizational Change: Competing Explanations? In: Luther, Kurt Richard/Müller-Rommel, Ferdinand (Hrsg.): Political Parties in the New Europe. Political and Analytical Challenges. Oxford: Oxford University Press, S. 119-142. Harmel, Robert,/Heo, Uk/ Tan, Alexander/Janda, Kenneth (1995): Performance, Leadership and Party Change: An Empirical Analysis. In: West European Politics 18, 1, S. 1-33. Politische Parteien als fragmentierte Organisationen im Wandel 33 Harmel, Robert/Janda, Kenneth (1994): An Integrated Theory of Party Goals and Party Change. In: Journal of Theoretical Politics 6, 3, S. 259-287. Harmel, Robert/Tan, Alexander (2003): Party Actors and Party Change: Does factional Dominance Matter? In: European Journal of Political Research 42,4, S. 409-424. Heidar, Knut (2006): Party Membership and Participation. In: Katz, Richard S./Crotty, William (Hrsg.): Handbook of Party Politics. London: Sage, 301-315. Houten, Pieter van (2009): Multi-Level Relations in Political Parties. A Delegation Approach. In: Party Politics 15,2, S. 137-156. Jun, Uwe (2004): Der Wandel von Parteien in der Mediendemokratie. SPD und Labour Party im Vergleich. Frankfurt am Main: Campus. Jun, Uwe (2009): Parteien, Politik und Medien. Wandel der Politikvermittlung unter den Bedingungen der Mediendemokratie. In: Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 42, Politik in der Mediendemokratie, herausgegeben von Frank Marcinkowski und Barbara Pfetsch, S. 270-295. Kieser, Alfred/Kubicek, Herbert (1992): Organisation. Berlin: de Gruyter. Katz, Richard S. (2008): Political Parties. In: Caramani, Daniele (Hrsg.): Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, S. 293-317. Katz, Richard S./Mair, Peter (1995): Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. In: Party Politics 1,1, S. 528. Katz, Richard S./Mair, Peter (2002): The Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth-century Democracies. In: Gunther, Richard/Montero, José Ramón/Linz, Juan J. (Hrsg.), Political Parties: Old Concepts and New Challenges. Oxford: Oxford University Press, S. 113-135. Katz, Richard S./Mair, Peter (2009): The Cartel Party Thesis: A Restatement. In: Perspectives in Politics 7,4, S. 753-766. Kirchheimer, Otto (1965): Der Wandel des westeuropäischen Parteiensystems. In: Politische Vierteljahresschrift 6,1, S. 20-41. Kitschelt, Herbert (1994): The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. Klein, Markus (2006): Partizipation in politischen Parteien. Eine empirische Analyse des Mobilisierungspotenzials politischer Parteien sowie der Struktur innerparteilicher Partizipation in Deutschland. In: Politische Vierteljahresschrift 47,1, S. 3561. Köllner, Patrich/Basedau, Matthias (2006): Faktionalismus in politischen Parteien: Eine Einführung. In: Dies./Erdmann, Gero (Hrsg.): Innerparteiliche Machtgruppen, Faktionalismus im internationalen Vergleich. Frankfurt am Main: Campus, S. 7-37. Lawson, Kay/Poguntke, Thomas (Hrsg.) (2004): How Political Parties Respond. Interest Aggregation Revisited. London: Routledge. Lösche, Peter (1993): »Lose verkoppelte Anarchie«. Zur aktuellen Situation von Volksparteien am Beispiel der SPD. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 43, S. 20-28. Luhmann, Niklas (2000): Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag. Mair, Peter (2008): The Challenge to Party Government. In: West European Politics 31,1-2, S. 211-234. 34 Uwe Jun Müller, Wolfgang C/ Strom, Kaare (1999): Political Parties and Hard Choices. In: Dies. (Hrsg.): Policy, Office, Or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, S. 1-35. Niedermayer, Oskar (1989): Innerparteiliche Partizipation. Opladen: Westdeutscher Verlag. Niedermayer, Oskar (1993): Innerparteiliche Demokratie. In: Ders./Stöss, Richard (Hrsg.): Stand und Perspektiven der Parteienforschung in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 230-250. Niedermayer, Oskar (2009): Ein Modell zur Erklärung der Entwicklung und Sozialstruktur von Parteimitgliedschaften. In: Jun, Uwe/Ders./Wiesendahl, Elmar (Hrsg.): Zukunft der Mitgliederpartei. Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, S. 91-110. Norris, Pippa (1997): Electoral Change since 1945. Oxford: Blackwell. Panebianco, Angelo (1988): Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press. Poguntke, Thomas (2000): Parteiorganisation im Wandel. Gesellschaftliche Verankerung und organisatorische Anpassung im europäischen Vergleich. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Poguntke, Thomas (2006): Political Parties and Other Organizations. In: Katz, Richard S./Crotty, William (Hrsg.): Handbook of Party Politics. London: Sage, S. 396-405. Raschke, Joachim (2001): Die Zukunft der Grünen. Frankfurt am Main: Campus. Raschke, Joachim/Tils, Ralf (2007): Politische Strategie. Eine Grundlegung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Sarcinelli, Ulrich (2007): Parteienkommunikation in Deutschland: zwischen Reformagentur und Reformblockade. In: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Reformen kommunizieren, Herausforderungen an die Politik. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 109-145. Schulz, Winfried (2008): Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Siavelis, Peter M. (2006): Party and Social Structure. In: Katz, Richard S./Crotty, William (Hrsg.): Handbook of Party Politics. London: Sage, S. 359-370. Trefs, Matthias (2006): Faktionen in westeuropäischen Parteien, Italien, Großbritannien und Deutschland im Vergleich. Baden-Baden: Nomos. Ware, Alan (1996): Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press. Wiesendahl, Elmar (1998): Parteien in Perspektive. Theoretische Ansichten der Organisationswirklichkeit politischer Parteien. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Wiesendahl, Elmar (2001): Die Zukunft der Parteien. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland (2. Auflage). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 592-619. Wiesendahl, Elmar (2006): Mitgliederparteien am Ende? Eine Kritik der Niedergangsdiskussion. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.