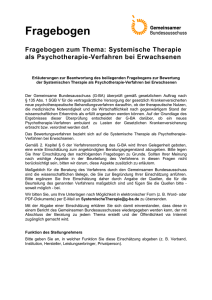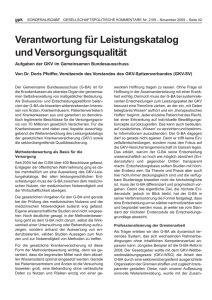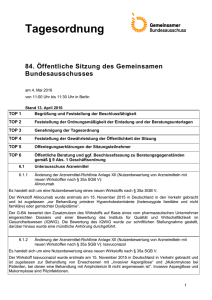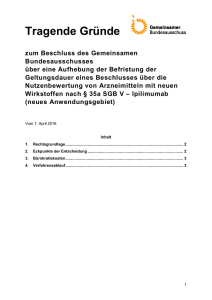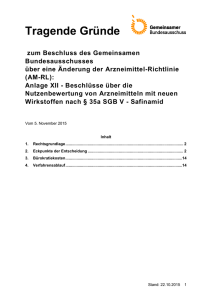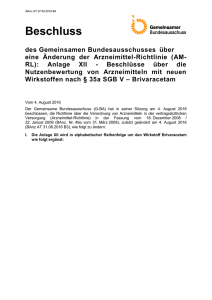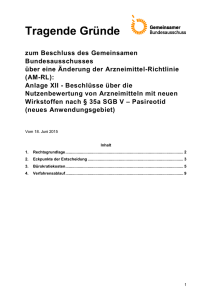Zeit für ein neues Marketing
Werbung

www.pharma-marketing.de Media Asset Management Dieses E-Journal erscheint alle zwei Monate als aktuelle Ergänzung zur Printausgabe | | | inhalt 1-2012 3 N ews: Frühe Nutzenbewertung Zytiga • Marketingbudgets • OTC-Marken • In aller Kürze © Foltolia 5 I nterview: Unternehmensberater Andreas Guhl über praktische und strategische Probleme der Nutzendossier-Erstellung 10 Titel: Vom klassischen Marketingansatz zum evidenzbasierten Marketing Zeit für ein neues Marketing Neue Herausforderungen für das Pharmamarketing 15 Kundenorientierung: Patientenansätze für die Pharmaindustrie 19 Social CRM: Wie verändert sich das Customer Relationship Management? 24Recht: Werbung mit Flyern auf Arzneimittelverpackungen 26Kolumne: Brand Bias bei der OTC-Marke Seite 10 Editorial ↘ Vorschau Vom Eminenz- zum Evidenzmarketing Im Verlauf der letzten Jahrzehnte war Marketing stark durch die Berufung auf Meinungsbildner, gewissermaßen auf Eminenzen ihres Faches, sowie durch Hinweise auf gewisse Zusatznutzen geprägt. Ein Marketing, dass nicht gerade zum positiven Image der Branche beigetragen hat. Folgt Marketing der Entwicklung in der Medizinwissenschaft, so wird seine Zukunft zunehmend evidenzbasiert sein, denn die Ausrichtung des Marketing folgt der wissenschaftlichen Entwicklung mit einer gewissen Zwangsläufigkeit. Unsere Titelgeschichte zeigt Ihnen, wie sich dementsprechend das Geschäftsmodell der Pharmabranche wandeln muss. Die Zahl der Unternehmen, die vor der Aufgabe stehen, ein Nutzendossier zu erstellen, steigt nach einem Jahr Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) kontinuierlich an. Eine Aufgabe, die es in sich hat, wie unser Interviewpartner Andreas Guhl weiß. Im Interview erläutert der Pharmamarketingexperte, welche praktischen und strategischen Implikationen sich für die Unternehmen ergeben. Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. pharma marketing journal Februar 2012 Im Februar-Heft lesen Sie unter anderem: Titel: E-Patient – Das Wissen der Patienten stammt zunehmend aus dem Internet. Aber wer ist der E-Patient, wie und wo informiert er sich? Interview: Dr. Rainer Hess, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (GB-A), über ein Jahr frühe Nutzenbewertung Closed-Loop-Marketing: Ein System zur intelligenten Gestaltung des Beziehungsmanagements Steigen Sie ein in das neue „pharma marketing e-journal“ und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Chancen und Risiken dieses spannenden Markts. Zielgruppen: Neue Konzepte sind notwendig, um die Bereitschaft von Frauen und Männern zu erhöhen, mehr Geld für ihre Gesundheit auszugeben. Ihr Peter Hanser verantwortlicher Redakteur E-Mail: [email protected] Recht: Bestechlichkeit von Ärzten Interesse? Dann klicken Sie hier und bestellen die Februar-Ausgabe bequem per E-Mail Impressum 2 ↘ Stabile Budgets Markt & Marketing ↘ Erste frühe Nutzenbewertung eines Onkologikums Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat seine Nutzenbewertung für Zytiga (Abirateronacetat) von Janssen im Rahmen des Arzneimittelmarkt-Neuordnungs-Gesetz (AMNOG) vorgelegt. Das IQWiG zieht in seinem Gutachten das Fazit, dass es Hinweise auf einen beträchtlichen Zusatznutzen von Zytiga für solche Patienten gibt, für die eine erneute Therapie mit Docetaxel nicht infrage kommt. Dieses Medikament ist in Kombination mit Prednison oder Prednisolon zugelassen bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) nach Versagen einer Docetaxel-haltigen Positiv bewertet: Auch die zweite frühe Nutzenbewertung des IQWiG fiel gut aus. Chemotherapie. Dies betrifft circa 75 Prozent der schätzungsweise 7 000 Patienten mit mCRPC in Deutschland. Der Zusatznutzen wird für die Endpunkte Mortalität und Morbidität bestätigt. Der Zusatznutzen der Therapie mit Zytiga für Patienten, die für eine weitere Chemotherapie infrage kämen, wird vom IQWiG als „nicht belegt“ eingestuft. Abweichend von der IQWiG-Bewertung ist Janssen der Meinung, dass auch bei solchen Patienten, die formal für eine erneute Therapie mit Docetaxel geeignet sind, ein beträchtlicher Zusatznutzen von Zytiga vorhanden ist. Diese Ansicht unterstützen auch Experten. Janssen wird wie vom Verfahren vorgesehen bis zum 23. Januar 2012 gegenüber dem Gemeinsamen-Bundesausschuss (G-BA) eine Stellungnahme zu der Nutzenbewertung des IQWiG abgeben und anschließend konstruktiv am weiteren Bewertungsprozess mitarbeiten. Stellungnahmen anderer Absender sind bis zu diesem Termin ebenfalls möglich. www.janssen-cilag.de 3 Die Marketingbudgets im Healthcare-Markt bleiben im Jahr 2012 stabil. 66 Prozent der von der Werbeagentur Wefra befragten Pharma-Marketingentscheider der Rx- und OTC-Segmente gehen davon aus, dass die Budgets gleich Mangelware: Smartbleiben. Zurückhaltend zeigt phone- und Tablet-PCsich die Branche im Hinblick Applikationen sind in der auf Kommunikationskanäle wie Pharma­branche noch nicht angekommen. Online und Social Media. Der Fokus der Aktivitäten liegt nach wie vor auf dem Außendienst und der klassischen Werbung respektive PR. Was aufhorchen lässt: Keinem der befragten Unternehmen stehen im kommenden Jahr mehr Mittel als 2011 zur Verfügung und das, obwohl die Herausforderungen als durchaus ambitioniert wahrgenommen werden. Fast alle Marketing-Entscheider (94 Prozent) erwarten einen höheren Wettbewerbsdruck und 89 Prozent gehen von einem zunehmenden Preisdruck auf einzelne Präparate aus. Doch was trägt zu dieser Markthaltung bei? 60 Prozent der Pharma-Marketing-Experten erwarten eine stärkere Einflussnahme von Politik und Kassen auf die Wettbewerbsspielregeln. Damit rückt die Kosteneffektivität einzelner Produkte in den Mittelpunkt und das kann teuer werden – vor allem für die Unternehmen. www.wefra.de ↘ In aller Kürze Markt & Marketing Kosten: Durch gezielte Reduktion der gewachsenen Komplexität im deutschen Gesundheitssystem kann der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 15,5 auf mindestens 14,2 Prozent gesenkt werden und können 13 Milliarden Euro eingespart werden. Eine Studie von A.T. Kearney zeigt erstmals auf, dass die Verwaltungskosten im öffentlichen deutschen Gesundheitssystem im Jahr 2010 tatsächlich 40,4 Milliarden Euro betragen haben. ↘ Aspirin ist das bekannteste OTC-Medikament Fragt man die Deutschen, welche Medikamente sie kennen, wird Aspirin mit deutlichem Abstand am häufigsten genannt. Im Westen kommt mehr als jeder Vierte (25,2 Prozent) un- Top-Marke: Jeder vierte Bundesbürger gestützt, also ohne einen Markennamen vorzugeben, auf kennt die Bayermarke Aspirin. das Produkt. Im Osten sind es 18,8 Prozent. Das ist ein Ergebnis der West-Ost-Markenstudie (WOM 2011) von MDR-Werbung und dem Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK). Mit erheblichem Abstand folgen dann Ratiopharm (8,1 Prozent West, 7,2 Prozent Ost) und Paracetamol (6,8 Prozent West, 5,0 Prozent Ost). Die Ergebnisse zeigen, dass kaum Unterschiede in Markenbekanntheit zwischen Ost und West festzustellen sind. Erst ab dem vierten Platz sind geringe Abweichungen abzulesen. So spielt Thomapyrin im Osten keine Rolle. Dagegen landet Dolormin nur zwischen Rügen und Rennsteig unter den Top Ten. „Die Ostprodukte im OTC-Segment, wie Bromhexin Tropfen – ein Hustenmittel von Berlin Chemie – oder Imidin – ein Schnupfenspray von Pharma Wernigerode – sind nicht im Gedächtnis der Verbraucher verankert und können bei einer Befragung nicht spontan genannt werden. Das belegt eindrucksvoll, was mit einer Marke passiert, wenn sie nicht für sich wirbt“, warnt Niels N. von Haken, Geschäftsführer der MDR-Werbung. Dabei spielt die regionale Herkunft bei der Kaufentscheidung im Osten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Für die WOM 2011 haben die MDR-Werbung und IMK 2 000 Menschen repräsentativ befragt. www.mdr-werbung.de 4 www.atkearney.com Hausapotheke: Während in jungen Singlehaushalten das Wort „Hausapotheke“ eher fremd ist und Medikamente eher in der Wohnung verteilt sind, so sind in Haushalten mit Kindern wohlgeordnete und gepflegte Hausapotheken schon eher die Regel als die Ausnahme. Nur am Rande interessieren sich die Haushaltsmitglieder für die „Apotheke an der Wand“ wie die Marktforscher von TNS Infratest herausfanden. www.tns-infratest.com Personalien: Dr. Andreas Kiefer (50) ist neuer Vorsitzender des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts e.V. (DAPI). Das DAPI befasst sich mit der pharmakoökonomischen und -epidemiologischen Prüfung und Bewertung von Arzneimitteln sowie allgemeinen Fragen der Arzneimittelversorgung. Zum Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dr. Peter Froese gewählt. www.dapi.de Interview »Kostentreiber sind in erster Linie die Personalkosten« Autor: Peter Hanser Kontinuierlich steigt die Zahl der beim G-BA eingereichten Nutzendossiers. Über die strategischen und praktischen Probleme bei der Dossiererstellung sprach pharma marketing journal mit dem Londoner Berater Andreas Guhl. 5 Interview Herr Guhl, Dossiers sind in der Pharmabranche nichts Neues. Unternehmen erstellen parallel eine ganze Reihe von Dossiers. Was unterscheidet ein Nutzendossier von den bisher erstellten Dossiers? ANDREAS GUHL: Das bekannteste Dossier ist das sogenannte „Value Dossier“. Ein Value Dossier begleitet ein Produkt während seines gesamten Life-Cycles. Dort werden sämtliche Daten (unter Umständen auch zu den Mitbewerbern) erfasst, die für die Erstattungsfähigkeit von Interesse sind. Üblicherweise fokussiert man dabei auf die fünf großen europäischen Märkte, USA und Japan. Mit dem vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geforderten Nutzendossier kommt jedoch eine neue Qualität hinzu. Das Unternehmen muss einen Zusatznutzen gegenüber einer Vergleichstherapie nachweisen, die vom G-BA festgelegt wird und möglicherweise nur in Deutschland als adäquate Vergleichstherapie angesehen wird. Wie man am Beispiel Ticagrelor gesehen hat, können vom IQWiG dabei auch Subpopulationen auf einen Zusatznutzen untersucht werden, wobei dann im Extremfall jede ihre eigene spezifische Vergleichstherapie erhält. Das kann natürlich dazu führen, dass bei der Dossiereinreichung keine entsprechenden Daten vorhanden sind und diese in klinischen Studien erst noch erhoben werden müssen. Erschwerend kommt dazu, dass die Informationen rund um das AMNOG nicht erschöpfend genug in englischer Sprache zur Verfügung stehen, was die interne Unternehmenskommunikation noch weiter erschwert. Für jemanden wie mich, der die meiste Zeit im Ausland verbringt, ist es manchmal schon erstaunlich zu sehen, was dort an falschen Informationen oder Halbwahrheiten zum AMNOG kursiert. Welches Ziel verfolgt das Nutzendossier? GUHL: Die Nutzendossiers sind eindeutig darauf ausgerichtet, dem Gesundheitssystem in Deutschland Geld zu sparen. Das zeigt sich alleine daran, dass die Vergleichstherapie mehr oder weniger festgelegt wird und beispielsweise gesundheitsökonomische Daten eine eher untergeordnete Rolle spielen. In anderen Ländern wie UK werden gesundheitsökonomische Daten zu einem Produkt als ebenso relevant angesehen wie die klinische Evidenz. Welche formalen Anforderungen werden vom G-BA an das Nutzendossier gestellt? GUHL: Die formalen Anforderungen sind sehr hoch und im internationalen Vergleich mit die anspruchsvollsten. Das Dossier besteht aus fünf Modulen deren Inhalte und Struktur vom G-BA klar vorgegeben sind. Allerdings sind meiner Meinung nach die Fristen viel zu kurz. Für ein Produkt, welches aus dem Bestandsmarkt aufgerufen wird, ist eine Dossiererstellung in nur drei Monaten, wie vom G-BA gefordert, kaum zu bewältigen. Die Erstellung eines Value Dossiers erfordert mindestens einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten. Muss noch eine systematische Lite- 6 raturrecherche durchgeführt werden verlängert sich dieser Zeitraum entsprechend. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor ist die Tatsache, dass das Nutzendossier nur in deutscher Sprache eingereicht werden darf. In anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden oder Skandinavien kann auch in Englisch eingereicht werden. Gerade für internationale Unternehmen liegt damit die größte Arbeitsbelastung bei der deutschen Filiale. Drei Monate nach Einreichung des Dossiers wird die Bewertung durch das IQWiG auf der Webseite des G-BA veröffentlicht. Ausgenommen ist Modul 5, da dieses die vertraulichen Informationen enthält. Ich denke, diese klaren Vorgaben unterstützen die Unternehmen auch in der Erstellung der Dossiers, gerade in einem Land, wo man mit dieser Art von Dossiers kaum oder nur wenig Erfahrung hat. Kann der Bewertungsprozess schon an der Nichterfüllung formaler Kriterien scheitern? GUHL: Ja, das kann in der Tat passieren. Unternehmen können gleich zu Beginn der Einreichung in mehrere Fettnäpfchen treten. Zum Beispiel ist ein Abweichen von der vorgegeben Dossierstruktur nicht möglich. Auch sollten sich Unternehmen über die Konsequenzen im Klaren sein, dem G-BA Informationen vorzuenthalten. Das kann natürlich auch unwissentlich passieren. Das IQWiG führt seine eigenen Literaturrecherchen durch und wenn dabei eine wichtige publizierte Studie Interview zum Produkt entdeckt wird, die nicht im Dossier berücksichtigt wurde, kann das zu einer Abweisung des Nutzendossiers wegen Unvollständigkeit führen. Der G-BA führt auf Wunsch eine Vollständigkeitsprüfung des Dossiers durch, falls dies spätestens zwei Wochen vor Deadline eingereicht wird. Eine Checkliste zur Vollständigkeitsprüfung kann man sich auch von der Webseite des G-BA herunterladen. Erhalten Unternehmen nach einer Abweisung eine zweite Chance? GUHL: Ja, die gibt es, allerdings mit erheblicher zeit- Unabhängige Prüfinstanz: Das Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Gesundheitswirtschaft untersucht, welchen Nutzen und Schaden medizinische Maßnahmen für Patienten haben können. »Es ist manchmal schon erstaunlich zu sehen, was im Ausland an falschen Informationen oder Halbwahrheiten zum AMNOG kursiert.« licher Verzögerung, je nachdem, wie schwerwiegend die Abweichungen waren. Welche Implikationen ergeben sich aus den formalen Anforderungen an die Unternehmen? GUHL: Das ist eine gute Frage, denn die Implikationen können sehr facettenreich und schwierig in einer einzigen Antwort abzubilden sein. Sicherlich hängt es davon ab, ob das Dossier für eine Neueinführung erstellt wird oder für ein Bestandsmarktprodukt, welches weitaus umfangreicher ist. Durch die Vielschichtigkeit eines Nutzendossiers müssen unterschiedliche Kompetenzen von der Medizin über die Zulassung bis hin zur Rechtsabteilung innerhalb eines Unternehmens gebündelt und diese dann teilweise unter extrem hohem Zeitdruck auf die Erstellung von Nutzendossiers fokussiert werden. Dabei darf das Alltagsgeschäft auch nicht zu kurz kommen. Dies erfordert in erster Linie ein hohes Maß an Projektmanagement. Die meisten großen Unternehmen haben diese Kompetenz frühzeitig aufgebaut und teilweise neue Abteilungen gegründet, die genau für diese Koordination verantwortlich sind. Bei den mittleren und kleineren Unternehmen dagegen sieht es ein wenig anders aus. Die müssen sich oftmals 7 diese Kompetenz von extern einkaufen, ein zusätzlicher Kostenfaktor, der nicht unbedingt im Budget vorgesehen war. Ein weiteres Phänomen ist die Tatsache, dass es im Ausland mittlerweile eine Knappheit an deutschen Muttersprachlern im Bereich Market-Access gibt. Nicht nur Unternehmensberatungen suchen händeringend nach Mitarbeitern – auch internationale Unternehmen, die eine Schnittstelle hinsichtlich AMNOG zwischen der deutschen Filiale und dem Headquarter eingerichtet haben, haben Schwierigkeiten, diese Positionen zu besetzen. Der G-BA bietet auch eine Beratung zur Erstellung der Nutzendossiers an. Ist es sinnvoll, diese zu nutzen? GUHL: Der G-BA bietet nicht nur eine Beratung zum Dossier per se an sondern beispielsweise auch zur möglichen Vergleichstherapie. Allerdings muss der Terminus „Beratung“ relativiert werden. Man darf sich das nicht als eine Diskussion am runden Tisch mit Fachexperten des G-BA vorstellen – eine Vorstellung die gerade international noch in vielen Köpfen vorherrscht. Die Fragen des Unternehmens gehen an einen Unterausschuss des G-BA, der sich damit befasst und seine Einschätzung in Form eines Protokolls dem Interview Unternehmen zur Verfügung stellt. Das Prozedere ist identisch mit der Beratung des National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) in England und Wales. Ich denke, die Unternehmen sollten von dem Service Gebrauch machen, insbesondere, um frühzeitig herauszufinden, welche Therapie vom G-BA in der späteren Bewertung als mögliche Vergleichstherapie herangezogen wird. Ist die Vergleichstherapie bereits generisch, kann man sich an drei Fingern abzählen, worauf die späteren Preisverhandlungen mit dem GKV Spitzenverband hinauslaufen werden. Der G-BA berät Unternehmen auch zum Design von Phase-III-Studien. Dadurch, dass die Firmen schriftlich ein offizielles Protokoll zur Verfügung gestellt bekommen, kann das die interne Kommunikation unheimlich erleichtern. Meiner Meinung nach ersetzt jedoch die Beratung nicht unbedingt profunde qualitative Marktforschung im Bereich Payer Research. Die Kritik an der Beratung durch den G-BA ist die mangelnde Transparenz, denn die Unternehmen wissen nicht „wer“ ihre Fragen beantwortet hat, geschweige denn, ob es sich um einen Experten aus dem Fachgebiet handelt. Hierzu habe ich mit „Payer Chat“ ein innovatives Tool entwickelt, welches genau dieses Problem angeht und auch in englischer Sprache zur Verfügung steht. Entstehen für diese Beratung Kosten? GUHL: Die Beratung ist gebührenpflichtig. Die Höhe richtet sich dabei nach der Komplexität der Fragestel- »Unternehmen können gleich zu Beginn der Einreichung des Nutzendossiers in mehrere Fettnäpfchen treten.« lungen und ist in drei Kategorien eingestuft, wobei Kategorie 1 mit 2 000 Euro zu Buche schlägt, Kategorie 2 mit 7 000 Euro und Kategorie 3 mit 10 000 Euro. Sollte der G-BA der Meinung sein, dass die Fragestellung sehr komplex war, kann sich die Gebühr sogar verdoppeln. Bei einfachen Fragestellungen gibt es aber auch Abschläge. Unternehmen müssen vorab einen Vorschuss von 5 000 Euro leisten, bevor der GBA seine Arbeit aufnimmt. Welche Inhalte sollten in dieser Beratung ange­ sprochen werden? GUHL: Die entscheidende Frage ist die nach der Vergleichstherapie – auch für mögliche Subpopulationen. Gibt es keine, so sollte sicherlich die Frage des indirekten Vergleichs angesprochen werden. Bei einer frühen Beratung, das heißt vor dem Start der Phase-IIIStudien, steht sicherlich die adäquate Vergleichstherapie im Vordergrund, aber auch Punkte wie Studiendesign, primäre und sekundäre klinische Endpunkte sowie mögliche Subpopulationen. Wie verbindlich ist die Beratung durch den G-BA? GUHL: Die Beratung ist nicht rechtsverbindlich. Das 8 ist jedoch europaweit bei allen G-BA-ähnlichen Institutionen der Fall. Wenn der G-BA in der Beratung eine Vergleichstherapie empfiehlt, kann dann möglicherweise eine andere Vergleichstherapie im Bewertungsverfahren herangezogen werden? GUHL: Theoretisch wäre das möglich. Deshalb sollte sich ein Unternehmen durch qualitative Marktforschung absichern. Ist das schon vorgekommen? Welche Konsequenzen hatte dies für die Unternehmen? GUHL: Meines Wissens noch nicht. Die Konsequenzen wären unter Umständen fatal. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen baut ein komplettes Phase-III-Studiendesign auf Basis der Beratung durch den G-BA auf und stellt später fest, dass die Daten wertlos sind, weil zwischenzeitlich ein anderes Produkt als Vergleichstherapie herangezogen wird. Der G-BA ist jedoch nicht völlig rigide, was die Vergleichstherapie angeht. In mindestens zwei Fällen wurde die Vergleichstherapie revidiert, nachdem dem G-BA neue Informationen zu den Produkten zur Verfügung gestellt wurden. Interview Gibt es auch Software-Unterstützung für die Erstellung von Nutzendossiers? GUHL: Es gibt keine spezifische Software für die Erstellung des Nutzendossiers in Deutschland, jedoch Software, die im Rahmen der Erstellung von Value Dossiers genutzt wird, und auch bei der Erstellung von Nutzendossiers herangezogen werden kann. Für die Literaturrecherche kann zum Beispiel ein Programm wie „RefMan“ unterstützend eingesetzt werden oder Software für die Editierung des Dossiers, wie sie auch für Zulassungsdossiers benutzt wird. Um die interne Kommunikation während der Erstellung eines Nutzendossiers zu erleichtern kann, Intranet-basierte Software wie „Sharepoint“ hilfreich sein. Die an der Dossiererstellung beteiligten Personen können sich damit in Echtzeit über den Fortschritt der Dossiererstellung informieren, Dokumente und Projektpläne können dort hinterlegt oder interne Termine für Telefonkonferenzen vereinbart werden. Diese Kommunikationsplattform funktioniert ganz ähnlich wie Facebook, es fehlt jedoch der „Like“Button. Das Endprodukt ist das elektronische und leicht navigierbare Nutzendossier, das sogenannte e-AMNOG-Dossier. Welche Umfänge kann ein solches Nutzendossier erreichen? Und mit welchen Kosten ist zu rechnen? GUHL: Die Umfänge der Dossiers sind sehr unterschiedlich und momentan haben wir es ja nur mit Dos- siers für Neueinführungen zu tun. Die Nutzendossiers aus dem Bestandsmarkt werden sicherlich weitaus umfangreicher. Dadurch, dass die Informationen in Modul 5 vertraulich sind, sind Informationen über den kompletten Umfang nicht öffentlich zugänglich. Die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, nannten eine Größenordnung von 3 000 bis hin zu 15 000 Seiten. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass dieses Volumen nicht komplett neu erstellt werden muss, sondern das meiste aus den Zulassungsunterlagen übernommen werden kann. Die Kosten für die Erstellung eines Nutzendossiers hängen insbesondere davon ab, welcher Anteil der Arbeiten im Unternehmen selbst erstellt werden kann, und was noch extern vergeben werden muss. Die Preisspanne liegt zwischen 100 000 und 300 000 Euro, wobei ein forschendes Unternehmen für ein Bestandsmarktprodukt im Diabetes-Bereich die internen und externen Kosten mit knapp 600 000 Euro angesetzt hat. Welches sind die Kostentreiber bei der Nutzendossiererstellung? GUHL: Die Kostentreiber sind in erster Linie die Personalkosten. Auch wenn ein Unternehmen in der Lage ist, das meiste intern durchzuführen, so ist die Erstellung eines Nutzendossiers eine interdisziplinäre Herausforderung mit hohem Personalaufwand. Manche Firmen führen vor der Erstellung des Nutzendossiers und/ 9 oder kurz vor Einreichung des Dossiers zusätzliche Advisory Boards mit externen Experten durch. Dabei fokussiert sich die Diskussion insbesondere auf die Argumentation zur Vergleichstherapie und der Argumentierung hinsichtlich des möglichen Zusatznutzens. Solche Maßnahmen sind weitere Kostentreiber, können jedoch im Endergebnis viel Geld sparen. Ist denn wenigstens eine Zweitverwertung der Nutzendossiers möglich? GUHL: Diese Frage kommt insbesondere von Unternehmen, die bereits am Nutzendossier aus dem Bestandsmarkt arbeiten. „Was, wenn wir gar nicht ‚dran‘ kommen?“. Nutzendossiers können auf vielfältige Weise verwendet werden. Die klinische Evidenz ist international und kann in anderen Ländern für Health Technology Assessments (HTA) herangezogen werden beziehungsweise auch für nationale Erstattungsdossiers. Aus den zusammengetragenen Informationen im Nutzendossiers können Schulungsunterlagen oder Aktualisierungen von Schulungsunterlagen für den Außendienst oder, falls vorhanden, für den gesundheitspolitischen Außendienst erstellt werden. Ebenso können die Informationen aus dem Nutzendossier als Basis für die Verhandlungen von Direktverträgen mit Krankenkassen herangezogen werden. Der Aufwand für die Erstellung eines Dossiers ist nicht komplett umsonst, auch wenn kein Aufruf durch den G-BA erfolgt. ← © Foltolia Titelstory Zeit für ein neues Marketing Autor: Klaus-Jürgen Preuß Der Pharmamarkt hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Mit einem „klassischen“ Marketingansatz wird man den zukünftig geltenden Regeln nicht mehr gerecht werden. Nur durch ein paralleles Redesign des Marketings im Sinne der evidenzbasierten Medizin wird man erfolgreich bestehen können. 10 Titelstory Die Vergangenheit gehörte den Blockbustern. Heute sterben sie, ähnlich wie die Dinosaurier, langsam aus. Die Zukunft gehört den sogenannten „Nichebustern“, effektiven Orphan Drugs, „Super Orphan Drugs“ und einer zunehmend individualisierten Medizin in Diagnostik und Therapie. Gemein ist allen diesen Ansätzen, dass es sich um hoch spezifische Diagnose- oder Therapieansätze handelt, die sich auf abgegrenzte Patientenpopulationen konzentrieren. Das Marketing muss sich künftig auf kleine Zielgruppen und Spezialpopulationen ausrichten. Innerhalb des Marketingmix hat das Preis- und Erstattungsmanagement inzwischen in seiner Bedeutung alle anderen Elemente auf die Plätze verwiesen. Im alten Paradigma waren die wesentlichen Entscheider der Arzt und der Apotheker. Viele kleine Einzelentscheider prägten unser Gesundheitswesen in den vergangenen Jahrzehnten. Hierzu benötigte man eine wenig differenzierte Massenkommunikation und große Außendienste, um die einfachen Botschaften an diese zersplitterte Zielgruppe effektiv heranzutragen. Der Marketingmix bestand im Grunde aus nur wenigen Elementen. Parallel hat sich die Kostenträgerlandschaft neu organisiert. Von mehr als eintausend Kassen in den achtziger Jahren werden bis Mitte dieses Jahres lediglich 145 übriggeblieben sein. In wenigen Jahren werden es nicht einmal mehr einhundert sein. Die entscheidenden Mechanismen und relevanten Prozesse folgen heute dem Business-to-Business(B2B)-Konzept. Die Verhandlungen und Gespräche zwischen den Transaktionspartnern werden weniger, dafür komplexer und intensiver. Neue Stakeholder dominieren die relevanten Entscheidungsmechanismen und Prozesse. Die Fokussierung auf ein evidenzbasiertes Marketing wird bei der Neuorientierung im Zentrum stehen. Diese Entwicklung folgt mit einer gewissen Zwanghaftigkeit – aber auch Logik – der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft in den letzten zwei Jahrzehnten. Mit der Einführung des evidenzbasierten Marketings wird ein großer Schritt in Richtung von mehr Transparenz und Objektivität getan. Parallel zur Objektivierung der Ergebnisse in der Medizin und Behandlung über die Schritte der Trias nach Donabedian (Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität) wird auch das Marketing sich entsprechend anpassen müssen. Marketingkommunikation nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin ist ein Paradigmenwandel. Es kommt also wieder mehr auf die Inhalte und auch die geeignete Form der Übermittlung von zunehmend komplexen Inhalten an. Hierzu stehen dem evidenzbasierten Marketing eine Reihe von spezifischen Instrumenten wie Caremaps, das EBM-Dossier (über evidenzbasierte Medizin), der HTA(Health-Technology-Assessment)-Bericht (zur Medizintechnik-Folgenabschätzung), Metaanalysen, Leitliniensynopsen und gesundheitsökonomische Modellierungen zur Verfügung. 11 ↘ Handbuch Market-Access Eine ausführliche Darstellung der Veränderungen in der Markt- und Unternehmenssteuerung der Pharmabranche finden Sie in dem „Handbuch Market Access“. Darüber hinaus bietet das Werk einen grundlegenden Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten eines erfolgreichen und umfassenden Market-Access. In neun Kapiteln setzen sich Autoren aus Praxis und Wissenschaft von verschiedenen Standpunkten her mit dem Thema auseinander. So wird der gesamte Lebenszyklus eines Produkts von den ersten Stufen seiner prä-klinischen Entwicklung bis hin zur Konsumption durch den Endverbraucher ganzheitlich aus der Perspektive des MarketAccess dargestellt. Ein Buch für alle Beteiligten im Gesundheitssystem. www.pharma-marketing.de/shop Titelstory Neue und andere Entscheidungsstrukturen rshift Entscheide Kostenträger Ärzte KVen G-BA IQWiG Apotheker 1980 1990 2000 Patienten 2012 Eine monodimensionale Entscheiderstruktur wird durch multidimensionale Entscheidungsprozesse abgelöst. Das evidenzbasierte Marketing bewegt sich viel stärker an der Kernleistung des Produktes. Das vorrangige Ziel ist nicht mehr, multiplen kaum belegbaren Zusatznutzen zu generieren und zu kommunizieren. Die wirklichen Stärken des Produktes stehen im Fokus der Aktivitäten des evidenzbasierten Marketiers. Die Herausarbeitung der besseren und möglichst kosteneffizienten Versorgung durch ein Arzneimittel, ein Medizinprodukt oder eine medizinische Dienstleistung ist die eigentliche Kernaufgabe. Die scharfe Profilierung am bestehenden Therapiestandard, das Delta in der CER-Perspektive zum etablierten „Goldstandard“, das Abschneiden bei den relevanten Outcomeparametern oder das qualitative Delta in der Verträglichkeit in einem Head-to-Head-Vergleich stellen die Essenz des evidenzbasierten Marketings dar. Auch der Kosten-Nutzen-Betrachtung wird in diesem Ansatz eine hohe Bedeutung zugemessen, denn in Zeiten beschränkter Ressourcen ist es eine ethische Verpflichtung, die vorhandenen limitierten Ressourcen möglichst nutzenstiftend einzusetzen. Alle Ansätze der Gesundheitsökonomie von der Cost-of-Illness-Studie bis hin zu guten Quality-of-Life-Studien werden hier ihren Platz finden. Grundsätzlich wird damit das Marketing mehr auf Fakten und Daten basiert. Das schnelle „Claimen“ von schwer greifbaren Produktbenefits verfängt bei professionellen Businesskunden nicht mehr. Relevante Outcomes und Endpunkte müssen durch die Produkt- wie die gesamte Versorgungsleistung nachhaltig erreicht und belegt werden, um diese Kunden zu überzeugen. Auch das Visualisieren von selektiven Ergebnissen aus Einzelstudien in Gesprächsfoldern ist kein akzeptierter Lösungsweg mehr. Dieser „Scientific Fake“ wird durch die qualifizierten Experten der anderen Seite schnell entlarvt werden und das Verspielen von Credibility und Good Will durch derartige Ansätze ist bei einem B-to-B-Modell beinahe tödlich. Wenn man hin und wieder einmal einen Arzt oder auch eine Praxisgemeinschaft verliert, nun denn, aber ein ganzes Ärztenetz 12 oder eine bundesweite Klinikkette oder eine große Versorgerkasse? Damit ist klar: Zukünftig zählt Qualität und nicht mehr Quantität. Bei den B-to-B-Rezeptoren gibt es nicht – wie in der Konsumgüterindustrie – ein Jahresgespräch, aber zukünftig wohl kaum zehn und mehr Calls pro Kalenderjahr, um seine Geschichte zu erzählen. Auch die professionelle Ausschreibung durch die Businesskunden wird stark zunehmen, und dann muss man mit qualifizierten Daten und Fakten punkten, sonst bleiben nur der Preis und der Rabatt auf diesen als Argumente. Mit dem Wandel des Geschäftsmodells, einerseits weg von den einzelnen Ärzten und Apothekern hin zu den Einkäufern von aggregierten horizontalen Versorgerketten, vertikalen IV-Modellen oder regionalen Versorgungsverbünden und andererseits weg von den Blockbustern hin zu den Nichebustern und Orphan Drugs, werden die Produkt- und Marketingmanager zunehmend ein evidenzbasiertes Marketingmix einsetzen, denn die gut ausgebildeten Gesprächspartner auf der anderen Seite werden sich nicht mehr mit den eher schlichten Botschaften und Argumenten der Vergangenheit begnügen. Allerdings wird sich die Verbreitung der neuen EBMInstrumente nicht schlagartig vollziehen, sondern eher evolutionär. Mit der Geschwindigkeit des Entstehens Titelstory Neugewichtung im Marketingmix Gewichtung im Marketingmix 1985 – 2000 Gewichtung im Marketingmix 2000 – 2020 Product Place Product Place Promotion Price Promotion Price Public Relation Public Relation Healthcare-Politics Healthcare-Politics von aggregierten Leistungsverbünden und Ketten auf allen Stufen der medizinischen Wertekette steigt auch die Nachfrage nach EBM-Instrumenten und -Argumenten. Für die nächsten Jahre werden wir noch in einer Parallelwelt leben. Innovative Unternehmen, die die Zeichen der Zeit zu deuten wissen, werden sich frühzeitig den Chancen und Möglichkeiten des evidenzbasierten Marketings zuwenden. Andere, eher traditionell ausgerichtete Firmen mit einem entsprechenden Produktangebot, werden hingegen noch viele Jahre an dem bestehenden „klassischen“ Marketingmodell festhalten. Grundsätzlich wird das neue Marketing differenzierter und komplexer. Es müssen parallel Kompetenzen und Ressourcen für ein professionelles B-to-B-Marketing aufgebaut, ein effektives Ausschreibungs- und Vertragsmanagement organisiert, das Stakeholdermarketing für die neuen Entscheider und Regulatoren professionalisiert, die medizinischen Meinungsbildner und Fachgesellschaften mit einem entsprechenden medical Marketing bedient und die Endkunden in einem glaubwürdigen D-to-C-Ansatz angesprochen werden. Mit dieser Vielzahl der neuen Aufgaben und steigenden Komplexität ist eine Evolution des Marketings unabdingbar. Dennoch wird man auch das „klassische“ Marketing nicht einfach einstellen können. Es wird darauf ankommen, die Transition vom „klassischen“ zum new Marketing mit Augenmaß zu managen. Mit der Ausrichtung auf ein strikt evidenzbasiertes Marketing und der Fokussierung auf die Businesskunden, also auf ein vorwiegendes B2B-Marketing, wird sich die Kosten-Nutzen-Relation wieder in die gesellschaftlich gewünschten beziehungsweise sozial akzeptierten Relationen verschieben. Für ein evidenzbasiertes Marketing an eine begrenzte Anzahl von Entscheidern und Endkunden werden weit weniger Marketingmittel benötigt als für die flächendeckende Abdeckung von vielzahligen Einzelkunden (Ärzten und Apothekern). Die Zahl der relevanten Zielgruppen reduziert sich zukünftig von mehreren Zehntausend auf wenige Hundert. 13 In einem viel beachteten Buch haben Porter und Olmsted Teisberg (Redefining Health Care, Creating Value-Based Competition on Results, 2006) aufgezeigt, was die Industrie verändern muss, um die Probleme im Gesundheitswesen zu lösen. Der Fokus muss auf einen Wettbewerb um die Ergebnisse der qualitativ besten und ökonomisch tragbaren Versorgung gelegt werden. Dabei geht es nicht mehr um einzelne Arzneimittel oder Medizinprodukte, sondern um komplette Versorgungsabschnitte oder gar um den gesamten Versorgungszyklus. Durch besseres Verständnis des Carecycles und durch Economies of Scale sowie einen qualitätsorientierten Versorgungsansatz können zukünftig Versorgungs- Der evidenzbasierte Marketingmix Produkt Place Promotion Price integrale Versandhandel EBM-Dossier Verträge Systemlösung Internet HC-Signalling Capitation Literaturreview Risk-Sharing Hard- und Software Direct to Patient Carekonzepte DMP & BMP Casemanagement CER-Zusatznutzen Versorgungsrelevanz IV-Modelle Healthcaremapping Caremaps Leitliniensynopse P4P & P4C EBM-Claims-Check Mehrwertansatz CME HEO-Modell Healthcarecoaching Willingness to pay Titelstory leistungen preisgünstiger erbracht werden. Ihre in dem Buch dargestellte Hypothese geht davon aus, dass eine hohe Qualität der Versorgung letztendlich preiswerter ist als ein schlechtes Qualitätsniveau der Versorgung. Die weltweit anerkannten Autoren gehen darüber hinaus davon aus, dass der Wettbewerb im Gesundheitssystem zukünftig überwiegend regional und nur in ausgesuchten Feldern national ausgerichtet sein wird. Das von Porter und Olmsted Teisberg geforderte Redesign der Prozesse bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen gilt auch für das Marketing. Mit einem traditionellen Marketingansatz wird man den zukünftig geltenden Regeln nicht mehr gerecht werden. Nur durch ein paralleles Redesign des Marketings Komplexität im Marketing Marketing „Klassisches“ B2PMarketing 2010 Direct-to-Consumer- Neues Stakeholder- Direktvertrags- Marketing B2B- marketing marketing Marketing evidenzbasiertes Marketing ↘ Die zehn Gesetze des evidenzbasierten Marketings – im Sinne der evidenzbasierten Medizin – wird man erfolgreich bestehen können. Einschneidende Schlussfolgerungen lassen sich aus den in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Szenarien ohne große Phantasie ziehen. Ein Mikrokosmos von tausenden einzelnen Leistungserbringern wird durch professionelle und aggregierte Dienstleistungsstrukturen abgelöst. Der Standardisierung und Konfektionierung der medizinischen Dienstleistung, statt einer heterogenen Überindividualisierung des Leistungsgeschehens, gehört die Zukunft. Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Benchmarking der eigenen Leistung werden zum Regelfall. Nur für qualitativ bessere Leistungen und Produkte wird zukünftig noch eine bessere Vergütung möglich sein. Man muss sie allerdings schlüssig und nachhaltig – möglichst evidenzbasiert – belegen können. Mit der sich langsam durchsetzenden Erkenntnis, dass ein evidenzbasiertes Marketing auch viele neue Chancen bietet, werden sich vor allem forschende und innovative Unternehmen diesem Konzept zuwenden. 14 Vielleicht kommt es in den nächsten Jahren sogar zu einem entsprechend ausgerichteten Qualitätsmanagement im Marketing. Dann wird es auch eine erste Leitlinie zum evidenzbasierten Marketing geben. Fortschrittliche Unternehmen werden diese Leitlinie als konstitutiv für ihr Marketing ansehen und auf ihre Einhaltung hinwirken. Parallel wird sich eine Zertifizierung des Marketings durchsetzen, welche die Kompetenz und Qualifikation des Marketings nach den Methoden der evidenzbasierten Medizin testiert. Damit wird ein evidenzbasiertes Marketing eher zur Pflicht- als zur Wahlleistung für die Unternehmen werden. Bezüglich des gewählten Akronyms EBM für evidenzbasiertes Marketing lässt sich hieraus auch eine andere Interpretation ableiten, EBM: Ein Besseres Marketing für die Pharmabranche. ← Dr. Klaus-Jürgen Preuß ist Arzt und geschäftsführender Gesellschafter der EPC Healthcare GmbH und verfügt über langjährige Erfahrung in Pharmabranche und Medizintechnikindustrie. Kontakt: [email protected] Kundenorientierung © Foltolia Der Patient im Fokus Stand in den vergangenen Jahrzehnten der Arzt im Fokus der kommerziellen Aktivitäten der Pharmaindustrie, so richtet sich ihr Augenmerk immer mehr auf die umfassende Betreuung der Patienten. Aber außer der Einsicht, dass diese Verschiebung neue Geschäftsmodelle ermöglicht, bietet die Industrie bislang wenig konkrete Lösungen für die Umsetzung. Autor: Karsten Sternberg 15 Aber warum soll oder gar muss denn der Patient in dem komplexen Zusammenspiel von Verschreibern, Erstattern und dispensierenden Apothekern überhaupt berücksichtigt werden? Schließlich ist er ja nur der „Konsument“. Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten: Erstens: Der traditionelle Marketing- und Sales-Ansatz stumpft zunehmend ab. Seit Jahrzehnten sind sich die Marketing- und Vertriebskonzepte für patent- Kundenorientierung geschützte Medikamente der meisten Hersteller sehr ähnlich. Der gesamte Marketingmix mit allen Facetten rund um Meinungsbildner, Spezialisten und Allgemeinmediziner wird virtuos bei jedem Launch repliziert und die Vertriebsaktivitäten rund um A-, B- und C-Segmente appliziert. Jahrelang waren große Außendienstlinien maßgeblich für den Umsatzerfolg der Produkte. Aber Rabattverträge mit den Krankenkassen, notwendige Kosten-Nutzen-Analysen von neutralen Instituten, gesetzlich limitierte Arztbesuche und reduzierter Einfluss der Außendienstlinien bei Ärzten haben das Marktumfeld verändert. Ein neuer Ansatzpunkt ist die Fokussierung auf den Patienten. Den Herstellern, die dies bereits praktizieren, fehlen hierfür jedoch die maßgeschneiderten und umfassenden Marketingkonzepte. In Ermangelung alternativer Ansätze begnügen sie sich mit sporadischen oder Standardprogrammen, die oft nicht die gewünschte Wirkung entfalten und kaum nachhaltig sind. Zweitens: Die Patienten haben sich verändert. Sie sind – vor allem Dank des Internets – viel aufgeklärter als früher und daher auch immer selbstbewusster. Während viele der älteren Generation die verschriebene Arznei in der Regel widerspruchslos und im vollen Vertrauen auf ihren Arzt eingenommen haben, so fragt die jüngere Generation häufig kritisch nach und diskutiert Therapie und Medikation mit dem Arzt. Dies gilt – berechtigterweise – umso mehr, je schwerwiegender die Erkrankung ist. Gerade viele chronisch Kranke sind in medizinischer Hinsicht sehr mündig geworden und wissen bestens Bescheid um therapeutische Alternativen. Hinzu kommen gut aufgestellte und informierte Patientenorganisationen, die vor allem chronisch Kranke mit umfangreichen Informationen versorgen. Drittens: Die Industrie hat einen weiteren wesentlichen Grund für die Orientierung in Richtung Patienten erkannt: das Thema Adhärenz. Zahlreiche Untersuchungen auf Ebene der Patienten ergeben mittlerweile alarmierende Einblicke in das Einnahmeverhalten. Ging man bislang davon aus, dass chronisch kranke Patienten wenigstens den Großteil ihrer Medikamente regelmäßig wie verordnet einnehmen, der Arzt bei Nebenwirkungen die Dosierung neu einstellt und die Nicht-Einnahme eher die Ausnahme war, so zeigen patientenbasierte Studien inzwischen ein komplett anderes Bild. Innerhalb der ersten zwölf Monate sind je nach in der Grafik aufgezeigter Indikation lediglich zwischen 47 und 70 Prozent der Patienten adhärent, und selbst bei AIDS nehmen annähernd 20 Prozent ihre Medikation nicht oder zumindest nicht wie verordnet. Das beobachtete Einnahmeverhalten hat drastische Folgen. Zunächst für den Patienten selbst, da Falscheinnahme, Unterbrechungen oder gar der 16 Abbruch der Einnahme den Therapieerfolg deutlich reduziert. Unterschiedliche Studien zeigen aber auch, dass durch „Non-Adherence“ – wie zu erwarten war – die Hospitalisierungkosten deutlich steigen. Für die Pharmaindustrie ergeben sich aus dieser Erkenntnis zwei wesentliche Konsequenzen. Erstens: Ein geringerer Therapieerfolg für den Patienten oder schlimmstenfalls erhöhte Nebenwirkungsmeldungen aufgrund fehlender Adhärenz können die Zulassung des Präparates gefährden. Zweitens: Zielt der bisherige Marketingansatz darauf ab, den Arzt zu überzeugen, das beste Medikament für den Patienten zu vertreiben, so konterkariert der Patient diese Aufwendungen durch sein eigenes Fehlverhalten, durch fehlende Adhärenz. Besonders offensichtlich ist dies bei chronischen Erkrankungen, bei denen die Medikation langfristig dem Patienten helfen sollte und Jahrestherapiekosten hoch sind. All die in einem Jahr abgesprungenen Patienten müssen, wirtschaftlich betrachtet, wieder zurückgewonnen werden, um Absatz und Umsatz zu halten. Beides führt dazu, dass immer mehr Pharmaunternehmen den Patienten in ihre Marketingaktivitäten involvieren wollen. So findet sich beispielsweise folgendes Zitat im Jahresbericht 2010 der Novartis AG: „Prior to the launch of Gilenya, we talked with patients, physicians and payers about possible hurdles to access to treatment. We wanted to design a program that would address their needs.“ Kundenorientierung Unterschiedliches Einnahmeverhalten Gefährdeter Therapieerfolg: Innerhalb der ersten zwölf Monate sind je nach Indikation lediglich zwischen 47 und 70 Prozent der Patienten adhärent. Wie können diese Patientenansätze seitens der Pharmaindustrie aussehen? Hier gibt es einige Hürden und Unsicherheiten zu überwinden, die bis dato dazu beitragen, dass sich die Industrie eher in Zurückhaltung geübt hat: •Die gesamte Marketing- und Vertriebsorganisation sowie das Instrumentarium wurden darauf fokussiert, optimal die Ärzteschaft zu informieren. Daher gibt es weder die Instrumente, noch die Kultur, mit Patienten zu arbeiten. Allenfalls Patientenorganisationen wurden in der Vergangenheit sporadisch involviert. •Eine gewisse Unsicherheit bei jeglicher Art der Patientenaktivität resultiert aus dem rechtlichen Kontext. Unter welchen Voraussetzungen darf mit dem Patienten gearbeitet werden? Wie sehen Datenschutzbestimmungen dazu aus? Ergänzend dazu: das Damoklesschwert des Heilmittelwerbegesetzes. •Die Beziehung zwischen Arzt und Patient sollte ungestört bleiben. Für alle diese Punkte gibt es nachhaltige Lösungen. Sicherlich ist die kulturelle Umstellung der eigenen Organisation ein großes und auch langfristiges Vorhaben. Daher bedienen sich mittlerweile viele Pharmakonzerne des Outsourcings und wenden sich an professionelle Dienstleister, die sich auf patientenzentrierte Services spezialisiert haben. Dazu bietet der Dienstleistungspartner maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten und Konzepte an, die an das Produkt, die Zielgruppe und den jeweiligen geografischen Markt angepasst sind und gleichzeitig den Außendienst des Herstellers sowie den Arzt integrieren. Dies mag sich zunächst kompliziert anhören, ist es aber nicht. Denn in aller Regel trägt der Außendienst die patientenzentrierten Programme an den Arzt heran und bekommt damit sogar ein neues Tool für die Interaktion mit dem Arzt an die Hand. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Pharmamarktes sind stets zu beachten, stellen jedoch meist 17 keine Hürde dar. Grundsätzlich muss der Patient jedem Service, dem man ihm nahebringen will, zustimmen – eine Patientenzustimmung, so wie die Industrie sie von klinischen Studien her kennt. Nur wenn ein Patient aktiv zustimmt, darf er über Services betreut werden. Welche Services der Patient erhalten kann, ist in Europa von Land zu Land im Detail unterschiedlich. Grundsätzlich darf die Applikation des Medikaments am Patienten zu Hause nicht von der Krankenschwester vorgenommen werden – mit Ausnahme in Großbritannien. Jede Form von Aufklärung zur Krankheit, der Wichtigkeit der regelmäßigen Medikamenteneinnahme, die Erinnerung zur Einnahme oder die Erklärung, wie Autoinjektoren benutzt werden, ist hier möglich. Psychosoziale Unterstützung hilft chronisch Kranken und erhöht deren Einsicht zur Adhärenz. Diese Programme unterstützen letztlich die Therapie des Arztes, der, wenn er vom Nutzen überzeugt ist, sie auch aktiv seinen Patienten anbietet. In einigen europäischen Ländern sind solche Programme bereits im Einsatz. In Finnland unterstützen Krankenschwestern in Kliniken die frühzeitige Diagnose von AlzheimerPatienten. Zu diesem Zweck schulen diese Schwestern im Auftrag eines Pharmaunternehmens das Klinikpersonal, worauf bei einer Diagnose zu achten ist und wie die Patienten bereits in sehr frühem Kundenorientierung Stadium identifiziert werden können. Patientenfragebögen ergänzen das Programm. Mithilfe dieses Ansatzes konnten 2010 rund 2 500 Klinikmitarbeiter in 40 Kliniken geschult werden. Das Feedback der Mitarbeiter war sehr positiv. Ebenfalls in Skandinavien setzten Kliniken Programme auf, um die Qualität eines TNF-Alpha-Hemmers zu erhöhen und gleichzeitig die Infusionszeiten zu reduzieren. Dazu nahmen in Schweden 45 Kliniken an einem von der Industrie finanzierten Programm teil, welches die Prozessqualität erhöhte, von der wiederum der Patient profitiert. In Deutschland gibt es Programme, bei denen Krankenschwestern Multiple-Sklerose-Patienten betreuen. Sobald der Patient zugestimmt hat, erfolgt die persönliche Betreuung zunächst durch den Besuch einer ausgebildeten Fachkraft. Persönliche Besuche wechseln sich ab mit Anrufen eines medizinischen Servicecenters; der Patient hat auch die Möglichkeit, das Servicecenter selbst anzurufen. Inhalte der Gespräche sind Fragen rund um das Präparat, Antworten im Zusammenhang mit der Krankheit zu geben und auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Einnahme zu verweisen. Gemeinsam ist diesen Beispielen, dass sie darauf abzielen, den Erfolg der Therapie zu erhöhen, was dem Patienten zugutekommt. Daher finden diese Programme auch eine breite Unterstützung der involvierten Health-Care-Professionals. Die Steigerung der Adhärenz der beschriebenen Programme ist durchaus beeindruckend. So beschreiben Beteiligte in einigen Fällen eine Steigerung der Adhärenz von 60 auf bis zu 90 Prozent für in die Programme eingeschlossene Patienten. Dabei stehen der damit verbundenen Umsatzsteigerung überschaubare Kosten für das Programm gegenüber, die insgesamt somit zu einem erheblichen Return of Investment (ROI) der Maßnahme führen. Zusätzlich führt das Design der Maßnahme zu einer recht zuverlässigen ökonomischen Steuerungsmöglichkeit. So ist beispielsweise eine individuelle Betreuung der Patienten durch Krankenschwestern bei teuren Biotech-Produkten sinnvoll, während bei Produkten mit vergleichsweise geringen Jahrestherapiekosten die Maßnahme weniger über den persönlichen Kontakt, sondern mehr über allgemeine Kommunikationskanäle wie SMS-Reminder, Outbound-Call-Center oder auch Remote-rep-Konzepte konzipiert werden kann, um den ökonomischen Erfolg zu sichern. Bei den patientenorientierten Dienstleistungen gibt es im Wesentlichen drei unterschiedliche Ansatzpunkte: •Beim Arzt oder in der Klinik durch operative Hilfestellung in der Diagnose beziehungsweise auch im Prozessmanagement. •Beim Apotheker; hier kann durch Apothekenschu- 18 lungen Aufklärungsarbeit für den Patienten erfolgen, um diesen immer wieder an die Notwendigkeit der Adhärenz zu erinnern. •Der direkteste Ansatzpunkt ist beim Patienten selbst, was dessen persönliches Einverständnis voraussetzt und über den behandelnden Arzt zu lancieren ist. Das Feedback von involvierten Ärzten zeigt sehr deutlich, dass sich ein gut aufgesetztes Patientenprogramm auch positiv auf das Verordnungsverhalten auswirkt. Dies überrascht wenig, denn der Arzt partizipiert auch nur dann im Programm, wenn er von dessen Ziel und Durchführung überzeugt ist. Sofern diese Voraussetzung erfüllt ist, differenziert sich das Pharmaunternehmen von seinem Wettbewerb in der Wahrnehmung des Arztes. Nicht zu unterschätzen ist der gesundheitsökonomische Aspekt. Gute Adhärenz reduziert die Hospitalisierungskosten und erhöht gleichzeitig den Therapieerfolg. Beide Argumente können dazu beitragen, die Verhandlungsposition des Pharmaunternehmens gegenüber Behörden und auch Krankenkassen zu stärken. ← Autor Karsten Sternberg ist Vice President Global Business Development beim Outsoursing-Dienstleister Pharmexx. Kontakt: [email protected] ng Neuerscheinu Januar 2011 Handbuch Market-Access Marktzulassung ohne Nebenwirkung Das Thema Market-Access hat insbesondere in Folge des drastischen Wandels der gesetzlichen Rahmenbedingungen einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Ziel des Buches ist es, einen ersten Beitrag zu den Gestaltungsmöglichkeiten eines erfolgreichen und umfassenden Market-Access zu leisten. E rfahrene Autoren stellen praxisnah anhand vieler konkreter Beispiele den gesamten Produktlebenszyklus eines Arzneimittels von der präklinischen Entwicklung bis zur Kosumption durch den Endverbraucher aus der Perspektive des Market-Access dar. V on Insidern für Market-Access-Professionals geschrieben dient es als umfangreiches Nachschlagewerk für alle Fragen zum Market-Access. D ie Impacts des Arzneimittelneuordnungsgesetzes (AMNOG) wurden berücksichtigt. Dr. Thomas Ecker/Dr. Klaus-Jürgen Preuß/ Prof. Dr. Ralph Tunder (Hrsg.) Handbuch Market-Access Markzulassung ohne Nebenwirkungen ISBN 978-3-942543-00-2 Preis: € 149,–, 731 Seiten Nehmen Sie die Hürde Market-Access und bestellen Sie das umfassende Nachschlagewerk zum Preis von € 149,- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten www.fachverlag-shop.de/pmj-buecher. 19 Social CRM Der öffentliche Dialog mit der Zielgruppe Die sozialen Medien machen vor der Pharmabranche nicht halt. Allerdings besteht die Gefahr, in den Unternehmen Social-Media-Silos zu etablieren. Dabei bieten sie die Gelegenheit, die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zu erforschen und auf diese einzugehen. Autor: Dominique Löpfe Zur unumkehrbaren Tatsache ist längst der Trend geworden: Social-Media-Plattformen haben sich durchgesetzt und fest im Alltag von Abermillionen Menschen etabliert. Und noch immer können Facebook, Twitter und Co. mit immer neuen Nutzer­ rekorden aufwarten. Unter diesen Millionen Nutzern befinden sich selbstverständlich auch viele Ärzte, Apotheker und Patienten. Entsprechend interessant ist es für Pharmaunternehmen, die Kommunikation 20 in den sozialen Medien zu verfolgen oder sich an ihr zu beteiligen – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und unter Sicherstellung der ComplianceAnforderungen. Seit jeher ist die Interaktion mit dem Kunden eine der zentralen Aufgaben eines Customer-RelationshipManagement-Systems. Und weil modernes Customer Relationship Management (CRM) sich nicht mehr nur auf die klassischen Kommunikationskanäle wie Social CRM Telefon, Brief und E-Mail beschränken kann, schlägt derzeit die Stunde einer neuen CRM-Disziplin: die des Social CRM. Für manche Anbieter von CRM-Systemen ist Social CRM lediglich eine neue unternehmensinterne Kommunikationsform – das Social Networking findet intern statt und es sind die eigenen Mitarbeiter, die sich mittels der CRM-Applikation austauschen. Der wahren Bedeutung der Social Media werden solche Systeme natürlich nicht gerecht. Die große Stärke von Systemen und Modulen für Social CRM ist es gerade, dass sie im Idealfall eng mit der operativen CRM-Lösung eines Pharmaunternehmens verzahnt sind: Social Media werden integraler Bestandteil des CRM-Systems, und alle möglichen Zielgruppen-Kontaktkanäle werden tatsächlich im selben System abgebildet. Nur so kann ein CRM-System seine Aufgabe, für Transparenz in der Zielgruppenkommunikation zu sorgen und das Organisationswissen zu erhalten, wirklich erfüllen. Alle Kontaktvorgänge – ob per Brief, E-Mail, Telefon oder aus dem Social-MediaDialog – sind im selben CRM-System dokumentiert. Unbestreitbar ist Social-Media-Monitoring, das Beobachten der Meinungsbilder und Themen im Web, eine wichtige Aufgabe für alle Life-Sciences-Unternehmen. Wenn sich über medizinische Produkte ein Dialog auf Social-Media-Plattformen, in Blogs oder Foren ent- Informationen auf einen Blick Identifizieren – analysieren – reagieren: Das Monitoring von Social Media, Blogs und Foren dient sowohl der Konkurrenzbeobachtung als auch gerade relevanter Pharmathemen im Web. faltet, ist es wichtig, die Meinungen der beteiligten Ärzte, Apotheker und Patienten zu verfolgen und zu analysieren. Entsprechend groß ist die Zahl der Tools, die speziell für das Social-Media-Monitoring angeboten werden. Solch eine softwaregestützte und weitgehend automatisierte Social-Media-Beobachtung liefert zweifellos wichtige Erkenntnisse über Key Opinion Leader, medizinische Fachkräfte und Stakeholder, die mit herkömmlichen Methoden der Marktforschung sehr viel teurer bezahlt werden müssten. Solche Tools zum reinen Social-Media-Monitoring haben aber einen ganz entscheidenden Nachteil: sie ignorieren die dialogische Form, die Social Media zwangsläufig mit sich bringen. Social Media dienen 21 der Kommunikation, und damit sind sie eben nicht ein bloßes Meinungsbarometer, sondern auch ein wichtiger Kanal der Kundenkommunikation. Was nutzt es einem Pharmaunternehmen, wenn sich auf einer Social-Media-Plattform, in einem Forum oder in einem Blog immer mehr Nutzer kritisch über ein bestimmtes Medikament äußern, der Hersteller dies wahrnimmt, aber nicht auf eben dieser Plattform auch auf die Kritik antwortet? Es gilt, Social Media als weiteren möglichen Kanal der Kundenkommunikation ernst zu nehmen. Genau dies macht die Stärke guter Social-CRM-Lösungen aus: sie helfen nicht nur, die für ein Unternehmen wichtigen Konversationen zu identifizieren und zu analysieren, sie können auch automatisch die entsprechenden Unternehmensprozesse auslösen – und nachvollziehbar dokumentieren. Eine gute Social-CRM-Lösung kann zum Beispiel das Service-Management von Pharmaunternehmen verbessern, indem es die relevanten Mitarbeiter auf Social-Media-Beiträge aufmerksam macht, bei denen es wichtig sein kann, direkt und zeitnah darauf zu antworten. Welche Rolle Social CRM zukünftig in der pharmazeutischen Industrie spielen wird, hat das Marktforschungsunternehmen Makam Market Research aus Wien im Auftrag der Update Software AG kürzlich untersucht. Die herstellerneutrale Studie „Deep Insight: CRMTrends in der Life-Sciences-Industrie 2011 – Wie neue Social CRM Rahmenbedingungen CRM-Prozesse und -Zielgruppen revolutionieren“ kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Rahmenbedingungen für das Customer Relationship Management grundlegend wandeln werden. Denn Pharmaunternehmen agieren in einem Umfeld der besonderen Art: sie sind nicht nur strengen gesetzlichen Regularien unterworfen, sondern unter den Anbietern herrscht auch großer Konkurrenzdruck, der sich durch die Globalisierung weiter verstärkt. Darum ist die Pharmabranche aufgefordert, ihre Vertriebsprozesse zu straffen und die strategischen Herausforderungen anzunehmen, die neue Zielgruppen und Kommunikationskanäle an sie stellen – mithilfe neuer Technologien wie Social CRM. Außerdem erfordert die verstärkte Fokussierung auf Patienten, Krankenkassen und Einkaufsverbünde eine optimierte Dokumentation von Kontakten, eine verbesserte Wahrnehmung von Beziehungen zwischen den Protagonisten im Gesundheitssystem und nicht zuletzt eine erweiterte Form der Ansprache – etwa durch die aktive Nutzung der Social Media. Doch nicht nur Pharmaunternehmen können von den Möglichkeiten profitieren, die ihnen die Social Media bieten. Für ihre Zielgruppen bedeutet der Siegeszug der sozialen Medien eine neue kommunikative Macht. Ihre Meinungsäußerungen haben ein potenziell viel größeres Gewicht als früher – sie sind öffentlich und prinzipiell für jeden zugänglich, der sich darum bemüht. Eine wichtige Aufgabe der Social-Media-Analyse ist es darum, möglichst automatisiert die Relevanz der einzelnen Äußerungen bestimmen zu können – ansonsten kann die Beschäftigung mit den Social Media leicht zu einem sehr ärgerlichen Zeitfresser werden. Ein gutes Social-CRM-Modul beherrscht den Dreiklang: es identifiziert die relevanten Diskussionen im Social Web, analysiert sie und leitet die richtige Reaktion darauf ein. Vielleicht bedarf nicht jede Beschwerde einer öffentlichen Antwort, aber die Meinungsführer innerhalb der eigenen Branche sollte jedes Pharmaunternehmen in den Social Media identifizieren können. Es schadet gar nichts, hier mit offenem Visier aufzutreten, im Gegenteil. Wenn das Life-Sciences-Unternehmen selbst beispielsweise zum Twitter-Follower eines solchen Meinungsführers wird, demonstriert das ein legitimes Interesse an dessen Meinung. Und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens, das sich offen dem Dialog mit seiner Zielgruppe stellt, kann nur wachsen. Manche Branchen sind bei der Beschäftigung mit Social Media und mit Social CRM schon weiter als andere. Insbesondere die pharmazeutische Industrie, die bisher aufgrund der Werberestriktionen für verschreibungspflichtige Arzneimittel keine Möglichkeit zum direkten Kundenkontakt hatte, erschließt sich über die Social-Media-Plattformen einen Kanal, auf dem sie ihren Kunden direkt zuhören kann. Nicht zuletzt die 22 Analyse von Meinungsbildern macht Social Media für die Pharmabranche attraktiv – zudem ist diese Analyse oft kostengünstiger als klassische Marktforschung. Die Diskussionen im Web zu ignorieren, wäre in der Life-Sciences-Branche fahrlässig. Zumal das Monitoring von Social Media, Blogs und Foren durchaus auch der Konkurrenzbeobachtung dient. Eine gute Social-CRM-Lösung kann helfen, sämtliche Themen zu identifizieren, die in der pharmazeutischen Branche gerade relevant sind und im Web besonders intensiv diskutiert werden. Bei den Kommunikationsvorgängen in den Social Media gilt es natürlich, auch alle Compliance-Anforderungen strikt einzuhalten – gerade im Kontext verschreibungspflichtiger Medikamente. Zwar sind Social Media ihrer Natur nach dialogisch, und oft leben Firmen-Accounts davon, dass sich eine größere Zahl an Mitarbeitern am Informationsaustausch beteiligt und beispielsweise twittert. Es gibt aber für Pharmahersteller doch einen einfachen Weg, unbeabsichtigte Compliance-Verstöße zu verhindern: indem Social-Media-Kommunikation durch geeignete Tools kanalisiert und überwacht wird. Dann fungiert die Social-Media-Lösung, die das Unternehmen einsetzt, als eine Art Firewall für ausgehende Nachrichten. In einem Wörterbuch kann ein Pharmaunternehmen einfach Wörter mit bestimmten Bedeutungen und Definitionen hinterlegen und deren Social CRM Verwendung in den Social Media durch die eigenen Mitarbeiter automatisiert blockieren. So sorgt das Unternehmen dafür, dass Mitarbeiter keine Dinge in den Social Media posten, die sie nicht sollten, und dass auch in allen Tweets die besonders strengen Compliance-Richtlinien für Pharmaunternehmen eingehalten werden. ↘ Sieben Schritte zum Social CRM 1.Legen Sie sich eine Strategie zurecht 2. Definieren Sie Ihre Ziele Das durch Social Media alles völlig anders werde, scheinen viele Unternehmen zu glauben – und schaffen kurzerhand die Stelle eines dedizierten Social-Media-Beauftragten. So löblich ein solches Social-Media-Engagement auch ist, letztlich greift es doch zu kurz. Denn in Wirklichkeit sind nahezu alle Mitarbeiter im Unternehmen, die bisher schon in einer Beziehung zu Ärzten und Institutionen standen, auch von der Kommunikation betroffen, die in den Social Media stattfindet. Was bleibt beispielsweise dem Social-Media-Beauftragten, der üblicherweise aus dem Marketing stammt, anderes übrig, als die MedWiss-Anfrage, die er im Web entdeckt hat und 3.Stellen Sie sicher, dass diese Ziele auch umsetzbar sind 4.Bestimmen Sie Verantwortliche für die Umsetzung 5. Legen Sie Richtlinien fest die er nicht beantworten kann und darf, dann doch an einen Mitarbeiter aus der medizinischen Fachabteilung weiterzuleiten? Der vielleicht größte Fehler, den Pharmaunternehmen in Sachen Social Media machen können, ist, das Thema isoliert zu betrachten und eine Art Social-Media-Silo aufzubauen, personell und in ihren Prozessen. Denn vor allem eröffnen die Social Media einen weiteren Kommunikationskanal – über die bestehenden hinaus. Genauso wie das CRM-System bisher schon E-Mails an die für die Beantwortung geeigneten Mitarbeiter weitergeleitet hat, muss ein Social-CRM-Modul auch mit Fragen verfahren, die es in den Social Media entdeckt. Zielgruppenkommunikation ist eine Aufgabe, die das ganze Unternehmen durchdringen sollte – genauso wie die Philosophie der Kundenorientierung. Es ist die große Chance, welche die Social Media eröffnen: sie geben der pharmazeutischen Industrie eine herausragende Gelegenheit in aller Öffentlichkeit zu zeigen, wie ernst es ihnen damit ist, auf ihre Patienten, Ärzte und Vertriebspartner zu hören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Wer Social CRM lebt, ist näher an seiner Zielgruppe. ← 6. Nutzen Sie die Informationen 7.Kontrollieren und adaptieren Sie Ihre Zielsetzungen 23 Dominique Löpfe ist Produktmanager Cosmic des CRM-Software-Spezialisten Update Software AG. Kontakt: [email protected] Recht Werbeflyer auf der Verpackung Das Oberlandesgericht (OLG) München hat entschieden, dass ein Werbeflyer, durch den ein Arzneimittel beworben wird, auf der Verpackung eines anderen Arzneimittels angebracht werden darf. Zumindest dann, wenn der Flyer ohne nennenswerten Kraftaufwand von der Verpackung gelöst werden kann. Autor: Simon Menke Bei dem beklagten Pharmaunternehmen handelte es sich um ein pharmazeutisches Unternehmen, das ein rezeptfreies, apothekenpflichtiges Präparat zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen vertreibt. Auf der Längsseite der Verpackung dieses Präparats hatte es mithilfe von Klebepunkten einen Flyer befestigt, in dem für ein anderes Präparat des Beklagten geworben wurde. Hiergegen wandte sich der Kläger, ein Verein zur Selbstkontrolle der pharmazeutischen Industrie. Nach der Auffassung des Klägers hat der Beklagte durch das Anbringen des Werbeflyers unter anderem gegen die Vorgaben aus § 10 Abs.1 Satz 5 Arzneimittelgesetz (AMG) verstoßen. Die Regelung in § 10 AMG beinhaltet einzelne Pflichtangaben, die auf den Behältnissen beziehungsweise äußeren Um- hüllungen von Arzneimitteln wiederzugeben sind. Zu diesen Pflichtangaben gehören unter anderem der Name sowie die Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens und die Zulassungsnummer des Präparats. § 10 Abs.1 Satz 5 des Arzneimittelgesetzes sieht vor, dass weitere Angaben als die gesetzlich vorgeschriebenen unter anderem nur dann zulässig sind, wenn sie „mit der Anwendung des Arzneimittels im Zusammenhang stehen und für die gesundheitliche Aufklärung der Patienten wichtig sind“. Die in dem Werbeflyer des Beklagten wiedergegebenen Angaben zum beworbenen Produkt seien der Ansicht des Klägers nach gerade nicht wichtig für die Aufklärung der Patienten, da sie ein ganz anderes Präparat betreffen. 24 Recht Nachdem in der ersten Instanz das Landgericht (LG) der Klage stattgegeben hatte, wurde diese nun vom OLG München abgewiesen. Nach der Auffassung des OLG München ist die Vorschrift in § 10 AMG in dem vorliegenden Fall gar nicht anwendbar, da der Werbeflyer nicht Bestandteil der Verpackung des Rheumapräparats sei (Urteil vom 05.05.2011, Az. 6 U 3795/10). Dies begründete das Oberlandesgericht damit, dass der Werbeflyer von dem Verbraucher durch einen zumutbaren Kraftaufwand von der Verpackung gelöst werden konnte und deswegen nur vorübergehend auf dieser angebracht worden sei. Trotz der Fixierung des Flyers auf der Verpackung erkenne der von diesem angesprochene Verbraucher, dass es sich bei der Verpackung und der Werbung um unterschiedliche Gegenstände handle. Für diesen entstehe nicht der Eindruck, dass der Flyer Bestandteil des Rheumapräparats ist. Dies sei auch trotz des Umstands, dass der Flyer und die Verpackung eine ähnliche Aufmachung aufwiesen, der Fall. Es sei schließlich von der Beklagten auch gewollt, dass der Erwerber des Rheumamittels den Flyer als Werbung für ein anderes Präparat erkennt. Für eine Anwendbarkeit der Regelung in § 10 Abs. 5 AMG spreche auch nicht der dieser zugrunde liegende Gedanke, dass die Verbraucher nicht durch andere Informationen als die vorgeschriebenen Pflichtangaben verunsichert oder verwirrt werden sollen. Dieser Vorbehalt gelte nämlich nur für Angaben, die auf der Verpackung selbst wiedergegeben sind. Diese Entscheidung ist von erheblicher Relevanz für Pharmaunternehmen. Dies liegt daran, dass sie insbesondere dann, wenn Werbeflyer auf Verpackungen von Arzneimitteln, die einen großen Verbreitungsgrad aufweisen, angebracht werden, einen beachtlichen potenziellen Abnehmerkreis wirksam bewerben können. Auch wenn das OLG München in seiner Begründung ausführt, dass die Erwerber des Präparats zwischen der Verpackung an sich und dem Werbeflyer genau unterscheiden würden, wird eine Vielzahl der Erwerber den Flyer trotzdem zur Sicherheit zumindest oberflächlich durchlesen. In diesem könnten nämlich vielleicht doch wichtige Informationen zu dem erworbenen Präparat wiedergegeben sein. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Vorgehens des Erwerbers könnte im Übrigen noch dadurch erhöht werden, dass für den Flyer eine Aufmachung gewählt wird, die der der Verpackung ähnelt. Dies hat zu Recht auch der Verein zur Selbstkontrolle der pharmazeutischen Industrie in dem beschriebenen Rechtsstreit vorgetragen. Die Wirksamkeit der Werbung könnte außerdem unter Umständen noch vergrößert werden, wenn in dieser Präparate beworben werden, die als Ergänzung zu dem erworbenen Arzneimittel eingenommen werden können. 25 Bei Werbung mittels auf der Verpackung von Arznei­ mitteln angebrachten Flyern müssen Pharmaunternehmen unbedingt darauf achten, dass diese ohne einen nennenswerten Kraftaufwand von der Verpackung gelöst werden können. Darüber hinaus sind die Flyer derart anzubringen, dass keinerlei auf der Verpackung wiedergegebene Pflichtangaben von diesen verdeckt werden. Wollen die Pharmaunternehmen sich rechtlich weiter absichern, sollte der Werbeflyer nicht die identische Aufmachung wie die Verpackung aufweisen. Auch wenn es nach der Ansicht des OLG München für die rechtliche Bewertung auf die Aufmachung des Flyers nicht (entscheidend) ankommt, könnte der Bundesgerichtshof (BGH) dies in einer abschließenden Entscheidung noch anders sehen. Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass das OLG München in dem vorliegenden Fall die Revision zum BGH nicht zugelassen hat, so dass dieser sich mit den in diesem Beitrag erörterten Rechtsfragen wohl nicht zeitnah beschäftigen wird. Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass der Werbeflyer den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen hat. ← Dr. Simon Menke ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dr. Bahr in Hamburg. Kontakt: [email protected] Kolumne Brand Bias bei der OTC-Marke Die Selbstmedikationsindustrie kann noch deutlich Markenpotenziale heben. Viele sprechen über die OTC-Marke. So hat die Zeitschrift „Der erfolgreiche Apotheker“ den Award „TopMarke 2011“ an 15 OTC-Marken verliehen. Ich hatte den Jury-Vorsitz übernommen und zwangsläufig viel intensiver als sonst mit Produktmanagern, Marketingund Vertriebsleitern gesprochen oder Selbstauskünfte studiert. Mein bleibender Eindruck: Die Branche hat gravierende Probleme. Es waren Produktverantwortliche von einem gestützten Bekanntheitsgrad von 100 Prozent überzeugt. So nannte nicht nur einer als seine Markenbesonderheit die generische Substanz. Nicht wenige waren sicher, dass Produkt und Marke praktisch identische Konzepte seien. Nun darf man das nicht pars pro toto nehmen. Doch meine Beobachtung ist: Es sind zu viele Verantwortliche und es ist zu viel falsch. Zwei Begriffe stehen scheinbar gegeneinander: Da ist zunächst die Marktleistung. Sie bündelt alle verkaufsaktiven physischen, informatorischen, logistischen und weiteren Elemente der Nachfrage in ein Angebot. Der Einzelkunde ordnet diese Einzelelemente nach seiner Relevanz und entscheidet dann über die Gesamtleistung. In ihr ist das Produkt nur ein Teilelement. Dagegen steht die Marke. Sie kann als Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft oder hervorrufen soll, um das Präparat von anderen zu unterscheiden. Die Vorstellungen werden durch Namen, Begriffe, Zeichen, Logos, Symbole oder Kombinationen dieser zur Identifikation und Orientierungshilfe bei der Auswahl von Produkten geschaffen. Was eine Marke ausmacht, ist stark von subjektiven Eindrücken geprägt und spielt sich vor allem in den Köpfen und Vorstellungen der Kunden ab. Marktleistung ist also eine „technische“ Marketing­ betrachtung, Marke ist eine Sozialtechnik, die vornehmlich durch Kommunikation und Verhalten gestaltet wird. Marktleistung ist ein induktiver Ansatz, Marke ein deduktiver. Die Marke basiert auf einer vom Kunden eingeforderten Marktleistung und komplexitätsreduzierender Kommunikation. Sie ist damit Element im Customer-Centricity-Konzept. Eine OTC-Marke muss unter anderem wirtschaftliche Bedeutung haben, ein eindeutiges Vorstellungsbild erzeugen und dadurch die notwendige Information re- 26 duzieren, starken Nutzen signalisieren, ideellen Nutzen aufzeigen, Unverzichtbarkeit implizit kommunizieren, Einmaligkeit und Differenzierung zu Wettbewerbern darstellen, eine schnelle Geschichte erzählen und sich so erzählbar machen. Zudem sollte sie wenige Aussagen/Indikationen umfassen und sich eher eng eingrenzen, als Produkt stetig auf der Höhe der Zeit sein und sich erneuern, beeindruckende zusätzliche Marktleistungen anbieten, in Kontinuität und nicht zwingend in Lautstärke kommunizieren sowie der Fantasie mehr Raum geben als der reinen Information Warum sind diese Dinge zu wenig bekannt oder nicht angewandt? Es ist die Selbstüberschätzung – wissenschaftlich Overconvidence Bias. Es ist der Unterschied, was wir wirklich wissen und was wir zu wissen glauben. OTC-Marke mit Overconvidence besitzt nach meiner Einschätzung eine Evidenz von 30 Prozent. Jetzt hat das Topmanagement die Aufgabe, die darin liegenden Markenwertschöpfungspotenziale durch Teaching, Training und Coaching schnellstmöglich zu heben. Die sinnvollste Maßnahme gegen den Brand Bias. ←