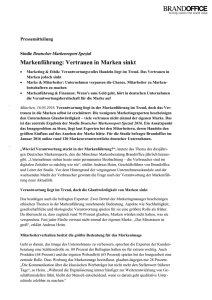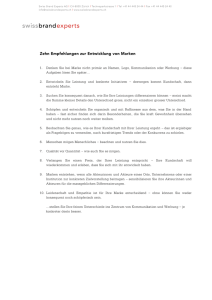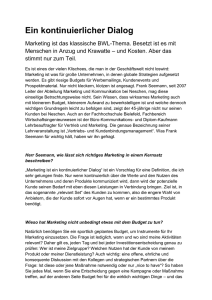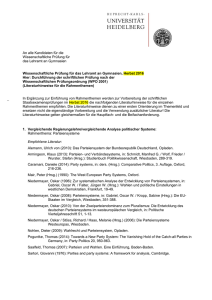Brands go East - Marketing Center Münster
Werbung

Projektbericht Nr. 1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Dieter Ahlert (Hrsg.): Brands go East – Internationale Markenführung und Netzwerkmarketing bei Dienstleistungen Dieter Ahlert Christof Backhaus Johannes Berentzen Markus Blut Manuel Michaelis Wolfgang Ullrich IMADI.net –I – Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS I ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS III ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV TABELLENVERZEICHNIS V 1 EXPORTFÄHIGKEIT UND INTERNATIONALISIERUNG VON DIENSTLEITUNGEN – AUSGANGSPUNKT DES PROJEKTS IMADI.NET 1 2 INHALTLICHER RAHMEN 4 3 TERMINOLOGISCHER RAHMEN 6 3.1 Unternehmensnetzwerke 3.1.1 Systematisierung von Netzwerken 3.1.2 Netzwerkverständnis dieses Projekts 3.2 Marke 6 6 16 17 3.2.1 Ansätze zur Definition der Marke 17 3.2.2 Markenverständnis dieses Projekts 26 3.3 Internationalisierung von Dienstleistungen 28 3.3.1 Grundlagen der Internationalisierungstheorie 28 3.3.2 Dienstleistungen als Betrachtungsgegenstand 31 3.3.3 Ziele, Motive und Barrieren der Internationalisierung von Dienstleistungen 36 3.3.4 Formen der Internationalisierung von Dienstleistungen 37 3.4 Markenführung in internationalen Dienstleistungsnetzwerken 39 3.5 Internationalisierungs-Scorecard 43 4 4.1 OSTEUROPA ALS SCHWERPUNKT Relevanz der Standortwahl 46 46 –II– 4.2 Rahmenbedingungen in Osteuropa am Beispiel von Polen und Tschechien 47 4.3 Markenführung in Osteuropa 49 FAZIT 57 LITERATURVERZEICHNIS 58 –III– Abkürzungsverzeichnis AG Aktiengesellschaft Aufl. Auflage Bd. Band bspw. beispielsweise bzw. beziehungsweise et al. et alii f. folgende ff. fort folgende ggü. Gegenüber GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hrsg. Herausgeber insbes. insbesondere i.S. im Sinne Jg. Jahrgang KG Kommanditgesellschaft KMU Kleine und mittlere Unternehmen MNU Multinationale Unternehmen Nr. Nummer S. Seite u.ä. und ähnliche usw. und so weiter u.U. unter Umständen Vgl. Vergleiche z.B. zum Beispiel –IV– Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Systematik der skizzierten Netzwerkansätze S. 7 Abbildung 2: Organisationsformen ökonomischer Aktivitäten S. 12 Abbildung 3: Ressourcenabhängigkeit und Machtverteilung im Netzwerk S. 14 Abbildung 4: Ansätze der Markendefinition und -führung S. 18 Abbildung 5: Grundformen der Internationalisierung S. 38 Abbildung 6: Standardisierungspotenzial der Kerndienstleistung S. 41 Abbildung 7: Balanced Scorecard S. 45 Abbildung 8: Einflussfaktoren des Markenerfolgs S. 50 –V– Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Typologie interorganisationaler Netzwerke Tabelle 2: Merkmale und Merkmalsausprägungen von Netzwerken Tabelle 3: Ausgewählte Theorien, Ansätze und Modelle der Internationalisierung S. 9 S. 16 S. 30 –1– 1 Exportfähigkeit und Internationalisierung von Dienstleitungen – Ausgangspunkt des Projekts IMADI.net „Jedes Dienstleistungsangebot ist heute potenziell global“ (Stille 2000, S. 11) „…da ist Musik drin“ – so charakterisiert Reichwald (2004, S. 35) die Thematik der Internationalisierung von Dienstleistungen. Die Erfolgsstory der Media-Saturn-Gruppe, die im Jahr 2004 im europäischen Ausland 69 neue Märkte eröffnet hat und für ihre Internationalisierungsstrategie auf internationaler Ebene ausgezeichnet wurde (vgl. o.V. 2004a), gibt hierfür ein anschauliches Beispiel. Andererseits zeigen die Bemühungen von Roland Berger in den USA (vgl. o.V. 2004b) oder Wal-Mart in Deutschland (vgl. Knorr/Arndt 2003, S. 5 ff.), dass ein erfolgreiches „Going International“ kein „Selbstläufer“ ist. Etwa 2/3 der gesamten Weltproduktion werden in Form von Dienstleistungen erwirtschaftet (vgl. o.V. 2004c; John 2004, S. 65) – dabei betrug der Anteil von Dienstleistungen am gesamten Welthandel im Jahr 2004 lediglich 19,3% (vgl. WTO 2005, S. 3).1 In dieser Diskrepanz wird der Grund dafür gesehen, dass dem internationalen Dienstleistungshandel das im Eingangszitat deutlich werdende enorme Wachstumspotenzial zugesprochen wird (vgl. Dolski/Hermanns 2004, S. 87; John 2004, S. 65; o.V. 2004c). So stützen sich auch in Deutschland – mit einem Dienstleistungsanteil von 13,9% am Gesamtexport im internationalen Vergleich sogar noch zurückliegend (vgl. Kreibich/Oertel 2004, S. 1; Ehrenfeld 2004, S. 75 f.) – die Hoffnungen für zukünftiges Wachstum und Beschäftigung auf den Dienstleistungsexport (vgl. Jörissen 2004, S. 100; Reichwald 2004, S. 35; Mangold 1999, S. 13). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Internationalisierungsgrad von Dienstleistungen tendenziell unterschätzt wird, da Dienstleistungsvorleistungen als Teil von Exportindustrieware nicht in der Dienstleistungsbilanz erfasst werden. (vgl. hierzu Lichtblau 2000, S. 264; Stille 1999, S. 70; John 2004, S. 74) Trotz des negativen Gesamtsaldos der deutschen Dienstleistungsbilanz, zu dem neben dem Reiseverkehr 1 In diesem Zusammenhang sei auf die Problematik der Erfassung des internationalen Dienstleistungshandels hingewiesen; vgl. hierzu Hübner 1996, S. 63 f. Zur Bedeutung des GATS vgl. auch Linnemann 2004, S. 65 ff. –2– u.a. auch Kommunikationsdienstleistungen, Ingenieur- und technische Dienstleistungen (vgl. hierzu ausführlich Belitz/Stille 2004, S. 1 ff.) sowie Patente und Lizenzen beitragen, werden die Chancen Deutschlands zur Ausnutzung der konstatierten Potenziale als positiv gewertet (vgl. Schultz/Weise 2000, S. 46; Bullinger 2004, S. 22). Die Notwendigkeit dazu wird vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Arbeitsplatzverlagerungen im Produzierenden Gewerbe (vgl. hierzu bspw. Garz/Gilles 2004, S. 24) besonders deutlich. Vor diesem Hintergrund verfolgt das Projekt IMADI.net zwei grundsätzliche Zielsetzungen: Zum einen sollen Maßnahmen ermittelt werden, mit denen deutsche Dienstleistungsunternehmen die Wahrnehmbarkeit und Präferenz für ihre Dienstleistungen im Ausland erhöhen können. Diese Zielsetzung stellt auf ein optimal angepasstes Markenmanagement ab. Zweitens geht es um die Verbesserung der Verfügbarkeit deutscher Dienstleistungen im Ausland. In diesem Kontext sollen Organisationskonzepte wie Netzwerke und Franchising analysiert und so die Frage nach einer potenziell optimalen Koordinationsform der Internationalisierung beantwortet werden. Im Sinne einer integrierenden Herangehensweise gliedert sich das Projekt IMADI.net daher in drei Handlungsfelder: • Handlungsfeld 1: Markenführung in internationalen Dienstleistungsnetzwerken • Handlungsfeld 2: Internationalisierung von KMUs • Handlungsfeld 3: Internationalisierung im Textilhandel Im Einzelnen liegen dem Projekt IMADI.net in den jeweiligen Handlungsfeldern folgende Forschungsfragen zu Grunde: Handlungsfeld 1: Markenführung in internationalen Dienstleistungsnetzwerken 1. Welche Realtypen existieren in Bezug auf die internationale Markenführung in Dienstleistungsnetzwerken? 2. Welche Hauptprobleme bestehen bei der internationalen Markenführung in Dienstleistungsnetzwerken? 3. Was sind die erfolgsentscheidenden Faktoren netzgeführter Marken im internationalen Kontext? –3– Handlungsfeld 2: Internationalisierung von KMUs 1. Was sind die Besonderheiten der Internationalisierung von KMUs (kleine und mittlere Unternehmen)? Was sind die erfolgsentscheidenden Faktoren beim „Going International“ von KMUs? 2. Wie wirkt sich die Heterogenität von Dienstleistungen auf die Gültigkeit potenzieller Erfolgsfaktoren aus? Gibt branchenübergreifende Erfolgsfaktoren? es branchenspezifische und/oder 2 3. Wie lässt sich die Internationalisierung von KMUs steuern? Handlungsfeld 3: Internationalisierung in der Textilbranche 1. Welche Besonderheiten in Bezug auf die Internationalisierung existieren im Bekleidungseinzelhandel? 2. Wie lässt sich die Internationalisierung von Unternehmen im Bekleidungseinzelhandel steuern? Der vorliegende Projektbericht entstand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „Internationale Markenführung in Dienstleistungsnetzwerken (IMADI.net)“. Die mit diesem vorliegenden Projektberichts verbundene Zielsetzung besteht darin, den Untersuchungsbereich des Projekts IMADI.net zu entfalten, weshalb zunächst in Kapitel 2 der inhaltliche Hintergrund erläutert wird, um den Gegenstand des Projekts IMADI.net zu erörtern. Dann wird in Kapitel 3 ein terminologischer Rahmen gelegt, um die grundlegenden Termini zu konkretisieren, die für die Studien im Projekt IMADI.net benötigt werden. Somit soll ein einheitliches Begriffsverständnis erreicht werden. Der Projektbericht erhebt allerdings nicht den Anspruch, ein vollständiges Glossar zu bilden, da an dieser Stelle nicht antizipiert werden kann, welche Termini im weiteren Verlauf des Projekts benötigt werden. Nichtsdestotrotz stellt der Projektbericht dennoch ein erstes Ergebnis der „Analyse des erweiterten Gegenstandsbereichs“ dar und eine wesentliche Grundlage für zeitlich nachgelagerte Arbeitspakete. 2 Diese Fragestellung der branchenübergreifenden Gültigkeit von Erfolgsfaktoren wird auch von Ahlert et al. 2002, S. 28, als „entscheidende Frage“ der Erfolgsforschung im Zusammenhang mit Dienstleistungen bezeichnet. –4– 2 Inhaltlicher Rahmen Der inhaltliche Rahmen des Projekts IMADI.net wird durch die mit dem Projekt verbundenen Zielsetzungen vorgegeben. So gilt es die Wahrnehmbarkeit und Präferenz für deutsche Dienstleistungen zu erhöhen. Hierbei spielt die Marke einer Dienstleistung eine besondere Rolle. Die Marke wird dabei häufig als „Seele“ des Unternehmens bzw. deren Abbild begriffen. Sie dient dem Kunden als „Vertrauensanker“ (vgl. Ahlert/Kenning 1999, S. 115; Kenning 2003) bzw. als Qualitätssignal (vgl. Keller 1993). Insbesondere bei der Vermarktung von Dienstleistungen ist diese Funktion der Marke von besonderem Gewicht. Denn bei Dienstleistungen bestehen für den potenziellen Konsumenten Schwierigkeiten hinsichtlich der objektiven Bewertung der zu erwerbenden Leistung. Das seitens des Konsumenten einer Marke gegenübergebrachte Vertrauen kann diese objektive Nachprüfung der adäquaten Leistungserstellung ersetzen. Allgemein gilt, dass die Überprüfung der Leistungsqualität umso schwerer ausfällt, je höher die Informationsasymmetrie zu Ungunsten des Nachfragers ausgestaltet ist. Neben der Informationsasymmetrie spielt ebenfalls die Immaterialität der Dienstleistung eine wichtige Rolle: Je immaterieller bzw. intangibler eine Dienstleistung ist, desto wichtiger wird die Marke (vgl. Bharadway/Varadarajan/ Fahy 1993, S. 90). Dabei stellt die Marke selbst eine intangible Ressource eines Unternehmens dar. Allgemein wird in der Stärkung intangibler Ressourcen die Voraussetzung zur Schaffung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile gesehen (vgl. im Folgenden Evanschitzky 2003, S. 120 f.). Liegen bestimmte erfolgkritische Ressourcen in einem Unternehmen nicht vor, besteht für dieses die Möglichkeit in kooperativen Netzwerken mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und dadurch über einen gebündelten Ressourcenpool zu verfügen. Netzwerke bieten somit ebenfalls die Grundlage, die Verfügbarkeit deutscher Dienstleistungen im Ausland zu verbessern. Dienstleistungsnetzwerken wird das Potenzial zugeschrieben, die Zukunft im tertiären Sektor maßgeblich zu bestimmen, da sich diese Koordinationsform im Wettbewerb der Systeme als die dominierende zeigen wird (vgl. Ahlert/Evanschitzky 2003, S. 3). Die Multiplikation national erfolgreicher Dienstleistungen über die Grenzen hinweg, kann für bestimmte minimierend durch Netzwerke erfolgen. Dienstleistungstypen Transaktionskosten –5– Im Rahmen des Projekts IMADI.net sollen beide Aspekte – Marke und Netzwerk – jedoch nicht nur allein für sich analysiert werden. Vielmehr ist eine integrative Sichtweise anzustreben. Denn für Dienstleistungsnetzwerke liegt der Wert einer Marke insbesondere in seiner differenzierenden Wirkung. In der Funktion eines Qualitätsindikators erleichtert die Marke eine Abschöpfung der Aufpreisbereitschaft des Kunden und dessen engere Bindung an das Unternehmen. Dadurch wirken starken Marke insbesondere für potenzielle Wettbewerber als Markteintrittbarrieren, die Wettbewerbsvorteile nach sich ziehen können (vgl. Srivastava/Shocker 1991). Anbieter von Dienstleistungen müssen daher vorrangig in ihre Marke investieren. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt die internationale Markenführung dar, da diese im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und lokaler Anpassung steht. Unternehmen wie bspw. die Deutsche Bank leiden in Osteuropa unter ihrer Herkunft. Der Erfolg der internationalen Markenführung wird durch eine Vielzahl von intervenierenden Variablen beeinflusst, die es im Rahmen dieses Forschungsprojektes zu identifizieren und in ihrem Wirkungszusammenhang zu quantifizieren gilt. Liegen diese Wirkungszusammenhänge vor, können diese im Rahmen einer Internationalisierungs-Scorecard abgebildet werden. Diese stellt ein Managementtool zur operativen Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie dar, um die dem Projekt zugrunde gelegten Ziele der Verbesserung von Präferenz und Verfügbarkeit zu erreichen. Im anschließenden Kapitel sollen die bereits erwähnten zentralen Begriffe definiert und systematisiert werden. Kapitel 3.1 widmet sich den Unternehmensnetzwerken, Kapitel 3.2 setzt sich mit der Begriffwelt der Marke auseinander. In Kapitel 3.3 wird die Internationalisierung von Dienstleistungen behandelt, bevor in Kapitel 3.4 die Besonderheiten der Markenführung in Dienstleistungsnetzwerken thematisiert werden. Der terminologische Bezugsrahmen einer Internationalisierungs-Scorecard wird in Kapitel 3.5 entwickelt. –6– 3 Terminologischer Rahmen 3.1 Unternehmensnetzwerke 3.1.1 Systematisierung von Netzwerken „Unter welchen Bedingungen entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten ohne zentralen Herrschaftsstab? Diese Frage hat die Menschen aus gutem Grund seit langer Zeit fasziniert. Wir wissen alle, dass Menschen keine Engel sind, und dass sie dazu neigen, in erster Linie für sich selbst und ihre eigenen Interessen zu sorgen. Wir wissen jedoch auch, dass Kooperation vorkommt und dass sie die Grundlage unserer Zivilisation bildet.“ (Axelrod 1995, S. 3) Ohne an dieser Stelle weit auszuholen oder gar philosophisch sich dem Netzwerkphänomen zu nähern, ist dennoch zu allererst zu konstatieren, dass in der Literatur kein einheitliches Verständnis über den Begriff des Netzwerkes existiert. Ebenso sind Netzwerke selbst realiter in mannigfaltigen Varianten vorzufinden, weshalb ohne eine genaue Klärung des Begriffes und der Klassifizierung von Realtypen es kaum möglich ist sich dem Betrachtungsgegenstand adäquat zu nähern und es daher zunächst gilt ein breiteres Verständnis für die Netzwerkproblematik zu schaffen. Netzwerke können grundsätzlich anhand ihrer geografischen Orientierung klassifiziert werden. Eine Unterscheidung in z.B. regionale, nationale, europäische und internationale Netzwerke ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Untersuchung angebracht. Sie gibt Auskunft darüber, wo die Netzwerkpartner geografisch zu lokalisieren sind. Überdies lassen sich Netzwerke gemäß ihrer Kooperationsrichtung in vertikale, horizontale oder laterale einteilen. Der Marktauftritt des Netzwerks als Ganzes kann dabei entweder einheitlich (z.B. unter einer gemeinsamen Marke) oder uneinheitlich sein. Neben diesen eher oberflächlichen Einteilungen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsansätze, die sich mit dem Phänomen der „Netzwerke“ befassen (vgl. exemplarisch z.B. Lorenzoni et al. 1989; Mueller 1988; Bartlett/Goshal 1990; Miles/Snow/Coleman 1992; Jarillo 1988; Sydow 1992; Obrig 1992; Alter/Hage 1993; Meyer 1994; Powell 1990; Teubner 1992; Klein 1996). Unterscheiden lassen sich –7– diese Ansätze zunächst nach ihrem jeweils dominierenden Begriffsverständnis in Ansätze mit • personeller, • interner oder • externer Ausrichtung. Ansätze mit personeller Ausrichtung (vgl. hierzu Mueller 1988; Lorenzoni et al. 1989), interpretieren Netzwerke als Gefüge sozialer Beziehungen, Ansätze interner Ausrichtung verstehen sie als Gefüge innerhalb von Unternehmen und Ansätze externer Ausrichtung sehen sie als Gefüge zwischen Unternehmen. Vorgestellte Netzwerkansätze Personelle Ausrichtung (Netzwerk als Gefüge sozialer Beziehungen) Interne Ausrichtung (Netzwerk als Gefüge innerhalb einer Unternehmung) • Betriebliche Netzwerke nach Mueller (1988) • Interne Netzwerke nach Lorenzoni et al. (1989) • Interpersonelle Netzwerke nach Lorenzoni et al. (1989) • Transnationale Unternehmungen nach Bartlett/ Ghoshal (1990) Externe Ausrichtung (Netzwerk als Gefüge zwischen Unternehmungen) • Interne Netzwerke nach Miles et al. (1992) Transaktionskostenorientiertes Verständnis von Netzwerken (Netzwerke als Hybridform zwischen Markt und Unternehmung) • Hybridformen nach Williamson (1991) • Strategische Netzwerke nach Sydow (1992) • Strategische Netzwerke nach Jarillo (1988) • Polyzentrische Netzwerke nach Obrig (1992) • Stabile/Dynamische Netzwerke nach Miles et al. (1992) • Produktionsnetzwerke nach Alter/Hage (1993) Systemtheoretisch geprägtes Verständnis von Netzwerken (Netzwerke als spezifische Form neben Markt und Unternehmung) • Netzwerke nach Thorelli (1986) • Netzwerke nach Powell (1990) • Netzwerke als System höherer Ordnung nach Teubner (1992) • Fokale, Tausch-, Lern-Netzwerke und Clubs nach Klein (1996) • Netzwerke nach Meyer (1994) Abbildung 1: Systematik der skizzierten Netzwerkansätze (Quelle: Borchert et al. 1999, S. 57) Letztere Forschungsrichtung kann wiederum unterteilt werden in solche, die transaktionskostenorientierte Netzwerke tendenziell als Hybridformen zwischen den Extrempolen Markt und Unternehmung sehen (dies bedeutet allerdings nicht, dass –8– die Existenz von Netzwerken auch transaktionskostentheoretisch erklärt wird; vgl. Borchert et al. 1999, S. 56) und solchen, die aus systemtheoretischer Sicht Netzwerke als eine spezifische Form neben Markt und Unternehmung auffassen. Abbildung 1 gibt die unterschiedlichen Ansätze in Auszügen wieder. Anschauungsobjekt von Mueller (1988, S. 21 ff.) ist eine überwiegend hierarchisch und bürokratisch strukturierte Unternehmung. Netzwerke fasst er als Konzepte menschlicher Beziehungen innerhalb dieser hierarchischen Struktur auf. Lorenzoni/Grandi/Boari (1989) unterscheiden zwischen externen, internen und interpersonalen Netzwerken. Ein interpersonales Netzwerk reflektiert nach ihrer Auffassung die Beziehungen und die Kommunikation zwischen Individuen und/oder Gruppen. Interne Netzwerke entwickeln sich aus der Externalisierung interner Organisationseinheiten. Als interne Netzwerke lassen sich also die Beziehungen zwischen Organisationseinheiten innerhalb einer Unternehmung ansehen. Bartlett/Goshal (1990) sehen transnationale Unternehmen als integrierte Netzwerke an und untersuchen die Beziehungen zwischen Stammhaus, Inlands- und Auslands- niederlassungen. Das interne Netzwerk nach Snow/Miles/Coleman (1992, S. 11 ff.) entsteht, indem Marktmechanismen auf die Beziehungen innerhalb eines Unternehmens übertragen werden. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit der Steigerung der Allokationseffizienz innerhalb des Unternehmens, der Reduktion von Ressourcenabhängigkeiten und die Möglichkeit der Reduktion von Reaktionszeiten. Dem Verständnis von Netzwerk als Gefüge zwischen Unternehmen soll im Folgenden die meiste Aufmerksamkeit gewidmet werden, da diese interorganisationalen Netzwerke das Verständnis der Autoren von der Relevanz für das Management von (Dienstleistungs)-Netzwerken am besten widerspiegeln. Zu klären ist somit, ob Netzwerke eine eigene, spezifische Governanceform neben Markt und Unternehmung darstellen, oder ob es sich bei Netzwerken um eine hybride Koordinationsform auf einem Kontinuum zwischen Markt und Unternehmung handelt. Thorelli (1986), Teubner (1992) und Klein (1996) sehen das Netzwerk als eigenständige Organisationsform. Powell (1990) sieht dies auch so, wobei er als charakterisierende Elemente eine langfristige Perspektive und Vertrauen der Partner zueinander anführt. Dies kommt einem transaktionstheoretischen Verständnis schon recht nahe (vgl. Jarillo 1988, S. 36 ff.). Die Vertreter eines solchen transaktionsorientierten Verständnisses –9– ordnen Netzwerke auf dem Kontinuum zwischen Markt und Hierarchie ein (vgl. Tabelle 1) (vgl. Jarillo 1988; Miles/Snow/Coleman 1992; Sydow 1992; Obig 1992; Alter/Hage 1993; Meyer 1994). Netzwerktypen Industrielle Netzwerke – Dienstleistungsnetzwerke Konzerninterne – konzernübergreifende Netzwerke Strategische – regionale Netzwerke Lokale – globale Netzwerke Einfache – komplexe Netzwerke Vertikale – horizontale Netzwerke Obligationale – promotionale Netzwerke Legale – illegale Netzwerke Freiwillige – vorgeschriebene Netzwerke Stabile – dynamische Netzwerke Marktnetzwerke – Organisationsnetzwerke Hierarchische – heterarchische Netzwerke Intern – extern gesteuerte Netzwerke Zentrierte – dezentrierte Netzwerke Bürokratische – clan-artige Netzwerke Austauschnetzwerke – Beteiligungsnetzwerke Explorative – exploitative Netzwerke Soziale – ökonomische Netzwerke Formale – informale Netzwerke Offene – geschlossene Netzwerke Geplante – emergente Netzwerke Innovationsnetzwerke – Routinenetzwerke Käufergesteuerte – produzentengesteuerte Netzwerke Beschaffungs-, Produktions-, Informations-, F&E-, Marketing-, Recyclingnetzwerke u.ä. Tabelle 1: Bestimmung über bzw. Synonyme Sektorenzugehörigkeit der meisten Netzwerkunternehmungen Konzernzugehörigkeit der meisten Netzwerkunternehmungen Art der Führung und weitere Merkmale (s.u.) Strategic networks – small firms networks Räumliche Ausdehnung des Netzwerks Zahl der Netzwerkakteure, Dichte des Netzwerks, Komplexitätsgrad des Beziehungsgeflechts Stellung der Unternehmung in der Wertschöpfungskette Netzwerkzweck im Sinne eines Leistungsaustausches bzw. einer gemeinsamen Interessendurchsetzung Verstoß gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen (z.B. Kartelle) Gesetzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit der Unternehmungen Stabilität der Mitgliedschaft bzw. der Netzwerkbeziehungen Dominanz des Koordinationsmodus Steuerungsform nach der Form der Führung Steuerungsform nach Ort (z.B. durch Drittparteien bzw. Netzwerkmanagementorganisation) Grad der Polyzentrizität Form der organisatorischen Integration der Netzwerkunternehmungen Grund der Netzwerkmitgliedschaft Dominanter Zweck des Netzwerks Dominanter Zweck der Netzwerkmitgliedschaft Formalität bzw. Sichtbarkeit des Netzwerks Möglichkeit des Ein- bzw. Austritts aus dem Netzwerk Art der Entstehung Netzwerkzweck im Hinblick auf Innovationsgrad „Ort“ der strategischen Führung Betriebliche Funktionen, die im Netzwerk kooperativ erfüllt werden Typologie interorganisationaler Netzwerke (Quelle: Sydow 1999, S. 285) – 10 – Ein Markt ist im Sinne der neoklassischen Theorie als eine Organisationsform ökonomischer Aktivitäten zwischen beliebigen, unabhängigen und sich begrenzt rational und opportunistisch verhaltenden Markteilnehmern, die eine genau spezifizierte Arbeitsleistung austauschen, zu verstehen (vgl. Sydow 1992, S. 98). Der Markt kann organisiert und damit institutionalisiert sein (Börsen, Jahrmärkte, Auktionen, elektronische Handelsplattformen) oder aber nicht organisiert sein. Marktliche Beziehungen sind eher kurzfristig angelegt. Die Koordination erfolgt über den Preis. Dabei sind begrenzte bzw. beschränkte Rationalität und Opportunismus Grundannahmen institutionenökonomischer Ansätze. Begrenzte Rationalität ist eine Folge unvollständigen Wissens und der begrenzten menschlichen Verarbeitungskapazität. Menschen können lediglich in Bezug auf ihren subjektiven Wissensstand rational handeln (vgl. Simon 1959). Opportunistisches Verhalten basiert auf der individuellen Nutzenmaximierung, wobei der opportunistisch Handelnde bei der Erreichung seiner eigenen Nutzenmaximierung auch negative Auswirkungen für andere Akteure in Kauf nimmt (vgl. Picot/Reichwald/Wigand 2001, S. 45; Sydow 1992, S. 131). Dargestellt werden kann dieses Verhalten am Gefangenendilemma (vgl. Luce/Raiffa 1957; UllmannMargalit 1977). Die Unabhängigkeit der Marktteilnehmer kann auf der Ebene von Unternehmen in diesem Zusammenhang in die rechtliche und die wirtschaftliche Unabhängigkeit unterschieden werden. Rechtliche Unabhängigkeit konstituiert sich in einer rechtlich eigenständigen Gesellschaftsform. Jedes Unternehmen behält im Netzwerk seine eigene Rechtspersönlichkeit. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit bzw. wirtschaftliche Selbstständigkeit bezieht sich auf das Ausmaß der Fähigkeit eines Unternehmens, eigenständige strategische Entscheidungen zu treffen (vgl. Sydow 1992, S. 90). Strategische Entscheidungen sind aber immer auch durch das Beziehungsgeflecht von Lieferanten, Abnehmern, Kapitalgebern, Arbeitnehmern, Verbänden, Staat und anderen Anspruchsgruppen, in welches das Unternehmen eingebunden ist, beeinflusst (vgl. Sydow 1992, S. 79, S. 90). Aus dieser Einbindung resultieren vielfältige Einschränkungen der Handlungsfreiheit, sodass eine wirtschaftliche Unabhängigkeit immer nur eine eingeschränkte Unabhängigkeit bzw. Selbstständigkeit sein kann. Ebenso ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit mit dem Eingehen einer Kooperationsbeziehung eingeschränkt. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer solchen – 11 – Beziehung erfordert von dem Unternehmen Investitionen in Form einer teilweisen Aufgabe der Freiheit unabhängigen Handelns (vgl. Sydow 1992, S. 90). Das andere Extrem des Kontinuums bildet die Unternehmung, in der die Koordination mittels Hierarchie erfolgt. Hierarchie bedeutet, dass die Beziehungen zwischen den Handelnden durch Über-/Unterordnung gekennzeichnet sind. Die Unternehmensleitung erteilt Weisungen gegenüber einer prinzipiell begrenzten Zahl von Organisationsmitgliedern, wodurch die marktliche Koordination weitgehend substituiert wird. Im Gegensatz zu marktlichen Beziehungen sind hierarchische Beziehungen auf Dauer angelegt und kennzeichnen sich durch ex ante abgestimmte Pläne (vgl. Sydow 1992, S. 98). Seinen theoretischen Ursprung hat die Unterscheidung von Markt, Hierarchie und Hybridformen zwischen Markt und Hierarchie in der Transaktionskostentheorie (vgl. grundlegend Coase 1937, S. 386 ff.; Williamson 1990, S. 1 ff.; Weber 1999, S. 111). Die Transaktionskostentheorie untersucht die im Rahmen der Übertragung von Handlungs- und Verfügungsrechten entstehenden Kosten. Dies sind Kosten, die während der einzelnen Phasen der Transaktion entstehen. Eine Transaktion umfasst die Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und u.U. die Anpassung (vgl. Picot 1982, S. 269). Transaktionskosten sind somit (Picot 1982, S. 270; Sydow 1992, S. 130; Picot/Reichwald/Wigand 2001, S. 50): • Anbahnungskosten (z.B. für Informationssuche, Recherchen, Reisen, Beratung), • Vereinbarungskosten (z.B. für Verhandlung, Vertragsformulierung, Vereinbarung usw.), • Abwicklungskosten (z.B. Prozesssteuerung), • Kontrollkosten (z.B. für Sicherstellung der Einhaltung von Terminen, Qualität, Mengen-, Preis- oder Geheimhaltungsvereinbarungen), • Anpassungskosten (z.B. für Durchsetzung von qualitativen, preislichen oder terminlichen Änderungen aufgrund veränderter Bedingungen während der Laufzeit). – 12 – Die Summe der Transaktionskosten ist ein zentraler Bestimmungsfaktor für die Wahl der Organisationsform ökonomischer Aktivitäten. Dabei wird die Höhe der Transaktionskosten durch die Anzahl der Transaktionspartner, die Transaktionshäufigkeit und -unsicherheit sowie durch die strategische Bedeutung der Transaktion für eine Unternehmung beeinflusst. Diejenige Organisationsform erscheint effizient, die die Transaktionskosten (also die Summe der fünf „Teilkosten“) minimiert. Je nach Ausprägung dieser Einflussvariablen ist dabei eine marktliche, eine hierarchische oder eine hybride, netzwerkartige Koordinationsform (hier nicht im Sinne einer eigenständigen Organisationsform verstanden, sondern als Hybridform) effizient. marktliche Koordination „spot contracting“ Kaufvertrag Tauschgeschäft Markt „arm‘s length transaction“ „relational/obligational contracting“ hierarchische Koordination „employment relationship“ langfristige Joint Lieferverträge Lizenz-/ / Sub-Unter- Franchising- Ventures nehmerschaft Verträge Internalisierung Interorganisationales Netzwerk „quasi-firm“ Profit-Center FunktionalOrganisation/ organisation SGE Externalisierung Unternehmung „hierarchic firm“ Abbildung 2: Organisationsformen ökonomischer Aktivitäten (Quelle: Sydow 1992, S. 104) Neben der Fokussierung auf (Transaktions-)Kostenminimierung ist ein ergänzender Ansatz zur Systematisierung von Netzwerken der der Nutzenmaximierung. Dieser Aspekt wird insbesondere von der „Resource Dependence Theory“, einem Ansatz der Interorganisationstheorie, untersucht. Pfeffer und Salancik (1978) sehen es als Ziel einer (ökonomischen) Organisation, deren langfristiges Überleben zu sichern (vgl. Hickson et al. 1981; Pfeffer 1987). Um dies zu gewährleisten, ist der Zufluss an – 13 – Ressourcen unabdingbar. Zum besseren Verständnis der gegenseitigen Ressourcenabhängigkeit können folgende Fragen gestellt werden (Pfeffer/Salancik 1978, S. 79 f.): • Welche Ressourcen sind als kritisch zu bezeichnen? • Wer liefert bzw. kontrolliert diese kritischen Ressourcen? • Über welche Macht verfügt der „Lieferant“, über welche Gegenmacht verfügt man selbst? • Welche Gegenleistungen verlangen die Lieferanten der Ressourcen für die Ressourcenlieferung? • Wie bewerten die Lieferanten die belieferte Organisation? • Wie wirkt sich die Befriedigung der Interessen eines Lieferanten auf die Befriedigung der Interessen anderer Lieferanten aus? Grundsätzlich kann der Austausch kritischer Ressourcen über einen Markt oder durch hierarchische Koordination vonstatten gehen. Der marktliche Austausch birgt die Gefahr einer möglichen Unterversorgung an adäquaten Ressourcen. Zahlreiche Ressourcen können als „pfadabhängig“ bezeichnet werden, sie „entstehen“ erst im Laufe der Zeit unter besonderen, komplexen historischen Umständen (vgl. z.B. Barney 1991, S. 107 f. und die dort angegebene Literatur). Somit sind diese Ressourcen nur sehr schwer über einen Markt zu beziehen. Hierarchische Strukturen ermöglichen zwar den uneingeschränkten Zugang zu solchen Ressourcen. Was fehlt ist zum einen die Flexibilität bei der Auswahl von Bezugsquellen für Ressourcen. Zum anderen führt eine hierarchische Organisation tendenziell zu fehlender Marktnähe. Insbesondere der Zugang zur Ressource (Markt-)Wissen ist somit eingeschränkt. Das Phänomen der Netzwerke versucht die Vorteile beider Organisationsformen zu vereinen und deren Nachteile zu vermeiden. Aus Sicht der Ressourcenabhängigkeitstheorie kann die Netzwerkbildung als Mittel zur Reduktion der Unsicherheit bei der Beschaffung notwendiger Ressourcen verstanden werden (vgl. Kloyer 1995, S. 12). Durch den „abgestimmten“ (also weder marktlichen noch hierarchischen) Austausch von wertvollen Ressourcen in einem Netzwerk kann für die Teilnehmer am Netzwerk ein zusätzlicher Nutzen gestiftet werden, der ohne das Netzwerk nicht hätte erzielt werden können. Jeder Akteur wird versuchen, das für ihn optimale – 14 – Verhältnis von abgegebenen zu erhaltenen Ressourcen zu erzielen. Trotzdem kann es zur Ungleichverteilung der Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse im Netzwerk kommen. Die relative Macht eines Netzwerkpartners ergibt sich aus dessen Abhängigkeit zu anderen bzw. zum Netzwerk als Ganzem. Drei Faktoren bestimmen diese Ressourcenabhängigkeit: • die Wichtigkeit der getauschten Ressourcen, • die Existenz von Alternativen und • die Verfügungsrechte (Wer ist Inhaber dieser Rechte?). Aus der Wichtigkeit der Ressourcen und der Existenz von Alternativen für einen Akteur A sowie dessen Verfügungsrechte, ergibt sich die Abhängigkeit von A vom Netzwerk als Ganzem bzw. von einem anderen Akteur. Folgendes Schaubild visualisiert die verschiedenen Formen der (Ressourcen-)Abhängigkeit in einem Netzwerk. Abhängigkeit der übrigen Akteure von Akteur A maximale gegenseitige Abjängigkeit sehr hoch von „A“ dominiertes Netzwerk „A“ wird durch das Netzwerk dominiert sehr niedrig sehr niedrig sehr hoch Abhängigkeit des Akteurs A von den übrigen Akteuren Abbildung 3: Ressourcenabhängigkeit und Machtverteilung im Netzwerk (Quelle: Ahlert/Blaich/Evanschitzky 2003, S. 40) In einem Netzwerk lässt sich die Position eines Akteurs als „dominierend“ oder „dominiert“ bezeichnen. Entlang der Diagonalen befindet sich der Akteur mit dem – 15 – Netzwerk in gegenseitiger Abhängigkeit, wobei diese von „gegenseitig sehr schwach abhängig“ (unten links im Schaubild) bis „gegenseitig völlig abhängig“ (oben rechts im Schaubild) bezeichnet werden kann. Die Steuerung von Netzwerken regelt, wie Transaktionen zwischen den Partnern vonstatten gehen und wie Entscheidungen im Netzwerk gefällt werden. Dabei lassen sich zwei Stufen unterscheiden, nämlich • die Willensbildung und • die Willensdurchsetzung. Die Willensbildung gibt Auskunft darüber, wer die grundsätzlichen Entscheidungen im Netzwerk trifft. Dies kann ein Partner (autonom) oder eine (einfache oder absolute) Mehrheit sein. Ebenso kann es sein, dass Entscheidungen nur einstimmig getroffen werden können. Unabhängig davon, wie Entscheidungen gefällt werden, ist die Frage, wie einmal getroffene Entscheidungen durchgesetzt werden. Hier besteht die Möglichkeit, dass ein Partner („Systemkopf“) eine einmal getroffene Entscheidung (hierarchisch) durchsetzt, also auch Sanktionspotenzial besitzt oder dass auch bei jeder Willensdurchsetzung grundsätzliche Freiwilligkeit herrscht. Eng verbunden mit der Frage nach der Willensbildung bzw. Willensdurchsetzung ist die nach Bindungs- und Autonomiegrad im Netzwerk. Der Bindungsgrad gibt Auskunft darüber, ob und in welchem Ausmaß die am Netzwerk teilnehmenden Partner ihr Verhalten (vertraglich) bewusst und vorab abstimmen und festlegen. Eine extrem hohe Bindung im Netz liegt vor, wenn sich die Akteure langfristig, in Bezug auf die meisten der denkbaren Aktivitätsbereiche und mit sehr stringenten Vorgaben abstimmen. Der Autonomiegrad beschreibt die Freiheitsgrade, über welche die Akteure in dem abgestimmten Aktivitätsbereich verfügen. Der Autonomiegrad ist umso niedriger, je mehr die eigene Rechtspersönlichkeit des Netzwerkpartners durch vertragliche Regeln eingeschränkt ist und je mehr die Entscheidung eines Partners über den Einbzw. Ausstieg durch z.B. spezifische Investitionen eingeschränkt ist (vgl. Grossekettler 1981). Zusammenfassend seien die Überlegungen zu Netzwerken anhand der Merkmale und deren Ausprägungen in der folgenden Tabelle 2 dargestellt. – 16 – Merkmal geografische Orientierung Kooperationsrichtung Marktauftritt Ausrichtung des Netzwerks Transaktionstyp Ressourcenabhängigkeit Willensbildung Willensdurchsetzung Bindungsgrad Autonomiegrad Tabelle 2: 3.1.2 Merkmalsausprägung regional/national/europäisch/international vertikal/horizontal/lateral völlig einheitlich (1) (...) völlig uneinheitlich (5) personell/intern/extern (= interorganisationales Netzwerk) Markt (1) (...) Hierarchie (7) • völlige gegenseitige Ressourcenabhängigkeit (5/5) vs. völlige gegenseitige Ressourcenunabhängigkeit (1/1) • völlige Ressourcenabhängigkeit des Akteurs A von Netzwerk (5/1) vs. völlige Ressourcenabhängigkeit des Netzwerks von Akteur A (1/5) ein Partner/Gruppe/Mehrheit/Einstimmigkeit ein (bestimmter) Partner („Systemkopf“)/Mehrheit/Einstimmigkeit sehr hoch (1) (...) sehr niedrig (5) • Bindungsdauer (kurzfristig (...) langfristig) • Bindungsintensität (stringente (...) lockere Vorgaben) • Bindungsumfang (wenige (...) alle Aktivitätsbereiche) sehr hoch (1) (...) sehr niedrig (5) Merkmale und Merkmalsausprägungen von Netzwerken Netzwerkverständnis dieses Projekts Aus den dargestellten Systematisierungsansätzen lässt sich folgende Minimaldefinition von Unternehmensnetzwerken aufstellen: „Unternehmensnetzwerke bezeichnen die auf die Erbringung einer (Dienst-)Leistung ausgerichtete Zusammenarbeit von mehr als zwei rechtlich selbstständigen Partnern, die jedoch zumindest in Bezug auf den Kooperationsbereich wirtschaftlich nicht unabhängig sind. Die Beziehungen zwischen den die (Dienst-)Leistung erbringenden Unternehmungen gehen dabei über rein marktliche Beziehungen hinaus, d.h. dass sie für eine gewisse Dauer angelegt sind und die (Dienst-)Leistung von den Unternehmungen nicht nur einmalig erbracht, sondern dauerhaft am Markt angeboten wird. Ebenso findet ein Austausch von Ressourcen zwischen den beteiligten Netzwerkpartnern statt“ (Ahlert/Evanschitzky 2003). – 17 – Auf eine weitere Systematisierung von (Dienstleistungs-)Netzwerken, wie sie denn vielfach im internationalen Kontext vorzufinden sind, sei an dieser Stelle mit deutlichem Verweis auf Kapitel 3.3.3. verzichtet. 3.2 Marke 3.2.1 Ansätze zur Definition der Marke Analog dem uneinheitlichen Begriffsverständnis des Unternehmensnetzwerkes besteht ebenso Unklarheit über das Verständnis des Markenbegriffs.3 Bereits 1970 charakterisierte Schenk (1970, S. 4) die Situation als „babylonische Sprachverwirrung“.4 In einer umfassenden Literaturrecherche konnten De Chernatony/Riley (1988, S. 417 ff.) nachweisen, dass in Wissenschaft und Praxis zumindest zwölf grundlegend verschiedene Markendefinitionen Verwendung finden. Allerdings ist davon auszugehen, dass weit mehr Definitionsvarianten existieren. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Begriff der Marke nicht mehr nur im Zusammenhang mit Konsumgütern Anwendung findet, sondern im Sinne eines „Broadenings“ (Meffert/Burmann 1996, S. 16 f.) eine Ausdehnung auf weite Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens erfahren hat. So lassen sich neben Konsumgütermarken je nach Markierungsobjekt und institutioneller Stellung des Trägers der Marke weitere Erscheinungsformen der Marke unterscheiden. Zu nennen sind hier insbesondere die Investitionsgütermarke, Handelsmarke, Betriebstypenmarke, Dienstleistungsmarke, digitale Marke, netzgeführte Marken, NonProfit-, Regionen- und Personenmarke (vgl. beispielhaft Schneider 2002). Gleichzeitig hat sich auch der inhaltliche Bezug deutlich gewandelt. Ausgehend von der Erkenntnis, dass nicht nur die Absatzmärkte, sondern auch die Personal-, Absatzmittler-, Beschaffungs- und Kapitalmärkte sowie die Öffentlichkeit Anspruchsgruppen an die Marke sein können – Ahlert (2004b, S. 11 f.) spricht in diesem Zusammenhang von Markenpublikum –, hat die Markenführung eine inhaltliche Ausweitung erfahren. Meffert/Burmann (1996, S. 16 f.) bezeichnen dies als „Deepening“. Demnach bezieht sich die „moderne“ Markenführung nicht nur auf die Sicherung 3 4 Übersichten vermitteln beispielsweise Bruhn 2004; Baumgarth 2001, S. 2. In jüngerer Zeit griffen Ahlert/Kenning/Schneider 2001, S. 1; De Chernatony/Riley 1998, S. 417; Kelz 1989, S. 20 sowie Bruhn 1994b, S. 5 diesen Begriff auf. – 18 – konstitutiver Markenmerkmale durch den Einsatz des Marketing-Mix, sondern bspw. auch ökologische und gesellschaftliche sowie mitarbeiter- und partnergerichtete Aspekte. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz intensiver, Jahrzehnte währender Bemühungen um Erkenntnisfortschritt noch keine einheitliche Terminologie, geschweige denn eine geschlossene „Theorie der Marke“ existiert. Die Entwicklung des Begriffsverständnisses von Marken vollzog sich chronologisch in vier Phasen, die sich durch wesentliche Veränderungen der Aufgabenumwelt der Unternehmen und den Wandel der Hersteller-Handels-Beziehung erklären lassen (vgl. hierzu ausführlich Meffert/Burmann 2002c, S. 19). Diese ist in Abbildung 4 dargestellt. Ansätze der Markendefinition und -führung Ansätze der Markendefinition Zeichen orientierter Ansatz Angebotsorientierte Ansätze Nachfrageorientierte Ansätze Integrierte Ansätze Marke als Eigentumsund Herkunftsnachweis Merkmalsorientierter Ansatz Funktionen orientierter Ansatz Image orientierte Ansätze Herkunftsstrukturierender Ansatz Wirkungsorientierter Ansatz Identitätsorientierte Ansätze Interdisziplinäre Ansätze Seit Mitte 19. Jh. Seit Anfang 20. Jh. Seit ca. 1960 Seit ca. 1990 Abbildung 4: Ansätze der Markendefinition und -führung (Quelle: In Anlehnung an Meffert/Burmann 2002; Thurm 2000) Zeichen orientierte Ansätze Ursprünglich bezeichnete das germanische Wort „Marka“ einen Grenzstein bzw. ein Grenzzeichen, erlebte jedoch im lateinisch-römischen Sprachraum eine Sinnausweitung zu einem Eigentums- und Herkunftsnachweis, insbesondere für handwerkliche Erzeugnisse (vgl. Kemper 2000, S. 3 ff.; Baumgarth 2001, S. 2 ff.; Bruhn 2001, S. 5 ff.; Meffert/Burmann 2002, S. 18 ff.; Sattler 2001, S. 39 ff.; Dichtl 1978, S. 17 ff.; – 19 – Linxweiler 1999, S. 51). An diese etymologische Interpretation des Markenbegriffs5 knüpft die Markendefinition der American Marketing Association (AMA) an, die „Brand“ definiert als “a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may identify one item, a family of items, or all items of that seller“ (vgl. AMA 2004). Aus der AMA-Definition lassen sich mit der Einzigartig- und Schutzfähigkeit des Zeichens zwei Anforderungen an die Marke ableiten, die auch Einzug in die deutsche Markengesetzgebung fanden. Entsprechend genießen laut der Legaldefinition der Marke in § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) in der Fassung vom 01.01.1995 nur solche Marken den Schutz des Gesetzgebers, „die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. In die Kritik gerieten diese Definitionen, da sie lediglich auf verschiedene Formen und Funktionen von Marken abstellen, ohne den Gegenstand der Marke und ihre Bildung konkret zu beschreiben (vgl. Meffert/Burmann/Koers 2002, S. 6). Angebotsorientierte Ansätze Mit dem Aufkommen und der späteren Dominanz der „Markenartikel“ – in sprachlich korrekter Darstellung „Hersteller-Markenartikel“ (vgl. Leitherer 1988, S. 86 ff.) – entwickelte sich ein Markenverständnis, das über die Anforderungen der Einzigartigund Schutzfähigkeit hinaus reichte. Absatzpolitischen Zielsetzungen Folge leistend, erhielt der Begriff des Markenartikels eine qualitative Komponente (vgl. Leitherer 1988, S. 91). „Echte“ Marken (Markenartikel) differenzierten sich dadurch von „unechten“ Marken (markierte Artikel). Der Unterschied bestand jedoch nicht in einer zwangsläufig höheren Qualität des Markenartikels, sondern in der Anbringung einer Markierung an anonyme Ware im Sinne des zeichenorientierten Ansatzes. Da zur Definition der Marke Eigenschaften herangezogen wurden, die nicht mehr von der Marke isoliert, sondern nur noch von dem „Amalgam“ Markenartikel erfüllt werden konnten, war eine Trennung von Marke und Produkt nicht mehr möglich. Die Fokus- 5 Eine etymologische Begriffsanalyse führte zu dem Ergebnis, dass das deutsche Wort „Marke“ aus dem französichen „marque“ entlehnt ist, das wiederum eine Rückbildung aus „marquer“ bzw. italienisch „marcare“ für das Verb „kennzeichen“ ist. Vgl. Kluge, 2002, S. 541. – 20 – sierung auf die Vermarktungsform des Markenartikels führte zu einem neuen Markenverständnis, das als angebotsorientiert bezeichnet werden kann.6 Innerhalb dieses Ansatzes entwickelten sich unterschiedliche Ströme (vgl. Thurm 2000, S. 28). Die Vertreter des merkmalsorientierten Ansatzes definieren eine Sammlung von Charakteristika, die in generalisierter Form zu konstitutiven Eigenschaften des Markenartikels erklärt werden (vgl. Thurm 2000, S. 28 ff.). Die bekannteste Zusammenstellung einer abschließenden Anzahl von Merkmalen geht auf Mellerowicz (1963, S. 39) zurück. Demnach sind Markenartikel „für den privaten Bedarf geschaffene Fertigwaren, die in einem größeren Absatzraum unter einem besonderen, die Herkunft kennzeichnenden Merkmal (Marke) in einheitlicher Aufmachung, gleicher Menge sowie in gleich bleibender oder verbesserter Güte erhältlich sind und sich dadurch sowie durch die für sie betriebene Werbung die Anerkennung der beteiligten Wirtschaftskreise (Verbraucher, Händler und Hersteller) erworben haben (Verkehrsgeltung)“. Die Aufstellung von Merkmalskatalogen darf als Reaktion auf die unternehmerische Praxis gewertet werden, aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr Produkte als Markenartikel zu deklarieren. Schon bald jedoch stand die inflationäre Verwendung des Markenbegriffs in der Umgangssprache im Widerspruch zu dem definitorisch engen Korsett der Merkmalskataloge. Nach mehrheitlicher Meinung wird den Merkmalskatalogen heute die Eignung zur Begriffsbestimmung des Markenprodukts abgesprochen, da die statische und formalistische Sichtweise dieses Ansatzes der Dynamik des Markenprodukts und der Vielfalt seiner Erscheinungsformen nicht mehr gerecht werde (vgl. bspw. Meffert/Burmann 1996, S. 5; Leitherer 1994, S. 78; Berekoven 1978, S. 40 ff.; Schäfer 1959, S. 406) Dennoch ist der merkmalsorientierte Ansatz zur Bestimmung eines Markenartikels bis in die heutige Zeit in der Praxis verbreitet.7 6 7 Mellerowicz 1963, S. 5 bezeichnete Markenartikel als „Kinder der modernen Industrie“. Siehe den Merkmalskatalog zur Definition des Markenartikels des Deutschen Markenverbands; vgl. Markenverband 2004. – 21 – Dem herkunftsstrukturierenden Ansatz zufolge spannen der klassische Markenartikel und die unmarkierte Ware als Extrema ein Kontinuum auf, dem neu gebildete Markenkategorien zugeordnet werden können. (vgl. Thurm 2000, S. 32). Schäfer (1959, S. 128 ff.) und Goldack (1948) als Vertreter dieses Ansatzes griffen die schon eingeführte Trennung von Markenartikel und Markenware auf und ordneten die Markenware (Handelsmarke) zwischen Markenartikel (Herstellermarke) und unmarkierter Ware ein. Trotz des unstrittigen Vorteils einer hohen Trennschärfe der einzelnen Kategorien vermochten sie nicht alle Probleme zu lösen, die dem merkmalsorientierten Ansatz anhaften. Denn weiterhin konnten die konsumentenseitig als Marke wahrgenommenen Produkte anhand der Merkmalskataloge nicht zweifelsfrei als solche identifiziert werden. Nachfrageorientierte Ansätze Als Reaktion auf eben diese Vernachlässigung der Kundenperspektive und die Uneindeutigkeit der Markendefinitionen (vgl. beispielhaft Bruhn 2003, S. 181 ff.; Keller 2003, S. 3; Morschett 2002, S. 24; Esch/Wicke 2001, S. 10) bei den merkmalsorientierten Ansätzen entwickelten sich im Zeitablauf Abgrenzungsversuche, bei denen nicht mehr das Produkt mit seinen besonderen Eigenschaften, sondern die kompletten Bemühungen des Anbieters im Vordergrund standen (vgl. Hartmann 1966, S. 13 f.; Hansen 1970, S. 30; Angehrn 1969, S. 21). Diese Entwicklung führte schließlich zu einem nachfrageorientierten Markenverständnis, das die markenpolitischen Möglichkeiten der Wirkungsbeeinflussung und die so erzielte Wirkung bei den Konsumenten in den Mittelpunkt der Betrachtung stellte. Entsprechend lassen sich innerhalb der nachfrageorientierten Ansätze der funktionen- und der wirkungsorientierte Ansatz unterscheiden. Die Verfechter des funktionenorientierten Ansatzes stellen die Frage nach der Ausgestaltung der betrieblichen Funktionen zur Erfolgssicherung eines Markenprodukts in den Mittelpunkt (vgl. Hansen 1970, S. 30 f.). Bedeutung erlangte die Unterscheidung, nach der sich Marken über die Erfüllung Nutzen stiftender Funktionen aus der Hersteller-, Handels- und Verbrauchersicht definieren (vgl. Thurm 2000, S. 34 f.). Im – 22 – Zuge der Wandlung von der Angebots- zur Nachfrageorientierung avancierte die Konsumentenperspektive zur dominierenden Sichtweise.8 Als erster funktionaler Ansatz darf der auf Domizlaff (1992) und Bergeler (1939) zurückgehende sog. instrumentelle Ansatz der Markentechnik bezeichnet werden. Mit dem Wort Markentechnik bezeichnete Domizlaff die systematische Nutzbarmachung massenpsychologischer Methoden und Erkenntnisse „für den Geltungskampf ehrlicher Leistungen oder produktiver Ideen.“ (vgl. Domizlaff 1992, S. 11). Die Markentechnik beruht auf der Erkenntnis, dass Konsumenten häufig nicht die Fähigkeiten oder das Wissen aufweisen, durch Inspektion die Qualität eines Produktes zu eruieren und ihre Entscheidung stattdessen an vermuteten Indikatoren festmachen. Dies führe dazu, dass ein „sinnfälliges“ Angebot die persönliche Erfahrung zu ersetzen vermag. Im Mittelpunkt der Markentechnik steht die Frage, welche absatzpolitischen Instrumente geeignet erscheinen, anonyme Waren in Markenartikel zu transformieren. Die Markentechnik umfasst bereits Elemente, die später als Push- und Pull-Strategie Eingang in das vertikale Marketing fanden. Mit dem 15. seiner „22 Gesetze der natürlichen Markenbildung“, „das Ziel der Markentechnik ist die Sicherung einer Monopolstellung in der Psyche der Verbraucher“ (Vgl. Domizlaff 1992, S. 37, S. 51), nahm Domizlaff bereits Aspekte der späteren, wirkungsorientierten Ansätze vorweg. Die Vorgehensweise, den Markenartikelcharakter eines Gutes nicht mittels verschiedener Merkmale oder Methoden, sondern vielmehr der erreichten Wertschätzung beim Konsumenten zu bestimmten, kommt bei den wirkungsorientierten Ansätzen voll zum Tragen. Berekoven (1961, S. 150) folgerte, „dass es sich bei einer Marke um eine Erscheinung […] handelt, die den Erfolg zum wesensmäßigen Inhalt hat […]“. Diese Auffassung gipfelt in der Aussage, „dass alles, was die Konsumenten als Markenartikel bezeichnen oder – besser – empfinden, tatsächlich ein solcher ist.“ 8 Die wissenschaftliche Diskussion um eine zielführende und vollständige Enumeration der Markenfunktionen zeigt Parallelen zur Kontroverse um die Merkmalskataloge. Als Minimalkonsens kann konstatiert werden, dass Marken eine Informations- und Komplexitätsreduktionsfunktion in der Phase der Entscheidungsvorbereitung, eine Vertrauens- oder Risikoreduktionsfunktion in der Entscheidungsphase und eine im weitesten Sinne „ideelle“ Funktion in der Phase des Konsums – 23 – (Berekoven 1978, S. 43) Das erfolgsorientierte Verständnis des Markenprodukts findet heute trotz Kritik an der beschränkten Operationalisierbarkeit des „Erfolgs“ große Akzeptanz (vgl. Stauss 1998, S. 13; Meffert 2000, S. 847; Matt 1988, S. 38). Bei den integrierten Ansätzen werden die beiden Sichtweisen der angebots- und nachfrageorientierten Markenverständnisse miteinander kombiniert und um Aspekte der Markenführung erweitert (vgl. Baumgarth 2001, S. 5). Innerhalb des integrierten Markenverständnisses sind insbesondere der Image orientierte, der identitätsorientierte und der interdisziplinäre Ansatz von Bedeutung. Imageorientierte Ansätze Als Weiterentwicklung der erfolgsbezogenen Begriffsbestimmungen etablierten sich Definitionen, die Marken vollständig auf der Wirkungsebene abgrenzten. Diesem Verständnis folgend wird Marke nicht mehr als Absatzobjekt, sondern als Vorstellungsbild aufgefasst. Als Vertreter dieser, als Image orientiert bezeichneten Richtung darf Meffert (2000, S. 847) gelten, der die Marke als „ein in der Psyche des Menschen verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung“ definiert. Die Anhänger des imageorientierten Ansatzes widmen sich ausführlich der Untersuchung des Markenimages als Prädiktor des Kaufverhaltens (vgl. z.B. Keller 2003, S. 58 ff.; Trommsdorff 1992, S. 458 ff.). Sie richten ihr Augenmerk auf Aspekte der Definition und Führung von Marken, weshalb der Ansatz stark normative Wirkungen entfaltet (vgl. Meffert/Burmann 2002, S. 24). Die definitorische Loslösung der Marke vom eigentlichen Produkt und ihre Gleichstellung mit dem hypothetischen Konstrukt der Einstellung trafen auf Skepsis. Kritik musste der Ansatz insbesondere auch dafür erfahren, dass durch den ausgeprägten Imagefokus methodische Aspekte wie die Operationalisierung des Markenimages zu Lasten der Integration sämtlicher betrieblicher Funktionen in den Vordergrund rückten (vgl. Koers 2001, S. 52). Mit dem technokratisch-strategieorientierten Ansatz suchte man die formulierten Defizite der imageorientierten Markenführung durch Planung, Steuerung und Kontrolle erfüllen. Vgl. Thurm 2000, S. 35; Fischer/Meffert/Perrey 2004, S. 337 f.; Meffert 2000, S. 847 f.; – 24 – aller Markenmaßnahmen zu beseitigen (vgl. o.V. 2003; Brandmeyer 2001; Brandmeyer/Deichsel 1999; Haedrich/Tomczak 1994; Franzen/Trommsdorff/Riedel 1994; Voss 1983). Da alle Marketingparameter Imagerelevanz aufweisen bzw. entwickeln können, sind sie dem Primat der Marke zu unterstellen. Identitätsorientierte Ansätze Eine wechselseitige Berücksichtigung angebots- und nachfrageorientierter Aspekte der Markenführung steht im Mittelpunkt der identitätsorientierten Markenführung (vgl. Meffert/Burmann 1996, S. 13 ff.; Kapferer 2001, S. 97 ff.; Aaker/Joachimsthaler 2000, S. 41 ff.; Upshaw 1995; Schmitt/Simonson/Marcus 1995). Die Grundlage des identitätsorientierten Ansatzes bildet eine imagebasierte Begriffsdefinition (vgl. Meffert/Burmann/Koers 2002, S. 6), die sich in das angebotsseitige Selbstbild (insideout) und das nachfrageseitige Fremdbild (outside-in) differenzieren lässt.9 Die Identität der Marke zeigt sich im Grad der Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbild. Die Problemfelder der Identitätsstiftung resultieren aus vier konstitutiven Merkmalen der Identität: die Wechselseitigkeit zwischen der Außen- und Innenperspektive, die Kontinuität der essentiellen Identitätsmerkmale, die Konsistenz aller Aktivitäten im Rahmen der Markenführung und die Individualität als kundenseitig wahrgenommene Einzigartigkeit bestimmter Merkmale (vgl. Meffert/Burmann 1996, S. 29). Durch die Schaffung von Identität kann die Marke das Vertrauen der Konsumenten und damit ökonomische Bedeutung gewinnen.10 Die Vertreter des identitätsorientierten Ansatzes betrachten die Markenbildung als einen sozialpsychologischen Prozess, der über die funktionsübergreifende Vernetzung aller relevanten Aktivitäten des Unternehmens zielführend zu gestalten sei. In der Erweiterung der absatzmarktbezogenen um die innengerichtete Perspektive und der Zugrundelegung eines sozialpsychologischen und damit weniger deterministisch 9 10 Teas/Grapentine 1996, S. 25; Hätty 1989, S. 19. Im weiteren Sinne lassen sich auch die persönlichkeitsorientierten Markenverständnisse dem identitätsorientierten Ansatz subsumieren. Vgl. hierzu z.B. Aaker 1997; Meyer/Tostmann 1995; Garolera 2000; Weis/Huber 2000; Hieronimus 2003; Bauer/Mäder/Huber 2002. Die Bedeutung des Vertrauenskonstrukts wurde bereits von Domizlaff 1992, S. 34 ff. betont und als Grundstein der Markenbildung bezeichnet. Zur Bildung von Vertrauen siehe ausführlich Kenning 2003. – 25 – anmutenden Denkansatzes differenziert sich der identitätsorientierte vom technokratisch- strategieorientierten Ansatz (vgl. Meffert/Burmann 1996, S. 14 f.). Kritik musste der identitätsorientierte Ansatz in erster Linie dafür erfahren, dass er die mit der Definition des Images verbundenen wissenschaftstheoretischen Bedenken nicht zu überwinden verstand. Mängel sind insbesondere bei der Konzeptualisierung und Operationalisierung des Images und der empirischen Fundierung zu konstatieren, die im Sinne von Ex-Post-Fallstudien einen anekdotischen Charakter aufweist. Burmann/Blinda/Nitschke gelangen (2003) zu einer veränderten Markendefinition (in Anlehnung an Keller 2003). Sie verstehen nunmehr unter einer Marke „ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht der relevanten Zielgruppen nachhaltig differenziert“ (vgl. auch Burmann/ Nitschke 2006, S. 157). Es fragt sich allerdings, ob die Substitution des Images durch Nutzenbündel die oben genannte Kritik zu entschärfen geeignet ist. Interdisziplinäre Ansätze Mit den identitätsorientierten Ansätzen avancieren die bereits von Domizlaff beschriebenen sozialpsychologischen Aspekte der Marke zum integralen Bestandteil der Markenführung. Durch die Berücksichtigung weiterer Wissenschaften, die sich detailliert mit dem menschlichen Verhalten beschäftigen, wird beim interdisziplinären Ansatz der Integrationsgedanke konsequent fortgeführt. Der Rückgriff auf Erkenntnisse nicht nur der Psychologie und Soziologie, sondern auch der Kommunikationswissenschaften, Pädagogik, Theologie und Medizin soll zur Gewinnung eines besseren Verständnisses der Marke beitragen, das auch nach fast 40 Jahren intensiver Kaufverhaltensforschung noch rudimentär anmutet (vgl. die Publikationen zum inderdisziplinären Markenverständnis von Ahlert 2004b; Gutjahr 2004; Hengsbach 2004; Markowitsch 2004; Merten 2004). Ziel der Markenforschung muss es letztlich sein, das beobachtbare Kaufverhalten theoretisch bestmöglich abzubilden. Die Integration fachfremder Methoden aus anderen, mit dem menschlichen Verhalten befassten Wissenschaftsgebieten wie z.B. den – 26 – Neurowissenschaften verspricht große Fortschritte auf dem Gebiet der Entscheidungstheorie (vgl. Smith 2002). Eine interdisziplinäre Betrachtungsweise kann zu zwei zentralen Erkenntnisgewinnen für das Markenmanagement führen (vgl. hierzu und im Folgenden Kenning/Ahlert 2004). Durch Integration der genannten wissenschaftlichen Disziplinen können zum einen die bisherigen Messverfahren durch innovative Methoden verbessert werden (vgl. für einen Methodenüberblick z.B. Kenning et al. 2004). Dies gilt insbesondere für theoretische Konstrukte, die zwar Kaufverhaltensrelevanz entfalten, mit den üblichen Befragungsmethoden aber nicht gemessen werden können. Der Einsatz innovativer Methoden verspricht eine adäquate Operationalisierung dieser Konstrukte und damit eine Verbesserung der Erklärungskraft der theoretischen Modelle. Zweitens kann interdisziplinäre Forschung dazu beitragen, die aus den Sozialwissenschaften bekannten Vermutungen über die Wirkung von Marken auf eine breitere theoretische Basis zu stellen und in Einzelfällen naturwissenschaftlich zu fundieren. 3.2.2 Markenverständnis dieses Projekts Vor dem Hintergrund der genannten Vorteile soll im Folgenden dem interdiziplinären Markenverständnis des brandsboard gefolgt werden, der Marken definiert als „kollektive Deutungsmuster, die Menschen als Orientierungshilfen zur Bewältigung von Entscheidungskonflikten nutzen“ (Ahlert 2004b, S. 14). Die Zweckmäßigkeit dieser Definition fand Bestätigung in den neurowissenschaftlichen Untersuchungen von Kenning et al. (2005), S. 55 f.), die Marken als Stimuli definieren, „die während einer (Kauf-) Entscheidung sowohl zur Entlastung rationaler als auch zur gesteigerten Aktivität affektiver und emotionaler Hirnareale führen“. In enger Anlehnung an Ahlert (2005) und Kenning et al. werden Marken als „psychologische Trägersysteme von Deutungsmustern definiert, die durch Konfrontation mit einem individualisierten und schutzfähigen Zeichen oder Zeichenbündel im Gedächtnis aktiviert werden“. Im Rahmen dieses Markenverständnisses unterteilt Ahlert (2004b, S. 14 f.) die Marke gedanklich in zwei Teile: „Die Struktur einer Marke besteht aus einem veränderlichen Image und einer beständigen Substanz“. Diese Definition umfasst zum einen die geforderte eindeutige Explikation der Wirkungsweise von Marken, zum anderen einen eindeutigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Das Markenimage wird in Anlehnung an die bestehende breite Literaturbasis definiert als Vorstellungs- und – 27 – Erwartungsbild des Markenpublikums, das mit dem Markierungszeichen und der dazugehörigen markierten Leistung bewusst verbunden wird (vgl. Gutjahr 2004, S. 58; Meffert/Burmann 2002, Keller 2003, S. 70 ff.; Aaker/Joachimsthaler 2000, S. 27 f.). Ahlert (2004b, S. 14 f.) weist darauf hin, dass die an eine Marke geknüpften AttributAssoziationen nur einen kleinen Teil zur Markenbildung beitragen. Aus Managementsicht besitzt der Anteil des Markenimages an der Markenbildung jedoch große Bedeutung, da er Anknüpfungspunkte für eine gezielte Beeinflussung des Bildungsprozesses bietet. Dem liegt die Überzeugung zu Grunde, dass sich bestimmte Imagebestandteile in der Markensubstanz als produktunabhängiger Sinngebung der Marke sedimentieren. Ihre Existenz erlaubt die Ausschöpfung markenstrategischer Optionen, bei denen die Sinngebung der Marke auf ein neues Produkt übertragen wird. Während das Markenimage in zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten als Untersuchungsgegenstand fungierte, wird die Markensubstanz erst durch interdisziplinäre Forschung zugänglich und stellt somit eine wesentliche Erweiterung der bisherigen Ansätze zur Erforschung des Markenwesens dar. Unter der Markensubstanz wird die produktunabhängige unbewusste Sinngebung der Marke verstanden, deren wesentlicher Bestandteil emotionale Haltungen sind (vgl. Gutjahr 2004, S. 58). Die latente Markensubstanz wird durch Symbole und Bilder bzw. in Form von symbolischen und bildhaften Geschichten wie z.B. Mythen transportiert. Die Markensubstanz gilt als unveränderliche und kaum direkt beeinflussbare Komponente des Markenwesens (vgl. Ahlert 2004a, S. 205). Aus Sicht der Markenführung ist sicherzustellen, dass die Bedeutungsinhalte von Image und Substanz nicht in einer widersprüchlichen Relation zueinander stehen. Der Grundstein für die Ausprägung von Deutungsmustern im Rahmen der Markenbildung wird mit Schaffung einer Problemlösung für einen persönlichen Entscheidungskonflikt des Konsumenten gelegt (vgl. Ahlert 2004b, S. 10). Durch dieses Verständnis der Markenbildung gewinnen zwei zentrale Faktoren an Bedeutung. Erstens muss eine risikobehaftete Entscheidungssituation bei der Markenproduktwahl vorliegen. Die Existenz eines subjektiv wahrgenommenen Risikos, verstanden als kognitive Inkonsistenz durch unvollständige Information (Vorentscheidungsdissonanz), begründet einen Entscheidungskonflikt (vgl. Ahlert 2005; Merten 2004, S. 62 – 28 – f.). Die von Bauer (1967, S. 389 ff.) begründete Risikotheorie unterscheidet mit finanziellen, funktionalen und physiologischen sowie psychischen und sozialen Risiken fünf mögliche Konfliktauslöser. In schlecht strukturierten Entscheidungssituationen stellt die konsumentenseitige Orientierung an Marken häufig eine Erfolg versprechende Strategie dar, um diese Risiken zu reduzieren und Informations- und Suchkosten einzusparen. Besteht die realistische Situation unvollkommener Sicherheit und Information, fungiert die Marke im Rahmen der Entscheidungsfindung als Vertrauensanker und Komplexitätsreduzierer. Der Entscheidungskonflikt ist zweitens nur dann von Bedeutung, wenn er die individuellen Motive und Bedürfnisse des jeweiligen Markenpublikums tangiert. Verspricht die Marke keine Befriedigung der persönlichen Bedürfnis- und Konsumproblemstrukturen, ruft sie kein Involvement hervor. Ein hoher Grad an Involvement in der Definition als Ich-Bezogenheit ist jedoch Voraussetzung für die Verankerung der Marke in den Gedächtnisstrukturen des Konsumenten, da es die Aktivierung und Aufmerksamkeit in hohem Maße beeinflusst (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003, S. 371 f.). Aus dem Blickwinkel einer funktionalen Betrachtung gehen Einflüsse auf die Marke nicht nur von der betrieblichen Funktionseinheit des Marketing aus, sondern von sämtlichen Ressorts der Unternehmung sowie von Absatzmittlern, Kooperationspartnern, beauftragten Agenturen, Konkurrenten etc. „Daher besteht die Kunst der ‚markenorientierten Unternehmensführung’ darin, diese Impulse übergreifend über die Ressorts, Märkte, Wertschöpfungsstufen und sogar über die Managergenerationen derart zu koordinieren, dass die markenpolitischen Ziele bestmöglich erreicht werden“ (Ahlert 2004b, S. 15). 3.3 Internationalisierung von Dienstleistungen 3.3.1 Grundlagen der Internationalisierungstheorie Die Internationalisierung als Unternehmensstrategie wird in der betriebswirtschaftlichen Theorie grundsätzlich aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet (vgl. Bamberger/Evers 1997b, S. 105 f.; Glaum 1996, S. 11): – 29 – Einerseits wird Internationalisierung im Sinne einer Zeitpunktbetrachtung anhand der erstmaligen Aufnahme oder Ausweitung der Auslandsaktivitäten eines inländischen Unternehmens festgemacht. Dementsprechend wird Internationalisierung als nachhaltige und bedeutsame Markterweiterung über Ländergrenzen hinweg verstanden (vgl. Dülfer 1982, S. 50; Macharzina 1989, Sp. 904). Diese Sichtweise spezifizieren einige Autoren, indem (bspw.) ein bestimmter Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz gegeben sein muss, um überhaupt von der Internationalisierung eines Unternehmens zu sprechen (vgl. Macharzina/Engelhard 1984, S. 30; Swoboda 2002, S. 6; Krystek/Zur 2002, S. 5 f.). Andererseits wird Internationalisierung als dynamischer Prozess aufgefasst, der als Teil der Unternehmensentwicklung über die Zeit hinweg stattfindet (vgl. Macharzina/Engelhard 1984, S. 30; Welch/Luostarinen 1988, S. 36; Bamberger/Evers 1997, S. 106; Swoboda 2002, S. 8). Aus dieser Perspektive wird die Folge von Aktivitäten untersucht, welche zu einem ansteigenden Internalisierungsgrad oder zu verschiedenen Internalisierungsformen führen. In der Theorie existiert eine Vielzahl von Konzepten, die zu erklären versuchen, in welcher Weise sich Internationalisierungsprozesse vollziehen. In Tabelle 3 ist eine Auswahl der bedeutendsten Theorien synoptisch zusammengefasst, um aufgrund der vorherrschenden Heterogenität der Ansätze einen hilfreichen Überblick über einige wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Internationalisierungsprozessen geben können. Nicht auszuschließen ist an dieser Stelle jedoch die teilweise gegebene Inkomensurabilität einzelner Theorien. Autor (Jahr) Vernon (1966) Aharoni (1966) Theorie Produktlebenszyklustheorie Behavioristische Theorie Perlmutter (1969) EPRGKonzept Luostarinen (1970) HelsinkiModell Grundgedanke Übertragung der PLZ-Theorie auf Exporte und internationale Direktinvestitionen. Die Internationalisierungsaktivitäten verlaufen im Zeitablauf phasenweise entlang dieses PLZ. Die Internationalisierung erfolgt durch schwer berechenbare Entscheidungsprozesse, die von dem Verhalten und den Attitüden der Manager stark abhängig sind. Typischer Entwicklungspfad je nach Erfahrung bzw. Intensität der Internationalisierungsaktivität von Ethnozentrierung über Polyzentrierung, Regiozentrierung bis hin zur Geozentrierung. Internalisierung durch Entscheidungs- und Lernprozesse, in deren Verlauf Unternehmen abhängig vom Grad ihrer lateralen Rigidität schrittweise ihre internationalen Aktivitäten erweitern. – 30 – Johanson/ Vahlne (1977) UppsalaModell Dunning (1980) Eklektische Theorie Cavusgil (1980) Exportstufenmodell Meissner/ Gerber (1980) Porter (1989) Deskriptives Stufenmodell Globalisierungskonzept Der Internationalisierungsprozess wird verstanden als ein inkrementaler, gradueller Entwicklungsprozess, beeinflusst vom Grad der Marktbindung und dem Wissensstand über den Markt. Integration verschiedener Analyserichtungen (z.B. PR-Theorie, Organisationstheorie) in ein Gesamtkonzept. Komparative Vorteile beeinflussen die Internationalisierungsaktivitäten. Der Internationalisierungsprozess ist ein Lernprozess und resultiert aus Managementinnovationen. Er verläuft in fünf Stufen: Domestic Marketing, Pre-Export Stage, Experimental Involvement, Active Involvement, Committed Involvement. Internationalisierungsaktivitäten stellen sich als ein in mehreren Stufen typisch verlaufender Prozess dar, der von Kapital- und Managementleistung im Gastland abhängig ist. Zweiteilung der Wirtschaftszweige in globale und länderspezifische Branchen, abhängig davon, ob Rückkopplungen zwischen den Marktgeschehen in anderen Ländern bestehen. Prozessorientiertes ganzheitliches Internationalisierungsmodell. In dem diskontinuierlichen Prozess der Internationalisierungsaktivitäten folgen auf lange Phasen relativer Stabilität kürzere Phasen revolutionären Wandels. Der Internationalisierungsprozess vollzieht sich dynamisch auf drei Entwicklungsebenen: inkrementale Evolution, Episoden und Epochen. Macharzina/ Engelhard (1984) GAINSAnsatz Kutscher (1992) Three-EsAnsatz Tabelle 3: Ausgewählte Theorien, Ansätze und Modelle der Internationalisierung (Quelle: Ahlert/Evanschitzky/Woisetschläger 2004) Ansätze, welche vornehmlich die Betrachtung von großen, in mehreren Ländern mit Direktinvestitionen vertretenden Unternehmen, die im Folgenden als MNU (Multinationale Unternehmen) bezeichnet werden, zum Gegenstand haben, sind der Three-EsAnsatz (vgl. Kutscher 1992, S. 11 ff.) und das EPRG-Konzept (vgl. Perlmutter 1969 S. 9 ff.). Behavioristische Ansätze, wie der von Aharoni (vgl. Aharoni 1966, S. 40 ff.) und das Exportstufenmodell von Cavusgil (vgl. Calvusgil 1980, S. 273 ff.), erklären hingegen eher den Internationalisierungsprozess von KMU, der stark von den Entscheidungen der Geschäftsführer bzw. Eigentümern beeinflusst wird. Auch das Uppsala-Modell (vgl. Johanson/Vahlne 1977, S. 23 ff.) und das Helsinki-Modell (vgl. Luostarinen 1970) beziehen sich vorwiegend auf KMU, da diese insbes. erste Internationalisierungsschritte analysieren. Der GAINS-Ansatz (vgl. Macharzina/Engelhard 1991, S. 23 ff.) und die eklektische Theorie (vgl. Dunning 1980, S. 9 ff.) nehmen eine Integration diverser Ansätze vor und liefern so einen universellen Erklärungshorizont. Ebenfalls universell in der Herangehensweise, jedoch auf den Phasenablauf der Internationalisierung beschränkt, erklären Meisner/Gerber (1980, S. 220 ff.) und Vernon (1966, S. 190 ff.) die Internationalisierung von Unternehmen. Anzumerken ist – 31 – jedoch, dass sich in der Literatur die eklektischen, „ganzheitlichen“ Theorien bisher noch nicht durchsetzen konnten. In den nachfolgenden Studien wird bei der Ermittlung der Erfolgsfaktoren der Internationalisierung von Dienstleistungsnetzwerken eine dynamische Sicht der Internationalisierung unterstellt. In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung der Begriffe Internationalisierung und Globalisierung von Bedeutung, welche oftmals im allgemeinen Sprachgebrauch irrtümlich verwechselt oder synonym verwendet werden. Während unter dem Begriff der Internationalisierung im Allgemeinen eine länderübergreifende Ausdehnung des unternehmerischen Aktionsfeldes verstanden wird, bezieht sich der Begriff der Globalisierung auf Märkte bzw. Branchen (vgl. Zentes/Swoboda 1997, S. 149). Er beinhaltet zunächst, dass unterschiedliche und zuvor weitgehend unabhängige Märkte bzw. Branchen in verschiedenen Ländern homogener werden und möglicherweise zu globalen Märkten bzw. Branchen zusammenwachsen (vgl. Bamberger/Wrona 1997, S. 714). Nach Porter kann ein Markt dann als global bezeichnet werden, wenn die Wettbewerbsposition auf einem Markt von der Position auf einem anderen Markt abhängt (vgl. Porter 1989, S. 18). Diese definitorische Trennung der Begriffe Internationalisierung und Globalisierung wird nachfolgend vorausgesetzt. 3.3.2 Dienstleistungen als Betrachtungsgegenstand Studien im Dienstleistungssektor setzen die Identifikation einzelner Dienstleistungsbranchen voraus. Die wissenschaftliche Diskussion hierzu basiert im Wesentlichen auf dem Drei-Sektoren-Modell (Den meisten amtlichen Statistiken – so auch der des Statistischen Bundesamtes – liegt die sektorale Gliederung nach Clark 1957 zu Grunde) aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (vgl. Mößlang 1995, S. 7; Meyer 1994, S. 7 f.). Danach werden alle Wirtschaftsbereiche, die nicht dem Landwirtschaftsbereich (primärer Sektor) und dem Produzierenden Gewerbe (sekundärer Sektor) zuzurechnen sind, als Residualgröße im tertiären Sektor zusammenfasst (vgl. Stille 2000, S. 4; Bieberstein 2001, S. 26; Maleri 1997, S. 10 ff.). – 32 – Das statistische Bundesamt untergliedert diesen auch als Dienstleistungssektor bezeichneten (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 9) Wirtschaftsbereich in mehrere Unterbereiche: Energie- und Wasserversorgung, Baugewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen/Vermietung beweglicher Sachen/Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen (vgl. Statistisches Bundesamt 2002, S. 28 ff.) Eine solche Einteilung enumerativen Charakters ist zwar nicht als Definitionsansatz mit dem Ziel der Herleitung konstitutiver Merkmale von Dienstleistungen geeignet (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 27; Haller 2002, S. 5; Decker 1975, S. 58; Maleri 1997, S. 42 f.), als Basis zur vorzunehmenden Identifikation von Dienstleistungsbranchen wird der Ansatz im Rahmen des Forschungsprojektes aufgrund seines „statistisch klassifizierenden und institutionellen Charakters“ (Mößlang 1995, S. 9.) aber als sinnvoll erachtet (vgl. ähnlich Ahlert et al. 2002, S. 14). Die Zugehörigkeit einzelner Branchen – insbesondere des Handels, der Kreditinstitute und Versicherungen – zum Dienstleistungssektor wird dagegen in der Literatur zum Teil kontrovers diskutiert. Im Hinblick auf die Zielsetzung des Forschungsprojektes erscheint es zweckmäßig, eine möglichst umfassende und heterogene Grundgesamtheit an Dienstleistungsbranchen als Betrachtungsgegenstand zu Grunde zu legen. Zur Ableitung relevanter und valider Aussagen ist es weiterhin sinnvoll, Branchen auszuwählen, in denen Internationalisierungstendenzen eine praktische Relevanz zugesprochen wird und in denen die Marktteilnehmer bereits über ein gewisses Ausmaß an Erfahrung verfügen. Der gleichen Argumentation folgend, sowie aufgrund des unterschiedlichen Charakters der entsprechenden Institutionen (vgl. z.B. Schwarz 1985, S. 91), sind die Bereiche Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie sonstige Dienstleistungen nicht Gegenstand des Forschungsprojektes. Auf Basis der vorangegangenen volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise soll im Folgenden die betriebswirtschaftliche Sicht dessen, was unter Dienstleistungen – 33 – verstanden wird, kurz erläutert werden, um darauf aufbauend die konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen zu diskutieren. Trotz des volkswirtschaftlich enormen Bedeutungsanstiegs des Dienstleistungssektors (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 9; Meffert/Bruhn 2002, S. 2; Bieberstein 2001, S. 17; Stille 2000, S. 4 ff.; vgl. kritisch hierzu auch Albach 1989, 397 ff., der einen Verlagerungseffekt vom Produktions- auf den Dienstleistungssektor konstatiert) findet das Thema Dienstleistungen erst in den letzten Jahren eine verstärkte Beachtung auf betriebswirtschaftlicher Ebene, wofür die gestiegene Anzahl eigenständiger Publikationen zu Dienstleistungen ein Indiz darstellt (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 4; Scheuch 2002, S. 1). Dabei sind auch heute noch grundlegende Fragen wie Wesen und Charakteristika von Dienstleistungen Gegenstand einer lebhaften Debatte, wobei „die Auffassungen darüber selbst heute fast noch so heterogen wie die Dienstleistung selbst“ (Hübner 1996, S. 16) sind – was sich in den zahlreich in der Literatur zu findenden Definitionsansätzen widerspiegelt (vgl. Haller 2002, S. 5; Rück 1995, S. 3). Die expliziten, auf konstitutiven Merkmalen von Dienstleistungen basierenden Definitionsvorschläge lassen sich vier Ansätzen zuordnen (vgl. Ahlert et al. 2002, S. 4; Bieger 2001, S. 7): Der tätigkeitsorientierte Definitionsansatz nach Schüller (1967, S. 19) versteht Dienstleistung sehr weit gefasst als jegliche physische bzw. psychische Tätigkeit des Menschen mit dem Ziel der Befriedigung eigener und/oder anderer Interessen. Zur Ableitung von Implikationen für das Dienstleistungsmanagement wird dieser Ansatz aber als problematisch erachtet (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 27; Evanschitzky 2003, S. 16). Als weitere Gruppe zielen potenzialorientierte Definitionsansätze auf die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft eines Anbieters ab (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 28; Bieberstein 2001, S. 29; Corsten, 2001, S. 21 f.). Prozessorientierte Ansätze fassen Dienstleistungen dynamisch als Tätigkeiten auf (vgl. Rück 1995, S. 5) und stellen die Notwendigkeit des synchronen Kontakts zwischen Anbieter und Kunden bzw. dessen Objekten in den Vordergrund (uno-actu-Prinzip) (vgl. Corsten 2001, S. 22; Berekoven 1983, S. 23). Der immaterielle Output bzw. Kundennutzen steht als Resultat des Dienstleistungsprozesses im Mittelpunkt ergebnisorientierter Definitionsansätze (vgl. Corsten 2001, S. 22; Maleri 1997, S. 3; Gerhardt 1987, S. 78 f.). – 34 – Die erläuterten Beispiele für sich genommen thematisieren somit einzelne konstitutive Merkmale von Dienstleistungen. Zur Erfassung sämtlicher relevanter Aspekte in einer Definition erachten Meffert/Bruhn (2003) die auf Hilke (1989) zurückgehende phasenbezogene Integration von Potenzial-, Prozess- und Ergebnisorientierung als geeignet: Hilke unterteilt den Produktionsprozess von Dienstleistungen in drei zeitlich aufeinander folgende Phasen, die durch je ein konstitutives Element gekennzeichnet sind: Das Dienstleistungspotenzial (konstitutives Element sind die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft), der Dienstleistungsprozess (Integration des externen Faktors) und das Dienstleistungsprodukt (Immaterialität). Der darauf aufbauende Definitionsansatz Meffert/Bruhn (2003) soll aufgrund des veranschaulichenden Charakters den folgenden Ausführungen zugrunde gelegt werden (Auch die integrierende Definition Meffert/Bruhn (2003) eignet sich nicht uneingeschränkt zur Identifikation einer Leistung als Dienst- oder Sachleistung; vgl. Ahlert et al. 2002): „Dienstleistungen sind selbständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung […] und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten […] verbunden sind (Potenzialorientierung). Interne […] und externe Faktoren […] werden im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktorenkombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren, an Menschen […] oder deren Objekten […] nutzenstiftende Wirkungen […] zu erzielen (Ergebnisorientierung)“ (Meffert/Bruhn 2003, S. 30). Die den vorgestellten Definitionsansätzen zu Grunde liegenden konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen dienen im Rahmen dieses Forschungsprojektes als Grundlage diverser Studien. Auf die marketing- bzw. internationalisierungsspezifischen Implikationen dieser Merkmale wird in den jeweiligen Folgestudien zurückgegriffen werden, so dass die einzelnen Merkmale hier nur kurz erläutert werden sollen: Die Immaterialität, d.h. die „fehlende sinnliche Wahrnehmbarkeit“ (Maleri 1997, S. 69 f.; vgl. hierzu bspw. auch Ahlert et al. 2002, S. 6; Meffert/Bruhn 2003, S. 64; Meyer 1994, S. 19 f.) von Dienstleistungen, wird als das grundlegendste die Dienstleistung vom Sachgut unterscheidende Merkmal angesehen (vgl. Zeithaml et al. 1985, S. 33; Corsten 1990, S. 22; Ekeledo/Sivakumar 1998, S. 278), wobei gleichzeitig auch hier – 35 – die wissenschaftlichen Sichtweisen die genaue Bedeutung des Begriffs betreffend stark differieren. So wird Immaterialität teilweise auf den Leistungserstellungsprozess und/oder das Dienstleistungsergebnis bezogen (vgl. Hilke 1989, S. 14; Meffert/Bruhn 2003, S. 64), teilweise werden Leistungspotenziale, die zur Erstellung einer Dienstleistung notwendig sind, in den Vordergrund gestellt (vgl. Ahlert et al. 2002, S. 6; Meyer 1994, S. 21; Gerhardt 1987, S. 78). Als akzessorische Merkmale leiten einige Autoren aus der Immaterialität die marketingspezifischen Dienstleistungsbesonderheiten Nichtlager- und Nichttransportfähigkeit her (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 64. Eine gegensätzliche Meinung hierzu vertritt Rosada 1990, S. 19 ff., der die ökonomische Relevanz der akzessorischen Merkmale zwar anerkennt, diese aber als sich aus der Integration des externen Faktors ergebend darstellt). Die Integrationserfordernis des externen Faktors bezeichnet die zwingend notwendige Einbeziehung eines sich außerhalb des Verfügungsbereichs des Dienstleistungsanbieters befindenden Faktors in den Leistungserstellungsprozess (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 62), und wird in der Literatur weitgehend unumstritten als konstitutives Merkmal von Dienstleistungen anerkannt (vgl. Rück 1995, S. 15). Dieser Fremdfaktor kann der Nachfrager selbst oder ein zur Verfügung gestelltes Objekt sein (vgl. Meyer 1994, S. 22; Eine Übersicht über die verschiedenen Formen von Fremdfaktoren geben bspw. Scheuch 2002, S. 18; Maleri 1997, S. 148 ff.); die Integrationsintensität kann je nach Art der Dienstleistung variieren (vgl. Maleri 1997, S. 108; Corsten 2000, S. 151; Corsten unterscheidet weiterhin zwischen einer raumzeitlichen (die Integration des Fremdfaktors erfolgt räumlich und zeitlich synchron wie z.B. beim Friseurbesuch) und einer lediglich zeitlichen Integration (uno-actu-Prinzip) wie z.B. bei der Telefonauskunft). Teils als sich aus der Immaterialität und der Integrationserfordernis des externen Faktors ergebend, teils als eigene konstitutive Merkmale von Dienstleistungen werden in der Literatur das uno-actu-Prinzip (d.h. die Synchronität von Leistungserstellung und Leistungsabgabe) (vgl. Haller 2002, S. 6; Corsten 1990, S. 19; Dunning 1989, S. 6; Bieger 2001, S. 8 f.), und die Nichtstandardisierbarkeit der Leistungsqualität betrachtet (Eine Übersicht zu in der Literatur referenzierten Dienstleistungscharakeristika geben Zeithaml et al. 1985, S. 33). Schließlich wird diskutiert, ob es sich bei der Notwendigkeit einer spezifischen Leistungsfähigkeit des – 36 – Dienstleistungsanbieters um ein konstitutives Merkmal handelt. Meffert/Bruhn (2003) verstehen hierunter das zur Erbringung einer Dienstleistung bereitzustellende Potenzial in Form einer menschlichen oder automatisierten Leistungsfähigkeit (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 61; Meffert/Wolter 2000, S. 7). Da im Zusammenhang mit der Internationalisierung von Dienstleistungen hieraus aber wesentliche Implikationen für die Ausgestaltung internationalisierter Dienstleistungen abgeleitet werden können (vgl. Meffert/Bruhn 2003, S. 722 f.), wird die Notwendigkeit der Leistungsfähigkeit ebenfalls als Basis für die Bildung zukünftiger Forschungshypothesen herangezogen. Da bezüglich der generellen Existenz und ökonomischen Relevanz von dienstleistungsspezifischen Besonderheiten weitestgehend Konsens besteht (vgl. Rück 1995, S. 18), soll die Diskussion darüber, welche Besonderheit sich aus welchem konstitutiven Merkmal ableitet, an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. 3.3.3 Ziele, Motive und Barrieren der Internationalisierung von Dienstleistungen Nachdem die Charakteristika von Dienstleistungen im Gegensatz zu Sachleistungen diskutiert wurden, soweit dies überhaupt in einer ersten Entfaltung des Untersuchungsbereiches möglich ist, gilt es im Folgenden die spezifischen Beweggründe und die daraus abgeleiteten Unternehmensziele für die Internationalisierung von Dienstleistungen zu betrachten (vgl. Rück 1995, S. 18). In der Regel werden mit der Internationalisierung zugleich mehrere Motive verfolgt (vgl. Cicic/Patterson/Shoham 1999, S. 97; Czinkota/Ronkainen 1998, S. 285; Meffert/Bolz 1998, S. 97). Diese lassen sich einerseits in reaktive und andererseits in pro-aktive Motive unterteilen (vgl. Czinkota/Ronkainen 1998, S. 285; Ahlert/ Woisetschläger 2004, S. 7; Ahlert/Evanschitzky/Woisetschläger 2004, S. 307). Reaktive Motive liegen vor, wenn die Entscheidung eines Unternehmens, in anderen Ländern aktiv zu werden, z.B. von Kunden, Umweltfaktoren oder Wettbewerbern beeinflusst wird. Entscheidet sich das Unternehmen dagegen von sich aus heraus, die Chancen in anderen Ländern zu nutzen, bevor (z.B.) der Heimatmarkt seine Sättigung erreicht, spricht man von pro-aktiver Internationalisierung. Bisher war festzustellen, dass reaktive Motive einen weitaus größeren Einfluss auf die Internationalisierungsentscheidung ausüben als pro-aktive Motive (vgl. Meffert/Wolter 2000, S. 20). – 37 – Im Vordergrund der Internationalisierungsbemühungen stehen hauptsächlich absatzorientierte Motive, wie die Sicherung bestehender und die Erschließung neuer Absatzmärkte (vgl. Kebschull 1989, Sp. 980; Meffert/Bolz 1998, S. 97). Zu den wichtigen weiteren pro-aktiven Motiven zählt die Verbesserung des Images ggü. den Kunden, Ausnutzung von Größeneffekten, der Zugang zu ausländischem Know-How sowie die internationale Risikostreuung. Große Bedeutung haben auch die beiden reaktiven Motive, Internationalisierung der bestehenden Kunden und der Wettbewerber (vgl. Köhler 1991, S. 80; Ahlert/Woisetschläger 2004, S. 8; Ahlert/Evanschitzky/ Woisetschläger 2004, S. 308). Darüber hinaus sind in der nachfolgenden Abbildung weitere pro-aktive und reaktive Motive aufgeführt, weswegen Unternehmen den Schritt in die Internationalisierung wagen und entsprechende Internationalisierungsziele formulieren. 3.3.4 Formen der Internationalisierung von Dienstleistungen Transaktionen über Ländergrenzen hinweg, die bei international tätigen Unternehmen ex definitione auftreten, können in verschiedenen Koordinationsformen durchgeführt werden. Diese sollen den gegebenen Anforderungen möglichst effizient entsprechen. Ein Überblick über die Grundformen der Internationalisierung in Abhängigkeit der Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, sowie des Ressourceneinsatzes im Ausland ist Abbildung 5 grafisch dargestellt. Vertreter der Stufenmodelle (vgl. Tabelle 3) gehen davon aus, dass Unternehmen die verschiedenen Internationalisierungsformen im Zeitablauf in der dargestellten Weise stufenförmig durchlaufen (vgl. Gankema/ Snuif/Zwart 2000, S. 25). – 38 – Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten + Tochtergesellschaft Joint Venture Franchising Lizenzierung Export Import − − + Ressourceneinsatz Abbildung 5: Grundformen der Internationalisierung (Quelle: In Anlehnung an Meissner/Gerber 1980, S. 224) Eine erste denkbare Grundform der Internationalisierung ist die Betätigung auf ausländischen Beschaffungsmärkten, bei der es sich neben dem Import von Rohstoffen auch um Personal-, Know-how- oder Kapitalimport handeln kann (vgl. Pleitner 1995, S. 315 f.). Da jedoch seit der hohen internationalen Transparenz durch das Internet nahezu jede Unternehmung in einer der genannten Formen importiert, wird dies nicht als eigenständige Internationalisierungsstrategie angesehen. Die meisten Phasenmodelle berücksichtigen den Import nicht. Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland und Maßnahmen wie das Offshoring, d.h. das Outsourcen von IT-Aufgaben in Niedriglohnländer, stellen ebenfalls keine eigenständigen Internationalisierungsstrategien dar, da es am Eintritt in den dortigen Markt fehlt (vgl. Gerum 2000, S. 277), und solche Strategien eher finanzpolitisch als durch Internationalisierungsstreben motiviert sind. Die erste Stufe der Internationalisierung ist demnach der Export, welcher auf unterschiedliche Weise organisiert werden kann. Entweder als indirekter Export unter Verwendung von spezialisierten Zwischenhändlern oder als direkter Export. In der – 39 – vorliegenden Arbeit wird ausschließlich der direkte Export untersucht, da sich der indirekte Export aus Unternehmenssicht kaum von Inlandsgeschäften unterscheidet. Zum einen liefert der Exportmittler das landesspezifische Know-how und zum anderen werden ihm alle exportbezogenen Tätigkeiten überlassen (vgl. Brenner 1989, Sp. 580 ff.). Die nächsten Stufen im Internationalisierungsprozess bestehen aus kooperativen Internationalisierungsformen. Sie bauen bei rechtlicher Selbständigkeit auf einer gemeinsamen Zielsetzung auf und es handelt sich zumindest bei einem der Partner um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit (vgl. Perlitz 1997, S. 443). Zu den Kooperationsstrategien bzw. strategischen Allianzen zählen Lizenzierungen und Franchising als vertragliche Kooperationen ohne Kapitalbeteilung sowie Joint Ventures als Kooperationsform mit Kapitalbeteiligung (vgl. Bleicher 2002, S. 860; Kumar 1989, Sp. 916). Joint Ventures sind definiert als Gemeinschaftsunternehmen zweier rechtlich selbständiger, jedoch wirtschaftlich abhängiger Unternehmen, bei dem sich die Partner Finanzierung, Risiko und Führungsverantwortung teilen (vgl. Kutscher 1992, S. 500). Der höchste Ressourcen- und Managementeinsatz im Ausland muss bei der Direktinvestitionsstrategie aufgewendet werden. Neben den aus dort beschriebenen Gründen zuvor genannten Joint Ventures zählen Tochtergesellschaften im Ausland zu den internationalen Direktinvestitionen. Diese voll beherrschten Tochtergesellschaften können einerseits selbst gegründet werden oder andererseits durch Akquisitionen erworben werden. Dabei grenzt der Wunsch nach unternehmerischer Einflussnahme und Kontrolle die Akquisition von Portfolio-Investitionen und Finanzbeteiligungen ab (vgl. Gerpott 1993, S. 22). 3.4 Markenführung in internationalen Dienstleistungsnetzwerken Dieses Kapitel integriert die bisher dargestellten Erkenntnisse der vorherigen Kapitel, indem es die Schlüsselbegriffe Unternehmensnetzwerk, Marke und Internationalisierung von Dienstleistungen inhaltlich zusammenführt. Markenführung in internationalen Dienstleistungsnetzwerken ist der Kern des zugrunde liegenden Forschungsprojekt IMADI.net, den es innerhalb der nächsten Projektschritte tiefer gehend zu analysieren gilt. – 40 – Das Markenmanagement ist aufgrund der zunehmenden Homogenisierung von Produkten und Dienstleistungen ein wichtiger – wenn nicht gar der entscheidende – Stellhebel für eine erfolgreiche Internationalisierung. Insbesondere vor dem Hintergrund der in 3.2.2 dargestellten Risikotheorie von Bauer kommt der Marke im Rahmen der Entscheidungsfindung eines Konsumenten beim Kauf einer Dienstleistung als Komplexitätsreduzierer und Vertrauensanker eine besondere Rolle zu. Diese allgemein unterstellte und nicht nur auf Dienstleistungen beschränkte Wirkungsweise von Marken kann jedoch im internationalen Kontext sehr unterschiedlich geartet sein. Da Menschen unterschiedlicher Kulturen – gemäß der Whorfschen Hypothese – unterschiedliche Denkweisen und Bilder von der Realität besitzen (vgl. Usunier/Walliser 1993, S. 63 f.), muss das Markenmanagement am divergenten Markenwissen der Konsumenten ansetzen. Dieses zeigt sich vor allem in unterschiedlichen Bildern, Verwendungszusammenhängen, Gefühlen und Eigenschaften einer Marke in den Köpfen der Konsumenten (vgl. Esch/Wicke 2001, S. 10 f.). Das internationale Markenmanagement steht daher in einem Spannungsfeld zwischen den Extrema der globalen Standardisierung und der lokalen Differenzierung. Kulturelle Unterschiede können den Erfolg der Internationalisierung aus verschiedenen Richtungen beeinflussen: So können Produkte und Dienstleistungen culture-free oder culture-bound, d.h. mit bestimmten Werten eines Landes bzw. einer Kultur geladen sein. Speziell Soft-Drinks, Zigaretten und Fast-Food-Unternehmen sind von angloamerikanischen Marken dominiert wie bspw. Coca-Cola, Seven-Up, Sprite, Schweppes, Marlboro, Camel, Rothmans, Subway, McDonald’s, Burger King oder KFC. Die Tendenz zur Konvergenz in diesen Produktkategorien wird damit in Verbindung gebracht, dass die genannten Unternehmen und Marken als erste fortgeschrittene Marketingtechniken angewandt und mit zunehmendem Wettbewerb aus Effizienzgründen immer weiter standardisiert haben (vgl. De Mooij 2003, S. 195). Diese Paradebeispiele für erfolgreiches standardisiertes Markenmanagement der letzten Dekaden erzielen jedoch in Ländern, deren kulturelle Werte von angloamerikanischen Werten differieren, zum Teil nur suboptimale Ergebnisse: „Global advertising, however, does not appeal to universal values because there are no universal values … the idea that there are universal values that can be used for global – 41 – advertising is one of the global marketing myths of past decades“ (vgl. De Mooij 2003, S. 196 f.). Jedoch bedeutet dies nicht zwingend, dass das Markenmanagement bei starken kulturellen Unterschieden zwischen Heimatmarkt und Zielland in letzterem eine differenzierte Strategie umsetzen muss. Dies ist stets abhängig von den Einstellungen und der Präferenzstruktur der Konsumenten. So werden bspw. sog. ethnozentrische Kunden weltweit standardisiert vermarktete Dienstleistungen als befremdlich empfinden und meiden. Ist das Markenimage des Anbieterlandes aus Sicht der Kunden im Zielland in der jeweiligen Produktkategorie positiv – in diesem Fall spricht man von einem positiven „Country-of-Origin“-Effekt –, ist eine Anpassung unter Umständen sogar kontraproduktiv. So schätzen bspw. deutsche Verbraucher die Herkunft von Schuhen und Lederwaren aus Italien (vgl. Ahlert et al. 2004) und englische Verbraucher die Herkunft von Automobilen aus Deutschland positiv ein (vgl. Balabanis and Diamantopoulos 2004). Neben kulturellen Unterschieden, die – wie gezeigt – durchaus unterschiedliche Konsequenzen für die Markenstrategie haben können, sind eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten, die in Abbildung 6 dargestellt sind. Abbildung 6: Standardisierungspotenzial der Kerndienstleistung und des sonstigen Marketingmix in Dienstleistungsunternehmen (Quelle: Meffert/Wolter 2000, S. 30) – 42 – Zusätzlich zu den zu berücksichtigenden Faktoren im internationalen Kontext sind in internationalen Dienstleistungsnetzwerken ebenso netzwerkspezifische Fragestellungen zu beantworten. Unternehmensnetzwerke umfassen eine Mehrzahl von Unternehmen, die in irgendeiner Form Markenmanagement betreiben (vgl. Kapitel 3.1). Ziel des sog. integrierten Markenmanagement ist es daher, die Markenstrategien der Partner durch aufeinander abgestimmte, vertrauensbildende Maßnahmen zu harmonisieren (vgl. Ahlert 2001, S. 37). Diese beziehen sich bspw. auf die Koordination • der Firmenmarke des Systemkopfs und den Firmenmarken der Mitglieder. • den Betriebstypenmarken differenter Vertriebslinien oder • dem Markenauftritt des Unternehmensnetzwerks als Ganzes und den der Mitglieder (vgl. Ahlert 2001, S. 41). Konkret ergeben sich für das Markenmanagement von Unternehmensnetzwerken unterschiedliche strategische Optionen (vgl. hierzu und im Folgenden Ahlert 2001, S. 45). Dabei stellt die Harmonisierung, z.B. im Rahmen von ECR-Kooperationen, die schwächste und die markenpolitische Dominanz des Netzführers die weitest gehende Form des kooperativen Markenmanagements dar. Daneben bestehen weitere Optionen in Form des Co-Branding und des Megabranding. Beim Co-Branding handelt es sich um das gemeinsame Auftreten selbständiger Marken unterschiedlicher Unternehmen (vgl. Braitmayer 1998, S. 33; Aaker/ Joachimsthaler 2001, S. 151; Esch 2004, S. 353). Dabei ist auf eine Übereinstimmung bzw. Ergänzung der mit den beiden Marken verbundenen Assoziationen aus Sicht der Konsumenten zu achten (vgl. Aaker/Joachimsthaler 2001, S. 151; Meffert 2002, S. 152). Die Chancen des Co-Branding liegen in einem gegenseitigen Imagetransfer und der Nutzung des von den Kunden den beiden Partnern gegenüber gebrachten Vertrauens (vgl. Meffert 2002, S. 152). Für die Verankerung des gemeinsamen Leistungskomplexes eines mehrere Partner umfassenden Unternehmensnetzwerkes als Einheit aus Sicht der Konsumenten ist das Co-Branding allerdings nur bedingt geeignet, da der Kunde mit differenten Markenkombinationen konfrontiert ist. Zielführender ist die Einführung einer sog. Megabrand zu den weiterhin isoliert in Erscheinung tretenden Einzelmarken (vgl. Ahlert 2001, S. 48 f.). Im Unterschied zum – 43 – Co-Branding tritt hierbei die Gesamtheit der Netzakteure unter einem Markendach nach außen in Erscheinung, wodurch sich die Chancen, allerdings auch die Risiken erheblich vergrößern. Die markenpolitische Handlungsfreiheit der beteiligten Netzakteure ist erheblich eingeschränkt und es bedarf zwingend einer zentralen Markenführung. Als „zu Ende gedachte Form der Vertikalisten“ ist schließlich die netzgeführte Marke anzuführen. Sie ist „ein Know-how-Verbund mit einer Marke als Klammer und der Systemzentrale als Kern“ (BBE 1999, S. 158) Die Netzakteure treten unter dieser Marke anderen Marktteilnehmern gegenüber auf, als wären sie eine einzige Unternehmung. Die eigenen Firmen- und Produktmarken der Beteiligten treten fast vollständig in den Hintergrund. Die netzgeführte Marke wird von einem Systemkopf gesteuert. Als Ideen-Träger delegiert und kontrolliert dieser alle Aktivitäten innerhalb des Netzwerkes (vgl. BBE 1999, S. 158). Welche Markenstrategie seitens des Netzwerks zu verfolgen ist, bleibt abhängig von dessen Konfiguration und den Ressourcen der Partner. Sofern die Netzwerkakteure bereits über starke Marken verfügen, ist das Megabranding die Erfolg versprechende Strategie (vgl. Ahlert 2001, S. 52). Die netzgeführte Marke kann bei Partner mit eher schwachen Marken bzw. in einem dynamischen Marktumfeld zum Tragen kommen. Da die Bewertung von Marken interkulturell zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, ist fraglich, inwieweit solche normativen Empfehlungen im internationalen Kontext gelten. Dies ist im Rahmen dieses Projekts zu untersuchen. 3.5 Internationalisierungs-Scorecard Um die dem Forschungsprojekt zugrunde gelegten Ziele der Verbesserung von Präferenz und Verfügbarkeit von Dienstleistungen zu erreichen, bedarf es aus Sicht der Unternehmen eines ständigen Controllings des internationalen Engagements. Ein Managementtool, das diesbezüglich eine weite Verbreitung in Forschung und Praxis erfahren hat, ist die Balanced Scorecard. Ihre Grundlagen sollen im Folgenden vorgestellt werden. Die Balanced Scorecard geht auf Kaplan/Norton (1997) zurück, die diese als Instrument des strategischen Managements konzipiert haben. Sie dient in erster Linie der – 44 – Eliminierung von Diskrepanzen zwischen Strategieplanung und -implementierung eines Unternehmens (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 184). Darüber hinaus sollen mit der Balanced Scorecard Mängel klassischer Performance Measurement-Systeme überwunden werden, weshalb die Balanced Scorecard • nicht nur finanzielle, sondern auch nicht-finanzielle Kennzahlen umfasst (vgl. Kaplan/Norton 1996, S. 75 ff., 1997, S. 7 f.; Müller 2000, S. 70). • nicht nur vergangenheitsorientierte, sondern auch zukunftsorientierte Kennzahlen berücksichtigt. Mit vergangenheitsorientierten Kennzahlen sind traditionelle Ergebniskennzahlen („Spätindikatoren“) wie z. B. Rentabilität und Marktanteil, mit zukunftsorientierten Kennzahlen hingegen sog. Leistungstreiber („Frühindikatoren“) wie z. B. Kompetenzen gemeint (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 7 ff.; Engel 2001, S. 54 ff.). • nicht nur Kennzahlen umfasst, die die Unternehmensleistung aus unternehmensinterner, sondern auch aus unternehmensexterner Perspektive beurteilen (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 10 ff.). • nicht nur der Unternehmensleitung sondern, durch ihre Implementierung auf allen Hierarchieebnen, allen Mitarbeitern des Unternehmens dient (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 8 ff.). Um eine Balanced Scorecard in einem Unternehmen einzuführen, ist zunächst eine Strategie zu formulieren (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 11). Anschließend werden für die, in Abbildung 7 dargestellten, exemplarischen Perspektiven der Balanced Scorecard aus der Strategie des Unternehmens Ziele und Kennzahlen abgeleitet (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 8; Kaplan/Norton 1996, S. 82). Dabei müssen die jeweiligen Kennzahlen und Ziele in einem Ursache-Wirkungszusammenhang zueinander stehen, damit gewährleistet ist, dass die Ziele tatsächlich erreicht werden. Dazu ist die die Strategie umzusetzen, indem die Mitarbeiter die „Vorgaben“ (Zielwerte) für die Kennzahlen erreichen. Durch den Vergleich der Ziel- mit den Istwerten der Kennzahlen besteht für die Führungskräfte zudem eine Kontrollmöglichkeit, so dass diese gegebenenfalls korrigierend eingreifen können (vgl. Kaplan/Norton 1996, S. 84 f.).11 11 Zu den verschiedenen Formen der Korrektur i.S. von Single-Loop, Double-Loop und Detero Lernens vgl. Creusen/Salfeld 2001, S. 246 f. – 45 – Finanzielle Perspektive Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen Kunden Perspektive Ziele Kennzahlen Vorgaben Interne Geschäftsprozess Perspektive Strategie Maßnahmen Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen Innovationsperspektive Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen Abbildung 7: Balanced Scorecard (Quelle: In Anlehnung an Kaplan/Norton 1996, S. 76) In Abbildung 7 ist eine Balanced Scorecard mit den vier von Kaplan/Norton vorgeschlagenen Perspektiven dargestellt (vgl. Kaplan/Norton 1996, S. 75 ff.; Kaplan/ Norton 1997, S. 8 ff.). In Abhängigkeit vom Ziel der Anwendung der Balanced Scorecard können gegebenenfalls Perspektiven gestrichen oder ergänzt werden (vgl. Johnson 1998, S. 35 f.; Mende/Stier 2002, S. 101 ff.; Müller 2000, S. 71 ff.). Da im Rahmen des Internationalisierungprozesses anzunehmen ist, dass die Präsenz eines Dienstleistungsunternehmens auf mehreren Ländermärkten eine Vielzahl zusätzlicher Aspekte impliziert, muss auch diese Besonderheit explizit in der Ausgestaltung der Balanced Scorecard Berücksichtigung finden. Um einer internationalen Ausrichtung gerecht zu werden, ist somit zu überlegen, ob eine eigenständige Auslandsperspektive einzubeziehen ist. Auch könnte unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Dienstleitungsunternehmen sich zunehmend der Organisationsform des Netzwerkes bedienen, die Integration einer Partnerperspektive sinnvoll sein. – 46 – 4 Osteuropa als Schwerpunkt 4.1 Relevanz der Standortwahl Nachdem die allgemeinen Grundlagen der Internationalisierung von Dienstleistungen betrachtet wurden, soll der besondere Fokus dieses Forschungsprojektes „Osteuropa“ näher erläutert werden. Nicht nur in der Internationalisierungsliteratur, sondern auch in der Unternehmenspraxis besteht eine hohe Verunsicherung hinsichtlich dieser Internationalisierungsländer, da auch und insbesondere im Bereich der Dienstleistungen die Wahl eines geeigneten Standorts von zentraler Bedeutung ist. Die Standortwahl hat nicht nur einen langfristigen Charakter, sondern ist auch schwer revidierbar Sie. beeinflusst sowohl Transport- als auch Lohnkosten und hat dadurch einen direkten Einfluss auf die Gewinnsituation des internationalisierenden Unternehmens. Wie bereits erwähnt, müssen die meisten Dienstleistungen vor Ort erbracht werden, wo sich auch der Kunde befindet. Sollten Probleme auftreten, wird es dem Kunden wichtig sein, in seiner Muttersprache zu kommunizieren und auf eine ihm bekannte Rechtssicherheit vertrauen zu können (vgl. Woratschek/Pastowski 2004, S. 218 f.; Contor 2004, S. 2). Im Folgenden sollen die Standortfaktoren Osteuropas mit denen Deutschlands verglichen werden, um einen ersten Eindruck vom Markteintritt deutscher Unternehmen nach Osteuropa zu gewinnen. Zunächst sei festzuhalten, dass Deutschland gerade in Hinsicht auf die Unternehmenskosten wesentliche Nachteile gegenüber osteuropäischen Ländern aufweist. Die deutschen Bruttoarbeitnehmerentgelte betragen im Dienstleistungsbereich im Durchschnitt 2.500€ monatlich bei einer durchschnittlich geleisteten Jahresarbeitszeit von 1.660 Stunden. Im Vergleich zu den osteuropäischen Ländern sind die Arbeitskräfte jedoch besser ausgebildet und auch effizienter. Die Unternehmenssteuern in Deutschland sind mit 38,7% die höchsten in ganz Europa. Auch die Kosten für Telekommunikation und Internet sind im Vergleich hoch. Deutschland hat zwar ein ausgesprochen gut ausgebautes Verkehrsnetz, damit ist jedoch kein wesentlicher Vorteil gegenüber den osteuropäischen Ländern verbunden, da auch diese über ausreichende Flughafenanbindungen und gut ausgebaute Straßennetze verfügen (vgl. Contor 2004, S. 93 f.). Zusätzlich zu den Kostenvorteilen besteht ein wesentlicher Vorteil der Expansion in Richtung Osteuropa in der geographischen Nähe zu – 47 – Deutschland. Weitere Vorteile, die aus den geographischen Gegebenheiten resultieren, sind die geringen sprachlichen Barrieren, da ein Großteil der osteuropäischen Bevölkerung neben der Landessprache über Englisch- und Deutschkenntnisse verfügt. 4.2 Rahmenbedingungen in Osteuropa am Beispiel von Polen und Tschechien Als erste Forschungsmärkte seien aufgrund ihres raschen Fortschrittes im Vergleich zu den weiteren Ländern Osteuropas Polen und Tschechien genannt. Polen Das seit dem 01.05.2004 zur EU gehörende Polen erlebte in den vergangenen drei Jahren einen Konjunkturaufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg seit 2002 jährlich um bis zu 6 Prozentpunkte. Der wirtschaftliche Aufschwung Polens führte zu einer gestiegenen Kaufkraft der polnischen Konsumenten (vgl. Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. 2004a; Dresdner Bank 2004, S. 18 ff.) Deutsche Investitionen in Polen lohnen sich nicht nur aufgrund der positiven geographischen Lage, sondern auch wegen der geringen Kosten, insbesondere im Bereich der Löhne und Gehälter. Die monatlichen Bruttoentgelte betragen in Polen im Durchschnitt 750€, das entspricht gerade 30% des deutschen Durchschnittsentgelts. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden liegt mit einem Durchschnittswert von 1.890 Stunden jährlich deutlich über dem deutschen Wert. Polen verfügt zwar über qualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte, das deutsche Niveau wird aber bei weitem nicht erreicht. Insbesondere im Bereich des Führungspersonals weisen polnische Mitarbeiter Defizite auf. Des Weiteren liegen die Beschäftigtenanteile im tertiären Sektor an der Gesamtbeschäftigung mit nur 55,5% deutlich unter dem deutschen Wert von 70,3% (vgl. Contor 2004, S. 87 f.; Dresdner Bank 2004, S. 18 ff.; Statistisches Bundesamt 2005b; Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. 2004a). Im Bereich der Infrastruktur weist Polen Nachteile gegenüber Deutschland auf; Flughäfen sind zwar mit einer Entfernung von bis zu 100km von allen Regionen aus erreichbar, das Straßennetz ist jedoch längst noch nicht auf westlichem Niveau. Telekommunikations- und Internetkosten liegen weit unter dem deutschen Durchschnitt. – 48 – Der Anteil der Nutzer moderner Informations- und Kommunikationstechnologien hat den westeuropäischen Stand noch nicht erreicht. In Polen werden inländische und ausländische Unternehmen rechtlich gleich gestellt. Auch der Erwerb von Immobilien durch ausländische Investoren ist problemlos möglich. Schutzrechte, wie z.B. Patentgesetzte und Markenzeichen, sind dem internationalen Recht angeglichen. Deutsche Unternehmen können in Polen zwischen der Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und der Aktiengesellschaft (AG) wählen. Um in Polen tätig zu werden, ist lediglich eine Registrierung der geschäftlichen Tätigkeit erforderlich (vgl. Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. 2004a). Tschechien Auch das ebenfalls seit dem 01.04.2004 zur EU gehörende Tschechien ist ein stetig wachsender Markt. Seit 2003 ist das BIP jährlich um bis zu 4 Prozentpunkte gestiegen. Die gestiegene Kaufkraft führte auch hier zu einer gestiegenen Nachfrage nach deutschen Gütern. Mit einem Anteil von 21,5% am gesamten Osthandel Deutschlands liegt Tschechien unangefochten an der Spitze. 50% der Investitionen in Tschechien stammen aus Deutschland, was den Status als wichtigstes Herkunftsland ausländischer Investitionen bestätigt. Gerade für den Bereich der Tourismusund Transportdienstleistungen ist Tschechien aufgrund der Attraktivität als Reiseziel sowie der guten Transportinfrastruktur ein wichtiger Standort. Nicht nur die strategisch günstige Lage, sondern auch die geringen Kosten stellen Vorteile des Wirtschaftsstandorts Tschechien dar. Die monatlichen Bruttoarbeitsentgelte betragen im tertiären Sektor durchschnittlich 650€ monatlich bei einer Durchschnittsjahresarbeitszeit von 1.790 Stunden. Tschechien verfügt dabei über ein breites Angebot qualifizierter Fachkräfte, die insbesondere in der deutschen Sprache gut ausgebildet sind. Der Anteil der Bevölkerung mit einem weiterführenden Schulabschluss ist nach den USA und der Schweiz der dritthöchste der Welt. In der funktionierenden Infrastruktur mit einem dichten inländischen Flug- und Eisenbahnnetz und guter Straßenqualität ist ein weiterer Standortvorteil zu sehen (vgl. Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. 2004b). Moderne Informations- und Kommunikati- – 49 – onstechnologien werden in Tschechien im nahezu gleichen Maße genutzt wie in Westeuropa (vgl. Statistisches Bundesamt 2005a). Zwischen der rechtlichen Stellung inländischer und ausländischer Unternehmen besteht auch in Tschechien kein Unterschied. In Tschechien registrierte Unternehmen können Immobilien erwerben und auch die Schutzrechte gelten uneingeschränkt. Zusätzlich zu den Rechtsformen der KG, der AG sowie der GmbH ist in Tschechien auch die Möglichkeit gegeben, eine offene Handelsgesellschaft (OHG) zu gründen. Außer im Finanzdienstleistungsbereich werden ausländische Investitionsmaßnahmen von der Regierung nicht kontrolliert (vgl. Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. 2004b). 4.3 Markenführung in Osteuropa Die Expansion von Unternehmen nach Osteuropa ist vor dem Hintergrund der Osterweiterung der europäischen Union und dem Zusammenwachsen der Märkte in Europa in aller Munde. So zeigen die Entwicklungen in den Ländern deren hohe ökonomische Attraktivität. Doch während auf der Sourcing-Seite die Internationalisierung deutscher Unternehmen vielfach mit negativen Schlagzeilen verbunden ist – so etwa die negative Reaktion der Presse auf die Auslagerungsbemühungen von Siemens nach Osteuropa –, liegt auf der Vertriebsseite der Unternehmen ein großes Potenzial für Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum in Deutschland. So sind die deutschen Exporte nach Osteuropa in den letzten 2 Jahren um jährlich etwa 7% gestiegen. In der Summe ist der osteuropäische Markt nach Angaben der deutschen Bundesbank für deutsche Unternehmen bereits bedeutender als der US-amerikanische Markt. Es ist somit höchste Zeit, den Blick nach Osten zu wenden und den osteuropäischen Markt genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn während einige deutsche Unternehmen bereits sehr erfolgreich in Osteuropa tätig sind, waren zahlreiche Engagements nicht von Erfolg gekrönt. Dabei bietet der Export von bereits im bisherigen Heimatmarkt erfolgreichen Produkten nach Osteuropa enorme Chancen. Dem Marketing, insbesondere der Markenführung fällt aufgrund der zunehmenden Homogenisierung von Produkten und Dienstleistungen die Rolle eines wichtigen – wenn nicht gar entscheidenden – Stellhebels zu. – 50 – Ziel weiterer Studien wird es sein, typische Fehler der Markenführung in Osteuropa darzustellen, um somit für zukünftige Entscheidungen aus Erfahrungen anderer Unternehmen zu lernen. Die im Folgenden exemplarisch vorgestellten Fälle gehen auf Beobachtungen der internationalen Werbeagentur GREY zurück, die seit 1990 in Osteuropa aktiv ist und dort zurzeit etwa 150 Accounts betreut. Welche Faktoren müssen berücksichtigt bzw. beeinflusst werden, um eine Unternehmens-, Produkt- oder Dienstleistungsmarke erfolgreich im Ausland zu managen? Wie in Abbildung 8 dargestellt, muss die Unternehmung externe, kurzfristig nicht beeinflussbare Faktoren aufdecken und beachten. Hierbei handelt es sich einerseits um konsumentenbezogene Faktoren, wie bspw. soziodemographische, psychographische oder kulturelle Merkmale potenzieller Kunden. Andererseits sind das Wettbewerbsumfeld im Sinne der Five Forces Porters sowie die politischen, sozialen, rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu ermitteln und daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Interne Faktoren können hingegen von der Unternehmung auch kurzfristig beeinflusst werden. Organisationsbezogene Faktoren umfassen bspw. die Wahl der Koordinationsform der Auslandsaktivität, Führungs- und Controllingfragen oder die internationale Personalpolitik. Marketing-Mix bezogene Faktoren umfassen schließlich produkt- preis-, distributions- und kommunikationspolitische Entscheidungen der Unternehmung. Konsumentenbezogene Faktoren Umweltbezogene Faktoren Organisationsbezogene Faktoren Markenerfolg Externe Faktoren Marketing-Mixbezogene Faktoren Interne Faktoren Abbildung 8: Einflussfaktoren des Markenerfolgs (Quelle: In Anlehnung an Kaplan/Norton 1996, S. 76) – 51 – Analog zur vorgestellten Einteilung der Einflussfaktoren des Markenerfolgs werden im Folgenden typische Fehlerquellen, Versäumnisse und Irrtümer vorgestellt, die GREY seit 1990 bei den in Osteuropa betreuten Unternehmen beobachten konnte. Konsumentenbezogene Faktoren Ein zentraler externer Faktor, den es für eine gewünschte Erhöhung des Markenerfolgs zu berücksichtigen gilt, ist der Kunde bzw. Konsument. Um in Osteuropa erfolgreich zu sein, gilt es neben den üblichen psychographischen und soziodemographischen Kriterien vor allem kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. So konnte GREY regelmäßig beobachten, dass Konsumentenerwartungen nicht berücksichtigt werden bzw. die im Heimatland entwickelten Konzepte mit einem zu hohen Standardisierungsgrad übertragen werden. Fehlende Marktanalysen haben dann oft Flops zur Folge. So scheiterte ein großes deutsches Verlagshaus in Polen bei der Einführung mehrerer Magazine, die im Kern mit Inhalten aus Deutschland bestückt wurden. Ursächlich für das Scheitern war die Tatsache, dass die Inhalte nicht konform mit den Konsumenteneinstellungen waren. Eine Analyse der IQS and Quant Group ergab, dass polnische Konsumenten zwar einerseits sehr interessiert an der westlichen Lebensart sind, aber andererseits durch die Wertunterschiede zwischen den Kulturen tief verunsichert sind. Gerade traditionsbewusste Kundensegmente werden von einer durch westliche Werte geprägten Kommunikation eher abgeschreckt als angezogen. Als weitere Herausforderung konnte GREY feststellen, dass die Kundenloyalität gegenüber Marken in Osteuropa sehr schlecht ist. Kunden lassen sich durch Promotions leichter zum Kauf anderer Marken überzeugen, als dies bspw. in Deutschland der Fall ist. Eine Hauptursache hierfür kann darin gesehen werden, dass viele Markenprodukte im Bewusstsein der (potenziellen) Kunden noch neu sind und daher die Loyalitäts- und Vertrauensfunktion einer Marke nicht in dem Maße zum tragen kommt, wie dies in Westeuropa bei jahrzehntelang erfolgreichen Marken der Fall ist. Schließlich traf eine große deutsche Bank bei ihrer Expansion nach Osteuropa auf Ressentiments, die sich wiederum auf mangelhaftes Wissen über Kundeneinstellungen bzw. fehlenden Willen zur lokalen Anpassung zurückführen lassen und in diesem Fall eng mit kulturellen Differenzen – aufgrund der gemeinsamen Geschichte – zusammenhängen. Die Vorteile einer international standardisierten Strategie können also in Märkten mit stark abweichenden Kundenanforderungen nicht die Nachteile einer fehlenden lokalen Anpassung ausgleichen. – 52 – Es ist daher im Rahmen einer erfolgreichen Internationalisierung einer Unternehmensleistung von zentraler Bedeutung, Konsumentenerwartungen und - einstellungen über die einzuführende Leistung und das Unternehmen zu erheben. Wettbewerbs- und umweltbezogene Faktoren Im Zuge einer Markeneinführung sind darüber hinaus die spezifischen Wettbewerbsbedingungen und sonstigen Rahmenbedingungen der Märkte in Osteuropa zu analysieren. So scheiterte ein deutscher Nahrungsmittelerzeuger mit seinem Engagement in Polen am mangelnden Gefühl für „Land und Leute“. Das Unternehmen investierte zusammen mit einem lokalen Partner in den Aufbau von Strukturen. Nachdem der polnische Kooperationspartner Wissen und Investitionen in Technologie erhalten hatte, beendete dieser die Partnerschaft. Nach dem Scheitern dieser Kooperation versuchte es das Unternehmen erneut auf eigene Faust in Polen und befindet sich momentan im Mittelfeld der Anbieter. Der einstige Kooperationspartner ist hingegen Marktführer. Ein früher Einstieg in den „Emerging Market“ muss also nicht bedeuten, dass der Erfolg vorprogrammiert ist. Denn unzureichende Kenntnisse der politischen Verhältnisse, mangelndes Verständnis der geschäftlichen Rahmenbedingungen, fehlende Analysen des Marktes sowie ein blauäugiges Kooperationsmanagement waren im geschilderten Beispiel des Nahrungsmittelherstellers die Gründe des Scheiterns. Organisationsbezogene Faktoren Doch nicht nur fremde Kunden und unbekannte Umstände und Rahmenbedingungen erschweren es den internationalen Unternehmen, in Osteuropa Fuß zu fassen. Teilweise sind es gerade auch interne – d.h. vom Unternehmen selbst verursachte bzw. beeinflussbare – Faktoren, die den Erfolg der Marken(ein-)führung dezimieren. So entwickelte das Deutschland-Management eines Tabakherstellers mit sehr viel Engagement und Sensibilität trotz internationaler Konkurrenz eine lokale Zigarettenmarke in Polen und machte sie im Jahr 2000 zum absoluten Marktführer. Das Markenmanagement produzierte mit dem Produkt eine Punktlandung in Sachen Identifikation. Jedoch setzte die internationale Führung des Unternehmens andere Prioritäten, nämlich auf die Durchschlagskraft ihrer „Global Brands“. Diese wurden durch hohen Werbedruck und damit verbundenes hohes Budget in einen umkämpf- – 53 – ten Markt gedrückt und entwickelten sich nur langsam. Das Unterschätzen der Entwicklungsmöglichkeiten der nationalen Marke führte nun aufgrund fehlender Budgets und Aktivitäten zum Verlust von Marktanteilen. Schließlich wirken sich Organisationsprobleme von Unternehmen noch drastischer aus, wenn diese „internationalisiert“ werden. So führte die Spaltung eines Unternehmens der Snackbranche zu immensen Struktur- und Zuständigkeitsproblemen in der polnischen Gesellschaft und zu Irritationen am Markt aufgrund zum Teil verwirrender Änderungen am Markenzeichen. Ein weiteres Beispiel ist der ursprüngliche Marktführer im Convenience-Food-Markt in Polen, der nach der Übernahme durch einen Wettbewerber mit dem Verlust von Marktanteilen zu kämpfen hatte. Permanente Änderungen in den internen Strukturen, bedingt durch die unterschiedlichen Unternehmensphilosophien und die damit verbundenen Personalwechsel, hemmten die weitere Entwicklung. So verfolgte auch der Unilever Konzern konsequent die Idee durch die Übernahme von Bestfoods und deren global-brands Knorr und Hellmann’s endlich auch im Konzert der global players mitwirken zu können und das Marken-Portfolio international aufzuwerten. Nur waren bzw. sind beide Unternehmen in ihrer Markenführungs-Politik nicht gerade ideale Ergänzungen, sondern durchaus unterschiedlich organisiert und orientiert. Unilever als konservativer Riese in Reinkultur – Bestfoods als flexibler, innovativer und aggressiver Puncher. In Polen wurden allein zwischen 1994 und 1997 vom Bestfoods-Management 13 unterschiedliche Produkt-Kategorien entwickelt und introduziert – von Standard-Suppen über Soßen bis zu Gourmet-Produkten, in Zusammensetzung und Geschmack speziell auf den polnischen Markt ausgerichtet. Sie bilden somit die ideale Plattform zum Aufbau von „international premium brands“ mit hohem Qualitätsanspruch. Eine zusätzliche Problematik entsteht auch im Rahmen personal-politischer Maßnahmen, zum Beispiel in der Zusammenlegung von Marketing-Abteilungen unterschiedlicher Unternehmen – eventuell noch verbunden mit einem Ortswechsel. Diese „Aktionen“ können zusätzlich „mittlere Erdbeben“ verursachen, d.h. den Ver- – 54 – lust von qualifizierten Mitarbeitern entscheidend beeinflussen. In sich rasant entwickelnden Märkten wie Polen führt dies zu einer zusätzlichen Schwächung der Marktposition. Marketing-Mix bezogene Faktoren Die Beeinflussung der Wahrnehmung einer Marke ist neben organisationsbezogenen Maßnahmen der zweite große Stellhebel für Unternehmen. Die einzigartige Positionierung einer Marke im Wettbewerb kann durch die Kombination eines einzigartigen Auftritts (Kommunikation und Produktgestaltung) und durch eine entsprechend angepasste Distributions- und Preispolitik erreicht werden. Wird eine Marke internationalisiert, so ist anzunehmen, dass diese im Heimatmarkt vom Unternehmen selbst als erfolgreich wahrgenommen wird. Unternehmen neigen daher aus gutem Grunde dazu, das Geschäftsmodell, welches sich im Heimatmarkt als erfolgreich dargestellt hat, möglichst standardisiert ins Ausland zu übertragen. Die Möglichkeit der Erzielung von Skaleneffekten durch die „Wiederverwendung“ bzw. mehrfache Anwendung von Marketingmaßnahmen sprechen darüber hinaus für eine Standardisierung. Andererseits erfordern unterschiedliche Sprachen, länderspezifische Gesetze, individuelle ökonomische und politische Bedingungen sowie differierende kulturelle Eigenschaften eine lokale Anpassung des Geschäftsmodells bzw. einzelner Maßnahmen des Marketing-Mix. Die richtige Balance zwischen Standardisierung und Differenzierung zu finden, erfordert vor allem Marktforschungsaufwand vor Ort. In welchem Maße ist der Konsument in Osteuropa bereit, ein standardisiert vermarktetes Produkt aufzunehmen? Wie ist es mit der Einstellung des Kunden bzgl. des Herkunftslandes der angebotenen Leistung bestellt? Erlauben die rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen überhaupt eine standardisierte Vermarktung? Die Tatsache, dass selbst die größten Konsumgüterhersteller der Welt – zudem auch noch die Lieblinge der großen Werbeagenturen – durch die absolut gesetzte Strategie der globalen Standardisierung in einigen Produktbereichen Marktanteile verlieren, verdeutlicht die Notwendigkeit der Berücksichtigung länderspezifischer Aspekte. Dazu die folgende Geschichte: Ein international agierendes blue-ship Unternehmen verliert in Polen – in einem äußerst kompetitiven Marktsegment – zwischen 1997 und – 55 – 2001 über 70% seines Marktanteils. Das neue Management gibt der Agentur eine letzte Chance mit „knallharten“ Zielvorgaben. Ein länderspezifisches und innovatives Kommunikationskonzept – versehen mit einem ausreichenden Budget „retten“ Marke und Agentur. Heute ist die Marke wieder ein Renner im polnischen Markt – mit stabilen Image-Werten. Weltweit identische Verpackungsdesigns und Kommunikationsmaßnahmen können zwar in einem bestimmten Maße zu Kosteneinsparungen führen und werden von den weltweit agierenden Agenturen aus eigenem Interesse heraus gefordert. Der Konsument sieht die beworbene Marke jedoch vielfach als profillose, teure Leistung und greift dann zu anderen Alternativen, da ihr Flexibilität, Präzision und damit Akzeptanz in Aussage und Ansprache fehlen. Neben der Festlegung der richtigen Balance zwischen extremer Standardisierung und lokaler Anpassung erschwert ein zweites Problem den Aufbau starker Marken in Osteuropa: das Phänomen des ungeduldigen Managers. Die sehr langfristig anzulegende Arbeit an der Marke steht nicht im Einklang mit den kurzfristigeren Zielen der Manager (vgl. Ahlert 2004, S. 22). Die Illoyalität der Kunden bzw. Konsumenten in Osteuropa erschwert zusätzlich den Aufbau langfristig erfolgreicher „starker“ Marken. Unternehmens- oder Produktmarken, die in ihren westlichen Heimatmärkten bereits in der Psyche der Konsumenten verankert sind, sehen sich in neuen Märkten aufgrund der dort fehlenden Verankerung enormen Absatzschwankungen ausgesetzt. Die Unternehmen reagieren vielfach panisch und peitschen im Wechselspiel mit den Wettbewerbern Verkaufsförderungsaktionen und wechselnde Imagekampagnen durch den Markt. Die Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass der Markenauftritt häufig inkonsistent ist und das langfristige Ziel des Aufbaus einer starken Marke torpediert wird. Der am kurzfristigen Ergebnis gemessene Manager vernachlässigt diesen Teufelskreis jedoch häufig. Als Fazit der Beobachtungen kann festgestellt werden, dass in Osteuropa viele aus dem Westen importierte Marken in den Köpfen der Konsumenten noch „neu“ sind. Die Marke als kollektives Deutungsmuster wächst jedoch erst langsam im Bewusstsein der Konsumenten. Die Unternehmen dürfen nicht davon ausgehen, dass sie mit den gleichen Maßnahmen, mit denen sie ihre bereits erfolgreichen Marken in ihren Heimatmärkten führen, in Osteuropa erfolgreich sind. Vielmehr sind die geschilderten Managementfehler und der „Teufelskreis der Markenführung“ zu vermeiden. Eine – 56 – langfristige Festigung einer Marke im Bewusstsein der Kunden lässt sich nur durch detaillierte Analysen, daraus zu entwickelndes Know-how und durch einen langen Atem in der Markenpolitik erzielen. – 57 – Fazit Die Frage nach der Relevanz der Internationalisierung für deutsche Unternehmen ist unbestritten. Dennoch weiß bisher weder die Unternehmenspraxis noch die Forschung um die Besonderheiten von Dienstleistungen bei der Internationalisierung, speziell nach Osteuropa oder gar um die Markenführung in Unternehmensnetzwerken. Dementsprechend hat dieser erste Projektbericht auch mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert, zumal es das Ziel dieses ersten Projektberichts ist, einen inhaltlichen und terminologischen Rahmen für das Forschungsprojekt zu schaffen. Erste Antworten auf die diskutierten Fragen werden in künftigen Projektberichten gegeben. – 58 – Literaturverzeichnis AAKER, D.A./JOACHIMSTHALER, E. (2000): Brand Leadership, New York, 2000. AAKER, J.L. (1997): Dimensions of brand personality, in: Journal of Marketing Research (JMR), 34. Jg., 1997, Nr. 3, S. 347-356. AHARONI, Y. (1966): The Foreign Investment Decision Process, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1966. AHLERT, D. (2001): Integriertes Markenmanagement in kundengetriebenen Category Management-Netzwerken, in: Ahlert, D./Oblrich, R./Schröder, H. (Hrsg.): Jahrbuch Handelsmanagement 2001, Frankfurt a.M., 2001, S. 15-60. AHLERT, D. (2004a): Markenmanagement, Marketing und Vertrieb: Schlagkräftiges Triumvirat oder Anachronismus?, in: Ahlert, D. et al. (Hrsg.): Exzellenz in Markenmanagement und Vertrieb, Wiesbaden 2004, S. 197-215. AHLERT, D. (2004b): Warum ein zentrales Brand Controlling unverzichtbar wird, in: Markenverband (Hrsg.): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004, S. 7-28. AHLERT, D. (2005): Marken sind nicht die Schöpfung von Markentechnikern, www.absatzwirtschaft.de, [Zugriff: 18.04.2005]. AHLERT, D./BLAICH, G./EVANSCHITZKY, H. (2003): Systematisierung von Dienstleistungsnetzwerken, in: Bruhn, M./Stauss, B. (Hrsg.): Jahrbuch Dienstleistungsnetzwerke, Dienstleistungsmanagement 2003, Wiesbaden, 2003. AHLERT, D./BLAICH, G./EVANSCHITZKY, H./HESSE, J. (2002): Erfolgsforschung in Dienstleistungsnetzwerken, in: Ahlert, D./Evanschitzky, H./Hesse, J. (Hrsg.): Exzellenz in Dienstleistung und Vertrieb – Konzeptionelle Grundlagen und empirische Ergebnisse, Wiesbaden, 2002, S. 1-28. AHLERT, D. ET AL. (2004): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004. AHLERT, D./EVANSCHITZKY, H. (2003): Dienstleistungsnetzwerke, Management, Erfolgsfaktoren und Benchmarks im internationalen Vergleich, Berlin, Heidelberg, 2003. AHLERT, D./EVANSCHITZKY, H./WOISETSCHLÄGER, D. (2004): Internationalisierung von Franchisesystemen, in: Jahrbuch Vertriebs- und Handelsmanagement 2004, Frankfurt, 2004. – 59 – AHLERT, D./KENNING, P. (1999): Die Betriebstypenmarke als Vertrauensanker bei der Einkaufsstättenwahl der Konsumenten?, in: BBE-Jahrbuch des Handels 1999: Aufbruch durch Innovation, 1999, S. 115-134. AHLERT, D./KENNING, P./SCHNEIDER, D. (2000): Markenmanagement im Handel, Wiesbaden, 2000. AHLERT, D./WOISETSCHLÄGER, D. (2004): Status Quo der Internationalisierung von Franchisesystemen in Deutschland, Studie, Internationales Centrum für Franchising und Cooperation, Münster, 2004. ALBACH, H. (1989): Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, in: ZfB, 59. Jg., 1989, Nr. 4, S. 397-421. ALTER, C./HAGE, J. (1993): Organizations working together, London, 1993. AMA (2004): Marketing Glossary Dictionary, www.marketingpower.com, [Zugriff: 25.11.2004]. ANGEHRN, O. (1969): Handelsmarken und Herstellermarken im Wettbewerb, Stuttgart, 1969. AXELROD, A. (1995): Die Evolution der Kooperation, Studienausgabe, 3. Aufl., München, Wien, 1995. BALABANIS, G./DIAMONOPOULOS, A. (2004): Domestic Country Bias, Country-of Origin Effects, and Consumer Ethnocentrism: A Multidimensional Unfolding Approach, in: Journal of the Academy of Marketing Science, 32. Jg., 2004, Nr. 1, S. 80-95. BAMBERGER, I./EVERS, M. (1997): nationalisierungsentscheidungen Ursachen und mittelständischer Verläufe von Unternehmen, Interin: Macharzina, K./Oesterle, M.-J. (Hrsg.): Handbuch Internationales Management: Grundlagen – Instrumente – Perspektiven, Wiesbaden, 1997, S. 103-137. BAMBERGER, I./WRONA, T. (1997): Globalisierungsbetroffenheit und Anpassungsstrategien von Klein- und Mittelunternehmen, in ZfB, 67. Jg., 1997, Nr. 7, S. 713-735. BARNEY, J.B. (1991): Firm resources and sustained competitive advantage, in: Journal of Management, 17. Jg., 1991, S. 99-120. BARTLETT, C./GHOSHAL, S. (1990): Internationale Unternehmensführung, Frankfurt a.M., 1990. BAUER, R.A. (1967): Consumer Behavior as risk taking, in: Cox, D.F. (Hrsg.): Risk taking and information handlich in consumer behavior, Boston, 1967, S. 23-33. – 60 – BAUER, H.H./MÄDER, R./HUBER, F. (2002): Markenpersönlichkeit als Determinante von Markenloyalität, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 54. Jg., 2002, Nr. 12, S. 687-709. BAUMGARTH, C. (2001): Markenpolitik: Markenwirkungen, Markenführung, Markencontrolling, 2. Aufl., Wiesbaden, 2001. BBE (1999): BBE-Unternehmensberatung: BBE-Spezialreport System-Handel und Systemvertrieb, Köln, 1999, S. 140 ff. BELITZ, H./STILLE, F. (2004): Deutschlands Position im internationalen Austausch technologischer Dienstleistungen: Kaum Anlass zur Besorgnis, Wochenbericht des DIW Berlin, 22/04, Berlin. BEREKOVEN, L. (1961): Die Werbung für Investitions- und Produktionsgüter, ihre Möglichkeiten und Grenzen, München, 1961. BEREKOVEN, L. (1978): Zum Verständnis und Selbstverständnis des Markenwesens, in: Andreae, C.-A. (Hrsg.): Markenartikel heute: Marke, Markt und Marketing, Wiesbaden 1978, S. 35-48. BEREKOVEN, L. (1983): Der Dienstleistungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Göttingen, 1983. BERGELER, G. (1939): Der Markenartikel im Rahmen der industriellen Absatzwirtschaft, in: Bergeler, G./Erhard, L. (Hrsg.): Marktwirtschaft und Wirtschaftswissenschaft, Berlin, 1939, S. 233-248. BHARADWAY S.G./VARADARAJAN P.R./FAHY J. (1993): Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Propositions, Journal of Marketing, 57. Jg., 1993, Nr. 10, S. 83-99. BIEBERSTEIN, I. (2001): Dienstleistungsmarketing, 3. Aufl., Kiel, 2001. BIEGER, T. (2001): Dienstleistungs-Management, 2. Aufl., Bern, Stuttgart, Wien, 2001. BLEICHER, K. (2002): Zwischen Vision und Realität: Die virtuelle Unternehmung als Motor der Internationalisierung, in: Krystek, U./Zur, E. (Hrsg.): Handbuch Internationalisierung. Globalisierung – eine Herausforderung für die Unternehmensführung, 2. Aufl., Berlin, 2002, S. 859-873. BORCHERT, S./MARKMANN, F./STEFFEN, M./VOGEL, S. (1999): Netzwerkaspekte – Konzepte, Typologie und Managementansätze, Arbeitspapier Nr. 21 des Lehrstuhls für Distribution & Handel, Münster, 1999. BRAITMAYER, O. (1998): Die Lizenzierung von Marken: Eine entscheidungs- und transaktionskostentheoretische Analyse, Frankfurt a.M., 1998. – 61 – BRANDMEYER, K.H. (2001): Jahrbuch Markentechnik 2002/2003 – Markenwelt, Markentechnik, Markentheorie, Forschungsbericht, Horizonte, 2001. BRANDMEYER, K./DEICHSEL, A.H. (1999): Jahrbuch Markentechnik 2000/2001 – Markenwelt, Markentechnik, Markentheorie, Forschungsbericht, Horizonte, 1999. BRENNER, H. (1989): Exporttechniken, in: Macharzina, K./Welge, M.K. (Hrsg.): Handwörterbuch Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart, 1989, Sp. 577-592. BRUHN, M. (1994): Begriffsabgrenzungen und Erscheinungsformen von Marken, in: Bruhn, M. (Hrsg.): Handbuch Markenartikel, Bd. 1, Stuttgart, 1994, S. 4-41. BRUHN, M. (2001): Bedeutung der Handelsmarke im Markenwettbewerb – eine Einführung, in: Bruhn, M. (Hrsg.): Handelsmarken. Zukunftsperspektiven der Handelsmarkenpolitik, 3. Aufl., Stuttgart, 2001, S. 3-48. BRUHN, M. (2003): Markenpolitik: ein Überblick zum State of the Art, in: DBW, 63. Jg., 2003, Nr. 2, S. 179-202. BRUHN, M. (2004): Was ist eine Marke? Aktualisierung der Markendefinition, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung, 50. Jg., 2004, Nr. 1, S. 4-30. BULLINGER, H.J. (2004): Erfolg mit innovativen Dienstleistungen, in: Kreibich, R./ Oertel, B. (Hrsg.): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit, Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 1323. BURMANN, C./BLINDA, L./NITSCHKE, A. (2003): Konzeptuelle Grundlagen des identitätsbasierten Markenmanagements, Arbeitspapiere Nr. 1, Universität Bremen, Bremen, 2003. BURMANN, C./NITSCHKE, A. (2006): Profilierung von Marken durch Sponsoring und Ambushing, in: Ahlert, D./Woisetschläger, D./Vogel, V. (Hrsg.): Exzellentes Sponsoring – Innovative Ansätze und Best Practices für das Markenmanagement, Wiesbaden, 2006, S. 155-179. CAVUSGIL, S.T. (1980): On the internationalisation process of firms, in: European Research, 8. Jg., 1980, Nr. 6, S. 273-281. CICIC, M./PATTERSON, P.G./SHOHAM, A. (1999): A Conceptual Model of the Internationalization of Services Firms, in: Journal of Global Marketing, 12. Jg., 1999, Nr. 3, S. 81-107. CLARK, C. (1957): The Conditions of Economic Progress, London, 1957. – 62 – COASE, R.H. (1937): The nature of the firm, in: Economia, 4. Jg., 1937, S. 396-405. CONTOR (2004): Standorte typisierter Unternehmen in Europa, Hünxe, 2004. CORSTEN, H. (1990): Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungsunternehmungen, 2. Aufl., München, Wien, 1990. CORSTEN, H. (2001): Dienstleistungsmanagement, 4. Aufl., München, Wien, 2001. CREUSEN, U./SALFELD, A. (2001): Balanced Scorecard als Instrument zum Aufbau von lernen Netzwetzwerken – dargestellt anhand des Franchisesystems OBI, in: Ahlert, D. (Hrsg.): Handbuch Franchising & Cooperation – Das Management kooperativer Unternehmensnetzwerke, Neuwied, Kriftel, 2001, S. 237-258. CZINKOTA, M.R./RONKAINEN, I.A. (1998): International Maketing, 5. Aufl., SouthWestern College Pub, 1998. DE CHERNATONY, L./RILEY, F.D.O. (1998): Defining A 'Brand': Beyond The Literature With Experts' Interpretations, in: Journal of Marketing Management, 14. Jg., 1998, Nr. 4/5, S. 417-443. DECKER, F. (1975): Einführung in die Dienstleistungsökonomie, Paderborn, 1975. DE MOOIJ, M. (2003): Convergence and Divergence in Consumer Behavior: Implications for global Advertising, in: International Journal of Advertising, 22. Jg., 2003, Nr. 2, S. 183-202. DICHTL, E. (1978): Grundidee, Entwicklungsepochen und heutige wirtschaftliche Bedeutung des Markenartikels, in: Andreae, C.-A. (Hrsg.): Markenartikel heute: Marke, Markt und Marketing, Wiesbaden, 1978, S. 17-34. DOLSKI, J./HERMANNS, A. (2004): Internationalisierungsstrategien von Dienstleistungsunternehmen, in: Gardani, M.A./ Dahlhoff, H.D. (Hrsg): Management internationaler Dienstleistungen: Kontext – Konzepte – Erfahrungen, S. 85-110. DOMIZLAFF, H. (1992): Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens – Ein Lehrbuch der Markentechnik, Neuaufl., Hamburg, 1992. DRESDNER BANK (2004): Investieren in Mittel- und Osteuropa, Frankfurt a.M., 2004. DÜLFER, E. (1982): Internationalisierung der Unternehmung – gradueller oder prinzipieller Wandel?, in: Lück, W./Trommsdorff, V. (Hrsg.): Internationalisierung der Unternehmung als Problem der Betriebswirtschaftslehre, Berlin et al., S. 4772. DUNNING, J.H. (1980): Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, in: JIBS, 11. Jg., 1980, Nr. 1, S. 9-31. – 63 – DUNNING, J.H. (1989): Multinational Enterprises and the Growth of Services: Some Conceptual and Theoretical Issues, in: The Service Industries Journal, 9. Jg., 1989, S. 5-39. EHRENFELD, H. (2004): Dienstleistungsexport – Unternehmen und Wirtschaftspolitik sind gefordert, in: Kreibich, R./Oertel, B. (Hrsg): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit, Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 75-83. EKELEDO, I./SIVAKUMAR, K. (1998): Foreign Market Entry Mode Choice of Service Firms: A Contingency Perspective, in: Journal of the Academy of Marketing Science, 26. Jg., 1998, Nr. 4, S. 274-292. ENGEL, A. (2001): Ausgewählte Kennzahlen der Balanced Scorecard, in: Kostenrechnungspraxis, 45. Jg., 2001, H. 3, S. 54-59. ESCH, F.-R. (2004): Strategie und Technik der Markenführung, 2. Aufl., München, 2004. ESCH, F.-R./WICKE, A. (2001): Herausforderungen und Aufgabe des Markenmanagements, in: Esch, F.-R. (Hrsg.): Moderne Markenführung: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 3. Aufl., Wiesbaden, 2001, S. 355. EVANSCHITZKY, H. (2003): Erfolg von Dienstleistungsnetzwerken – Ein Netzwerkmarketingansatz, Wiesbaden, 2003. FISCHER, M./MEFFERT, H./PERREY, J. (2004): Markenpolitik: Ist sie für jedes Unternehmen gleichermaßen relevant? Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung von Marken in Konsumgütermärkten, in: Die Betriebswirtschaft, 64. Jg., 2004, Nr. 3, S. 333-356. FRANZEN, O./TROMMSDORFF, V./RIEDEL, F. (1994): Ansätze der Markenbewertung und Markenbilanz, in: Markenartikel, 56. Jg., 1994, Nr. 8, S. 372-387. GANKEMA, H./SNUIF, H.R./ZWART, P.S. (2000): The Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: An Evaluation of Stage Theory, in: JSBM, 38. Jg., 2000, Nr. 4, S. 15-27. GAROLERA, J. (2000): Peacefulness and passion: the meaning of brand personalities across cultural boundaries, in: Global Branding, Conference Summary, June 20.-21., Hotel Palace, Milan, Italy, MSI Working Paper Series, 2000, S. 21-23. – 64 – GARZ, H./GILLES, M. (2004): Germany goes East – Die Chancen der Globalisierung nutzen, Research-Publikation zur WestLB‚ Deutschland Conference 2004, Düsseldorf, 2004. GERHARDT, J. (1987): Dienstleistungsproduktion: eine produktionstheoretische Analyse der Dienstleistungsprozesse, Bergisch-Gladbach, Köln, 1987. GERPOTT, T.J. (1993): Integrationsgestaltung und Erfolg von Unternehmensakquisistionen, Stuttgart, 1993. GERUM, E. (2000): Internationalisierung mittelständischer Unternehmen durch Netzwerke, in: Gutmann, J./Kabst, R. (Hrsg.): Internationalisierung im Mittelstand, Chancen – Risiken – Erfolgsfaktoren, Wiesbaden, 2000, S. 273285. GLAUM, M. (1996): Internationalisierung und Unternehmenserfolg, Wiesbaden, 1996. GOLDACK, G. (1948): Der Markenartikel für Nahrungsmittel, Nürnberg, 1948. GROSSEKETTLER, H. (1981): Die volkswirtschaftliche Problematik von Vertriebskooperationen – zur wettbewerbspolitischen Beurteilung von Vertriebsbindungs-, Alleinvertriebs-, Vertragshändler- und Franchisesystemen, in: Ahlert, D. (Hrsg.): Vertragliche Vertriebssysteme zwischen Industrie und Handel, Wiesbaden, S. 255-314. GUTJAHR, G. (2004): Warum der Zugriff auf das Markenkapital einen neuen Forschungsansatz fordert, in: Markenverband (Hrsg.): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004, S. 51-60. HAEDRICH, G./TOMCZAK, T. (1994): Strategische Markenführung, in: Bruhn, M. (Hrsg.): Handbuch Markenartikel, Bd. 2, Stuttgart, 1994, S. 925-948. HÄTTY, H. (1989): Der Markentransfer, Heidelberg, 1989. HALLER, S. (2002): Dienstleistungsmanagement: Grundlagen, Konzepte, Instrumente, 2. Aufl., Wiesbaden, 2002. HANSEN, P. (1970): Der Markenartikel: Analyse seiner Entwicklung und Stellung im Rahmen des Markenwesens, Berlin, 1970. HARTMANN, V. (1966): Markentechnik in der Konsumgüterindustrie, Freiburg i.B., 1966. HENGSBACH, F. (2004): Der Glanz der Transzendenz in einer nicht sortierten Welt, in: Markenverband (Hrsg.): Ertragsreserven aus Markenkapital, Wiesbaden, 2004, S. 37-43. – 65 – HICKSON, D.J./ASTLEY, W.G./BUTLER, R.J./WILSON, D.C. (1981): Organization as power, in: Cummings, L.L./Staw, B.M. (Hrsg.): Research in Organizational Behavior, 3. Bd., 1981, S. 151-196. HIERONIMUS, F. (2003): Persönlichkeitsorientiertes Markenmanagement: eine empirische Untersuchung zur Messung, Wahrnehmung und Wirkung der Markenpersönlichkeit, Frankfurt a.M., 2003. HILKE, W. (1989): Grundprobleme und Entwicklungstendenzen des DienstleistungsMarketing, in: Hilke, W. (Hrsg.): Dienstleistungs-Marketing, Wiesbaden, 1989, S. 5-44. HÜBNER, C.C. (1996): Internationalisierung von Dienstleistungsangeboten – Probleme und Lösungsansätze, München, 1996. JARILLO, J.C. (1988): On strategic networks, in: Strategic Management Journal, 9. Jg., 1988, S. 31-41. JÖRISSEN, H.J. (2004): Internationale Kooperationsanbahnung für Technologiedienstleister, in: Kreibich, R./Oertel, B. (Hrsg): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit, Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 95-103. JOHANSON, J./VAHLNE, J.-E. (1977): The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and increasing Foreign Market Commitments, in: JIBS, 8. Jg., 1977, Nr.1, S. 23-32. JOHN, E.-M. (2004): Zur Globalisierung des Dienstleistungssektors: Entwicklungsperspektiven für Deutschland, in: Gardini, M.A./Dahlhoff, H.D. (Hrsg): Management internationaler Dienstleistungen: Kontext – Konzepte – Erfahrungen, 2004, S. 65-81. JOHNSON, S.D. (1998): Application of the Balanced Scorecard Approach, in: Corporate Environmental Strategy, 5. Jg., 1998, Nr. 4, S. 34-41. KAPFERER, J.-N. (2001): Les marques: capital de l'entreprise: créer et développer des marques fortes, 3ème éd., Paris, 2001. KAPLAN, R.S./NORTON, D.P. (1996): Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, in: Harvard Business Review, 74. Jg., 1996, Nr. 1, S. 7585. KAPLAN, R.S./NORTON, D.P. (1997): Balanced Scorecard – Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart, 1997. – 66 – KEBSCHULL, D. (1989): Internationalisierungsmotive, in: Macharzina, K./Welge, M. (Hrsg.): Handwörterbuch Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart, 1989, Sp. 973-982. KELLER, K.L. (1993): Conceptualizing, Measuring, Managing Customer-Based Brand Equity, in: Journal of Marketing, 57. Jg., 1993, Nr. 1, S. 1-21. KELLER, K.L. (2003): Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, 2. Aufl., Upper Saddle River, 2003. KELZ, A. (1989): Die Weltmarke, Idstein, 1989. KEMPER, A.C. (2000): Strategische Markenpolitik im Investitionsgüterbereich, Lohmar, 2000. KENNING, P. (2002): Customer Trust Management. Ein Beitrag zum Vertrauensmanagement im Lebensmitteleinzelhandel, Wiesbaden, 2002. KENNING, P./AHLERT, D. (2004): Marke und Hirnforschung: Status quo, in: Marketing Journal, Nr. 7/8, 2004, S. 44-46. KENNING, P. (2004): Neue Ansätze in der Marketingforschung: Notwendigkeit und erste Ergebnisse für das Marken- und Vertriebsmanagement, in: Ahlert, D. et al. (Hrsg.): Exzellenz in Markenmanagement und Vertrieb, Wiesbaden, 2004, S. 63-71. KENNING, P./DEPPE, M./SCHWINDT, W./KUGEL, H./PLASSMANN, H. (2005): Wie eine starke Marke wirkt, in: Harvard Business Manager, Nr. 3, 2005, S. 53-57. KNORR, A./ARNDT, A. (2003): Wal-Mart in Deutschland – eine verfehlte Internationaliierungsstrategie, in: Knorr, A./Lemper, A./Sell, A./Wohlmuth, K. (Hrsg.): Materialien des Wissenschaftsschwerpunkts „Globalisierung der Weltwirtschaft“, Bd. 25, Bremen, 2003. KLEIN, S. (1996): Interorganisationssysteme und Unternehmensnetzwerke, Wechselwirkungen zwischen organisatorischer und informationstechnischer Entwicklung, Wiesbaden, 1996. KLOYER, M. (1995): Management von Franchisesystemen – Eine RessourceDependence-Perspektive, Wiesbaden, 1995. KLUGE, F. (2002): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 2002. KÖHLER, L. (1991): Die Internationalisierung produzentenorientierter Dienstleistungsunternehmen, Hamburg, 1991. KOERS, M. (2001): Steuerung von Markenportfolios: ein Beitrag zum Mehrmarkencontrolling am Beispiel der Automobilwirtschaft, Frankfurt a.M., 2001. – 67 – KREIBICH, R./OERTEL, B. (2004): Vorwort zum Berichtsband der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, in: Kreibich, R./ Oertel, B. (Hrsg): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit, Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 1-5. KROEBER-RIEL, W./WEINBERG, P. (2003): Konsumentenverhalten, 8. Aufl., München, 2003. KUMAR, B. (1989): Formen der internationalen Unternehmenstätigkeit, in: Macharzina, K./Welge, M.K. (Hrsg.): Handwörterbuch Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart, 1989, Sp. 915-926. KUTSCHER, M. (1992): Die Wahl der Eigentumsstrategie der Auslandsniederlassung in kleineren und mittleren Unternehmen, in: Kumar, B.N./Haussmann, H. (Hrsg.): Handbuch der Internationalen Unternehmenstätigkeit, München, 1992, S. 497-530. KRYSTEK, U./ZUR, E. (2002): Unternehmenskultur, Strategie und Akquisition, in: Krystek, U./Zur, E. (Hrsg.): Handbuch Internationalisierung. Globalisierung – eine Herausforderung für die Unternehmensführung, 2. Aufl., Berlin, 2002, S. 777-792. LEITHERER, E. (1988): Die Entwicklung des Markenwesens: von den Ursprüngen bis zum Beginn der fünfziger Jahre (Wiederabdruck der Dissertation von 1954), München, Wiesbaden, 1988. LEITHERER, E. (1994): Geschichte der Markierung und des Markenwesens, in: Bruhn, M. (Hrsg.): Handbuch Markenartikel, Stuttgart, 1994, S. 135-152. LICHTBLAU, K. (2000): Internationalisierung der Dienstleistungen – Ein grafisches Portrait, in: MANGOLD, K. (Hrsg.): Dienstleistungen im Zeitalter Globaler Märkte – Strategien für eine vernetzte Welt, Frankfurt, Wiesbaden, 2000. LINNEMANN, C. (2004): Liberalisierung des internationalen Handels mit Transportdienstleistungen, in: Kreibich, R./Oertel, B. (Hrsg.): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit, Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 65-72. LINXWEILER, R. (1999): Marken-Design. Marken entwickeln, Markenstrategien erfolgreich umsetzen, Wiesbaden, 1999. LORENZONI, G./GRANDI, A./BOARI, C. (1989): Network organizations: Three basic concepts, unveröff. Arbeitspapier der Universität Bologna, Bologna, 1989. – 68 – LUCE, R.D./RAIFFA, H. (1957): Games and decisions: Introduction and critical survey, New York, 1957. LUOSTARINEN, R. (1970): Internationalization of the Firm, The Helsinki School of Economics, Helsinki, 1970. MACHARZINA, K./ENGELHARD, J. (1984): Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit, Arbeitspapier Nr. 16, Institut für BWL, Univ. Hohenheim, Stuttgart, 1984. MACHARZINA, K./WELGE, M.K. (1989): Handwörterbuch Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart, 1989. MALERI, R. (1997): Grundlagen der Dienstleistungsproduktion, 4. Aufl., Berlin u.a., 1997. MANGOLD, K. (1999): Globalisierung durch innovative Dienstleistungen, in: Bullinger, H.-J. (Hrsg.): Dienstleistungen – Innovation für Wachstum und Beschäftigung: Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs, Wiesbaden, 1999, S. 1225. MARKENVERBAND (2004): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004. MARKOWITSCH, H.J. (2004): Zur Physiologie der Marke: Die Verankerung der Marke in Gehirn und Geist, in: Markenverband (Hrsg.): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004, S. 45-60. MATT, D.V. (1988): Markenpolitik in der schweizerischen Markenartikelindustrie, Bern, Stuttgart, 1988. MEFFERT, H. (2000): Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung: Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele, 9. Aufl., Wiesbaden, 2000. MEFFERT, H. (2002): Strategische Optionen der Markenführung, in: Meffert, H./Burmann, C./Koers, M. (Hrsg.): Markenmanagement – Grundfragen der identitätsorientierten Markenführung, Wiesbaden, 2002, S. 135-165. MEFFERT, H./BOLZ, J. (1998): Internationales Marketing-Management, 3. Aufl., Stuttgart, 1998. MEFFERT, H./BRUHN, M. (2002): Wettbewerbsüberlegenheit durch exzellentes Dienstleistungsmarketing, in: Bruhn, M./Meffert, H. (Hrsg.): Exzellenz im Dienstleistungsmarketing – Fallstudien zur Kundenorientierung, Wiesbaden, 2002, S. 1-26. – 69 – MEFFERT, H./BRUHN, M. (2003): Dienstleistungsmarketing: Grundlagen – Konzepte – Methoden, 4. Aufl., Wiesbaden, 2003. MEFFERT, H./BURMANN, C. (1996): Identitätsorientierte Markenführung – Grundlagen für das Management von Markenportfolios, Arbeitspapier Nr. 100 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung, Münster, 1996. MEFFERT, H./BURMANN, C. (2002): Wandel in der Markenführung: vom instrumentellen zum identitätsorientierten Markenverständnis, in: Meffert, H./Burmann, C./Koers, M. (Hrsg.): Markenmanagement: Grundfragen der identitätsorientierten Markenführung, Wiesbaden, 2002, S. 17-33. MEFFERT, H./BURMANN, C./KOERS, M. (2002): Stellenwert und Gegenstand des Markenmanagement, in: Meffert, H./Burmann, C./Koers, M. (Hrsg.): Markenmanagement: Grundfragen der identitätsorientierten Markenführung, Wiesbaden, 2002, S. 3-15. MEFFERT, H./WOLTER, F. (2000): Internationalisierungskonzepte im Dienstleistungsbereich – Bestandsaufnahme und Perspektiven, Arbeitspapier 136 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung, Münster, 2000. MELLEROWICZ, K. (1963): Markenartikel: die ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung und Preisbindung, 2. Aufl., München, 1963. MEISNER, H.G./GERBER, S. (1980): Die Auslandsinvestition als Entscheidungsproblem, in: BFuP, 32. Jg., 1980, Nr. 3, S. 217-228. MENDE, M./STIER, S. (2002): Den Vertrieb steuern mit der Balanced Scorecard, in: Harvard Business Manager, 24. Jg., 2002, H. 2, S. 96-107. MERTEN, K. (2004): Aus psychosozialen Befunden sind kontrollierbare Strukturmerkmale zu bestimmen, in: Markenverband (Hrsg.): Ertragsreserven aus Markenkapital, 2. Aufl., Wiesbaden, 2004, S. 61-70. MEYER, A. (1994): Dienstleistungsmarketing – Erkenntnisse und praktische Beispiele, 6. Aufl., Augsburg, 1994. MEYER, M. (1994): Ökonomische Organisation der Industrie: Netzwerkarrangements zwischen Markt und Unternehmung, Münster, 1994. MEYER, A./TOSTMANN, T. (1995): Die nur erlebbare Markenpersönlichkeit, in: Harvard Business Manager, 17. Jg., 1995, Nr. 4, S. 9-15. – 70 – MILES, R.E./SNOW, C.C./COLEMAN, H. (1992): Managing the 21st century network organizations, in: Organizational Dynamics, 20. Jg., 1992, S. 5-20. MÖßLANG, A.M. (1995): Internationalisierung von Dienstleistungsunternehmen: Empirische Relevanz – Systematisierung – Gestaltung, Wiesbaden, 1995. MORSCHETT, D. (2002): Retail Branding und Integriertes Handelsmarketing – Eine verhaltenswissenschaftliche und wettbewerbsstrategische Analyse, Wiesbaden, 2002. MUELLER, R.K. (1988): Betriebliche Netzwerke: kontra Hierarchie und Bürokratie, Freiburg, 1988. MÜLLER, A. (2000): Strategisches Management mit der Balanced Scorecard, Stuttgart, 2000. OBRIG, K. (1992): Strategische Unternehmensführung und polyzentrische Strukturen, Dissertation, München, 1992. OST- UND MITTELEUROPA VEREIN E.V. (2004a): Informationsbroschüre Polen, Hamburg, 2004. OST- UND MITTELEUROPA VEREIN E.V (2004b): Informationsbroschüre Tschechien, Hamburg, 2004. O.V. (2003): Handwerkszeug für Marken-Lenker, in: Absatzwirtschaft, Sonderausgabe Marken, 2003, S. 116-118. O.V. (2004a): Media Markt und Saturn erhalten den Mapic Award für die Qualität ihrer internationalen Expansion, www.presseportal.de, [Zugriff: 19.04.2006]. O.V. (2004b): Roland Berger fährt Amerika-Geschäft zurück, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.08.2004, Nr. 201, Seite 18. O.V. (2004c): Bundesministerium Entwicklung: für Entwicklungsländer wirtschaftliche in einer Zusammenarbeit und dienstleistungsorientierten Weltwirtschaft: Handelsoptionale und entwicklungspolitische Implikationen, www.bmz.de, [Zugriff: 05.01.2005]. PERLITZ, M. (1997): Spektrum kooperativer Internationalisierungsformen, in: Macharzina, K./Oesterle, M.-J. (Hrsg.): Handbuch Internationales Management: Grundlagen – Instrumente –Perspektiven, Wiesbaden, 1997, S. 103-137. PERLMUTTER, H.V. (1969): The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, in: Columbia Journal of World Business, 4. Jg., 1969, S. 9-18. PLEITNER, H.J. (1995): Internationalisierung von Klein- und Mittelunternehmen – Formen, Ausmass und Erfolgsfaktoren am Beispiel schweizerischer Firmen, in: – 71 – Mugler, J./Schmidt, K.-H. (Hrsg.): Klein- und Mittelunternehmen in einer dynamischen Wirtschaft, Ausgewählte Schriften von Hans Jobst Pleitner, Berlin, 1995, S. 311-332. PFEFFER, J. (1987): A resource dependence perspective on intercorporate relations, in: Mizruchi, M.S./Schwartz, M. (Hrsg.): Intercorporate relations, Cambridge, 1987, S. 25-55. PFEFFER, J./SALANCIK, G.R. (1978): The external control of organizations – a resource dependence perspective, New York, 1978. PICOT, A. (1982): Transaktionskostenansatz in der Organisationstheorie: Stand der Diskussion und Aussagewert, in: Die Betriebswirtschaft, 42. Jg., 1982, S. 267284. PICOT, A./REICHWALD, R./WIGAND, R. (2001): Die grenzenlose Unternehmung, Information, Organisation und Management, 4. Aufl., Wiesbaden, 2001. PORTER, M.E. (1989): Der Wettbewerb auf globalen Märkten: Ein Rahmenkonzept, in: Porter, M.E. (Hrsg.): Globaler Wettbewerb – Strategien der neuen Internationalisierung, Wiesbaden, 1989, S. 17-68. POWELL, W.W. (1990): Neither markets nor hierarchy: Network forms of organization, in: Staw, B.M./Cummings, L.L. (Hrsg.): Research in Organizational Behavior, Greenwich, 1990, S. 295-336. REICHWALD, R. (2004): 2. Nachwuchswettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Export von Dienstleistungen“, in: Kreibich, R./Oertel, B. (Hrsg): Erfolg mit Dienstleistungen – Innovationen, Märkte, Kunden, Arbeit. Beiträge der 5. Dienstleistungstagung des BMBF, Stuttgart, 2004, S. 35-37. ROSADA, M. (1990): Kundendienststrategien im Automobilsektor: theoretische Fundierung und Umsetzung eines Konzeptes zur differenzierten Vermarktung von Sekundärdienstleistungen, Berlin, 1990. RÜCK, H.R.G. (1995): Dienstleistungen – ein Definitionsansatz auf Grundlage des „Make or buy“ – Prinzips, in: Kleinaltenkamp, M. (Hrsg): Dienstleistungsmarketing – Konzeptionen und Anwendungen, Wiesbaden, 1995. SATTLER, H. (2001): Markenpolitik, Stuttgart, 2001. SCHÄFER, E. (1950): Die Aufgaben der Absatzwirtschaft, 2. Aufl., Köln, 1950. SCHÄFER, E. (1959): Aufgaben und Ansatzpunkte der Markenforschung, in: Markenartikel, Nr. 5, 1959, S. 403-412. SCHENK, H.-O. (1970): Die leidige Markenwaren-Terminologie, Berlin, 1970. – 72 – SCHEUCH, F. (2002): Dienstleistungsmarketing, 2. Auflage, München, 2002. SCHMITT, B.H./SIMONSON, A./MARCUS, J. (1995): Managing Corporate Image and Identity, in: Long Range Planning, 28. Jg., 1995, Nr. 5, S. 82-92. SCHNEIDER, H. (2002): Markenführung in der Politik, in: Meffert, H./Burmann,C./Koers, M. (Hrsg.): Markenmanagement. Grundlagen der identitätsorientierten Markenführung, Wiesbaden, 2002, S. 353-373. SCHÜLLER, A. (1967): Dienstleistungsmärkte in der Bundesrepublik Deutschland – Sichere Domänen selbständiger mittelständischer Unternehmen?, Köln, Opladen, 1967. SCHULTZ, S./WEISE, C. (2000): Deutschlands Position im globalen Dienstleistungswettbewerb, in: Bullinger, H.J./Stille, F. (Hrsg.): Dienstleistungsheadquarter Deutschland – Entwicklungstrends und Erfahrungsberichte, Wiesbaden, 2000, S. 23 – 48. SCHWARZ, P. (1985): Nonprofit-Organisationen – Problemfelder und Ansätze einer Allgemeinen BWL von nicht-erwerbswirtschaftlichen (Nonprofit) Organisationen, in: Die Unternehmung, 39. Jg., 1985, S. 90-111. SIMON, H.A. (1959): Administrative behavior: A study of decision-making processes in Administrative Organization, 2. Aufl., New York, 1959. SMITH, V. L. (2002): Constructivist and ecological rationality in economics, Nobel Prize Lecture, Stockholm, 2002. STATISTISCHES BUNDESAMT (2005a): Länderprofil Tschechien, www.destatis.de, [Zugriff: 02.04.2006]. STATISTISCHES BUNDESAMT (2005b): Länderprofil Polen, www.destatis.de, [Zugriff: 02.04.2006]. STAUSS, B. (1998): Dienstleistungen als Markenartikel: etwas Besonderes?, in: Tomczak, T./Schögel, M./Ludwig, E. (Hrsg.): Markenmanagement bei Dienstleistungen, St. Gallen, 1998, S. 10-23. STILLE, F. (1999): Exportschlager Dienstleistungen, in: Bullinger, H.-J. (Hrsg.): Dienstleistungen – Innovation für Wachstum und Beschäftigung, Wiesbaden, 1999, S. 69-71. STILLE, F. (2000): Entwicklungslinien einer wettbewerbsstarken Dienstleistungswirtschaft, in: Bullinger, H.J./Stille, F. (Hrsg.): Dienstleistungsheadquarter Deutschland – Entwicklungstrends und Erfahrungsberichte, Wiesbaden, 2000, S. 1-22. – 73 – SRIVASTAVA, R.K./SHOCKER, A. D. (1991): Brand Equity: A Perspective on Its Meaning and Measurement, Cambridge, 1991. STATISTISCHES BUNDESAMT (2002): Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2002, Wiesbaden, 2002. SWOBODA, B. (2002): Dynamische Prozesse der Internationalisierung: mangementtheoretische und empirische Perspektiven des unternehmerischen Wandels, Wiesbaden, 2002. SYDOW, J. (1992): Strategische Netzwerke, Evolution und Organisation, Wiesbaden, 1992. SYDOW, J. (1999): Management von Netzwerkorganisationen, Wiesbaden, 1999. TEAS, R.K./GRAPENTINE, T.H. (1996): Demystifying brand equity, in: Marketing Research, 8. Jg., 1996, Nr. 2, S. 24-29. TEUBNER, G. (1992): Die vielköpfige Hydra: Netzwerke als kollektive Akteure höherer Ordnung, in: Krohn, W./Küppers, G. (Hrsg.): Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung, 2. Aufl., Frankfurt a.M., 1992, S. 189216. THORELLI, H.B. (1986): Networks: Between markets and hierarchies, in: Strategic Management Journal, 7. Jg., 1986, S. 37-51. THURM, M. (2000): Markenführung: Sondierungen - Methodologische Disposition – Konzeptioneller Grundriß, München, 2000. TROMMSDORFF, V. (1992): Wettbewerbsorientierte Image-Positionierung, in: Markenartikel, 54. Jg., 1992, Nr. 10, S. 458-463. ULLMANN-MARGALIT, E. (1977): The Emergence of Norms, Oxford, 1977. UPSHAW, L. B. (1995): Building brand identity: a strategy for success in a hostile marketplace, New York, 1995. USUNIER, J./WALLISER, B. (1993): Interkulturelles Marketing. Mehr Erfolg im internationalen Geschäft, Wiesbaden, 1993. VOSS, W.D. (1983): Modellgestützte Markenpolitik: Planung und Kontrolle markenpolitischer Entscheidungen auf der Grundlage computergestützter Informationssysteme, Wiesbaden, 1983. VERNON, R. (1966): International Investment and International Trade in Product Cycle, in: QJE, 80. Jg., 1966, Nr. 2, S. 190-207. – 74 – WEBER, S.M. (1999): Netzwerkartige Wertschöpfungssysteme – Informations- und Kommunikationssysteme im Beziehungsgeflecht Hersteller-Handel-Serviceanbieter, Wiesbaden, 1999. WEIS, M./HUBER, F. (2000): Der Wert der Markenpersönlichkeit – Das Phänomen der strategischen Positionierung von Marken, 2000. WELCH, L.S./LUOSTARINEN, R. (1988): Internationalization: Evolution of a Concept, in: JGMM, 14. Jg., 1988, Nr. 2, S. 34-55. WILLIAMSON, O.E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus: Unternehmen, Märkte, Kooperation, Tübingen, 1990. WORATSCHEK, H./PASTOWSKI, S. (2004): Dienstleistungsmanagement und Standortentscheidungen im internationalen Kontext – Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes betriebswirtschaftlicher Verfahren, in: Gardini, M.A./Dahlhoff, H.D. (Hrsg.): Management internationaler Dienstleistungen, Wiesbaden, 2004, S. 215-240. WTO (2005): International Trade Statistics 2005, New York, 2005. ZEITHAML, V.A./ PARASURAMAN, A./ BERRY, L.L (1985): Problems and Strategies in Services Marketing, in: Journal of Marketing, 1985, 49. Jg., 1985, Nr. 2, S. 3346. ZENTES, J./SWOBODA, B. (1997): Grundbegriffe des internationalen Managements, Stuttgart, 1997.