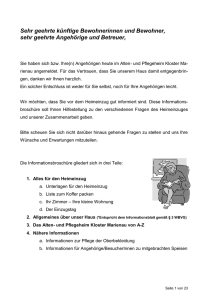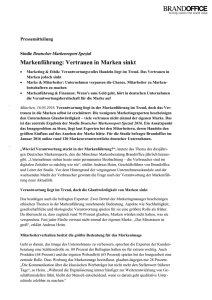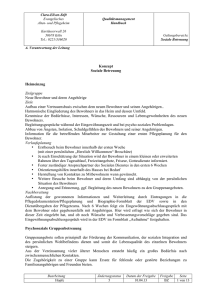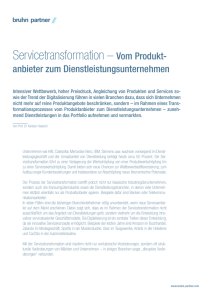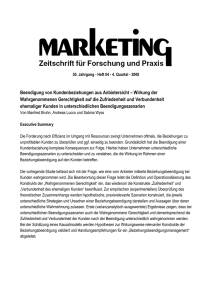Gestaltungsmöglichkeiten und Bedeutung des Marketings in Alten
Werbung

Gestaltungsmöglichkeiten und Bedeutung des Marketings in Alten- und Pflegeheimen Autor Michael Settgast Institut Angefertigt an der Fachhochschule Neubrandenburg Erschienen Abgegeben am: 25.05.1998 Sonstiges Diplomarbeit, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit, Studiengang Pflege und Gesundheit Betreuerin: Professorin Dr. Ilsabe Sachs Inhaltsverzeichnis Abkürzungs- und Symbolverzeichnis Abildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis 1.Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 2.Strukturelle Rahmenbedingungen für Alten- und Pflegeheime 2.1 Definition des Alten- und Pflegeheimes 2.1.1 Gesetzliche Definition 2.1.2 Betriebswirtschaftliche Klassifikation 2.2 Situation vor Inkrafttreten der Pflegeversicherung 2.3 Grundsätze der Pflegeversicherung 2.4 Aktuelle Situation 2.5 Charakteristika des Pflegemarktes 3.Grundlagen des Marketings in Alten- und Pflegeheimen 3.1 Begrifflichkeit 3.2 Besonderheiten von Dienstleistungen 3.3 Elemente des Marketingkonzeptes7 3.3.1 Strategisches Marketing 3.3.2 Operatives Marketing 3.3.3 Marketingkontrolle 3.4 Qualitätsmanagement 3.4.1 Qualitätsbegriff 3.4.2 Dimensionen der Dienstleistungsqualität 3.4.3 Intention des Qualitätsmanagements 3.4.4 Merkmale des Qualitätsmanagements 3.5 Erfolgsrelevante Zielgruppen 4. Mögliche Gestaltung des Marketings in Alten- und Pflegeheimen 4.1 Marketingsituationsanalyse 4.1.1 Unternehmensebene 4.1.2 Ebene des Umfeldes 4.1.3 Methoden der Informationsgewinnung 4.2 Marketingstrategien 4.2.1 Marktfeldstrategien 4.2.2 Präferenzstrategie 4.2.3 Kooperationsstrategie 4.3 Angebotspolitik 4.3.1 Pflegerisch-betreuerisches-Leistungsprogramm 4.3.2 Unterkunfts- und Verpflegungsprogramm 4.3.3 Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogramm 4.3.4 Serviceleistungsprogramm 4.4 Distributionspolitik 4.5 Kontrahierungspolitik 4.6 Kommunikationspolitik 4.6.1 Öffentlichkeitsarbeit 4.6.1.1 Externe Öffentlichkeitsarbeit 4.6.1.2 Interne Öffentlichkeitsarbeit 4.6.2 Pressearbeit 4.6.3 Werbung 4.6.4 Soziosponsoring 4.7Qualitätsmanagement 4.7.1 Qualitätsbeauftragter 4.7.2 Qualitätsmanagementhandbuch 4.7.3 Qualitätszirkel 4.7.4 Vorgehensweise 5.Bestandsaufnahme des Marketings in Alten- und Pflegeheimen 5.1 Untersuchungsgegenstand und -methode 5.1.1 Ziele der Studie 5.1.2 Planung und Durchführung 5.1.3 Der teilstrukturierte Interviewleitfaden 5.1.4 Die befragten Alten- und Pflegeheime 5.2 Ergebnisdarstellung und Diskussion 5.2.1 Rahmenbedingungen 5.2.2 Marketingsituationsanalyse 5.2.3 Marketing-Mix 5.2.4 Marketingstrategien 5.2.5 Qualitätsmanagement 5.2.6 Zusammenarbeit mit den Pflegekassen 6.Fazit und Ausblick Anhang Literaturverzeichnis Eidesstattliche Erklärung Abkürzungs- und Symbolverzeichnis Abb. Abbildung Abs. Absatz Bd. Band BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BSHG Bundessozialhilfegesetz bzw. beziehungsweise d. h. das heißt DIN Deutsche Industrie Norm DVöpF Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Frankfurt/M.) DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen (Berlin) EDV Elektronische Datenverarbeitung EKD Evangelische Kirche Deutschlands e. V. eingetragener Verein f. folgende ff. Fortfolgende f&w Führen und Wirtschaften im Krankenhaus gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung HeimG Heimgesetz Hrsg. Herausgeber ISO International Organization for Standardization KDA Kuratorium Deutsche Altershilfe (Köln) KLR Kosten-Leistungs-Rechnung km Kilometer km2 Quadratkilometer ku Krankenhaus Umschau Marketing ZFP Marketing Zeitschrift für die Praxis MDK Medizinischer Dienst der Krankenversicherung § Paragraph §§ Paragraphen PBV Pflege-Buchführungsverordnung PDCA-Zyklus Plan-Do-Check-Act-Zyklus % Prozent PR Public Relations S. Seite SGB XI Sozialgesetzbuch elf ( Pflegeversicherungsgesetz) SGB V Sozialgesetzbuch fünf (Gesetzliche Krankenversicherung) Tab. Tabelle TQM Total Quality Management u. und u. a. und andere u. U. unter Umständen UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Verl. Verlag vgl. vergleiche z. B. zum Beispiel ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft zfo Zeitschrift Führung und Organisation ZögU Zeitschrift für öffentliche und gemeinnützige Unternehmen z. Z. zur Zeit Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Marketing als Managementprozeß Abb. 2: Zielgruppen des Heim-Marketings Abb. 3: Sind Marketingfortbildungen für die Zukunft geplant? Abb. 4: Wurde bereits die Marketingsituation erforscht? Abb. 5: Werden Zusatzleistungen angeboten? Abb. 6: Implementierungsstand der Unternehmensphilosophie Abb. 7: Stehen Sie in Kooperation mit anderen Anbietern von Pflegeleistungen? Abb. 8: Dienstleistungszentrum Alten- und Pflegeheim Tabellenverzeichnis Tab. 1: Unterscheidung der Alten- und Pflegeheime anhand der Trägerschaft Tab. 2: Möglichkeiten des strategischen Handelns Tab. 3: Mögliche Fragen an Heimbewohner zur Beurteilung der wahrgenommenen Qualität Tab. 4: Produkt-Markt-Matrix nach ANSOFF Tab. 5: Veranstaltungsangebote Tab. 6: Positives und negatives Heimklima Tab. 7: Trägerschaft der befragten Alten- und Pflegeheime Tab. 8: Rechtsform der befragten Alten- und Pflegeheime 1. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit Angesichts des stetigen gesellschaftlichen Wandels und der sich dadurch bedingt rasch ändernden Marktbedingungen ist es seit geraumer Zeit für erwerbswirtschaftliche Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, Marketing zu implementieren und bewußt zu gestalten. Eine meist hohe Konkurrenzintensität sowie ein ausgeprägter Wettbewerb um die Akzeptanz und das Vertrauen der Kunden zwingen den Profit-Bereich generell dazu, sich marktorientiert zu verhalten bzw. auf die Bedürfnisse des relevanten Marktes einzustellen und sich gegenüber der Konkurrenz zu profilieren. Zur Erhaltung und zum Ausbau einer sicheren Marktposition, verbunden mit der Realisation des wirtschaftlichen Erfolges, ist ein systematisches und offensives Marketing als funktionsübergreifende Denk- und Handlungsweise unerläßlich. Es bedeutet in der Regel eine aktive Existenzsicherung. In Alten- und Pflegeheimen, als Anbieter von sozialen Dienstleistungen in einem durch den Staat stark reglementierten Markt ein mehr oder weniger typisches Beispiel für Non-profit-Unternehmen, bestand bis Mitte 1996 nur selten Anlaß, sich über einen möglichen Nachfragerückgang und damit über das Thema Marketing Gedanken zu machen. Von dem vereinzelten und geringfügigen Wettbewerb zwischen zwei vergleichbaren Einrichtungen abgesehen, gab es keine Konkurrenz für das einzelne Alten- und Pflegeheim. Der stationäre Altenhilfesektor war ein Anbietermarkt mit recht stabilen und überschaubaren Bedingungen, gekennzeichnet durch Nachfragekontinuität, Absprachen zwischen den Heimen, hohe Markteintrittsbarrieren für neue, insbesondere gewerbliche Anbieter und weitestgehende Übernahme der Kosten durch die Sozialleistungsträger (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 22). Mit dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der Pflegeversicherung am ersten Juli 1996 mußten sich die Alten- und Pflegeheime auf deutlich veränderte Rahmenbedingungen einstellen. Die eingeführten gesetzlichen Reformen fördern, basierend auf den Grundsätzen der Wettbewerbsneutralität und der Marktöffnung, den Wettbewerb und lassen diesen ausdrücklich zu (vgl. KLIE, 1996, S. 82). Dieses Abrücken von einer restriktiven Bedarfsdeckung in Richtung "mehr Markt" hat zur Folge, daß weitere, in erster Linie gewerblich ausgerichtete Anbieter auf einen zunehmend wettbewerbsorientierten Markt drängen und in Konkurrenz zu den bereits etablierten Einrichtungen treten. Wie in anderen Dienstleistungssektoren auch gelten zunehmend Marktverhältnisse, die sich mit Preiskonkurrenz, Versuchen, über Dumping Marktanteile zu gewinnen, unlauteren Wettbewerb und ähnlichen Erscheinungen beschreiben lassen. Es vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel von einem Anbieter- zu einem Nachfragermarkt. Nicht mehr die in hoher Konkurrenzintensität stehenden stationären Pflegeeinrichtungen, sondern die Kunden1 bzw. die alten und pflegebedürftigen Menschen, die die Wahl zwischen verschiedenen Leistungsanbietern haben, sind in der stärkeren Verhandlungsposition (vgl. BRUNS, 1996, S. 31 ; PANTENBURG, 1996, S. 22). Vor diesem Hintergrund wird die zentrale Bedeutung des Marketings für das Alten- und Pflegeheim als einem wesentlichen Bestandteil der Unternehmenspolitik recht deutlich. Versorgungsverträge mit den Pflegekassen als Hauptfinanzierungsträger gewährleisten heute keine kontinuierliche Auslastung der Heimkapazitäten bzw. -belegung mehr. Das Unternehmen Alten- und Pflegeheim ist gefordert, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken des Pflegemarktes und einer stets konkurrenzbezogenen Analyse der eigenen Stärken und Schwächen, innovative Marktstrategien zu entwickeln und Erfolgspotentiale frühzeitig am Absatzmarkt zu erkennen, aufzubauen, auszuschöpfen und langfristig zu sichern. Dabei kommt es darauf an, potentielle Kunden, also in erster Linie Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, mit einem deren Bedürfnissen und Wünschen entsprechenden sowie zeitgemäßen Angebot als kompetenter Dienstleister zu überzeugen und sich gegenüber den Mitbewerbern am Pflegemarkt durchzusetzen. Mit Blick in die Zukunft müssen Alten- und Pflegeheime ihr Dienstleistungsangebot zu einem Erfolgsfaktor werden lassen, um eine dauerhafte Positionierung und Profilierung im Pflegemarkt realisieren zu können. Ohne umfassende Marketingaktivitäten, verbunden mit effizienten Betriebsstrukturen und anerkannter Dienstleistungsqualität, erscheint künftig die Sicherung der Unternehmensexistenz fast unmöglich. 1 Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff „Kunden“ synonym für Heimbewohner und andere Zielgruppen und damit aufgrund der betriebswirtschaftlichen Orientierung ein erweiterter Kundenbegriff verwendet, d. h., es wird zwischen externen und internen Kunden unterschieden. Zudem werden alte und pflegebedürftige Menschen zwar einerseits als die wichtigste Kundengruppe angesehen, andererseits stellen sie nur einen Teil der Kunden des Alten- und Pflegeheimes dar (siehe auch Abschnitt 3.5, „Erfolgsrelevante Zielgruppen“). Ausgehend von der grundsätzlichen Überlegung, daß Marketing geeignet ist, die Existenz eines Unternehmens, und damit auch eines Alten- und Pflegeheimes, am Markt zu sichern, ist es das primäre Ziel dieser Arbeit, Möglichkeiten der Gestaltung des Marketings anhand ausgewählter Instrumente, die eine effiziente Auslastung der Heimkapazitäten gewährleisten und fördern sowie die Position im Pflegemarkt stärken können, aufzuzeigen. Hierbei können nicht Patentlösungen für eine einzelne Einrichtung präsentiert, sondern vielmehr allgemeine Gestaltungsmöglichkeiten des Marketings in Alten- und Pflegeheimen dargestellt werden. Auf der Basis dieser theoretischen Erkenntnisse ist zudem beabsichtigt, mittels einer explorativen Studie ( Siehe auch Abschnitt 5.1.1, „Ziele der Studie“.) den Ist-Zustand des Marketings in Alten- und Pflegeheimen zu erfassen und unter Beachtung der abzusehenden Entwicklungen des Pflegemarktes Schwachstellen zu ermitteln, die sich in der Zukunft nachteilig für das Behaupten im Wettbewerb erweisen könnten. Dieser Einleitung folgt das zweite Kapitel mit einer Beschreibung der strukturellen Rahmenbedingungen für Alten- und Pflegeheime. Hierbei geht es darum, das Alten- und Pflegeheim zu definieren sowie die Situation für die Heime vor und nach Inkrafttreten der Pflegeversicherung zu erläutern. Es schließt sich im dritten Kapitel die Darstellung der Grundlagen des Marketings in Alten- und Pflegeheimen bezogen auf die Definition des Marketingbegriffes, die Erläuterung der Merkmale von sozialen Dienstleistungen und die Beschreibung der Elemente des Marketingkonzeptes an. Hier werden ebenfalls der Zusammenhang zwischen Marketing und Qualitätsmanagement aufgezeigt und die Zielgruppen der Marketingaktivitäten benannt. Im Rahmen des vierten Kapitels, das zugleich den Schwerpunkt der Arbeit bildet, wird anhand elementarer Instrumente des Marketingkonzeptes die mögliche Gestaltung des Marketings unter Berücksichtigung der aktuellen und zu erwartenden Bedingungen des Pflegemarktes erläutert. Der empirische Teil der Arbeit (Fünftes Kapitel) führt mittels eines an einem teilstrukturierten Leitfaden orientierten Experteninterviews zu Erkenntnissen über das Marktverhalten einzelner Alten- und Pflegeheime. Vor dem Hintergrund der Marktbedingungen und sich abzeichnender Marktentwicklungen werden Defizite und Schwachstellen der Marketingaktivitäten deutlich. Im sechsten und abschließenden Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten empirischen und theoretischen Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit. Die prognostizierte strukturelle Entwicklung im Pflegemarkt und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Marketing im Alten- und Pflegeheim werden Bestandteil des Ausblicks sein. 2.Strukturelle Rahmenbedingungen für Alten- und Pflegeheime Zunächst wird die Einrichtung Alten- und Pflegeheim aus gesetzlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht definiert. Anschließend werden die Eckpunkte des bis zum 30. Juni 1996 gültigen Systems skizziert sowie die Grundsätze der seit diesem Zeitpunkt gültigen Pflegeversicherung und die mit der Einführung dieses Gesetzes verbundenen Veränderungen des unternehmerischen Umfeldes der Alten- und Pflegeheime dargestellt. Den Abschluß bildet die Beschreibung der Charakteristika des Pflegemarktes. 2.1 Definition des Alten- und Pflegeheimes 2.1.1 Gesetzliche Definition Unter einem Heim sind per Legaldefinition nach § 1 des Heimgesetzes (HeimG) Einrichtungen zu verstehen, "die zum Zwecke der nicht nur vorübergehenden Unterbringung von alten Menschen sowie pflegebedürftigen oder behinderten Volljährigen entgeltlich betrieben werden und in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl ihrer Bewohner unabhängig sind. Die Unterbringung ... umfaßt neben der Überlassung der Unterkunft die Gewährung oder Vorhaltung von Verpflegung und Betreuung" (VOLLMER, 1994, S. 2). Des weiteren bezeichnet das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) Alten- und Pflegeheime als Anstalten, Heime oder gleichartige Einrichtungen, die der Pflege, der Behandlung oder sonstigen Hilfe dienen (vgl. §§ 97 Abs. 4 und 100 Abs. 1). Etwas ausführlicher definiert das Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) in § 71 Abs. 2 für seinen Geltungsbereich stationäre Pflegeeinrichtungen bzw. Pflegeheime als "selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige: 1. unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt werden, 1. ganztägig (vollstationär) oder nur tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden können" (KLIE, 1996, S. 299). Zur deutlicheren Abgrenzung von anderen Einrichtungen wird unter Abs. 4 in diesem Paragraphen weiter ausgeführt, daß "stationäre Einrichtungen, in denen die medizinische Vorsorge oder Rehabilitation, die berufliche oder soziale Eingliederung, die schulische Ausbildung oder die Erziehung Kranker oder Behinderter im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung stehen, sowie Krankenhäuser keine Pflegeinrichtungen im Sinne des Absatzes 2 sind" (KLIE, 1996, S. 300). Demnach ist ein Altenheim darauf ausgerichtet, alten bzw. älteren Menschen, die nicht im Sinne des SGB XI3 pflegebedürftig sind und lediglich keinen eigenen Haushalt führen (können), Wohnraum, Verpflegung und Betreuung zu gewährleisten. Das Pflegeheim dagegen dient der umfassenden Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen und chronisch Kranker (vgl. DVöpF, 1992, S. 12 - 14). 3Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird in § 14 SGB XI, die Stufen der Pflegebedürftigkeit in § 15 SGB XI erläutert (vgl. KLIE, 1996, S. 122/123 und 133/134). 2.1.2 Betriebswirtschaftliche Klassifikation Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich zunächst die Frage, welchem Typ von Einzelwirtschaften die Altenund Pflegeheime zugeordnet werden können. Auf den ersten Blick wird deutlich, daß Heime die systemindifferenten Kriterien eines Betriebes erfüllen, da sie unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und über eine zielorientierte und planmäßige Kombination von Produktionsfaktoren soziale Dienstleistungen erstellen. Zudem müssen sie darauf achten, daß sie ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen können (Prinzip des finanziellen Gleichgewichtes), um die Existenz nicht zu gefährden (vgl. WÖHE, 1996, S. 5). Die genauere Betrachtung zeigt, daß ebenfalls die Merkmale eines Unternehmens zutreffen. Alten- und Pflegeheime erbringen gegen ein Entgelt in Form der Pflegesätze ihre pflegerischen und betreuerischen Dienstleistungen zum Nutzen von Dritten, d. h., die Adressaten des Outputs sind in erster Linie die Bewohner (Fremdbedarfsdeckung). Hierbei entscheiden sie im Rahmen der geltenden Gesetze eigenverantwortlich beispielsweise über den Einsatz ihrer Ressourcen, die Kalkulation der Einnahmen oder ihre Organisationsstrukturen (Autonomieprinzip), um dem Auftreten von Verlusten adäquat entgegenzuwirken bzw. das Markt- und Konkursrisiko zu bewältigen (vgl. BEA u. a., 1992, S. 23 - 25). Eine andere Möglichkeit, das Unternehmen Alten- und Pflegeheim zu beschreiben, bietet die Unterscheidung nach öffentlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft. Öffentliche Alten- und Pflegeheime werden in der Regel von einer kommunalen Gebietskörperschaft oder einer sonstigen Körperschaft des öffentlichen Rechts getragen. Freigemeinnützige Heime werden dagegen von religiösen, kirchlichen, humanitären oder sozialen Vereinigungen, Verbänden oder Stiftungen betrieben, während private Alten- und Pflegeheime von privaten Trägern in privater Rechtsform geführt werden. Für alle drei gelten die gemeinsamen Formalziele "Substanzerhaltung" und "Liquidität". Für die öffentlichen und freigemeinnützigen Alten- und Pflegeheimen gilt darüber hinaus das Prinzip der Eigen- bzw. Gemeinwirtschaftlichkeit und Kostendeckung. Bei privaten Heimen kommt hingegen das erwerbswirtschaftliche Prinzip und damit die Gewinnerzielungs- und Rentabilitätsmaxime hinzu (vgl. BEA u. a., 1992, S. 28/29 und 358 ff. ; SCHIERENBECK, 1995, S. 22 - 35 ; WÖHE, 1996, S. 374 ff.). Einen Überblick über die wesentlichen Unterscheidungskriterien vermittelt die folgende Tabelle: Tab. 1: Unterscheidung der Alten- und Pflegeheime anhand der Trägerschaft Öffentliche Alten-/ Pflegeheime Freigemeinnützige Alten-/ Pflegeheime Private Alten-/ Pflegeheime Kapitaleigentum Gemeineigentum Eigentum von Teilen der Gesellschaft Privateigentum Formalziele Substanzerhaltung Liquidität Kostendeckung Substanzerhaltung Liquidität Kostendeckung Substanzerhaltung Liquidität Gewinnerzielung Anzahl der Heime 1.114 4.563 2.576 Anteil an Gesamtzahl der Heime in % 13,5 55,3 31,2 119.106 409.320 133.205 18,0 61,9 20,1 Bewohnerplätze in Heimen Anteil an Gesamtzahl der Plätze in % Quelle der numerischen Daten: BMFSFJ, 1996, Heimstatistik (Heime nach § 1 Abs. 1 HeimG, Stand: 30.06.1996) Ein weiteres relevantes Kriterium stellt die Betrachtung der Zugehörigkeit der Heime zum Profit- oder Non-ProfitBereich dar. Alten- und Pflegeheime übernehmen die öffentliche Aufgabe der Pflege und Betreuung hilfe- bzw. pflegebedürftiger Menschen. Die durch sie erbrachten sozialen Dienstleistungen kommen der gesamten Gesellschaft zugute und dienen dem Gemeinwohl. Das Unternehmen Heim agiert somit auf einem sozial ausgerichteten Markt, dem sogenannten Gesundheits- bzw. Pflegemarkt. Im Gegensatz zu anderen Märkten greift hier der Staat von außen reglementierend ein, um eine kontinuierliche, sozial verträgliche Versorgung der Hilfe- und Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Hieraus folgt, daß Alten- und Pflegeheime, unabhängig von ihrer Unternehmensform, keine "Markt-Preise" für ihre Pflegeleistungen erzielen können, sondern sich fast ausschließlich über im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen festgelegten Vergütungen bzw. Leistungsentgelten nach dem Äquivalenzprinzip finanzieren müssen (vgl. KLIE, 1996, S. 65). Private, gewerbliche Pflegeeinrichtungen sind somit nicht in der Lage, ihr Formalziel der Gewinnmaximierung in der Form zu verwirklichen, wie dies ein privates Unternehmen auf einem "freien" Markt vermag (z. B. Autoindustrie). Demgegenüber müssen sich öffentliche und freigemeinnützige Heime, die zwar die formale Zielsetzung der Kostendeckung verfolgen, mehr in Richtung eines Profit-Centers bewegen, um dem nach Einführung der Pflegeversicherung steigenden Kostendruck und der zunehmenden Konkurrenzintensität standhalten zu können4. Infolgedessen können Alten- und Pflegeheime sowohl dem Profit- als auch dem Non-Profit-Bereich zugeordnet werden. Tendenziell jedoch lassen sie sich dem Non-Profit-Bereich zuordnen, da sie ihre Dienstleistungen aufgrund der durch den Gesetzgeber vorgenommenen Einschränkungen in einem "QuasiMarkt" anbieten und erbringen (vgl. BRUNS, 1996, S. 31). 4 Eine genaue Beschreibung der Marktverhältnisse findet sich unter den Abschnitten 2.4 und 2.5. 2.2 Situation vor Inkrafttreten der Pflegeversicherung Bis zum Inkrafttreten der zweiten Stufe der Pflegeversicherung am ersten Juli 1996 bildete in erster Linie das Sozialhilferecht neben dem Heimgesetz und dessen Folgeverordnungen den Handlungsrahmen für die Altenund Pflegeheime. Das BSHG regelte die grundsätzlichen Aspekte, für die Organisation und Umsetzung waren die einzelnen Bundesländer mit ihren nachgeordneten Verwaltungen als überörtlicher Sozialhilfeträger und die kreisfreien Städte bzw. Landkreise als örtlicher Sozialhilfeträger in Selbstverwaltung verantwortlich (vgl. §§ 9, 96 ff. BSHG, "Träger der Sozialhilfe"). Daraus folgte zwangsläufig, daß keine einheitlichen Strukturen im Bereich der stationären Altenhilfe existieren. Die Bedarfsplanungen des vorzuhaltenden Angebotes an stationären Plätzen und Einrichtungen wurden auf örtlicher oder überörtlicher Sozialhilfeträgerebene unter Einbezug der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vorgenommen (vgl. § 10 Abs. 2 bis 5 BSHG, "Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege"). Diese symbiotische Beziehung führte dazu, daß keine beachtenswerte Konkurrenzsituation aufkam. Neue, gewerbliche Anbieter konnten sich in der Regel nur vereinzelt und mit Schwierigkeiten auf dem "Markt" etablieren. Die Verhandlung der Pflegesätze erfolgte zunächst zwischen den Vertretern der Sozialhilfeträger (z. B. Landeswohlfahrtsverband) und denen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege. An den in diesen Verhandlungen auf der Basis des Selbstkostendeckungsprinzips erzielten Pflegesatzvereinbarungen für den sozialhilfeabhängigen Bereich wurde sich im weiteren sowohl bei der Festlegung der Entgelte für Selbstzahler als auch bei den Einzelverhandlungen mit kommunalen und gewerblichen Heimen orientiert (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 104). Mit der Novellierung des Bundessozialhilfegesetzes beabsichtigte der Gesetzgeber Mitte 1994, über die Einführung von leistungsgerechten Entgelten Anreize zur Kosteneinsparung und Wirtschaftlichkeit zu setzen. Zudem wurden die Vertragsparteien dazu verpflichtet, Regelungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen festzulegen (vgl. § 93 Abs. 2 BSHG). Diese Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip bedeutete gleichzeitig, daß die Pflegesätze prospektiv für das folgende Jahr ausgehandelt und Gewinne und Verluste nicht mehr ausgeglichen werden sollten (vgl. § 93 Abs. 3 BSHG). Entgegen der Intention des BSHG wurde zwischen den Vertragsparteien überwiegend nach dem Prinzip der Budgetdeckelung eine jährliche Steigerungsrate für Pflegesätze (gedeckelte Pflegesatzvereinbarung) vereinbart, die normalerweise nicht überschritten werden durfte (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 105). Grundsätzlich erfolgte die Finanzierung öffentlicher und freigemeinnütziger Heime nach dem dualen Prinzip, die gewerblicher Heime nach dem monistischen. Bei Erstgenannten waren die Einnahmen über die Pflegesätze für die Deckung der Betriebskosten bestimmt, Investitionen in Form von Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden mit Hilfe von Zuschüssen der öffentlichen Hand finanziert. Gewerbliche Träger, die keine Investitionszuschüsse erhalten, konnten dagegen in der Regel die höheren Eigen- bzw. Fremdkapitalkostenanteile und höhere Abschreibungsbeträge im Pflegesatz verrechnen (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 105). Die Überwachung und Sicherstellung der Qualität in den Alten- und Pflegeheimen übernahm ausschließlich die sogenannte Heimaufsicht auf der Grundlage des Heimgesetzes und dessen Folgeverordnungen (Heimmindestbau-, Heimsicherungs-, Heimmitwirkungs-, Heimpersonalverordnung). In den Zuständigkeitsbereich dieser kommunalen Behörde fallen sowohl die Erteilung der Betriebserlaubnis für private bzw. gewerbliche und nicht verbandlich organisierte, gemeinnützige Einrichtungen als auch die regelmäßige Prüfung und Besichtigung aller Heime (vgl. § 6 HeimG, "Erlaubnis" und § 9 HeimG, "Überwachung"). Mit dem Stichtag erster Juli 1996, dem Tag der Einführung der Pflegeversicherung, wurde für den Bereich der Pflegeheime, wurde ein Großteil dieser bisherigen Regelungen aufgehoben und das System umfassend restrukturiert 5. 5Altenheime und Altenwohnheime sind von diesen neuen Regelungen nicht betroffen, da sie nicht als stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI gelten. Für diese Bereiche hat weiterhin vorwiegend das BSHG und das Heimgesetz Gültigkeit 2.3 Grundsätze der Pflegeversicherung Die Pflegeversicherung ist konzipiert als die fünfte Säule der gesetzlichen Sozialversicherung mit den Pflegekassen als Träger, um den veränderten gesellschaftlichen und demographischen Bedingungen Rechnung zu tragen. Sie verfolgt die grundsätzliche Intention, die Situation der Pflegebedürftigen zu verbessern und ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu ermöglichen (vgl. § 2 Abs. 1 SGB XI). Dies impliziert, daß der betroffene Personenkreis möglichst lange in seiner vertrauten häuslichen Umgebung bleiben soll. Die Pflegebedürftigen verfügen dabei über ein ausdrückliches Wunsch- und Wahlrecht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger und unterschiedlichen Angeboten auswählen zu können. Der Vorrang der häuslichen bzw. ambulanten Pflege vor der stationären Pflege stellt eines der wesentlichen Ziele dieses Gesetzes dar. Dementsprechend gehen die Leistungen der teilstationären Pflege (Tages- oder Nachtpflege) und der Kurzzeitpflege denen der vollstationären Pflege vor (vgl. § 3 SGB XI). Ein weiteres wichtiges Ziel ist in dem festgeschriebenen Vorrang von Prävention und Rehabilitation zu sehen. Da die Pflegekassen nicht selbst diese Leistungen gewähren, haben sie bei den zuständigen Leistungsträgern darauf hinzuwirken, daß frühzeitig alle geeigneten Maßnahmen eingeleitet werden, um den Eintritt der Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und, im Falle der Pflegebedürftigkeit, diese zu überwinden, zu vermindern sowie eine Verschlimmerung zu verhindern (vgl. §§ 5 und 31 SGB XI). Zusätzlich verfolgt die Pflegeversicherung das Prinzip der Wettbewerbsneutralität und Marktöffnung. Dabei wird allen stationären und ambulanten Pflegeanbietern, die die festgelegten Anforderungen zur Qualität, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen (vgl. § 71 SGB XI, "Pflegeeinrichtungen"), ein Rechtsanspruch auf die Zulassung als Pflegeheim bzw. Pflegedienst zum Markt der Pflegeleistungen zugesichert (vgl. § 72 Abs. 3 SGB XI, "Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag"). Auf bedarfssteuernde, dirigistische Elemente wird somit zugunsten von marktwirtschafts- und wettbewerbsorientierten Steuerungsinstrumenten verzichtet, mit der Folge, daß die Zulassung als vollstationäre Pflegeeinrichtung nicht weiter von einer örtlichen Bedarfsprüfung abhängig ist und die freigemeinnützigen Träger ihrer exponierten Stellung enthoben worden sind. Da die Pflegekassen ebenfalls dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet sind, haben öffentliche Träger allerdings nur einen Zulassungsanspruch, wenn freigemeinnützige und private Anbieter nicht in ausreichender Zahl in das plural zu gestaltende Versorgungssystem integriert werden können (vgl. §§ 11 Abs. 2 und 72 Abs. 3 SGB XI). 2.4 Aktuelle Situation Infolge der Einführung der Pflegeversicherung ist das Umfeld, auf das sich ein Alten- und Pflegeheim einstellen muß, wesentlich komplexer geworden. Die Verantwortlichkeit bzw. Federführung für den gesamten Pflegesektor verschiebt sich zum größten Teil von den Sozialhilfeträgern zu den Pflegekassen, die als dominierender Finanzierungsträger (Die Gruppe der Finanzierungsträger setzt sich aus Pflegekassen, Krankenkassen, Sozialhilfeträgern und Selbstzahlern zusammen) über weitreichende Kompetenzen sowohl bei der Auswahl und Kontrolle der Anbieter als auch bei den Pflegesatzvereinbarungen verfügen. Statt einzelner örtlicher bzw. überörtlicher Sozialhilfeträger zeigen sich primär die Landesverbände der Pflegekassen für die Gestaltung der Angebotsstrukturen und der Finanzierung der Pflegeleistungen verantwortlich. Dieser starke Einfluß zeigt sich beispielsweise anhand der Rahmenverträge, die auf Landesebene von den Landesverbänden der Pflegekassen mit den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen abgeschlossen werden. In diesen Rahmenverträgen gemäß § 75 SGB XI werden sowohl der Inhalt der Pflegeleistungen definiert, Maßstäbe und Grundsätze für die personelle Ausstattung festgelegt, örtliche und regionale Einzugsbereiche der Pflegeeinrichtungen formuliert als auch Prüfrechte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der Qualitätssicherung vereinbart. Die Folge ist, daß die Pflegekassen insbesondere bei der Verhandlung der Pflegesätze eine starke Position einnehmen, da diese institutionellen Nachfrager auf umfangreiche Informationen hinsichtlich Leistungen, Qualität und Höhe der Leistungsentgelte aller Einrichtungen und damit auf eine größere Transparenz zurückgreifen können (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 159). In diesem Zusammenhang sind die Pflegeeinrichtungen gemäß § 80 SGB XI dazu verpflichtet, eine kontinuierliche Qualität bei den Pflegeleistungen zu erbringen und sich an internen und externen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zum Beispiel in Form von Qualitätszirkeln, Zertifizierungsmaßnahmen und kommunalen Qualitätskonferenzen, zu beteiligen. Unabhängig von den bisherigen Qualitätssicherern, der Heimaufsicht, den Krankenkassen und den Sozialhilfeträgern, nimmt somit die Pflegekasse ebenfalls Aufgaben der Qualitätskontrolle wahr und prüft die Einhaltung der Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung (vgl. KLIE, 1996, S. 28/29). Mit der Pflegeversicherung wird das Finanzierungssystem umgestaltet und differenzierter aufgebaut, als dies über den mehr oder weniger pauschalen Pflegesatz der Sozialhilfeträger der Fall gewesen ist. Während die Investitionskosten nach dem Grundsatz der dualen Finanzierung überwiegend durch die Länder zu fördern sind (vgl. § 9 SGB XI), decken die zugelassenen Pflegeheime ihre laufenden Betriebskosten getrennt nach Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung (Hotelkosten) und den sogenannten Zusatzleistungen (vgl. § 82 Abs. 1 SGB XI). Die Höhe der leistungsgerechten Entgelte für die beiden erstgenannten Leistungskomplexe werden in der prospektiv abzuschließenden Pflegesatzvereinbarung fixiert. In diesem Zusammenhang sieht das Gesetz ebenso wie das novellierte BSHG weder einen Gewinn- noch einen Verlustausgleich vor (vgl. §§ 84 und 85 SGB XI). Für die Kosten der Unterkunft und Verpflegung hat der Heimbewohner aufzukommen, in begründeten Fällen übernimmt der Sozialhilfeträger einen Teil. Da die Pflegeversicherung nicht das gesamte Pflegerisiko abdeckt, sondern nur den durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) festgestellten Bedarf an Grundleistungen, hat der Bewohner Zusatzleistungen im Sinne besonderer Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen selbst zu zahlen (vgl. § 88 SGB XI). Die Definition der Zusatzleistungen gestaltet sich jedoch für die Pflegeheime recht schwierig, da die Verhandlungen über die Rahmenverträge nach § 75 SGB XI noch nicht beendet worden sind, so daß aufgrund der fehlenden eindeutigen Abgrenzung der Leistungskomplexe die meisten Einrichtungen auf diese zusätzliche Einnahmequelle derzeit verzichten 7 . 7 Das Leistungsangebot und die Leistungsbedingungen müssen den Landesverbänden der Pflegekassen und den überörtlichen Sozialhilfeträgern nur mitgeteilt werden. Während der Wettbewerb zwischen den Heimen bis Mitte 1996 aufgrund vielfältiger Angebotsregulierungen größtenteils unterdrückt worden ist, zeichnet sich nach der Reduktion der Markteintrittsbarrieren eine Intensivierung der Wettbewerbssituation mit umfangreichen Folgen für den stationären Altenhilfesektor ab. Das Abrücken von der bisherigen Bedarfsdeckung und die Bewegung in Richtung "mehr Markt" hat dazu geführt, daß weitere, in erster Linie gewerbliche Anbieter auf einen zunehmend wettbewerbsorientierten Markt drängen und in Konkurrenz zu den bereits existierenden Einrichtungen treten. Gleiches gilt auch für eine Reihe von Krankenhäusern, die ihre unausgelasteten Kapazitäten in Pflege- und geriatrische Rehabilitationsabteilungen umstrukturieren (vgl. DREWES, 1993, S. 428 ; PANTENBURG, 1996, S. 162 ff.). Gleichzeitig nehmen mehr Pflegebedürftige, als zu Beginn der Pflegeversicherung prognostiziert, die Geldleistungen in Anspruch (vgl. KLIE, 1996, S. 12), so daß nun ein größerer Kreis an Pflegeeinrichtungen seine stationären Leistungen einer bestenfalls konstanten Anzahl an potentiellen Kunden anbietet. Diese als dynamisch zu bezeichnende Wettbewerbsintensität läßt zusammenfassend folgende Entwicklungen erwarten (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 165): ● ● ● ● ● Anstieg des Kostendrucks der Pflegekassen. Auslastungsprobleme und Betriebsverluste durch hohe Fixkosten. Zunehmende Zahl an Konkursen, insbesondere kleinerer Anbieter. Etablierte, konventionelle Angebote infolge der sich ändernden Anforderungen zunehmend nicht mehr zeitgemäß. Ausdifferenzierung der Angebotsformen und des Marktes infolge des Wandels vom Anbieter- zum Nachfragermarkt; wegen der Konkurrenz unterschiedlicher Dienstleistungen für gleiche Problemlagen Abwanderungstendenzen weg von herkömmlichen hin zu zukunftsfähigen Leistungsangeboten. 2.5 Charakteristika des Pflegemarktes Die anfänglichen vielfachen Befürchtungen, daß der Gesetzgeber über den Zwang zu mehr Wirtschaftlichkeit und einem effizienteren Leistungsangebot die Implementierung eines vollkommenen Pflegemarktes beabsichtige, erscheinen aufgrund der rechtlichen, organisatorischen und institutionellen Gegebenheiten unbegründet. Entscheidende Marktbedingungen, wie beispielsweise der uneingeschränkte Austausch von Gütern und Dienstleistungen als Voraussetzung eines Marktes von Pflegeleistungen, werden nicht erfüllt. Der Pflege- bzw. Gesundheitsmarkt wird durch Steuerungsinstrumente wie Budgetlimitierung oder Leistungsausgrenzung von außen reglementiert. Zudem existiert keine unmittelbare Anbieter-NachfragerBeziehung, sondern eine Dreiteilung. In den meisten Fällen werden Pflegeleistungen erst erbracht, wenn der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit attestiert hat. Ähnlich verhält es sich bei der Vergütung der Leistungen. Der Bewohner bezahlt lediglich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Versicherungsbeiträge, die Kosten für die Pflegegrundleistungen übernimmt die Pflegekasse. Außerdem erhalten die Pflegeeinrichtungen statt "Markt-Preisen" in Pflegesatzverhandlungen festgeschriebene Entgelte. Erschwerte Marktbedingungen resultieren des weiteren daraus, daß die potentiellen Bewohner nur über sehr unzureichende Informationen über das PreisLeistungsverhältnis der in den einzelnen Heimen angebotenen Dienstleistungen verfügen (eingeschränkte Konsumenten-Souveränität). Von einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb kann somit nicht gesprochen werden, zumal die Heime infolge ihres Versorgungsvertrages weder aus Wettbewerbs- noch aus Preisgründen Leistungen ablehnen dürfen. Im Gegensatz zu klassischen Unternehmen bzw. Dienstleistern agieren Alten- und Pflegeheime unter modifizierten Marktbedingungen in einem "Quasi-Markt" (vgl. BRUNS, 1996, S. 31). Der Wettbewerb beschränkt sich größtenteils auf nicht-marktliche Wettbewerbsparameter wie zum Beispiel die Qualität der Dienstleistungen. Die Wettbewerbselemente der Pflegeversicherung haben dennoch bewirkt, daß der Kostendruck von Seiten der Pflegekassen ansteigt und, daraus resultierend, daß die Erbringung der Leistungen (markt)wirtschaftlicher ausgerichtet erfolgt (vgl. MEINERS/ALBERS, 1998, S. 48). 3. Grundlagen des Marketings in Alten- und Pflegeheimen Im nachfolgenden Kapitel wird zunächst der Marketingbegriff eingegrenzt und definiert, danach erfolgt die Erläuterung der Besonderheiten von sozialen Dienstleistungen. Anschließend werden zum besseren Verständnis die Elemente des Marketingkonzeptes im Überblick dargestellt und der Bezug zum Qualitätsmanagements erläutert. Den Abschluß bildet die Beschreibung der Zielgruppen der Marketingaktivitäten, die den Erfolg eines Alten- und Pflegeheimes entscheidend determinieren. 3.1 Begrifflichkeit Der Begriff des Marketings wird sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der praxisorientierten Literatur mit keinem einheitlichen Vorstellungsbild verbunden und ist dementsprechend einem permanenten Wandel unterworfen. Es herrscht jedoch weitgehende Übereinstimmung, daß der Erfolg eines Unternehmens zu einem nicht unerheblichen Teil von dessen Absatzmarkt abhängig ist und somit unter Marketing allgemein das "Denken vom Markt her" verstanden werden kann (vgl. Unter anderem MEFFERT, 1986 ; WEIS, 1990 ; NIESCHLAG u. a., 1991 ; KOTLER/BLIEMEL, 1995 ; BRUHN, 1997). Dies induziert generell die bewußte Gestaltung der Austauschbeziehungen eines Unternehmens zu seiner Umwelt, d. h., daß Unternehmen ihre Geschäftsführung bewußt marktorientiert gestalten bzw. ihre unternehmerischen Entscheidungen marktorientiert treffen (vgl. MEFFERT, 1986, S. 29). Marketing heißt somit, daß alle auf die potentiellen und aktuellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten, in deren Mittelpunkt die Bedürfnisbefriedigung der am Austauschprozeß beteiligten Gruppen (Kundenbedürfnisse und Unternehmensziele) steht, geplant, koordiniert und kontrolliert werden (vgl. MEFFERT, 1986, S. 31). Mit anderen Worten bedeutet Marketing für ein Altenund Pflegeheim nichts anderes, als in den Pflegemarkt hineinzugehen und sich an dessen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen ihrer Kunden zu orientieren, um die eigene Existenz dauerhaft zu sichern. Im einzelnen läßt sich die Mehrdimensionalität des Marketingbegriffes anhand der folgenden Wesensmerkmale charakterisieren (vgl. WEIS, 1990, S. 18 ; BIEBERSTEIN, 1995, S. 21 - 23): ● ● ● ● ● ● Marketing ist als eine Philosophie der marktorientierten Unternehmensführung zu bezeichnen, die die Erfordernisse des Marktes und nicht den Verkauf der vorhandenen Produkte fokussiert. Zum Marketing gehört in diesem Zusammenhang, daß kontinuierlich Informationen über aktuelle und potentielle Märkte ermittelt werden, die als Entscheidungsgrundlage dienen. Marketing dient der Bedürfnisbefriedigung aller Beteiligten. Der Absatzmarkt bildet den Ausgangspunkt aller strategischen und taktischen Planungen, die gesamten Aktivitäten des Unternehmens werden zielgerichtet und geplant auf den Markt hin ausgerichtet. Marketing versteht sich als bewußte Kunden- und Absatzorientierung aller Unternehmensbereiche. Die einzelnen Bereiche des Unternehmens werden aufeinander abgestimmt und die Organisation den Zielen und Aktivitäten entsprechend modifiziert, um auf dem Absatzmarkt eine koordinierte und integrierte Vorgehensweise sicherzustellen und damit über die Synergieeffekte der eingesetzten Marketinginstrumente eine optimale Orientierung am Kunden realisieren zu können. Damit läßt sich Marketing zusammenfassend wie folgt definieren: "Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert sich in der Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher interner und externer Unternehmensaktivitäten, die durch die Ausrichtung der Unternehmensleistungen am Kundennutzen im Sinne einer konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen, absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu erreichen" (BRUHN, 1997, S. 16). Diese Definition macht deutlich, daß Marketing als ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Bestandteil der Unternehmenspolitik angesehen werden muß. Es besitzt mindestens die gleiche Bedeutung wie andere Unternehmensfunktionen, beispielsweise dem Personalwesen, sondern ist als eine Art Leitkonzept des Managements zu verstehen. In diesem Kontext kann Marketing auch als ein "marktorientiertes, duales Führungskonzept" bezeichnet werden, das einerseits eine unternehmerische Funktion und andererseits eine Denkhaltung darstellt (vgl. MEFFERT, 1994, S. 4 f.). 3.2 Besonderheiten von Dienstleistungen Dienstleistungen weisen im Vergleich zu Sachgütern spezifische Eigenschaften auf, die sogenannten "konstitutiven Merkmale", die bei den Marketingaktivitäten generell zu beachten sind (vgl. MEFFERT, 1986, S. 43 47 ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 23 - 66). Dienstleistungen werden in der Regel zur gleichen Zeit erbracht und verbraucht, die Leistung selbst ist also nicht konservierbar (Uno-Actu-Prinzip). Sie sind demnach nicht lager- und transportfähig, eine Vorratsproduktion schließt sich somit aus. Dies hat zur Folge, daß sie über eine geringe Kapazitätselastizität verfügen, so daß einer erhöhten oder erniedrigten Nachfrage nicht direkt mit einer Ausweitung bzw. Reduktion der Kapazitäten begegnet werden kann. Weiterhin sind Dienstleistungen immaterieller Natur, so daß der Kunde keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat, gleichartige Dienstleistungen miteinander zu vergleichen, ohne sie in Anspruch zu nehmen. Das Image eines Anbieters spielt somit im Vorfeld der Entscheidung der Kunden für ein Dienstleistungsangebot eine wichtige Rolle. Dienstleistungen vollziehen sich zudem nicht isoliert vom Kunden, sondern es wird ein sogenannter externer Faktor in Form des Kunden selbst oder eines von ihm zur Verfügung gestellten Gegenstandes integriert und transformiert. Kennzeichnend ist hierbei eine Interaktion zwischen der Person, die die Dienstleistung erbringt, und dem Konsumenten. Dadurch wird das Leistungsergebnis in der Regel beeinflußt. Darüber hinaus unterliegen Dienstleistungen qualitativen Schwankungen, da das Qualitätsniveau der Erbringung personenabhängig ist. Bei Unzufriedenheit des Kunden kann die Leistung aufgrund ihres immateriellen Charakters nicht umgetauscht werden. Infolgedessen sind Dienstleistungen nur sehr schwer standardisierbar, so daß besondere Anforderungen an die Qualifikation, Schulung und Motivation der Mitarbeiter zu stellen sind. Idealtypisch lassen sich sach- und personengebundene Dienstleistungen in Abhängigkeit von dem Adressaten der einzelnen Dienstleistung unterscheiden, die wiederum jeweils in eine Potential-, Prozeß- und Ergebnisdimension differenziert werden können (vgl. MEYER, A., 1990, S. 177 ff.). In diesem Zusammenhang erbringen Alten- und Pflegeheime personenbezogene Dienstleistungen, deren Potentialgröße sich aus den unabhängig von der Nachfrage für die Leistungserbringung vorzuhaltenen Ressourcen wie Personal, Bewohnerzimmer oder Ausstattung zusammensetzt. Als typische Prozeßgrößen sind beispielsweise die Pflege und Betreuung der Bewohner selbst und deren Unterbringung in ihren Zimmern zu bezeichnen. Ziel dieser sozialen, also einen Mitmenschen versorgenden Dienstleistungen ist es, eine nutzenstiftende Zustandsveränderung zu bewirken, indem das Wohlbefinden des Bewohners verbessert und seine Gesundheit erhalten werden, so daß dem (hilfe- und pflegebedürftigen) Bewohner ein menschenwürdiger Lebensabend und eine weitgehende selbständige Lebensführung ermöglicht werden (Ergebnisgröße). 3.3 Elemente des Marketingkonzeptes Eine marktorientierte Ausrichtung und Führung eines Unternehmens läßt sich nur konsquent realisieren, wenn, entsprechend dem Verständnis des Marketings als einem Managementkonzept, systematisch entschieden und planvoll vorgegangen wird. Ein Unternehmen ist gezwungen, seine Marketingaktivitäten zu strukturieren und einen Marketingplan zu erstellen. Das bedeutet, daß zunächst das aktuelle und potentielle Marktund Unternehmensgeschehen untersucht werden muß, um richtungsweisende Anhaltspunkte für die Gestaltung des Marketings ableiten zu können. Das Ergebnis dieser Analysen und Planungsprozesse stellt die sogenannte Marketingkonzeption dar (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 115 ; SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 19). Diese ist als ein umfassender gedanklicher Entwurf zu verstehen, der sich an den Leitideen und relevanten Zielgrößen orientiert sowie den grundlegenden Handlungsrahmen, in Form der Marketingstrategien, und die hiervon abgeleiteten operativen Aktivitäten, dem Marketinginstrumenteeinsatz, zu einem Programm zusammenfaßt (vgl. BECKER, 1992, S. 2). Die Marketingkonzeption beinhaltet somit sowohl eine strategische als auch eine operative Dimension. Erstere setzt sich aus der Marketingsituationsanalyse, den Marketingzielen und den Marketingstrategien zusammen, die letztgenannte bildet das sogenannte marketingpolitische Instrumentarium. 3.3.1 Strategisches Marketing Die Analyse der Marketingsituation ist Ausgangspunkt der Marketingkonzeption. Hierbei werden die, die derzeitigen und zukünftigen Marktverhältnisse kennzeichnenden Informationen und die eigenen Potentiale erfaßt und ausgewertet. Ergebnis dieser analytischen Phase sollte die Identifizierung der wichtigsten Chancen und Risiken des Pflegemarktes sowie der Stärken und Schwächen des Alten- und Pflegeheimes sein (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 65 ; BRUHN, 1997, S. 40). Der Situationsanalyse schließt sich die Festlegung der Marketingziele an. Diese sind operational zu halten, um eine kontinuierliche Bestimmung des Zielerreichungsgrades zu ermöglichen und damit neben ihrer Motivationsfunktion auch ihre Steuerungs- und Kontrollfunktion zu erfüllen. Die Basis der Marketingziele bilden einerseits der Unternehmenszweck, also die vollstationäre Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen, und die obersten Unternehmensziele, wie Substanzerhalt und Liquidität, und andererseits die Ergebnisse der Analyse der Marketingsituation. Marketingziele spiegeln somit den angestrebten zukünftigen Zustand, der aufgrund der unternehmerischen Aktivitäten erreicht werden soll, wider. Typische Zielsetzungen eines Alten- und Pflegeheimes sind in diesem Zusammenhang beispielsweise eine höhere Auslastung, eine gezieltere Mittelverwendung, eine größere Kundenzufriedenheit, die Erhöhung des Bekanntheitsgrades oder die Gewinnung von Spendern (vgl. MEFFERT, 1986, S. 81 - 85 ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 139 - 150). Im Rahmen der Marketingkonzeption müssen nach der Zielfestlegung Wege gefunden werden, mit denen die definierten Ziele erreicht werden können. Hierzu werden mittel- bis langfristig wirkende Verhaltensgrundsätze in Form sogenannter Marketingstrategien festgelegt, die beschreiben, wie die strategischen Marketingziele mit Hilfe der marketingpolitischen Instrumente zu realisieren sind (vgl. WEIS, 1990, S. 40/41 ; BRUHN, 1997, S. 55 ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 151). Im einzelnen lassen sich die Marktfeld-, Marktstimulierungs-, Marktparzellierungs-, Marktareal- und konkurrenzorientierte Strategien unterscheiden. Die Marktfeldstrategien stellen dar, welche Dienstleistungen auf welchen Märkten angeboten werden ("Fixierung der Produkt-MarktKombination"), Marktstimulierungsstrategien erläutern, wie die ausgewählten Marktfelder beeinflußt werden sollen ("Bestimmung der Art und Weise der Marktbeeinflussung"). Marktparzellierungsstrategien geben vor, wie differenziert der Markt bearbeitet werden soll ("Festlegung von Art bzw. Grad der Marktbeeinflussung"), Marktarealstrategien machen Aussagen zum Marktgebiet, das fokussiert werden soll ("Bestimmung des Markt- bzw. Absatzgebietes"). Diese vier Strategienarten werden auch allgemein als "Basisoder Grundsatzstrategien" bezeichnet (vgl. ausführlich BECKER, 1992, S. 121 ff.). Die konkurrenzorientierten Marketingstrategien nehmen dagegen eine besondere Rolle ein. Aufgrund der Steigerung der Konkurrenzintensität auf vielen Märkten werden Entscheidungen im Bereich der vier skizzierten Grundsatzstrategien zunehmend vor dem Hintergrund getroffen, Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten zu erzielen. Mit anderen Worten, es erfolgt eine "Festlegung der Art der zu realisierenden Wettbewerbsvorteile" (vgl. SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 29). Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Alternativen der Marketingstrategien. Tab. 2: Möglichkeiten des strategischen Handelns Strategieebenen 1. Marktfeldstrategien 5. Konkurrenzorientierte Strategien 2. Marktstimulationsstrategien (Kostenführerschaft, Abhebungsstrategie Strategiealternativen Marktdurchdringungsstrategie Marktentwicklungsstrategie Präferenzstrategie Produktentwicklungsstrategie Diversifikationsstrategie Preis-Mengen-Strategie 3. Marktparzellierungsstrategien Anpassungsstrategie, Ausweichstrategie, 4. Marktarealstrategien Kooperationsstrategie, Rückzugsstrategie) Massenmarktstrategie (totale) (partielle) Lokale Strat. Segmentierungsstrategie (totale) (partielle) Regio- Überregionale Nationale Multinationale Internationale nale Strat. Strat. Strat. Strat. Strat. Quelle: In Anlehnung an BECKER, 1992, S. 309 ; SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 29, 48 f. 3.3.2 Operatives Marketing Im Anschluß an die Erarbeitung der marktbezogenen Ziele und Strategien erfolgt für deren Umsetzung die konkrete Ausgestaltung der marketingpolitischen Instrumente, die als die taktische Komponente einer Marketingkonzeption gelten (vgl. MEFFERT, 1986, S. 116). Es handelt sich hierbei um die laufenden, kurzfristig wirkenden und relativ leicht korrigierbaren Maßnahmen, mit deren Hilfe die erfolgsrelevanten Zielgruppen 8 im Sinne der strategischen Vorgaben beeinflußt werden sollen (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 155 ; SCHARF/ SCHUBERT, 1997, S. 28/29). Die Kombination dieser Einzelmaßnahmen bezeichnet man als Marketing-Mix, das im Allgemeinen in die vier klassischen Instrumente Angebots-, Distributions-, Kontrahierungs- und Kommunikationspolitik differenziert wird (vgl. BECKER, 1992, S. 459 ff. ; KOTLER/BLIEMEL, 1995, S. 141 ff.): 8 Siehe auch Abschnitt 3.5 dieses Kapitels, „Erfolgsrelevante Zielgruppen“. Die Angebotspolitik umfaßt alle Aktivitäten, die die Gestaltung einzelner Dienstleistungen oder das gesamte Dienstleistungsprogramm betreffen. Zentrale Inhalte dieses Kernbereiches des Marketing-Mix sind zum einen die Definition von Umfang und Art der Dienstleistungen, d. h., der Breite und Tiefe des Angebotsprogrammes, und zum anderen die kontinuierliche Optimierung der Dienstleistungsqualität 9(vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 166 169). Da Dienstleistungen ebenso wie Sachgüter einem Lebenszyklus unterliegen und somit veraltern oder schlicht unnützlich werden, müssen zudem neue Dienstleistungen eingeführt oder existierende verändert bzw. ersetzt werden (Innovation, Variation, Elimination: vgl. KOTLER, 1978, S. 169 ff. ; BRUHN/TILMES, 1994, S. 107). 9 Zum Thema Dienstleistungsqualität siehe auch Abschnitte 3.4 und 4.7. Zur Distributionspolitik gehören alle Entscheidungen, die sich auf den Weg der Dienstleistung zum Konsumenten, d. h., auf die Festlegung der Absatzwege, der physischen Verteilung (Marketing-Logistik) und der betrieblichen Standorte, beziehen (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 250). Die Maßnahmen zur Distribution zielen also darauf ab, daß die Dienstleistungen im richtigen Zustand, am richtigen Ort, in der richtigen Menge und zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen (vgl. BRUHN/TILMES, 1994, S. 194). Da die Erbringung der Dienstleistungen durch Altenund Pflegeheime in direkter Abhängigkeit zu der Anwesenheit des Bewohners bzw. Kunden steht (Kundenpräsenzbetriebe), kann folglich weniger von klassischer Distribution als vielmehr von genereller Erreichbarkeit gesprochen werden. Im wesentlichen geht es darum, den verschiedenen Zielgruppen die physische, zeitliche und informatorische Erreichbarkeit der Leistungen so weit wie möglich zu ermöglichen (vgl. PETERS, 1995, S. 61 ; MAYER, 1996, S. 47/48). Die Kontrahierungspolitik beinhaltet die vertraglichen Vereinbarungen im Hinblick auf das Leistungsangebot, also die Transaktionsbedingungen. Hierzu zählen neben der Festlegung der Art und Höhe der Leistungsentgelte die Gestaltung preisähnlicher Maßnahmen, den Konditionen, wie beispielsweise Rabatte, Zahlungsbedingungen und Finanzierungsangebote (vgl. MEFFERT, 1986, S. 118/119). Ziel der Kontrahierungspolitik ist es, die Wahrnehmung der Relation zwischen Preis und Nutzenstiftung einer Dienstleistung durch die Zielgruppen dahingehend zu verändern, daß diese die Angemessenheit des Preis-Leistungs-Verhältnisses besser abschätzen können (vgl. HILKE, 1989, S. 21 ; SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 134). Zur Kommunikationspolitik werden schließlich sämtliche Maßnahmen zusammengefaßt, die dem Informationsaustausch zwischen dem Unternehmen und seinen aktuellen und potentiellen Kunden sowie Mitarbeitern dienen. Sie zielt darauf ab, Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber dem Heim und dessen Leistungsfähigkeit systematisch zu beeinflussen. Die Kommunikationspolitik gilt deshalb auch als "Sprachrohr" des Marketings, da es ihre Aufgabe ist, auf die anderen drei Bereiche des Marketing-Mix aufmerksam zu machen und deren Transparenz im Pflegemarkt zu erhöhen. Hierfür stehen einem Dienstleistungsunternehmen sowohl Instrumente der unpersönlichen (Massen-) Kommunikation als auch Maßnahmen des persönlichen Dialogs, zum Beispiel in Form der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und des Sponsorings, zur Verfügung (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 287 ; BRUHN, 1997, S. 32 ; SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 53). 3.3.3 Marketingkontrolle Entsprechend anderen Managementfunktionen unterliegen auch die Marketingaktivitäten einem Kontrollprozeß, d. h., alle marktbezogenen Prozesse müssen kontinuierlich und systematisch überprüft und beurteilt werden. Hierbei erfolgt ein Vergleich der anvisierten Ziele und festgelegten Standards mit den aktuellen Werten (Ist-Zustand) vorwiegend mit Hilfe der Jahresplan-, der Aufwands- und Ertrags-, der Strategie- sowie der Effizienzkontrolle, um bei Abweichungen frühzeitig adäquate Korrekturmaßnahmen einleiten zu können (vgl. KOTLER, 1978, S. 249 ; KOTLER/BLIEMEL, 1995, S. 1149 ff.). Die nachstehende Abbildung gibt abschließend einen Überblick über den Marketingentscheidungsprozeß und dessen einzelner Phasen. Abb. 1: Marketing als Managementprozeß Quelle: In Anlehnung an BRUHN, 1997, S. 40 3.4 Qualitätsmanagement Unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung der Alten- und Pflegeheime zur Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen (vgl. § 93 BSHG und § 80 SGB XI) ist die zentrale Bedeutung der Qualität von Dienstleistungen als strategischer Erfolgsfaktor heute mehr oder weniger unbestritten. Zeitgemäßes Qualitätsmanagement und Unternehmenserfolg stehen in direkter Korrelation. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten beeinflußt die Qualität des Angebotes maßgeblich die Entscheidung des Kunden, ein Dienstleistungsunternehmen in Anspruch zu nehmen (vgl. CORSTEN, 1997, S. 292). 3.4.1 Qualitätsbegriff "Qualität" bezeichnet allgemein die Beschaffenheit oder Eigenschaft eines Gegenstandes oder einer Handlung. Darüber hinaus steht der Begriff für die Bedeutung Wert oder Güte (vgl. DUDEN, 1990, S. 654). Nach der DIN-Norm ist Qualität die "Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen" (GRODE, 1993, S. 310/311). Diese beiden, in erster Linie auf Sachgüter bezogenen Definitionsansätze sind jedoch wenig hilfreich bei der Identifizierung der Dienstleistungsqualität. Sie lösen aufgrund der komplexen Vorgänge in Alten- und Pflegeheimen eher Unsicherheit oder sogar Verwirrung aus. Am Beispiel der Dienstleistung Pflege formulierte DONABEDIAN deshalb bereits 1968, daß "Qualität der Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten Pflege ist" (BÜSE, 1996, S. 34). Allgemeiner gefaßt, kann unter Dienstleistungsqualität der Grad der Übereinstimmung zwischen der erbrachten Dienstleistung und den bestehenden Kriterien für diese Dienstleistung verstanden werden (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 200). Diese produktionswirtschaftliche bzw. produktbezogene Sichtweise wird aber in der Regel als zu einseitig angesehen und deshalb um eine marketing- bzw. kundenorientierte Betrachtung erweitert. Die durch potentielle Kunden an eine Dienstleistung gestellten Qualitätsansprüche sowie die qualitative Beurteilung der in Anspruch genommenen Leistungen beeinflussen ebenfalls das Qualitätsverständnis. Qualität kann also als das Maß der Übereinstimmung der Eigenschaften einer Dienstleistung hinsichtlich der individuellen Nutzenerwartungen eines Kunden bzw. als der Grad der Übereinstimmung zwischen Qualitätserwartung und Qualitätswahrnehmung bezeichnet werden (vgl. MEFFERT, 1994, S. 129). Allgemein gesagt liegt die Qualität von Dienstleistungen in der Erfüllung der Anforderungen und Ansprüche und dem Erreichen einer möglichst hohen Verwertbarkeit der erbrachten Leistungen. Ziel eines Dienstleistungsunternehmens muß deshalb ein hoher Grad der Kongruenz zwischen Leistung und den dafür von Seiten der Kunden festgelegten Kriterien bzw. eine marktund situationsgerechte Leistungserbringung und -verwertung sein, Dienstleistungsqualität ist somit eine kontinuierliche Größe. 3.4.2 Dimensionen der Dienstleistungsqualität Die Vielschichtigkeit und Mehrdimensionalität des Qualitätsbegriffes erfordern dessen Operationalisierung, um die Evaluierbarkeit der einzelnen Dienstleistungen gewährleisten zu können. Im folgenden werden die beiden für den Bereich der sozialen Dienstleistungen allgemein anerkannten Konzepte von DONABEDIAN und PARASURAMAN et al. beschrieben, für weitergehende Ansätze sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (vgl. ausführlich unter anderem CORSTEN, 1997, S. 294 ff. ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 236 ff.) DONABEDIAN nimmt eine Kategorisierung der Qualität analog zu den Dimensionen der Dienstleistung (Siehe auch Abschnitt 3.2., „Besonderheiten von Dienstleistungen“) vor und unterscheidet zwischen Struktur-, Prozeßund Ergebnisqualität, wobei die letztere in direkter Abhängigkeit zu Struktur- und Prozeßqualität steht (vgl. CORSTEN, 1997, S. 295/296). Infolgedessen beinhaltet die Strukturqualität die Frage, ob das Alten- und Pflegeheim von seinen Ressourcen her in der Lage ist bzw. das Potential besitzt, die versprochenen Dienstleistungen zu erbringen. Die Prozeß- oder Verrichtungsqualität umfaßt den eigentlichen Vorgang der Erbringung der Dienstleistung, während sich die Ergebnisqualität auf das Resultat der Dienstleistung, also das Wohlbefinden, den Gesundheitszustand und den Zufriedenheitsgrad des Kunden, bezieht. Die Ergebnisebene stellt somit den primären Maßstab für die angemessene oder unzureichende Qualitätsausprägung einer Dienstleistung dar. Einen weiteren Ansatz, die Dienstleistungsqualität zu beschreiben, bilden die zentralen Bewertungsdimensionen der Dienstleistungsqualität aus Kundensicht nach PARASURAMAN, ZEITHAML und BERRY, die die folgenden fünf Faktoren im Rahmen von empirischen Untersuchungen ermittelten (vgl. KOTLER/BLIEMEL, 1995, S. 722/723 ; CORSTEN, 1997, S. 303 f.): Zuverlässigkeit: Hierunter wird die Fähigkeit verstanden, die versprochene Leistung verläßlich und präzise zu erbringen. Entgegenkommen: D. h., die Bereitschaft und Schnelligkeit, dem Nachfrager bei der Lösung seines Problems zu helfen. Souveränität: Hierunter fällt die Fachkompetenz und das Verhalten der Mitarbeiter, sowie deren Vertrauenswürdigkeit. Einfühlungsvermögen: D. h., die Bereitschaft des Anbieters, sich um die individuellen Kundenwünsche zu kümmern. Materielles: Hierzu zählen die Einrichtung und Ausstattung sowie das Erscheinungsbild des Personals und der für die Öffentlichkeit gedachten Informationsmaterialien. Die Dienstleistungsqualität ergibt sich bei diesem Ansatz aus der Differenz zwischen Kundenerwartungen und Kundenwahrnehmungen. 3.4.3 Intention des Qualitätsmanagements Die Komplexität der Zusammenhänge um die Qualität von Dienstleistungen verlangt ein geplantes und systematisch organisiertes Qualitätsmanagement, das alle Schritte koordiniert und die einzelnen Bereiche und Tätigkeiten der Beschäftigten in einer Einrichtung miteinander abstimmt. Das Ergreifen nur einzelner Maßnahmen zur Qualitätssicherung, wie die Einführung von Standards oder die Weiterentwicklung der Pflegedokumentation, reicht für ein beständiges, den Anforderungen der Kunden entsprechendes Qualitätsniveau nicht aus (vgl. KALTENBACH, 1991, S. 144). Die Interaktion beispielsweise zwischen dem Pflegepersonal und den Bewohnern ist nur ein kleiner Ausschnitt des heiminternen Geschehens, das notwendig ist, um das Wohlbefinden der Bewohner positiv zu gestalten. Die unzähligen, teilweise auch im Hintergrund ablaufenden Aktivitäten der Verwaltung, der Küche und anderer sind für den Erfolg der Einrichtung und damit für die Zufriedenheit der Bewohner genauso wichtig. Deshalb sollte die Basis für eine umfassende Qualitätspolitik ein weit gefaßtes und mehrdimensionales Qualitätsverständnis sein, das neben der Qualität der einzelnen Dienstleistungen auch die Qualität der Prozesse bzw. Arbeitsabläufe, die Qualität der Arbeitsbedingungen und die Qualität der Umweltund Umfeldbeziehungen integriert. Damit dem Kunden eine ihn kontinuierlich überzeugende Dienstleistungsqualität angeboten werden kann, muß die Qualitätspolitik präventiv ausgerichtet sein. Diese Zielsetzung läßt sich heutzutage weitestgehend mit Hilfe eines Konzeptes im Sinne des "Total Quality Management" verwirklichen, das die einzelnen Subsysteme bzw. Elemente vernetzt und somit isolierten Teilkonzepten den Rücken kehrt (vgl. TÖPFER, 1994, S. 8 ff.). In diesem Zusammenhang bezeichnet "Totales Qualitätsmanagement" nicht eine kurzfristige Rationalisierungsmaßnahme oder einen Modetrend, sondern vielmehr ist hierunter, ebenso wie beim Marketing, ein Konzept der strategischen Unternehmensführung zu verstehen (vgl. OESS, 1993, S. 89), das auf den drei Prinzipien Null-Fehler-Ansatz, Kundenorientierung und System-Management basiert. Der Null-Fehler-Ansatz steht für das kontinuierliche Bemühen um eine Qualitätsoptimierung, präventiv Fehler zu vermeiden, und sich nicht bloß mit deren Behebung zu begnügen. Kundenorientierung sagt aus, daß die Beurteilung die durch interne und externe Kunden der Maßstab für die Qualität der Dienstleistung ist. Das System-Management beinhaltet die Verknüpfung der in einer Einrichtung auf allen Hierarchieebenen existierenden partiellen Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu einem ganzheitlichen Qualitätsmagementsystem und ihre zentralverantwortliche Koordination (vgl. KALTENBACH, 1991, S. 168 - 173). Ebenso wie das Marketing-Management-Konzept ist das Total Quality Management-Konzept somit als eine generelle Unternehmensphilosophie zu bezeichnen, die, entgegen einer oberflächlichen Betrachtung, nicht in Konkurrenz zum Marketing-Konzept steht. Die Kombination dieser beiden Philosophien kann vielmehr als geradezu ideal angesehen werden, da sich deren Inhalte gegenseitig bei der Realisation der Zielsetzung - die Kunden mit einem ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Dienstleistungsangebot zu überzeugen - unterstützen und ergänzen(vgl. STAUSS, 1994, S. 149 - 159). 3.4.4 Merkmale des Qualitätsmanagements Zur Verdeutlichung des Wirkungskreises und des Wesens des Qualitätsmanagements werden dessen Charakteristika übersichtartig dargestellt (vgl. KAMISKE/BRAUER, 1995, S. 243 - 247 ; BRUHN, 1996, S. 160): ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Qualität ist das oberste, ständig neu zu definierende Ziel der Einrichtung. Es sind Visionen zu entwickeln, wie die Einrichtung in Zukunft arbeiten soll (Qualitätspolitik, -ziele). Die Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse der Kunden wird als Maßstab für die Qualität angesehen (Kundenorientierung). Der ständige Prozeß der Anpassung an die Anforderungen und Erwartungen der Kunden wird sichergestellt. Führungskräfte kommen ihrer Vorbildfunktion nach und setzen sich überzeugend für die Qualität ein. Sie zeigen ein tolerantes, offenes und teamorientiertes Führungsverhalten. Die Meinung der Mitarbeiter wird akzeptiert und die Bereitschaft gefördert, kontinuierlich (aus Fehlern) zu lernen, gute Leistungen werden anerkannt. Es sind Bedingungen zu schaffen, in denen sich die Mitarbeiter und die Einrichtung weiterentwickeln können. Die Mitarbeiter aller Hierarchieebenen sind zu integrieren und zu beteiligen, z. B. durch die Einführung von Qualitätszirkeln, damit die Visionen von allen Mitarbeitern mit Leben gefüllt werden (Mitarbeiterorientierung). Qualität wird als Aufgabe sämtlicher Mitarbeiter und nicht nur einzelner Bereiche verstanden. Qualität bedeutet die Anerkennung von serviceorientiertem Verhalten. Es sind Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Teamarbeit und Engagement unterstützen und die Umsetzung von Ideen und Projekten ermöglichen. Die kontinuierliche Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter wird gefördert. Die Arbeitsabläufe werden optimiert (Prozeßorientierung). Präventive, fehlervermeidende Maßnahmen müssen betont werden. Qualitätsförderung und -verbesserung wird als ein langfristiger Prozeß, der nur über Zwischenschritte zu realisieren ist, betrachtet. 3.5 Erfolgsrelevante Zielgruppen Entgegen der oftmaligen Ansicht, daß sich die Marketingaktivitäten vorwiegend auf die aktuellen und potentiellen Bewohner als die Bedarfsträger beschränken, beeinflussen darüberhinaus noch andere Zielgruppen den Erfolg des Dienstleistungsunternehmens Alten- und Pflegeheim. Im einzelnen handelt es sich um die folgenden, in Interaktion miteinander stehenden Zielgruppen, die auch als Teilöffentlichkeiten bezeichnet werden können: Von besonderer Bedeutung für ein Alten- und Pflegeheim sind zweifelsohne dessen hilfe- und pflegebedürftigen Bewohner. Werden ihre Anforderungen und Bedürfnisse nicht im ausreichenden Maße zufriedengestellt, besteht das Risiko, daß zumindest ein Teil in eine andere Einrichtung umzieht. Ihre positiven oder negativen Eindrücke und Erfahrungen multiplizieren sie zudem in einer Art Mundpropaganda in ihr soziales Umfeld und beeinflussen damit die Einstellung dieses gegenüber dem Heim (vgl. KOTLER, 1978, S. 307). In diesem Zusammenhang sollten außerdem die Angehörigen der Bewohner bedacht werden, da diese in der Regel einen großen Einfluß im Hinblick auf den möglichen Ein- oder Auszug besitzen. Ähnlich verhält es sich mit potentiellen Interessenten und deren Angehörigen. Überzeugt sie das Alten- und Pflegeheim mit seinem Angebot nicht, orientieren sie sich in Richtung anderer Mitbewerber. Eine weitere relevante Gruppe stellen die die Heimbewohner behandelnden niedergelassenen Ärzte dar, die in Bezug auf das Heim zwei verschiedene Rollen inne haben. Einerseits betreuen sie als Hausarzt ihre Patienten und sind dementsprechend beispielsweise dafür verantwortlich, Medikamente oder spezielle Materialien für die Behandlungspflege zu rezeptieren. Andererseits fungieren sie auch als Multiplikator, da sie von ihren älteren Patienten und deren Angehörigen oftmals hinsichtlich einer Heimunterbringung und der Auswahl einer Einrichtung um eine Beratung gebeten werden, die bei einer guten Zusammenarbeit mit dem Heim und einem überzeugenden Qualitätsniveau für dieses positiv ausfallen dürfte (vgl. THILL, 1996, S. 106). Als eine zusätzliche Zielgruppe können außerdem die Finanzierungsträger betrachtet werden, die sich in erster Linie aus den Pflege- und Krankenkassen sowie dem Sozialhilfeträger zusammensetzt. Gerade im Hinblick auf die jährlich stattfindenden Pflegesatzverhandlungen sollte das Dienstleistungsunternehmen Alten- und Pflegeheim kontinuierlich daran interessiert sein, seine Kompetenz gegenüber diesen Institutionen zu verdeutlichen. Als letzte erfolgsrelevante externe Zielgruppe gilt die Gemeinde, in der das Heim angesiedelt ist. Zu diesem Bereich, der sich nicht nur auf die politisch abgegrenzte Kommune bezieht, zählen alle übrigen Personen und Institutionen sowohl der fachlichen als auch der allgemeinen Öffentlichkeit wie zum Beispiel Besucher, Politiker, Medien, Bildungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Sponsoren, Behörden, Krankenhäuser und der Medizinische Dienst der Krankenversicherung. Diese sind dadurch gekennzeichnet, daß sie als Meinungsbildner oder Multiplikatoren die Ansichten und Einstellungen der Öffentlichkeit beeinflussen und damit auf die Akzeptanz bzw. Ablehnung des Heimes, der Mitarbeiter und des Leistungsangebotes einwirken können (vgl. FLECHTNER, 1996, S. 221 ; RIEGL, 1996c, S. 203). Erfolgsrelevant für Alten- und Pflegeheime sind jedoch nicht nur die beschriebenen externen Zielgruppen, sondern auch die Mitarbeiter, als die internen Adressaten des Marketings. Ihnen kommt im marketingorientierten Heim eine Schlüsselrolle zu, da sie diejenigen sind, die die Dienstleistungen meistens im unmittelbaren Kontakt zu den Bewohnern erbringen, deren Qualität von der Qualifikation, Motivation und Tagesform jedes einzelnen Mitarbeiters abhängig ist (vgl. PETERS, 1995, S. 54). Ihr Auftreten und Verhalten beeinflussen somit entscheidend den Grad der Zufriedenheit der Bewohner. Die folgende Abbildung stellt die Zielgruppen des Marketings noch einmal in der Übersicht dar: Abb. 2: Zielgruppen des Heim-Marketings 4.Mögliche Gestaltung des Marketings in Alten- und Pflegeheimen In diesem Kapitel werden anhand ausgewählter Instrumente des Marketingkonzeptes Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Marketingaktivitäten in Alten- und Pflegeheimen unter Berücksichtigung der im zweiten Kapitel beschriebenen Rahmenbedingungen gestaltet werden können. 4.1 Marketingsituationsanalyse Grundlage einer erfolgreichen Marketingarbeit bildet die regelmäßige Erhebung von relevanten Informationen über die Situation des Unternehmens Alten- und Pflegeheim sowie die Marktgegebenheiten bzw. Umfeldsituation. 4.1.1 Unternehmensebene Die Unternehmensanalyse verfolgt das Ziel, Erkenntnisse über die internen Rahmenbedingungen und damit über die Stärken und Schwächen der Einrichtung zu gewinnen. Im Zentrum der Untersuchung steht das eigene Leistungsprogramm und die Einschätzung von dessen Qualität bzw. die Zufriedenheit der Zielgruppen mit diesem (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 105 ff.). Um eine Einseitigkeit der Beurteilung zu verhindern, plädiert RIEGL in diesem Zusammenhang dafür, ein Stärken-Schwächen-Profil u. a. aus Sicht der Unternehmensführung, der Bewohner und der Mitarbeiter zu erstellen (vgl. 1993, S. 52). Besonders interessieren hierbei zum einen die Gründe für die positive oder negative Bewertung einzelner Aspekte, wie beispielsweise organisatorische, personelle, bauliche oder finanzielle Umstände, und die daraus abzuleitenden Anforderungen der Zielgruppen, zum anderen eventuelle gegenseitige Kompensationswirkungen zwischen Stärken und Schwächen (vgl. MAYER, 1996, S. 127). Neben dem Leistungsspektrum liegt ein weiteres Augenmerk auf der Ressourcenanalyse. Auf der Basis der Pflege-Buchführungsverordnung11lassen sich mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung das betriebswirtschaftliche Ergebnis der einzelnen Dienstleistungen12 und damit die Kostenstruktur und Kapitalausstattung feststellen (vgl. BRUHN, 1997, S. 28). Die Ermittlung des Einzugsgebietes, differenziert in Kern-, Rand- und Fernzone, kann als ebenso bedeutsam angesehen werden, da sich hierüber das Streugebiet der Marketingaktivitäten definieren läßt (vgl. THILL, 1996, S. 49/50). Darüber hinaus sollten personalpolitische Aspekte ebenfalls in die Betrachtungen einbezogen werden. Im Vordergrund stehen hier Fragen nach Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter, der Fluktuationsrate, dem Qualitätsbewußtsein sowie nach Existenz und Ausmaß der Motivation, marktorientiert zu denken und zu handeln (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 452). 11 Weitere Informationen zur Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) finden sich unter anderem bei KLIE, 1996, S. 466 ff. 12 In diesem Zusammenhang sei auf die Zeiterfassung einzelner pflegerischer Handlungen hingewiesen, mit der identifiziert werden kann, bei welchen Leistungen ein hoher oder niedriger Deckungsbeitrag erwirtschaftet wird (vgl. BEA u. a., 1993, S. 489 f.). 4.1.2 Ebene des Umfeldes Die Analyse des Unternehmensumfeldes zielt darauf ab, die regionale bzw. lokake Marktsituation transparent zu machen, um die Chancen und Risiken des Pflegemarktes für die eigene Einrichtung auf der Grundlage der festgestellten Stärken und Schwächen beurteilen zu können. Zu diesem Zweck wird zunächst die Nachfrageseite im Hinblick auf ihre demographischen und psychographischen Daten, die in der Regel mit Hilfe kommunaler Pläne zur Altenhilfe zu ermitteln sind, betrachtet, um eine Orientierung über die Struktur der Nachfrage, Vorstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse zu erhalten (vgl. BRUNS, 1996, S. 32 ; MAYER, 1996, S. 132). Anhand der demographischen Daten läßt sich für das Alten- und Pflegeheim ableiten, wie sich der Anteil der älteren, vor allen Dingen alleinstehenden sowie hilfe- und pflegebedürftigen Menschen entwickeln wird (prognostizierter Bedarf) und wo Wohngebiete mit einem hohen Altenanteil zu finden sind. Von weiterem Interesse sind unter anderem Angaben zum Geschlecht, zur Religionszugehörigkeit, zu den Einkommensverhältnissen, zur Schul- und Berufsausbildung sowie zum Umfang der potentiellen Hilfe- bzw. Pflegebedürftigkeit. Der zweite Bereich, die psychographischen Daten, beschreibt dagegen die Erwartungen und Bedürfnisse der potentiellen Kunden bzw. Heimbewohner, deren Erfahrungen, Einstellungen gegenüber dem generellen Dienstleistungsangebot und Motive für die Inanspruchnahme von sozialen Dienstleistungen. Aufgabe der Marktanalyse ist es jedoch nicht nur, die Nachfrageseite zu betrachten, sondern ebenfalls die Konkurrenzsituation zu untersuchen. Dazu werden in einem ersten Schritt die Konkurrenten mit Blick auf Anzahl, Leistungsspektrum und -tiefe, Leistungsprofil, Marktstellung, möglicher Dienstleistungsqualität und Kooperations- bzw. Wettbewerbsverhalten identifiziert (vgl. BEEK, 1996, S. 94 ; THILL, 1996, S. 55 - 58 ; BRUHN, 1997, S. 28). Zur genaueren Bestimmung der Marktposition empfiehlt es sich außerdem, die jeweiligen Marktanteile für jede einzelne Einrichtung und jeden einzelnen Leistungsbereich zu ermitteln (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 82). In einem zweiten Schritt schließt sich ein Vergleich des eigenen im Rahmen der Unternehmensanalyse ermittelten Marketingprofils bzw. Potentials mit den Ergebnissen der Anbieteranalyse, insbesondere der der Hauptkonkurrenten, an13, um die eigene Wettbewerbsposition differenzierter beschreiben zu können und Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen zu erhalten (vgl. MEFFERT, 1986, S. 134). Einen zusätzlich zu berücksichtigenden Aspekt stellen die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben dar. Neben den einschlägigen Gesetzen sollten zudem die kommunalpolitischen Zielsetzungen bezüglich der Altenhilfe, die Forderungen lokaler, regionaler und überregionaler Interessenvertretungen älterer Menschen sowie die Anforderungen von Seiten der Pflege- und Krankenkassen beachtet werden. 13Dieses Vorgehen wird auch als „Benchmarking“ bezeichnet, vgl. ausführlich unter anderem KARLÖF, 1994. 4.1.3 Methoden der Informationsgewinnung Zum Zwecke der Informationsgewinnung bieten sich dem Alten- und Pflegeheim die Methoden der Sekundärund Primärerhebung an. Bei der Sekundärforschung werden bereits zu einem früheren Zeitpunkt unter einer anderen Zielsetzung gewonnene Daten aufbereitet und analysiert. Im Hinblick auf die Herkunft des Datenmaterials kann zwischen unternehmensinternen Informationsquellen, wie betriebliches Rechnungswesen, interne Statistiken oder frühere Studien, und unternehmensexternen Informationen, wie Veröffentlichungen der Statistischen Bundes- und Landesämter, von Ministerien, Bezirksregierungen, Kommunen und Fachverbänden, von Forschungsberichten oder Fachartikeln, unterschieden werden. Der Umfang dieser Informationen kann in den meisten Fällen für die Entscheidungsfindung als ausreichend bewertet werden (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 100 - 102). Für die Ermittlung von Kundeneinstellungen und -erwartungen müssen jedoch in der Regel neue Daten beschafft und aufbereitet und somit Primärforschung durchgeführt werden. Als Methoden kommen grundsätzlich die schriftliche, persönliche und telefonische Befragung in Betracht (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 97), auf deren Vor- und Nachteile an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann (vgl. ausführlich unter anderem BORTZ/DÖRING, 1995 ; ATTESLANDER, 1984). In diesem Zusammenhang sollte zudem bedacht werden, regelmäßig auf die Kenntnisse der Mitarbeiter zurückzugreifen, die im persönlichen Kontakt mit den verschiedenen Kundengruppen detaillierte Informationen beispielsweise zum Image des Heimes erhalten. Gerade im Hinblick auf ihre Einsicht in die Probleme und Ansprüche der Bewohner lassen sich in der Regel frühzeitig das Ausmaß der Unzufriedenheit und neue Bedürfnisse erkennen und somit wichtige Hinweise für die Verbesserung der Dienstleistungen ableiten (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 104). Allgemein empfiehlt sich bei der Durchführung von Befragungen die folgende Vorgehensweise (vgl. THILL, 1996, S. 65 - 72): ● ● ● ● ● ● ● ● Schritt 1: Definition der Zielgruppe und der Analyseziele Schritt 2: Festlegung der Befragungsmethode (schriftlich, telefonisch, persönlich) Schritt 3: Entwurf der Fragebogenstruktur (z. B. offene/geschlossene Fragen, Methode des semantischen Differentials) Schritt 4: Festlegung der Befragungsparameter (z. B. Zeitraum, Vorbereitung der Auswertung, Information der Mitarbeiter) Schritt 5: Durchführung eines Vorlaufes (Pretest) Schritt 6: Durchführung der Befragung Schritt 7: Auswertung der Befragung Schritt 8: Ableitung des Handlungsbedarfs Die nachfolgende Tabelle zeigt abschließend einige Beispielfragen zur Erhebung der Bewohnerzufriedenheit. Tab. 3: Mögliche Fragen an Heimbewohner zur Beurteilung der wahrgenommenen Qualität Dimension Fragen zur Ermittlung der Zufriedenheit Materielles - Welchen Eindruck macht der bauliche Zustand unserer Einrichtung auf Sie? - Sind die Zimmer/ Appartements bewohnergerecht ausgestattet? - Wie beurteilen Sie das äußere Erscheinungsbild unserer Mitarbeiter? - Sind schriftliche Mitteilungen verständlich formuliert? Zuverlässigkeit - Kommen unsere Mitarbeiter pünktlich zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt? - Nehmen sich die Pflegenden genügend Zeit für Sie? Entgegenkommen - Gibt es bei Problemen jemanden, den Sie ansprechen können und der daraufhin alles versucht, dieses Problem lösen zuhelfen? Souveränität - Sind Sie der Meinung, daß die Pflege fachgerecht ausgeführt wird? - Vertrauen Sie den Ratschlägen der Pflegenden? Einfühlungsvermögen - Haben Sie das Gefühl, unsere Mitarbeiter verstehen Ihre Situation und nehmen Anteil daran? - Können Sie den Mitarbeitern Ihre Beschwerden mitteilen? 4.2 Marketingstrategien Auf der Basis der abgeschlossenen Versorgungsverträge, die das Alten- und Pflegeheim dazu verpflichten, die vollstationäre Versorgung von Hilfe- und Pflegebedürftigen zu gewährleisten, erfolgt die Bestimmung der generellen strategischen Stoßrichtung, die die langfristige Realisation der Unternehmenszielsetzungen sicherstellen soll. Grundlegende Ansatzebenen einer Marketingstrategie liegen in der Auswahl der zu bearbeitenden Marktfelder (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 162). 4.2.1 Marktfeldstrategien Marktfelder bezeichnen Angebots-Nachfrage-Sektoren, in denen ein Unternehmen bestimmte Leistungen entweder bereits anbietet oder künftig anbieten will. Anhand der von ANSOFF 1966 entwickelten "ProduktMarkt-Matrix" können durch die Gegenüberstellung der alten und der neuen Produkte bzw. Dienstleistungen mit jeweils alten und neuen Märkten für ein Unternehmen generell vier verschiedene marktfeldstrategische Optionen aufgezeigt werden (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 135). Diese besitzen zugleich angebotpolitischen Charakter, da sie die Breite und Tiefe des Dienstleistungsangebotes sowie Entscheidungen über die Modifikation von Dienstleistungen direkt beeinflussen (vgl. WEIS, 1990, S. 160). Tab. 4: Produkt-Markt-Matrix nach ANSOFF Produkte Märkte gegenwärtig neu gegenwärtig Marktdurchdringung Marktentwicklung neu Produktentwicklung Diversifikation Quelle: BIEBERSTEIN, 1995, S. 135 Aufgrund der durch den Versorgungsvertrag gemäß § 72 SGB XI erfolgten Zulassung des Alten- und Pflegeheimes als eine vollstationäre Dienstleistungen für Hilfe- und Pflegebedürftige nach § 43 SGB XI anbietende Einrichtung bildet der Markt der vollstationären Altenhilfe das grundlegende Marktfeld und somit den Ausgangspunkt der weiteren Betrachtungen. Auf der Grundlage dieser "marketingstrategischen Urzelle" (BECKER, 1992, S. 124) ergeben sich im Kontext der Produkt-Markt-Matrix von ANSOFF für das Unternehmen Alten- und Pflegeheim die folgenden Möglichkeiten, über die Ausdehnung des bisherigen Marktfeldes "Vollstationäre Versorgung, Pflege und Betreuung älterer Menschen" die Existenz der Einrichtung abzusichern (vgl. KOTLER, 1978, S. 166 ; Raffée u. a., 1994, S. 155/156). Marktdurchdringung: Im Rahmen dieser Strategie wird versucht, eine Absatzsteigerung dadurch zu realisieren, daß mit dem vorhandenen Angebot das latente Potential des gegenwärtigen Marktes aktiviert wird. Um diese Zielsetzung, also verstärkte Inanspruchnahme der Dienstleistungen über die Gewinnung neuer Kunden bzw. Bewohner, zu erreichen, sollten die Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit forciert und, vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Images der Einrichtung eine beständig hohe Qualität der Dienstleistungen angestrebt werden. Marktentwicklung: Die Strategie der Marktentwicklung zielt darauf ab, das bisherige Leistungsangebot auf neue Märkte auszudehnen (vgl. SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 31). Beispiele hierfür sind die Erschließung neuer Marktsegmente wie das der Tages- und Nachtpflege (vgl. § 41 SGB XI), der Kurzzeitpflege (vgl. § 42 SGB XI) oder der stationären gerontopsychiatrischen Versorgung. Diese Strategie erscheint besonders für Heime geeignet, die ihre Marktposition nicht mehr weiter ausbauen können und eventuell mit einem Nachfragerückgang aufgrund eines fortgeschrittenen Angebotslebenszyklus rechnen müssen. In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, daß ein solcher Ausbau des Leistungsangebotes stets adäquate personelle Maßnahmen nach sich zieht. Angebotsentwicklung: Diese Strategie basiert auf der Überlegung, für den gegenwärtigen Markt neue Dienstleistungen zu entwickeln. Neben der Schaffung von Angeboten im Sinne von echten Neuheiten bietet sich als Alternative eine Programmerweiterung durch das Angebot zusätzlicher Dienstleistungsvarianten (Erweiterung der Angebotstiefe) an. Infolge der noch andauernden Verhandlungen der Rahmenverträge nach § 75 SGB XI und der damit fehlenden gesetzlichen Grundlage kann momentan keine eindeutige Abgrenzung zwischen den Grund- und Komfortleistungen, für die der Bewohner selbst aufzukommen hat, vorgenommen werden, so daß sich die Umsetzung dieses Ansatzes in der Praxis recht schwierig gestaltet. Als Beispiele können hier jedoch Angebote wie Urlaubsfahrten für die Bewohner oder Sprachkurse angesehen werden. Zudem besteht auf der Basis des § 45 SGB XI die Möglichkeit, Schulungskurse für die Angehörigen der Bewohner anzubieten, um deren Verständnis für die Pflegesituation zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, wenn der Pflegebedürftige sie besucht, diesen entsprechend versorgen zu können (Im Falle eines Besuches durch den Pflegebedürftigen.). Diversifikation: Die Diversifikationsstrategie ist dadurch gekennzeichnet, daß neue Dienstleistungen in neuen Märkte angeboten werden (Erweiterung der Angebotsbreite). Diese Strategie sollte ein Heim besonders in Betracht ziehen, sobald Anzeichen zu erkennen sind, daß der Markt der stationären Altenhilfe gesättigt oder sogar übersättigt erscheint (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 138). Je nach Grad der mit dieser Strategie intendierten Risikostreuung der unternehmerischen Tätigkeit lassen sich die horizontale, vertikale und laterale Form unterscheiden (vgl. SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 85/86). Bei der horizontalen Diversifikation wird das bestehende Angebot um solche Leistungen erweitert, die eine Verwandtschaft zu den bisherigen Leistungen aufweisen, es erfolgt somit der Aufbau einer horizontalen Leistungskette (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 138). Möglichkeiten für ein Heim sind hier zum einen in der Gründung eines ambulanten Pflegedienstes, der ambulante Pflegeleistungen nach § 36 SGB XI und § 37 Abs. 1 und 2, häusliche Pflegeberatung nach § 37 Abs. 3 und Schulungskurse nach § 45 SGB XI anbietet, zum anderen im Betreutem Wohnen, Essen auf Rädern oder Hausnotruf zu sehen. Die vertikale Diversifikation beinhaltet die Ausweitung des Programmes um Leistungen, die den bisherigen Leistungen vor- oder nachgeschaltet sind. Für den Bereich der stationären Altenhilfe findet diese Form jedoch infolge ihres unbedeutenden und unrealistischen Charakters keine Anwendung (vgl. BECKER, 1992, S. 142). Von lateraler Diversifikation wird gesprochen, wenn zwischen den bisherigen und neuen Leistungen kein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierbei läßt sich beispielsweise an die Gründung eines Catering-Party-Services, eines Fortbildungsinstituts, eines Taxi-Services oder an die Einrichtung eines Hotel-Garni denken (vgl. RIEGL, 1996c, S. 328). 4.2.2 Präferenzstrategie Infolge der stärker werdenden Wettbewerbsintensität ist das Alten- und Pflegeheim in zunehmendem Maße gezwungen festzulegen, wie der anvisierte Markt zugunsten des Heimes beeinflußt und damit die Nachfrage stimuliert werden kann. Aufgrund der normierten Pflegesätze stellt die sogenannte Präferenzstrategie dabei eine realistische Vorgehensweise dar. Über den Aufbau von Leistungspotentialen bzw. die Schaffung von Qualitätsvorteilen, die bei den Kunden zu Präferenzen für die Einrichtung führen, wird beabsichtigt, einen Wettbewerbsvorsprung zu erreichen. Als das bedeutendste Profilierungsinstrument im Wettbewerb zwischen den Heimen gilt in diesem Zusammenhang die Dienstleistungsqualität in Verbindung mit einem hohen Serviceniveau (vgl. MEFFERT, 1994, S. 14 u. 129). Entscheidend für den Erfolg dieses präferenzstrategischen Ansatzes ist allerdings, daß die von den Kunden erwartete und gewünschte Qualität stets erreicht bzw. übertroffen wird. Konkret bedeutet dies, daß das individuelle Eingehen auf den Kunden bzw. Bewohner und auf dessen Bedürfnisse in physischer und psychischer Hinsicht im Vordergrund der Gestaltung der Leistungsprozesse steht. Den Mitarbeitern kommt somit innerhalb der Präferenzstrategie eine besondere Bedeutung zu, da sie nicht nur im Kontakt mit den Bewohnern die Dienstleistungen erbringen, sondern darüberhinaus von diesen als fester Bestandteil der Dienstleistungen identifiziert werden (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 143). 4.2.3 Kooperationsstrategie Für das Unternehmen Alten- und Pflegeheim ist die Frage, ob die Marketingstrategien alleine oder zusammen mit einem oder mehreren anderen Unternehmen realisiert bzw. umgesetzt werden, ebenfalls von grundsätzlicher Bedeutung. Das heißt, daß die Unternehmensführung zwischen den Alternativen zu entscheiden hat, das gesamte Dienstleistungsangebot selbst zu erbringen oder einzelne Leistungen durch externe Dienstleistungsunternehmen erbringen zu lassen (Make-or-buy-Entscheidung) und somit eine Kooperation einzugehen. Unter Kooperationen versteht man in diesem Zusammenhang die systematische Zusammenarbeit mit anderen, konkurrierenden Unternehmen unter Beibehaltung der eigenen Selbständigkeit (vgl. SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 51). Allgemein bietet sich dem Heim die Möglichkeit der schriftlich oder mündlich vereinbarten Zusammenarbeit mit anderen Anbietern auf dem Pflegemarkt (horizontale Kooperation) und der mit Unternehmen aus anderen Branchen (vertikale Kooperation) an (vgl. SCHWINN, 1993, S. 197 ; BIEBERSTEIN, 1995, S. 153). Die Vorteile der Kooperation beispielsweise mit anderen ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen sind zum einen darin zu sehen, daß auf die Stärken und besonderen Kenntnisse der einzelnen Kooperationspartner zurückgegriffen werden kann, zum anderen können in der Regel der Wettbewerbsdruck reduziert sowie Synergieeffekte durch gemeinsame Marketingmaßnahmen erzielt werden (vgl. SIEBER, 1996, S. 18). Beispiele für die vertikale Kooperation sind die Zusammenarbeit mit Wäschereien oder Gebäudereinigungsfirmen, die im Auftrag des Heimes bestimmte Leistungsbereiche komplett übernehmen (Outsourcing). Vorteilhaft wirkt sich hierbei aus, daß diese Fachbetriebe zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung beitragen können, da sie aufgrund ihrer Spezialisierung über ein umfangreicheres Knowhow verfügen. Zudem erbringen sie die Leistungen in der Regel kostengünstiger als das Heim, so daß durch die Absenkung fixer Kosten bzw. die Einsparung von Ressourcen die wirtschaftliche Lage verbessert und damit die Reaktionsfähigkeit auf Nachfrageveränderungen vergrößert wird (vgl. GABLER, 1988, S. 2977). 4.3 Angebotspolitik Das Alten- und Pflegeheim muß, um sich im Wettbewerb des "Pflegemarktes" behaupten und den unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen sowie den vielfältigen Ansprüchen alter und pflegebedürftiger Menschen entsprechen zu können, ein umfangreiches und zugleich attraktives Dienstleistungsangebot vorhalten. Für alte und pflegebedürftige Menschen bedeuten der Einzug in ein Heim und das Leben in einem Heim immer eine große Veränderung, verbunden mit der Befürchtung, die sozialen Kontakte und die Selbständigkeit zu verlieren und auf viele Gewohnheiten und Möglichkeiten der Lebensgestaltung verzichten zu müssen. Um potentielle Bewohner für sich zu gewinnen und die Wünsche der momentanen Bewohner zufriedenzustellen, ist das Heim gefordert, ein, durch den Bewohner individuell abrufbares, Angebotsprogramm zusammenzustellen, das den hilfe- und pflegebedürftigen Menschen bei der Führung eines, den individuellen Umständen entsprechenden, normalen Lebens unterstützt sowie eine kompetente und flexible, die Persönlichkeit respektierende Versorgung verdeutlicht (vgl. HILKE, 1989, S. 17). Die durch das Heim zu erbringenden Dienstleistungen können den einzelnen Leistungsbereichen des Pflegerisch-betreuerischen-Leistungsprogrammes, des Unterkunfts- und Verpflegungsprogrammes, des Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogrammes sowie des Serviceleistungsprogrammes zugeordnet werden, deren Ausgestaltung im folgenden betrachtet wird: 4.3.1 Pflegerisch-betreuerisches-Leistungsprogramm Das Pflegerisch-betreuerische-Leistungsprogramm wird im wesentlichen durch die Vorgaben des SGB XI geprägt und gilt allgemein als das wichtigste Kernleistungsprogramm des Alten- und Pflegeheimes. Es beinhaltet sowohl die sogenannte Grundpflege bzw. allgemeine Pflege, die die Hilfen zur Körperpflege, Ernährung und Mobilität und die Betreuung umfaßt, als auch die Behandlungspflege (vgl. KLIE, 1996, S. 540 543). Der Umfang der Leistungserbringung richtet sich nach dem individuellen Gesundheitszustand bzw. dem Hilfe- und Pflegebedarf sowie den Wünschen des Bewohners. Da sich der Inhalt der Pflegeleistungen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bei allen Heimen gleich gestaltet, können das Qualitätsniveau der Pflege und die Atmosphäre, in der die Leistungserbringung erfolgt, im Hinblick auf die Profilierung gegenüber den Wettbewerbern als die zentralen Erfolgsfaktoren angesehen werden. Entscheidend ist, wie gepflegt wird und welchen Ruf die Einrichtung diesbezüglich in der Öffentlichkeit genießt. Die bei den Mitarbeitern vorherrschende Grundhaltung bzw. das Selbstverständnis ist somit von grundlegender Bedeutung. Um ein gleichbleibend hohes Niveau bei der Qualität der Dienstleistungsverrichtung zu erzielen, ist eine Handlungsorientierung für die Mitarbeiter in Form eines Pflegeleitbildes erforderlich, das durch ein einheitliches Pflegeverständnis eine konstante Pflegequalität gewährleisten soll und gleichzeitig die Grundlage weiterer qualitätssichernder Maßnahmen bildet. Je verständlicher, realistischer und detaillierter dieses Leitbild unter Mitwirkung der Mitarbeiter formuliert wird, desto größer ist die Chance, daß sich die Mitarbeiter mit diesem identifizieren können, es internalisieren und im Alltag motiviert beherzigen (vgl. TRILL, 1996, S. 23). Im einzelnen sollte deshalb ein Pflegeleitbild die folgenden Aspekte beinhalten (vgl. HELLIGE u. a., 1994, S. 234/235): ● ● ● ● ● ● ● ● Oberstes Gebot muß es sein, eine Haltung zu entwickeln, trotz aller körperlichen und geistigen Abbauvorgängen des Heimbewohners in diesem ein voll ausgebildetes, frei entscheidendes Wesen zu erkennen und zu respektieren. Grundlage der Arbeit bildet ein ganzheitlich verstandenes Menschenbild, das jeden Menschen in seiner Gesamtheit von Körper, Geist und Seele betrachtet. Das Menschenbildes wird bestimmt durch Wertschätzung, Anteilnahme und Akzeptanz jedes einzelnen Individuums. Statt einer Standardisierung wird die Individualisierung der Pflege gesetzt, an die Stelle funktionaler Arbeitszerlegung tritt die ganzheitliche Pflege, die nicht am, sondern mit dem Bewohner als integriertem Bestandteil stattfindet. Eine systematisch geplante Pflege läßt sich nur durch die Anwendung der Pflegeprozeß-Methode realisieren. Die Pflegeprozeß-Methode muß im Bezugsrahmen eines Pflegemodells stehen, da sie keine normativen Pflegevorgaben beinhaltet, sondern als ein Regelkreis zu verstehen ist. Das Pflegemodell ist der Orientierungsrahmen für die pflegerische Tätigkeit, es gibt Vorstellungen von dem, was Pflege bewirken kann bzw. soll. Voraussetzung für die Evaluation der Pflege ist ein praktikables, auf die Einrichtung zugeschnittenes Dokumentationssystem. Die Planung und Dokumentation der Pflegeleistungen wird wesentlich durch den Einsatz von Pflegestandards erleichtert. Diese haben nichts mit standardisierter Pflege zu tun, sondern dienen lediglich als Orientierungsschemata, anhand derer die individuelle Pflege des Bewohners geplant wird. ● ● ● Sie sollen einen gleichmäßigen Qualitätsstandard bezüglich der zu erbringenden Pflegeleistungen garantieren. Ganzheitliche Pflege kann nur mittels eines personal- und bewohnerorientierten Pflegesystems realisiert werden. Deshalb ist ein Organisationssystem wie die Bezugspflege anzustreben, das durch relativ stabile, sehr persönliche Beziehungen gekennzeichnet ist. Die funktionierende Zusammenarbeit innerhalb des Pflegedienstes und mit den anderen Bereichen des Heimes ist unerläßlich. Die regelmäßige Teilnahme aller Mitarbeiter an Fortbildungsmaßnahmen ist unumgänglich, um eine den sich ständig verändernden Anforderungen angepaßte Qualifikation zu erhalten und zu erweitern. 4.3.2 Unterkunfts- und Verpflegungsprogramm Im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes lassen sich unter dem Bereich "Unterkunft und Verpflegung" Bereitstellung und Reinigung des Wohnraumes, Wäscheversorgung, Speise- und Getränkeversorgung sowie Wartung und Unterhaltung der Einrichtung zusammenfassen (vgl. KLIE, 1996, S. 543/544). Für das Alten- und Pflegeheim existieren innerhalb dieses Kernleistungsbereiches eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben und Präferenzen in der Öffentlichkeit zu schaffen. Neben der allgemeinen baulichen Struktur und der Außenanlage des Heimes stellt das ausreichende Angebot von Einzelzimmern bzw. -appartements einen wichtigen Faktor dar, da die Mehrzahl der Bewohner nur ungern auf die eigenen vier Wände verzichten möchte. Um den vielfältigen Ansprüchen und der Vielschichtigkeit der Bewohner zu entsprechen, bietet es sich deshalb an, daß die Einrichtung mehrere übersichtliche, eine häusliche Atmosphäre ausstrahlende Pflege- bzw. Wohneinheiten mit unterschiedlichen Ein- oder Zweibettzimmern enthält, zwischen denen der Bewohner auswählen kann. Auf Wunsch sollte zusätzlich die Möglichkeit bestehen, das Zimmer selbst einzurichten, um sich dadurch die bisher vertraute Umgebung ein Stück weit bewahren zu können. Außerdem sollten alle Zimmer über eine seniorengerechte Naßzelle sowie eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia, Appartements zudem über eine Küchenzeile verfügen und mit entsprechenden Anschlüssen für Telefon, Radio und Fernsehen ausgestattet sein. Hinsichtlich der Verpflegung empfiehlt es sich, morgens und abends ein Buffet und mittags eine Menüauswahl in Form eines Komponentenessens anzubieten, um die differenzierten Bedürfnisse, angefangen von diätetischer bis hin zur vegetarischen Kost, der Bewohner abzudecken. Das Eingehen auf besondere Essenswünsche sollte ebenfalls eine Selbstverständlichkeit sein. Weiterhin sollte überlegt werden, den Bewohnern zu ermöglichen, Haustiere zu halten, da diese oftmals im Leben von alten Menschen als Weggefährte eine wichtige Rolle einnehmen. 4.3.3 Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogramm Mit der Institution Alten- und Pflegeheim assoziiert die Öffentlichkeit oftmals die Isolation der Bewohner vom gesellschaftlichen Leben und damit eine Ghettoisierung. Die Leistungsfähigkeit eines Heimes wird deshalb auch daran gemessen, wie abwechslungsreich es den Alltag seiner Bewohner gestaltet und welche Bemühungen es unternimmt, die sozialen Kontakte der Bewohner zu fördern und diese in das gesellschaftliche Umfeld zu integrieren. Der Zusammenstellung eines die Wünsche und Interessen der Bewohner berücksichtigenden Tages- und Freizeitprogrammes, das zugleich den beschäftigungstherapeutischen Anforderungen nach Erhaltung und Rückgewinnung der mentalen, manuellen und sozialen Fähigkeiten der Bewohner gerecht wird, kommt somit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang kann zwischen Angeboten, die normalerweise regelmäßig jede Woche stattfinden, und als Rahmenprogramm bezeichnet werden können, und zusätzlichen kulturellen und geselligen Veranstaltungen, die das "Standardprogramm" ergänzen, unterschieden werden. Im folgenden sind einige typische Angebote aufgeführt: Tab. 5: Veranstaltungsangebote Rahmenprogramm Kulturelle und gesellige Veranstaltungen - Kreatives Gestalten - Konzert-, Theaterbesuche - Schwimmen - Vorträge - Literaturkreis - Ausflugsfahrten - Gedächtnistraining - Besichtigungen - Klönnachmittag - Jahreszeitliche Feste - Singen, Malen, Basteln - Ferienfahrten - Spielkreise - Geburtstagsfeiern - Tanz - Kulinarische Abende - Gymnastik - Filmvorführungen - Gottesdienst, Morgenandacht 4.3.4 Serviceleistungsprogramm Die Serviceleistungen eines Alten- und Pflegeheimes dienen zum einen der Ergänzung der Haupt- bzw. Kernleistungen, insbesondere der Bereiche "Pflege und Betreuung" sowie "Unterkunft und Verpflegung", zum anderen der Schaffung einer dem "normalen" Leben ähnelden Umgebung, die den Bewohnern ermöglicht, ihrem früheren Leben vergleichbare Aktivitäten zu unternehmen (vgl. MAYER, 1996, S. 84). Dem Heim bietet sich über die Servicegestaltung die Chance, sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben und somit ein zusätzliches Differenzierungskriterium für die Kunden zu schaffen (vgl. BRUNS, 1996, S. 38). Ziel ist es somit, über das Vorhalten weiterführender attraktiver Leistungen Präferenzen bei den Kunden zu bewirken. Dem Heim sind in diesem Zusammenhang bei der Gestaltung dieses Bereiches allenfalls wirtschaftliche Grenzen gesetzt. Um die Vorhaltekosten für einzelne Serviceleistungen zu reduzieren und damit eine größere Anzahl an zusätzlichen Leistungen anbieten zu können, sollte versucht werden, ehrenamtliche Mitarbeiter in die Leistungserbringung zu integrieren. Als Einsatzfelder eignen sich hier insbesondere Bereiche, in denen eher die persönliche Zuwendung als die fachliche Hilfe Priorität genießt, hauptamtliche Mitarbeiter nicht finanzierbar wären oder für Dienstleistungen, die unentgeltlich erbracht werden, wie zum Beispiel Einkaufshilfe oder Spaziergänge (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 174). Folgende Angebote können in Betracht gezogen werden (vgl. MAYER, 1996, S. 83 - 86): ● ● ● ● ● Kiosk oder Minimarkt. Cafeteria, Bistro oder Restaurant. "Schalterstunden" eines Geldinstituts. Öffentliche Münz- oder Telefonkartenfernsprecher. Sprechstunden der Rentenversicherungsanstalten, Pflege- und Krankenkassen. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Briefmarkenverkauf, Briefkasten. Friseursalon, Medizinische Fußpflege. Physiotherapeutische Praxis. Ausgestaltung von persönlichen Feiern der Bewohner. Einkaufsservice (auch für Medikamente). Vermietung von Gästezimmern für die Besucher der Bewohner. Nähstube, die Ausbesserungsarbeiten der Kleidung übernimmt. Kapelle bzw. Andachtsraum. Hausbibliothek, die an eine öffentliche Bücherei angeschlossen ist. Fahrdienst. 4.4 Distributionspolitik Das Alten- und Pflegeheim gilt als standortgebunden, da die angebotenen Dienstleistungen nur im direkten Kontakt von Mitarbeitern und Bewohnern bzw. Kunden erstellt werden können, die Anwesenheit des Kunden am Ort der Leistungserstellung ist zwingend (vgl. HILKE, 1989, S. 24). Im Gegensatz zur klassischen Distribution, die den Transport eines Produktes oder den Weg einer Dienstleistung bestimmt, geht es für das Alten- und Pflegeheim im wesentlichen um die Distribution von Informationen, d. h., die Festlegung der Informationskanäle und -wege, die wie ein flächendeckendes Netz die Verfügbarkeit der Informationen sicherstellen (vgl. PETERS, 1995, S. 61/62). Hier bietet sich beispielsweise das Auslegen von Broschüren, Prospekten oder Faltern als Streuartikel in Arztpraxen, ambulanten Diensten und öffentlichen Verwaltungen an. Einen weiteren Aspekt bildet die sogenannte physische Erreichbarkeit des Heimes, also die infrastrukturelle Anbindung der Einrichtung. Neben einer Bushaltestelle in direkter Nähe sollte an einen Taxihaltestand sowie eine ausreichende Zahl an Parkplätze, eventuell auch an die Einrichtung eines Fahrdienstes des Hauses gedacht werden (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 426), um gerade Besuchern das Aufsuchen des Heimes zu ermöglichen. Die zeitliche Erreichbarkeit umfaßt die Sprechzeiten bestimmter Ansprechpartner bzw. die Öffnungszeiten der Verwaltung und anderer Bereiche, an denen die Kunden immer jemanden erreichen können (vgl. MAYER, 1996, S. 49). In diesem Zusammenhang besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Wartezeiten bis zum Einzug ins Heim dadurch zu reduzieren, indem bei einem Nachfrageüberhang ein anderes Heim, zu dem partnerschaftliche Beziehungen existieren, eingeschaltet wird, das auch seinerseits nicht zu erfüllende Aufträge abgibt. Eine zusätzliche Möglichkeit der Distribution von Pflegeleistungen in Form einer Standortdezentralisation bietet der Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes, bei dem die Kunden in einem größeren Gebiet erreicht werden können und schon erste (positive) Erfahrungen mit der Pflegequalität der Einrichtung sammeln können. Dadurch kann auch die Entscheidung für die Einrichtung, wenn eine Heimaufnahme durch die Patienten in Betracht gezogen wird, entsprechend beeinflußt werden (vgl. RITTER, 1995, S. 1005/1006). 4.5 Kontrahierungspolitik Die Kontrahierungspolitik im Alten- und Pflegeheim muß differenziert betrachtet werden, da sie die zwei Teilgebiete, die Bestimmung der Entgelte für die verschiedenen Dienstleistungen und die Festlegung zusätzlicher Vereinbarungen, die die Leistungsentgelte oder deren Bezahlung tangieren, umfaßt. Grundsätzlich besteht für das Unternehmen Alten- und Pflegeheim keine Möglichkeit, für seine Dienstleistungen aus dem SGB XI und dem SGB V eine eigene Preispolitik durchzuführen. Die Festsetzung der Höhe der Leistungsentgelte erfolgt generell in den Pflegesatzverhandlungen mit den Finanzierungsträgern (vgl. § 85 SGB XI). Infolge dieser "Preisnormierungen" (vgl. CORSTEN, 1997, S. 363 ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 402) entfallen für den einzelnen Heimträger im Bereich der Grundleistungen alle Maßnahmen wie Preisfestlegung, Preismodifizierung, Preisabstufung und Preisänderung. Eine realistische Möglichkeit zur Preisgestaltung und Preisdifferenzierung wird dagegen allgemein hinsichtlich der Wahl- und Zusatzleistungen gesehen (vgl. BRUNS, 1996, S. 36). Hierunter fallen alle Leistungsangebote, die über das Maß der durch das SGB XI definierten Grundleistungen hinausgehen, wie zum Beispiel Mani- oder Pediküre, Vorlesen, individuelle Auswahl von Musikprogrammen und besondere Fahrdienste (vgl. KLIE, 1996, S. 354 - 356). Dieser Bereich kann jedoch aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Rahmenverträge nach § 75 SGB XI, die jeweils eine landesweite Differenzierung zwischen den Grund- und Komfortleistungen vornehmen, noch nicht vollkommen ausgenutzt werden (vgl. KLIE,1996, 319 f. u. S. 540 ff.). Bei der Kalkulation der Höhe der Entgelte für diese zusätzlichen Leistungen empfiehlt es sich, neben der Beachtung der entstehenden Kosten auch das Vorgehen der konkurrierenden Einrichtungen in die eigenen Überlegungen einzubeziehen. Aus taktischen Gründen kann es sich anbieten, teilweise auf eine Rechnungstellung zu verzichten, um sich mit diesem "Service des Hauses" auf dem Markt zu profilieren. Den Bewohnern würde in diesem Fall ein echter materieller Vorteil entstehen, der ihnen zudem das gute PreisLeistungs-Verhältnis des Heimes verdeutlicht. Eine weitere Alternative zur Veranschaulichung des PreisLeistungs-Verhältnisses bietet in diesem Zusammenhang das Angebot des "Probe-Wohnens" für noch unschlüssige potentielle Bewohner, um die breite Palette von Dienstleistungen, die Mitbewohner und die Mitarbeiter kennenzulernen, bevor sie sich für oder gegen einen Umzug in das Heim entscheiden (vgl. HILKE, 1989, S. 21). Die Konditionenpolitik, die die reinen preispolitischen Maßnahmen ergänzt, gibt dem Heim eine weitere Möglichkeit, sich als ein kompetentes, serviceorientiertes Unternehmen darzustellen. Hier können zum einen die Gestaltung der Zahlungsbedingungen in Form eines zurückhaltenden Umganges mit Mahnungen zahlungsrückständiger Kunden, zum anderen die Gewährung von Rabatten ab einem bestimmten Umfang an erbrachten Wahl- und Zusatzleistungen dazu beitragen, sowohl den Bewohnern als auch der gesamten Öffentlichkeit ein "faires" und angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu verdeutlichen (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 280 ff.). 4.6 Kommunikationspolitik Da die durch das Alten- und Pflegeheim angebotenen Dienstleistungen als immaterielle Güter erst bei ihrer Erbringung durch den Bewohner auf ihre Qualität hin beurteilt werden können, muß die Kommunikationspolitik mit Werbemaßnahmen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit darauf ausgerichtet sein, kontinuierlich die Leistungsfähigkeit und die Leistungsziele sachlich und überzeugend darzustellen. Durch die Transparenz der Dienstleistungsqualität soll ein Vertrauensverhältnis zu den Kunden aufgebaut und eine positive Imagebildung in der Öffentlichkeit erzielt werden. Ziel der Kommunikationspolitik des Heimes muß es also sein, das Einzigartige des unternehmerischen Profils herauszustellen und die spezifische Unternehmensidentität durch aufeinander abgestimmte Kommunikationsmaßnahmen zu vermitteln, so daß das Heim im Pflegemarkt identifizierbar ist (vgl. MEFFERT, 1994, S. 87 ; BIEBERSTEIN, 1995, S. 326/327). Die Bedeutung der kommunikationspolitischen Maßnahmen sollte gerade für das Angebot sozialer Dienstleistungen nicht unterschätzt werden. Die inhärente Immaterialität dieser Leistungen erfordert flankierende kommunikationspolitische Instrumente vor, während und nach dem Dienstleistungsprozeß, die die besondere Kompetenz des Heimes hervorheben. Bei der Gestaltung der informations- und kommunikationspolitischen Maßnahmen hat das Heim generell das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu beachten, das Wettbewerber und Nachfrager gegen alle Formen der beabsichtigten und unbeabsichtigten Irreführung schützen soll (vgl. § 3 UWG). Ein weiteres elementares Ziel dieses Gesetzes ist es, werbliche Aktivitäten, die gegen die guten Sitten verstoßen, wie zum Beispiel die Heranführung potentieller Bewohner an das Heim durch "Kundenfang" (Beeinträchtigung der freien Willensbildung), Nötigung (Ausübung von Zwang) oder Verlockungen in Form von Zuwendungen und Geschenken, zu unterbinden. Unter diesen § 1 UWG fällt ebenfalls die Behinderung von konkurrierenden Einrichtungen, vergleichende Werbung oder der Verstoß gegen bestehende Gesetze (vgl. RITTER, 1995, S. 1003/1004 ; TSCHEULIN/HELMIG, 1996, S. 1362 ff.). Allgemein gilt jedoch, daß, je mehr der informative Aspekt im Vordergrund steht und je sachlicher die Beschreibungen und Aussagen formuliert sind, es desto unwahrscheinlicher erscheint, daß das Heim hier in juristische Konflikte verwickelt wird (vgl. PEPELS, 1996, S. 634 - 638 ; THILL, 1996, S. 39). Im folgenden werden die wichtigsten Instrumente der Kommunikationspolitik für ein Alten- und Pflegeheim erläutert: 4.6.1 Öffentlichkeitsarbeit Wie die Begriffe Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations (PR) schon zum Ausdruck bringen, umfaßt dieser Bereich die Beziehungen des Unternehmens Alten- und Pflegeheim zu seiner Umwelt bzw. zur gesamten Öffentlichkeit. Speziell geht es darum, positive Einstellungen gegenüber dem Heim zu erzeugen und zu festigen, wobei sich die Kommunikationsinhalte weniger auf die einzelnen Dienstleistungen als vielmehr auf das Heim als Gesamtheit mit allen seinen vertrauensbildenden und -erhaltenden Eigenschaften beziehen (vgl. BRUHN/TILMES, 1994, S. 141). Im Allgemeinen lassen sich der Öffentlichkeitsarbeit fünf Aufgaben bzw. Funktionen zuordnen, anhand derer das Wesen dieses Kommunikationsinstrumentes beschrieben werden kann (vgl. MEFFERT, 1986, S. 494 ; WEIS, 1990, S. 383): ● ● ● ● ● Informationsfunktion, d. h., die Übermittlung von Informationen über das Alten- und Pflegeheim an relevante Zielgruppen mit dem Ziel, eine verständnisvolle Einstellung im Hinblick auf das Haus und seine Situation zu erzielen. Imagefunktion, d. h., den Aufbau und die Änderung einer bestimmten Vorstellung von dem Alten- und Pflegeheim in der allgemeinen Öffentlichkeit. Kommunikationsfunktion, d. h. das Zustandebringen von Kontakten zwischen dem Heim und den relevanten Zielgruppen. Führungsfunktion, d. h. die Beeinflussung der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Posiotinierung des Heimes am Markt. Existenzerhaltungsfunktion, d. h. die glaubwürdige Darstellung der Notwendigkeit des Heimes für die Öffentlichkeit. Der Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit hängt im wesentlichen davon ab, ob die Regeln der Public-RelationsMaßnahmen Berücksichtigung finden. Öffentlichkeitsarbeit darf nicht entsprechend eines "Gießkannenprinzips" durchgeführt werden, d. h., je breiter eine Information gestreut worden ist, desto größer gestalten sich die Streuverluste, so daß die Information nicht zur Kenntnis genommen, übergangen oder übersehen werden (vgl. MEINERS/ALBERS, 1998, S. 52). Außerdem muß jede Public-Relation-Aussage der Wahrheit entsprechen, die Kontrolle ihres Inhaltes muß einkalkuliert werden. Als wichtiger Grundsatz gilt deshalb, niemals mehr zu versprechen, als man auch wirklich zu leisten vermag. Einen weiteren wichtigen Punkt stellt die Klarheit der Sprache dar. Es sollte einfach, verständlich und ohne verbale Finessen formuliert werden, so daß der Empfänger die Botschaft auch versteht. Dritter Aspekt ist die anzustrebende Einheit von Wort und Tat. Verdrehungen, Doppelsinnigkeiten und widersprechende Aussagen sollten vermieden werden, da sie in der Regel Irritationen auslösen (vgl. MEFFERT, 1986, S. 495 ; HABA, 1996, S. 601). Je nachdem, welche Zielgruppen im Rahmen der Public Relations angesprochen werden sollen, kann zwischen externer und interner Öffentlichkeitsarbeit unterschieden werden (vgl. PEPELS, 1994, S. 341). 4.6.1.1 Externe Öffentlichkeitsarbeit In dem Bestreben, die externen Zielgruppen 14 hinsichtlich der Dienstleistungsqualität kontinuierlich zufriedenzustellen und zu überzeugen, muß sich das Heim an der subjektiven Wahrnehmung der einzelnen Zielgruppen orientieren und damit die für diese wahrnehmbaren und verständlichen Qualitätsdimensionen beachten15 , wobei die externe Öffentlichkeitsarbeit ganzheitlich auf alle Zielgruppen ausgerichtet sein muß. Unabhängig von den einzelnen Zielgruppen gilt es, sogenannte Atmosphären zu schaffen, die das Erscheinungsbild des Heimes im Hinblick auf die sensorisch wahrnehmbaren Elemente der Ausstattung und der Umgebung sowie des Umganges mit bzw. das Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit kennzeichnen. Ein einladender, hotelähnlich gestalteter Eingangs- oder Empfangsbereich, in dem eventuell leise Musik erklingt, helle Räume, eine ansprechende Gebäudefassade, Blumendekorationen, eine bedürfnisgerechte Raumgestaltung und Möblierung, Sauberkeit, sogar ein angenehmer, "normal" riechender Duft sowie eine gute Verpflegung können als die Aushängeschilder des Heimes bezeichnet werden (vgl. KOTLER, 1978, S. 221 ; HABA, 1996, S. 602). 14 Siehe auch Abschnitt 3.5, „Erfolgsrelevante Zielgruppen“. 15 Siehe auch Abschnitt 3.4.2, „Dimensionen der Dienstleistungsqualität“. Von ebenso großer Bedeutung sind, insbesondere für die ersten Eindrücke beim Betreten der Einrichtung, wie freundlich die Begrüßung ist und wie das Auftreten, die Kleidung und das Erscheinungsbild des Personals empfunden wird. Diese, auch als "Schlüssel-Qualitäts-Erlebnisse" charakterisierbaren, Eindrücke prägen aus der Sicht der allgemeinen Öffentlichkeit das Bild der Einrichtung maßgeblich, zumal sie auch für Außenstehende eindeutiger beurteilbar sind als die pflegerische Fachkompetenz (vgl. RIEGL, 1991b, S. 257). In diesem Zusammenhang bieten sich die folgenden Medien an, mit deren Hilfe den einzelnen Zielgruppen das Erscheinungsbild des Heimes vermittelt bzw. Informationen übermittelt werden können: Um zu gewährleisten, daß die Bewohner, die als die wichtigste Zielgruppe anzusehen sind, kontinuierlich Veranstaltungshinweise und aktuelle Informationen erhalten, sollten ein "Schwarzes Brett" und Pinnwände zum Einsatz kommen. Eine zum Beispiel monatlich erscheinende Hauszeitung dient zusätzlich einerseits als Plattform, um über Aktivitäten und gemeinsam Erlebtes zu berichten, und andererseits als Forum für Leserbriefe, Anregungen, Kritik und aktuelle Themen. Gleichzeitig hat sie die Aufgabe, den übrigen Zielgruppen, hier insbesondere den Angehörigen und Besuchern, zu verdeutlichen, wie engagiert sich das Alten- und Pflegeheim um das Wohlbefinden seiner Bewohner kümmert. Mit Hilfe einer mit ansprechenden Bildern ausgestalteten Heimbroschüre kann man neue Bewohner und potentielle Interessenten über die Hausstrukturen und die Abläufe informieren und damit zum einen eine Unterstützung bieten, sich schneller einzuleben, und zum anderen eventuell vorhandene Hemmschwellen durch die transparente Darstellung des Heimes abbauen. Außerdem bietet die Broschüre die Möglichkeit, für die gesamte Öffentlichkeit die Einrichtungsphilosophie und -kultur unter Hervorhebung der Besonderheiten des Leistungsprogrammes zu beschreiben (vgl. DREWES, 1993, S. 467). Eine Alternative zu der sehr kostenaufwendigen Heimbroschüre, die sich allerdings durch die Vergabe von Werbeflächen ( Siehe auch Abschnitt 4.6.3, „Werbung“) reduzieren lassen, stellen Faltblätter dar, die beispielsweise die Erläuterung einzelner Segmente des Leistungsprogramms oder eine Kurzdarstellung des Selbstverständnisses des Heimes ("Wir über uns") beinhalten (vgl. MAYER, 1996, S. 80). Die Selbstdarstellung kann weiterhin über das Medium Alten- und Pflegeheim-Video erfolgen, das im Rahmen von Gesprächen mit potentiellen Interessenten und ihren Angehörigen in deren bisheriger häuslicher Atmosphäre oder von Messeauftritten und sonstigen öffentlichen Präsentationsterminen des Heimes eingesetzt werden kann (vgl. RIEGL, 1991a, S. 116). Um den Angehörigen zu zeigen, daß das Heim auf ihre Eindrücke Wert legt und ihre Verwandten gut versorgt werden, sollten Angehörigenabende veranstaltet werden, in denen altersspezifische Probleme und Krankheiten thematisiert und Erfahrungen ausgetauscht werden (vgl. GLANDER, 1994, S. 130). Weiterhin stellen die Hausärzte der Heimbewohner aufgrund ihrer Multiplikatorenrolle eine nicht zu vernachlässigende Zielgruppe dar, die regelmäßig ins Heim eingeladen werden sollte, um die Zusammenarbeit und gegenseitige Informationsweitergabe zu pflegen und damit die Präferenz für das Heim zu erhalten (vgl. MÜLLER, 1991, S. 14). Hierbei empfiehlt es sich zur Förderung des Interesses an einer solchen Veranstaltung, diese mit einem Fachvortrag über ein aktuelles medizinisches Thema zu verbinden. Ein weiteres Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist der Tag der offenen Tür. Um bereits im Vorfeld Interesse bei allen Zielgruppen zu wecken und den Interessierten einen Überblick der zu erwartenden Vorführungen, Informationen und des Aktionsrahmens zu geben, ist es ratsam, frühzeitig ein detailliertes Programm zu veröffentlichen. Bei dieser Gelegenheit können sich alle relevanten Zielgruppen ein Bild über das Heim machen, wie man es nicht alltäglich sieht. Bei der Organisation einer solchen Veranstaltung sollte jedoch unbedingt beachtet werden, daß die Intimsphäre der Bewohner gewahrt bleibt, da sie sich sonst wie "Ausstellungsstücke" vorkommen könnten. Aus diesem Grund sollte im Zweifelsfalle auf einen Tag der offenen Tür verzichtet und andere, von der Wirkung her ähnlich orientierte Events in Betracht gezogen werden. Hier kommen in erster Linie Vernissagen und Ausstellungen, Basare, Flohmärkte und Sommerfeste in Frage, die sich auch dadurch auszeichnen, daß die Bewohner besser integriert werden können (vgl. HABA, 1996, S. 602). Im Rahmen dieser Veranstaltungen bietet sich zudem dem Heim die Gelegenheit, Geschäftsberichte, Jahresberichte, statistische Veröffentlichungen oder Pressespiegel an die Hand zu geben, die ebenfalls bei anderen Anlässen verwendet werden können. Sie stellen ein interessantes und wirksames Mittel dar, mit dem insbesondere den Finanzierungsträgern und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung die Leistungsfähigkeit und Kompetenz verdeutlicht werden kann, wenn deren Vertreter ohnehin nicht schon regelmäßig in das Heim eingeladen werden, um sich persönlich ein Bild von dem überzeugenden Qualitätsniveau zu machen (vgl. MÜLLER, 1991, S. 15). 4.6.1.2 Interne Öffentlichkeitsarbeit Die interne Öffentlichkeitsarbeit ist auf die Mitarbeiter des Heimes ausgerichtet 17 , die durch ihr Verhalten und ihre Äußerungen gegenüber den Bewohnern und den anderen Zielgruppen in erheblichen Maße die Meinung, die sich die Öffentlichkeit von der Einrichtung bildet, prägen und somit die wichtigsten Imageträger eines Heimes sind. Ziel der internen Public Relations ist es deshalb, auf der Basis der Unternehmensphilosophie eine Identifizierung der Mitarbeiter mit dem Heim und eine optimale Zufriedenheit am Arbeitsplatz, verbunden mit einer Motivationssteigerung zu erreichen (vgl. MÜLLER, 1991, S. 15). Dabei ist zu beachten, daß sich Meinungen über das Heim nicht verordnen lassen, schöne Prospekte bewirken wenig, wenn die Mitarbeiter nicht hinter den Aussagen stehen oder Worte schlichtweg in Frage stellen. Die Ziele des Unternehmens Altenund Pflegeheim müssen den Mitarbeitern transparent gemacht und von den Führungskräften auch vorgelebt werden (vgl. HABA, 1996, S. 601). Das Image des Heimes bei seinen Mitarbeitern wird durch die folgenden Faktoren entscheidend beeinflußt: Die Schaffung eines positiven Heimklimas trägt wesentlich zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter bei. Die Organisationsstruktur des Heimes hinsichtlich der Arbeitszeitregelungen, der Hierarchieebenen und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen sowie der Führungsstil der Vorgesetzten und das Angebot des Heimes für die Mitarbeiter selber, wie zum Beispiel eine Sportgruppe, können das Klima positiv oder negativ beeinflussen (vgl. MÜLLER, 1991, S. 17). WEH und SIEBER charakterisieren in diesem Zusammenhang die verschiedenen Heimklimata wie folgt: 17 Der Begriff „Internes Marketing“ wird in der Literatur synonym verwendet (vgl. ausführlich BIEBERSTEIN, 1995, S. 335 ff. ; MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 444 ff. ; BRUHN, 1997,S. 84). Tab. 6: Positives und negatives Heimklima Positives Heimklima Negatives Heimklima - Miteinander reden. - Übereinander reden, Intrigen. - Einander akzeptieren, verstehen, leben lassen, tolerieren. - Gegenseitiger Konkurrenzkampf, aufeinander herumhacken; Ablehnung. -Gegenseitiges Bemühen, Teamarbeit, vom Team getragen. -Einzelkämpfertum, Konkurrenzdenken, Vereinsamung. -Wechselseitige Entwicklung unterstützen. - Seelisch-geistige Stagnation, Verlust an Motivation. - Positive Einstellung zur Arbeit, zum Heim, Loyalität - Gleichgültige Mitarbeiter, fehlende Loyalität. - Eigene Ideen verwirklichen, Fähigkeiten einsetzen können, Initiative - Befehle ausführen, unselbständig und ängstlich sein, warten auf ... - Sich so geben können, wie man ist. - Eine (fremde) Rolle spielen, sich verstekken. - An den anderen denken. - Sich egoistisch in Szene setzen. - Offen, gelöst sein können, Vertrauen haben. - Sich zurückhalten, sich verkrampfen, einander mißtrauen, Beziehungsschwund. - Sachliche Problemlösung. - Persönliche Anrempeleien, Sündenbocksyndrom - Sich auseinandersetzen, sich aussprechen. - Sich zerstreiten, Konflikte verdrängen, Auseinandersetzung verhindern. - Gute Arbeitsbedingungen. - Schlechte Arbeitsbedingungen. - Vorgesetzte, Mitarbeiter, die sich für die Belange ihrer Mitarbeiter und Kollegen einsetzen. - Vorgesetzte, Mitarbeiter, die sich nur um sich selbst und ihre Position kümmern. - Klare Trennung der Kompetenzen. - Sich in Kompetenzbereiche anderer einmischen. - An zeitliche Absprachen halten, Pünktlichkeit - Termine verpassen. - Wenig Arbeitsausfälle. - Häufige Krankheiten, Unfälle, übermüdete Mitarbeiter. - Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten gefordert. - Über-, unterforderte Mitarbeiter. Quelle: In Anlehnung an WEH/SIEBER, 1995, S. 133 ; TRILL 1996, S. 219/220 Die Weitergabe von Informationen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Information sollte als "leicht verderbliche Ware" gelten, die nicht zentralisiert und gehortet wird, sondern jedem jederzeit zur Verfügung steht (vgl. BRATER/MAURUS, 1995b, S. 152). Gut informierte Mitarbeitern können ihre Arbeit besser leisten, da sie wissen, was sie gerade tun, und wie ihre Tätigkeit in das Gesamtkonzept integriert ist. Außerdem verhindert ein kontinuierlicher Informationsfluß die doppelte Erledigung der gleichen Arbeit, die ansonsten schnell Irritationen bei den Bewohnern auslösen würde. Durch das Publizieren einer Mitarbeiterzeitschrift, die auch mit der Hauszeitschrift kombiniert werden kann, können hausinterne Veränderungen und Geschehnisse weitergegeben werden. Hierbei ist es wichtig, die Mitarbeiter bei der Gestaltung dieser Zeitschrift einzubeziehen und genügend Freiraum für eigene Anliegen und Probleme einzuräumen (vgl. MÜLLER, 1991, S. 18). Das Angebot von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen kann außerdem unterstützend auf die Motivation der Mitarbeiter wirken und die Bereitschaft zum kontinuierlichen und berufsbegleitenden Lernen fördern. Zudem führt das erworbene Wissen zu einer Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiter und bereichert somit den täglichen Arbeitsprozeß. An weiteren zusätzlichen Maßnahmen zur internen Öffentlichkeitsarbeit sollten ebenfalls Betriebsfeste und ausflüge, die Gratulation zum Geburtstag, die Anerkennung besonderer Leistungen in Form von Gratifikationen, die Gestaltung des Arbeitsplatzes, Team- und Mitarbeitergespräche nicht außer Acht gelassen werden. Die Schaffung eines "Wir-Gefühls" und die überzeugende Vermittlung, daß alle an einem Strang ziehen, ist als die Hauptaufgabe der internen Öffentlichkeitsarbeit anzusehen (vgl. RIEGL, 1994, S. 118). Der Erfolg der internen Öffentlichkeitsarbeit hat zudem direkte Auswirkungen auf die externe Öffentlichkeitsarbeit und läßt sich damit anhand dieser bewerten. Mitarbeiter, die sich mit ihrem Heim identifizieren, Freunde an ihrem Beruf haben und eine hohe Zufriedenheit ausstrahlen prägen das Image des Heimes in der Öffentlichkeit entscheidend, da insbesondere die im ständigen Kontakt mit dem Heim stehenden Zielgruppen, wie auch besonders die Bewohner, ganz genau spüren, ob sich die Arbeitsabläufe harmonisch gestalten und ein positives Heim- bzw. Betriebsklima vorherrscht. Die Mitarbeiter sind somit als der Schlüsselfaktor (Key People) der Kundenzufriedenheit zu sehen (vgl. MEFFERT/BRUHN, 1997, S. 445). Die Kundenorientierung ist folglich nur so gut wie die Mitarbeiter, die sie umsetzen. 4.6.2 Pressearbeit In direktem Verbund mit der Öffentlichkeitsarbeit steht die Presse- bzw. Publicityarbeit, die den Zielgruppen über die Medien Presse, Rundfunk oder Fernsehen auf indirektem Wege Informationen liefert. Die Pressearbeit bietet dem Heim die Möglichkeit, Informationen über die Einrichtung in möglichst positiver Form unentgeltlich und für ein relativ großes Publikum zu verbreiten. Gute Beziehungen zu Journalisten der örtlichen Presse sind für das Alten- und Pflegeheim von enormer Bedeutung, da eine enge Zusammenarbeit das Verständnis der Presse für die Anliegen des Heimes fördern kann und zudem Artikel positiv im Sinne des Heimes beeinflußt werden können (vgl. THILL, 1996, S. 251/252). Positive redaktionelle Berichte erhöhen die Glaubwürdigkeit des Alten- und Pflegeheimes und fördern das Vertrauen der Öffentlichkeit, da sie in einem journalistischen und seriösen Kontext dargeboten werden (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 325). Eine Möglichkeit der Plazierung von Nachrichten besteht in Form der Pressemitteilung an die örtliche Tagespresse. Damit kann beispielsweise auf die Fertigstellung eines neuen Gebäudekomplexes und die damit verbundene Einweihung aufmerksam gemacht werden. Ein weiteres Medium stellt die Pressemappe dar, die meistens noch umfangreichere Informationen als die Pressemitteilung enthält, und den Journalisten eine Arbeitserleichterung dienen soll, da sich der Aufwand für die Recherchen deutlich reduziert (vgl. WEH/SIEBER, 1995, S. 177 ff.). Bei einem Pressegespräch wird eine kleine Anzahl von Journalisten eingeladen, die in einem möglichst nicht vorstrukturierten Rahmen in Form einer Diskussion über aktuelle bzw. die Medienvertreter interessierende Aspekte informiert werden. Die Atmosphäre ist dabei deutlich persönlicher als bei einer Pressekonferenz und bietet somit für beide Seiten einen größeren Raum zum besseren Kennenlernen und zu einem intensiveren, individuelleren Informationsaustausch. Im direkten Kontext zum Pressegespräch ist die Pressebesichtigung zu sehen, da die anschauliche Darstellung der Sachverhalte zu einem schnelleren Verständnis der Inhalte beiträgt. Sind die zu vermittelnden Informationen abstrakterer Natur, empfiehlt sich die Durchführung eines Interviews. Um den effizienten und damit erfolgreichen Ablauf zu gewährleisten, sollten im Vorfeld die geplanten Themen und möglichen Fragestellungen abgeklärt werden (vgl. MÜLLER, 1994, S. 553). Weiterhin ist es zweckmäßig, kontinuierlich die Bereitschaft zur Teilnahme an Diskussionsrunden und Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen zu signalisieren, da es sich hierbei um günstige Gelegenheiten zur Darstellung der Kompetenz des Heimes handelt. Aufgrund der nicht zu unterschätzenden imagefördernden Wirkung sollte das Heim schließlich auch versuchen, über Berichterstattungen und Reportagen in regionalen Tageszeitungen sowie Radio- und Fernsehsendern das Besondere seiner Leistungen vorzustellen (vgl. HABA, 1996, S. 603 ; THILL, 1996, S. 262/263). 4.6.3 Werbung Die Werbung als ein weiteres Instrument der Kommunikationspolitik des Heimes läßt sich allgemein charakterisieren als eine unpersönliche Form der Massenkommunikation, bei der durch den Einsatz von Werbemitteln in bezahlten Werbeträgern versucht wird, die erfolgsrelevanten Zielgruppen anzusprechen und zu beeinflussen. Sie beabsichtigt, die Adressaten der Werbemaßnahmen unmittelbar von den Vorzügen der eigenen Dienstleistungen zu überzeugen und ganz konkret neue Bewohner zu gewinnen (vgl. KREIDENWEIS, 1996, S. 348 ; SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 214). Im Gegensatz zur Öffentlichkeits- und Pressearbeit, mit deren Hilfe das Ansehen und das Vertrauen des Heimes langfristig gefördert werden sollen, ist die Werbung in der Regel auf das Ziel gerichtet, relativ kurzfristig Markterfolge zu realisieren (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 325). Bei der Gestaltung der Werbemaßnahmen ist entscheidend, daß die psychologische Wirkungsweise von Werbung auf den Menschen generell beachtet wird, d. h., die Werbung muß entsprechend dem mehrstufigen Verarbeitungsprozeß von Werbeinformationen durch den Menschen als ein denkendes, fühlendes und handelndes Wesen strukturiert sein. Die bekannteste Faustregel für erfolgreiche Werbung stellt das sogenannte AIDA-Schema dar (vgl. BRUHN, 1997, S. 209): 1. Stufe: A wie "Aufmerksamkeit" (Attention) Als erstes muß die Aufmerksamkeit des Betrachters um jeden Preis auf das Werbemittel gelenkt werden. Hier geht es vor allem um Blickfangpunkte, die das Auge gleichsam magisch anziehen. 2. Stufe: I wie "Interesse" (Interest) Das tiefere Interesse des Werbeadressaten an dem Medium ist zu wecken, ihn also beispielsweise zum Weiterlesen einzuladen. 3. Stufe: D wie "Das will ich haben" (Desire) An dieser Stelle ist im Vergleich zur Konsumgüterindustrie nicht der Verstand anzusprechen, sondern das Gefühl. Bei Pflegeleistungen sind beispielsweise die emotionalen Gesichtspunkte ausschlaggebend, sich oder seine Angehörigen bei genau diesem Alten- und Pflegeheim in gute Hände geben zu können. 4. Stufe: A wie "Aktion" (Action) Es muß erreicht werden, beispielsweise über eine freundliche Aufforderung zum Anruf, daß die potentiellen Bewohner und ihre Angehörigen mit dem Heim Kontakt aufnehmen. Neben der Festlegung der inhaltlichen Konzeption der Werbebotschaft müssen durch das Heim Entscheidungen über die Wahl der Werbemedien und Werbemittel getroffen werden. Diese stehen in enger Korrelation, da in den meisten Fällen die Wahl der Werbemittel an ganz bestimmte Werbemedien gebunden ist. In diesem Zusammenhang versteht man unter einem Werbemittel die personelle und sachliche Ausdrucksform der Werbung, während die Werbemedien die Medien bezeichnen, durch die die Werbemittel an die Adressaten der Werbung herangetragen bzw. gestreut werden (vgl. SCHARF/SCHUBERT, 1997, S. 232/233). Als Werbemittel kommen für das Alten- und Pflegeheim insbesondere Annoncen, Anzeigen oder Beilagen in den regionalen Tageszeitungen, Wochenblättern oder Telefonbüchern, aber auch Plakate oder Prospekte, die beispielsweise in Arztpraxen oder Kirchengemeinden ihre Wirkung erzielen können, in Frage (vgl. BRUNS, 1996, S. 37). Grundsätzlich sollten aber bei der Gestaltung der Werbemaßnahmen sowohl die Kosten-Nutzen-Relation als auch die Problematik, daß eine aggressive Werbung in den Printmedien auch dahingehend durch die Öffentlichkeit interpretiert werden könnte, daß das Heim beispielsweise aufgrund seines Qualitätsniveaus nicht ausreichend ausgelastet ist, im Auge behalten werden. Zudem könnten Irritationen, und damit unter Umständen ein negatives Echo in der Öffentlichkeit ausgelöst werden, wenn sich potentielle Interessenten im Rahmen wiederholter Werbekampagne um einen Heimplatz bemühen, aber wegen bereits bestehender Vollauslastung eine Absage erhalten. 4.6.4 Soziosponsoring Der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Finanzierungsprobleme einzelner Projekte und Vorhaben, wie zum Beispiel die Herstellung einer Hauszeitung oder einer Heimbroschüre, bedeuten für ein Alten- und Pflegeheim, neue Finanzierungsquellen suchen zu müssen. In diesem Zusammenhang ist das Soziosponsoring18 eine interessante Alternative. Hierunter versteht man "die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im sozialen Bereich durch die Bereitstellung von Geld-/ Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder indirekt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und -kommunikation anstreben" (BRUHN, 1990, S. 6). Auf der Basis des Prinzips von Leistung und Gegenleistung gewährt der Sponsor Fördermittel und erhält dafür von Seiten des Gesponserten, also dem Alten- und Pflegeheim, als Gegenleistung die Möglichkeit zur Werbung in eigener Sache. Im Gegensatz zu einem Freundeskreis bzw. Förderverein, die ebenfalls als mögliche Sponsoren anzusehen sind, verfolgt ein das Heim sponserndes Wirtschaftsunternehmen neben dem Fördermotiv auch das Ziel, durch die Dokumentation der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung das Firmenimage in der Öffentlichkeit, bei Kunden und Geschäftspartnern positiv zu beeinflussen (vgl. DREWES, 1993, S. 447 ; MÜLLER, 1993, S. 732). Als Formen des Sponsorings kommen Geldleistungen, Sachmittel, wie zum Beispiel Bereitstellung von Computern oder Fahrzeugen, und Dienstleistungen in Form von Know-how-Vermittlung zur Lösung bestimmter Probleme in Betracht (vgl. BRUHN, 1990, S. 16). Bei der Art der durch das gesponserte Heim zu erbringenden Gegenleistungen wird allgemein zwischen einer aktiven Gegenleistung und einer passiven Duldung unterschieden. Im Rahmen der aktiven Gegenleistung erhält zum Beispiel das gesponserte Fahrzeug Firmenaufdrucke des Sponsors oder das Sponsoringunternehmen wird in der Hauszeitschrift, in Pressemitteilungen und sonstigen Veröffentlichungen des Heimes erwähnt. Eine passive Duldung besteht im Einverständnis des Gesponserten, daß der Sponsor selbst mit dem Sponsorship in der eigenen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wirbt (vgl. BRUHN, 1990, S. 19). 18 Die Begriffe Sozio- und Sozialsponsoring werden in der Literatur synonym verwendet (vgl. MÜLLER, 1993 ; DREWES, 1993, S. 447 ff. ; BRUHN/TILMES, 1994, S. 167 ff.). Aus Sicht des Alten- und Pflegeheimes kann Sponsoring in der Regel mit folgenden Vorteilen verbunden werden (vgl. DREWES, 1993, S. 449 ; BRUHN/TILMES, 1994, S. 176 ; THILL, 1996, S. 269): ● ● ● ● Soziosponsoring vergrößert den finanziellen Spielraum. Durch eine verbesserte finanzielle, materielle und/oder personelle Ausstattung kann die Aufgabenerfüllung optimiert werden, zudem wird ein breiterer finanzieller Spielraum zur Finanzierung von Innovationen geschaffen. Der Bekanntheitsgrad des Heimes nimmt durch die Werbe- und Öffentlichkeitsaktivitäten zu. Die im Sponsoring gewonnenen Erfahrungen können zum einen auf andere Bereiche übertragen werden und zum anderen neue Impulse für die eigene Öffentlichkeitsarbeit initiieren. Neben diesen Vorteilen müssen allerdings auch die Gefahren, die direkt oder indirekt mit Sponsoring verbunden sind, berücksichtigt werden. Dabei ist vor allem an folgende Nachteile zu denken (vgl. DREWES, 1993, S. 449 ; BRUHN/TILMES, 1994, S. 177): ● ● ● ● Das Heim könnte bei einer erfolgreichen und dauerhaften Verbindung finanziell vom Sponsor abhängig werden. Das Bekanntwerden des Sponsorings könnte je nach Umfang zur Folge haben, daß das Spendenaufkommen zurückgeht, da die Spender der Ansicht sind, daß ihre Spenden wegen der von ihnen vermuteten, großzügigen Finanzierung durch den Sponsor für andere Spendenzwecke besser eingesetzt werden können. Es besteht die Gefahr, daß staatliche Stellen ihre finanziellen Zuschüsse reduzieren. Sollte der Sponsor in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit ein negatives Image gehabt haben, könnte sich die Annahme der Unterstützung negativ auswirken. Im konkreten Fall, zum Beispiel beim Verkauf von Werbeflächen in der Heimbroschüre oder Hauszeitung oder der Unterstützung bei Baumaßnahmen, sollte deshalb überprüft werden, ob mit den genannten Risiken gerechnet werden muß. Um die Gefahren im Vorfeld zu minimieren, sollte ein Sponsoringvertrag abgeschlossen werden, der unbedingt die Klausel enthalten sollte, daß der Vertrag gekündigt werden kann, wenn das Sponsorunternehmen in die Schlagzeilen gerät. Außerdem sollten hier die Leistungen und Gegenleistungen beider Vertragsparteien eindeutig formuliert, die Vertragsdauer festgelegt sowie allgemein die Sachverhalte beschrieben werden, die jeweils beide Seiten zu einer Kündigung des Vertrages berechtigen (vgl. DREWES, 1993, S. 449/450 ; MÜLLER, 1993, S. 735). 4.7 Qualitätsmanagement Für die Umsetzung des Qualitätsmanagements im Alten- und Pflegeheim sollten die Stelle bzw. Funktion des Qualitätsbeauftragten, das Qualitätsmanagementhandbuch und Qualitätszirkel als unterstützende Instrumente ihre Anwendung finden, um zum einen eine kontinuierliche Dienstleistungsqualität gewährleisten und damit die Kunden zufriedenzustellen und zum anderen den gesetzlichen Anforderungen umfassend nachkommen zu können (vgl. GROSSER, 1996, S. 628). In diesem Zusammenhang wird von dem Verständnis ausgegangen, daß aktives Qualitätsmanagement nicht mit einer Zertifizierung beispielsweise nach der ISO-Normenreihe 9000 gleichgesetzt werden kann. Eine Zertifizierung gibt keine detaillierten inhaltlichen Auskünfte über die Qualität, sondern regelt lediglich das Verfahren, wie eine Einrichtung ihr System zur Förderung und Sicherung der Qualität aufzubauen hat und wie zum Beispiel bei der Entwicklung und Einführung von Standards vorzugehen ist. Die ISO-Norm basiert somit auf einem dem Total Quality Management diametral entgegenstehenden Qualitätsverständnis, das die permanenten Lern- und Entwicklungsprozesse nicht beachtet (vgl. BRETZKE, 1995, S. 417 ; HILDEBRAND, 1995, S. 32). Der Ausweis einer ISO-Zertifizierung dient somit mehr oder weniger der Dokumentation nach außen, um dem Kunden ein gewisses Qualitätsniveau nachzuweisen, bevor dieser die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Entgegen der allgemeinen Ansicht der Öffentlichkeit lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf die Dimension der Ergebnisqualität ziehen, die Normung führt in erster Linie dazu, daß die Qualitätsmanagementssysteme der Einrichtungen und damit die internen Verfahrensweisen vergleichbar werden (vgl. BIEBERSTEIN, 1995, S. 192 ; TRILL, 1996, S. 247/248). 4.7.1 Qualitätsbeauftragter Die Schaffung einer Stelle eines "Qualitätsbeauftragter" für die gesamte Einrichtung bzw. die teilweise Freistellung von Mitarbeitern oder die Beauftragung eines Mitarbeiters in Zweitfunktion aus den verschiedenen Bereichen des Heimes für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Qualitätsbeauftragten wird in der Praxis als eine wichtige Voraussetzung für ein effektives Qualitätsmanagement angesehen (vgl. BÜSE, 1996, S. 140/141). Qualitätsbeauftragte, in einigen Einrichtungen auch Qualitätsberater genannt, entlasten die Führungskräfte in fachlicher Hinsicht und nehmen eine beratende, koordinierende und kontrollierende Funktion wahr. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört in der Regel die Vorbereitung und Begleitung der Entwicklung, Überarbeitung und Einführung von Standards, die fortlaufende Beurteilung und Überprüfung des Qualitätsmanagementssystems sowie der Aufbau und die Pflege des Qualitätsmanagementhandbuches. Zudem können sie zusätzlich als eine Anlaufstelle für Beschwerden und Probleme dienen, die vor Ort nicht geklärt werden können oder bei denen die Bewohner der Ansicht sind, keinen richtigen Ansprechpartner zu haben. Weiterhin vertreten sie nach Möglichkeit die Einrichtung in allen Qualitätsbelangen nach außen, koordinieren und moderieren intern die Arbeit der Qualitätszirkel und verfolgen die Umsetzung deren Verbesserungsvorschläge in die Praxis. Zusammen mit den Führungskräften der einzelnen Bereiche zeichnen sie sich ebenfalls dafür verantwortlich, den Schulungsbedarf der Mitarbeiter festzustellen und entsprechende regelmäßige Fortbildungsprogramme mit zu organisieren. In ihrer Funktion sind sie Mitglied der Qualitätskonferenz bzw. -kommission des Alten- und Pflegeheimes, die die gesamten Aktivitäten zur Qualitätssicherung überwacht und genehmigt (vgl. SPERL, 1994, S. 131/132). 4.7.2 Qualitätsmanagementhandbuch Das Qualitätsmanagementhandbuch stellt eine Sammlung aller Dokumente dar, die die Entwicklung, Ausführung und Verbesserung der gesamten Dienstleistungen des Alten- und Pflegeheimes betreffen. Es gibt die grundsätzliche Haltung bzw. Einstellung des Alten- und Pflegeheimes in Form der Unternehmensphilosophie sowie die Absichten und Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Dienstleistungsqualität wieder (Qualitätspolitik, -ziele). Neben der Beschreibung des Qualitätsmanagementssystems werden hier Regelungen über Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten dokumentiert, hinzu kommt die Festlegung der organisatorischen Ausgestaltung sowie der Verfahren und Anweisungen zur Umsetzung einzelner Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Das Handbuch beinhaltet zudem sowohl einen Qualitätssicherungsplan, der die spezifischen Qualitätspraktiken, die Mittel und die Reihenfolge von Tätigkeiten für die einzelnen Dienstleistungen enthält, als auch Verfahrensanweisungen, die festhalten, wie konkrete Handlungen und Abläufe ausgeführt werden sollen, dokumentiert und gesteuert werden und welche Qualitätspraktiken zur Anwendung kommen (vgl. KAMISKE/BRAUER, 1995, S. 151/152). Besonders im Hinblick auf die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bedeutet diese Zusammenfassung aller in der Einrichtung praktizierten Qualitätsstandards eine nicht zu unterschätzende Hilfestellung. 4.7.3 Qualitätszirkel Qualitätszirkel sind durch die Leitung des Alten- und Pflegeheimes institutionalisierte, auf Dauer angelegte Arbeitsgruppen, in denen sich in der Regel drei bis zehn Mitarbeiter eines Arbeitsbereiches oder mehrerer Arbeitsbereiche mit einer gemeinsamen Erfahrungsgrundlage in einem zwei- bis vierwöchigen Rhythmus auf freiwilliger Basis während der Arbeitszeit für ein bis zwei Stunden treffen. Diese Mitarbeiter analysieren Fragen sowie Abläufe aus ihrem Arbeitsbereich, hinterfragen Qualitätsstandards und erarbeiten gemeinsam unter Anleitung eines geschulten Moderators, gegebenenfalls unter Hinzuziehung externer Experten, mit Hilfe spezieller, erlernter Problemlösungs- und Kreativitätstechniken Lösungs- und Verbesserungsvorschläge. Diese Lösungen werden dann anschließend durch die Qualitätszirkelmitglieder selbständig oder im Instanzenweg umgesetzt mit Ergebniskontrollen im Rahmen der Erprobungsphase. Die Qualitätszirkel eines Heimes sind über den Qualitätsbeauftragten und die Qualitätskommission in den organisatorischen Rahmen des Qualitätsmanagementssystems eingebunden und unterhalten zu den einzelnen Bereichen kommunikative Beziehungen, um über das Geschehen Transparenz herzustellen (vgl. KALTENBACH, 1991, S. 227 - 233 ; HELLIGE u. a., 1994, S. 155 - 158). Ziel dieser in Anlehnung an den PDCA-Zyklus19 agierenden Gruppen ist es also, die eigene Arbeit zu reflektieren, Schwachstellen und Fehlerquellen aufzudecken und eine Verbesserung der Arbeitsprozesse und damit der Arbeitsergebnisse zu erreichen (vgl. GIEBUNG u. a., 1996, S. 98). Die diskutierten Probleme dienen somit als Impuls für ein gemeinsames, qualitätsorientiertes Handeln. Für die Mitarbeiter in den Qualitätszirkeln ist es hierbei besonders wichtig, daß sie die volle Unterstützung und Förderung durch die Vorgesetzten erhalten; Versuch und Irrtum müssen ohne Sanktionen möglich sein, erst dann kann diese Arbeit den gewünschten Erfolg zeigen (vgl. STEINLE u. a., 1996, S. 310/311). 19Diese Abkürzung steht für Plan-Do-Check-Act-Zyklus (Planen, Ausführen, Überprüfen,Verbessern), der auch als Deming-Kreis bezeichnet wird (vgl. KAMISKE/BRAUER, 1995,S. 216 - 220). Qualitätszirkel bieten sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Heim viele Vorteile. Langfristig führen sie zu einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit und einer damit verbundenen Fluktuationsrate sowie einer Reduzierung von Konflikten. Im einzelnen bedeutet dies für die Mitarbeiter, daß sie sich dadurch aktiv in die Bewältigung ihrer Probleme einbringen können. Ihre Kreativität und Motivation wird durch diese bewußte Problemauswahl deutlich gesteigert, sie erfahren eine größere Wertschätzung. Gleichzeitig können durch diese Form der Mitarbeit unter Umständen nicht mehr wahrgenommene Ressourcen bei den Mitarbeitern aktiviert werden, die sich für die tägliche Praxis positiv auswirken. Weiterhin steigert das Engagement im Qualitätszirkel zum einen die fachliche Qualifikation, zum Beispiel durch Ursachenforschung oder Entwicklung von Standards, zum anderen führt es zu einer persönlichen Weiterentwicklung durch gemeinsame Gespräche und den Prozeß der Konsensfindung, Konfliktfähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit werden geschult und gefördert (vgl. PARATSCH, 1996, S. 123). Die Einrichtung profitiert vom vorhandenen Mitarbeiter-Know-how und ist damit nicht gezwungen, dieses möglicherweise auf dem Markt teuer zu erwerben. Die Ergebnisse der Qualitätszirkel können zudem oftmals vom eigentlichen Problembereich auf andere übertragen werden, so daß auch dort die täglichen Arbeiten vereinfacht und erleichtert oder Probleme beseitigt werden können. Dies hat zur Folge, daß nicht nur durch eine effektivere Organisation von Arbeitsabläufen als Ergebnis der Qualitätszirkelaktivitäten Kosten reduziert werden können, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden positiv beeinflußt werden kann. Außerdem ist eine Zunahme der Identifikation der Mitarbeiter mit der Einrichtung zu erwarten, da die Mitarbeiter in der Regel hinter den Ergebnissen ihrer Arbeitsgruppen stehen und ein großes Interesse an der Umsetzung der Lösungs- und Verbesserungsvorschläge haben (vgl. BÜSE, 1996, S. 152 ff. ; DÜHRUNG, 1996, S. 185). 4.7.4 Vorgehensweise Um die Effizienz der Aktivitäten zur Qualitätssicherung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Vorgehen folgendermaßen zu strukturieren und organisieren (vgl. EICHHORN, 1990, S. 95): ● Qualitätssicherung erfolgt in erster Linie intern und eigenverantwortlich. ● Voraussetzungen schaffen. ● - Dokumentationssystem. - Auswertung der Dokumentation sicherstellen. - Stabsstelle(n) für Qualitätsbeauftragte(n) einrichten. - Qualitätszirkel und Qualitätskommission institutionalisieren. Einzelfallanalysen statistisch festgelegter Auffälligkeiten bei einzelnen Qualitätsmerkmalen durchführen. Bei Bedarf externe Beratung hinzuziehen. Strukturierungsprinzipien für Qualitätssicherungsmaßnahmen beachten. ● - Qualitätsindikator (Auswahl der Leitprobleme, Setzen von Prioritäten) - Beurteilungsansatz.(Struktur-, Prozeß-, Ergebnisorientierung) - Beurteilungstechnik.(Methoden zur Ermittlung des Zielerreichungsgrades) - Beeinflussungsstrategien.(Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung) Methodenvielfalt bei der Ist-Dokumentation gewährleisten. ● ● ● - Bewohnerbezogene Basisdokumentation. - Routinemäßige Besprechungen.(Arbeitsgruppen, Leitungsbesprechungen, Teambesprechungen) - Beobachtung des Leistungsgeschehens. - Befragung von Bewohnern und Mitarbeitern. Qualitätssichernde Interventionen kontinuierlich vorbereiten und begleiten, Maßnahmen zur Qualitätssicherung zwischen den Bereichen der Einrichtung koordinieren und integrieren 5. Bestandsaufnahme des Marketings in Alten- und Pflegeheimen Die in den vorangegangenen Kapiteln dargelegten theoretischen Erkenntnisse bildeten die Grundlage der durchgeführten empirischen Erhebung. Zunächst werden der Untersuchungsgegenstand und die Methodenwahl erläutert. Hierbei geht es im einzelnen um die Ziele der Studie, die Planung und Durchführung der Untersuchung, das angewandte Forschungsinstrument sowie eine Deskription der befragten Heime, die gleichzeitig zur Darstellung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse der Erhebung des Ist-Zustandes der Marketingaktivitäten in Alten- und Pflegeheimen überleitet. 5.1 Untersuchungsgegenstand und -methode 5.1.1 Ziele der Studie Im Hinblick auf die eingangs dargelegte Zielsetzung verfolgt diese Studie die Intention, die Marketingaktivitäten einzelner Alten- und Pflegeheime in privater, öffentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft unter den modifizierten Wettbewerbsbedingungen des Pflegeversicherungsgesetzes zu erfassen und zu untersuchen. Ohne auf dezidierte Forschungsergebnisse zurückgreifen zu können, soll sie einen Eindruck der augenblicklichen Situation vermitteln und den Boden für weitere differenzierte Untersuchungen bereiten. Die sekundärstatistischen Materialien liefern zwar Anhaltspunkte für Entwicklungstrends im Pflegemarkt insgesamt, sie lassen jedoch keine Rückschlüsse auf die Verhaltensweisen einzelner Alten- und Pflegeheim zu. Bei der vorliegenden Studie handelt es sich somit um eine Primärerhebung mit explorativem Charakter, die bewußt keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt (vgl. FRIEDRICHS, 1990, S. 121 f. ; BORTZ/DÖRING, 1995, S. 334 ff.). Damit ein enger Themenbezug hergestellt ist, stützt sich die Untersuchung auf die in den vorangegangenen Kapiteln geleisteten theoretischen Vorarbeiten. Auf der Basis der theoretischen Erkenntnisse zur möglichen Gestaltung des Marketings in Alten- und Pflegeheimen sollen unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen des unternehmenrischen Umfeldes und den daraus abzuleitenden Anforderungen an das Unternehmen Alten- und Pflegeheim Trends aufgezeigt werden, die sich unter Umständen in der Zukunft als Schwachstellen im Konkurrenzkampf auf dem Pflegemarkt herausstellen könnten. Dabei wird im Rahmen dieser Studie folgenden Fragestellungen nachgegangen: ● ● ● ● ● ● ● ● Haben die Heime die Notwendigkeit eines umfassenden Marketings erkannt? Welche Bedeutung messen sie dem Marketing bei? Gibt es Unterschiede bei städtisch und ländlich gelegenen Heimen? Wie hoch ist die Auslastung des Heimes? Werden die Marketingaktivitäten systematisch durchgeführt? Welche Leistungsspektrum wird angeboten? Welcher Schwerpunkt wird bei den Aktivitäten gesetzt? Wie wird die Marketingsituation erforscht? ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ist das Leistungspotential der konkurrierenden Heime bekannt? Welche marketingpolitischen Instrumente werden überwiegend eingesetzt? Welche Serviceleistungen werden angeboten? Wie versucht das Heim, sich über die Serviceleistungen von der Konkurrenz abzuheben? Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit gestaltet? Betreibt das Heim Soziosponsoring? Wo werden Chancen zur Expansion bzw. Existenzsicherung gesehen? Welche Kooperationsformen werden genutzt, um Kosten- und Nutzenvorteile ausschöpfen zu können? Welche Schwerpunkte werden beim Qualitätsmanagement gesetzt? Wie wird die Dienstleistungsqualität gewährleistet? 5.1.2 Planung und Durchführung Die Überlegungen zur Zielsetzung der Studie und die damit verbundene Notwendigkeit, daß für die Erforschung und Beschreibung der Marketingaktivitäten Fakten, Einstellungen und Bewertungen der Alten- und Pflegeheime zu ermitteln sind, führten zu der Entscheidung, die empirische Erhebung in Form von, für diese Art von Informationsgewinnung allgemein als Standardinstrument angesehenen, qualitativen Befragungen durchzuführen (vgl. SCHNELL u. a., 1993, S. 328). Die in der Literatur aufgeführten wesentlichen Funktionen dieser Methode sind unter anderem in einer beschreibenden Erfassung von Tatsachen sowie in dem systematischen, zielorientierten Vorgehen unter weitreichender Kontrolle der Erhebungssituation zu sehen (vgl. ATTESLANDER, 1984, S. 86). Im Hinblick auf diese Anforderungen bietet das Experteninterview gegenüber einer schriftlichen Befragung für die Untersuchung des Ist-Zustandes der Marketingaktivitäten die Vorteile, daß zum einen im Rahmen des Interviews die Befragungssituation kontrolliert werden kann und daß zum anderen gewährleistet ist, daß die anvisierte Zielgruppe Auskünfte erteilt (vgl. ATTESLANDER, 1984, S. 111). Außerdem ist bereits zu Beginn der Erhebung das Ausmaß der Beteiligung bekannt20. Zudem lassen sich Kommunikationsprobleme, sowohl das Verständnis einzelner Fragen als auch deren Beantwortung betreffend, durch Hilfestellungen seitens des Interviewers reduzieren (vgl. LOBIONDO-WOOD/HABER, 1996, S. 397 ff.). Um die Ergebnisse der unterschiedlichen Erhebungssituationen vergleichbar zu machen, empfehlen BORTZ und DÖRING (vgl. 1995, S. 289) den Einsatz eines Interviewleitfadens, durch den der Interviewer ein Gerüst für die Datenerhebung und Datenanalyse erhält. Dieses Fragebogengerüst ist dadurch gekennzeichnet, daß es den Gesprächsablauf und -inhalt zwar vorgibt, jedoch gleichzeitig genügend Spielräume bei der Formulierung der Fragen und der Aufnahme der Antworten läßt. 20 Bei schriftlichen Befragungen ist die Rücklaufquote ungewiß, so daß eine geringe Beteiligung die Untersuchung insgesamt gefährden kann. Für die Bestandsaufnahme der Marketingaktivitäten in Alten- und Pflegeheimen erschien es in diesem Zusammenhang zweckmäßig, einen teilstrukturierten Interviewleitfaden (Der Interviewleitfaden „Marketing im Alten- und Pflegeheim“ befindet sich im Anhang) zu entwickeln, der eine gezielte Variation des Gesprächs ermöglichte, da verschiedene Informationen, wie zum Beispiel Insiderwissen über anvisierte Strategien, nur durch ein flexibles Eingehen auf den Befragten bzw. die Befragte und die jeweilige Situation zu erwarten waren. Somit konnten Fragen übergangen oder während des Experteninterviews modifiziert werden, was die spätere Auswertung zwar nicht erleichterte, dafür aber dem allgemeinen Verständnis diente und zudem die Informationsausbeute sowohl quantitativ als auch qualitativ erhöhte. Bei der Frageform handelte es sich, wie es allgemein von BORTZ und DÖRING (vgl. 1995, S. 194) für, ein wissenschaftlich neues Problemfeld beschreibende Erkundungsstudien angeraten wird, bis auf wenige Ausnahmen um offen gehaltene Fragen. Diese Vorgehensweise ist einerseits dadurch gekennzeichnet, daß sie oftmals eine Zuordnung der Aussagen zu quantitativ auswertbaren Antwortkategorien erschwert und zum Teil sogar unmöglich macht. Andererseits können aufgrund der - nicht wie bei geschlossenen Fragestellungen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten komplexere Informationen erhoben werden, die in der Regel einen tieferen Einblick in das bisher unerforschte Untersuchungsfeld ermöglichen, so daß sich die Marketingaktivitäten der Alten- und Pflegeheime teilweise detaillierter und differenzierter beschreiben lassen und zudem eine umfassende Materialbasis für weitere dezidierte Studien zur Verfügung steht (vgl. BORTZ/DÖRING, 1995, S. 194). Im Rahmen der Überlegungen zur Art und Weise der Dokumentation der Interviews wurde in Bezug auf die Zielsetzung der Studie und das Thema der Arbeit von der Möglichkeit, Audioaufzeichnungen durchzuführen, Abstand genommen, da in diesem Fall der Aufwand dafür zu hoch erschien. Die Tonbanddokumentation bietet zwar insbesondere bei unstrukturierten Interviews den Vorteil, das Risiko der Informationsverfälschung zu minimieren, da die gewonnenen Informationen nach dem Gespräch überprüft und somit die Gefahr einer fehlerhaften Auswertung reduziert werden können (vgl. BORTZ/DÖRING, 1995, S. 283 ff.). Aufgrund der Konzeption der Studie und der Struktur des Interviewleitfadens konnte aber die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten und Datenverfremdungen als gering eingeschätzt werden, so daß das Protokollieren der Äußerungen der Befragten zum größten Teil in Stichworten, einige Aussagen auch im Orginalzitat, keine elementaren bzw. verfälschenden Auswirkungen auf die Ergebnisse der Untersuchung erwarten ließ. In einem anderen Kontext wäre jedoch der Einsatz der Tonbanddokumentation durchaus als sinnvoll und zweckmäßig zu bezeichnen gewesen. Um eine ausreichende Aussagekraft der Ergebnisse bzw. Trends zu gewährleisten, sollten bei der Studie nicht weniger als 15 Heimleitungen interviewt werden. Die Befragung der Heimleitungen garantiert, daß die Interviewpartner als die obersten Führungskräfte des Heimes und Experten für die Marketingaktivitäten in alle grundsätzlichen Vorgänge der Einrichtung involviert sind. Außerdem ist davon auszugehen, daß diese Personengruppe über ressortübergreifendes Wissen verfügt und sich schon aufgrund ihrer Position mit Marketing- bzw. Profilierungsfragen auseinandergesetzt hat. Insofern kann man erwarten, von einer Heimleitung für die Untersuchung relevante Auskünfte über das "Heim-Marketing" zu erhalten (vgl. PANTENBURG, 1996, S. 185). Als entscheidendes Kriterium für die Teilnahme eines Heimes an der Studie wurde ein abgeschlossener Versorgungsvertrag sowohl nach § 93 Abs. 2 BSHG als auch nach § 72 SGB XI angesehen, durch den die jeweilige Einrichtung als Alten- und Pflegeheim zur vollstationären Betreuung und Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen aller Pflegestufen (0 bis III, vgl. § 15 SGB XI) zugelassen wird. Zusätzlich wurde darauf geachtet, daß sowohl städtisch als auch ländlich gelegene Heime befragt wurden. Ein weiterer Gesichtspunkt war, daß die interviewten Heimleitungen schon mindestens ein Jahr lang in dieser Funktion tätig sein mußten und damit von einer Mindesterfahrung in dieser Funktion ausgegangen werden konnte. Die Befragung der HeimleiterInnen fand in der Zeit vom 16. Februar bis zum 20. März 1998 an insgesamt 13 Tagen statt. Die Dauer der Interviews lag zwischen 60 und 180 Minuten, der Durchschnitt betrug 100 Minuten. Insgesamt kam es zu einem zweimaligen Kontakt mit den HeimleiterInnen, wobei in einem telefonischen Vorgespräch das Untersuchungsvorhaben, der Verwendungszweck und die Anonymisierung der Daten erläutert wurden, dem sich bei gezeigter Teilnahmebereitschaft eine Terminvereinbarung für das eigentliche Interview anschloß 22 . Alle Befragungen wurden zur verabredeten Zeit in den Büros der HeimleiterInnen ohne Anwesenheit einer dritten Person durchgeführt. Das Verhältnis zwischen Interviewer und den Befragten gestaltete sich weitgehend ähnlich positiv, die Interviewatmosphäre war jeweils durchweg freundlich und entspannt. 22 Lediglich vier (20 %) der insgesamt 20 angesprochenen Heimleitungen waren aufgrund von terminlicher Überlastung nicht bereit, an der Studie teilzunehmen. 5.1.3 Der teilstrukturierte Interviewleitfaden Der Interviewleitfaden "Marketing im Alten- und Pflegeheim" gliedert sich in die Bereich ● ● ● ● ● ● ● Situation des Unternehmens, Rahmenbedingungen, Marketingsituationsanalyse, Marketing-Mix, Marketingstrategien, Qualitätsmanagement und Zusammenarbeit mit den Pflegekassen. Innerhalb des ersten Interviewteils wurden allgemeine Angaben, wie die Trägerschaft, die Rechtsform und das Leistungsspektrum bzw. die Leistungsarten, und aktuelle Daten, wie die Anzahl der Bewohnerplätze, differenziert nach den Stationen und den Leistungsarten, sowie die durchschnittliche Auslastung der Einrichtung erfragt. Der zweite Fragenkomplex beschäftigte sich mit den Rahmenbedingungen innerhalb des Heimes, d. h., es wurden die Einstellung des Trägers zum Marketing, die Entscheidungsträger über die Marketingaktivitäten, die Existenz von speziellen Planstellen, das Marketingwissen der Führungskräfte und deren diesbezüglichen Fortbildungsambitionen ermittelt. Der dritte Abschnitt des Leitfadens thematisierte die Aktivitäten des Heimes in Richtung der Analyse der Marketingsituation. Neben eventuell bereits durchgeführten Untersuchungen interessierte hier die Form der Kritikerhebung, die Größe des Einzugsgebietes und dessen Bewohnerpotential, der Marktanteil, die Konkurrenzsituation, die eingeschätzte Position der eigenen Einrichtung im Vergleich zu den Mitbewerbern und in der Öffentlichkeit besonders bekannte und geschätzte Dienstleistungen des Heimes. Im Rahmen des vierten Themenbereiches waren Fragen zur Gestaltung des marketingpolitischen Instrumentariums mit dem Schwerpunkt auf angebotspolitischen, distributionspolitischen und kommunikationspolitischen Aspekten zu beantworten. Der fünfte Fragenkomplex hatte die marketingstrategische Vorgehensweise des Heimes zum Inhalt. Von besonderem Interesse waren dabei die Frage nach der Existenz eines Marketingplanes, dem Anteil marketingrelevanter Themen in den Sitzungen des Trägers, der Kostentransparenz, der Steigerung der Erträge durch eine Ausdehnung oder Spezialisierung des Kernleistungsspektrums sowie der vertikalen und horizontalen Kooperation mit anderen Unternehmen. Der sechste Themenbereich befaßte sich mit dem Qualitätsmanagement der Einrichtung und den damit verbundenen qualitätssichernden Maßnahmen. Den Abschluß des Interviewleitfadens (siebter Themenbereich) bildete die Frage nach der Haltung der Pflegekassen gegenüber den Marketingaktivitäten des Heimes und deren mögliche Einflußnahme. 5.1.4 Die befragten Alten- und Pflegeheime An der durchgeführten Befragung beteiligten sich 16 HeimleiterInnen von privaten, öffentlichen und freigemeinnützigen Alten- und Pflegeheimen aus Nordrhein-Westfalen und dem Südwesten Bayerns. Elf der Einrichtungen sind im städtischen Bereich angesiedelt, die restlichen fünf Heime in ländlichen Regionen. Unterschieden im Hinblick auf die Trägerschaft setzen sich die befragten Heime wie folgt zusammen: Tab. 7: Trägerschaft der befragten Alten- und Pflegeheime Trägerschaft Bundesland Privat Öffentlich Freigemeinnützig Gesamt Bayern 1 1 6 8 Nordrhein-Westfalen 0 3 5 8 Gesamt 1 4 11 16 Bei der Rechtsform handelt es sich um fünf gemeinnützige Stiftungen, zwei gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbH), vier eingetragene Vereine (e. V.), drei Eigenbetriebe, einen Regiebetrieb sowie einen Gewerbebetrieb. Tab. 8: Rechtsform der befragten Alten- und Pflegeheime Rechtsform Land Stiftung gGmbH e. V. Sonstige Gesamt Bayern 4 0 2 2 (1Gewerbebetrieb, 1 Regiebetrieb) 8 NordrheinWestfalen 1 2 2 3 (3 Eigenbetriebe) 8 Gesamt 5 2 4 5 16 Neben dem für ein Alten- und Pflegeheim klassischen Versorgungsangebot der vollstationären Pflege und Betreuung nach § 43 SGB XI und § 93 BSHG bieten sechs Einrichtungen noch zusätzlich die Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, eine die Tagespflege nach § 41 SGB XI sowie vier betreutes Wohnen an. Drei Heime halten außerdem einen ambulanten Pflegedienst für die Dienstleistungserbringung nach § 36 SGB XI und § 37 SGB V vor, der auch gleichzeitig das betreute Wohnens versorgt. Eine Einrichtung ergänzt ihr Leistungsspektrum durch einen Seniorenserviceruf, vergleichbar mit dem sogenannten Hausnotruf anderer Anbieter, eine im Aufbau befindliche Seniorenbildungsstätte, eine Wohnraumanpassungsberatungsstelle und ein seniorengerechtes Ferienhaus. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die an der Studie beteiligten Heime entweder nur vollstationäre Leistungen erbringen oder bestrebt sind, über im Durchschnitt zwei weitere Leistungsbereiche das Angebotsspektrum abzurunden. Eine Besonderheit bilden hier die sechs im Bereich der Arbeiterwohlfahrt, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Caritas und der Diakonie (kreis-) verbandlich organisierten Heime, die zwar einerseits ausschließlich vollstationäre Dienstleistungen erbringen, jedoch andererseits indirekt auch zusätzliche Leistungen vorhalten, da der Verband als Träger in der Regel weitere soziale Dienstleistungen anbietet, auf die potentielle Interessenten verwiesen werden können. Die Alten- und Pflegeheime verfügen über eine Kapazität von 26 bis zu 170 Bewohnerplätzen bei 40 bis 60 % Einzelzimmern, im Durchschnitt können sie 116 Bewohner aufnehmen. Der Anteil der Kurzzeitpflegeplätze liegt zwischen 2 und 15, der der reinen Altenheimplätze zwischen 25 und 34 sowie der des betreuten Wohnens zwischen 22 und 27 Wohnungen für ein bis zwei Personen. Die eine Tagespflege anbietende Einrichtung ist in der Lage, bis zu zehn Patienten aufzunehmen. Die Größe der einzelnen Pflege- und Wohnbereiche umfaßt 17 bis 53 Bewohnerplätze, durchschnittlich sind es 28 Bewohner pro Pflegestation bzw. Wohnbereich. Für den Zeitraum 01.01.1997 bis Anfang 1998 betrug die durchschnittliche Gesamtauslastung der befragten Heime 97 bis 100 Prozent, im Mittel etwa 98,7 Prozent. 5.2 Ergebnisdarstellung und Diskussion 5.2.1 Rahmenbedingungen Von grundlegender Bedeutung für die Gestaltung der Marketingaktivitäten ist die Einstellung des Trägers der Einrichtung im Hinblick auf diese marktorientierte Unternehmensführungsphilosophie. Bis auf den Träger eines freigemeinnützigen Heimes, der Marketing ausschließlich negativ mit "Verkaufen" assoziiert, stehen die übrigen dem Marketinggedanken sehr positiv gegenüber und sehen für diesen Bereich einen großen Nachholbedarf. In der Vergangenheit bestand jedoch aufgrund der guten Heimauslastung kein Anlaß, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so daß dieses somit vernachlässigt wurde. Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit einer positiven Mundpropaganda hält die Mehrheit der Träger (13) für existenznotwendig. Allerdings ist in diesem Zusammenhang bei vielen Trägern (14) noch nicht einmal ansatzweise geklärt, wie ein umfassendes Marketingkonzept, geschweige denn die Umsetzung in die Praxis, aussehen könnte. Insofern erscheint es nur konsequent, daß dann die Heimleitung in der Regel die Kompetenz besitzt, über die einzelnen Marketingaktivitäten verantwortlich im Rahmen des vorgegebenen Budgets, bei höheren Beträgen nach Rücksprache mit dem Träger, entscheiden zu können, um vor Ort die nötige Reagibilität zu haben. Die Ausnahme bildet ein einem Kreisverband einer Wohlfahrtsorganisation angehörendes Heim, bei dem der sogenannte Kreisvorstand über alle Marketingaktivitäten die Entscheidungen treffen muß, so daß aus der Sicht der betroffenen Heimleitung die meisten Vorhaben infolge dieses Instanzenweges zwangsläufig blockiert werden. Um die Möglichkeiten des Marketings optimal ausnutzen und die Maßnahmen aufeinander gezielt abstimmen zu können, empfiehlt sich die Schaffung einer eigenen Planstelle. In keiner Einrichtungen wurde bisher eine entsprechende Stelle eingerichtet, die Gestaltung des Marketings fällt primär in den Aufgabenbereich der Heimleitung. 9 Heimleitungen (56,25 %) kümmern sich neben ihren sonstigen Tätigkeiten um das Marketing und erhalten keine weitere Unterstützung, in einer Einrichtung sind einzelne Bereiche des Marketings auf mehrere Stellen verteilt worden, die 6 verbandlich organisierten Heime bekommen Hilfestellung in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit durch ihre Verbände, die hierfür im Durchschnitt einen Mitarbeiter eingestellt haben. Auf die Frage, ob sich die Führungskräfte (z. B. Heim-, Pflegedienst-, Verwaltungsleitung) Marketingwissen angeeignet hätten, antworteten immerhin knapp die Hälfte der Befragten (7), daß dies bisher nicht geschehen bzw. das vorhandene Wissen aus der praktischen Erfahrung der Leitungstätigkeit heraus gewachsen sei ("Learning by doing"). Fünf Heimleitungen (31,25 %) gaben an, daß das entsprechende Wissen im Rahmen eines absolvierten Studiums, der Heimleiterausbildung und/oder sonstiger für die Leitungsposition relevanter Weiterbildungen vermittelt worden sei. In zwei Einrichtungen (12,5 %) besuchten die Führungskräfte eine einschlägige Fortbildung zum Thema "Öffentlichkeits- und Pressearbeit", während in den verbleibenden zwei Heimen die Wissensaneignung über das Eigenstudium der Fachliteratur stattfindet. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß 81,25 % (13) der interviewten Alten- und Pflegeheime für die Zukunft trotz der allgemein erkannten Bedeutung der Thematik keine Teilnahme an gezielten Marketingfortbildungen planen, sondern sich in diesem und im nächsten Jahr auf die Themenbereiche Qualitätssicherung, EDV, sowie Kosten-Leistungs-Rechnung und Controlling konzentrieren wollen. Abb. 3: Sind Marketingfortbildungen für die Zukunft geplant? 5.2.2 Marketingsituationsanalyse Die Ausrichtung der Aktivitäten auf die Zielgruppen des Unternehmens Alten- und Pflegeheim beginnt bei der Ermittlung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen sowie des Bedarfs an sozialen Dienstleistungen generell. Aufgrund der beständig hohen Auslastung der Heimkapazitäten sahen fast alle Einrichtungen (14) bisher keinen Grund, sich mit dem Thema "Marketingsituationsanalyse" näher zu befassen. Lediglich 2 Heime haben bereits diesbezüglich erste eigene Untersuchungen durchgeführt. Das eine Heim richtete eine schriftliche Befragung an die die Bewohner betreuenden Hausärzte mit dem Ziel, die Anzahl der sonstigen älteren Patienten und deren Krankheitsspektrum zu ermitteln, um anhand dieser Angaben abschätzen zu können, wie groß das Potential der hilfe- und pflegebedürftigen Bewohner in den nächsten Jahren sein wird und welche Pflegeintensität zu erwarten ist. Die andere Einrichtung erhob bei den örtlichen Seniorenclubs im Vorfeld der Einführung des Angebotes des Betreuten Wohnens Daten in Bezug auf ein potentielles Interesse bzw. einen Bedarf an dieser Dienstleistung aus der Sicht der älteren Menschen, die als notwendig angesehenen vorzuhaltenen unterstützenden Leistungen, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Akzeptanz des beabsichtigten Standortes. Abb. 4: Wurde bereits die Marketingsituation erforscht? Die kontinuierliche Kritikerhebung ist eine nicht zu unterschätzende Maßnahme, um den Zufriedenheitsgrad insbesondere der Bewohner und deren Angehörigen als wichtigste Kunden des Alten- und Pflegeheimes beurteilen zu können. Alle Heimleitungen sind davon überzeugt, daß in ihren Einrichtungen eine Atmosphäre herrscht, die es den Bewohnern ermöglicht, sich mit ihren Anregungen, Ideen und ihrer Kritik an alle Mitarbeiter des Hauses wenden und mit einem offenen Ohr rechnen zu können. Die auf diese Weise erhaltenen Informationen werden dann über die unmittelbaren Vorgesetzten der Mitarbeiter an die Heimleitung bzw. das Leitungsteam weitergeleitet. In besonderen Fällen gelten allgemein sowohl die Heim- als auch die Pflegedienstleitung als die direkten Anlaufstellen. Großen Wert legen die befragten Einrichtungen zudem auf den regelmäßigen und transparenten Informationsaustausch mit dem Heimbeirat, dem eine Art Schnittstellenfunktion zugesprochen wird, da hier Vorschläge und Kritik gesammelt sowie mögliche Veränderungen diskutiert werden können. 12 Heime (75,0 %) veranstalten außerdem ein- bis zweimal pro Jahr Angehörigenabende 23, die zum einen als eine Plattform für die Beschwerden und zum anderen als ein Medium gedacht sind, das Verständnis für die Erkrankungen der Bewohner zu intensivieren sowie die Abläufe in der Einrichtung transparent zu machen. Um die Reaktionszeit auf die vorgebrachten Kritikpunkte zu reduzieren und ein systematischeres Beschwerdemanagement zu gewährleisten, hat eine Einrichtung vier feste Ansprechpartner, die gleichzeitig auch als Qualitätsbeauftragte fungieren, Anfang dieses Jahres benannt. Diese sollen in der Zukunft für die Bearbeitung der "Reklamationen" mit Hilfe von Checklisten verantwortlich sein. 23Angehörigenabende sind gleichzeitig auch ein Instrument der externen Öffentlichkeitsarbeit Die Frage nach der Größe des Heimeinzugsgebietes beantworteten die Befragten relativ zügig und genau, indem sie die Orte am Rand dieses Gebietes auflisteten. Die Anzahl der Einwohner in diesem Einzugsgebiet war allerdings im Großen und Ganzen unbekannt und mußte geschätzt werden. In städtischen Bereichen beträgt den Angaben der Heimleitungen zufolge die Einzugsgebietsgröße durchschnittlich etwa 10 bis 15 km2, in ländlichen Regionen etwa 40 km2, wobei die Anzahl der Einwohner zwischen 15.000 (Land) und 500.000 (Stadt) beziffert wurde. Weitaus schwieriger gestaltete sich die Nennung des Bewohnerpotentials im Einzugsgebiet des einzelnen Heimes. Neun der Befragten (56,25 %) wußten darauf keine Antwort zu geben, während vier (25,0 %) zögernd versuchten, mit Hilfe der Addition der in der vorherigen Frage geschätzten Einwohnerzahlen das hier interessierende Potential zu ermitteln. Zwei Interviewte (12,5 %) waren nach relativ kurzer Überlegungszeit in der Lage, das vermutete Bewohnerpotential zu nennen, lediglich ein Gesprächspartner (6,25 %) konnte die konkrete Antwort sofort geben. Verwirrung stiftete im Anschluß daran die Frage nach der Höhe des Marktanteils (Siehe auch Abschnitt 4.1.2, „Ebene des Umfeldes“) der einzelnen Dienstleistungsbereiche. Bis auf eine Einrichtung wurden bisher keine Marktanteilsberechnungen durchgeführt, zumal den meisten Befragten (11) auch unklar war, wie der Marktanteil berechnet werden kann. In zwei Heimen ist man der Ansicht, daß es für die eigene Einrichtung praktisch keine Konkurrenz gibt, was einem Marktanteil von 100 % entspräche. Eine Heimleitung versuchte, den Marktanteil mit Hilfe der Nachfragen von potentiellen Bewohnern hochzurechnen. Im Zweifel muß aufgrund der einzelnen Reaktionen auf diese und die vorherige Frage davon ausgegangen werden (Zitat: "Ach du liebes bißchen, mit der Frage habe ich nicht gerechnet!"), daß sich die Interviewten mit diesen Themen anscheinend noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Die Beschreibung der Mitbewerber bzw. Konkurrenten wurde in Abhängigkeit von dem Umfang der vorhandenen Informationen sehr unterschiedlich vorgenommen. Alle befragten Heimleitungen sind sich der durch die Pflegeversicherung initiierten Konkurrenzsituation bewußt und können ihre direkten Mitbewerber benennen, sie verfügen jedoch nur zu etwa einem Drittel (5) über differenzierte Informationen uber die Konkurrenz im Hinblick auf deren Leistungsspektrum, Kapazität, Pflegeentgelte und Preis-Leistungs-Verhältnis, Ausstattung sowie baulichen Zustand. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß keine Einrichtung von einem spürbaren Wettbewerbsdruck spricht, sondern vielmehr das allgemeine Interesse deutlich wird, die momentane Situation, die keinen unmittelbaren existenzbedrohenden Charakter hat und die gute Auslastung nicht gefährdet, zu erhalten bzw. zu wahren, und sich nicht durch ein noch ungewohntes progressives Marketing möglicherweise unbeliebt zu machen. Anschließend wurden die Gesprächspartner aufgefordert, die Marktposition des eigenen Heimes im Vergleich mit den Konkurrenten zu bewerten. Drei ländlich gelegene Einrichtungen sehen sich aufgrund der aus ihrer Sicht unmittelbar fehlenden Konkurrenz auf dem ersten Platz vor Ort. Die übrigen Befragten kommen mit Hilfe der vier Kriterien Dienstleistungsangebot, Preis-LeistungsVerhältnis, baulicher Zustand und Standort zu Einschätzungen, die von vorsichtigen Äußerungen wie "konkurrenzfähig", "preislich in der Mitte", "nicht schlechter und besser als die anderen, Marktführer ist ein anderes Heim" und "aufgrund einer Stagnation in der Entwicklung jetzt nur noch Mittelmaß" über "vom Angebot her im oberen Drittel" bis hin zu der Ansicht reichen, infolge des Standortes und des modernsten baulichen Zustandes die erste Position inne zu haben sowie "nach einem anstrengenden Kampf jetzt Marktführer" zu sein. Im Mittelpunkt der folgenden Frage standen diejenigen Leistungen aus dem angebotenen Leistungsspektrum, für die das Heim in der Öffentlichkeit besonders bekannt ist und geschätzt wird. Die Aussagen der Heimleitungen machen deutlich, daß die vor Jahren in der Öffentlichkeit als die Differenzierungskriterien geltenden Aspekte "gute Pflege" und "freundliche Atmosphäre" heute größtenteils als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden. Im einzelnen betrachten die Interviewten aufgrund des von Angehörigen und potentiellen Bewohnern erhaltenen Feedbacks beispielsweise ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● das sehr individuelle Eingehen auf die Wünsche der Bewohner, die ausgesprochene Herzlichkeit des Personals und "übergroße" Mitarbeiterfreundlichkeit, die die "Wärme im Haus" bzw. das positive Klima spüren ließen, die geringe Personalfluktuation, das umfangreiche, die Bewohner in das "normale Leben" integrierende und die Gemeinschaft fördernde soziale Betreuungsangebot bzw. Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogramm, das Offensein für neue Ideen, die Spezialisierung auf besondere Krankheitsbilder, wie z. B. die Einrichtung einer Alzheimergruppe, die Selbsthilfegruppen für Angehörige, das gute Essen, die moderne, offene Architektur und Ausstattung, der sich um die Einrichtung befindliche Park bzw. "die Lage im Grünen", die zentrale Lage und günstige Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ("Mercedes-Qualität zu VW-Preisen") als die besonders hervorzuhebenden Leistungen, die zudem in einem nicht zu unterschätzendem Maß den Ruf der Einrichtung mit beeinflussen würden. 5.2.3 Marketing-Mix Die Frage nach dem Umfang der Serviceleistungen (Siehe auch Abschnitt 4.3.4, „Serviceleistungsprogramm“) verdeutlicht, daß sich alle Einrichtungen in der Gestaltung dieses Bereiches an dem Angebot der Konkurrenz orientieren. Andachtsraum bzw. Kapelle, Café, Friseur, Nähstube, Briefmarkenverkauf, Einkaufsservice und Bibliothek können als Standard betrachtet werden, wobei letztere sich generell im Aufbau befindet. Bis auf drei Heime (18,75 %) verfügen zudem die übrigen über einen Kiosk mit einem speziell auf das Haus abgestimmten Sortiment. "Schalterstunden" eines Geldinstituts haben nur ein Drittel der Befragten (5) im Angebot, ebenfalls die Ausnahme bildet die Vermietung von Gästezimmern für die Besucher der Bewohner (2). Knapp die Hälfte (7) der Einrichtungen bietet das Eindecken der Geburtstagstafel und die Organisation von privaten Festen der Bewohner an. Für vier Heime (25,0 %) könnte es sich in der Zukunft als Nachteil erweisen, kein eigenes Fahrzeug zu besitzen und somit keinen Fahrdienst vorhalten zu können, so daß die Bewohner gezwungen sind, sich selbst beweglich machen zu müssen. Im Hinblick auf die Möglichkeit, nach § 88 SGB XI über den Grundbedarf hinausgehende Zusatzleistungen zu definieren und abzurechnen, agieren fast alle Heime aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlagen sehr zurückhaltend. Lediglich die private Einrichtung macht hiervon Gebrauch (Haare eindrehen, Mani- und Pediküre, Fahrten zum Arzt über 9 km Länge), ein Heim arbeitet momentan in Verbindung mit einem neuen Heimvertrag ein Konzept aus, während fünf die Einführung noch für dieses Jahr planen. Ein weiteres Heim macht sein Verhalten von dem Ergebnis der anstehenden Pflegesatzverhandlungen abhängig. Abb. 5: Werden Zusatzleistungen angeboten? Wahlmöglichkeiten bei den Kernleistungen des Unterkunfts- und Verpflegungsprogrammes ( Siehe auch Abschnitt 4.3.2, „Unterkunfts- und Verpflegungsprogramm“) haben die Bewohner in der Regel bei den Mahlzeiten. Alle an der Studie beteiligten Einrichtungen bieten zum Frühstück und zum Abendessen eine buffetähnliche Auswahl an, mittags können sich die Bewohner bis auf in drei Heimen zwischen mindestens zwei Alternativen entscheiden, sieben Einrichtungen arbeiten bereits mit dem System des Komponentenessens. Aufgrund des Einzelzimmeranteils zwischen 40 und 60 % und der innerhalb des Heimes existenten Wartelisten ist die Chance für neue Bewohner, ein solches direkt beim Einzug zu erhalten, eher als gering und damit diese Auswahlmöglichkeit als eingeschränkt zu bezeichnen. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die künftigen älteren Generationen, die heute schon wesentlich stärker ihren individuellen Lebensraum beanspruchen, diesen Zustand akzeptieren werden. Die Darstellung des Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogrammes (Siehe auch Abschnitt 4.3.3, „Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogramm“) ergibt, daß alle Einrichtungen ihr Angebot ähnlich gestalten. Die gesamten Angebote, angefangen vom Basteln bis hin zu Kaffeenachmittagen, sind im Allgemeinen für die Bewohner kostenlos, nur bei größeren Ausflügen mit einem Reisebus wird in der Regel ein geringer Teilnehmerbeitrag erhoben. Festzustellen ist, daß die Heime, die auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern und/oder örtlichen Vereinen zurückgreifen können, meistens in der Lage sind, ein umfangreicheres Programm organisieren und den Bewohnern anbieten zu können. Außerdem veranstalten die Einrichtungen, die einen eigenen Kleinbus besitzen, deutlich häufiger Ausflüge in Kleingruppen, so daß die Bewohner noch mehr Abwechslung außerhalb des Heimes erfahren. Als eine Besonderheit stellt sich die Organisation von Ferienfahrten dar, wie dieses zwei Einrichtungen tun. Der folgende Abschnitt beschäftigte sich mit der externen Öffentlichkeitsarbeit der Alten- und Pflegeheime (Siehe auch Abschnitt 4.6.1.1, „Externe Öffentlichkeitsarbeit“). Immerhin 37,5 % (6) der Befragten nutzen weder eine Heimbroschüre noch eine Hauszeitung als Medien, um sich in der Öffentlichkeit (positiv) darzustellen. Diese Tatsache resultiert zum einen aus den hohen Produktionskosten, die sich allerdings durch die Vergabe von Werbeflächen drastisch reduzieren ließen (Zu beachten ist jedoch, daß mit den dann sinkenden Kosten auch die Übersichtlichkeit dieser Medien nachläßt, wie der direkte Vergleich verschiedener Broschüren und Zeitungen gezeigt hat. Es erscheint deshalb angeraten, einen für das Heim vorteilhaften Mittelweg einzuschlagen.). Zum anderen werden für die Nichtexistenz einer Broschüre noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen verantwortlich gemacht, die erst beendet sein sollen, bevor dann endgültige Unterlagen veröffentlich werden. Sieben Einrichtungen (43,75 %) verfügen über eine entsprechende, sowohl in der Einrichtung selbst als auch in Arztpraxen und Apotheken ausgelegte Broschüre, die in erster Linie für die Information von Interessenten, also von potentiellen Bewohnern und deren Angehörigen, gedacht ist. Ebenfalls sieben Heime "publizieren" eine Hauszeitung, mit der sie aktuelle und variable Informationen an alle Zielgruppen weiterzugeben beabsichtigen. Diese Zeitungen erscheinen in der Regel regelmäßig (monatlich, viertel- oder halbjährlich) und werden im Heim, in den umliegenden Geschäften, aber auch in Arztpraxen und Apotheken verteilt. Für ein Heim besteht zudem die Möglichkeit, Ausschnitte der Zeitung im Gemeindebrief der Pfarrgemeinde zu veröffentlichen. Die verbleibenden drei Einrichtungen (18,75 %) setzen ein Faltblatt bzw. einen Falter als Ersatz für eine Broschüre oder Zeitung ein. Begründet wird dieser Schritt damit, daß auf diese Weise eine größere Aktualität gewährleistet werden kann. Außerdem seien die Kosten wesentlich geringer, so daß man nicht auf Werbung angewiesen sei, zumal die Einrichtung dieses Medium selber ohne Probleme herstellen könne. Die Äußerungen hinsichtlich der weiteren PR-Materialien veranschaulichen, daß sich 75,0 % der Interviewten (12) auf die beschriebenen Medien Broschüre und Zeitung konzentrieren. Nur vier Heime können zusätzlich zum Beispiel auf einen Videofilm über Feste und Veranstaltungen, einen Filmbericht des Regionalfernsehens, einen noch unbearbeiteten Pressespiegel und ein Informationsheft für neue Bewohner zurückgreifen. Die Frage nach dem bereits durchgeführten Tag der offenen Tür oder einer ähnlichen Veranstaltung wurde von den meisten Interviewten (12) positiv beantwortet. Praktisch jedes Heim hat solche Tage bereits bei der Eröffnung des Hauses oder der Fertigstellung eines Bauabschnittes veranstaltet. Regelmäßig, d. h., alle ein bis zwei Jahre, werden diese größeren Ereignisse organisiert, wobei meistens eine Mischform zwischen einem Tag der offenen Tür und einem Sommerfest unter Beteiligung des Heimumfeldes durchgeführt wird. Besondere Beachtung findet hierbei der Schutz der persönlichen Sphäre der Bewohner, so daß an diesen Tagen keine Hausbesichtigungen stattfinden, sondern diese individuell nach Absprache erfolgen. Ein Viertel der Befragten bezweifelt die Wirkung von diesen regelmäßigen Großveranstaltungen und favorisiert dementsprechend die internen Veranstaltungen, die den Bewohnern mehr zugute kommen würden. Bei der Gestaltung der internen Öffentlichkeitsarbeit legen die befragten Einrichtungen besonderen Wert auf die Durchführung von Besprechungen auf allen Ebenen, um eine informatorische Transparenz herzustellen und alle Mitarbeiter in die Abläufe zu integrieren. Über das Angebot der Teilnahme an internen und externen Fortbildungen sind die Heimleitungen zudem bestrebt, unterstützend auf die Mitarbeitermotivation einzuwirken, die Flexibilität der Mitarbeiter zu erhöhen und die Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen zu fördern, aber auch die Notwendigkeit dieser Maßnahme aufgrund der an die Pflege und Betreuung alter Menschen gerichteten zunehmenden Anforderungen zu verdeutlichen. Zur Erleichterung des Einarbeitens von neuen Mitarbeitern arbeiten drei Heime mit einem Einarbeitungskonzept. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Erarbeitung und Festlegung von einheitlichen intern und extern gerichteten Verhaltensweisen bzw. "Spielregeln", wie beispielsweise das Melden am Telefon oder der Umgang mit Bewohnerkritik, denen die Interviewten im Hinblick auf die Darstellung in der Öffentlichkeit und damit das Image bei den erfolgsrelevanten Zielgruppen eine hohe Bedeutung beimessen. In diesem Zusammenhang haben bereits 25,0 % der Einrichtungen (4) eine Unternehmensphilosophie implementiert und orientieren sich an dieser, weitere 25,0 % befinden sich in der Entwicklungsphase und 50,0 % planen zumindest für die nähere Zukunft, dieses Thema anzugehen. Abb. 6: Implementierungsstand der Unternehmensphilosophie Die Kontakte zu den Medien beschränken sich in der Regel (13) auf sporadische Kontakte zur Presse (Siehe auch Abschnitt 4.6.2, „Pressarbeit“), die entweder zu besonderen Veranstaltungen eingeladen oder für die ein kurzer Artikel über diese verfaßt wird. Den sechs verbandlich organisierten Einrichtungen nehmen deren Kreisgeschäftsstellen einen Großteil dieses Aufgabenfeldes ab. Nur drei Heime wenden sich regelmäßig alle zwei bis vier Wochen an die lokalen Zeitungen und informieren diese über die Aktivitäten der Einrichtung oder senden Redaktionsbeiträge zu Fachthemen ein. Hier ist die Zusammenarbeit bereits so weit fortgeschritten, daß sich die Zeitungen umgekehrt ebenfalls regelmäßig erkundigen, ob es etwas zu berichten gibt. In zwei Fällen bestehen sogar gelegentliche Kontakte zu den lokalen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Da Werbeanzeigen (Siehe auch Abschnitt 4.6.3, „Werbung“) in Relation zu der guten Auslastung allgemein als zu kostenaufwendig betrachtet werden, inseriert lediglich die Hälfte der Heime ab und zu in den Printmedien oder in Prospekten der Krankenkassen. Die letzte Frage zum Bereich des marketingpolitischen Instrumentariums betraf die Aktivitäten des Soziosponsorings (Siehe auch Abschnitt 4.6.4, Soziosponsoring“.). Vier Einrichtungen lehnen ein Engagement in dieser Richtung grundsätzlich ab. Drei davon begründen diese Haltung damit, daß sie ein Anheizen des Konkurrenzkampfes vermeiden möchten. Bei dem vierten Heim befürchtet der Träger generell einen Imageverlust, sobald bekannt wird, daß die Einrichtung durch Sponsoren unterstützt wird. Die übrigen Einrichtungen betreiben kein kontinuierliches Soziosponsoring, sondern sprechen insbesondere Firmen und Geschäftsleute, mit denen sie in Geschäftsbeziehungen stehen, gezielt für die Finanzierung einzelner Maßnahmen an. So werden beispielsweise im Vorfeld der Organisation eines Sommerfestes die Apotheken, Sanitätshäuser und Zulieferer um Sachspenden als Preise für eine geplante Tombola gebeten. Zudem sind alle Einrichtungen, die Broschüren und/oder Hauszeitungen veröffentlichen, daran interessiert, diese zumindest kostenneutral über Inserate zu finanzieren. Zusätzlich verfügen bereits zwei der interviewten Heime über einen kleinere Projekte, wie zum Beispiel das Betreiben des Kiosks, subventionierenden Förderverein und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Sonstige finanzielle Einzelspenden erhalten die Häuser nach eigenen Aussagen nur sporadisch, so daß das Soziosponsoring keine kalkulierbare Größe darstellt. 5.2.4 Marketingstrategien Nicht unbedingt überraschend ist das Ergebnis der Frage nach der Existenz eines formal festgelegten Marketingplans. Keine Einrichtung hat bisher ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, das den umfassenden, aufeinander abgestimmten und ganzheitlichen Einsatz aller Marketinginstrumente beschreibt. Lediglich drei Heime haben diesbezüglich erste Schritte unternommen, von denen eines die zentralen Ziele des Marketings in den Geschäftsplan aufgenommen hat. Die beiden anderen Einrichtungen haben bereits eine erste Konzeption zur zielgruppenspezifischen Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Inwieweit Marketing generell in Alten- und Pflegeeime bereits Einzug gehalten hat, läßt sich auch am Prozentanteil charakteristischer Themen wie "Marketing", "Zufriedenheit" und "Service" in Arbeitssitzungen des Trägers bzw. der Entscheidungsträger grob ablesen. Der von den Heimleitungen für die eigene Einrichtung geschätzte ungefähre Anteil reicht von 5 bis zu 80 %, wobei die obere Grenze als ein Ausreißer zu interpretieren sein dürfte. Das arithmetische Mittel aller Angaben liegt bei 27 %. Wie von einem Gesprächspartner zu erfahren war, lag dieser Wert bis Mitte letzten Jahres tendenziell bei 0 %. In einer anderen Einrichtung werden marketingspezifische Aspekte nur dann thematisiert, wenn Beschwerden von Bewohnern vorliegen. Das Instrumentarium der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Teilbereich des internen Rechnungswesens auf der Basis der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) ist bereits in 13 Einrichtungen implementiert, während es in den restlichen drei gerade aufgebaut wird, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen (vgl. § 7 PBV). Die damit zusammenhängende Kostentransparenz zur Feststellung ineffizienter Bereiche ist heute erst in sechs Einrichtungen annähernd gewährleistet, wobei diese in der Regel anhand der Pflegestufen und der wichtigsten Kostenstellen (z. B. Pflegedienst, Küche, Wäscherei) realisiert wird. Die anderen zehn Heime sind noch nicht in der Lage, einen aktuellen Soll-Ist-Abgleich zu erstellen und erhalten eine Budgetübersicht nur mit deutlicher Verzögerung (ein bis zwei Monate). Die für die Kostentransparenz notwendigen Voraussetzungen werden jedoch gerade geschaffen bzw. erweitert, die Maßnahmen sollen allgemein bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein. Wäre ein Verzicht auf ineffiziente Bereiche denkbar, wenn sich zum Beispiel aus im Rahmen der KLR durchgeführten Analysen entsprechende Ergebnisse ableiten ließen? Grundsätzlich scheint es in allen Einrichtungen denkbar, unwirtschaftliche Bereiche umzustrukturieren. Ob es dabei zur Auflösung oder lediglich zu einer Verkleinerung eines Bereiches kommt, würde meist der Heimträger entscheiden, wobei sich hier in den vergangenen Jahren größtenteils eine an ökonomischen Aspekten orientiertere Sichtweise entwickelt habe. Die Hälfte der Einrichtungen nennt als Beispiele für bereits entsprechend durchgeführte Maßnahmen die Umstellung der Wäscheversorgung sowie der Gebäude- bzw. Unterhaltsreinigung. Die Interviewten weisen jedoch im Zusammenhang mit der Entscheidungsoption, Bereiche zu schließen bzw. aufzulösen, darauf hin, daß sie die mit den Finanzierungsträger vereinbarten Vorhalteleistungen jederzeit anbieten können müssen, um ihrem Versorgungsauftrag und damit auch den Zielen des Trägers gerecht zu werden. Sind unverzichtbare Bereiche von Ineffizienz betroffen, so ist man allgemein bestrebt, diese insbesondere durch die Veränderung von Arbeitsabläufen unter Einbeziehung der Mitarbeiter wirtschaftlicher zu gestalten. Eines der generellen Ziele der Marktorientierung ist die Bestandssicherung durch Erhaltung bzw. Steigerung der Erträge. In der Befragung wurden zwei Möglichkeiten zur Steigerung der Heimerträge erörtert (Siehe auch Abschnitt 4.2.1, „Marktfeldstrategien“). Eine Ertragssteigerung durch die Ausdehnung des Kernleistungsspektrums ist für fünf Einrichtungen nicht von Interesse, da sie zum einen ihr Angebot als ausreichend betrachten und zum anderen die Anzahl der Mitbewerber in den anderen Sparten für zu hoch halten. Ein Heim macht für diese Zurückhaltung die mit einer Kernleistungsspektrumserweiterung verbundenen Investitionen verantwortlich, die momentan unter keinen Umständen aufgrund der anstehenden Renovierungsmaßnahmen getätigt werden könnten. Acht Interviewte sehen hier für ihre Einrichtung gute Chancen zur horizontalen Diversifikation, wobei sich die geplanten Vorhaben auf die Bereiche voll- und teilstationäre geriatrische Rehabilitation, Kurzzeitpflege, ambulante Pflege, betreutes Wohnen und Essen auf Rädern konzentrieren. Drei Einrichtungen halten infolge ihrer Konkurrenzsituation die laterale Diversifikation für realistischer und beabsichtigen, einen Catering-Party-Service aufzubauen sowie die Leistungen der Wäscherei auch anderen, branchenfremden Unternehmen anzubieten. Die Möglichkeit, die Erträge durch eine Spezialisierung des Leistungsangebotes zu steigern, wird von neun Interviewten (56,25 %) als auf absehbare Zeit unrealistisch eingeschätzt. Die übrigen sieben Heime können sich eine Ausrichtung auf die voll- und teilstationäre Versorgung von Bewohnern mit speziellen Krankheitsbildern (Appalliker, Krebspatienten, gerontopsychiatrische Patienten) vorstellen. Von einer vollkommenen Spezialisierung nimmt diese Gruppe jedoch Abstand, um kein zu einseitiges, unter Umständen auch negatives Image in der Öffentlichkeit aufzubauen. Zwei Einrichtungen haben ihre Ideen bereits umgesetzt und bieten einige vollstationären Pflegeplätze für Appalliker bzw. gerontopsychiatrische Tagespflege an. Gut zwei Drittel der befragten Einrichtungen (11) haben Fremdfirmen im Rahmen einer schriftlich vereinbarten vertikalen Kooperation (Siehe auch Abschnitt 4.2.3, „Kooperationsstrategie“) beauftragt, bestimmte Leistungsbereiche für das Heim zu übernehmen. Hierbei handelt es sich bis auf zwei Ausnahmen (komplette Wäschevergabe) ausschließlich um die Auslagerung der sogenannten Flachwäsche und/oder die teilweise oder vollständige Vergabe der Gebäudereinigung (Boden- und Glasreinigung). Die verbleibenden fünf Heime beabsichtigen keine derartigen Schritte einzuleiten, zumal sie es als eine klassische Aufgabe eines sozial orientierten Unternehmens betrachten, sich auch um Sozialschwache zu kümmern, die oftmals in diesen Bereichen tätig sind. In horizontaler Kooperation mit anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens steht die Hälfte (50,0 %) der an der Untersuchung teilgenommenen Heime, wobei hierbei zu beachten ist, daß die sechs wohlfahrtsverbandlich organisierten Einrichtungen automatisch über ihren Träger einem festen Kooperationsverhältnis angehören (unter anderem gemeinsame Buchhaltung, Personalverwaltung, Public Relations und Werbung). Ein Heim wird im Rahmen eines Förderprogrammes durch ein psychiatrisches Fachkrankenhaus ambulant gerontopsychiatrisch betreut. Die Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang eine einzelne freigemeinnützige Einrichtung, die eine Zusammenarbeit mit fünf anderen vollstationären Anbietern, die nicht in deren direktem Einzugsgebiet liegen, einem ambulanten Pflegedienst sowie einem Hospizverein vertraglich festgelegt hat. Weitere drei befragte Heime (18,75 %) streben eine Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst an, um möglichst frühzeitig mit potentiellen Bewohnern und deren Angehörigen in Kontakt treten und so das Leistungsangebot komplettieren zu können. Die restlichen fünf Heime (31,25 %) halten diesbezügliche Überlegungen momentan nicht für notwendig und planen zumindest für dieses Jahr keine entsprechenden Schritte. Abb. 7: Stehen Sie in Kooperation mit anderen Anbietern von Pflegeleistungen? 5.2.5 Qualitätsmanagement Marketing im Alten- und Pflegeheim bedeutet auch, daß qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbracht werden (müssen). Der Stellenwert des Qualitätsmanagements (Siehe auch Abschnitte 3.4 und 4.7, „Qualitätsmanagement“)und dessen Gestaltung standen im Mittelpunkt der nächsten Frage. Allgemein wird diesem Thema eine große Bedeutung zugeschrieben und sich entsprechend umfangreich engagiert. Alle Einrichtungen sind bestrebt, die Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 80 SGB XI ("Qualitätsvereinbarungen") umzusetzen, wobei sie auf der Basis der Prinzipien des TQM die Internalisierung des Qualitätsbewußtseins bei den Mitarbeitern anstreben. Der Schwerpunkt wird hierbei auf interne Maßnahmen zur Qualitätssicherung gelegt, wie Optimierung der Pflegedokumentation und - planung (gerade auch vor dem Hintergrund der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit der Bewohner durch den MDK), Implementierung und Weiterentwicklung von Verfahrensstandards, regelmäßige Durchführung von Besprechungen auf allen Ebenen, kontinuierliches Angebot von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen und Einrichtung von Qualitätszirkeln gelegt. Zusätzlich hat eine Einrichtung vier Qualitätsbeauftragte benannt, die einen Qualitätskreis bilden, der für die Bearbeitung von Kritik und Verbesserungsvorschlägen sowie die Erfassung des Zufriedenheitsgrades der Bewohner zuständig ist. Vier Heime haben zudem Schwachstellenanalysen durchgeführt, eine Heimleitung hat zu diesem Zweck den MDK in die Einrichtung eingeladen. Drei weitere Heime führen z. Z. die Erfassung der pflegerischen Leistungen über die EDV ein. Das Instrument der Stellenbeschreibung gehört noch nicht in jeder Einrichtung zum Standard, es wird nur von der Hälfte (8) der Heime genutzt. Über ein schriftlich fixiertes Pflegekonzept, das die speziellen pflegetheoretischen bzw. pflegewissenschaftlichen Zielsetzungen und Leitgedanken beschreibt, verfügen lediglich zwei der befragten Einrichtungen, von denen eine sogar ein Qualitätshandbuch ("Qualitätsmanagementhandbuch") besitzt, das neben der Unternehmensphilosophie auch das Pflegekonzept, die organisatorischen Regelungen, die Stellenbeschreibungen, die Erläuterung der Arbeitsweise von Qualitätszirkeln und die bereits implementierten Standards enthält. Weitere fünf Heime entwickeln momentan eine entsprechende, auf das Haus abgestimmte Pflegekonzeption. Eine Zertifizierung nach ISO ist z. Z. für keine Einrichtung ein aktuelles Thema. Diese Maßnahme wird allgemein eher für noch nicht ausgereift und verwirrend sowie, was die Vergleichsmöglichkeiten zweier Heime betrifft, für undurchsichtig gehalten, zumal nicht alle Qualitätsdimensionen bei diesem Verfahren Berücksichtigung fänden. Die Interviewten gaben allerdings auch zu bedenken, daß aus der zunehmenden Wettbewerbssituation heraus eventuell in der Zukunft auf diese oder eine ähnliche Maßnahme zurückgegriffen werden muß, um den Kunden mit Hilfe eines "Qualitätssiegels" besser verdeutlichen zu können, daß die Dienstleistungsqualität einen hohen Stellenwert einnimmt. Sollte die Zertifizierung im Gesundheitswesen eine größere Akzeptanz erfahren, sehen sie die Gefahr, daß die einzelne Einrichtung aufgrund einer nicht nachweisbaren Zertifizierungsmaßnahme von der Öffentlichkeit für weniger leistungsfähig gehalten werden könnte, was wiederum wahrscheinlich eine rückläufige Heimauslastung zur Folge hätte. Entsprechende Schritte könnten diesbezüglich jedoch erst eingeleitet werden, sobald Finanzierung, Organisation und Förderung von solchen kostenintensiven qualitätssichernden Aktivitäten rechtlich unter anderem in Verbindung mit den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI festgelegt worden sind. 5.2.6 Zusammenarbeit mit den Pflegekassen Im Rahmen der Expertenbefragung interessierte abschließend, welche Haltung die Pflegekassen zum Thema "Marketing im Alten- und Pflegeheim" zum Ausdruck gebracht haben bzw. bringen. Alle Interviewten antworteten hier übereinstimmend, daß die Pflegekassen in dieser Richtung bisher keine Äußerungen getätigt hätten und deren Ansichten somit nicht bewertet werden könnten. Ihr bisheriges und gegenwärtiges Marketing sei durch die Pflegekassen in keinster Weise behindert aber auch nicht gefördert worden. Die Mehrheit der Befragten (11) meinte allerdings auch, daß das abzusehende restriktive Verhalten der Finanzierungsträger (z. B. Pflegesatzverhandlungen) indirekt die Ausweitung der Marketingaktivitäten begünstigen und fördern werden würde. 6. Fazit und Ausblick Als Ergebnis der durchgeführten explorativen Studie läßt sich feststellen, daß die Gestaltungsspielräume des Marketings in der unternehmerischen Praxis der Alten- und Pflegeheime unabhängig von ihrem städtischen oder ländlichen Standort und vom Bundesland - nur partiell ausgeschöpft werden. Das Bewußtsein, sich gegenüber der Konkurrenz profilieren zu müssen, ist bei allen befragten Einrichtungen mehr oder minder vorhanden bzw. die Bedeutung und Notwendigkeit umfassender Marketingaktivitäten wird allgemein vor dem Hintergrund der prognostizierten Entwicklungen im Pflegemarkt anerkannt. Es sind jedoch diesbezüglich, vermutlich infolge der bisher konstant hohen Heimkapazitätsauslastung und des seitens der Heime z. Z. kaum spürbaren Wettbewerbsdrucks sowie des vielfältigen Aufgabenbereiches der Verantwortlichen (Heimleitungen) relativ wenige Anstrengungen unternommen worden. Allein schon die Nichtexistenz eines formal festgelegten Marketingplans macht deutlich, daß weder von einem systematischen und zielgerichteten Einsatz der Marketinginstrumente gesprochen werden kann, noch davon auszugehen ist, daß der präventive Charakter des Marketings als praktizierte Unternehmensphilosophie in seinem vollen Umfang realisiert wird. Die Einschätzung der Marketingsituation bzw. Marktverhältnisse stützt sich in der Regel nicht auf durchgeführte Untersuchungen, beispielsweise zum tatsächlichen Image bei den Zielgruppen, sondern erfolgt auch heute noch oftmals aus den praktischen Erfahrungen heraus. Entscheidungen werden somit teilweise auf der Basis unzureichender Informationen getroffen, die Orientierung am lokalen Bedarf und den Ansprüchen der Kunden ist nicht automatisch gewährleistet. Heimbeirat und Angehörigenabende gelten als wichtige Instrumente, um kritische Hinweise und Anregungen und damit den Zufriedenheitsgrad dieser beiden entscheidenden Kundengruppen zu ermitteln. Das Leistungsspektrum umfaßt in der Regel nur die klassischen vollstationären Leistungen, das Bestreben, das Angebot über weitere Leistungsbereiche, wie zum Beispiel ambulante Pflege oder betreutes Wohnen, abzurunden bildet die Ausnahme. Hierbei ist allerdings das Risiko in Betracht zu ziehen, daß aufgrund dieser tendenziellen Einseitigkeit der Angebotsgestaltung dem Bedürfnis alter und pflegebedürftiger Menschen nach einem individuellen und selbstbestimmten Wohnen (Appartement, betreutes Wohnen, ambulante Versorgung) nicht in ausreichendem Maße nachgekommen werden kann. Die Folge wäre, daß das Alten- und Pflegeheim auf die Nachfrage nicht reagieren kann, die Auslastung aufgrund eines geänderten Nachfrageverhaltens zurückgeht oder die Einrichtung zu einem reinen Pflegeheim wird. Die Gestaltung der einzelnen Leistungsprogramme orientiert sich im Allgemeinen grob an dem Angebot der Konkurrenz, so daß insbesondere bei dem Serviceleistungsprogramm heute Vieles als Standard bezeichnet werden und die Profilierung somit nur anhand einzelner, gezielter Angebote stattfinden kann (z. B. Vermietung von Gästezimmern für die Besucher, Fahrdienst, Anzahl der Ausflüge). Das Ausnutzen der Möglichkeit, Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI zu definieren und abzurechnen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden, da noch keine eindeutige Rechtslage existiert. Im Rahmen der Kommunikationspolitik wird der Schwerpunkt auf die externe und interne Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Das Fehlen einer Heimbroschüre oder einer Hauszeitung oder eines Faltblattes bzw. der Verzicht auf jegliche Medien, um sich in der Öffentlichkeit positiv darzustellen und bei potentiellen Interessenten wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, kann als ein besonderes Manko angesehen werden. In diesem Zusammenhang sollte ein Tag der offenen Tür oder eine Veranstaltung ähnlichen Ausmaßes nicht zu häufig durchgeführt werden, damit das Interesse der Öffentlichkeit nicht erlahmt. Die interne Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf die Durchführung von Besprechungen auf allen Ebenen zur Gewährleistung der informatorischen Transparenz und auf das Angebot von regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen. Zudem wird der Implementierung von einheitlichen, intern und extern gerichteten Verhaltensweisen eine große Bedeutung beigemessen, wobei sich deren Umsetzung ohne eine Unternehmensphilosophie als Basis schwierig gestalten dürfte. Hinsichtlich der Durchführung von kontinuierlichen Soziosponsoring-Maßnahmen wird allgemein Zurückhaltung geübt, um den Konkurrenzkampf nicht unnötig zu entfachen. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden massiven finanzwirtschaftlichen Engpässe im Gesundheitswesen ist es jedoch fraglich, wie lange diese Haltung in der Zukunft bewahrt werden kann. Das Instrumentarium der Kosten-Leistungs-Rechnung wird in der Regel noch nicht als Informations-, Steuerungs- und Kontrollsystem zur Unternehmensführung genutzt. Existenzgefährdungen lassen sich allerdings nur mit einem solchen Instrument verhindern, da dadurch rechtzeitig Indizien für Kostenrisiken ermittelt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. In diesem Zusammenhang werden realistische Möglichkeiten zur Erhaltung bzw. Steigerung der Heimerträge bzw. Wirtschaftlichkeit und damit zur Bestandssicherung der Einrichtung insbesondere in der horizontalen Diversifikation, aber auch in der Marktentwicklung gesehen. Die Umsetzung dieser Überlegungen bedeutet in der Regel, daß das Leistungsspektrum abgerundet oder ergänzt wird, so daß das Heim einer größeren und differenzierteren Nachfrage entsprechen kann. Vertikale Kooperationen werden in erster Linie für die Leistungsbereiche Flachwäscheversorgung und Gebäudereinigung vereinbart, da diese Leistungen durch auf diese Bereiche spezialisierte Firmen kostengünstiger als durch das Heim erbracht werden können. Die Vorteile einer horizontalen Kooperation, also zum einen die Möglichkeit der Komplettierung und Vernetzung des Leistungsangebotes unter Vermeidung von hohen Investitions- und Folgekosten, die mit dem selbständigen Aufbau eines neuen Leistungsbereiches verbunden wären, und zum anderen die mögliche Reduzierung der Konkurrenzintensität, werden nur selten ihrer zukünftigen Bedeutung entsprechend vollkommen ausgenutzt (Ursache hierfür könnten Befürchtungen sein, daß die Kooperationspartner letztendlich mehr von der Zusammenarbeit profitieren als die eigene Einrichtung.). In der Regel wird mit ein bis zwei anderen Anbietern von ambulanten und/oder stationären Pflegeleistungen zusammengearbeitet, wobei sich Art und Umfang der Kooperation unterschiedlich gestalten. Ein besonderes Augenmerk wird auf die zeitgemäße Gestaltung des Qualitätsmanagements gelegt. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Förderung des Internalisierungsprozesses des Qualitätsbewußtseins bei den Mitarbeitern auf der Basis der TQM-Prinzipien und die Durchführung von internen Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß den Vorgaben der Qualitätsvereinbarungen nach § 80 SGB XI. Es ist zu erwarten, daß die Zertifizierung nach ISO oder vergleichbare Maßnahmen infolge der zunehmenden Wettbewerbssituation in der Zukunft an Bedeutung gewinnen werden, da mit Hilfe von "Qualitätszertifikaten" den Kunden der hohe Stellenwert der Dienstleistungsqualität verdeutlicht bzw. visualisiert werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse der Studie verdeutlichen, daß Marketing in Alten- und Pflegeheimen nur ansatzweise in Form einzelner Marketinginstrumente, aber keineswegs schon als funktionsübergreifende, marktorientierte Denk- und Handlungsweise Anwendung findet. Der mit der Einführung der Pflegeversicherung eingeleitete tiefgreifende Umbau der Alten- und Pflegeheimlandschaft von einem finanziell abgesicherten, planwirtschaftlichen Versorgungsunternehmen zu einem marktwirtschaftlich und sozial unverzichtbaren Dienstleistungsunternehmen bedingt den Einzug des Marketings. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Entwicklungen im Pflegemarkt, wie beispielsweise der Wandel zum Nachfragermarkt und die rasch ansteigende Wettbewerbsintensität, sowie des steigenden Kostendrucks erscheint es fraglich, ob sich das Unternehmen Alten- und Pflegeheim ohne die Implementierung des Marketings als eine umfassende Unternehmensphilosophie künftig als ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen behaupten kann. Solange das Dienstleistungsangebot einer Einrichtung als bedarfsgerecht gelten kann, wird diese Einrichtung auch ausgelastet sein, vorausgesetzt es wird kontinuierlich ermittelt, ob die Leistungen den Erwartungen der Bewohner wirklich entsprechen oder neuen bzw. anderen Anforderungen und Bedürfnissen angepaßt werden müßten. Um auf Bedarfsveränderungen mit adäquaten Anpassungsmaßnahmen flexibel reagieren und zudem das Risiko am Markt besser streuen zu können, muß sich das klassische Alten- und Pflegeheim zu einem in sein unternehmerisches Umfeld integrierten Dienstleistungszentrum entwickeln, das nicht nur die ambulanten und stationären sozialen und pflegerischen Versorgungsbedarfe einer Region, eventuell in Kooperation mit anderen Einrichtungen, professionell abdeckt, sondern ebenso als das regionale Zentrum ehrenamtliche Hilfestrukturen organisiert sowie die Selbsthilfepotentiale der Pflegebedürftigen unterstützt. Abb. 8: Dienstleistungszentrum Alten- und Pflegeheim Die konsequente Ausrichtung des Leistungsspektrums an den Bedürfnissen und Präferenzen der Kunden bzw. der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen ist als zentrale Maxime des Marketings anzusehen und stellt bei der Entwicklung des Unternehmensprofils die zentrale Leitlinie dar. In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, daß die strategischen Positionsbestimmungen stets in Orientierung an den jeweiligen Strategien der Konkurrenten vorgenommen werden, da sich nur auf diese Weise ein eigenständiges und unverwechselbares Strategiemuster konzipieren läßt. Um sich sich von den konkurrierenden Alten- und Pflegeheimen unterscheiden zu können, reicht es jedoch nicht aus, funktional optimale bzw. qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, dieses wird von Seiten der Kunden als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Einzigartigkeit und damit der Erlebnischarakter einer Dienstleistung entsteht erst durch den ideelen und emotionalen Nutzen, der die Dienstleistungsfunktion ergänzen kann, d. h., nicht nur "was" man am Markt anbietet ist wichtig, sondern auch "wie" die Leistung erbracht wird. Im Hinblick auf die hohen moralischen und ethischen Ansprüche, die die Gesellschaft allgemein mit einem Dienst am Menschen bzw. den von einem Alten- und Pflegeheim angebotenen sozialen Dienstleistungen verbindet, "... geht es nicht um das Erlernen von Tricks, sondern um die Schöpfung von immateriellem Mehrwert. Ein ausgewogenes Marketing steigert die Qualität der Dienstleistung, fördert die Identifikation der Mitarbeiter und sorgt für eine kontinuierliche Kommunikation" (BAPTISTE, 1992, S. 18). Mit Hilfe des Marketings werden sowohl die Öffentlichkeit auf das Dienstleistungsangebot aufmerksam gemacht als auch die Leistungen regelmäßig, entsprechend den sich wandelnden Bedürfnissen und Wünschen der Zielgruppen, modifiziert, so daß es zum einen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern hilft, und zum anderen die Wettbewerbsfähigkeit, Substanzerhaltung, Liquidität und somit die Lebensfähigkeit eines Alten- und Pflegeheimes sicherstellen hilft. Das Unternehmen Alten- und Pflegeheim ist im Wettbewerb des Pflegemarktes gezwungen, sich marketingstrategisch neu zu orientieren, seine Rolle im Markt zu überdenken und eine Position mit langfristigen Perspektiven im Pflegemarkt zu suchen. Der an Dynamik und Härte zunehmende Wettbewerb im Pflegemarkt sowie die starke Betonung der Wirtschaftlichkeit lassen die Prognose zu, daß nur die Alten- und Pflegeheime am Markt nachhaltig erfolgreich sein werden, die vergleichsweise früh und planmäßig in der Orientierung ihrer Markt- und Unternehmenspolitik den veränderten Marktbedingungen entsprechen, d. h., ihrem unternehmerischen Handeln ein schlüssiges Marketingkonzept zugrundegelegt haben. Anhang Teilstrukturierter Interviewleitfaden "Marketing im Alten- und Pflegeheim" b) Aktuelle Informationen: 01) Wieviel Plätze hat die Einrichtung? Wie teilen sich diese auf? a) Differenziert nach Stationen: b) Differenziert nach den Leistungsarten Vollstationär und Kurzzeitpflege: c) Differenziert nach sonstigen Leistungen (Teilstationär): 02) Welche(r) Bereich/Station hat die höchste Auslastung? Wieviel beträgt sie ungefähr? 03) Welche(r) Bereich/Station hat die geringste Auslastung? Wieviel beträgt sie ungefähr? 04) Wie hoch ist die durchschnittliche Gesamtauslastung der Einrichtung? II. Rahmenbedingungen: 05) Wie steht der Träger zu Marketingaktivitäten? 06) Wer entscheidet über Marketingaktivitäten? 07) Wurde eine eigene Planstelle geschaffen? 08) Haben sich die Führungskräfte Marketingwissen angeeignet? Wenn ja, wie? 09) Sind entsprechende Fortbildungsmaßnahmen für die Zukunft geplant? (Seminare, Vorträge, Literatur, Workshop) III. Marketingsituationsanalyse: 10) Wurde bereits die Marketingsituation erforscht? 11) Wer war die Zielgruppe (Bewohner, ...) der Erhebung? 12) Welche Methoden wurden bei der Erhebung angewendet? (Primär-, Sekundärerhebung, Befragung, Fragebogen) 13) Welcher Bereich (z. B. Image, Qualität, Zufriedenheit) wurde abgefragt? 14) Wie wird Kritik, beispielsweise von Bewohnern, Angehörigen oder Besuchern, erhoben? 15) Wie groß ist das Einzugsgebiet des Heimes? a) Räumliche Größe: b) Anzahl der Einwohner: 16) Wie hoch ist das Kunden- bzw. Bewohnerpotential in Ihrem Einzugsgebiet? 17) Wie hoch ist der Marktanteil der einzelnen Bereiche Ihres Heimes? 18) Beschreiben Sie bitte Ihre Mitbewerber bzw. Konkurrenten (Leistungsspek- trum, Kapazität, Positionierung, Zielgruppe, ...)! 19) Welche Position hat Ihr Heim im Vergleich mit den Konkurrenten inne? 20) Gibt es Leistungen aus dem angebotenen Leistungsspektrum, für die das Heim in der Öffentlichkeit besonders bekannt ist und geschätzt wird? Wenn ja, welche? IV. Marketing-Mix: 21) Welche zusätzlichen Dienstleistungen ("Service") werden neben dem Kernleistungsangebot noch angeboten? (Friseur, Bibliothek, Schalterstunden eines Geldinstituts, Kapelle, Café, Restaurant, Minimarkt/Kiosk, Briefmarkenverkauf/Briefkasten, Einkaufsservice, Vermietung von Gästezimmern, Nähstube, Fahrdienst) 22) Welche Zusatzleistungen (nach § 88 SGB XI) werden angeboten? 23) Wo haben die Bewohner Auswahlmöglichkeiten beim Kernleistungs- bzw. Standardangebot (z. B. Frühstücksbuffet, Menü, Einzel-, Doppelzimmer, ...)? 24) Welche Besonderheiten enthält Ihr Beschäftigungs- und Veranstaltungsprogramm? 25) a) Existiert eine Heimbroschüre und/oder Hauszeitung? Wenn nicht der Fall, warum? b) Für wen sind diese Medien gedacht? (Bewohner, Angehörige, Besucher, Mitarbeiter, ...) c) Wann und wie werden diese ausgehändigt? 26) Gibt es sonstiges, für die Öffentlichkeit gedachtes Material über das Heim? (z. B. Statistiken, Pressespiegel, Video, ...) 27) Wurde bereits ein Tag der offenen Tür oder vergleichbares durchgeführt? Wenn ja, finden diese regelmäßig oder sporadisch statt? 28) Wie gestalten Sie die interne Öffentlichkeitsarbeit? 29) Wie sehen die Kontakte zu der Presse bzw. zu den Medien und die zielgrup- penspezifische, bewohnerorientierte Werbung (z. B. Redaktionsbeiträge, Inserate ...) aus? 30) Welche Erfolge haben Sie bisher mit Soziosponsoring erzielt? (Freundeskreis, Förderverein, ...) V. Marketingstrategien: 31) a) Gibt es einen Marketingplan? b) Ist dieser formal festgelegt? 32) Wie hoch ist der Anteil (%) der Themen „Marketing“, „Zufriedenheit“ und „Service“ in Sitzungen des Trägers bzw. der Entscheidungsträger? 33) Gibt es eine Kosten- und Leistungsrechnung? 34) Wie stellen Sie die Kostentransparenz sicher, damit Sie ineffiziente Bereiche identifizieren können? 35) Wäre ein Verzicht auf ineffiziente Bereiche denkbar? 36) Wo wäre eine Ausdehnung des Kernleistungsspektrums möglich, um die Erträge zu steigern (z. B. ambulante Pflege)? 37) Auf welche Leistungsangebote könnten Sie sich spezialisieren, um eine Steigerung der Erträge zu erzielen (z. B. Gerontopsychiatrie)? 38) a) Welche Leistungsbereiche haben Sie im Rahmen einer vertikalen Kooperation an Fremdfirmen ("Outsourcing") vergeben? b) Mit welchen anderen Anbietern kooperieren Sie horizontal? c) Wie ist die Kooperation vereinbart (Vertrag, ...)? VI. Qualitätsmanagement: 39) Wie gestalten Sie Ihr Qualitätsmanagement?(z. B. TQM, QS gemäß Vereinbarungen nach § 80 SGB XI, Zertifizierung,...) VII. Zusammenarbeit mit den Pflegekassen: 40) Wie stehen die Pflegekassen zu Ihren Marketingaktivitäten? Beeinflussen sie diese? Literaturverzeichnis Ahlert, D. ; Schröder, H. (1996): Rechtliche Grundlagen des Marketing 2. Auflage Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer Albuschkat, I. (1995): Neue Wege gehen In: Häusliche Pflege 4 (7/95), S. 468 - 473 Allemeyer, J. (1996): Alten- und Pflegeheime im Umbruch In: Altenheim 35 (3/96), S. 212 - 216 Atteslander, P. (1984): Methoden der empirischen Sozialforschung 5. Auflage Berlin; New York: de Gruyter Bade, T. ; Lindner, R. (1995): Mogelpackung oder Verheißung? Die DIN ISO 9000 ff. in der Praxis In:Häusliche Pflege 4 (4/95), S. 280 - 285 Baptiste, R. (1992): Marketing oder Die wiederentdeckte Ethik im Gesundheits- und Sozialbereich In: Stemmle, D. (Hrsg.), Marketing im Gesundheits- und Sozialbereich. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 1992, S. 18 - 47 Bea, F. X. ; Dichtl, E. ; Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Bd. 1: Grundfragen 6. Auflage Stuttgart; Jena: G. Fischer Schweitzer, M. (1992): Bea, F. X ; Dichtl, E. ; Schweitzer, M. (1993): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Bd. 2: Führung 6. Auflage Stuttgart; Jena: G. Fischer Becker, J. (1992): Marketing-Konzeption Grundlagen des strategischen MarketingManagements 4. Auflage München: Vahlen Beek, K. (1996): Positionen im Markt erobern In: Häusliche Pflege 5 (2/96), S. 94 - 100 Benkenstein, M. ; Güthoff, J. (1997): Qualitätsdimensionen komplexer Dienstleistungen In: Marketing ZFP 19 (Heft 2/1997), S. 81 92 Berger, G. ; Gerngroß-Haas, G (1997): Wo liegen die Stärken und Schwächen? In: Altenheim 36 (3/97), S. 28 - 39 Berndt, R. ; Hermanns, A. (1993): Handbuch Marketing-Kommunikation Wiesbaden: Gabler Bieberstein, I. (1995): Dienstleistungs-Marketing Ludwigshafen/Rh.: Kiehl Birkigt, K. ; Stadtler, M. (1986): Corporate Identity Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele 3. Auflage Landsberg/Lech: Verl. Moderne Industrie Bischof, S. (1995): Qualität beginnt im Kopf In: Forum Sozialstation Nr. 72 (Febr. 1995), S. 43/44 Bortz, J. ; Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation 2. Auflage Berlin; Heidelberg: Springer Brater, M. ; Maurus, A. (1995a): Marktorientierung ist überlebensnotwendig (Teil 1) In: Altenpflege 2/95, S. 81 - 83 Brater, M. ; Maurus, A. (1995b): Marktorientierung ist überlebensnotwendig (Teil 2) In: Altenpflege 3/95, S. 148 - 152 Bretzke, W.-R. (1995): Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen in Dienstleistungsunternehmen In: Bruhn, M. ; Stauss, B. (Hrsg.), Dienstleistungsqualität. 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 1995, S. 401 - 427 Brühl, A. (1994): Bundessozialhilfegesetz 4. Auflage München: C. H. Beck Bruhn, M. (1990): Sozio- und Umweltsponsoring München: Vahlen Bruhn, M. ; Tilmes, J. (1994): Social Marketing 2. Auflage Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer Bruhn, M. (1995): Qualitätssicherung im Dienstleistungsmarketing - eine Einführung in die theoretischen und praktischen Probleme In: Bruhn, M. ; Stauss, B. (Hrsg.), Dienstleistungsqualität. 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 1995, S. 19 - 46 Bruhn, M. (1996): Qualitätsmanagement für Dienstleistungen Grundlagen, Konzepte, Methoden Berlin; Heidelberg: Springer Bruhn, M. (1997): Marketing Grundlagen für Studium und Praxis 3. Auflage Wiesbaden: Gabler Bruns, B. (1996): Dienstleistungs-Marketing ambulanter Pflegedienste In: Pflegen Ambulant 7 (3/96), S. 31 - 38 Bundesministerium für Familie,Se- Heimstatistik - Heime nach § 1 Abs. 1 Heimgesetz, Stand: 30.06.1996 Bonn nioren, Frauen und Jugend (1996): Büse, F. (1996): DIN ISO für Heime: Qualitätsmanagementsystem für Altenhilfeeinrichtungen Hannover: Vincentz Corsten, H. (1997): Dienstleistungsmanagement 3. Auflage München; Wien: Oldenbourg Deutscher Verein für öffentliche und private Nomenklatur der Altenhilfe Fürsorge (1992): Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer Deutsches Zentrum für Altersfragen; Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.) (1995): Heimkonzepte der Zukunft 3. Auflage Berlin; Köln Diller, H. (1996): Kundenbindung als Marketingziel In: Marketing ZFP 18 (Heft 2/1996), S. 81 - 94 Drewes, F.-H. (1993): Diakonie-Marketing In: Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.), Leitfaden zur wirtschaftlichen Führung diakonischer Einrichtungen und Werke. Stuttgart: Diakonie-Verlag, 1993, S. 427 - 480 Duden (1990): Fremdwörterbuch Mannheim; Wien; Zürich: Dudenverl. Dühring, A. (1996): Maßnahmen der Qualitätssteigerung und -sicherung In: Junkers, G. ; Moldenhauer, B. ; Reuter, U. (Hrsg.), Pflegeversicherung : Konsequenzen für die Reorganisation, Finanzierung und Qualitätssicherung. Stuttgart; New York: Schattauer, 1996, S. 181 - 190 Dullinger, F. (1996): Krankenhaus-Management im Spannungsfeld zwischen Patientenorientierung und Rationalisierung 2. Auflage München: FGM-Verlag Eckmann, H.-J. (1996): Kundenfreundliches Krankenhaus In: Paul-Lempp-Stiftung (Hrsg.), Kundenorientierung in sozialen Unternehmen. Stuttgart; Düsseldorf: Raabe, 1996, S. 183 - 197 Eichhorn, S. (1990): Qualitätssicherung im Krankenhaus In: Büchner, E. (Hrsg.), Diagnosenstatistik und Qualitätssicherung im Krankenhaus. Berlin: Blackwell Ueberreuter Wiss., 1990, S. 95 Falk, B. (1980): Zur Bedeutung des Dienstleistungsmarketing In: Falk, B. (Hrsg.), Dienstleistungsmarketing Landsberg/Lech: Verl. Moderne Industrie, 1980, S. 9 - 28 Falk, J. ; Kerres, A. (1995): Die DIN ISO 9000 im Gesundheitswesen In: Pflegemanagement 4/95, S. 12 - 18 Flechtner, G. C. (1996): Vom "Kranken-Haus" zum "Haus der Heilung" Was können Imagetechniken dazu beitragen? In: Paul-Lempp-Stiftung (Hrsg.), Kundenorientierung in sozialen Unternehmen. Stuttgart; Düsseldorf: Raabe, 1996, S. 217 - 226 Friedrichs, J. (1990): Methoden empirischer Sozialforschung 14. Auflage Opladen: Westdt. Verl. Frosch, M. ; Zimmerschied, I. (1995): Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9000 In: Altenheim 34 (1/1995), S. 18 - 27 Gabler (1988): Wirtschafts-Lexikon 12. Auflage Wiesbaden: Gabler Giebing, H. u. a. (1996): Pflegerische Qualitätssicherung Konzept, Methode, Praxis Bocholt: EICANOS Verlag Glander, A. (1994): Gutes Image kommt nicht von allein In: Altenheim 33 (2/1994), S. 128 - 133 Görres, S. (1996): Qualitätssicherung und standardisierte Verfahren - eine kritische Auseinandersetzung In: Pflege 9 (Heft 4/1996), S. 300 - 306 Grode, H.-P. (1993): Qualitätssicherung In: Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Einführung in die DIN-Normen. Stuttgart: Teubner ; Berlin; Köln: Beuth, 1993, S. 310 - 317 Grosser, C. (1996): Notwendiger Wandel ohne Trauma In: Häusliche Pflege 5 (9/96), S. 626 - 633 Grunwald, W. (1995): Über die Grenzen unternehmensinterner Öffentlichkeit In: zfo 64 (2/1995), S. 95 - 99 Haba, T. (1996): Vom Leisetreter zum Lautsprecher In: Altenpflege 9/96, S. 600 - 605 Hasitschka, W. ; Hruschka, H (1982): Nonprofit-Marketing München: Vahlen Hefermehl, W. (1997): Wettbewerbsrecht und Kartellrecht 18. Auflage München: C. H. Beck Heister, W. (1995): Marketing als Grundlage erfolgreicher Spendenaquisition In: ZögU 18, (Heft 3/1995), S. 298 - 311 Hellige, B. u. a. (1994): Leitfaden zur Neuordnung des Pflegedienstes Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges. Hilbert, J. (1995): Pflegedienste vor neuen Herausforderungen In: Häusliche Pflege 4 (11/95), S. 820 - 825 Hildebrand, R. (1995): Total Quality Management In: f & w 12 (1/95), S. 31 - 41 Hilke, W. (1989): Grundprobleme und Entwicklungstendenzen des Dienstleistungs-Marketing In: Hilke, W. (Hrsg.), Dienstleistungs-Marketing. Wiesbaden: Gabler, 1989, S. 5 - 44 Hinterhuber, H. H. ; Bailom, F. ; Matzler, K. ; Sauerwein, E. (1996): Das Kano-Modell der Kundenzufriedenheit In: Marketing ZFP 18 (Heft 2/1996), S. 117 - 126 Hoefert, H.-W. (Hrsg.) (1997): Führung und Management im Krankenhaus Göttingen; Stuttgart: Verl. für Angewandte Psychologie Holscher, C. ; Meyer, A. (1990): Sozio-Marketing In: Meyer, P. W. ; Meyer, A. (Hrsg.), Marketingsysteme. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1990, S. 221 - 258 Janßen, H. (1997): Total Quality Management im Gesundheitswesen In: Spörkel, H. u. a. (Hrsg.), Total Quality Management im Gesundheitswesen. 2. Auflage, Weinheim: Psychologie Verlags Union, 1997 Junkers, G. ; Moldenhauer, B. ; Stationäre Altenpflege Situation und Perspektiven in den alten und neuen Bundesländern Stuttgart; New York: Schattauer Reuter, U. (Hrsg.) (1995): Kaltenbach, T. (1991): Qualitätsmanagement im Krankenhaus Melsungen: Bibliomed, Med. Verl.-Ges. Kamiske, G. F. ; Brauer, J.-P. (1995): Qualitätsmanagement von A bis Z 2. Auflage München; Wien: Hanser Karlöf, B. ; Östblom, S. (1994): Benchmarking München: Vahlen Karmeli, A. ; Zimmerschied, I. Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9000 (1994): In: Altenheim 33 (8/1994), S. 554 - 559 Katz, J. ; Green, E. (1996): Qualitätsmanagement Ein Ratgeber zur Überprüfung und Bewertung des Pflegedienstes Berlin; Wiesbaden: Ullstein Mosby Kissels, U. ; Wallrafen-Dreisow, H. (1995): Der verzerrte Qualitätsbegriff In: Forum Sozialstation Nr. 77 (Dez. 1995), S. 36 - 39 Klie, T. (1994): Bewohnerorientierte Qualitätssicherung In: Altenheim 33 (12/94), S. 850 - 854 Klie, T. (1996): Pflegeversicherung Einführung, Lexikon, Gesetzestexte, Nebengesetze, Materialien 3. Auflage Hannover: Vincentz Koch, C. (1997): Sparen mit Werbung In: Altenheim 36 (5/97), S. 36 - 38 Kotler, P. (1978): Marketing für Nonprofit-Organisationen Stuttgart: Poeschel Kotler, P. ; Bliemel, F. (1995): Marketing-Management Analyse, Planung, Umsetzung und Steuerung 8. Auflage Stuttgart: Schäffer-Poeschel Kreidenweis, H. (1996): Wirkung erzielen In: Häusliche Pflege 5 (5/96), S. 348 - 353 Kricsfalussy, A. (1997): Kundenorientierung = Marktorientierung? In: zfo 66 (2/1997), S. 99 - 103 Latten, K.-U. ; Schleypen, K. J. (1996): Von der Marktanalyse zum Konzept In: Altenheim 35 (11/96), S. 816 - 825 Leschinsky, A. (1996): 10 Thesen zum 60+ Marketing im Jahr 2001 In: Paul-Lempp-Stiftung (Hrsg.), Kundenorientierung in sozialen Unternehmen. Stuttgart; Düsseldorf: Raabe, 1996, S. 57 - 69 Lo-Biondo-Wood, G. ; Haber, J. (1996): Pflegeforschung Methoden, kritische Einschätzung und Anwendung Berlin; Wiesbaden: Ullstein Mosby Mayer, A. (1996): Implementierung von Marketing im Krankenhaus Regensburg: Roderer Meffert, H. (1986): Marketing Grundlagen der Absatzpolitik 7. Auflage Wiesbaden: Gabler Meffert, H. (1994): Marketing-Management Analyse, Strategie, Implementierung Wiesbaden: Gabler Meffert, H. ; Bruhn, M. (1997): Dienstleistungsmarketing Grundlagen, Konzepte, Methoden 2. Auflage Wiesbaden: Gabler Meiners, N. ; Albers, F. (1998): Überlebensstrategien durch zeitgemäßes Marketing In: Die Schwester / Der Pfleger 37 (1/98), S. 48 - 52 Meyer, A. (1983): Dienstleistungs-Marketing 1. Auflage Augsburg: FGM-Verlag Meyer, A. (1990): Dienstleistungs-Marketing In: Meyer, P. W. ; Meyer, A. (Hrsg.), Marketingsysteme. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1990, S. 173 - 214 Meyer, P. W. (1996): Integrierte Marketingfunktionen Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer Mischallik, S. ; Conrad, B. (1996): Gründliche Vorbereitung sorgt für Akzeptanz und Engagement In: ku 65 (12/96), S. 910 - 916 Moldenhauer, B. (1996a): Die Reorganisation von Altenhilfeeinrichtungen nach PflegeVG - Aufgaben der Träger und Leitungskräfte In: Junkers, G. ; Moldenhauer, B. ; Reuter, U. (Hrsg.), Pflegeversicherung : Konsequenzen für die Reorganisation, Finanzierung und Qualitätssicherung. Stuttgart; New York: Schattauer, 1996, S. 18 - 30 Moldenhauer, B. (1996b): Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung. Von der Qualitätskontrolle der Kassen zur freiwilligen Zertifizierung In: Junkers, G. ; Moldenhauer, B. ; Reuter, U. (Hrsg.), Pflegeversicherung : Konsequenzen für die Reorganisation, Finanzierung und Qualitätssicherung. Stuttgart; New York: Schattauer, 1996, S. 158 - 172 Müller, H. (1991): Marketing- und Führungsinstrumente im Krankenhaus In: Das Krankenhaus 83 (1/91), S. 12 - 20 Müller, J. F. W. (1993): Social-Sponsoring In: Häusliche Pflege 2 (12/93), S. 728 - 735 Müller, J. F. W. (1994): Information ist alles In: Häusliche Pflege 3 (9/94), S. 552 - 557 Müller, J. F. W. ; Treike, S. (1995): Qualitätssicherung in kleinen Schritten In: Altenheim 34 (3/95), S. 189 - 194 Nieschlag, R. ; Dichtl, E. ; Marketing 16. Auflage Berlin: Duncker und Humblot Hörschgen H. (1991): Oess, A. (1993): Total quality management Die ganzheitliche Qualitätsstrategie 3. Auflage Wiesbaden: Gabler Oppl, H. (1995): Helfen als Dienstleistung In: Häusliche Pflege 4 (2/95), S. 76 - 80 Pantenburg, S. (1996): Marketingstrategien freigemeinnütziger Unter-nehmen im Altenhilfesektor 1. Auflage Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. Paratsch, F. (1995): Qualität kommt aus den Mitarbeitern In: Altenheim 34 (2/95), S. 118 - 125 Pepels, W. (1994): Kommunikations-Management Marketing-Kommunikation vom Briefing bis zur Realisation Stuttgart: Schäffer-Poeschel Pepels, W. (1995): Einführung in das Dienstleistungsmarketing München: Vahlen Pepels, W. (1996): Marketing München: Oldenbourg Peters, M. (1995): Besonderheiten des Dienstleistungsmarketing - Planung und Durchsetzung der Qualitätspolitik im Markt In: Bruhn, M. ; Stauss, B. (Hrsg.), Dienstleistungsqualität. 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 1995, S. 47 - 63 Raffée, H. ; Fritz, W. ; Wiedmann, P. (1994): Marketing öffentlicher Betriebe Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer Rathje, E. (1997): Kooperation: Notwendige Verzahnung und Konzentration im Gesundheitswesen? In: Das Krankenhaus 89 (4/97), S. 178 - 182 Rheinbay, P. ; Günther, A. (1995): Rechtsfragen des Dienstleistungsangebots Wettbewerbsrecht und Haftung In: Bruhn, M. ; Stauss, B. (Hrsg.), Dienstleistungsqualität. 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 1995, S. 105 - 127 Riegl, G. F. (1991a): Neue Dienstleistungsqualitäten im Krankenhaus mit Marketing In: f & w 8 (2/91), S. 112 - 118 Riegl, G. F. (1991b): Mit Marketing zu optimal gestalteten Augenblicken der Wahrheit am Klinik-Empfang In: f & w 8 (4/91), S. 256 - 260 Riegl, G. F. (1993): Spielregeln des Erfolges nach dem GSG: "Fit For Change" mit Krankenhaus-Marketing In: f & w 11 (2/94), S. 51 - 56 Riegl, G. F. (1995): Marketing-Strategien für das Krankenhaus als Gesundheitszentrum In: f & w 12 (1/95), S. 57 - 64 Riegl, G. F. (1996a): Klinik-Marketing beginnt bei Vorgesetzten und Mitarbeitern In: f & w 13 (1/96), S. 45 - 52 Riegl, G. F. (1996b): Krisenmanagement für Reha-Kliniken Das Marketing der Gastfreundschaft bringt Belegungssicherung In: f & w 13 (4/96), S. 324 - 331 Riegl, G. F. (1996c): Marketingorientierte Pflegekräfte als Hoffnungsträger für das zukunftssichere Krankenhaus In: Paul-Lempp-Stiftung (Hrsg.), Kundenorientierung in sozialen Unternehmen. Stuttgart; Düsseldorf: Raabe, 1996, S. 199 - 215 Ristok, B. (1996): Socialmarketing In: Boskamp, P. ; Knapp, R. (Hrsg.), Führung und Leitung in sozialen Organisationen. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1996, S. 229 - 239 Ritter, J. (1995): Rechtliche Rahmenbedingungen eines Krankenhausmarketings In: Die Schwester / Der Pfleger 34 (11/95), S. 1000 - 1006 Roßkopf, B. (1994): Möglichkeiten und Grenzen des Marketing für Krankenhäuser München: Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Universität der Bundeswehr Scharf, A. ; Schubert, B. (1997): Marketing Einführung in Theorie und Praxis 2. Auflage Stuttgart: Schäffer-Poeschel Scharmer, C. O. (1995): Strategische Führung im Kräftedreieck Wachstum-Beschäftigung-Ökologie In: ZfB 65 (Heft 6/1995), S. 633 - 661 Schierenbeck, H. (1995): Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre 12. Auflage München: Oldenbourg Schlüchtermann, J. (1996): Qualitätsmanagement im Krankenhaus In: f & w 13 (3/96), S. 252 - 259 Schnell, R. ; Hill, P. B. ; Esser, E. (1993): Methoden der empirischen Sozialforschung 4. Auflage München; Wien: Oldenbourg Schroeder-Hartwig, K. (1995): Qualitätssicherung In: Die Schwester / Der Pfleger 34 (6/95), S. 477 - 481 Schulin, B. (1996): Sozialgesetzbuch Reichsversicherungsordnung 22. Auflage München: C. H. Beck Schwinn, R. (1993): Betriebswirtschaftslehre München; Wien: Oldenbourg Sieber, H. (1996): Kooperation für ein Mehr an Leistung In: Forum Sozialstation Nr. 82 (Okt. 1996), S. 18 - 21 Sperl, D. (1994): Qualitätssicherung in der Pflege Hannover: Schlütersche Stauss, B. (1987): Grundlagen des Marketing öffentlicher Unternehmen 1. Auflage Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft Stauss, B. (1994): Total Quality Management und Marketing In: Marketing ZFP 16 (Heft 3/1994), S. 149 - 159 Steinle, C. ; Bruch, H. ; Böttcher, K. (1996): Qualitätsmanagement in Dienstleistungsunternehmen In: zfo 65 (5/1996), S. 308 - 313 Stratmeyer, P. (1997): Dynamisches Qualitätsmanagement oder zertifizierte Bürokratie? In: ku 66 (4/97), S. 260 - 262 Thill, K.-D. (1996): Ideenhandbuch für erfolgreiches Krankenhaus-Marketing Kulmbach: Baumann Töpfer, A. (1994): Total Quality Management 3. Auflage Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand Töpfer, A. (Hrsg.) (1996): Kundenzufriedenheit messen und steigern Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand Trill, R. (1996): Krankenhaus-Management Aktionsfelder und Erfolgspotentiale Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand Tscheulin, D. K: ; Helmig, B. (1996): Arzt- und Krankenhauswerbung In: ZfB 66 (Heft 11/1996), S. 1357 - 1382 Vollmer, R. J. (1994): Heimrecht des Bundes Remagen: AOK-Verlag Wallrafen-Dreisow, H. (1995): Qualitätssicherung aus kommunaler Sichtweise In: Heim und Pflege 26 (9/95), S. 338 - 340 Weh, B. ; Sieber, H. (1995): Pflegequalität München; Wien: Urban und Schwarzenberg Weis, H.C. (1995): Marketing 7. Auflage Ludwigshafen/Rh.: Kiehl Weiss, M. (1997): Belegungsoptimierung mit innovativem Marke-ting In: Krankenhaus & Management 10/97, S. 45 Wendt, W. R. (1995): Beraten und Koordinieren In: Häusliche Pflege 4 (5/95), S. 320 - 325 Wiegers, H. (1997): "Rettungsanker" Marketing In: Krankenhaus & Management 10/97, S. 1 u. 42 Wöhe, G. (1996): Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre 19. Auflage München: Vahlen Zentes, J. (1992): Grundbegriffe des Marketing 3. Auflage Stuttgart: Schäffer-Poeschel