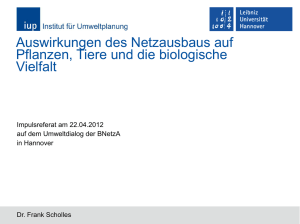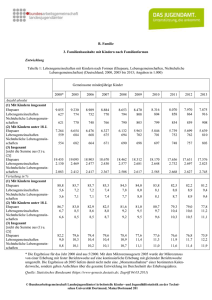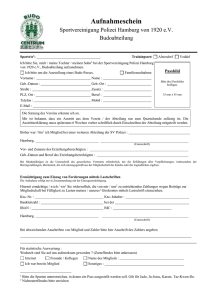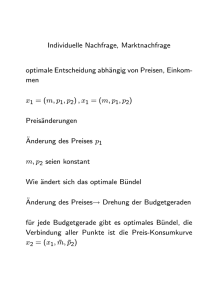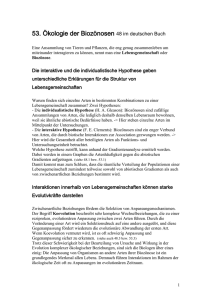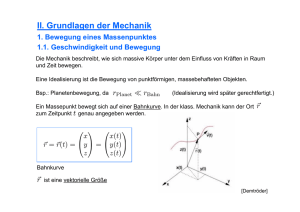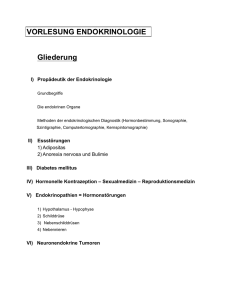Öko zusammenfassung
Werbung
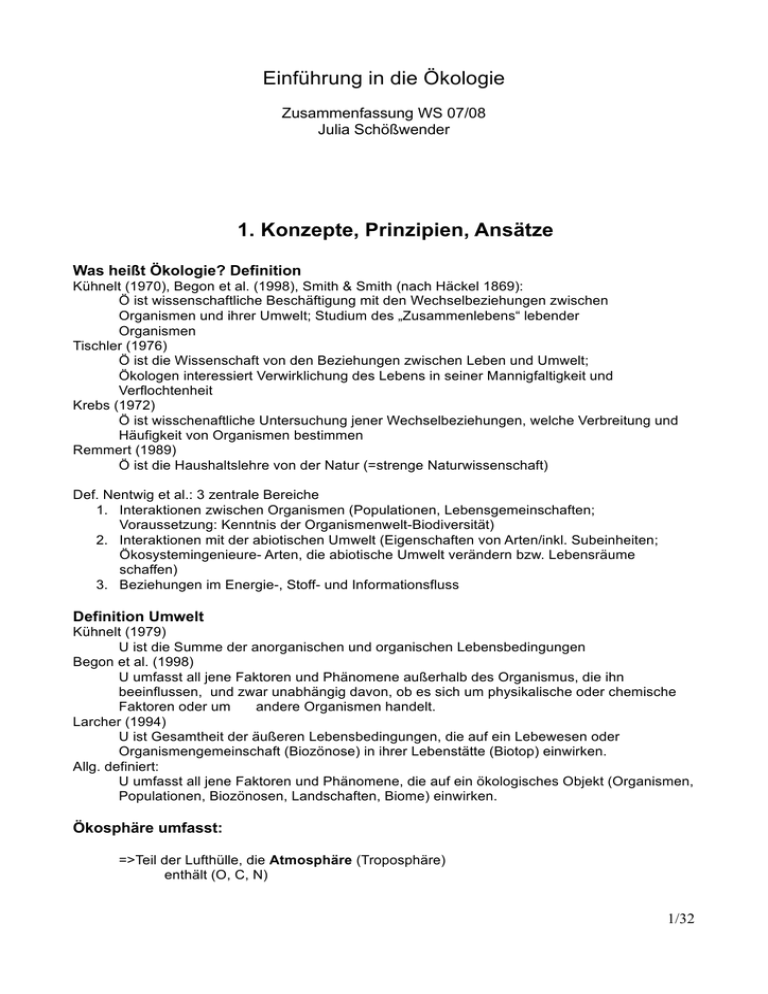
Einführung in die Ökologie Zusammenfassung WS 07/08 Julia Schößwender 1. Konzepte, Prinzipien, Ansätze Was heißt Ökologie? Definition Kühnelt (1970), Begon et al. (1998), Smith & Smith (nach Häckel 1869): Ö ist wissenschaftliche Beschäftigung mit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt; Studium des „Zusammenlebens“ lebender Organismen Tischler (1976) Ö ist die Wissenschaft von den Beziehungen zwischen Leben und Umwelt; Ökologen interessiert Verwirklichung des Lebens in seiner Mannigfaltigkeit und Verflochtenheit Krebs (1972) Ö ist wisschenaftliche Untersuchung jener Wechselbeziehungen, welche Verbreitung und Häufigkeit von Organismen bestimmen Remmert (1989) Ö ist die Haushaltslehre von der Natur (=strenge Naturwissenschaft) Def. Nentwig et al.: 3 zentrale Bereiche 1. Interaktionen zwischen Organismen (Populationen, Lebensgemeinschaften; Voraussetzung: Kenntnis der Organismenwelt-Biodiversität) 2. Interaktionen mit der abiotischen Umwelt (Eigenschaften von Arten/inkl. Subeinheiten; Ökosystemingenieure- Arten, die abiotische Umwelt verändern bzw. Lebensräume schaffen) 3. Beziehungen im Energie-, Stoff- und Informationsfluss Definition Umwelt Kühnelt (1979) U ist die Summe der anorganischen und organischen Lebensbedingungen Begon et al. (1998) U umfasst all jene Faktoren und Phänomene außerhalb des Organismus, die ihn beeinflussen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um physikalische oder chemische Faktoren oder um andere Organismen handelt. Larcher (1994) U ist Gesamtheit der äußeren Lebensbedingungen, die auf ein Lebewesen oder Organismengemeinschaft (Biozönose) in ihrer Lebenstätte (Biotop) einwirken. Allg. definiert: U umfasst all jene Faktoren und Phänomene, die auf ein ökologisches Objekt (Organismen, Populationen, Biozönosen, Landschaften, Biome) einwirken. Ökosphäre umfasst: =>Teil der Lufthülle, die Atmosphäre (Troposphäre) enthält (O, C, N) 1/32 =>Pedosphäre (Boden) inkl. Lithosphäre (=Gesteine der äußeren Erdkruste) Litosphäre enthält (H, O, C, Ca, K, Si, Mg, P, S, Al, Na, Fe, Cl) =>Hydrosphäre (Weltmeere, Grundwasser, fließende und stehende Binnengewässer, das Eis der Polkappen und Gletscher, sowie das Wasser in der Atmosphäre enthält (H, O, C, Ca, K, Mg, S, Na, Cl) =>Biosphäre, die Lebewelt enthält (H, O, C, N, Ca, K, Si, Mg, P, S, Al) Die ökologische Hierarchie Organismen- das Einzelindividuum, Eigenschaften und Bau einer Art als, Typus (o.Subeinheiten: Subspezies Rasse, Sorte, Ökotyp) Populationen setzen sich aus Individuen einer Art (Sippe) zusammen; def. Gruppe von Individuen einer Art in einem bestimmten Gebiet; Größe und Natur dieses Gebietes werden oft je nach Forschungszweck willkürlich festgelegt. Emergente Eigenschaften: Intraspezifische Konkurrenz: dichteabhängige Mortalität (Selbstverdünnungsgesetz) und Fekundität(=Fruchtbarkeit) (logistisches, sigmoides Wachstum) Biozönosen (Lebensgemeinschaften) setzen sich aus Populationen mehrerer Arten zusammen – Vielartpopulationen; Emergente Eigenschaften: Biodiversität, Stoffkreisläufe, Energieumsatz Komplexe/Landschaften setzen sich aus Zönosen zusammen; Emergente Eigenschaften: Migrationen- Nutzung von Teillebensräumen, Stoff- und Energietransfers, „Habitat des Menschen“ Biome/Zonobiome setzen sich aus den Komplexen/Landschaften einer klimatischen einheitlichen Region zusammen; spezielle Formen sind Pedobiome und Orobiome (Gebirge) Emergente Eigenschaften: Vermittlung der Energie und Stoffumsätze an der Erdoberfläche (v.a. zw. Lithos- und Athmosphäre) und zwischen den Großregionen; Beeinflussung von Klima und Wetter Die Vielfalt der Lebewelt (Biodiversität) Def. Biodiversität: UNCED: Rio1992 B ist die gesamte Vielfalt des Lebens auf der Erde. Es umfasst sämtliche Gene, die Arten und Ökosysteme und die ökologischen Prozesse, von denen sie Teil sind. Vereinfachte Definition Vielfalt der belebten Welt/ Vielfalt der Organismen bzw. deren Gemeinschaften Taxonomische Diversität Höhere Pflanzen: 250 000 Arten Beispiele für sehr artenreiche Familien Korbblütler (Compositae, Asteraceae) 22 750 Arten Orchideen (Orchidaceae) 18 500 Arten Kaffeegewächse (Rubiaceae) 10 200 Arten Süßgräßer (Gramineae, Poaceae) 9 500 Arten 2/32 artenarme und mittelgroße Familien Welwitschiaceae: 1 Arten Schachtelhalme (Equisetaceae): 15 A Seerosen (Nymphaeaceae): 75 A Nadelhölzer (Pinaceae): 220 A Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae): 2 450 A Rosengewächse (Rosaceae): 2 825 A bekannte Gattungen Frauenschuharten (Cypripedium) 40 A Edelweiß (Leontopodium) 58 A Brennesseln (Urtica) 80 A Veilchen (Viola) 400 A Eichen (Quercus) 400 A Primeln (Primula) 425 A Alpenrosen (Rhododendron) 850 A Greiskräuter (Senecio) 1 250 A Wolfsmilcharten (Euphorbia) 2 000 A Tiere 1 200 000 Bsp. Sehr artenreicher Gruppen Käfer (Coleoptera) 300 000 Zweiflügler (Diptera) 150 000 Hautflügler (Hymenoptera) 125 000 Schmetterlinge (Lepidoptera) 120 000 Insekten gesamt 950 000 mittelgroße Gruppen Spinnentiere (Arachnida) 75 000 Weichtiere (Mollusca) 70 000 Wirbeltiere (Vertebraten) 45 000 Krebse (Crustaceae) 40 000 Teilweise noch enorme Diskrepanz zwischen beschriebenen und möglichen Arten. Ökologische Diversität Unterschiede zw Meer und Land Höhere Taxa, die dem Meer der Süßgewässern fehlen bzw. weitgehend fehlen oder dort eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen: Bryophyta (Moose) Pteridophyta (Farnpflanzen) Spermatophyta (Samenpflanzen) Basidiomyceten und Ascomyceten ( höhere Pilze) Lichenes (Flechten) Insekten (nur dem Meer fast fehlend, im Süßwasser von großer Bedeutung) Amphibien (Lurche) Tierstämme, die ausschließlich marin sind: Placozoa, Mesozoa, Ctenophora, Gnathostomulida, Nemertini, Kamptozoa, Loricifera, Priapulida, Sipunculida, Echiurida, Chaetognatha, Pogonophora, Echinodermata, Hemichordata Höhere Pflanzentaxa, die vorwiegend marin sind: Phaeophyta (Braunalgen), Rhodophyta (Rotalgen), zentrale Kieselalgen (Centrales) Haptophyta (marine Plankter u.a. Coccolithophorales) 3/32 In summa scheint das Meer reicher an höheren Taxa zu sein, das Land dafür an Arten. Alpha Diversität = Artenzahl Tropische Regenwälder > 200 Temperate Wälder 15 – 80 Naturnahe und natürliche Wiesen und Steppen 20 – 90 Feuchtvegetationen < 20 (Schilf z.B. nur 3-5) Beta Diversität = Artenwechsel Beschrieben wird dabei der Artenzusammenhang zwischen zwei oder mehreren Lebensräumen. Je weniger Arten zwei Lebensräume gemeinsam haben, desto größer ist die Betadiversität. Gamma Diversität beschreibt die Artenvielfalt einer Landschaft. Gesamtdiversität – Surrogatprinzip Biodiversitätsgradienten Räumliche Biodiversitätsmuster Biodiversitätsmuster auf verschiedenen Skalen – quantitativer Aspekt Hot/Cold Spots Biodiversitätsmuster – qualitativer Aspekt Florenreiche – Florenelemente – Florengeschichte Florenreiche: Holarktis – nördliche Regionen, Europa, Nordamerika, Asien ... Paläotropis – Afrika, Süd-Asien Neotropis – Mittl- und Südamerika Capensis - Südafrika Australis – Australien, Neuseeland Antarktis – Antarktis Bioreiche: Holarktis Neotropis Paläotropis Australis Archinotis (Antarktis) Florenelemente: Holartis (Acer, Parrotia, Pterocarya, Quercus, Ulmus) Neotropis (Cactaceae) Paläotropis (Nepenthaceae) Australis/Camensis (Proteaceae) Antarctis (Azorella) Kontinentalverschiebung Florenelemente: Mitteleuropäisches (Ulmus laevis, Anemone ranunculoides) Boreales (Picea schrenkiana) 4/32 Atlantisches (Taxus baccata) Submediterranes (Cotinus coggygria) Mediterranes (Quercus ilex) Pontisch-pannonisch (Pulsatilla grandis, Ephedra distachya) Alpin endemisch (Androsace vandeli, Leontopodium alpinum) Neobiota Def.: Alle nach 1492 unter direkter Mitwirkung des Menschen eingebrachte Arten; Verursachen Probleme durch Konkurrenzdruck, Raubdruck, Übertragung von Krankheiten, Parasiten Neobiota in Österreich Gefäßpflanzen (Neophyten) Gesamt: 1 110 (zB Engelwurz, Sommerflieder) Etabliert: 224 Problematisch: <20 u.a. Eschenblättriger Ahorn, Götterbaum, div Zierastern, Wasserdorst, Japan-Knöterich, Goldruten, Kleines u. Drüsiges Springkraut, Topinambur, Rudbeckien, Robinie Pilze (Neophyten) Gesamt: 83 Schädlinge: Maisbrand, Ulmensterben, Krebspest, Feuerbrand, Tiere (Neozoen) Gesamt ca. 500; wahrscheinlich ca 700 – 800 Problematisch: Amerikanische Flußkrebse, Spanische Wegschnecke, Waschbär, Mink, Marderhund, Besatz mit fremden Fischen, Kartoffelkäfer Zehnerregel: von 1000 eingeführten Arten verwildern 100, davon etablieren sich ca 10 und davon werden 1 – 2 in irgend eine Form zum Problem; viele Arten ohne Einfluss, eine einzige kann aber ein ganzes Ökosystem beeinflussen. Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitatsrichtlinien) Tiere: Säuger: Mopsfledermaus, Langflü gelfledermaus, Bechsteinfledermaus, Kleines Mausohr, Großfußfledermaus, Wimperfledermaus, Großes Mausohr, Große Hufeisennase, Kleine Hufeisennase, Ziesel, Biber, Wolf, Sumpfwü hlmaus, Braunbär, Fischotter, Luchs Reptilien und Amphibien: Sumpfschildkrö te, Wiesenotter, Kammmolch, Rotbauchunke, Gelbbauchunke Fische: Ukrainisches Bachneunauge, Bachneuenauge, Rapfen, Hundsbarbe, Weißflossengrü ndling, Steingressling, Strö mer, Frauennervling, Perlfisch, Bitterling, Alpenbock), Mairenke, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Schrä tzer, Zingel, Huchen, Koppe Andere: Dohlenkrebs, div. Insekten(u.a. Hirschkä fer, Ameisenblä uling, Schneckenund Muscheln(z.B. Flußperlmuschel), Ziesel, Biber Pflanzen: 5/32 Gefäßpflanzen: Kriechende Sellerie, Schlitzblä ttriger Beifuß, Waldsteppen-Beifuß, Frauenschuh, Krainer Sumpfbinse, Alpen-Mannstreu, Sibirischer Goldkolben, MoorGlanzstendel, Bodensee-Vergißmeinnicht, Ö sterreichischer Drachenkopf, Steirisches Federgras, Vorblattloses Leinblatt, Felsen-Klee, Einfache Mondraute, Kleefarn Moose: Bruchia, Koboldmoos, Ricciabreidleri u.a. Ö̈kologischeTeildisziplinen Nach hierachischen Gesichtspunkten: Gen-Ö kologie, Autoökologie, Populationsökologie, Synö kologie (Biozönologie, community ecology), Landschaftsö kologie, global ecology Nach Lebensräumen: Terrestrische Ökologie(inkl. Pedologie, Limnologie), Meeresbiologie, Stadtö kologie Nach taxonomischen Gesichtspunkten: Pflanzenökologie(inkl. Vegetationsö kologie, Pflanzensoziologie), Tierö kologie, Mikrobielle Ökologie, Humanökologie Nach stofflich-funktionalen Gesichtspunkten: Biochemische Ö kologie, Ökophysiologie, Ö kosystemphysiologie, invasion ecology Nach angewandten Gesichtspunkten: Agrarö kologie, Waldö kologie, Naturund Landschaftsschutz, Umwelthygiene, Soziale Ökologie, Landschaftsplanung, Restaurationsö kologie 2. Autoökologie – ökol. Nische, Ökofunktionaler Typen Ö̈kofunktionaleTypen Grundsä tzlich besitzt jede Art ihre individuelle, spezifische ökologische Nische oder ihren ökologischen Steckbrief (environmental envelope); es lassen sich aber zumindest Artengruppen zusammenfassen, die offensichtlich ähnliche, relevante ö kologische Eigenschaften besitzen, sogenannten Ökofunktionale Typen(oder Lebensformen). Hinter Typenbildungen steht das Phä nomen der Konvergenz, d.i. Entwicklung ähnlicher Eigenschaften und Strukturen als Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen. Konvergenz bei: tropischen Hochgebirgspflanzen; Riesenrosetten Arten des Sandlückensystems an der Meeresküste Süßwasser- und Meeresplankton der Benthosfauna im Meer und beim Nekton des Meeres Ökofunktionale Typen (Pflanzen) 1) Resourcen-orientierteTypen Abiotische (unbelebt) R. Wasser: Hydrophyten (leben im Wasser, submers – unter Wasser), Hygrophyten (Wurzeln am Wasserboden sind an Wasser gebunden), Mesophyten (an feuchte Standorte gebunden), Xerophyten – trockener Standort (stenohydre X, malakophylle X, sklerophylle X (hartlaubig), Sukkulente (Wasser kann in Wurzeln, Knollen, Zweibel gespeichert werden); Poilkilohydre-homoiohydre Pfl.; ertragen hohen Wasserverlust 6/32 Hydrostabile-hydrolabile Pfl. Kohlendioxid: C-Heterotrophe, C-Autotrophe; C3/C4/CAM-Pflanzen Stickstoff N-autotrophe, N-heterotrophe; Nitratassimilierer, Ammoniumpflanzen Kochsalz Halophobe (Salz Feinde), Halophile (Salz-ertragend), halophytische Pflanzen (brauchen Salz) Kalk Calciphobe, Calcicole-Flora Edaphischer Vikariismus: nahe verwandte Arten, die sich auf verschiedenen Bodenverhältnissen entwickelt haben Metalle, Schwermetalle Al-Mn-Toxizitä t; Galmei-Flora Biotische (belebt) R. Bestäuber: Wind-, Insekten-, Vogel-, Fledermaus-, Selbstbestä uber Verbreitung: Anemochorie (Windverbreitung), Zoochorie (Tierverbreitung durch zB. Exo: Klettfrüchte, Klebefrüchte, Endo: Fressen) etc... 2. Konditionen-orientierte Typen Temperatur: Temperaturstress: Erkä ltungsempfindliche, gefrierempfindliche, gefrierbestä ndige, frosttolerante Arten; hitzeempfindliche, hitzetolerante Arten, Temperaturabhä ngigkeit von Photosynthese, Atmung, Wachstumsprozessen 3. Störungsorientierte Typen: Feuer: feuerempfindlich, feuertolerant, pyrophytisch (brauchen Feuer) Allgemeine Stressstrategien: ruderale, kompetitive, Stress-tolerante Arten; r-, K-Strategen Tierfraß: chemische, morphologische Abwehr Überdauerungstypen – Lebensformen nach Raunkiaer Phanerophyten – Tragen Knospen weit über dem Boden Chamaephyten - Überdauerungsorgane sich unterhalb der mittleren Schneehöhe von 25 cm befinden und damit im Schutz einer Schneedecke überwintern Hemikryptophyten – Überdauerungsorgan liegt direkt über der Oberfläche Geophyten – Knospenlage geschützt in der Erde Therophyten – kurzlebig, schnelle Entwicklung, Samen können überdauern 4. Ökofunktionale Typen(Tiere; nachKühnelt): Nach mechanischer Beschaffenheit des Aufenthaltsortes: 7/32 1) Substratsiedler Bodengrä ber, Planktonten-Nektonten, Luftplankter, Flieger(z.B. Drachenflieger, Schwirrflieger, Flatterflieger, Segelflieger) 2) Grenzflächensiedler Lauftiere, Kriechtiere(Boden-Luft); Kletterer(Pflanze-Luft); Schwimmer(Wasser-Luft) Nach der Nahrungsaufnahme: Euryphage, stenophage Tiere; Aufnahme flü ssiger versus fester Nahrung; Innenverdauung versus Außenverdauung (z.B. Spinnen, Hundertfü sser); Zerkleinerer, Graser, Browser, Filtrierer Nach der Wä rmeregulation: Homö othermie (Sä ugetiere, Vö gel; ausg. Jungtiereund Schnabeltiere) versus Poikilothermie (aber Vermeidungseinrichtungen und Einrichtungen zur Wä rmeregulation) Nach dem Wasserhaushalt: Wassertiere, Feuchtlufttiere, Trockenlufttiere; Wasseraufnahme versus Wasserrückgewinnung im Kö rper Nach chemischer Beschaffenheit des Umgebungssubstrats: z.B. stenohaline versus euryhaline Formen Konzepte der Ökologischen Nische eindimensional (Temperatur) zweidimensional (Temperatur + Feuchtigkeit) dreidimensional (Temperatur + Feuchtigkeit + zb Strömung) 3. Populationsökologie Def. Population(Brandl): Summe aller Individuen einer Art, die in einem Siedlungsgebiet leben und dort miteinander in Wechselwirkung treten Zu Individuum: Abgrenzung nicht immer eindeutig; unitare versus modulare Organismen Unitare Organismen: aus Zygote entsteht ü ber Embryonal-bzw. Larvalentwicklung das adulte“Individuum”; die Individuen sind in populationsgenetischer als auch ökologischer Hinsicht die biologisch relevanten Elemente! Bsp: Morpho-Falter, der Hund „Mutz“ Modulare Organismen: nur einzelne Bausteine –die Module –sind durch genetische Information festgelegt (z.B. Blatt, Achselknospe, Internodium); Zahl und Anordnung der Module hängt von Umweltbedingungen ab –modulare O. sind wesentlich flexibler; Module kö nnen selbstä ndig werden; populationsö kologisch relevant sind daher Individuen als selbständige Module (ramets) bzw. als genetisch einheitliche Einheit (genets); Gruppen von Individuen gleichen Alters (genets oder ramets) bezeichnet man als Kohorten. Bsp: Banksia spec. , Riffkorallen Zu Siedlungsgebiet: Abgrenzung nicht einfach; meist pragmatische Abgrenzung; Summe aller Siedlungsgebiete ist das Areal einer Art; Gegensatzpaar: Kosmopoliten versus Endemiten Zu Wechselwirkung: 8/32 WW in Populationsökologie: intraspezifische Konkurrenz = Wettbewerb zwischen den Individuen um verfügbare Ressourcen. WW in Populationsgenetik und Evolutionsforschung: WW sind alle Prozesse, die zum Austausch und zur Umverteilung der genetischen Information führen (z.B. Mutation, Selektion, Paarungsverhalten) Emergente Eigenschaften von Populationen: Populationsgröße Populationsdichte (Individuen pro Flächeneinheit) Es gilt: 1)Individuendichte kann zwischen Arten enorm schwanken. 2)Zwischen Körpergrö ße und Individuendichte besteht –zumindest bei Tieren –eine enge Beziehung: Insekten von 1mg Gewicht entspricht Dichte von 108Ind/km2/ Säugetier von 1kg entspricht Dichte von 100-1000 Ind/km2 3)Andere Eigenschaften spielen untergeordnete Rolle (z.B. Dichte von Eulen und Greifen nicht anders als von andern Vögeln gleicher Größe mit anderen Nahrungsansprü chen) 4)Bei Pflanzen keine so engen Beziehungen; auch hohe Plastizitä t der Pflanzengröße (bes. Unkräuter) Resultat der Modularitä t bei Pflanzen räumliche Verteilung 3 Mö glichkeiten: 1) regulä r 2) zufällig 3) geklumpt Altersstruktur Ziel der Populationsökologie: Beschreibung dieser Eigenschaften und deren Verä nderung in der Zeit Die primären Prozesse der Populationsdynamik 1)Produktion an Nachkommen im Zeitintervall Δt 2)Anzahl Sterbefälle im Zeitintervall Δt 3)Zuwanderung von Individuen (Immigration) 4)Abwanderung von Individuen zu anderen Populationen (Emigration) Verä nderung von Populationsgröße (N) in Zeiteinheit ergibt sich somit als: N(t+Δt) = N(t) + Geburten –Sterbefä̈lle + Zuwanderung –Abwanderung Die positiven und negativen Komponenten der Gleichung halten sich selten die Waage. Natürliche Populationen zeigen in der Regel regelmäßige, unregelmäßige bis chaotische Schwankungen. TypI: Mortalitätsrate steigt im Alter Typll: Mortalitätsrate konstant TypIII: Mortalitätsrate sinkt im Alter Populationswachstum: Exponentieller und sigmoider Dichteanstieg im Laufe der Zeit für Modelle mit kontinuierlicher Fortpflanzung Lebensstrategien 9/32 K-Selektion: stabile Umwelt Populationen erreichen K Konkurrenz große Arten jährliche Reproduktionsleistung gering wenig Jungtiere, Brutpflege möglich Langlebigkeit weniger, große Nachkommen R-Selektion: instabile Umwelt Populationen schwanken Neubesiedelung kleine Arten jährliche Reproduktionsleistung groß kurzlebigkeit viele, kleine Nachkommen Bsp: Pinus longaeva: 4000 Jahre alt (sehr groß), Kleinling: < 3 Wochen (etw. Größer als 1 Schilling) RCS-Strategien(bei Pflanzen): R –Strategen: Ruderale Pflanzen (entspricht etwa r-Strategie); Arten früher Sukzessionsstadien C –Strategen: Pflanzen, die andere aktiv weg konkurrenzieren kö nnen; Arten mittlerer Sukzessionstadien K –Strategen: Stress-tolerante Arten (entspricht in Grenzen K-Strategen); Arten mittlerer und später Sukzessionsstadien Intraspezifische Konkurrenz Durch Verbrauch von Ressourcen (z.B. Raum) Verdü nnungsgesetz w = c.d-3/2 w = Gewicht des Indiviuums d = Populationsdichte c = Konstante Konsequenz: bei Pflanzen wird Biomasse konstant gehalten; = Gesetz von konstantem Ertrag Konkurrenz durch gegenseitige Beeinträchtigung Direkte Interaktion zwischen Individuen(z.B. Territorialansprü che) Lebenszyklen bei Pflanzen: Diasporenbank –Keimung –vegetatives Stadium –reproduktives Stadium –Tod bei Tieren: Geburt –Jugendstadium (Larvalstadium)–Erwachsenenstadium –Altersstadium –Tod Dichteabhängige Regulierung kann besonders bei Tieren je nach Stadium sehr verschieden sein. 10/32 Semelpare (monokarpe, hapaxanthe) Arten: Arten schreiten nur einmal und dies am Ende des Lebens zur Fortpflanzung. Bsp: Arctium tomentosa, Silberschwert Iteropare (polykarpe) Arten: Arten reproduzieren im Laufe des Lebens mehrmals. Bsp: Pinus longaeva “trade offs”: gegenläufige Auswirkung auf Vermehrungspotential (Investition in Reserven verringert Mortalitätsrate, verringert aber auch Geburtenrate) Fitness Reproduktionsleistung eines Indiviuums im Laufe seines gesamten Lebens Ephemere, monocarpe Arten: Ackerwildkräuter – Papaver rhoeas, Camelina microcarpa, Consolida regalis Regionale Prozesse –Einwanderung und Auswanderung Metapopulationskonzept Def. System von Populationen zwischen denen Austausch von Individuen möglich ist; Gesamtsystem als Ensemble von selbständigen Siedlungsgebieten aufzufassen Verschiedene Modelle: “mainland–island” Modell: genügende Anzahl von Immigranten steht stets zur Verfügung “klassisches”Metapopulationsmodell: alle Populationen stehen miteinander gleichwertig in Beziehung; hohe Dynamik des Verschwindens und der Neubegründung von Populationen. Flä chengröße und Isolation sind wesentliche Bestimmungsgrößen der Metapopulationsdynamik –“targeteffect”(mit zunehmender Flä che steigt die Wahrscheinlichkeit der Neubesiedlung). 4. Lebensgemeinschaften – Ökosysteme Lebensgemeinschaften (inkl. Wechselwirkungen zwischen Arten) Def.: Lebensgemeinschaften sind Vielart-Populationen und als solche offene, komplexe Systeme Wesentliche emergente Eigenschaften von Lebensgemeinschaften: 1) Arten-Diversitä t(bzw. Div. Ö kofunktionaler Typen) 2) Nicht-Zufä lligkeit der Artenzusammensetzung: Lebensgemeinschaft (LG) ist charakterisiert durch bestimmte Artenzusammensetzung, Physiognomie und Standortseigenschaften (vgl. Def. von „Pflanzengesellschaft“durch Botanikerkongress 1910) 3) Spezifische Raumstruktur und Dynamik (LG hat länger Bestand als einzelne Individuen) 4) LG schaffen sich eigene Umwelt: Nischenvielfalt wird in Rü ckkoppelung mitbestimmt. LG’s sind zu Selbstregulation und Selbstgestaltung befähigt. LG ist ein komplexes Beziehungsgefüge Phytozönosekomplex +/+ Strukturbestimmende „ökologische Ingenieure“ (Karnivore, Parasiten, 11/32 Destruenten) +/++ Bestäuber (Karnivore, Parasiten, Destruenten) +/++ Destruenten (Karnivore, Parasiten) +/0 Untermieter (Karnivore, Parasiten, Destruenten) ++/++ Symbionten (Karnivore, Parasiten, Destruenten) -/++ Herbivore (Karnivore, Parasiten, Destruenten) Organisation von Lebensgemeinschaften Konzept des Konsortium: Def.: Organismenset, das an eine Schlüsselart unter den Primärproduzenten gebunden ist. Konsortium an Birken (Betulapendula, B. pubescens):127 parasitische und mykorrhizabildende Pilzarten, 46 epiphytische Flechten, 23 epiphytische Moose, 8 Milben-, 574 Insekten-, 8 Vogel-und 9 Sä ugetierarten mehr oder weniger eng verbunden. Konzept der Gilde: Def.1: Gruppe von Arten , welche auf ä hnliche Weise dieselbe Klasse von Ressourcen nutzt, ungeachtet deren Verwandtschaftsgrades. Die Fassung von Gilden richtet sich nach der Art der Ressource, die betrachtet wird. Def.2: Gruppe von Arten, die in Lebensgemeinschaften dasselbe tun oder besser, in ähnlicher Form tun. Letztlich besitzt jede Art eine gewisse Individualitä t und sind ihre ö kologischen Ansprü che grundsätzlich nicht ident mit einer anderen Art. Def.3: Gruppe von Arten, die dem gleichen ökofunktionalen Typ zuzuordnen sind. Wichtige Unterscheidung: Gilde kann allgemein, d.h. analog zu Lebensform bei den Pflanzen verstanden werden oder in Bezug zu eine konkreten Lebensgemeinschaft. Konzept der Synusie Def.: Gruppe von Pflanzenarten, Pilzen oder Mirkoorganismen, die in einer Lebensgemeinschaft dasselbe tun und ähnliche Teilhabitate besetzen. (vgl. Def.2 der Gilde) Im Gegensatz zu Gilde, sind Synusien immer auf Lebensgemeinschaften bezogen, d.h. Synusien des Buchenwaldes, Synusien der Vorstadtgärten, Synusien der Steppe etc. Allerdings sind Synusien nicht an eine bestimmte Lebensgemeinschaft gebunden – sie können auch darü ber hinaus gehen. Weitere Differenzierungen (Beispiele) Bestä uber: Pollenfresser, Pollensammler und Nektarlecker Phytophage: Blatt-und Sproßfresser (Minierer, Skelettierer, Lochfresser, Raspler Holzfresser, Bast-und Borkenfresser, Saftsauger, Wurzel-/Rhizom-/Knollen-und Zwiebelherbivore, Samen-und Früchtefresser Karnivore: Jäger, Fallensteller, Lauerer Untermieter: Hö hlenbrü ter, Kronenbrü ter, Bodenbrü ter Formen von Interaktionen zw 2 Arten: Mutualismus (Symbiose) +/+ Trophische Beziehunge +/- Typen: Letalität, Intimität hoch ->Parasitoid Letalität hoch, Intimität niedrig-> Räuber Letalität niedrig, Intimität hoch -> Parasit Letalität niedrig, Intimität niedrig -> Weidegänger 12/32 Konkurrenz -/Kommensalismus +/0 Amensalismus -/0 Neutralismus 0/0 Grundtypen von Lebensgemeinschaften Autochthone Lebensgemeinschaften Landökosysteme(ausgen. Höhlen, Städte), photische Zone von Seen und Meeren (spez. Litoral, inkl. hot vents), mittelgroße Flüsse Allochthone Lebensgemeinschaften Bäche und Flüsse (Flußkontinuumkonzept: Oberlauf: Zerkleinerergilde herrscht vor, Mittellauf: Weidegängergilde nutzt Primärproduktion durch Algenaufwüchseetc.,Unterlauf: Filtrierergildenutzt Feinpartikel, die mitgeschwemmt werden) Dysphotische und aphotischeZone der Meere und Seen (Destruentengilden nutzen Phytodetritusaggregate, Zooplankton-Fäzes, Tierleichen, Pflanzen Tangreste etc.; an diese komplex Nahrungsketten ansetzend) Grundwasser, Höhlensiedler, Lückensiedler Organismische Struktur autochthoner Lebensgemeinschaften: Phytozönose(inkl. karnivore Pflanzen) oder Phytozö nosenkomplex/ Pflanzengemeinschaft an Phytozönosegebunden: parasitische Pflanzen, Pilze (spez. Mycorrhiza, Rostpilze, Mehltaupilze etc.) bzw. Mikroorganismen (spez. Bakterien-Symbiosen) Destruenten(Pilze, Mikroorganismen) Gildenstruktur der Zoozönose Direkt an Phytozönoseansetzend Herbivorengilden (ca. 1⁄4aller lebenden Organismen !) Mutualistenspez. Bestä ubergilden Symbionten Ökologische Ingenieure Untermieter Destruenten An den genannten Gilden ansetzend (hö here Stufen der Nahrungskette besetzend) Karnivorengilden (Rä uber, Prä datoren), Omnivore Parasiten Parasitoide Organismische Struktur allohthoner Lebensgemeinschaften: An organischem Material ansetzend: Saprophytische Pflanzen Destruenten (Pilze, Mikroorganismen) Gildenstruktur der Zoozönose: 13/32 Detritusfresser Mutualistenspez. Bestä ubergilden Symbionten Ö kologische Ingenieure Untermieter An den genannten Gilden ansetzend (hö here Stufen der Nahrungskette besetzend) Karnivorengilden (Rä uber, Prä datoren) Parasiten Parasitoide Floristische Koinzidenzen –Pflanzengesellschaft (Vegetationsökologie) Defs.: Pflanzengemeinschaft–konkreter Pflanzenbestand Pflanzengesellschaft–abstrakter Typus Assoziation -Pflanzengesellschaft von bestimmter floristischer Zusammensetzung, einheitlichen Standortsbedingungen und einheitlicher Physiognomie; durch charakteristische Arten gekennzeichnet (Charakterarten, Differentialarten) Synsystematik –Assoziation als Basiseinheit kann zu hö heren Einheiten zusammengefaßt werden (= Kernaktivitä t von Pflanzensoziologie): Verbä nde, Ordnungen, Klassen Faunistische Koinzidenzen und Konzepte Leitartenkonzept Def.: Leitarten sind Arten, die in einem Lebensraum signifikant höhere Abundanzen erreichen. Leitarten kö nnen Pflanzengesellschaften zugeordnet werden. Fließgewässerregionen (Forellen-, Ä schen-, Barben-und Brachsenregion) Saprobiensystem(Bakterien, Algen, Ciliaten, Rotatorienetc.) Biotoptypen Europas (Biotop –Lebensstä tte einer Lebensgemeinschaft) Biotoptypen der Flora-Fauna-Habitats-Richtlinie der Europä̈ischen Union Marine und halophytische Lebensräume (Offene See und Gezeitenzone; Klippen und Felskü sten; Temperate und nordische Marschen und Salzwiesen -auch solche des Binnenlandes; Mediterrane Marschen und Salzwiesen; Binnenländische Salzund Gipssteppen) Küsten-und Binnendü̈nen (Meeresdü nen am Atlantik, der Nordsee und des Baltikums; Mediterrane Kü stendünen; Dü nen des Binnenlandes) Sü̈ßwasserlebensrä̈ume (Stillgewä sser; Fließgewä sser) Heiden und Gebüschformationen Mediterrane Hartlaubgebüsche (Submediterrane und warm-temperate Heiden und Gebüsche; mediterrane Gebü sche –Macchie, Matorral; thermo-mediterrane Steppengebüsche; mediterrane Zwergstrauchformationen –Phrygana, Garrigue) 14/32 Naturnahes und halbnatü̈rliches Grasland (natürliches Grasland –z.B. alpine Urwiesen“; halbnatü rliche Trockenrasen und Trockengebüsche; hartlaubige Weidewä lder –Dehesas; Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren; mesophile Wiesen) Hoch-, Übergangs-und Niedermoore(Hochmoore; kalkreiche Niedermoore; Aapa– Moore); Untergliederung als Beispiel: Naturnahe lebende Hochmoore; Geschädigte Hochmoore (die mö glicherweise noch auf natü rlichem Wege regenerierbar sind); Übergangs-und Schwingrasenmoore; Niedermoore ü ber Torfsubstraten (Rhynchosporion), Kalkreiche Sümpfe mit Cladiummariscusund Carex davalliana; Kalktuff-Quellen (Cratoneurion); Kalkreiche Niedermoore; alpine Pionierformationen des Caricionbicoloris-atrofuscae. Felshabitate und Hö̈hlen(Schutthalden; Felswä nde und –hänge; andere Felshabitate –Höhlen) Wä̈lder (boreale Wälder; temperate Wä lder; mediterrane , sommergrü ne Wälder; mediterrane Hartlaubwä lder; subalpine Nadelwä lder, mediterrane GebirgsNadelwä lder) Nationale und Regionale Typenkataloge (inkl. Roter Liste –Bewertung); siehe auch Biotoptypenkatalog Österreichs. Organismus-versus Individualistische Hypothese Konkurrenzausschlußprinzip (Gause’sPrinzip) Zwei konkurrierende Arten können nur durch Nischendifferenzierung existieren (d.h. in ihren realisierten Nischen). Erfolgt eine solche Differenzierung nicht, oder lässt es das Habitat nicht zu, dann wird eine Art die andere verdrä ngen. Oder es ist Nischenkomplementaritä t gegeben: Arten, die um eine Ressource konkurrieren unterscheiden sich in ihren Ansprü chen hinsichtlich eines anderen Faktors. Koexistenztheorien -Konkurrenzausschluß: Koexistenz möglich, wenn Ressourcen in genügendem Ausmaßvorhanden sind -ausbeutervermittelte Koexistenz: Prä datorenwirken regulierend auf Nutzarten, daher geringerer Verbrauch von Ressourcen durch diese -Koexistenz durch Konkurrenzverlangsamung: durch wiederkehrende Stö rungen; intermediate disturbance hypothesis -Mosaik -Zyklus –Theorie: Koexistenz, wenn Stö rflä chen verschiedenen Alters vorhanden sind und Migration dazwischen möglich ist. -Nischenheterogenität durch Schwellenwertüberschreitungen -Koexistenz durch Umweltheterogenitä̈t: paradox of the plankton -Vorratseffekt, Dominanz-und Grü̈nderbestimmung Positive Interaktionen -Prä̈adaptionshypothese: Lebensgemeinschaft ist Produkt koevolutiver Beziehungen; Diversitä t und Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften sind Resultat unterschiedlichster Krä fte, die in verschiedenen Weltteilen mit ähnlichen Lebensbedingungen gleich wirken bzw. gewirkt haben und so Präadaptationen an ö kologische Planstellen geschaffen haben, die zweifellos durch negative und positive Interaktionen zwischen ö kofunktionalen Typen mitdefiniert sind und waren. 15/32 Determinanten im Gesamtsystem Top down: Lebensgemeinschaft wird in Struktur und Artenzusammensetzung von oben her bestimmt (z.B. in Form von Rä uber-Beute-Systemen) Botto mup: Bestimmung von unten her durch Primärproduzenten, die die Energieflü sse und Nä hrstofftransfers bestimmen (Produktivitätshypothese: je mehr Energie dem System zur Verfü gung steht, umso lä nger die Nahrungsketten, umso mehr Arten) Stabilitä̈t von Lebensgemeinschaften Resiliente LG‘s: kehren immer wieder in ihren Ausgangszustand (oder einen ä hnlichen Zustand) zurück; r-selektionierte Arten Resistente LG’s: Veränderungen werden von Anfang an vermieden; K-selektionierte Arten Grundsätzlicht gilt: Stabilität ist NICHT an hohe Diversität oder Komplexitä t gebunden. 4 Hypothesen zur Veränderung von Funktionen (Energiefluss, Stofftransfers) bei Verä nderung der Diversitä t und Zusammensetzung: 1. Nullhypothese –es geschieht nichts. 2. Idiosynkratische Hypothese–Ä nderungen sind beobachtbar, aber ungerichtet 3. Nieten-Hypothese–jede Art ist wichtig, jede Entfernung auch nur einer Art verändert Prozeßrate in gerichteter Form 4. Redundanzhypothese–gewisse Grundausstattung an Arten ist notwendig, um Prozeßablä ufe bei gegebener Rate zu sichern –mehr Arten sind redundant. Gemeinschaftskomplexe, Ökosysteme Definition Gemeinschaftskomplex: Im realen Raum verschieden ausgedehnte, abgrenzbare Mosaike von Lebensgemeinschaften unterschiedlicher Form, Physiognomie und Struktur; einzelne Elemente nicht isoliert, sondern funktional mehr oder weniger eng verzahnt ; zu beachten ist das Phä nomen der Räumlichen Autokorrelation. Biozö̈nologischesParadoxon: Summe der Phytozö nosen > Summe der Zoozönosen Definition Ökosystem: Biozönose plus Umwelt = Ökosystem (Tansley) Besser: Phytozönose(n) + Zoozö̈nose = Biozönose Biozönoseplus Umwelt = Ö̈kosystem Phytozö̈nose(n) + Zoozö̈nose+ Umwelt = Ökosystem Konsequenz dieser Definition: Heterogenitä t ist ein Wesensmerkmal von Ökosystemen Ökosystemkonzept an sich abstraktes Modell: duale Sichtweise 1. Populationsö kologisch-zö nologische Sichtweise: Ökosystem ist ein multifunktionales Systeminteragierender Populationen, die mit der abiotischen Umwelt in Beziehung stehen 2. Stofflich-funktionale Sichtweise: Ö kosystem ist ein System trophischer Kompartimente, welche im Stoffaustausch mit der Umgebung stehen und durch den Energiefluss vebunden sind. Höhenstufen und Lebensbereiche 16/32 4270 m obere nivale Stufe (Kryptogamen: Pilze, Moose, Algen, Flechten) 3400 m untere nivale Stufe (Dikotyle Polsterpflanzen) 3000 m subnivale Stufe (Rasenfragmente, Schutt) 2800 m obere alpine Stufe (Mosaik aus Krummseggen-Rasen und Schneeböden, Schutt, Fels) 2600 m mittlere alpine Stufe (Hochlagen-Weiderasen, Gemsheide-Spaliere) 2400 m untere alpine Stufe (Sonnenseite: Bärentrauben-Heide, Schattenseite: AlpenrosenBärenheide, Felsfluren, Schutt, Weiderasen) 2000 m subalpine Stufe (Waldgrenze 1600-2400m Ostalpen:Lärchen, Westalpen Zirben, Legföhren, Föhren, Grünerlen, Weiderasen) Terrestrische Großlebensräume der Erde Klassifikation terrestrischer Lebensräume Formationssysteme nach Lebensformen / ö kofunktionalen Typen Biome: Grosslebensrä ume mit „einheitlichem“ Klima und „einheitlicher“ Pflanzen- und Tierwelt; Zonobiome: Zusammenfassung gleicher Biome Die einzelnen Zonobiome Jedes Zonobiomwird nach folgenden Inhalten besprochen: • natü rlich-zonale Ö kosysteme • Gebirgs-Ö kosysteme • natürlich-azonale Ökosysteme • anthropogene Einflüsse -Umweltprobleme Terrestrische Formationen Wälder: Tropische Regenwälder Subtr.-warmtemp. Regenwälder Kühltemp. Regenwälder Regengrüne Monsunwälder Sommergrüne Laubwälder kalttemp. Nadelwälder Lockengehölze: Dorngehölz Savannen Hartlaubgehölze Waldsteppen Gras u. Zwergstrauch (sub)tropische Grasländer Vegetation temperate Steppen Tundren Wüsten: Hitzewüsten Trockenwüsten Kältewüsten Zonobiome der Erde ZBI ZBII ZBIII ZBIV Tropische Regenwaldgebiete Tropische(-subtropische) Regenzeitwälder und Savannen Zone der heißen Halbwüsten und Wüsten Warmtemperate, dürre-und episodisch frostbelastete Gebiete mit i mmergrünen Wäldern (=mediterranes Zonobiom) ZBV Warmtemperate, regenreiche, episodisch frostbelastete Gebiete mit immergrünen Wäldern (= Lorbeerwaldgebiete) ZBVI Winterkalte Gebiete mit laubwerfenden Wäldern (nemorales Zonobiom) ZBVII Winterkalte Steppen, Halbwüsten und Wüsten 17/32 ZBVIII Winterkalte Nadelwaldgebiete oder Taiga (= boreales Zonobiom) ZBIX Tundren und polare Wüsten (=polares Zonobiom) • Zonale Vegetation • Hö̈henzonale Vegetation (extrazonal): Orobiome(intra-, inter-und multizonal) • AzonaleVegetation: ein bestimmter Faktor herrscht vor • Ökotone = Ü bergangsbereiche zwischen Ö kosystemen • Zonoökoton Zonobiom I : Tropische Regenwälder - mehr als die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten Zonale tropische Ökosysteme: Vertikalstruktur im Regenwald: mehrere Baumschichten: von Emergenten bis zu Klein- und Kleinstbäume; Vielfalt der Phanerogamen wenig Großtiere, Großteil der Arten kleiner als 3mm Berg-Regen- und Nebelwälder: extremer Epiphytenreichtum Alpine Stufe Azonale Ökosysteme Auen: großflächig im Kongo und Amazonasbecken Mangroven Sandküsten: oft mit weit verbreiteten Arten zB Kokospalme Anthropogene Einflüsse: Großflächige Abholzung „Hamburgerisierung“ Leguminosen als Zwischenfrucht für N-Input Mangrovenzerstörung: ca 50 % der Bestände zerstört 38% Mangrovenverlust in den letzten 20 Jahren Zonobiom II: Tropische(-subtropische) Regenzeitwälder und Savannen Zonale Vegetationsabfolge entlang zunehmender Saisonalität halbimmergrüne trop. Wälder 1500-2000m (Epiphyten können noch häufig sein, Brettwurzeln fehlen jedoch) regengrüne trop Wälder / Monsunwälder 500 – 1500 m ( Savannen 250-600 m (tropisches Grasland mit eingestreuten Bäumen; zonale bis azonale Ökosysteme) Savanne: Gräser-Gehölz-Antagonismus bezüglich Wasser-Verfügbarkeit Gräser: Wurzelsystem dicht, dort wo Boden in Regenzeit viel Wasser enthält; Wasserhaushalt: starke Transpiration bei intensiver Photosynthese ( C4 Pflanzen) bis Blätter verwelken; Gehölz: Wurzelsystem weitstreichend auch in tiefere Schichten, Wasser kann unregelmäßig verteilt sein; Wasserhaushalt: bei leichtem Wassermangel reagieren die Stomata; dann Blattabwurf; auch kahle Bäume brauchen Wasser Großtierherden sind ein wichtiger Ökofaktor Azonal: Edapische Savannen – Niederschlag für Wald ausreichend aber Böden zu seichtgründig oder zu nährstoffarm Hochgebirge: Himalaya – Süd und Südostseite-> Monsunale Sommerregen Zentrale Anden Subtropische Trockenwälder für den Soja-Anbau. Soja für die Europäische Massentierhaltung: Verdoppelung der Anbaufläche in Südamerika in den letzten 10 Jahren 18/32 Zonobiom III: heiße Halbwüsten und Wüsten: Halbwüste: 100-250mm/Jahr Niederschlag Vollwüste: < 100mm/Jahr Substratspezifische Wüstentypen: Steinwüste (Hammada) Sandwüste (Erg) Kieswüste (Serir) Salzwüste (Schott) Sandböden sind feuchter als Tonböden Kontrahierte Vegetation: Wurzelkonkurrenz (unterird Biomasse größer) Lebensformen/Strategietypen der Trockenheit „ausweichend“: Pluvio-Therophyten (als Samen) Geophyten (unterird. Überdauerungsorgane) der Trockenheit „widerstehend“: Sukkulente Xerophyten (oft CAMPflanzen) (wasserspeichernd) Sklerophylle Xerophyten (hartlaubig) Laubabwerfende Xerophyten Poikilohydre (können völlig austrocknen) Hochgebirge: 0-3000 m vegetationslose Wüste 3000-3500m Strauch und Sukkulenten-Halbwüste 3500-4200m Trockenpuna 4200-5000m andine Gras- und Polsterfluren >5000m subnivale Frostschutzzone bis in die unvergletscherte Gipfelregion Azonal: Oasen; durchwegs anthropogen genutzt; Nomadismus Anthropogene Einflüsse: Desertifikation- Überweidung, Bewässerung, Klimawandel Zonobiom IV: mediterranes Zonobiom: warmtemperate, dürre- und episodisch frostbelastete Gebiete mit immergrünen Wäldern Zonale Vegetation: Hartlaubwälder und xerotherme Kiefernwälder arido-humides Klima Sommertrockenheit: Einfluss der subtrop. Hochdruckzone Winterregen: Einfluss des temperaten Klimas (zyklonale Regen) Niederschlag: 300-1500mm; potentielle Evapotranspiration im Jahresmittel höher als Niederschläge; Flüsse oft austrocknend ca 2% der Landfläche (flächenmäßig kleinstes ZB) nach den immer feuchten Tropen das artenreichste ZB (2000 Arten/10 000km^2) xerotherme Kiefernwälder und Hartlaubwälder Sklerophyllie: harte, durch Sklerenchyme (Festigungsgewebe) verdickte und mit einer dicken Cuticula versehene Blätter, die zur Einschränkung der Verdunstung wachsartige und harzige Deckschichten aufweisen; meist immergrün; Stomata können teilw. Geschlossen werden und befinden sich oft an der Blattunterseite in kleinen Vertiefungen Malakophyllie: hydrolabile Arten, deren Blätter vergleichsweise weich und oft mit einem Haarfilz ausgestattet sind und deren osmotische Werte starken 19/32 Schwankungen unterliegen (ertragen hohe Wasserverluste); Regulation durch Welken und Blattabwurf zB Geophyten: Tulipa, Ophrys Anthropogene Einflüsse: altes Kulturland Zonobiom V: Lorbeerwaldgebiete; an den Ostseiten der Kontinente Temperatur: Jahresmittel 15°C; in den Übergangsgebieten zu ZBII bis um 20°C Die zonalen Lorbeerälder (Baumarten sind zumindest zum Teil immergrün) sind bis auf wenige Reste verschwunden (dichte Besiedlung; Reisanbau) an den Westseiten der Kontinente Temperatur: deutlich geringeres Jahresmittel um 10°C kühle Somer, kühle aber nicht kalte Winterregen z.T. Niederschlagsmaximum im Winter z.T. Ganzjährig feucht, zum Beispiel die Gebiet in S-Chile und SWNeuseeland mit über 5000m (Einfluss der Westerlies; Staulagen der Anden und Neusseländischen Alpen) Hochgebirge: Neuseeland - fast durchwegs endemische Arten Anthropog. Einflüsse: „europäische Kulturlandschaft“ und Forstplantagen Zonobiom VI: Winterkalte Gebiete mit laubabwerfenden Wäldern = nemorales Zonobiom fast nur auf der N-Hemishäre Zonale Vegetation: sommergrüne Laubwald; 1-2 Baumschichten, Strauchschicht, (Krautschicht) (Moosschicht fehlt wegen Laubfall oder nur teilw. Ausgebildet) Mesohylle Blatt der Laubbäume: wesentlich dünner und meist größer als Hartlaubblätter, eine Anpassung an die kurze Vegetationszeit und den frostgeprägten Winter Laubabwurf: obligatorisch durch die kalte Jahreszeit (wahrscheinlich durch die Tageslänge gesteuert) (Im Gegensatz zum fakultativen Laubabwurf durch Trockenheit) Laubwald wenn mehr als 4 Monate > 10°C Mitteltemperatur Krautschicht: Jahreszeitliche Aspekte/Synusien Frühjahr: Geophyten nutzen die günstigen Lichtverhältnisse vor dem Blattaustrieb der Bäume Ökogramme Nemorale Hochgebirge: Zentral-Alpen – Subalpiner Lärchenwald; subalpin bis unteralpin – Zwergstrauchstufe, hochapiner Rasen Azonal: Fluss-Alluvionen (Auen) Anthropogene Einflüsse: Bevölkerungsdichte; die drei Laubwaldregionen der Holarktis zählen zu den Gebieten der größten Bevölkerungsdichte Zonobiom VII: Winderkalte Steppen, Halbwüsten und Wüsten Zonale Ökosysteme: Waldsteppe Wiesensteppe, Tall Grass Prairie Kurzgrassteppe, Short Grass Prairie Strauchsteppe 20/32 Halbwüste Wüste Wiesen-Steppe: kalte Winter und Dürre im Spätsommer; Frühjahr bis Frühsommer günstige Bedingungen; sehr produktiv (Schwarzerdeböden) zT Relikte der periglazialen Steppen – alte Böden: hohe Biodiversität durch zeitliche und räumliche Trennung. Zeitlich: Vorfrühlung, Vollfrühling, Frühsommer, Hochsommer Räumlich: Gräser: dichte Durchwurzelung des oberen Bodens; oft C4-Pflanzen ; Gräser gegenüber Gehölze durch Brände und Groß-Herbivoren begünstigt Kräuter:oft Pfahlwurzeln bis in tiefere Schichten Winterkalte Halbwüsten und Wüsten: Steppe/Prärie: +/- geschlossene Vegetation Halbwüsten: offene Vegetation oft verbrackte Böden (Halophyten) In Nord-Amerika und Eurasien malakophylle Halbsträucher und Zwergsträucher; es fehlen Sukkulente und meist auch sklerophylle Arten) Wüsten:deutlich kontrahierte Vegetation an Sonderstandorten Hochgebirgs Ökosysteme: bsp Rocky Mountains, Anden E-Seite, Mittel und Zentral Asien: Tibet, Himalaya N-Seite,Altai.. Anthropogene Einflüsse: Großflächiges Ackerland vor allem Getreide auf Schwarzerde Böden. In ariden Gebieten mit Bewässerung; Weideland mit nomadischen Kulturen Zonobiom VIII: Winterkalte und Nadelwaldgebiete = boreales Zonobiom (Taiga) Klima: sehr kalte Winter, Temperatur-minima durchwegs unter -40 °C (Extremwerte -66°C, -68°C in Ostsibirien) rel. Warme Sommer Niederschlag 250, 500, (700)mm – Maximum im Sommer Zonale Ökosysteme: rel einheitliches Zonobiom Koniferen Wälder (durch kurze Vegetationszeit 3-6 Monate) dicke Rohhumus-Auflagen – Nadelstreu schwer zersetzbar und geringe Zersetzungsraten bei tiefen Temperaturen; relativ artenarm Unterwuchs: keine saisonale, synusiale Abfolge wegen steter Beschattung und kurzer Vegetationszeit Zwergstrauchschicht Kryptogamen-Schicht: Moose, Flechten, Pilze (Mykorrhiza) Azonal: Großflächige Vermoorungen (West-Sibirien – Ob-Tiefland, das größte Moorgebiet der Erde 800 000 km² Hochgebirge: nördlichster Ural, Waldgrenze 250m Zonobiom IX: Tundren und polare Wüsten = polares Zonobiom Klima und Lebensraum 21/32 sehr kalt dunkle Winter, kühle bis kalte aber immer helle Sommer Niederschlag gering: 100-300 mm Vegetation: Zwergstrauchtundra, Seggen- und Moostundra, Flechtentundra, polare Kältewüsten Moore noch in der südlichen Tundra, weiter nördlich zu geringe Biomasseproduktion für Moorbildung kein Sphagnum gesamte Arktische Flora: 1500 Blütenpflanzen, 750 Blütenpflanzen, 750 Bryophyten, 1200 Flechtenarten Tundra: Julimittel <10°C Antarktis: fast durchwegs vergletschert, mittlere Eisdicke 2,5 km, tiefste Temperaturen: -89,4 °C Arktische Kältewüsten Julimittel <2°C; >4 Monate durchgehend hell > 4 Monate durchgehend dunkel FJL: großteils vergletschert, Frostmuster-Böden Fauna: Küstenseeschwalbe, Elfenbei-Möwe, Eisbär, Polar-Fuchs, Krabbentaucher Anthropogene Einflüsse: Klimaerwärmung in den Polar-Regionen Rückkoppelungseffekte Arktis: Weltweit stärkste Erwärmung Großlebensräume (= ZONOBIOME) der Erde Ökosphäre Festlandanteil (ca. 29% der Erdoberflä che; bis 6000m Hö he in nivaler Stufe der hö chsten Berggipfel) inklusive Seen und Flü sse Mariner Anteil (ca. 71%); tiefer als 10.000 m im Meer/ Ökologischen Einheiten, mit denen sich die Landoberflä che bzw. die Meere sinnvoll gliedern und beschreiben lassen: nur durch Kombination abiotischer und biotischer Kriterien mö glich. Orientierung aus ökologischer Sicht: Vorhandensein bzw. die Dominanz bestimmter Lebensformen Bedingungen die Grenzen setzen: Wald: mindestens 400 mm Jahresniederschlag und mehr als vier Monate Vegetationszeit Sukkulenten-Halbwü sten: mehr als 100 mm Niederschlag und fehlende Frö ste Tiefsee: absolute Finsternis und hoher Wasserdruck. ist Durch die Verschiedenartigkeit der Land-, Sü ßwasser-und Meereslebensrä ume aber eine durchgehende Großgliederung nicht mö glich. Fließgewässer und Seen sind mit dem jeweiligen Klima und den umgebenden terrestrischen Lebensräumen verbunden. Eine strenge Parallelisierung mit den Landlebensräumen, etwa im Sinne eines „Zonobiom 6-Gewässers“ oder eines „typischen Savannengewässers“ ist nicht möglich. LimnischeLebensräume des Festlandes Lebensgemeinschaften im Wasser sind von dessen physikalischen und chemischen Eigenschaften abhä ngig und diese bestimmen primä r die Lebensbedingungen. Oft steht ein Faktor im Vordergrund, der von den Lebewesen eine bestimmte Spezialisierung verlangt (z.B. Nä hrstoffmangel, Sauerstoffmangel, Strö mung, Eisbildung, hoher 22/32 Salzgehalt etc.). Lebensformen des freien Wassers: Plankton, Nekton Lebensformen des Gewässergrundes: sedentä r (d.h. festsitzend, auch Tiere). Die vagilen Rä uber und Weidegä nger bewegen sich aufgrund des hohen Widerstandes langsam. Bäche/Flüsse Flusskoninuumkonzept: Lebensformen im Fließgewässer: Zerkleinerer im Oberlauf, Weidegänger im Mittellauf, Filtrierer im Unterlauf Fliessgewässertypen Rhithralflüsse(Salmonidengewässer) Hohe Fließgeschwindigkeit, niedere Temperaturen, geringe Temperaturschwankungen, hoher Sauerstoffgehalt; Abflußschwankungen in enger Beziehung zum Niederschlagsregime und der Niederschlagsmenge im Einzugsgebiet (z.B. Frü hsommerhochwasser schneereicher Hochgebirge; Frü hlingshochwasser schneereicher Mittelgebirge; Monsunhochwä sser): hochangepaßte strö mungstolerante Lebensgemeinschaften und Lebensformen sind typisch; Lebewelt am Gewä sserboden: Kö rper, Haft-und Saugapparate, schwere Gehä use; Lü ckensystem am Gewä sserboden Lebensraum fü r strö mungsintolerante Arten. Potamalflüsse(Cyprinidengewässer) Wassertemperaturen stä rker von Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung mitbestimmt; Sauerstoffgehalt variiert stä rker, geringere Konzentrationen; Strö mung gering, speziell nahe dem Gewä ssergrund; eurytherme Arten, die auch mit geringen Sauerstoffmengen auskommen kö nnen; oft die selben, die auch in stehenden Gewä ssern gefunden werden; Fischen dominieren Sommerlaicher. Seetypen Kalte Seen: Polargebiete; in der Tiefe am wä rmsten; im Winter eisbedeckt; meist vollstä ndig durchmischt, d.h. einmal im Jahr -kalt-monomiktisch. Warme Seen:Tropen und Subtropen; tiefe Wasserschichten kü hler als das Oberflä chenwasser Temperate Seen: 1) Regenzeitengebiete -Wasser mischt sich durch Dichteunterschiede 1x im Jahr, warm-monomiktisch; 2) Mittelmeer/warmtemperate Gebiete –durch Temperaturwechsel warm-monomiktisch; 3) Laubwaldzone -Wechsel im Herbst vom warmen zum kalten See und im Frü hjahr zurü ck (bimiktisch) Salzseen (Kochsalzseen, Sodaseen, Natronseen) Braunwasserseen( humide Zonobiome mit Moorbildung ); sehr nä hrstoffarm, durch eingeschwemmten Humus-Detritus sauer und reich an gelö sten Huminstoffen Eutrophe Seen –nä hrstoffreiche Seen mit meist flachem Becken und breiter Uferbank, reichlichem Phyto-und Zooplankton und gut ausgebildeter Ufervegetation; keine zonale Bindung Oligotrophe Seen –nä hrstoffarme Seen mit tiefem Becken und schmaler Uferbank, geringer Planktonentwicklung und damit klarem Wasser; keine zonale Bindung All diese klimazonalen oder vom Wasserchemismus her definierten Seentypen unterscheiden sich hinsichtlich prinzipieller Lebensformen (Plankter, Nektonorganismen) 23/32 praktisch nicht. Konvergenz wird durch den alles dominierenden Faktor Wasserdichte bzw. durch die hohe Viskositä t des Wassers bestimmt. Aber.................. Hohe Artendiversitä t durch Inselcharakter, lange Isolation und Ausbildung vieler endemischer Arten. Ö̈kozonale Gliederung des Meeres Polarmeere: ganzjä hrig bzw. im Winter von Eis bedeckt; Wasser relativ nä hrstoffreich, daher hohe Planktondichte und Wasser grü nlich; Wassertemperatur gering, ebenso der Salzgehalt; Temperate Meere: sü dlich bzw. nö rdlich derwinterlichen Packeisgrenze; bis in den Bereich der Subtropen; abwechslungsreiche Strö mungsregime = Mischwasserzone der mittleren Breiten; Tropische Meere: warm (>20 °C Wassertemperatur), besitzen einen hohen Salzgehalt, durch Nä hrstoffarmut geringe Produktion; Wasser klar und blau („Blaue Wü sten“). Barrierewirkung der Festländer, Strahlströ me (z.B. Golfstrom) sowie Isolierung der großen Nebenmeere bedingen große Unterschiede in Flora und Fauna; Lebensformen prinzipiell ä hnlich. Großlebensräume des Meeres Pelagial-und Benthal-Gemeinschaften der Seen und des Meeres in ihrer Lebensformenstruktur ä hnlich. Salzgehalt des Meeres: physiologische Anpassungen und nicht morphologisch-strukturelle Dichte und Viskositä t des Wassers sind daher auch fü r die Mobilitä t der Meeresbewohnern entscheidende Faktoren Die Teillebensrä ume des Meeres Pelagial des Meeres Schelfbereich(=neritische Provinz): Licht dringt bis zum Meeresgrund Offener Ozean ü ber dem Kontinentalabhang und den Tiefseebö den (=ozeanische Provinz): durchschnittliche Tiefe von 4000 m, reicht aber in den Tiefseegrä ben noch bis in Tiefen unter 10.000 m hinab; in Tiefe nimmt die Komplexitä t und Vielfalt der Lebensgemeinschaften ab, aber noch die grö ßten Tiefen belebt. Benthal des Meeres gewaltige Dimensionen, besonders jene der aphotischen Zone; Komplexe Strukturen im Kü stenbereich, bedingt durch Wellenschlag und Gezeiten; Supra-, Eu-und Sublitoral kö nnen je nach Kü stenform, Sedimentbeschaffenheit (Felskü ste, Sandkü ste), Nä hrstoffgehalt und Temperaturschwankungen des Wassers sehr verschieden sein; Benthal der aphotischen Zone einheitlicher; heiße Gasaustritte (hot vents) im Bereich der Berü hrungsnä hte der Kontinentalplatten mit Lebensgemeinschaften sehr eigenwilliger Art. 5. Landschaften und Großlebensräume 24/32 Landschaftsökologie Definition Landschaft: Naturwissenschaftl. Definition: Heterogene Landflä che (Landausschnitt), die aus einer Gruppierung von interagierendenÖ kosystemen besteht, welche auch ü ber weite Flä chen hin (von gleicher Umweltqualitä t) sich wiederholt; solcherart definierte Landschaften besitzen eine Ausdehnung von wenigen bis mehreren Quadratkilometern Geisteswissenschaftlich-ästethischeSichtweise: Landschaft als „Bild im Kopf“ lä sst angenehme oder unangenehme Empfindungen entstehen, die tief im Erlebnis-und Bildungshintergrund des Betrachters verankert sind. Wertungen schließen sich hier automatisch an bzw. sind der Filter, durch den Landschaft erlebt wird. Diese Wertungen verä ndern sich mit der Zeit, sind Zeitströ mungen ausgesetzt. Landschaft „als Habitat“des Menschen. Landschaftselemente Korridore (=corridors) Matrix (= matrix) punktfö rmige Elemente (= Inselelemente, patches). Inselartige Elemente (patches) 1. Störungsbedingte Inselelemente(disturbancepatches) entstehen durch menschenbedingte oder natü rliche Stö rungen, z.B. durch einen Hangrutsch, einen Brand, eine punktuelle Rodung. 2. „Überbleibsel, Restlinge“(remnantpatches) sind meist Reste ehemaliger, historischer Matrix-Elemente, z.B. Trockenrasenreste ehemaliger Hutweidelandschaften, alte Kirche zwischen Hochhä usern als Rest eines alten Stadtviertels. 3. ResourcenbedingteInselelemente(ressourcepatches) sind durch Abweichungen vom „Normalen“bedingt (zu feucht, zu trocken; sehr nä hrstoffreich, extrem nä hrstoffarm etc.); z.B. Quellfluren, kleine Moore, Felskö pfe, Lä gerfluren, Schuttplä tze. 4. Nutzinseln(introducedpatches) sind durch menschliche Nutzung entstanden und werden als solche erhalten; z.B. Pflanzungen, Sonderkulturen, Waldwiesen, kleine Parks. 5. Häuser, Gehöfte, Behausungen(introducedpatches) sind vor allem in Kulturlandschaften charakteristische Elemente. In Stä dten bilden sie die Matrix. Inselstrukturen erhö hen generell die Diversitä tvon Landschaften; entstehen bzw. verschwinden rascher als andere Elemente und prä gen daher den Wandel im Erscheinungsbild in besonderem Maße (Randeffekte). Korridore Linienkorridore (linecorridors) Bandkorridoren (stripcorridors) Korridore kö nnen vernetzen oder trennen; auch eigenstä ndige Lebensraumfunktion. Landschaftsmatrix(matrix) Hauptelement, in das Inseln und Korridore eingebettet sind. Kriterien, die die Matrix bestimmen: 1. Die Matrix nimmt mehr Fla che ein als die anderen Elemente, nimmt also relativ die grö ßte Flä che ein. 2. Die Matrix ist in sich verbunden; die sogenannte Konnektivitä tist hoch, wenngleich sehr unterschiedliche Grade von Konnektivitä t mö glich sind. 3. Die Dynamik der Landschaft als Einheit wird von der Matrix bestimmt. 25/32 Landschaftsmatritzes sind unterschiedlich porös: Dichte der anderen Elemente (Inseln, Korridore) ist unterschiedlich hoch. Matritzessind aber auch in sich selbst heterogen-Kö rnung. Gesamtbild der Landschaft wesentlich dadurch bestimmt, in welcher Dichte und Anordnung die kleineren Landschaftselemente angeordnet sind Ökologische Landschaftstypisierung Biotische und abiotische Attribute Ökologische Raumerkundung Induktive Karten(analytische) leiten die Einheiten, seien diese nun einzelne Typen oder Komplexe, direkt aus dem Studium der Vegetation in einem Gebiet bzw. aus faunistischenoder floristischen Aufnahmen ab. Deduktive(synthetische) Kartenformulieren die Einheiten auf Basis von Standortsmerkmalen, die einen Bezug zur Vegetation bzw. zur Habitatseignung für Tiere oder Pflanzenarten besitzen; Kartierung vom Schreibtisch aus. Räumlich expliziete Modelle Gradienten menschlichen Kultureinflusses auf Landschaften Konzept der Hemerobie Definition:Kulturabhä ngigkeit von Ö kosystemen; reziprok dazu Konzept der Natü rlichkeit Benutzt werden definierte Hemerobiestufen: ahemerob, oligohemerob, mesohemerob, euhemerob, polyhemerob, metahemerob Beurteilungskriterien: Naturnä he der Baumartenzusammensetzung Auftreten von Hemerochoren Verä nderung des Bodenprofils Anwendung von Agrochemikalien Ausmaß versiegelter Flä che usw. Beispiele für Hemerobiestufen(Natü rlichkeitsgrade): Ahemerob(natü rlich, ursprü nglich): Gebirgswä lder, Eis-und Felsregionen, alpine Ö kosysteme Oligohemerob(naturnah): Wä lder mit natü rlichem Artenbestand, Almen ü ber der Waldgrenze, Auen, Gewä sser Mesohemerob (halbnatü rlich): Extensive Wiesen, Weiden; Wä lder mit verä ndertem Baumbestand, Naturgä rten Euhemerob(stark verä ndert): Traditionelles Ackerland, Weinberge, Forste, Stauseen, regulierte Flü sse, Schipisten, Schrebergä rten Polyhemerob(kü nstlich): Modernes Grü nland, Ackerland, Forste mit „Exoten“, Parks Metahemerob(kü nstlich-naturfern): Siedlungen, Parkplä tze, Fabriks-, Hafenanlagen etc. Veränderungen der Strukturmerkmale von Landschaften entlang eines Gradienten von geringer zu hoher Hemerobie(= von hoher zu geringer Natürlichkeit): 1. Stö rungsbestimmte Inselelemente nehmen zuerst zu, dann stark ab, historisch bedingte Elemente nehmen zu, schließlich stark ab, ressourcenbedingte Inseln kontinuierlich ab, Nutzinseln stark und kontinuierlich zu. 2. Die Form von Inselelementen wird einheitlicher, die Dichte nimmtexponentiell zu. 3. Linienkorridore werden kontinuierlich und exponentiell hä ufiger, Bandkorridore zuerst ebenfalls, bei hohen Hemerobiegraden nehmen sie wieder ab. 4. Netzartige Strukturen (oft mit trennender Wirkung) nehmen zu, ebenso Siedlungselemente. Diese sind in die Landschaftsstrukturen zunehmend, spä ter 26/32 abnehmend, integriert. 1. Die Konnektivitä t der Matrix nimmt ab. HochaggregierteLandschaftstypen (Österreichs, Europa) Geographisch bestimmte Regionen:z.B. Landschaft der Niederen Tauern, des Bö hmerwaldes, des Weinviertels, Mü hlviertels, der Koralpe(Nachteil: Regional typisierte Landschaften sind Unikate.) der Landschaftsökologische Typen: Beispiel fü r Ö sterreich: 1. Fels-und Gletscherlandschaften der Hochalpen 2. Vegetationsgeprä gte, naturnahe-natü rlichealpine Landschaften (alpin = ü ber Waldgrenze) 3. Bandartige Bergwaldlandschaften 4. Flä chige, teils inselartige Bergwaldlandschaften 5. Almlandschaften (rodungsinselgepra gte Bergwaldlandschaften) 6. Inneralpine Wiesen-und Weidekorridore der Tä ler 7. Korridorartige außeralpine Wiesen-und Weidelandschaften 8. Mosaikartige Kulturlandschaften der Mittelgebirge und Voralpen mit gemischten Nutzungsformen 9. Matrixbetonte Ackerlandschaften des Tieflandes 10. Weinbaulandschaften 11. Weinbaulandschaften mit Obstbau 12. Urbane und Industrielandschaften Landbedeckungsklassen (land coverclassification):Versuch Landschaftstypen großrä umig darzustellen Beispiele: CORINE-landcovermap; PELCOM-map Funktionale Aspekte Landschaften bilden vernetztes funktionales Gefü ge; Energie-und Nä hrstoffflü sse verknü pfen die einzelnen Elemente; grundsä tzlich zu unterscheiden: Diffusion:Bewegung gelö ster oder suspendierter Materialien von einem Ort hoher Konzentration zu einem Ort geringer Konzentration (z.B. Verteilung von Duftstoffen, Spritzmitteln, Gentransfer) Massenfluss: Stoffflü sse setzen Energiegradienten voraus, die ungleich in der Landschaft verteilt sind (z.B. Windtransport von Samen, Bodenerosion an Hä ngen, Oberflä chenabfluss, Grundwasserfluss) Lokomotion: Bewegung eines Objekts von einem Ort zum andern unter Verbrauch von Energie. Die einzelnen Elemente sind keine geschlossenen Systeme, und Vektoren wie Wasser, Wind, Tiere vernetzen diese zu einer zwar heterogenen, aber in sich dynamischen funktionalen Einheit. Vektoren (Wind, Verbreitung von Diasporen, Krankheiten durch Tiere, Mensch)Einzelne Elemente beeinflussen Richtung und Wirksamkeit der Vektoren (z.B. Windwirkung an Hecken, Schneebö den, Nebelkä mmer). Landschaftswandel sehr rascher(katastrophaler) Wandel (z.B. durch Erdbeben, Vulkanausbrü che); langsamer, kaum wahrnehmbarer Wandel z.B. isostatische Landhebung, klimawandelbedingteVegetationsverä nderungen. Landschaftsverändernde Prozesse: 27/32 1. geomorphologische Prozesse wie Erosion durch Wind, Wasser, thermische Erosion, Landhebung, Sedimentation etc., 2. Klimaä nderungen, 3. Auftreten neuer Pflanzen-und Tierformen bzw. deren Verschwinden, 4. Bodenbildung, 5. Auftreten mehr oder weniger regelmä ßiger Stö rungen (Disturbationen) wie Feuer, Lawinen, Stü rme, Ü berflutungen 6. Aktuelle Umweltproblematik Global change–Globaler Wandel Landnutzungswandel (land usechange) Klimawandel Stickstoffdeposition(Eutrophierung) Biologischer Austausch (Exoten, Neobiota) athmosphä rischesCO2 Reaktion von Ökosystemen und Landschaften: Resilienz (Verä nderung reversible) Resistenz (keine Verä nderung) Sukzession (Verä nderung irreversibel, allenfalls langfristig reversibel) pro -Aussterberate ca. 1000-fach hö her als natü rliche AR (= 1 von 1.000.000Arten Jahr -Waldverlust 1990-2000: 94.000.000ha= > 10x Ö sterreich EU-Situation: -42% Sä ugetiere gefä hrdet (global) -43% Vö gel in einem ungü nstigenErhaltungszustand -kommerzielle Fischarten „outsidesafebiologicallimits“ -12% Schmetterlinge decliningseriousely -600 Pflanzenarten von Ausrottung bedroht Ökologischer Fußabdruck Europas: 3ha/Einwohner; Summe x2 der Gesamtfläche Land use change Hoch-, Übergangs- und Niedermoore >3,5 % Abnahme zw 1990 und 2000 Heiden und Gebüschformationen >1,5 % Abnahme Küsten- und Binnendünen: Meeresdünen am Antlantik, >1% Abnahme Mediterrane Hartlaubgebüsche, Thermomediterrane Sukkulentenflur, Tenerife, Abnahme >1% Abnahme Felshabitate und Höhlen (Felswände und -hänge) Diffuse Wirkung auf Habitate und Populationen Moderne Agrarlandschaft, Weinviertel <0,5 % Abnahme Feuchtwiesen mit Schwertlilien; <0,5% Abnahme Marine und halophytische Lebensräume: in etwa gleichbleibend Es gibt verschiedene forstliche Bewirtschaftungsformen der Wälder in Mitteleuropa Kahlschlag Schirmschlag Saumschlag Femelschlag Plenterung 28/32 Klimawandel Klima def.: Durchschnittliches Wettergeschehen einer Lokalitä t, einer Region oder der Erde als Ganzes Natü rliche Ä nderungen: Kurzfristige Ä nderungen: unbedeutend Mittelfristig Klimaschwankungen durch massive Vulkanausbrü che, El Niño Phä nomenetc. mö glich. Langfristige Klimaschwankungen: durch zyklische Verä nderung der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, Ä nderung des Neigungswinkels der Erdachse, Ä nderungen in der Energieabgabe der Sonne durch Sonnenfleckenaktivitä t (11 Jahreszyklen); Energiebilanz der Erde und ihrer Atmosphä re entscheidet ü ber Klimaentwicklung. Historische und aktuelle Klimaentwicklung Eiszeiten seit Frü hzeit der Erde (z.B. Karbon/ Permvor 300 Millionen Jahren) Stabile Phase mit warm-tropischem Klima bis in hohe Breiten folgend (200 bis 70 Millionen Jahren vor heute) Tertiä r phasenweise Verä nderung zu kä lteren und teils trockeneren Klimaten Instabile Klimaphase in den letzten 2 Millionen Jahren (vier große Kä ltephasen mit Vereisung riesiger Landmassen in hö heren Breiten und Hochgebirgen, kü hleren Regenzeiten in den Subtropen (z.B. war die Sahara „grü n“) und Trockenzeiten in manchen Tropenregionen (besonders ausgeprä gt im ä quatorialen Afrika); Temperatur um 8 °C geringer als heute. • Postglaziale Wä rmezeit (zwischen 8000 und 6000); Grund: Erdachse um einige zehntel Grad stä rker geneigt als heute; Perihel, der sonnennä chste Punkt der Erdumlaufbahn um die Sonne lag im September und nicht so wie heute im Jä nner; Nordhalbkugel erhielt dadurch im Sommer mehr und im Winter weniger Energie als heute. • Letzte 1000 Jahre: bis Mitte des 19. Jahrhunderts genereller Trend zu tieferen Temperaturen; Kleine Eiszeit.• • Seit Mitte des 19. Jahrhunderts Zunahme der Durchschnittstemperaturen; vor allem Nä chte wä rmer; • Nordhemisphä rischer Niederschlag (inkl. Schnee) hat um ca. 0,5-1 % pro Dekade abgenommen. Auswirkungen des Klimawandels ca. 40%. Meeresspiegel in letzten 100 Jahren um 0,1 –0,2 m aufgrund der erwä rmungsbedingten Expansion des Meerwassers angestiegen; Seen und Flü sse ca. zwei Wochen weniger lang vereist;Meereisverlor um den Nordpol 10-15% der Flä che im Frü hjahr und Sommer. Seine Dicke verringerte sich um Rü ckgang der Gletscher in den Tropen und mittleren Breiten: in den Alpen verloren die Gletscher zwischen 1850 und 1994 ca. 35% ihrer Flä che und ca. 50% ihres Volumens Erwä rmung der Frostbö den in den Alpen Beobachteter Klimawandel ist ö kologisch relevant: Hö herwandern der Gebirgspflanzen • Fülleffekt wesentlich • Prognosen zur Vegetationsverä nderung: fü r das 2xCO2- Szenario -vor allem im 29/32 Norden und den mitteleren Breiten –zumindest potentiell-signifikante Vegetationsverä nderungen; stabiler die Tropen, aber auch manche Regionen Mitteleuropas • Ausrottungssyndrom wahrscheinlich (z.B. Sierra Nevada in Spanien, im Sü dural, den Bergen Kretas und Sü dgriechenlands sowie Teilen der Alpen); • Tiere mobil: Fü r 58 europä ische und amerikanische Schmetterlinge wurde nachgewiesen, daß diese im letzten Jahrhundert ihr Areal um 35-200km nach Norden verlagerten, was in der Grö ßenordnung der latitudinalen Klimaerwä rmung entsprach • Korallenbleiche: bei der prognostizierten Hä ufung von El Nino-Jahren und Steigerung dessen Intensitä t ist mit einer empfindlichen Stö rung der Korallenriffe und ihrer Lebewelt zu rechnen Gewinner und Verlierer : wie Taiga wird „ackerfä hig“ Anstieg des Meeresspiegels bedroht Malediven, viele pazifische Inseln, Kü stenlä nder Bangladesh und Holland oder Kü stenstä dte wie Bankokund Dakka. Alpen verlieren Schneesicherheit unter 15oom; Schibetrieb wird unprofitabel. Einfluß auf die Verbreitung von Neobionten Laurophyllisierungin den wintermilden Lagen um die Alpen Potential des Neophytenpoolsin Gä rten, Wildkrautfluren Krankheitserreger: Malaria und Dengue-Fieberzu nennen Kaskadeneffekte –Beispiel Sahara Beispiele: Asiatischer Laubholzbockkä fer (Anoplophoraglabripennis) => Neozoa • Ausgangslage – in den 1980ern: Einschleppung ü ber Verpackungsmaterial nach New York– Larven entwickeln sich in lebenden Laubbä umendiverser Gattungen ( Acerspp., auch Fagus, Betulaetc – rasche Ausbreitung in den ö stlichen USA, massive ö konomische und ö kologische Schä den durch Absterben der befallenen Bä ume • Ö sterreich: – Erstnachweis fü r Mitteleuropa 2001 in Braunau – rasche Bekä mpfung durch BfW(Fä llen und Verbrennen der befallenen Bä ume, Monitoring)– Kosten bisher (2001-05): >80.000 € • Bekä mpfung: – mehrfach Einschleppung in A (Braunau) und BRD– Information der Ö ffentlichkeit ü ber Medien Meldung von Funden – Braunau: Rodung und Verbrennung der befallenen Ahorn-Bä ume– mehrjä hrige Kontrolle (Ausbohrlö cher) • Vorsorge: – internationales Ü bereinkommen wurde beschlossen und national implementiert • Kontrollen von Verpackungsmaterial aus Holz und internationale Verpflichtung zu Behandlung von Holz (Entrindung, Hitze-oder Methylbromidbehandlung, Kennzeichnungspflicht) Klimawandel: Fallstudie Ambrosie(Ambrosia artemisiifolia) • annuellerKorbblü ter, Heimat: N-Amerika• 19. Jhdt. unabsichtliche Einschleppung, seit Mitte 20. Jhdt. in S-Europaeingebü rgert• in Ö sterreich: deutliche Ausbreitung seit etwa 1950 (v.a. im Osten)• Ruderal-und Segetalstandorte tiefer Lagen • Auswirkungen: stark allergenePollen („2. Heuschnupfen-Saison im Frü hherbst“) 30/32 volkswirtschaftliche Kosten BRD: ca. 32 mio€• Behandlungskosten • Krankenstand / Produktivitä tskosten• zukü nftig: landwirtschaftliche Probleme • Fragestellung: rä umlich-zeitlicher Verlauf der Ausbreitung in Ö sterreich? Modellierung des potenziellen Areals unter verschiedenen Klimawandelszenarien? Ableitung von Handlungsempfehlungen Asiatischer Marienkäfer: in W-Europa mittlerweile häufig, verdrängt heimische Blattlausfresser da größer als andere Marienkäfer Der Treibhauseffekt Treibhausgase (CO2, CH4, N2O, O3, FCKW); natürliche Ursachen (Variabilität der Sonneneinstrahlung, vulkanische Aktivitäten ect.) erklären beobachtete Erwärmung nicht. Sie sind allerdings modulativin Erscheinung getreten. Treibhauseffekt natü rliches Phä nomen 1) 45% der Sonnenstrahlung an Erdoberflä che absorbiert und in langwellige Strahlung umgewandelt; 2) Atmosphä rische Gegenstrahlung - Atmosphä re wirkt als Strahlungsfalle; 3) Absorbtionund Gegenstrahlung bestimmt durch Dipolgase: Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan; • Ohne Treibhauseffekt Durchschnittstemperatur der bodennahen Luftschichten bei –18 °C und nicht wie jetzt bei ca. + 15 °C; • Verstä rkung durch Verbrennung durch Verlagerung natü rlicher Kohlenstoffdepots in die Athmosphä redurch Nutzung fosslierBrennstoffe, Abholzung, Humusverlust etc. • Zunahme CO2 von 280ppm auf 360ppm/ je nach Prognose Erwä rmung von 1,4 –5,8 °C bis Ende 21. Jhdt. • Aerosole –natü rliche: Meersalz, Staub-und Ascheemissionen von Vulkanen und von natü rlichen Brä nden etc., welche sulfatische und karbonatische Aerosole produzieren. • Aerosole –anthropogene: sulfatische Aerosole, Aerosole aus Biomasse, schwarze und organische Aerosole aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. • Abkü hlungswirkung zu gering. Perspektiven der Berglandwirtschaft • Traditionelle Landwirtschaft bereicherte die alpine Landschaft mit anthropogenen Elementen, nicht aber die Biodiversitä tper se; • Moderne Berglandwirtschaft ist aus den Fugen geraten: entweder wird mittels Hochtechnologie und Zü chtung auf Produktionssteigerung gesetzt oder experimentelles Biofarmingbetrieben; • Es existieren keine klaren Vorstellungen wie die traditionelle „biodiversitä ts-freundliche Landwirtschaft“in eine neue Form gebracht werd kann; derzeit divergierende Entwicklungen. • Traditionelle Landwirtschaft bereicherte die alpine Landschaft mit anthropogenen Elementen, nicht aber die Biodiversitä t per se; • Moderne Berglandwirtschaft ist aus den Fugen geraten: entweder wird mittels Hochtechnologie und Zü chtung auf Produktionssteigerung gesetzt oder experimentelles Biofarmingbetrieben; • Es existieren keine klaren Vorstellungen wie die traditionelle „biodiversitä ts-freundliche Landwirtschaft“in eine neue Form gebracht werden kann; derzeit divergierende Entwicklungen. 31/32 Besiedlung und Tourismus Bevölkerungsveränderung in den Gemeinden Dichteunabhängiges Wachstum Wachstum der Population = Geburten –Sterbefä lle N(t+1) –N(t) = gN(t) –sN(t) = (g –s)N(t) = RN(t) g= Geburtenrate/Individuum (z.B. 2) s= Sterbewahrscheinlichkeit des Individuum (z.B. 0,5) R= Netto-Wachstumsrate (diskretes Wachstum) r= IntrisischeWachstumsrate (kontinuierliches Wachstum) N(t+1) = N(t) + RN(t) = (1+R)Nt N(1) = (1+R)N(0) = λN(0) N(2) = λN(1) = λλN(0) = λ2N(0) usw N(t) = λ tN(0) = (1+R)tN(0) Konsequenzen dieser Beziehung: Fü r R>0 wä chst Populationsgrö ße unaufhaltsam und ohne Grenzen Fü r R=0 bleibt Populationsgrö ße konstant Fü r R<0 verringert sich Populationsgrö ße unaufhaltsam Wachstum dieser Form = exponentielles Wachstum Dichteabhängiges Wachstum Grundannahme: Netto-Wachstumsrate verä ndert sich mit zunehmender Dichte. Erreicht Rden Wert 0 wird die sogenannte Kapazitä tsgrenze Kerreicht, die durch das RessourcenAngebot bestimmt ist. Die maximale Wachstumsrate Rm ist nur im frü hen Stadium der Populationsentwicklung realisiert. Das dichteabhä ngige Populationswachstum ergibt sich somit als: N(t+1) –N(t) = (Rm–RmN(t)/K)N(t) Konsequenz: Population steigt nicht mehr ungebremst an. Wachstum zeigt s- fö rmigen Verlauf = logistisches Populationswachstum Achtung! Geburtenraten und Sterberaten sind altersabhängig! Populationswachstum daher auch von Altersstruktur maßgeblich beeinflußt. Komplexe Zusammenhänge: dargestellt als “Lebenstafeln”. 32/32