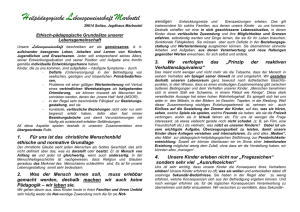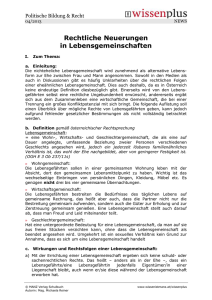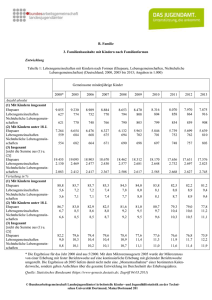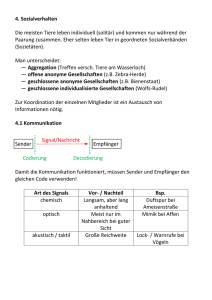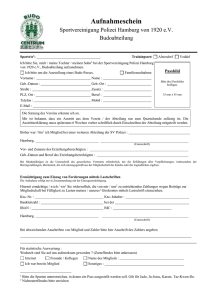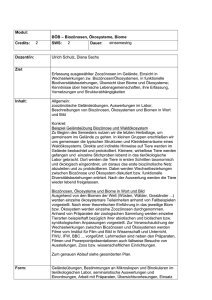53. Ökologie der Biozönosen 48 im deutschen Buch
Werbung
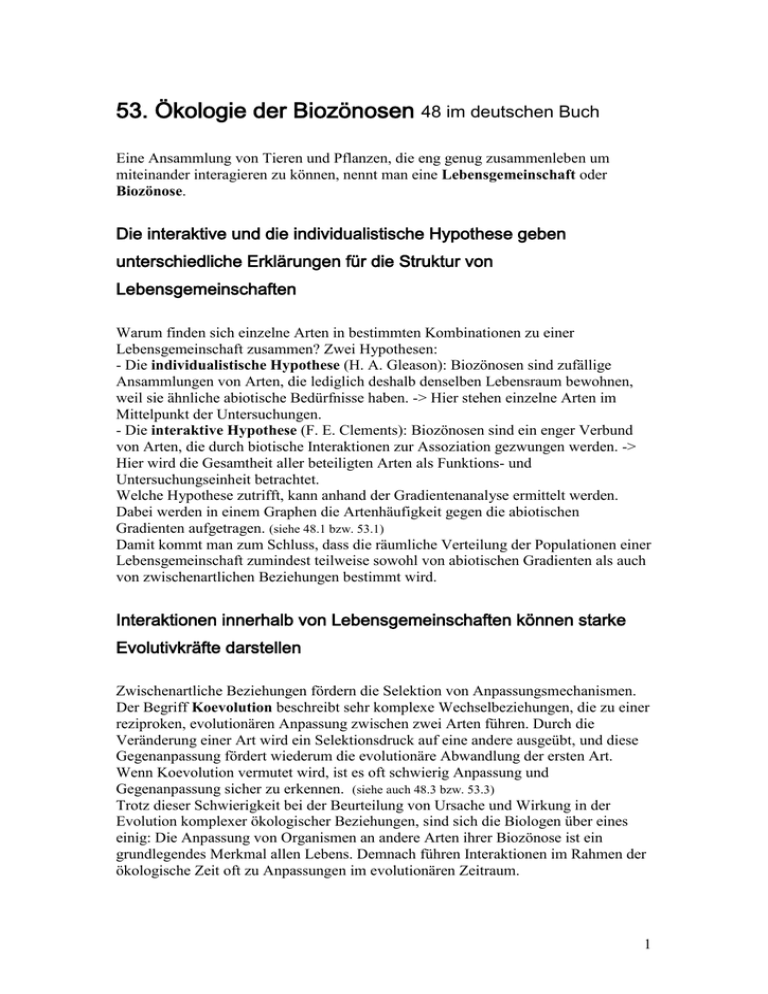
53. Ökologie der Biozönosen 48 im deutschen Buch Eine Ansammlung von Tieren und Pflanzen, die eng genug zusammenleben um miteinander interagieren zu können, nennt man eine Lebensgemeinschaft oder Biozönose. Die interaktive und die individualistische Hypothese geben unterschiedliche Erklärungen für die Struktur von Lebensgemeinschaften Warum finden sich einzelne Arten in bestimmten Kombinationen zu einer Lebensgemeinschaft zusammen? Zwei Hypothesen: - Die individualistische Hypothese (H. A. Gleason): Biozönosen sind zufällige Ansammlungen von Arten, die lediglich deshalb denselben Lebensraum bewohnen, weil sie ähnliche abiotische Bedürfnisse haben. -> Hier stehen einzelne Arten im Mittelpunkt der Untersuchungen. - Die interaktive Hypothese (F. E. Clements): Biozönosen sind ein enger Verbund von Arten, die durch biotische Interaktionen zur Assoziation gezwungen werden. -> Hier wird die Gesamtheit aller beteiligten Arten als Funktions- und Untersuchungseinheit betrachtet. Welche Hypothese zutrifft, kann anhand der Gradientenanalyse ermittelt werden. Dabei werden in einem Graphen die Artenhäufigkeit gegen die abiotischen Gradienten aufgetragen. (siehe 48.1 bzw. 53.1) Damit kommt man zum Schluss, dass die räumliche Verteilung der Populationen einer Lebensgemeinschaft zumindest teilweise sowohl von abiotischen Gradienten als auch von zwischenartlichen Beziehungen bestimmt wird. Interaktionen innerhalb von Lebensgemeinschaften können starke Evolutivkräfte darstellen Zwischenartliche Beziehungen fördern die Selektion von Anpassungsmechanismen. Der Begriff Koevolution beschreibt sehr komplexe Wechselbeziehungen, die zu einer reziproken, evolutionären Anpassung zwischen zwei Arten führen. Durch die Veränderung einer Art wird ein Selektionsdruck auf eine andere ausgeübt, und diese Gegenanpassung fördert wiederum die evolutionäre Abwandlung der ersten Art. Wenn Koevolution vermutet wird, ist es oft schwierig Anpassung und Gegenanpassung sicher zu erkennen. (siehe auch 48.3 bzw. 53.3) Trotz dieser Schwierigkeit bei der Beurteilung von Ursache und Wirkung in der Evolution komplexer ökologischer Beziehungen, sind sich die Biologen über eines einig: Die Anpassung von Organismen an andere Arten ihrer Biozönose ist ein grundlegendes Merkmal allen Lebens. Demnach führen Interaktionen im Rahmen der ökologische Zeit oft zu Anpassungen im evolutionären Zeitraum. 1 Interspezifische Wechselbeziehungen können sich positiv, negativ oder neutral auf die Populationsdichte auswirken Interspezifische Wechselbeziehungen treten zwischen unterschiedlichen Arten innerhalb einer Lebensgemeinschaft auf. Diese Interaktionen können positie, negative oder neutrale Effekte auf eine oder mehrere der beteiligten Populationen haben. Die möglichen Beziehungen zwischen zwei beliebigen Arten einer Biozönose sind in Tabelle 48.1 bzw. 53.2 zusammengefasst. Prädation und Parasitismus sind (+-)-Interaktionen Prädation Prädation ist eine sehr leicht erkennbare (+-)-Interaktion, bei der ein Räuber seine Beute frisst. Meist sind die für den Beuteerwerb wichtigen räuberischen Strategien für uns leicht erkennbar und vertraut. Die meisten Prädatoren haben scharfe Sinne und besitzen Anpassungen wie Krallen, Zähne, Stacheln oder Gift, die beim Fangen und überwältigen oder beim Kauen der Beute hilfreich sind. Räuber, die ihre Beute erjagen, sind in der Regel schnell und beweglich, solche die im Hinterhalt lauern, meist getarnt und ihrer Umgebung optisch angepasst. Durch das wiederholte Zusammentreffen mit Räubern haben sich bei den Beuteorganismen verschiedene Abwehr- und Schutzstrategien evolviert. Pflanzliche Abwehr gegen Herbivore Obwohl Herbivoren, im Gegensatz zu Prädatorn häufig nur Teile ihrer Futterpflanze fressen, beeinträchtigt der Verlust von Gewebe die Fitness und Überlebensfähigkeit der Pflanzen. Sie haben darum eine Reihe von Abwehrstrategien entwickelt. Häufig sind dies mechanische Schutzvorrichtungen, wie Dornen oder mikroskopisch kleine Kristalle in ihren Geweben oder Haken und Stacheln an den Blättern. So wird der Verzehr für grosse Tiere wie für Insekten erschwert. Viele Pflanzen prouzieren chemische Verbindungen, die unangenehm oder sogar schädlich für Herbivoren sind. Diese Substanzen fallen als Nebenprodukte normaler Stoffwechselvorgänge an, zum Beispiel der Glykolyse oder des Citatzyklus, und werden daher als Sekundärmetabolite oder sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet. Diese spezifischen pflanzlichen Abwehrmechanismen können zur Evolution von Gegenanpassungen bei den Herbivoren führen. Die pflanzlichen Schutzmassnahmen werden dadurch in den nachfolgenden Generationen wirkungslos. Es gibt Tiere, die die pflanzlichen Sekundärstoffe absorbieren oder entgiften können. Einige können sogar Pflanzengifte speichern und zur Abwehr ihrer eigenen Räuber einsetzen. Eine Pflanze kann durch Abwehr- und Schutzvorkehrungen die Artenzahl ihrer potentiellen Frassfeinde einschränken. Da Herbivore aber fressen müssen um sich zu reproduzieren, ist bei ihnen der Selektionsdruck auf Mechanismen, diese Pflanzenabwehr zu überwinden, sehr stark, so dass es wahrscheinlich keine Strategie gibt, die einer Pflanze einen dauerhaften Schutz vermitteln kann. Tierische Abwehr gegen Räuber Tiere können sich vor Erbeutung passiv schützen, zum Beispiel durch Verstecken, oder aktiv, durch Flucht oder Verteidigung. Flucht ist 2 eine sehr wirkungsvolle Reaktion auf einen Räuber, kann aber äusserst ernergieaufwendig sein. Viele Tiere verstecken sich aus diesem Grund und müssen so die Energiekosten für die Flucht nicht aufbringen. Aktive Selbstverteidigung ist seltener (Bsp. Löwen). Weitere Schutzmassnahmen sind Ablenkung von einem schwachen Tier auf potentielle Beuten mit besseren Fluchtchancen (Bsp. Vogeleltern) oder Alarmsignale um die Artgenossen anzulocken und den Räuber gemeinsam zu vertreiben. Viele andere Schuzmassnahmen basieren auf farblichen Anpassungen, die im Tierreich mehrmals unabhängig voneinander evolvierten. Die kryptische Färbung (Gestaltauflösung durch eine Tarnfärbung) ist der Inbegriff der passiven Verteidigung. Durch sie verschmilzt die Beute optisch mit dem Hintergrund. (siehe auch 48.5 bzw. 53.5) Auch die Form eines Tieres kann zur Tarnung beitragen. Diese Art der Tarnung wird als Mimese bezeichnet. Irreführende Farbmuster sind eine andere Art der optischen Tarnung. Vorgetäuschte Augen oder falsche Köpfe können Prädatoren offensichtlich für einen Moment verwirren und der Beute Zeit zur Flucht geben (Abb. 48.6 bzw. 53.6) oder sie veranlassen den Räuber, auf nicht lebensnotwendige Körperstellen zu zielen. Einige Tiere besitzen mechanische oder chemische Mechanismen zu Verteidigung gegen potentielle Feinde. Die meisten Räuber werden durch die bekannten Abwehrstrategien von Stachelschwein und Stinktier abgeschreckt. Einige Tiere, darunter giftige Kröten und Frösche, synthetisieren Toxine, andere erwerben passiv eine chemische Abwehr, indem sie Giftstoffe aus ihren Futterpflanzen akkumulieren. Tiere mit chemischen Schutzmechanismen sind häufig auffällig gefärbt, vermutlich um den Prädator zu warnen. Dieses Phänomen wird als Warnfärbung oder aposematische Färbung bezeichnet. (Abb. 48.7 bzw. 53.7) Mimikry Sowohl Räuber als auch Beutearten können sich durch Mimikry einen signifikanten Vorteil verschaffen. Mimikry ist ein Phänomen, bei dem ein “Mime³ eine andere Spezies, das “Modell³ in Form, Farbe oder Verhalten imitiert. Zur defensiven Mimikry eines Beuteorganismus gehört oft die Nachahmung einer Warnfärbung. Häufig sind Mime und Modell taxonomisch miteinander verwandt. Bei der Batesschen Mimikry ahmt eine essbare oder harmlose Art ein ungeniessbares oder wehrhaftes Modell nach. (Abb.48.8 bzw.53.8) Bei der Müllerschen Mimikry werden ähnliche Warntrachten von verschiedenen ungeniessbaren Arten beutzt. Vermutlich hat jede Art dabei einen zusätzlichen Vorteil, da Räuber umso schneller lernen, Beute mit einem bestimmten Aussehen zu meiden, je grösser die Zahl so gefärbter Tiere ist. Parasitismus Raub und Parasitismus werden gemeinsam betrachtet, da beide (+-)-Beziehungen darstellen. Beim Parasitismus bezieht der Parasit seine Nahrung von einem anderen Organismus, seinem Wirt, der dadurch geschädigt, aber in der Regel nicht getötet wird. Endoparasiten leben innerhalb des Wirtsgewebes (zum Beispiel Bandwürmer und Malaria-Erreger). Ektoparasiten (wie Moskitos und Läuse) halten sich - oft nur vorübergehend - an der Oberfläche eines Wirtsorganismus auf. Wie auch bei anderen (+-)-Beziehungen fördert die natürliche Selektion solche Parasiten, die einen Wirt am besten finden und ausbeuten können. Natürliche Selektion hat auch zur Evolution von Abwehrmöglichkeiten bei den potentiellen Wirtsorganismen geführt. Einige der 3 sekundären Pflanzenstoffe sind nicht nur für Herbivore giftig, sondern auch für Parasiten wie Pilze und Bakterien. Manchmal kommt es zu Koevolutionen. Es gibt auch Fälle in denen eine Lebewesen das Verhalten eines anderen ausnutzt (nicht den Wirt als Nahrungsquelle). Beispiel dafür ist der Brutparasitismus. Eine evolutionäre Anpassung die zum Teil auftritt, ist die Fähigkeit, fremde Eier im Nest zu erkennen und sie hinauszuwerfen. Interspezifische Konkurrenz ist eine (--)-Interaktion Sind in einer Lebensgemeinschaft zwei oder mehrere Arten auf dieselben limitierten Ressourcen angewiesen, kann sich interspezifische Konkurrenz entwickeln, die in unterschiedlicher Weise ausgeprägt sein kann. Bei der Interferenzkonkurrenz treten regelrechte Kämpfe um die Ressourcen auf, während bei der Ausbeutungskonkurrenz lediglich die gleichen Ressourcen konsumiert oder genutzt werden. Die dichteabhängige Wirkung der zwischenartlichen Konkurrenz ist vergleichbar mit der in Kapitel 47 bzw. 52 besprochenen intraspezifischen Konkurrenz, bei der bei zunehmender Dichte die limitierten Ressourcen für ein Individuum immer knapper werden. Bei der interspezifischen Konkurrenz wird das Wachstum einer Art nicht nur durch ihre eigene Abundanz, sondern auch durch die einer konkurrierenden Spezies limitiert. Das Konkurrenzausschluss-Prinzip Das logistische Wachstumsmodell (siehe Kap. 47 bzw. 52) wurde so modifiziert, dass die Effekte der interspezifischen Konkurenz berücksichtigt wurden. Danach können zwei in ihren Lebenserfordernissen gleichen Arten räumlich nicht koexistieren.Eien Art würde die Ressourcen besser nutzen können, sich effizienter fortpflanzen und damit die Auslöschung der anderen Art verursachen. (siehe 48.9 bzw. 53.10) Ökologische Nischen Der Begriff ökologische Nische steht für die Nutzung aller biotischen und abiotischen Ressourcen eines Lebensraums durch einen Organismus. Die fundamentale Nische bezieht sich auf die Ressourcen, die eine Art theoretisch unter optimalen Bedingungen nutzen könnte. Die Ressourcen, die eine Population tatsächlich nutzt wird insgesamt als realisierte Nische bezeichnet. Das Prinzip des Konkurrenzausschlusses kann damit neu definiert werden: Koexistenz ist nur möglich, wenn sich die Nischen von zwei Arten in mindestens einem Aspekt signifikant unterscheiden. Hinweise auf Konkurenz in der Natur Der Nachweis von Konkurrenz unter natürlichen Bedingungen ist schwierig. Falls sie wirklich eine solch treibende Kraft darstellt, wie es das Konkurrezausschlussprinip fordert, solte sie sehr selten sein. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie sich Konkurenz auf Arten mit derselben ökologischen Nische auswirken kann: Entweder wird der schwächere Konkurrent aussterben, oder eine Art wird sich so evolvieren, dass sie ein anderes Ressourcenspektrum nutzen kann. Beide Möglichkeiten führen zu konkurrenzfreien Situationen. Daher ist es schwer, die Existenz und Bedeutung einer 4 Kraft (Konkurrenz) nachzuweisen, die nur sehr kurz wirksam ist. Hinweise auf die Bedeutung von Konkurrenz geben die Ressourcenaufteilung oder unterschiedliche Ressourcennutzung wie auch die Merkmalsverschiebung oder Mekmalsdivergenz (siehe 48.11 bzw. 53.12) siehe auch Beispiel für experimentelle Hinwiese für natürliche Konkurrenz (48.12 bzw. 53.13) Karpose und Symbiose (Mutualismus) sind (+0)- beziehungsweise (++)-Beziehungen Bei der Karpose profitiert ein Partner aus der Beziehung, ohne den anderen massgeblich zu beeinflussen. Bei der Symbiose ist die Beziehung für beide Partner von Vorteil. (Im Amerikanischen ist Symbiose der Überbegriff des engen Zusammenlebens von zwei Spezies. Symbiose im deutschen Sinn bedeutet dort Mutualismus) Karpose (+0) “einseitiges Nutzniessertum³ Karpose ist nicht (? Bitte im engl. Buch noch kontrollieren) identisch mit Kommensalismus (“Tischgenosse³). (siehe auch 48.13 bzw. 53.14) Es gibt verschiedene Formen der Karpose: - Symphorismus: Der ständige Aufenthalt auf der Oberfläche eines Organismus. Allerdings können diese Gäste den Fortpflanzungserfolg ihrer Wirte beeinflussen, indem sie zum Teil deren Beweglichkeit reduzieren und damit die Möglichkeit zur Nahrungssuche oder Flucht einschränken. - Phoresie: Aktive, vorübergehende Benutzung eines anderen Organismus für Transportzwecke. (Bsp. Milben) - Parökie: Nachbarschaftsverhältnis, das einem der Beteiligten Schutz oder Nahrung bietet. - Synökie: Wohnstätte eines anderen Organismus wird mitbenutzt (Bsp. Ameisennester) - Entökie: Aufenthalt einer Art in nach aussen offenen Körperhöhlen einer anderen Art. Symbiose (Mutualismus) (++) Symbiontische Beziehungen basieren auf der evolutionären Anpassung beider Partnerspezies, da Veränderungen in einer Art sehr wahrscheinlich die Überlebensund Fortpflanzungsmöglichkeiten der anderen beeinflussen. Beispiel: Celluloseabbau durch Mikroorganismen im Darm von Termiten und Wiederkäuern. Eine Reihe von Symbiosen haben sich möglicherweise aus Räuber-Beute- oder WirtParasit-Beziehungen entwickelt. (siehe auch 48.14 bzw. 53.15) Die Struktur einer Lebensgemeinschaft wird durch die Aktivität und Abundanz ihrer Mitglieder bestimmt Nahrungsbeziehungen innerhalb von Lebensgemeinschaften 5 Die Nahrungsbeziehungen oder trophischen Strukturen werden durch RäuberBeute-, Wirt-Parasit-, und Pflanze-Herbivor-Interaktionen bestimmt, aber auch Nahrungskonkurrenz kann beteiligt sein. Trophische Strukturen lassen sich auf zwei Arten untersuchen: Durch die Analyse von Nahrungsbeziehungen lassen sich Arten in funktionelle Gruppen mit vergleichbarer trophischer Stellung einordnen. Die Analyse von Nahrungsnetzen liefert Informationen auf Speziesebene und betont die unzähligen Verbindungen zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Lebensgemeinschaft. Artenreichtum, relative Abundanz und Diversität Lebensgemeinschaften unterscheiden sich stark in ihrem Artenreichtum. Die relative Abundanz einer Art hat einen entscheidenden Einfluss auf den grundsätzlichen Charakter einer Lebensgemeinschaft. Der Begriff Artenvielfalt oder Artendiversität berücksichtigt beide Komponenten, den Artenreichtum und die relative Häufigkeit. Durch den Einfluss des Menschen (Monokulturen) wird in der Regel die Diversität von Biozönosen reduziert. Störungen und die Stabilität von Lebensgemeinschaften Störungen, sowohl natürlicher als auch anthropogener Art, kommen häufig in ökologischen Gemeinschaften vor und können sich unterschiedlich auswirken. Stabilität ist die Tendenz einer Lebensgemeinschaft, trotz auftretender Störungen ein Gleichgewicht oder zumindest einen annähernd konstanten Zustand zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Die Elastizität einer Lebensgemeinschaft ist ihre Fähigkeit, Störungen zu überwinden. Sie hängt eng mit der Stabilität zusammen, bezieht sich aber nicht auf einzelne Populationen, obwohl diese teilweise unterschiedlich auf Störungen reagieren. Die strukturbestimmenden Faktoren einer Biozönose sind Konkurrenz, Raub und die Heterogenität der Umwelt Der Einfluss der Konkurrenz Obwohl die Ökologen noch zögern, Konkurrenz als wichtigen Faktor bei der Strukturierung von Lebensgemeinschaften zu akzeptieren, ist sie doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr wichtiger Faktor, durch den die relative Artenabundanz und vielleicht auch der Artenreichtum vieler Lebensgemeinschaften reguliert wird. Konkurrenz kann aber erst dann bedeutsam werden, wenn sich die Populationsgrösse ihrer Umweltkapazität nähert und die Ressourcen knapp werden. Der Einfluss von Prädation Eigentlich müssten Räuber immer die Artenvielfalt einer Gemeinschaft reduzieren. Aber dem ist nicht immer so. Der wahrscheinlich wichtigste Effekt eines Räubers auf die Struktur einer Lebensgemeinschaft ist die Reduktion der Konkurrenz innerhalb 6 seiner Beutetiere. Eine starke Prädation kann die Dichte einer besonders konkurrenzfähigen Beuteart vermindern und einem schwächeren Konkurrenten das Überleben innerhalb der Gemeinschaft ermöglichen. Die sogenannten Schlüsselräuber haben einen wichtigen regulierenden und stabilisiernden Effekt auf die Gemeinschaft. Sie erhalten eine hohe biozönotische Artendiversität, indem sie die Abundanz starker Konkurrenten so reduzieren, dass kein Konkurrenzausschluss anderer Arten erfolgen kann. Der Einfluss der Umweltheterogenität Im Allgemeinen fördern heterogene Habitate die Vielfalt von Lebensgemeinschaften, da sie mehr ökologische Nischen zur Verfügung stellen. Dieses Heterogenität kann sowohl räumlich als auch zeitlich strukturiert sein. Ein wichtiger Aspekt der räumlichen Heterogenität ist die Vegetation, die sehr unterschiedlich sein kann. Die Pflanzenvielfalt bestimmt ihrerseits weitgehend die in der Lebensgemeinschaft vorkommenden Tierarten. In der Regel stellt eine komplex strukturierte Vegetation mannigfaltige Mikrohabitate zur Verfügung. Eine einfach strukturiete Pflanzengesellschaft bietet dagegen nur wenige unterschiedliche Raumressourcen. Ein weiterer wichtiger Faktor für räumliche Heterogenität ist die “Patchiness³, das heisst die verschiedenen Bodenparameter (Feuchtigkeit, Mineralgehalt,...) variieren lokal. Wenn verschiedene Arten an diese lokalen Unterschiede optimal angepasst sind, erhöhen solche Mosaikstrukturen die Diversität einer Lebensgemeinschaft, da sie die Ressourcenaufteilung unter potentiellen Konkurrenten erleichtert, Auch die zeitliche Trennung der Habitatnutzung kann sich auf die Diversität einer Lebensgemeinschaft auswirken. (Jahreszeit, Tageszeit) Beurteilung der ursächlichen Faktoren Sowohl interspezifische Beziehungen als auch abiotische Faktoren, die sich auf die Heterogenität des Lebensraumes auswirken, bestimmen die Charakteristika verschiedener Lebensgemeinschaften. Häufig beeinflussen sich die Faktoren gegenseitig, so dass es schwierig ist, ein Prinzip zu definieren, welches die Struktur und Diversität der Biozönosen bestimmt. Für jede Lebensgemeinschaft ist der Einfluss der verschiedenen Umweltfaktoren anders. Sukzession ist die Abfolge biozönotischer Veränderungen nach einer Störung Am offensichtlichsten werden Veränderungen in der Zusammensetzung und Struktur von Lebensgemeinschaften nach einem Ereignis, das die vorhandene Vegetation zerstört. Dies erfolgt zum Beispiel nach einer Überfllutung, einem Brand , wenn ein Gletscher zurückweicht oder nach Überweidung. Der Verlust der Vegetation verändert die Ressourcenverfügbarkeit und ermöglicht die Etablierung neuer Arten. Verschiedene Organismen können das gestörte Gebiet neu besiedeln und werden nach und nach durch andere ersetzt. Eine solche Verschiebung der Artenzusammensetzung in einem ökologischen Zeitrahmen nennt man ökologische Sukzession. Nach der traditionellen Hypothese durchläuft die Lebensgemeinschaft eine Abfolge voraussagbarer Übergangsstadien und erreicht schliesslich einen relativ stabilen 7 Endzustand, die Klimaxgesellschaft. Beginnt dieser Prozess in einer unbelebten Region, in der sich noch kein Boden gebildet hat, spricht man von einer primären Sukzession. Hier kennt man typische Pionierarten, die den Boden für die nachfolgende Vegetation vorbereiten. Eine sekundäre Sukzession erfolgt, wenn eine bestehende Gemeinschaft durch eine Störung, die den Boden intakt lässt, eliminiert wurde. Häufig entwickelt sich dieses Gebiet wieder in Richtung seines ursprünglichen Zustands zurück. Die Ursachen der Sukzession In den meisten Fällen wird der Sukzessionsverlauf von einer Reihe miteinander wechselwirkender Faktoren bestimmt. Obwohl Sukzession häufig als eine Aufeinanderfolge von Phasen unterschiedlicher Artenzusammensetzung dargestellt wird, findet sie eigentlich auf der Ebene einzelner, miteinander konkurrierender Arten statt. Mit dem Ressourcenangebot verändert sich im Laufe der Sukzession auch die Konkurrenzfähigkeit einzelner Spezies. Charakteristisch für frühe Sukzessionsstadien sind r-Strategen, die aufgrund ihrer hohen Fertilität und wegen ihrer exzellenten Verbreitungsmechanismen gute Erstbesiedler darstellen. Viele von ihnen sind sogenannte vorübergehende Arten. Sie können sich in etablierten Lebensgemeinschaften nicht durchsetzen und bleiben nur dadurch erhalten, dass sie gestörte Flächen sehr rasch besiedeln, bevor sich stärkere Konkurrenten dort niederlassen. Auch die Toleranzgrenzen der beteiligten Arten gegenüber abiotischen Faktoren wirkt sich auf die Zusammensetzung früher Sukzessionsgemeinschaften aus. Viele Kselektionierte Arten können zwar ein gestörtes Gebiet besiedeln, aber sie werden nur kümmerlich wachsen, wenn die Umweltbedingungen an den Grenzen ihrer Toleranzfähigkeit liegen. Auch die Wachstumsraten der besiedelnden Arten und die Dauer bis zur Geschlechtsreife sind von entscheidender Bedeutung. Vielfach beeinflussen auch die Organismen selbst die im Verlauf der Sukzession auftretenden Strukturveränderungen. Daran können direkte biotische Wechselbeziehungen beteiligt sein, zum Beispiel die Unterdrückung einer Art durch Ausbeutung- und/oder Interferenzkonkurrenz (Inhibierung). Durch ihre Anwesenheit verändern Organismen aber auch lokale, abiotische Umweltparameter. Dies kann dazu führen, dass die Arten eines Sukzessionsstadiums den Weg für nachfolgende Organismengruppen ebnen (Förderung). Sowohl Inhibierung, als auch Förderung können während des gesamten Sukzessionsverlaufs wirksam sein. Natürliche und anthropogene Störungen Störungen können Lebensgemeinschaften auflösen, indem sie das Ressourcenangebot verändern und Möglichkeiten für die Etablierung neuer Arten schaffen. Der Grad der Beeinflussung wird durch Grösse, Häufigkeit und Ausmass des Ereignisses bestimmt. Wichtige natürliche Ursachen sind Feuer, Trockenheit, Wind und fliessendes Wasser. Auch viele Tiere stellen Störfaktoren der Wälder dar. Die anthropogene Störung von Ökosystemen ist die Störung, für die der Mensch verantwortlich ist. Wird eine Lebensgemeinschaft gestört und und anschliessend sich selbst überlassen, können sich frühe Sukzessionsstadien, die häufig von Kräutern und Sträuchern dominiert werden, über viele Jahre hinweg erhalten. In vielen Fällen sind kleinräumige, natürliche Störungen, die zu einer mosaikartigen 8 Verteilung unterschiedlicher Sukzessionsstadien führen, wichtig für die Aufrechterhaltung der Artendiversität einer Lebensgemeinschaft. Gleichgewicht, Störung und Artendiversität einer Lebensgemeinschaft € Monoklimax-Hypothese: Die Schlussgesellschaft der ökologischen Sukzession stellt ein dynamisches Gleichgewicht dar. Interspezifische Interaktionen sind hier sehr wichtig. Sie ermöglichen den Anstieg der Diversität. € Polyklimax-Hypothese, Ungleichgewichtshypothese: Lebensgemeinschaften sind permanente Übergangsstadien. Art und Anzahl der Mitglieder verändern sich während allen Sukzessionsstadien, sogar im sogenannten Klimaxzustand. Hier beeinflussen in erster Linie Störungen die Zusammensetzung und Artendiversität eines Ökosystems. € intermediäre Störungshypothese: Die Artendiversität ist am grössten, wenn Störungen eine mittlere Häufigkeit und Stärke aufweisen, da in diesem Fall Organismen unterschiedlicher Sukzessionstadien vorkommen werden. Die Biogeographie unterstützt die Biozönologie in der Analyse der Artenverteilung Biogeographie ist die Untersuchung der vergangenen und rezenten Verbreitung von einzelnen Arten und ganzen Biozönosen. Die Grenzen der Speziesareale (Arealsystemgrenzen) Für die Begrenzung einer Art auf ein bestimmtes Areal lassen sich heute drei grundsätzliche Erklärungen formulieren: 1. Die Art breitete sich niemals über ihre jetzigen Raumgrenzen hinaus aus. 2. Pioniere hatten die heutigen Grenzen überschritten, konnten aber nicht überleben. 3. Im Verlaufe der Evolution hat sich die Art aus einem vormals grösseren Verbreitungsgebiet auf die heutigen Grenzen zurückgezogen. Globale Gradienten der Artendiversität Das Phänomen von Artendiversitätsgradienten, das heisst von graduellen Veränderungen der Artenvielfalt in Abhängigkeit grossräumiger geographischer Muster, wurde vielfach zu erklären versucht. Einige Hypothesen über die Artenvielfalt in tropischen Wäldern: - Tropische Ökosysteme sind sehr alt, kaum Störungen unterworfen und haben darum eine grössere Diversität an Pflanzen hervorgebracht. - Sie zeigen Störungen mittleren Ausmasses und haben eine grosse Umweltheterogenität. - Klima ist voraussehbar und die Organismen können sich auf einen engen Ressourcenbereich konzentrieren -> reduzierte Konkurrenz - Die stärkere Sonneneinstrahlung erhöht die pflanzliche Photosyntheseaktivität und verbessert so das Ressourcenangebot für andere Organismen. - Die strukturelle Komplexität erzeugt eine grosse Vielfalt an Mikrohabitaten, die andere Pflanzen und Tiere besiedeln können. - Diversität ist in gewisser Weise selbstfördernd, da so eine Dominanz einer Art 9 verhindert wird. Viele dieser Hypothesen treffen sicher auf die eine oder andere Organismengruppe zu, aber wahrscheinlich wirken meistens mehrere Faktoren in komplexer Weise zusammen. Welche Faktoren die beobachtbaren breitengradabhängigen Artendiversitätsgradienten bestimmen ist aber zu komplex, um dies einfach zu beantworten. Inselbiographie Wegen ihrer beschränkten Grösse und ihrer isolierten Lage bieten Inseln (Inseln im Meer, sowie isolierte terrestrische Habitate) eine ausgezeichnete Gelegenheit, einige der Faktoren zu untersuchen, die für die Artenvielfalt einer Lebensgemeinschaft mitverantwortlich sind. Die Betrachtung von Inseln kann dazu beitragen, Interaktionen in komplexeren Systemen zu verstehen. Die Artenvielfalt nimmt mit der Inselgrösse zu und der Artenreichtum einer Insel nimmt mit zunehmender Entfernung vom Festland ab. (Beispiel dazu siehe 48.21 bzw. 53.21 wie auch Text dazu.) Erkenntnisse aus Biozönologie und Biogeographie können helfen, Konzepte zur Erhaltung der Biodiversität zu entwickeln Zusammenfassung, das Bedürfnis nach Umwelt- und Naturschutz, Experimente um herauszufinden, welche minimale Grösse ein Regenwaldreservat haben muss, um seinen ursprünglichen Artenreichtum zu erhalten, der optimale Naturschutz und Naturschutzbiologie 10