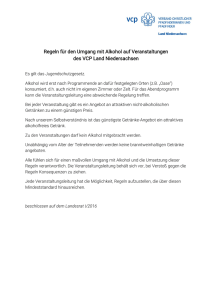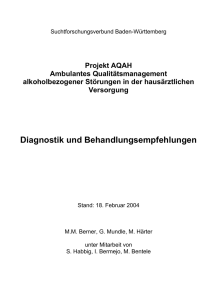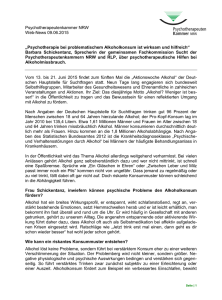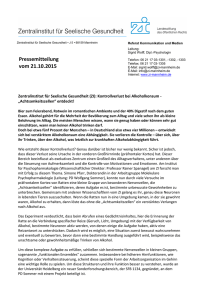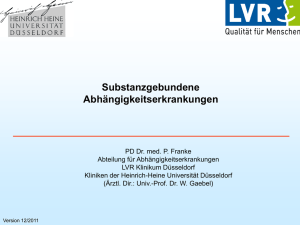Entwicklung eines Kurzinterventionskonzepts für stationäre
Werbung

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Abteilung Köln Masterstudiengang (M. Sc.) Master of Science in Addiction Prevention and Treatment Entwicklung eines Kurzinterventionskonzepts für stationäre depressive Patienten mit komorbidem Alkoholmissbrauch: Eine Evaluation durch Experten Masterthesis ` Vorgelegt von Gesine Rest 1. Gutachter: Diplom-Theologe, Diplom-Sozialarbeiter Wolfgang Scheiblich 2. Gutachter: Prof. Dr. med., M.A. Wolfgang Schwarzer Mannheim, März 2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................1 2 Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit .......................................................3 2.1 Diagnostik .............................................................................................................3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Diagnostische Klassifikationssysteme ....................................................................... 3 Klinische Laborwerte .................................................................................................. 5 Klinische Screeningverfahren .................................................................................... 6 Instrumente zur speziellen Diagnostik ....................................................................... 6 Diagnostisches Gespräch .......................................................................................... 8 2.2 Epidemiologie .......................................................................................................8 2.3 Ätiologie ..............................................................................................................10 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Biologische Erklärungsansätze ................................................................................ 10 Verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze ......................................................... 13 Psychoanalytische Erklärungsansätze..................................................................... 14 Soziologische Erklärungsansätze ............................................................................ 15 Trias Modell.............................................................................................................. 16 2.4 Grundlagen der Behandlung...............................................................................17 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Therapieprinzipien.................................................................................................... 17 Früh- und Kurzintervention, Motivation .................................................................... 18 Pharmakotherapie .................................................................................................... 20 Effektstudien............................................................................................................. 20 3 Depression...............................................................................................................22 3.1 Störungsbild Depression.....................................................................................22 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 Klassifikation ............................................................................................................ 22 Diagnostische Kriterien ............................................................................................ 23 Verlauf und Prognose............................................................................................... 25 Diagnostische Instrumente....................................................................................... 26 Suizidalität ................................................................................................................ 27 3.2 Epidemiologie .....................................................................................................28 3.3 Ätiologie ..............................................................................................................29 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Genetik und Neurobiologie....................................................................................... 29 Psychologische und soziologische Erklärungsansätze............................................ 31 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze ............................................ 32 Konsistenztheoretischer Erklärungsansatz .............................................................. 34 Integrative und multifaktorielle Erklärungsansätze .................................................. 34 3.4 Grundlagen der Behandlung...............................................................................35 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Allgemeine Therapieprinzipien................................................................................. 36 Pharmakotherapie .................................................................................................... 37 Effektstudien............................................................................................................. 38 Wahl eines geeigneten Behandlungsverfahrens ..................................................... 38 4 Komorbidität von Depression und Alkoholmissbrauch ......................................40 4.1 Begriffsbestimmung und Diagnostik ...................................................................40 4.1.1 Klassifikation ............................................................................................................ 41 4.1.2 Besonderheiten der Diagnosestellung ..................................................................... 41 4.1.3 Alkoholinduzierte affektive Störung im Entzug......................................................... 41 4.2 Epidemiologie .....................................................................................................42 4.3 Verlauf und Prognose .........................................................................................44 4.4 Ätiologie ..............................................................................................................46 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 Modellvorstellungen von Komorbidität ..................................................................... 46 Modellvorstellung Depression und Substanzmissbrauch ........................................ 48 Ätiologie Depression und Substanzmissbrauch....................................................... 48 Familienstudien ........................................................................................................ 49 Neurobiologische Aspekte ....................................................................................... 50 4.5 Behandlungsansätze ..........................................................................................51 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 Traditionelle Modelle ................................................................................................ 51 Pharmakotherapie .................................................................................................... 52 Spezifische Behandlungskonzepte .......................................................................... 53 Effektstudien............................................................................................................. 55 5 Kurzinterventionskonzept ......................................................................................57 5.1 Grundlagen des Programms...............................................................................57 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 Wirksamkeit von Kurzinterventionen........................................................................ 58 Die Institution............................................................................................................ 59 Der therapeutische Stationsalltag ............................................................................ 59 Rahmenbedingungen ............................................................................................... 61 Ziele.......................................................................................................................... 62 Inhalte und Aufbau ................................................................................................... 63 Identifikation der Zielgruppe..................................................................................... 65 Methode/ therapeutische Grundhaltung................................................................... 65 5.2 Durchführung ......................................................................................................67 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 Zugangsvoraussetzung (Screening, AUDIT) ........................................................... 67 Sitzung 1 (Vorgehensweise, SOKRATES, Psychoedukation I)............................... 69 Sitzung 2 (Psychoedukation II, IDTSA, Komorbiditätsmodell, Matrix) ..................... 76 Sitzung 3 (Selbstwirksamkeit, Wirkungserwartung, Zielformulierung)..................... 81 Sitzung 4 (Strategien, Umgang mit Rückschlägen) ................................................. 86 Sitzung 5 (Abschlussgespräch, SOKRATES, Netzwerk)......................................... 89 6 Evaluation des Behandlungskonzeptes................................................................93 6.1 Grundlagen Qualitativer Sozialforschung ...........................................................93 6.1.1 Prinzipien qualitativer Forschung ............................................................................. 94 6.1.2 Qualitative Interviews ............................................................................................... 96 6.1.2.1 Narrative Interviews.......................................................................................... 96 6.1.2.2 Diskursiv-Dialogische Interviews ...................................................................... 97 6.1.2.3 Experteninterviews ........................................................................................... 98 6.1.3 Auswahl der Experten .............................................................................................. 99 6.1.4 Interviewleitfaden ..................................................................................................... 99 6.1.5 Auswertung ............................................................................................................ 100 6.2 Vorgehen in der vorliegenden Arbeit ................................................................102 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Auswahl der Methode............................................................................................. 102 Auswahl der Experten ............................................................................................ 102 Interviewleitfaden und Forschungsfrage ................................................................ 103 Durchführung des Interviews ................................................................................. 104 Auswertung der Interviews..................................................................................... 104 Darstellung der Ergebnisse.................................................................................... 104 7 Diskussion .............................................................................................................113 7.1 Diskussion der spezifischen Elemente des Konzepts.......................................113 7.2 Diskussion der allgemeinen Elemente des Konzepts .......................................116 7.3 Ausblick ............................................................................................................118 Literaturverzeichnis ..................................................................................................120 Anhang 1 1 Einleitung Depressive Störungen einerseits, Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit andererseits zählen zu den häufigsten psychiatrischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Epidemiologisch sind depressive Störungen als Risikofaktoren für vermehrten Alkoholkonsum, Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit nachgewiesen. Patienten mit einer Major Depression bzw. einer Dysthymie weisen ein 2-3fach erhöhtes Risiko für einen Alkoholmissbrauch gegenüber der Normalbevölkerung auf. Bei einem Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit ist das Risiko um den Faktor 4 erhöht Episoden einer Major Depression zu entwickeln (Soyka & Lieb, 2004). In der täglichen klinisch-therapeutischen Praxis findet dieser Zusammenhang bislang wenig Berücksichtigung. Ein routinemäßiges Screening für die Konsummenge von Alkohol psychiatrischer Patienten gehört in der Regel nicht zur Standarddiagnostik. Selbst wenn Patienten mit einem komorbiden Alkoholmissbrauch diagnostiziert werden, findet sich im psychiatrisch-stationären Setting kaum eine Möglichkeit Behandlungsprobleme zu berücksichtigen, die durch den Substanzkonsum entstehen können. Hier kommt der psychiatrischen Primärversorgung jedoch eine wichtige Aufgabe zu: den alkoholmissbrauchenden Menschen frühzeitig zu erkennen, um ihm möglichst eine frühzeitige Auseinandersetzung mit seinem problematischem Alkoholkonsum und der Interdependenz mit seiner Grunderkrankung zu ermöglichen. Ein solcher sekundärpräventive Ansatz hat zu Folge, dass chronischer Verläufe verkürzt, wiederholte Behandlungen vermieden und Prävalenzrate in der Bevölkerung gesenkt werden (Hapke et al., 2002). Bislang liegen in der Literatur kaum sekundärpräventive Behandlungsangebote speziell für die Patienten mit depressiver Erkrankung und Alkoholmissbauch vor. Vor diesem Hintergrund wurde ein spezifisches Kurzinterventionskonzept für diese Patientengruppe entwickelt, welches sich gut in den stationären psychiatrischen Stationsalltag integrieren lässt. Dabei steht nicht die Abstinenz als übergeordnetes Ziel im Vordergrund, sondern es handelt sich um ein vom Patienten selbst bestimmtes, zieloffenes Programm, welches die Verringerung der Risiken und negativen Folgen durch Alkoholkonsum fokussiert Durch die Integration in den bestehenden Stationsalltag der Patienten sollen Synergieeffekte des gesamttherapeutischen Angebots effektiv und effizient genutzt werden. Psychoedukative Elemente dienen zur Vermittlung von behandlungsrelevanten Informationen. In einem verhaltenstherapeutischen Ansatz werden suchtspezifische und aufrechterhaltende Krankheitsbedingen miteinander verknüpft. Hieraus 2 ergibt sich das Anliegen des Konzepts: dem Patienten Verständnis und Einblick in die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Alkoholmissbrauch und Depression zu ermöglichen, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Textes wird jeweils nur die männliche Form verwendet, womit jedoch selbstverständlich stets auch die weibliche Form gemeint ist. 3 2 Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit Der Konsum von Alkohol lässt sich mit Recht sehr unterschiedlich bewerten; so ist bis heute in der Allgemeinbevölkerung und in der Fachwelt eine ambivalente Einstellung gegenüber Alkoholproblemen zu verzeichnen. Einerseits ist seit 1968 die Alkoholabhängigkeit gesetzlich als Krankheit anerkannt, andererseits werden Alkoholprobleme dem Betroffenen als schuldhaftes Fehlverhalten angelastet. Lange Zeit wurde in der Öffentlichkeit ausschließlich über die Alkoholabhängigkeit und deren Folgen diskutiert ohne dabei die große Anzahl der Konsumenten zu beachten, die riskant oder schädlich Alkohol konsumieren. In einer Gesellschaft, in der der Konsum von Alkohol zu großen Teilen anerkannt und erlaubt ist, wird es jedoch oftmals schwierig die Grenze zum Missbrauch und zur Abhängigkeit zu bestimmen. 2.1 Diagnostik Die Erfassung von Ausprägungen des Alkoholismus ist sowohl in der Forschung als auch der Therapie erforderlich. Abhängig von der diagnostischen Zielsetzung können hierbei unterschiedliche Fragestellungen im Vordergrund stehen. So kann z.B. der Schwerpunkt auf der Bestimmung der Häufigkeit des Alkoholkonsums liegen, auf der Ausprägung des Abhängigkeitssyndroms, auf der Erfassung häufig beeinträchtigter Lebensbereiche (Arbeit, Partnerschaft etc.), auf einer individuellen Prognose (Begutachtung) oder auf einer Therapiezuführung. John (1996) gibt an, dass die Symptome und Ausprägungen der Alkoholanhängigkeit separaten Messungen unterliegen sollten, da die Probleme, die im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch auftreten können, bei gleich starken Symptomen oft sehr unterschiedlich sind. Im klinischen Alltag werden diagnostische Klassifikationsmerkmale, klinische Laborwerte und psychologische Screeningverfahren als Diagnoseinstrumente eingesetzt. 2.1.1 Diagnostische Klassifikationssysteme Im klinischen Kontext werden zwei diagnostische Klassifikationssysteme benutzt: - Das „international Classification of Diseases“ in 10. Version (ICD-10), der WHO von 1992, Dilling et al. (2004). - Das „Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM IVTR (Textrevision)“ übersetzt nach der vierten Auflage des Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV-TR) der American Psychiatric Association von Saß, H. Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (2003). 4 Die Diagnose Alkoholabhängigkeit wird in beiden Klassifikationssystemen ähnlich erfasst. Nach DSM-IV ist sie dann zutreffend, wenn 3 von 7 Kriterien innerhalb eines Jahres gegeben sind. DSM-IV Kriterien für die Alkoholabhängigkeit (303.90): 1. Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien: Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen Intoxikationszustand oder erwünschten Effekt herbeizuführen. Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben Dosis. 2. Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien äußern: charakteristisches Entzugssyndrom der jeweiligen Substanz: d.h. dieselbe (oder eine sehr ähnliche Substanz) wird eingenommen, um Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden. 3. Die Substanz wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt eingenommen. 4. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren. 5. Viel Zeit für Aktivitäten, um die Substanz zu beschaffen. 6. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Substanzmissbrauchs aufgegeben oder eingeschränkt. 7. Fortgesetzter Substanzmissbrauch trotz Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das wahrscheinlich durch den Substanzmissbrauch verursacht oder verstärkt wurde. Die o.g. Kriterien sind klar formuliert und operationalisiert. Konsummuster und körperliche Entzugmerkmale fließen ebenso wie die zeitlichen Kriterien und der Schweregrad der Abhängigkeit mit in die Diagnostik mit ein. Blickt man auf den Internationalen Vergleich, wird die Diagnose Alkoholabhängigkeit häufig mithilfe des DSM-IV gestellt (Saß et al., 1989). Schuckit et al. (1994) zeigten jedoch in Vergleichsstudien, dass sich bei der Verwendung des ICD-10 zum Teil erheblich höhere Prävalenzraten in ein und derselben Population als bei der Verwendung des DSM-IV ergaben. Im ICD-10 müssen 3 von 6 Kriterien innerhalb von zwölf Monaten gleichzeitig vorhanden sein. ICD-10 Kriterien für die Alkoholabhängigkeit (F10.2): 1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren. 2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. 3. Ein körperliches Entzugssymptome bei Beendigung oder Reduktion des Konsums 4. Nachweis einer Toleranzsteigerung. 5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. 6. Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen. Die klassischen Symptome der körperlichen Abhängigkeit, nämlich „Toleranz“ (kontinuierliche Steigerung der Substanzmenge, um einen gleichbleibenden Effekt zu erzielen) und „Entzugssymptome“ (Syndrom von unangenehmen körperlichen Störungen nach 5 Absetzen der Substanz), müssen nicht mehr unbedingt gegeben sein, wenn andere Symptome zutreffen. Beide Systeme klassifizieren auch die schwächere Form des Konsumverhaltens, den „Alkoholmissbrauch“ (DSM-IV) und den „schädlichen Gebrauch von Alkohol“ (ICD-10). ICD-10 Kriterien für den schädlichen Gebrauch von Alkohol (F10.1): Tatsächliche Schädigung der psychischen oder physischen Gesundheit des Konsumenten. Schädliches Konsumverhalten wird häufig von anderen kritisiert und hat unterschiedliche negative soziale Folgen. Die Ablehnung des Konsumverhaltens von anderen Personen ist kein Beweis für den schädlichen Gebrauch, ebenso wenig wie etwaige negative soziale Folgen wie Inhaftierung oder Eheprobleme. Definitionen von schädlichem Alkoholgebrauch lassen sich danach unterscheiden, ob sie von drohenden Gefahren oder von bereits eingetroffenen Schäden bei dem Betroffenen ausgehen. So konnte Edwards et al. (1997) in seiner Übersicht belegen, dass die große Mehrheit der nichtabhängigen Trinker einen Großteil der alkoholbedingten gesellschaftlichen Folgekosten verursacht. DSM-IV Kriterien für die Alkoholmissbrauch (305.00) Für eine Diagnose des Alkoholmissbrauchs muss mindestens sich eines von 4 Kriterien innerhalb eines 12-monatigen Zeitraumes manifestieren 1. Wiederholter Substanzgebrauch, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt. 2. Wiederholter Substanzgebrauch in Situationen, in denen es auf Grund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann. 3. Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch. 4. Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz schädlicher oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Auswirkungen der psychotropen Substanz verursacht oder verstärkt werden. Eine sehr wichtige Unterscheidung der Diagnostik des DSM IV-TR ist die multiaxiale Einteilung, eine davon beschreibt die psychosozialen und umgebungsbedingten Probleme des Patienten. Die ICD-10 Klassifikation hingegen legt den Diagnoseschwerpunkt auf die gesundheitliche Dimension. 2.1.2 Klinische Laborwerte Die klinischen „Alkoholmarker“ spiegeln die laborchemischen Folgen des erhöhten Alkoholkonsums wieder. Jedoch ist keine Unterscheidung zwischen Abhängigkeit und Missbrauch möglich. Nach einer Blutentnahme lässt sich der Blutalkoholspiegel und sog. Biologische Marker identifizieren. Die sog. Trait-Marker weisen ein genetisches, zeitunabhängiges Merkmal nach (z.B. Alkoholdehydrogenase, MAO). Die State-Marker sind zeit- und zustandabhängige Variablen die nur im Rahmen des Substanzgebrauchs nachzuweisen sind (z.B. Blutalkohol, Transaminasen). Unter den Assoziations-Marker versteht man 6 eine Reihe genetischer und serologischer Merkmale, die sehr viel häufiger bei Alkoholabhängigen als bei Gesunden beobachtet werden. Eine detaillierte Beschreibung über klinische „Alkoholmarker“ liefern Agarwal und Agarwal-Kozlowski sowie Schmidt, L.G. in Singer und Teyssen (1999). Im Klinischen Alltag finden insbesondere die Transaminasen Anwendung, die umgangssprachlich als Leberwerte bezeichnet werden. 2.1.3 Klinische Screeningverfahren Neben den operationalisierten Diagnosekriterien und den laborchemischen Variablen wurden für die Diagnosestellung der Alkoholabhängigkeit Fragebogenverfahren entwickelt. Dem Einsatz von Screeninginstrumenten kommt vor allem in der medizinischpsychotherapeutischen Versorgung für die rechtzeitige Identifizierung von Alkoholproblemen größere Bedeutung zu. Im Folgenden sind die gängigsten Tests dargestellt. Eine gute Übersicht der vorhandenen Sreeningverfahren ist u. a. in Feuerlein, Küfner und Soyka (1998) zu finden. Kruse, Körkel und Schmalz (2000) beschreiben vier der Fragebögen ausführlich. Psychologische Screeningverfahren Autor Test 1. Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) Barbor et al. (1989) 10 Items 2. Cut down Annoyance Guilty Eye Opener (CAGE) Mayfield et al. (1976) 4 Items 3. Kurzfragebogen für Alkoholgefährdete (KFA) Feuerlein et al. (1989) 22 Items 4. Lübecker Alkoholismus-Screening-Test (LAST) Rumpf et al. (1995) 9 Items 5. Münchner Alkoholismustest (MALT) Feuerlein et al. (1979) 24+7 Items Insbesondere für wissenschaftliche Untersuchungen wird heute meist eine Befundabsicherung der Diagnose Alkoholabhängigkeit/-missbrauch durch gezielte zumindest halbstandartisierte Interviews gefordert (Soyka, 1999). Hier ist vor allem das „Composite International Diagnostic Interview“ (CIDI) (Wittchen et al., 1998) zu nennen. Dieses vollstandartisierte Interview ist in verschiedene Sektionen unterteilt und ermöglicht die Erfassung der Störungen nach ICD-10 und DSM-IV. 2.1.4 Instrumente zur speziellen Diagnostik Um eine differenzielle Therapiezuweisung zu ermöglichen wurden zur Bildung von Subgruppen mehrdimensionale Fragebögen entwickelt. Wetterling und Veltrup (1997) gaben an, dass in solchen umfassenden diagnostischen Instrumentarien die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung von Abhängigkeitsphänomenen eine herausragende Bedeutung hat. So sind die Angaben Abhängigkeitskranker in Selbstbeurteilungsbögen reliabel und valide und liefern z.B. bei Screenings zuverlässigere Einschätzungen als 7 biometrische Daten (Wetterling & Veltrup 1997). Schwoon (2002) hat mit den „Hamburger-Alkoholismus-Skalen“ einen Fragebogen mit 52 Items zusammengestellt, die sich auf sechs Skalen zuordnen lassen, aus denen jeweilig spezifische Muster für die soziale Situation sowie für Krankheitsentwicklung und -verlauf schließen lassen. Daraus lassen sich Akzentsetzungen für Planung, und Durchführung von Therapien ableiten (Schwoon, 2002). Weitere spezifische Diagnostikinstrumente geben z.B. Einschätzungen über das Ausmaß der suchtbedingten Einschränkungen der Teilhabe am Arbeitsleben/ gesellschaftlichen Leben oder die Belastetheit durch komorbide Störungen. Eine Beschreibung gibt Lindenmeyer (2005) sowie Soyka (1999). Hier seien einige Instrumente genannt: - Addiction Severity Index (ASI): wurde von McLellan (1980) entwickelt und gibt einen Überblick über die Suchtproblematik. - Trierer Alkoholismus Inventar (TAI): der von Funke et al. (1987) entwickelte Test beschreibt die spezifischen Alkoholprobleme. - Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit (SESA): der von John et al. (2001) entwickelte Fragebogen ermittelt den Schweregrad der Alkoholabhängigkeit. - Inventory of Drug Taking Situations (IDTSA): die deutsche Version wurde von Lindenmeyer und Florian (1998) vorgestellt und identifiziert Trinksituationen. - Kurzfragebogen zur Abstinenzzuversicht (KAZ-35): der von Körkel und Schindler (1996) entwickelte Fragebogen erfasst die Abstinenzzuversicht, Rückfallsituationen abstinent zu bewältigen. - Stages of Change Readiness und Treatment Eagerness Scale (SOCRATES): strebt die Erfassung der Veränderungsmotivation von Problemtrinkern an und wurde 1996 von Miller und Tonigan entwickelt. Die deutsche Übersetzung mit Auswertungsanleitung findet sich bei Wetterling und Veltrup (19997). Für die klinische Alkoholismusdiagnose spielt darüber hinaus auch das Erscheinungsbild des Patienten mit typischen alkoholbedingten Folgeschäden eine große Rolle. Diese können, wie z.B. eine leichte Verfettung der Leber, unter Abstinenz wieder abklingen. Oder aber irreversibel und schließlich auch tödlich sein (Mann & Schwärzler, 2000). Die wichtigsten Folgekrankheiten schlagen sich im Nervensystem (z.B. Polyneuropathie), im Herz-Kreislaufsystem (z.B. Hypertonie, Schlaganfälle), in der Leber (Fettleber, Leberzirrhose) sowie im Magen-Darm-Trakt (Ösophagusvarizen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse) nieder. Eine differenzierte Darstellung von alkoholbedingten Folgeschäden geben Singer und Teyssen (1999). 8 2.1.5 Diagnostisches Gespräch Nach Schmidt (1997) prägen dynamische Interaktionsprozesse den diagnostischen Prozess in erheblicher Weise. Weil die Grenzen zwischen schädlichen Gebrauch und Abhängigkeit, aber auch zwischen gesellschaftlich akzeptierten Konsum und „unnormalem“ Konsum fließend sind, wird die exakte Diagnosestellung erschwert. Aufgrund der Befürchtung einer sozialen Stigmatisierung oder Verzerrung des Denkens aufgrund der Krankheit werden die Angaben zu Trinkmengen oft bagatellisiert. Hier kommt dem diagnostischen Gespräch eine zentrale Bedeutung zu. Alkoholkranke im frühen Stadium zu erkennen ist eine wichtige Aufgabe in der Primärversorgung. Wegen der zentralen Bedeutung der Verleugnungs- und Bagatellisierungstendenzen sollte das diagnostische Gespräch mit der Technik des „Motivational Interviewing“ nach Miller und Rollnik (1999) vorgenommen werden (Schmidt 1997, Mann & Schwärzler 2000). Dieser empathische Beratungsstil und die sachliche Information/ Rückmeldung über diagnostische Befunde sind effektive Komponenten dieses Gesprächstils (Kremer, 2003). Eine ausführliche Beschreibung des Motivational Interviewing ist bei Miller und Rollnik (1999) zu finden. 2.2 Epidemiologie Seit Ende der 90er Jahre liegen mehrere repräsentative, an aktuellen diagnostischen Standards ausgerichteten Studien zur Problemprävalenz in der Population der Bundesrepublik Deutschland vor. Nach Wienberg (2002) kommt der „Bundesstudie“ von Kraus und Bauernfeind (1998) eine besondere Bedeutung zu, da sie als Einzige repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in Deutschland ist. Auf dieser Grundlage kommt eine Expertengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (Bühringer et al. 2000) für die Wohnbevölkerung ab 18 Jahren zu einer „Neuschätzung“ der Prävalenzraten: - 2,4% der Bevölkerung sind nach DSM-IV als alkoholabhängig anzusehen. Dies entspricht 1,6 Mio. Menschen. - 4% oder 2,7 Mio. betreiben aktuellen Alkoholmissbrauch (DSM-IV). - Eine remittierte Alkoholabhängigkeit liegt bei 4,9% oder 3,2 Mio. Menschen vor - Nach der Bundesstudie sind insgesamt knapp 12% (7,9 Mio.) Personen als riskante Alkoholkonsumenten einzuschätzen (> 40g/Tag Reinalkohol bei Männer und > 20g/Tag bei Frauen); in dieser Gruppe sind die Abhängigen und die Missbraucher enthalten. Subtrahiert man diese erhält man einen Schätzwert von 3,2 Mio. Personen die „nur“ riskant konsumieren. 9 Die Studie hat jedoch methodische Aspekte, die dazu führen, dass die Prävalenz der Alkoholabhängigkeit unterschätzt wird. Die Wichtigsten sind nach Wienberg (2002): - Der Fragebogen umfasst mehr als 100 Items. Viele Menschen sind dieser Anforderung nicht gewachsen, was dazu führt, dass abhängige Personen den Fragebogen überhaupt nicht oder fehlerhaft beantwortet haben. - Bedingt durch die Art der Durchführung wurden Menschen mit instabilen Wohnverhältnissen nicht erfasst, was dazu führt, dass Menschen mit besonders ausgeprägten Alkoholproblemen in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Somit stufen Holz und Leune (1999) die erhobenen Prävalenzen als „unterste Grenze“ ein. Die Autoren selbst weisen darauf hin, dass die von ihnen erhobenen Schätzwerte zum Alkoholkonsum erheblich unter den bundesweiten Verbrauchzahlen liegen (Wienberg 2002). Wie groß die quantitativen Effekte des Stichprobenfehlers sind, kann nur schwer abgeschätzt werden. Die „Neuschätzung“ nach Bühringer et al. (2000) (s.o.) nimmt hier keine Korrektur vor. Wienberg (2002) gibt an, dass eine PrävalenzSchätzung von 2 Mio. Alkoholabhängigen näher an der wahren Prävalenz liegt, sich jedoch in der Fachöffentlichkeit die Zahl von 1,6 Mio. alkoholabhängiger Erwachsener festsetzen wird. Insgesamt besteht in Deutschland mit 10,1 Liter reinem Alkohol pro Kopf und Jahr ein hoher und verbreiteter Alkoholkonsum (Meyer & John, 2008). Lediglich 2,1% (Männer) und 3,3% (Frauen) der Erwachsenenbevölkerung trinken überhaupt keinen Alkohol. Wobei Männer im Schnitt etwa dreimal so viel Alkohol konsumieren wie Frauen (Lindenmeyer 2005). Die Fortsetzung der o.g. „Bundesstudie“ im Jahr 2003 von Kraus und Augustin umfasste eine Stichprobe von 8061 Personen im Alter von 18-59 Jahren. Die Monatsprävalenz eines riskanten Konsums für Männer lag bei 12,1% und für Frauen bei 6,3%. 4,1% der Männer und 1,3% der Frauen wiesen einen gefährlichen Konsum auf. Insgesamt lagen 12,1 % (Männer: 16,2% und Frauen 7,6%) über dem Schwellenwert für langfristige gesundheitliche Probleme von durchschnittlich 20/30g Reinalkohol pro Tag (Kraus & Augustin, 2005). John et al. (1996) fanden in der Lübecker Studie ein besondere Häufung von Alkoholabhängigen bei stationären Patienten in Krankenhäusern (vor allem Psychiatrische Einrichtungen, Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgisch / Traumatologische Abteilungen). 1309 Patienten, die in einem Städtischen Krankenhaus stationär behandelt wurden, unterlagen den Einschlusskriterien der Studie Die Ergebnisse zeigten, dass 17,5% dieser Patienten im Alter von 18-64 Jahren alkoholabhängig sind oder einen Alkoholmissbrauch aufwiesen. Im Alter ab 65 Jahren betrug diese Quote 3,5%. 10 2.3 Ätiologie Für die Entstehung der Alkoholabhängigkeit und des Alkoholmissbrauchs lassen sich eine Vielzahl von Faktoren definieren die für das Zustandekommen und für die Ausprägung des Alkoholismus von Bedeutung sind. Bei der Komplexität der Faktoren wird deutlich, dass es die Alkoholismustheorie und den Alkoholismus nicht gibt und somit eindimensionale Erklärungsmodelle nur widersprüchlich empirische Bestätigung fanden (Lindenmeyer 2005). Die in der Literatur angegebenen Konzepte sind von unterschiedlichem Allgemeinheitsgrad und betreffen verschiedene Aspekte substanzgebundener Sucht. 2.3.1 Biologische Erklärungsansätze Grundsätzlich hält Arend (1999) fest, dass die biogenetische und biomedizinische Forschung Hinweise auf eine Beteiligung genetischer Faktoren bei einem bestimmten Alkoholikertyp geliefert hat. Dem Belohnungssystem (Reward-System) kommt innerhalb der biologischen Erklärung eine besondere Bedeutung zu. Es wird als Angriffspunkt aller psychoaktiven Substanzen betrachtet. (Rommelspacher 1999, Wolffgram 1997). Das neuronale Belohnungssystem besteht aus unterschiedlichen Schichten unseres zentralen Nervensystems und wird als „belohnungsvermittelnde“ Instanz beschrieben. Das Prinzip ist – vereinfacht ausgedrückt - „Lernen durch Belohnung“. Genetische Disposition Rommelspacher (1999) beschreibt die Metaanalyse von 39 Familienstudien, wobei einer von 3 Alkoholkranken zumindest einen kranken Elternteil aufwies. Solche Patienten beginnen in der Regel früher zu trinken als Alkoholkranke ohne ein trinkendes Elternteil (vgl. auch Lachner & Wittchen 1997, Maier 1997). Nach Rommelspacher (1999) wurde in Adoptionsstudien nachgewiesen, dass 18% der Adoptierten mit mindestens einem kranken Elterteil im Laufe ihres Lebens eine Alkoholkrankheit entwickelten im Vergleich zu 5% in der Gruppe von adoptierten Personen ohne einen kranken Elternteil. Aufgrund der äußerst komplexen Modellannahmen in der Neurobiologie werden im Folgenden exemplarisch und vereinfacht drei wichtige Mechanismen, die mit der Entwicklung der Alkoholabhängigkeit in Verbindung gebracht werden, dargestellt. Eine gute Übersicht über neurobiologische Mechanismen der Suchtentwicklung geben Wanke und Bühringer (1991). Toleranzentwicklung Toleranz bezeichnet die Abnahme der Drogenwirkung (neuronale Anpassung) bei wiederholter Gabe. Sie wird deshalb mit der Entstehung der Abhängigkeit in Verbindung 11 gebracht, da sie die Menge der eingenommenen Substanz beeinflusst. (Rommelspacher 1999). Daneben besteht auch eine pharmakokinetische Toleranz, die den beschleunigten Abbau von Drogen beschreibt. Zwei Faktoren werden mit der Steigerung von Toleranz in Verbindung gebracht (Lindenmeyer 2005): - Zwei-Phasenwirkung von Alkohol. Im glutamatergen und GABAergen System setzt nach der gewünschten angenehmen Hauptwirkung von Alkohol eine entgegengesetzte unangenehme Nachwirkung ein. Dies wurde in EEG Untersuchungen belegt. Die Nachwirkung ist geringer aber länger anhaltend. Durch wiederholte Einnahme kommt es zu einer „Auftürmung“ der Nebenwirkungen, die irgendwann die Form von Entzugserscheinungen annehmen können. Die Entzugserscheinung sind Folge der Tatsache, dass es unter permanenter Alkoholzufuhr zu neuronalen Anpassungsprozessen kommt und dass bei Absetzten der Substanz die Rezeptoren nun fehlangepasst sind. Oft ist der Zellstoffwechsel anderer Organsysteme mitbetroffen (Mann et al., 2004). Die Toleranzänderung in der Suchtentwicklung wurde von Wollfgramm (1997) im Tierversuch gut dargestellt. - Erhöhte Alkoholverarbeitungskapazität in der Leber Bei einer häufigen Blutalkoholkonzentration von über 0,5 Promille kann sich die Kapazität der Leber durch Bildung zusätzlicher Enzyme erhöhen. Dabei spielt das „Mikrosomale Ethanol Oxidations System“ (MEOS) eine besondere Bedeutung, da es den Abbau von Alkohol durch Zufuhr von Sauerstoff in der Leber beschleunigt. Dies führt zu einer rascher eintretenden Nüchternheit und somit auch zu einer vorzeitigen Wiedereinnahme von Alkohol. Weiter jedoch erzeugt die Verbindung der Enzyme mit Adrenalin eine verstärkt ausgeprägte und länger anhaltende unangenehme Nachwirkung nach der Einname von Alkohol. Endorphinmangel Im Fokus dieses Modells steht das „Belohnungssystem“ im Gehirn, das die „Wohlbefindlichkeit“ eines Menschen bewertet. Stammesgeschichtlich ist dieses Funktionssystem mit explorativer Neuentdeckung, Motivationsprozessen, allgemeiner Verhaltensaktivierung und Beibehaltung von stabilisierenden Gewohnheitshierarchien verbunden. Es ist vorwiegend dopaminerg-endophinerg reguliert. Nach Lindenmeyer (2005) gehen die Erklärungsansätze übereinstimmend davon aus, dass ein genetischer oder durch anhaltenden Alkoholkonsum erworbener Defekt verschiedener Transmittersysteme (dopaminerges und serotonerges System und endogene Endorphine) in einer mangelnden Selbstaktivierung seinen Niederschlag findet. Durch ein Absinken des Dopaminumsatzes bei Abstinenz entsteht wiederum Suchtmittelverlangen. Rommelspacher (1999) berichtet, dass in den meisten humanpharmakologischen Untersuchungen eine 12 Verminderung des Beta- Endorphinspiegels bei Alkoholkranken gefunden wurde. Erst durch die erneute Einnahme von Alkohol wird der Endorphinmangel ausgeglichen, indem Kondensationsprodukte („Alkogene“) mit endorphinähnlichen Eigenschaften den Mangel kurzfristig beseitigen. Situationsspezifische emotionale Gedächtniseffekte Verhaltensexperimentelle und neurobiologische Untersuchungen postulieren die Existenz eines „Suchtgedächtnisses“ (Feuerlein 1998 und Lindenmeyer 2005 beziehen sich auf Böning 1994). Endogene Opioide und Glutamat-NMDA-vermittelte Prozesse sind an der Gedächtnisbildung beteiligt. Die Befunde gehen davon aus, dass im limbischen System bestimmte suchtrelevante Gedächtnisinhalte gespeichert werden. Hinweise liegen außerdem dafür vor, dass durch eine anhaltende Aktivierung dieser Systeme sog. „regulative Gene“ (in Nervenzellen) aktiviert werden können, die im Zellkern dauerhafte Gedächtnisspuren hinterlassen. Das limbische System ist wiederum eng mit Funktionen wie Emotionalität, Triebregungen, Sexualität, Lust / Unlustempfinden und Nahrungsaufnahme assoziiert. Auf diese Weise können bei Alkoholabhängigen in bestimmten Auslösesituationen, die in der Vergangenheit mit Alkoholeinnahme gekoppelt waren, neurophysiologische Reaktionsweisen ausgelöst werden, die ein hohes Rückfallrisiko beinhalten. Die Reaktionsweisen liegen außerhalb jeglicher willentlichen Kontrolle. Lindenmeyer (2005) gibt an, dass die reflexartigen Veränderungen auf physiologischer Ebene wie Hautwiderstand, Speichelfluss, Herzfrequenz, EEG, Neurotransmitterausschüttung, Hormonausschüttung sowie auf kognitiver Ebene (Gedächtnis- und Wahrnehmungsbasis, Reaktions- und Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit) bei Alkoholabhängigen bei der Konfrontation mit alkoholbezogenen Stimuli nachgewiesen wurden. Subkortikale Sensitivierung Ein weiterer biochemischer Erklärungsansatz beschreibt die neuronale Adaption des Dopaminsystems bei permanentem Alkoholkonsum, welches zur Hypersensitivität des Belohnungssystems gegenüber der Anreizwirkung von alkoholspezifischen Stimuli führt. Nach Wolffgramm und Heyne (2000) zit. nach Lindenmeyer (2005) handelt es sich um löschungs- und überschreibungsresistente Veränderungen im mesolimbischen-mesocorticalen Bereich. Kiefer (2007a) gibt an, dass durch wiederholte Stimulation neuronaler Verknüpfungen Bahnen entstehen, die den spezifischen Reiz (hier die Wirkung von Alkohol), zunehmend sensitiver beantworten. So filtert und fokussiert ein abhängiger Mensch speziell die suchtassoziierten Reize aus der Summe der Umgebungseindrücke. 13 2.3.2 Verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze Verhaltens- oder lerntheoretische Konzepte haben bis heute die beste Integration von empirischen Einzelergebnissen für ein Erklärungsmodell der Abhängigkeitsentwicklung geleistet. Die Lernprinzipien des klassischen Konditionierens und des instrumentellen Lernens beschreiben Abhängigkeit als eine Form von hochfrequentem Verhalten unter der Kontrolle starker Anreizbedingungen. Im Folgenden werden die klassische und operante Konditionierung als „Konditionierte Effekte“ zusammengefasst. Konditionierte Effekte Zunächst wird Alkohol durch die Kontingenz mit positiven Erfahrungen (z.B. Stimulierung/ Sedierung) zum klassisch konditionierten Verstärker. Suchtmittel werden jedoch auch eingenommen, um subjektiv negative oder psychische Empfindungen abzumildern. Situationen, in denen solche negativen Empfindungen konkret auftreten oder erwartet werden, wird dann zunehmend mit dem Konsum des Suchtmittels begegnet. Der Konsum wird durch diese Wirkung unmittelbar positiv verstärkt. Eine allmähliche Konditionierung tritt ein und die Entwicklung der Abhängigkeit wird gebahnt. Eine Rolle für die langfristige Aufrechterhaltung der Alkoholabhängigkeit spielt die unbewusste Kopplung von sucht-assoziierten Reizen und sucht-assoziierten Reaktionen. „Da die Konditionierung sowohl Substanzeffekte als auch Toleranzeffekte betreffen kann, kann bei einem abhängigen Patienten unter abstinenten Bedingungen situationsunabhängig sowohl eine konditionierte Substanzwirkung (mit positiver Verstärkung durch Aktivierung des Belohnungssystems), als auch eine konditionierte Toleranz (mit negativer Verstärkung durch Entzugssymptome) auftreten“ (vgl. Kiefer 2007, S. 34). Durch Substanzeffekt und Toleranzentwicklung entsteht eine wesentliche Bedingung für das Fortsetzen der Substanzeinnahme. Hingegen beschreiben die konditionierten Mechanismen Rückfälle aus Phasen kontinuierlicher Abstinenz. Konditionierte Stimuli können über Jahre fortwirken und sowohl als positive als auch als negative Verstärker wirksam sein. Die Lerntheorien des Alkoholismus stellen innerhalb der verhaltenstherapeutischen Theorien einen umfassenden Ansatz dar. Der Schwerpunkt liegt in der Interaktion mit sozialen Umfeldfaktoren. Sie schließen Familien, Peergroups, Modelllernen, Alkoholerwartungen, unterschiedliche Kompetenzen, Sozialisationsdefizite, situative Faktoren und biologische Faktoren der Alkoholwirkung mit ein (Feuerlein 1998 bezieht sich auf Abrams & Niaura 1987). Dabei existiert nicht die Lerntheorie, sondern mehrere Ansätze, die manchmal unter dem Begriff „Verhaltenstheoretische Ansätze“ zusammengefasst werden (Arend 1999). Der Ausgangspunkt für alle Ansätze ist die Annahme, dass jeglicher Konsum von Alkohol auf der Grundlage der gleichen Lernprinzipien erlernt und aufrechterhalten wird. 14 Petry (1996) und Arend (1999) beschreiben einen ausführlichen Ansatz der sozialkognitiven Lerntheorie. 2.3.3 Psychoanalytische Erklärungsansätze Die folgende Darstellung bezieht sich im Wesentlichen auf Böhmer, Bühringer und Janik-Konecny (1993) sowie Reker und Kremer (2001). Ausführliche Beschreibungen der psychoanalytischen Theorien zur Entstehung von Abhängigkeit sind bei Rost (1987, 1994) zu finden. Die analytischen Schulen gehen von gestörten internalisierten Erfahrungen und infolgedessen auch von instabilen Ich-Strukturen aus. Diese Strukturen bewirken ein unreifes Konfliktmanagement und defizitäre Selbstregulation. Es wird von einer „prämorbiden“ Persönlichkeit ausgegangen, welche durch eine Störung in der individuellen Entwicklung bedingt ist. Die objektanalytische Theorie setzt sich mit (selbst)zerstörerischen Formen von Rückfällen auseinander, bei denen sich der Abhängige in autodestruktiver Weise mit Konsumexzessen in Lebensgefahr bringt. Der Alkohol dient somit zu Unterdrückung aggressiver Impulse und zerstört die verinnerlichten „bösen“ Objekte. Er dient der Fortführung (selbst-) zerstörerischer Erfahrungen in frühester Kindheit. Als Ursache hierfür werden schwere Formen der Ablehnung, körperliche und sexuelle Gewalt, Willkürlichkeit, mangelnde Verlässlichkeit der wichtigen Bezugspersonen etc. genannt (Arend, 1999). Hingegen begreift die Ich-psychologische Theorie das Suchtmittel als Wirkstoff mit einer Ich-ergänzenden Potenz, die Menschen mit einer schwachen Ich-Struktur unterstützen kann. Es ist eine entwicklungsgeschichtlich später anzusiedelnde Störung des Aufbaus der Ich-Funktionen und Ich-Strukturen. Störungen zu den Beziehungen der wichtigsten Bezugspersonen, willkürlicher und rascher Wechsel von Verwöhnung und Versagung, mangelnde Gefühle von Geborgenheit und Sicherheit, mangelnde Bestätigung und Förderung des Kindes etc. sind Ursachen für die Disposition für Störungen des Suchtmittelgebrauches. Zusätzliche psychische Störungen wie etwa Angstoder Affektstörungen sind häufig (Reker & Kremer, 2001). Der Alkohol dient hier der Regulierung emotionaler Erlebnisinhalte. In der Triebpsychologischen Theorie wird davon ausgegangen, dass mit einem Alkoholrückfall bei einer starken, reglementierten Über-Ich-Struktur im Sinne einer Triebabfuhr tabuisierte Affekte ausagiert werden. Der Alkohol dient somit dazu, Unlust zu vermeiden und Lust zu verstärken. Unlust resultiert aus einem ungelösten Konflikt zwischen Trieb und Realität. Die Person ist aufgrund von Störungen in der Entwicklung triebregulierender Prozesse nicht in der Lage, Konflikte „normal“ zu bewältigen und widerstrebende Impulse zu integrieren. Stattdessen 15 wird der Alkohol als Lösungsmittel eingesetzt und eine (vorübergehende) Befriedigung mittels Durchsetzung des Lustprinzips tritt ein. 2.3.4 Soziologische Erklärungsansätze Das Ziel dieser Theorieansätze ist die Erklärung mikro,- meso- und makroanalytischer Prozesse für den epidemiologischen Alkoholkonsum in einer Population oder in sozialen Gruppen. Nachfolgend werden exemplarisch die Ausgangsfragen aufgeführt, auf welche sich die soziologischen Theorien hauptsächlich beziehen (vgl. Feuerlein, 1989, S.99): - Welche Funktion und Aufgabe hat der Alkoholkonsum für die Funktionsfähigkeit bzw. für die soziale Integration einer Gesellschaft? - Wie können unterschiedliche Alkoholgewohnheiten (Menge, Frequenz, Trinksitten) in verschiedenen Gesellschaften oder sozialen Schichten auf soziologischer Ebene (soziale Normen, Regeln, Wertevorstellungen und sozioökonomische Bedingungen) erklärt werden? - Wie definiert eine Gesellschaft Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch im Hinblick auf soziale Normen und Wertvorstellungen? Soziologische Theorien bieten in erster Linie nicht die Erklärung für die Entstehung der Sucht, sondern für ihre Aufrechterhaltung. Die Vorstellung ist hier, dass der Suchtmittelkonsum von der Gesellschaft etikettiert wird. Der Betroffene wird zum Asozialen, zum Charakterschwachen degradiert und ist dadurch mit bestimmtem Reaktionsformen konfrontiert. Die zunehmende Verstrickung in diese abweichende Rolle hält den Suchtmittelkonsum aufrecht. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang die Drifthypothese oder der soziale Abstieg (Lindenmeyer, 2005). Auch sie trägt hauptsächlich zur Aufrechterhaltung des Suchtmittelkonsum bei und bezieht sich auf drei soziale Konsequenzen : - Direkte soziale Folgen des Alkoholkonsums (Ehescheidungen, Kündigung und Arbeitslosigkeit, finanzielle Engpässe und Schulden, strafrechtliche Komplikationen, Wohnungsverslust und Obdachlosigkeit). - Gesellschaftliche Ausgrenzung und Ablehnung gegenüber Alkoholkranken in der Bevölkerung. - Vermeidungsstrategien der Betroffenen um Stigmatisierungen zu entgehen (sozialer Rückzug). Die Aspekte des sozialen Abstiegs treten in eine Wechselwirkung. Hierbei entsteht die Gefahr, dass in der Selbstwahrnehmung des Betroffenen eine Verwechslung von Ursache und Folge auftritt. Das heißt, der Abhängige attribuiert die schweren sozialen Folgen als Ursache der Sucht und nicht mehr als deren Wirkung. 16 2.3.5 Trias Modell Wie Eingangs darauf hingewiesen wird deutlich, dass es die Alkoholismustheorie nicht gibt. Daher werden die unterschiedlichen Theorien und die Genese der Abhängigkeit häufig in einem Trias Modell (multifaktorielles Modell) zusammengefasst und subsumiert. Das Konzept ist sehr allgemein gehalten und zeigt somit kein explizites Ursachen-, Bedingungs- oder Wirkungsgefüge auf. Es stellt Variablen dar, denen drei Hauptelemente zuzuordnen sind: Trias-Modell Faktoren Trias-Modell-Variablen 1. Biologische Faktoren Soziale Faktoren 2. Personale Faktoren Psychische Variablen 3. Soziale Faktoren Soziokulturelle Variablen (Familienstruktur, Lebensbedingungen) Biologische Faktoren Die Alkoholabhängigkeit stellt keine Erbkrankheit im engeren Sinne dar. Dennoch verdeutlichen vor allem Zwillings- und Adoptionsstudien, dass genetische Faktoren eine erhebliche Rolle bei der Suchtmittelwirkung, der Entstehung und der Aufrechterhaltung des süchtigen Verhaltens darstellen (Lachner & Wittchen, 1997). Beck (1997) beschreibt die Beeinflussung des Nervensystems durch Veränderungen der körperlichen Wahrnehmung und des psychischen Zustandes aufgrund des Suchtmittels. Wird ein Suchmittel konsumiert, das einen angenehmen Effekt auslöst, speichert der Körper diesen als Belohnung. Verhaltensweisen die belohnt werden, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt und gelernt und die Wiederholung fixiert die belohnten Verhaltensmuster. Personale Faktoren Auf intrapsychischer Ebene wird das Suchtmittel in erster Linie zur Regulation von Affekten eingesetzt. Hierbei können unangenehme Gefühle der Ohnmacht, Verzweiflung oder Scham „erträglicher“ gemacht werden, oder ein unerträgliches Gefühl der „Leere“ wird durch Suchtmittelkonsum ausgefüllt. Der Suchtmittelgebrauch stellt somit eine selbstschädigende Problemlösung dar (Reker & Kremer, 2001). Eine Folge der Affektregulationsstörung ist häufig eine mangelhaft ausgeprägte Affektdifferenzierung. Soziale Faktoren Süchtige Verhaltensweisen entstehen nicht nur individuell, sondern immer in sozialen Systemen. Vorbilder, Interaktionsstile, Erwartungshaltungen prägen die persönliche Entwicklung im Umgang mit Alkohol. Sie haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Selbstbild und Selbstwirksamkeitserwartung. Soziale Faktoren beschreiben Variablen wie Zugang zur Bildung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Freizeit- 17 gruppierungen, Religionszugehörigkeit. Als Variablen die den sozialen Fernraum betreffen sind Variablen bezüglich Angebot und Verfügbarkeit sowie die Trinknormen und Trinkgewohnheit der Gesellschaft zu nennen (Feuerlein, 1998). 2.4 Grundlagen der Behandlung Die Behandlungsempfehlungen bei schädlichem Alkoholgebrauch und Alkoholabhängigkeit orientieren sich an dem Schweregrad der Erkrankung und den vordringlichen Therapiezielen. Hierbei sollte beachtet werden, dass das Behandlungsziel der „lebenslangen Alkoholabstinenz“ zwar eine Idealnorm darstellt, der tatsächlichen Problemlage aber selten entspricht. Kiefer und Mann (2007b) geben an, dass neben den klassischen Suchttherapien, vor allem in den letzten Jahren, die Früh- und Kurzinterventionen in den Fokus geraten sind. 2.4.1 Therapieprinzipien In vielen Kreisen der Suchthilfe geht man von einer mehrstufigen Behandlungskette zur Behandlung von Menschen mit Alkoholproblemen aus. Am Anfang steht eine mehrere Monate dauernde Kontaktphase von unterschiedlicher Dauer und eine Entgiftungsphase, die sich in der Regel über 1-4 Wochen erstreckt. Es folgt eine Entwöhnungsphase über 6- 24 Wochen und schließt mit einer Nachsorgephase, die auch die Beteiligung an einer Selbsthilfegruppe beinhaltet ab. Eine detaillierte Auflistung ist bei Feuerlein (1998) zu finden. Gerade in neuester Zeit setzten psychiatrische Kliniken auf das Konzept des sog. „qualifizierten Entzugs“ (Mann, 1999; Kiefer & Mann, 2007a). Im „qualifizierten Entzug“ finden einerseits eine differenzierte Diagnostik, die Behandlung der Entzugssymptome und der körperlichen Begleit- und Folgeerkrankungen statt. Andererseits weisen die Patienten in diesem Stadium eine gute Voraussetzung für den Aufbau von Motivation bzgl. der Abstinenz und Veränderungsmotivation hinsichtlich der der Lebensführung auf. Somit werden zeitgleich mit den körperlichen Entgiftung psychotherapeutische Verfahren (z. B. Motivational Interviewing, Miller & Rollnik, 1999) eingesetzt. Nach Mann (1999) weist der rein körperliche Entzug ohne Motivationsarbeit eine hohe Rückfallrate auf und mündet nur in wenigen Fällen in eine weiterführende Behandlung. Neben dem „qualifizierten Entzug“ hat sich die o.g. Behandlungsabfolge bei einer Vielzahl von chronisch Abhängigen bewährt und wird als Pfeiler gewachsener Suchtbehandlung in Deutschland gesehen (Kruse etal., 2000). Jedoch wird von Kraus und Bauernfeind (1998) kritisch angemerkt, dass zwei größere Patientengruppen von diesem Behandlungsweg wenig profitieren: 18 - Personen, die riskanten, missbräuchlichen oder abhängigen Alkoholkonsum betreiben, deren somatische, soziale und psychische Alkoholfolgeschäden jedoch noch nicht das Ausmaß einer beruflichen oder sozialen Unzulänglichkeit erreicht haben. - Personen, die aufgrund langjähriger und schwerer Abhängigkeit nicht im Stande sind, das Mehrphasenprogramm zu durchlaufen. Die Betroffenen dieser Patientengruppe werden häufig und Soziotherapeutischen Wohnheimen behandelt und betreut. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Therapie der Abhängigkeit in den letzen Jahren differenzierter wurde. Die Vielzahl unterschiedlicher psychotherapeutischer Techniken und Behandlungsinhalte sowie ihre phasenspezifische Anwendung werden in dieser Arbeit nicht vorgestellt. Eine Übersicht über Prinzipien einzelner psychotherapeutischer Verfahren gibt Scherbaum (1999). Auch durch neue Einsichten in die Rolle biologischer Faktoren ist die Behandlung vielschichtiger geworden. Die traditionelle Trias von Psychotherapie, sozialpädagogischen Maßnahmen und Unterstützung durch Teilnahme an Selbsthilfegruppen wurde durch medikamentöse Therapiestrategien ergänzt (Scherbaum, 1999). 2.4.2 Früh- und Kurzintervention, Motivation Wie oben dargestellt, erreicht der klassische Weg der Suchtbehandlung nicht alle Personengruppen, bei denen Interventionen angebracht wären. Die Früh- und Kurzinterventionen zielen auf das Stadium einer noch nicht schweren bzw. chronifizierten Suchtentwicklung ab, um die Ausbildung oder Verfestigung einer Abhängigkeit zu stoppen (Sekundärprävention) und intensivere und somit teurere Behandlungsmaßnahmen abzuwenden. Kritisch festzustellen ist, dass die Begriffe Früh- und Kurzintervention sehr „breit“ verwendet werden. Barbor (1994) zit. n. Ennenbach (2006) definiert die Kurzinterventionen wie folgt: Definition von Kurzintervention nach Barbor (1994) • Minimal interventions (einmalige Intervention von bis zu fünf Minuten) • Brief interventions (maximal drei Sitzungen, jeweils bis 60 Minuten) • Moderate interventions (fünf bis sieben Sitzungen) • Intensive interventions (acht oder mehr Sitzungen) Kruse et al. (2000) geben an, dass sich eine Intervention zwischen einem fünfminütigen Ratschlag und vier Stunden sorgfältig geplanter Einzeltherapie unterscheiden können. Genauere Untersuchungen hinsichtlich notwendiger Dauer, Bestandteile und Zielgruppen stehen somit noch aus. 19 John et al. (1996) und Hapke et al. (2002) geben an, dass im deutschsprachigen Raum besonders die Motivationsarbeit in engem Zusammenhang mit den Kurz- und Frühinterventionen zu beachten sind. In diesem Kontext lassen sich sechs Charakteristika bzgl. des Alkoholmissbrauchs im Sinne der Sekundärprävention nennen (John et al., 1996): 1. Die Intervention setzt im Verlauf möglichst früh ein im Sinne eines Stadiums kognitiver Bearbeitung der Probleme. Der Patient kann bereits einen langen manifesten Verlauf aufweisen, aber keinerlei Änderung seines Konsums wünschen. 2. Es handelt sich um Kurzinterventionen, die bis zu dreiwöchiger stationärer Behandlung reichen können. 3. Die Initiative liegt beim Berater. Sekundärprävention erfordert ein aktives Zugehen auf den Betroffenen. 4. Wesentliches Wirkgefüge ist die Motivationsarbeit hinsichtlich des Ziels der Veränderung des Betroffenen. 5. Die Berater–Klienten-Interaktion ist durch eine verstehende, anfangs nicht konfrontierende Haltung des Beraters gekennzeichnet. Er achtet zunächst auf die Herstellung einer Beziehung, die Einstellungsänderungen ermöglicht. 6. Ziel der Intervention ist die Förderung der Aktivität in der Auseinandersetzung mit der Alkoholabhängigkeit auf Seiten des Patienten. Die Intervention kann auch auf die Eingrenzung von substanzbezogenen Problemen gerichtet sein. Im Sinne des Wirkungsgefüges der Motivationsarbeit wird das Phasenmodell der Veränderungsbereitschaft nach Prochaska und DiClemente (1986), im Folgenden nach Wetterling und Veltrup (1997) skizziert (vgl. Behandlungskonzept Kapitel „Zugangsvoraussetzung“). Dieses Modell hat sich in der Praxis bewährt und ordnet die aktuelle Veränderungsbereitschaft des Betroffenen einer von vier Phasen zu: 1. Vorahnung (precontemplation): Beginnendes Problembewusstsein, noch keine weitergehende Motivation 2. Einsichtsphase (contemplation): Entwicklung eines adäquaten Krankheitskonzeptes, noch keine Behandlungsmotivation 3. Handlungsphase (action): Planung konkreter Schritte zur Behandlung 4. Aufrechterhaltung (maintenance): Sicherung des Therapieergebnisses Erfolgt nach längerer Abstinenz erneutes Trinken wird dies als Rezidivphase (relapse) bezeichnet. 20 Konzepte der Früh- und Kurzinterventionen werden häufig mit der Gesprächs- und Interventionstechnik des Motivational Interviewing (MI) in Verbindung gebracht (Kuhlmann, 2005). Ziel dieser Interventionstechnik ist die Bewältigung von Ambivalenz in Zusammenarbeit mit den Patienten. Sie kann somit eine effektive Grundlage der Frühintervention bieten. Eine Metaanalyse (Kremer, 2003) belegt eine hinreichende Evidenz von MI- Kurzinterventionen im Vergleich zu Kontrollgruppen, die keine Intervention erhalten haben. Eine ausführliche Darstellung der Gesprächstechnik bieten Miller und Rollnik (1999). Ein Literaturüberblick gibt Demmel (2001). 2.4.3 Pharmakotherapie In der Fachöffentlichkeit wird einstimmig gefordert, dass die pharmakotherapeutische Behandlung von Alkoholabhängigen immer in Kombination mit Psychotherapie genutzt werden sollte (Wetterling & Veltrup, 1997). Insbesondere für die abstinenzunterstützende Behandlung gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit „Anti-Craving“ Medikamente einzusetzen. Kiefer (2007a) gibt an, dass bei Substanzen mit Wirkung auf das cholinerge, dopaminerge und serotonerge System bisher kein replizierbarer abstinenzerhaltender Effekt gezeigt werden konnte. Erfolge konnten bei dem Glutamatmodulator Acamprosat und dem Opiatantagonist Naltrexon nachgewiesen werden. Zum Beispiel wurde die Wirksamkeit von Acamprosat in 18 placebokontrollierten Studien überprüft (Kiefer, 2007a). Die Metaanalyse der klinischen Studiendaten ergaben einen Anteil an kontinuierlicher Abstinenz nach 6 Monaten von 36,1% unter Acamprosatbehandlung verglichen mit 23,4% unter Placebobedingungen. Eine Nischenindikation besteht für das alkoholaversiv wirksame Disulfiram. Detaillierte Beschreibungen zum pharmakotherapeutischen Einsatz bei Alkoholabhängigkeit sowie Wirksamkeitsnachweise liefern u. a. Kiefer (2002), Mann (1999) und Soyka (1997, 1997a). 2.4.4 Effektstudien Die Forderung nach Effektivitätsnachweisen in der Alkoholismustherapie führte in den vergangenen 30 Jahren verstärkt zu klinischen Evaluationsstudien. Die Studien zum Therapieerfolg liefern zum Teil recht unterschiedliche Daten. In Ihrer Übersicht geben Feuerlein et al. (1998) schwankende Werte an: 30% abstinent, 30% gebessert, 30% ungebessert bis zu 50% gebessert, 50% ungebessert. In der bislang größten Psychotherapiestudie zur Untersuchung von Therapieeffekten wurden rund 1800 alkoholkranke Patienten untersucht (Project MATCH Research Group, 1997, im Folgenden zitiert nach Mann (1999). Die Betroffenen wurden initial drei Therapieformen zugeteilt: die 21 Behandlung nach dem Zwölf-Stufen-Programm der Anonymen Alkoholiker, Kognitive Verhaltenstherapie zur Verbesserung von Bewältigungsverhalten und einer Behandlung zur Förderung der Motivation. Das globale Ergebnis war positiv. Es wurde ein hochsignifikanter Anstieg der trinkfreien Tage festgehalten. Wurde doch getrunken, lag der Konsum deutlich niedriger als vor der Behandlung. Zwischen den Therapieformen wurden keine Unterschiede in den Abstinenzraten gefunden. Die Langzeitkatamnesen von stationär entwöhnungsbehandelten Alkoholkranker im deutschsprachigen Raum stellen Mann und Stetter (2002, S. 61) in ihrer Übersicht über Alkoholabstinenzquoten nach stationärer Entwöhnungsbehandlung dar: Behandlung Zeitpunkt der Nachuntersuchung Anzahl der Patienten Abstinenzquote Stationäre LZT (Küfner & Feuerlein, 1989) Stationäre LZT (Zemlin et al., 1999) Stationär/Ambulante Therapie (Mann & Batra, 1993) Stationär/Ambulante Therapie (Mann et al., 19996) Stationäre Entwöhnungsbehandlung 4-6 Monate (21 Kliniken) Stationäre Entwöhnungsbehandlung 6 Monate 6 Wochen stationär 1 Jahr ambulant 6 Wochen stationär 1 Jahr ambulant 6 Monate 1 Jahr 1 Jahr (am Ende der ambulanten Phase) 1 Jahr (am Ende der ambulanten Phase) 1.410 3.060 790 212 67% 60% 68% 67% Die Erfolgsraten bei stationären Entwöhnungsbehandlungen liegen bei 50-70%, wobei mittel- und längerfristig eine stabile Besserung bei 40-50% der Patienten erreicht werden kann (Mann & Stetter, 2002). Ziel jeder Behandlung ist es, die Motivation zum Trinken abzubauen und dies hin zugunsten einer Motivation zur Abstinenz. Dabei spielen die Krankheitseinsicht, die Bereitschaft zur Veränderung und die innere Einstellung zur Ursache der Alkoholabhängigkeit eine große Rolle. Jedoch auch das Ausmaß an Unterstützung oder Angst vor Sanktionen (z.B. Partnerverlust) tragen zur grundlegenden Veränderungsmotivation bei. Dabei können die Veränderungsphasen über längere Zeiträume andauern und unterschiedlichste Stärken annehmen. Potentiell ist zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit für einen Rückfall gegeben was wiederum die schwierige ambivalente motivationale Grundhaltung für den Betroffenen verdeutlicht. 22 3 Depression Ein Grossteil depressiv erkrankter Menschen muss phasenweise stationär in Kliniken behandelt werden. Meist sind es dann ein schwer zu behandelnder Verlauf oder das Vorliegen von Selbstverletzungstendenzen, die einen Klinkaufenthalt erforderlich machen. Aber auch chronische Verläufe werden in Kliniken behandelt, wobei die stationäre Behandlung in der Regel zehn Wochen kaum übersteigt (Schaub et al., 2006). Demgegenüber bestehen verschiedene Behandlungskomponenten, die eine effiziente und patientengerechte Therapie ermöglichen. 3.1 Störungsbild Depression Depressive Störungen sind zunächst durch das Erscheinungsbild depressiver Verstimmung geprägt. Der Terminus „Depression“ leitet sich vom lateinischen „deprimere“ (herunterdrücken, niederdrücken) ab. Depressive Erkrankungen gehören zu der Gruppe der affektiven Störungen, die insgesamt von Stimmungs- und Krankheitsverlauf sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen können (Schaub et al., 2006). Bei der Art der affektiven Störung kann es sich um unipolare oder bipolare Störungen (Depression/ Manie) handeln. Im Folgenden werden hauptsächlich die unipolaren Erkrankungen betrachtet. 3.1.1 Klassifikation Die gebräuchlichen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV (siehe Kapitel 2.1.2) gehen nicht auf ein ätiologisches Konzept einer Depressionsform ein, sondern definieren sich ausschließlich syndromal anhand der Symptomatik (Bramsfeld et al., 2006). Das bedeutet, es wird auf die früher üblichen Modelle wie endogen, neurotisch, reaktiv, autonom etc. verzichtet. Berger (2004) gibt an, dass Begriffe wie Endogenität oder Neurose ätiopathogenetische Vorstellungen implizierten, die zwischen Ländern, Schulen und Kliniken unterschiedlich waren und sich durch empirische Untersuchungen nicht belegen ließen. Somit stellte der Verzicht auf diese Termini eine Voraussetzung für eine internationale Vergleichbarkeit dar. Depressionen und Dysthymien werden im DSM-IV unter dem Begriff Mood-Disorders (Stimmungserkrankung) aufgeführt, während sie im ICD-10 unter affektiven Störungen subsumiert werden. Beiden oben genannten Klassifikationssystemen gemeinsam ist die weitgehende Verpflichtung zur deskriptiven, auf wissenschaftlicher Evidenz basierender Diagnostik. In Deutschland ist das verbindliche kategoriale Diagnosesystem der ICD-10, somit wird im Folgenden zur Darstellung der diagnostischen Kriterien nur Bezug auf den ICD-10 genommen. 23 Klassifikation affektiver Störungen (F30-F39 ICD-10) F 30 Manische Episode F 31 Bipolare Störung hypomanische Episode/ manische Episode mit/ ohne psychotischen Symptomen F 32 Depressive Episode mit/ ohne somatischen Symptomen mit/ ohne psychotischen Symptomen F 33 Rezidivierende depressive Störung mit/ ohne somatischen Symptomen mit/ ohne psychotischen Symptomen F 34 Anhaltende affektive Störung F 34.01 Zyklothymia (bipolar) F 34.02 Dysthymia (unipolar) F 38 Sonstige affektive Störung F 39 Nicht näher bezeichnete affektive Störung Die oben dargestellte Tabelle fasst einige affektiven Störungen, verschlüsselt als F3 Störungsgruppe des ICD-10, zusammen. 3.1.2 Diagnostische Kriterien Folgend werden die diagnostischen Kriterien einer Depression nach dem ICD-10 dargestellt. Definition gestörter affektiver Episoden: Depressionen werden durch eine Anzahl an gleichzeitig vorhandenen Symptomen, die über eine bestimmte Zeit andauern müssen und nicht durch andere Erkrankungen erklärbar sind, definiert. Einteilung nach Schweregrad Definition Leichte Episode Gleichzeitiges Vorhandensein von 4-5 der untern aufgelisteten Symptome Mittelschwere Episode Gleichzeitiges Vorhandensein von 6-7 der unten aufgelisteten Symptome Schwere Episode Gleichzeitiges Vorhandensein von 8 oder mehr der unten aufgelisteten Symptome Der Schweregrad einer Depression wird somit in leichte, mittelschwere und schwere Episoden unterteilt. Aufgrund der für diese Arbeit ausgewählten Patientengruppe der unipolar Erkrankten werden die diagnostischen Kriterien unipolar affektiver Störungen nach ICD-10 aufgeführt. Die Diagnose erfordert das Vorhandensein von mind. 5 der folgenden Symptome gleichzeitig während eines Zeitraumes von mindestens zwei Wochen, wobei depressive Stimmung oder Interessenverlust zwingend vorhanden sein müssen (Hautzinger, 2003). 24 Depressive Episode (F32 ICD-10) 1. Depressive Stimmung in einem für den Betroffenen deutlichen abnormen Ausmaß, die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag, weitgehend unbeeinflusst durch äußere Umstände mindestens zwei Wochen anhaltend. 2. Verlust von Interesse oder Freude an Aktivitäten, die normalerweise angenehm sind. 3. Verminderter Antrieb oder erhöhte Ermüdbarkeit. 4. Verlust von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 5. Unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte und unangemessene Schuldgefühle. 6. Wiederkehrende Gedanken an den Tod oder Suizid oder suizidales Verhalten. 7. Anzeichen für vermindertes Denk- oder Konzentrationsvermögen wie Unentschlossenheit oder Unschlüssigkeit. 8. Änderung der psychomotorischen Aktivität mit Agitiertheit oder Hemmung. 9. Schlafstörungen jeder Art. 10. Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung. Falls eine depressive Episode oder eine rezidivierende depressive Störung nach oben genannten Kriterien vorliegt, ist abzuklären, ob zusätzlich die diagnostischen Kriterien für ein „Somatisches Syndrom“ erfüllt sind. Hier müssen mindestens vier der acht Merkmale zutreffen. Somatisches Syndrom einer depressiven Episode 1. Verlust von Interesse oder Freude an Aktivitäten, die normalerweise angenehm sind. 2. Mangelnde Fähigkeit, emotional auf Ereignisse oder Aktivitäten zu reagieren, auf die normalerweise eine emotionale Reaktion erfolgt. 3. Frühmorgendliches Erwachen zwei Stunden oder mehr vor der gewohnten Zeit. 4. Morgentief der Depression. 5. Objektive Hinweise für ausgeprägte psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit. 6. Deutlicher Appetitverlust. 7. Gewichtsverlust (5% oder mehr im vergangenen Monat). 8. Deutlicher Libidoverlust. Ein etwas leichterer, dafür aber jedoch länger andauernder depressiver Verlauf wird mit einer Dysthymie beschrieben. Für die Diagnose einer Dysthymia müssen drei der elf Merkmale vorhanden sein. Als Merkmal besteht eine anhaltende oder häufig wiederkehrende depressive Stimmung für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 25 Dysthymia (F34.1 ICD-10) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Verminderte Energie oder Aktivität. Schlafstörung. Verlust des Selbstvertrauens oder Gefühl von Unzulänglichkeit. Konzentrationsschwierigkeiten. Häufiges Weinen. Verlust von Interesse oder Freude an sexuellen oder anderen Aktivitäten. Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Erkennbares Unvermögen, mit den Routine-Anforderungen des täglichen Lebens fertig zu werden. Pessimismus bezüglich der Zukunft oder Grübeln über die Vergangenheit. Sozialer Rückzug. Verminderte Gesprächigkeit. Liegt eine deutlich depressive Symptomatik vor, ohne dass die oben beschriebenen Kategorien zur Anwendung kommen, kann als Restkategorie eine nicht näher bezeichnete affektive Störung (F39 ICD-10) diagnostiziert werden. Stehen depressiven Symptome in engem Zusammenhang mit dem Tod einer nahestehenden Person, gilt dies als sozial erwartete und normal angesehene Reaktion und erhält erst Krankheitswert, wenn die Trauerreaktion über sechs Monate anhält. Differenzialdiagnostisch wichtig zu beachten ist der Ausschluss einer durch körperliche Prozesse provozierten und durch Substanzen induzierten depressiven Störung (Hautzinger, 1998). Ferner ist bei dem Auftreten wahnhafter Symptome die Abgrenzung von schizophrenen bzw. schizoaffektiven Störungen wichtig. Festzuhalten bleibt, dass depressive Syndrome durch eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome gekennzeichnet sind. Charakteristisch ist das gemeinsame Auftreten von körperlichen und psychischen Symptomen (Hautzinger, 2003). Ferner haben die Patienten in unterschiedlichem Ausmaß ein unterschiedlich zusammengesetztes Muster von Symptomen, was wiederum eine sehr sorgfältige Diagnostik erfordert. 3.1.3 Verlauf und Prognose Bei der Mehrzahl der Patienten treten Depressionen als Episoden oder als Phasen auf. Das heißt sie sind selbstlimitierend und können auch ohne therapeutische Maßnahmen wieder abklingen (Berger & van Calker, 2004). Typische Parameter, die neben dem Ersterkrankungsalter in Verlaufstudien ausgewertet wurden sind: Phasenzahl, Phasendauer, Phasenintensität, Dauer und Ausmaß des beschwerdefreien Intervalls, Zykluslänge sowie Zustand während der Indexuntersuchung. Sämtliche Verlaufstudien wiesen eine große interindividuelle Variabilität auf (Hautzinger & Bronisch, 2000). Die Autoren geben an, dass aufgrund der sehr heterogenen und methodisch wenig ver- gleichbaren Befundlage die Prognose depressiver Erkrankungen nur grob geschätzt werden kann. Berger und van Calker (2004) und Hautzinger und Bronisch (2000) ge- 26 hen davon aus, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Patienten soweit gebessert werden, dass sie wieder ihre gewohnte Leistungsfähigkeit besitzen, oft jedoch einzelne Beschwerden weiterbestehen. Entscheidend für die Beurteilung ist die Länge des Katamnesezeitraums. Eine Phase ohne Rückfall von zumindest fünf Jahren fand sich bei knapp 42% der unipolaren Patienten. Eine Chronifizierung der Erkrankung (Minimaldauer der Beschwerden von zwei Jahren) wird bei etwa 10% der unipolaren Patienten gefunden. Die Remissionsverläufe depressiver Erkrankungen zeigen, dass innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten über drei Viertel aller Erkrankungen wieder abgeklungen sind (Schauenburg & Zimmer, 2005). Ca. 50% aller Episoden weisen eine Länge von nur drei Monaten auf. Insbesondere bei einem frühen Krankheitsbeginn und einer unvollständigen Remission der ersten Episode, sowie bei Patienten mit einer ausgeprägten genetischen Belastung ist das Risiko einer ungünstigen Prognose erhöht (Berger & van Calker, 2004). 3.1.4 Diagnostische Instrumente Ergänzend zu den oben dargestellten diagnostischen Kriterien des ICD-10 werden im Folgenden die Instrumente zur klinischen Depressionsdiagnostik vorgestellt. Gut evaluiert und weit verbreitet sind Fremd- und Selbsteinschätzungsinstrumente, die zur Beurteilung der Schwere depressiver Symptomatik beitragen, sowie unterschiedliche klinische Interviews, die zur Informationserhebung dienen. Interviewverfahren Halbstandardisierte und standardisierte Interviews erlauben es objektiv und reliabel festzustellen, ob die in den Diagnosesystemen definierten Symptome vorhanden sind. Gebräuchliche Interviews sind nach Hautzinger (1998): Diagnostische Instrumente/ Interviewverfahren • • • Strukturiertes Interview für DSM-IV (SKID-I und SKID-II) (Wittchen et al., 1997) Diagnostisches Interview bei Psychischen Störungen (DIPS) (Margraf & Schneider, 1994) Diagnostisches Expertensystem für psychische Störungen (DIA-X) (Wittchen & Pfister, 1997) Während der DIPS und DIA-X im klinischen Alltag weniger eingesetzt werden, ist nach Hautzinger (2003) das „Strukturiertes Interview für DSM-IV“ (SKID) im klinischen Rahmen gut einsetzbar. Es ermöglicht die Bestimmung von 43 diagnostischen Kategorien sowie die Beurteilung des Schweregrades einer Störung. Das Interview beginnt mit einem kurzen Explorationsleitfaden, welcher einen Überblick über die Lebenssituation sowie die Problematik des Betroffenen gibt. Die neun aufgegliederten Abschnitte reichen von affektiven Störungen über substanzabhängige Störungen bis zu Anpassungsstörungen. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der gesamte Ablauf der Infor- 27 mationsgewinnung vorstrukturiert ist und somit eine valide Diagnosestellung ermöglicht. Nach Schaub et al. (2006) besteht ein Nachteil darin, dass die Durchführung sehr zeitaufwändig ist und für den Patienten (und auch für den Diagnostiker) eine Belastung darstellen kann. Verfahren zur Selbst- und Fremdbeurteilung Die international am meisten verbreiteten Skalen zur Messung der Schwere einer Depression sind das Beck-Depressions-Inventar (BDI) (Hautzinger, Bailer, Worall & Keller, 1995) und die Hamilton-Depressions-Skala (HAMD). Der HAMD gilt heute als das klassische Fremdbeurteilungsinstrument der Schwere depressiver Symptome. Nach Schaub et al. (2006) eignet sich das Instrument besonders gut zur Verlaufskontrolle und bietet für die Forschung gut vergleichbare Ergebnisse. Ebenfalls zur guten Verlaufskontrolle geeignet ist der BDI (Selbstbeurteilungsbogen). In Durchführung und Auswertung sehr zeitökonomisch wird er in klinischen Zusammenhängen zur Erfassung des Schweregrads einer depressiven Symptomatik innerhalb der vergangenen Woche eingesetzt. Die Allgemeine Depressionsskala (ADS) (Hautzinger & Bailer, 2003) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, welche das Vorhandensein der Beeinträchtigung durch depressive Affekte, körperliche Beschwerden, motorischen Hemmungen und negative Denkmuster erfasst. Das Instrument lässt sich gut wöchentlich oder monatlich während einer Behandlungsphase und somit zur Verlaufsbeobachtung einsetzen (Hautzinger, 2003). 3.1.5 Suizidalität Die größte Risikogruppe für suizidale Handlungen bildet die Gruppe der psychisch erkrankten Menschen. An erster Stelle stehen hier die Betroffenen mit depressiven Episoden. Wolfersdorf (2006) errechnete eine Lebenszeitsuizidmortalität von 4,3% für depressive Episoden nach ICD-10. Bei depressiven Episoden ist die Suizidmortalität um das 21–fache und bei der Dysthymia um das 11,9 – fache gegenüber der Allgemeinbevölkerung erhöht (Wolfersdorf 2006 bezieht sich auf Harris & Barraclough 1998). Weiterhin gibt der Autor an: - Etwa 60-70% aller akut depressiv Kranken haben Suizidideen und ca. 10% akute Suizidabsichten. - Der Anteil depressiv Kranker mit Suizidalität in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie liegt bei etwa 40-50%. Von allen Suizidgefährdeten versterben innerhalb der Klink ca. 5-10% wobei der Anteil der Depressiven an den Kliniksuiziden nur bei ca. 25% liegt. 28 Die Häufigkeiten belegen, dass der Suizidprävention eine der wichtigsten Aufgaben in der Diagnostik, Therapie und Langzeitbehandlung depressiv erkrankter Menschen zukommt. 3.2 Epidemiologie Obwohl sich ein wachsendes Interesse an der gesundheitspolitischen Relevanz affektiver Störungen, insbesondere der depressiven Erkrankungen, in einer Reihe repräsentativer epidemiologischen Studien niederschlug, sind die epidemiologischen Angaben in der Literatur breit gestreut. Nach Wittchen und Jacobi (2006) stiftet der Begriff der Depression sehr viel Konfusion, was nach Ansichten der Autoren nicht daran liegt, dass die diagnostischen Kriterien nicht trennscharf sind, sondern dass sie in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt sind. Termini wie „depressiv“ oder „Depression“ sind kein verlässlicher Ausdruck für eine „behandlungsbedürftige psychische Störung“, sondern lediglich „Platzhalter“ für viele Formen von negativen Befindlichkeiten. Exakte Angaben zur Inzidenz und Prävalenz sind zusätzlich dadurch erschwert, dass unterschiedliche Diagnosesysteme und Untersuchungsverfahren angewendet wurden. Nach Berger und van Calker (2004) stellen jedoch die Depressionen neben den Angststörungen eindeutig die häufigsten psychischen Erkrankungen dar. Dabei ist die unipolare Depression mit 65% die häufigste affektive Störung (Schaub et al., 2006), wobei Frauen doppelt so häufig erkranken wie Männer. Die nun im Folgenden dargestellten Prävalenzzahlen beziehen sich im Wesentlichen auf Wittchen und Jacobi (2006) die auf der Grundlage des Bundesgesundheitssurvey „Psychische Störungen“ von 1998 gebildet wurden. Die Autoren geben an, dass die 12Monats-Prävalenz unipolarer depressiver Störungen (DSM-IV) bei 18-65 jährigen Personen in Deutschland bei 10,9% liegt. Dies entspricht einer Zahl zwischen fünf und sechs Millionen Menschen. Wie oben bereits erwähnt sind Frauen mit 14,2% in allen Altersgruppen ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer (7,6%). Der Geschlechtsunterschied fällt in der Gruppe der 18-29 jährigen deutlich geringer aus (11,4%: 7,5%) als in den höheren Altersgruppen. Die höchsten Werte ergeben sich für die Gruppe der 40-65 jähriger Frauen (16,6%). Der Anteil rezidivierender Depressionen ist bei Frauen aller Altersgruppen größer (6,1%) als derer mit einzelnen depressiven Episoden (5,1%). Dieses Verhältnis ist bei Männern genau umgekehrt (3,4%: 2%). Zusammen mit der höheren Prävalenz für die Dysthymie (Frauen 5,8%, Männer 3,2%) belegen Wittchen und Jacobi (2006), dass Frauen nicht nur häufiger an einer Major Depression erkranken, sondern auch häufiger wiederholte Episoden und auch chronische depressive Syndrome durchmachen. Ferner geben die Autoren an, dass Depressionen in der Mehrzahl episodische Erkrankungen mit einem rezidivierenden Verlauf 29 sind. Bei etwa 60-75% aller Betroffenen ist davon auszugehen, dass nach einer ersten depressiven Episode mindestens eine weitere folgt. Im Mittel werden bei rezidivierenden Depressionen sechs Episoden über die Lebensdauer angegeben. Die Episodendauer ist höchst variabel und liegt bei der Hälfte aller Betroffenen unter 12 Wochen, in 25% bei 3-6 Monaten und bei 22% bei mehr als einem Jahr, wobei letzteres in etwa den Schätzungen chronischer Depressionen im Gesamtkollektiv entspricht. Die 12Monats- Prävalenz rezidivierender Depressionen beträgt 6%, die der chronischen Depressionen mit einer Dauer von über 12 Monaten 3%. Die Schwere der depressiven Phasen wird als variabel angegeben; in der Mehrzahl werden die Episoden aufgrund der Symptomzahl und Schwere als mittelschwer bis schwer klassifiziert. Das mittlere Ersterkrankungsalter geben die Autoren mit 31 Jahren an. Berger und van Calker (2004) gehen von einer Erstmanifestation depressiver Erkrankungen vor dem 40. Lebensjahr aus. Im höheren Lebensalter, d.h. über 65 Jahre, nimmt die Wahrscheinlichkeit der erstmaligen Manifestation einer depressiven Störung ab; nur 10% der Betroffenen erkranken zum erstem Mal nach dem 60. Lebensjahr. Die Inzidenzschätzungen für die Diagnose einer depressiven Episode liegen nach Hautzinger (2003) bei ein bis zwei Neuerkrankungen auf 100 Personen. Ferner gibt der Autor an, dass die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken bei Frauen bis zu 26% und bei Männern bei bis zu 12% liegt. 3.3 Ätiologie Generell wird in der Literatur zur Ätiologie der Depression angegeben, dass alle monokausalen Erklärungsversuche heute als unzureichend angesehen werden. Die Entstehung und Aufrechterhaltung affektiver Erkrankungen wird meist anhand multifaktorieller Modelle erklärt. Berger und van Calker (2004) stellen fest, dass das Wissen um die Ätiologie, einschließlich Pathochemie, Pathophysiologie, Psychodynamik, Lerngeschichte und Soziagenese lückenhaft ist. Dennoch haben die monokausalen Theorien einen heuristischen Wert, denn sie tragen zur Entwicklung einer geeigneten Behandlungsform bei. 3.3.1 Genetik und Neurobiologie Heute gilt als eindeutig nachgewiesen, dass die genetische Belastung einen entscheidenden Aspekt bei der Entwicklung depressiver Erkrankungen darstellt. Berger und van Calker (2004) erklären, dass aber lediglich die Vulnerabilität vererbt wird, die im Zusammenwirken mit anderen Auslösefaktoren das Auftreten bedingt. Als Auslöser kommen somatische, hormonelle und auch psychosoziale Faktoren in Frage. Die genetischen Konzepte beruhen auf Familien,- Zwillings- und Adoptionsstudien. Das Mor- 30 biditätsrisiko ist bei Angehörigen ersten Grades von unipolar Erkrankten um 15% erhöht. Das Risiko für Kinder zweier affektiv erkrankter Eltern steigt auf ca. 55% (Berger & van Calker, 2004). Hinsichtlich dysthymer Störungen geben die Autoren an, dass die Erkrankungen häufiger bei Angehörigen ersten Grades von Major-DepressionErkrankten auftreten als in der allgemeinen Bevölkerung. Anhand von Längsschnittuntersuchungen mit Zwillingen wird der Einfluss genetischer Faktoren auf 41% und der Einfluss von persönlichen Umweltbedingungen auf 46% bei der Entwicklung von Depressionen geschätzt (Hautzinger, 1998). Dabei besteht keine Einigkeit darüber, wie genau die mögliche genetische Grundlage weitergegeben wird. Die Genetiker arbeiten hierbei mit Verteilungs- und Schwellenmodellen, bei welchen durch Erb- und Umweltfaktoren die Krankheitsanfälligkeit („liability“) determiniert wird. Nach der Neurobiologie haben sich Hypothesen erhärtet, dass neurochemischen Störungen der Reizübertragung und Weiterleitung im Zentralen Nervensystem (ZNS) eine entscheidende Bedeutung für die Entstehung depressiver Erkrankungen zukommt. Im Folgenden werden die Erklärungsansätze (im Wesentlichen nach Schaub et al., 2006) für eine gestörte Neurotransmission nur aufgeführt. Ausführliche Darstellungen geben Berger und van Calker (2004) und Bauer (2004). - Katecholamin-Hypothese. Hier geht man davon aus, dass nicht ein einfacher Mangel an Botenstoffen (Serotonin, Noradrenalin, Dopamin), sondern eine Störung der Balance dieser Botenstoffe eine Depression bedingen kann. - Neuroendokrinologische Hypothesen. Sie beziehen sich vorwiegend auf zwei Achsen. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde (HPA) und die Hypothalamus- Hypophysen-Schilddrüsen (HPT) Achse. Hier wird von einer Hyperaktivität und verminderten Regulationsfähigkeit der HPA-Achse ausgegangen, was zu einem erhöhten Cortisolspiegel führt. Die Folge ist eine verstärkte hormonelle „Stressantwort“ auf belastende Ereignisse. Ob diese Dysregulation eine eigentliche „Ursache“ oder selbst Folge von voraus geschehenen Ereignissen ist, kann heute noch nicht abschließend beantwortet werden (Schaub et al., 2006 bezieht sich auf Aldenhoff, 1997). - Chronobiologische Befunde beschreiben eine Gruppe von Befunden, die jeweils die zeitliche Rhythmik der Ausschüttung verschiedener Hormone zum Inhalt haben. Zum Beispiel fehlt bei Depressiven eine erhöhte TSH- Ausschüttung während des Schlafes und die Rhythmik der Cortisolausschüttung ist verschoben. Charakteristisch für depressive Störungen sind REM - Schlaf Veränderungen, die in einer Verkürzung der REM–Latenz und Verlängerung der ersten REM-Phase sowie einer erhöhten REM- Intensität bestehen (Lieb, 2005). Subsumieren lassen sich dies Störungen unter dem Begriff der „zirkadianen“ 31 Rhythmusstörungen. Jedoch sind dies lediglich Befunde, die im Rahmen depressiver Störungen gefunden wurden. Die eigentlichen auslösenden oder verursachenden Faktoren bleiben ungeklärt. - Die „Saisonalen“ Rhythmusstörungen beziehen sich auf periodische Stimmungswechsel in größeren jahreszeitlichen Zeiträumen. Hier scheinen die Lichtverhältnisse und in deren Folge die Konzentration der Substanz Melatonin bei vulnerablen Personen eine auslösende oder ursächliche Rolle einzunehmen. Licht und soziale Rhythmen (und auch Stress) stellen offensichtlich zentrale Einflussfaktoren für die Ausprägung bzw. der Synchronisation der Rhythmen dar (Schaub et al., 2006 bezieht sich auf Frank & Monk, 1993). 3.3.2 Psychologische und soziologische Erklärungsansätze Theoretisch ist anzunehmen, dass Lebensereignisse als „auslösende Faktoren“ eine depressive Episode hervorrufen können, wobei dies jedoch eine Vulnerabilität für Depressionen voraussetzt. Die auslösenden Faktoren bestimmen, wann eine Depression auftritt, die Vulnerabilitätsfaktoren bestimmen, ob diese Ereignisse eine depressive Wirkung entfalten können (Hautzinger, 1998). Zusätzlich sind symptomformende Faktoren denkbar, die Schwere und Ausprägung einer Depression bestimmen. Hautzinger (2003) bemerkt, dass jedoch auch ca. ein Viertel der depressiven Patienten ohne auslösendes Lebensereignis klinisch auffällig werden. Dies erfordert zusätzlich die Annahme einer „Empfänglichkeit“, worunter sich die latente (biologisch determinierte) Bereitschaft einer Person ausdrückt, aufgrund eines minimalen Anstoßes bzw. interner Veränderungen eine Depression zu entwickeln. Seligmans „Theorie der Erlernten Hilflosigkeit“ (im Folgenden zitiert nach Schaub et al., 2006) stammt ursprünglich aus der experimentellen Tierforschung. Die zentrale Annahme besteht darin, dass ein Mensch lernt, dass sein Verhalten und die daraus folgenden Konsequenzen unabhängig voneinander sind, wenn zuvor die Erfahrung gemacht wurde, bedeutsame Ereignisse nicht beeinflussen oder kontrollieren zu können; d.h. Hilflosigkeit entsteht in Situationen, in denen eine Person erfährt, dass bestimmte negative Erfahrungen sich unbeeinflussbar durch eigenes Verhalten wiederholen. Humanexperimente zeigten folgende, für die Depressionstheorie entscheidende Beobachtung: Wenn Individuen in einer bestimmten Situation Hilflosigkeit und die Unmöglichkeit, Dinge selbst zu steuern, erleben, so resultiert daraus die Erwartung, auch in Zukunft in entsprechenden Situationen keinen Einfluss auf die Situation ausüben zu können (Berger & van Calker, 2004). Hier tritt nun auch das Muster der Kausalattribution hervor. Glaubt eine Person, dass andere Personen an ihrer Stelle die Situation kontrollieren könnten, spricht man von internaler Attribution; d.h. die Hilflosigkeit resultiert aus 32 dem Gefühl persönlichen Versagens. Ist die Person jedoch der Auffassung, dass auch andere Personen in dieser Situation keine Kontrollmöglichkeiten haben, beschreibt dies die externale Attribution. In diesem Sinne beschreibt die Theorie, dass das Gefühl der selbstverschuldeten Hilflosigkeit eine Verminderung des Selbstwertes bedingt und so mit der Gefahr einer depressiven Entwicklung einhergeht. Im psychoanalytisch-psychodynamischen Entstehungsmodell der Depression wird die zentrale Rolle von Verlust-, Verunsicherungs- oder Enttäuschungserlebnissen in der Kindheit besonders betont. Schauenburg (2000, 2007) beschreibt, dass die jeweils unterschiedlichen Verarbeitungsformen des Individuums für die Entwicklung einer Depression bestimmend sind. Der Verlust einer wichtigen Bezugperson oder eines lebensbestimmenden Ideals wird als ätiologischer Moment beschrieben. Jedoch wird hier auch differenziert zwischen normaler Trauerreaktion und der Depression mit Rückzug, Verminderung des Selbstwertgefühls und der Wendung aggressiver Impulse gegen das eigene Selbst. Menschen, die zu Depressionen neigen, weisen nach der psychodynamischen Theorie eine ungenügende Verarbeitung des depressiven Grundkonflikts von Bindungswunsch und Autonomiebestreben auf. 3.3.3 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze Charakteristisch für die verhaltenstherapeutischen Hypothesen zur Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Syndrome ist, dass sie bestimmte Symptomanteile als auslösend und aufrechterhaltend bewerten und deshalb diese auch vorrangig modifizieren. Als auslösend gilt das Verhalten einer Person (z.B. Art und Umfang ihrer Aktivität und Sozialkontakte) als auch ihre Kognition (z.B. Wahrnehmung und Deutung von Ereignissen). Lewinsohn (1979) im Folgenden zitiert nach Hautzinger (1996, 2003) schlug ein verstärkertheoretisches Modell der Depression vor. Die Grundannahmen des Ansatzes lauten: - eine geringe Rate (verhaltenskontingenter) positiver Verstärkung wirkt auslösend für depressives Verhalten (Mangel an positiven Erfahrungen und ein Überwiegen negativer Erfahrungen) und hält die Depression aufrecht. - Die Gesamtmenge positiver Verstärkung ist abhängig von dem Umfang potenziell verstärkender Ereignisse und Aktivitäten, dem Umfang erreichbarer Verstärker sowie dem Verhaltensrepertoire und den Fähigkeiten, Verhalten zu zeigen, das verstärkt werden kann. 33 - Depressives Verhalten wird oftmals aufrechterhalten durch die Art der Verstärkung, die ein Patient kurzfristig durch die (engere) soziale Umwelt erhält, wie Sympathie, Anteilnahme und Hilfe. In dem kognitionstheoretischen Erklärungsmodell nach Beck et al. (1996) postuliert der Autor, dass Depressionen auf gestörten kognitiven Abläufen beruhen. Dass heißt, dass Depressionen auf negativen Denkschemata bezüglich der eigenen Person beruhen. Ebenso beziehen sich die Denkschemata auf die gegenwärtigen und zukünftigen Umwelterfahrungen. So wird die Umwelt selektiv wahrgenommen - und zwar nur bezüglich ihrer negativen Elemente. Die so verzerrte Selbstwahrnehmung und die negative Interpretation von Umwelterfahrungen ist die Ursache für permanente Enttäuschung und Ablehnung. Positive und neutrale Situationen werden durch einen kognitiven Bewertungsprozess negativ getönt. Die im Folgenden aufgelisteten systematischen Denkfehler halten den Glauben des Patienten an die Gültigkeit seiner negativen Konzepte aufrecht (Beck et al., 1996): - Willkürliche Schlussfolgerungen. Sie liegen vor, wenn bestimmte Schlüsse gezogen werden, obwohl es keine Beweise gibt, die diese Schlüsse rechtfertigen. - Selektive Verallgemeinerung. Die Konzentration richtet sich auf ein aus dem Zusammenhang gerissenes Detail. Es werden bedeutsame Situationsmerkmale ignoriert. - Übergeneralisation. Bezeichnet ein Verarbeitungsmuster, bei dem eine allgemeine Regel auf der Basis eines isoliert betrachteten Vorfalles entsteht. Das Konzept wird unterschiedslos auf eine Vielzahl von Situationen angewandt. - Maximierung und Minimierung. Zeigt sich in Fehlern, bei denen die Bedeutung eines Ereignisses so ungenau eingeschätzt wird, dass eine Verzerrung entsteht. - Personalisierung. Bezeichnet die Neigung des Patienten, äußere Ereignisse auf sich zu beziehen, auch wenn es keine Grundlage für einen solchen Zusammenhang gibt. - Dichotomes Denken. Zeigt sich in der Neigung, alle Erfahrungen in eine von zwei sich gegenseitig ausschließende Kategorien einzuordnen. Die Auslösung und Aufrechterhaltung depressiver Episoden erklärt Beck (1996) durch ein Feedback-System. Die unbefriedigende momentane Lebenssituation reaktiviert das Denkschemata, welches in der Vergangenheit im Rahmen von negativen Erfahrungen entwickelt wurde. Damit werden auch die damaligen affektiven Prozesse reaktiviert. Die Affekte wiederum haben einen negativen Einfluss auf die negativen kognitiven Schemata und bestätigen sie scheinbar für den Betroffenen. Diese Wechselwirkung 34 zwischen den kognitiven und affektiven Prozessen haben nach Beck (1996) eine zentrale Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines depressiven Zustandes. 3.3.4 Konsistenztheoretischer Erklärungsansatz Kritisch betrachtet Grawe (2004) die kognitiven Erklärungsansätze zur Entstehung einer Depression. Der Autor postuliert, dass die Bindungstheorien besser zu einem Verständnis der Entstehung von Depressionen beitragen als die Theorie der depressogenen kognitiven Schemata. In seinem konsistenztheoretischen Erklärungsansatz stellt der Autor die Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt. „Unter psychischen Grundbedürfnissen verstehe ich Bedürfnisse, die bei allen Menschen vorhanden sind und deren Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung zu Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen“ (Grawe, 2004 S. 185). Tief in der Beschaffenheit des menschlichen Nervensystems verankerte Grundbedürfnisse nennt der Autor die Bedürfnisse nach Bindung, nach Lust, nach Selbstwerterhöhung und nach Orientierung/Kontrolle/Kohärenz und bezieht sich dabei auf Epstein (1993). Mit dem zentralen Prinzip des psychischen Funktionierens hängt der Begriff der Konsistenz und Konsistenzregulation zusammen. „Der Begriff Konsistenz bezieht sich auf einen Zustand des Organismus. Er meint die Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig ablaufenden neuronalen/psychischen Prozesse“ (Grawe, 2004). Die Konsistenztheorie nimmt an, dass das menschliche Gehirn so beschaffen ist, dass es nach einer Konsistenz der gleichzeitig ablaufenden Prozesse strebt und konsistente Zustände bevorzugt. Demnach sind psychische Störungen der Ausdruck von Inkonsistenzen. Die wichtigsten Formen von Inkonsistenzen sind Diskordanz und Inkongruenz. Diskordanz beschreibt die Nichtvereinbarkeit gleichzeitig aktivierter motivationaler Tendenzen. Inkongruenz beschreibt die Nicht-übereinstimmung der realen Erfahrungen mit den aktivierten motivationalen Zielen (Grawe, 2004). Die konsistenztheoretische Sicht beschreibt Grawe unter engem Bezug auf neuronaler Grundlagen. In seiner Übersicht verschiedener Studien, die den Zusammenhang zwischen spezifischen Bindungsmustern und psychischen Störungen darstellen, belegt er, dass ein unsicherer Bindungsstil als der größte Risikofaktor für die Ausbildung einer Depression anzusehen ist. (Grawe, 2004). 3.3.5 Integrative und multifaktorielle Erklärungsansätze Allen diesen Modellen ist gemeinsam, dass sie biologische und psychosoziale Erklärungshypothesen in einem Modell vereinen und ihr Zusammenwirken in Form von Kausalketten oder Wechselwirkungen beschreiben. Neuere Ansätze wie das „Kindling“, das „Final-Common-Pathway“ oder das „Biologische Narben-Modell“ sind in Schaub et 35 al. (2006) zu finden. Eine detaillierte Beschreibung über ihr eigenes multifaktorielles Modell geben Berger und van Calker (2004). Weitere mehrfaktorielle Modelle (z.B. Hautzinger 1998, 2003) beschreiben die beteiligten psychischen und sozialen Prozesse sowie die Entwicklung hin zu einer Depression. Nach Hautzinger (1998) berücksichtigen diese Modelle wichtige Funktionen, die bedeutende Einflussgrößen bei der Entwicklung depressiver Erkrankungen sind: - genetische und neuroendokrine Prozesse - dispositionelle Faktoren - innerpsychische Mechanismen - soziale und instrumentelle Faktoren - Erkenntnisse aus verändertem Erleben und Erinnern nach aversiven Erfahrungen - 3.4 Kognitive, interaktionelle und behaviorale Faktoren Grundlagen der Behandlung Trotz vieler Unklarheiten und komplexer Befunde bezüglich der Ätiologie affektiver Störungen sind die pharmakologischen, psychotherapeutischen, psychosozialen und physikalischen Behandlungsmöglichkeiten vielfältig und erfolgreich. Typische Empfehlungen für das Zusammenwirken der Therapiezugänge werden in folgender Übersicht nach Hautzinger (1998) dargestellt: Behandlungsansätze bei unipolarer Depression Psychotherapie Pharmakotherapie Physikalische Therapie • Elektrokrampfbehandlung (psychotische, stupuröse Symptomatik) • Schlafentzug (bei Depressionen mit deutlich zirkadianer Rhythmik) • Sport/Bewegung (leicht und mittelschwere Episoden und Depressionen bei körperlicher Erkrankung • Lichttherapie (10 000 Lux) (bei saisonal abhängigen und prämenstruellen depressiven Störungen Psychosoziale Therapie • Sozialarbeit (Hilfe bei der Lösung realer Probleme des psychosozialen Alltags) • Angehörigenarbeit Ergänzung beider Therapien von depressiven Episoden, Dysthymien, Anpassungsstörungen Internistische Therapie • Organisch begründete Depression Die pharmakotherapeutischen und psychotherapeutischen Behandlungen (alleine oder in Kombination) stellen die Hauptinterventionen dar. Die physikalischen, psychosozialen und internistischen Behandlungen sind ergänzende Interventionen oder sind Interventionen mit einer eng abgesteckten Indikation. 36 3.4.1 Allgemeine Therapieprinzipien In der Studie „Depression 2000“ (Wittchen & Pittrow, 2002) folgend zitiert nach Wittchen und Jacobi (2006) wurde folgende Stichtagsprävalenz von depressiven Patienten in Hausarztpraxen herausgearbeitet: 11% der Hausarztpatienten erfüllten am Stichtag die Kriterien eines „major depressiven Syndroms“, drei Viertel (74,1%) dieser Patienten wurden zwar von ihren behandelten Ärzten als „psychisch krank“ klassifiziert, jedoch nur bei knapp jedem zweiten Patient wurde die Diagnose „Depression“ gestellt; die offensichtlich weit verbreitete diagnostische Unsicherheit hatte einen deutlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Patienten, auch eine formal adäquate Therapie zu erhalten. Hier entsteht nun häufig die Frage, ob eine affektive Erkrankung stationär behandelt werden muss. Entscheidungshilfen können hierbei sein: droht Gefahr einer Suizidhandlung, bestehen Wahnideen, ist der Patient alleinstehend, bestehen schwere familiäre Konflikte? Da sich Patienten krankheitsbedingt häufig mit Entscheidungen schwer tun und auch ihre Depression schuldhaft erleben, können sie sich trotz objektiver Notwendigkeit oft nur schwer für eine stationäre Aufnahme entscheiden. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), 2000 hat grundlegende Therapieprinzipien zusammengefasst. Therapieprinzipien nach der DGPPN (2000) • • • Behandlungsziele: Remission der akuten Symptomatik, Vorbeugung von Rückfällen bzw. Wiedererkrankungen. Aufstellung eines Behandlungsplanes, Planung und Integration aller Behandlungsschritte in Absprache mit dem Patienten, eventuell seinen Angehörigen und den beteiligten Berufsgruppen. Wesentlichste Elemente des Behandlungsplanes und des „psychiatrischen Managements“: Therapeutische Bündnis Psychoedukation Vermittlung von Hoffnung und Entlastung Förderung der Compliance Geregelter Ruhe/Aktivitätsrhythmus Kontrolluntersuchungen, Anpassung der Behandlung Entwicklung von Bewältigungsstrategien Verhinderung krankheitsbedingter voreiliger Aktivitäten zur Veränderung der Lebenssituation Ein flexibles und stützendes Vorgehen mit einer empathischen Kontaktaufnahme und dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung hat sich in der Akutbehandlung depressiver Patienten bewährt. Im weiteren Behandlungsverlauf sollte geklärt werden, welche therapeutische Unterstützung der Patient erwartet. Dem sollte eine ausführliche Aufklärung über die vorliegende Krankheit folgen. Die Vermittlung eines medizinischen Krankheitsmodells stellt für mittel und schwer depressive Patienten eine wesentliche Entlastung dar (Berger & van Calker, 2004). Um Erfolgsergebnisse erzielen zu können, sollten im Verlauf weitere erreichbare Ziele gesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, alle Hilfestellungen konkret und spezifisch und nicht abstrakt zu formu- 37 lieren. Ferner ist in der therapeutischen Basisbehandlung die Vermittlung der Notwendigkeit in die medikamentöse Therapie (Compliance) eine wichtige Komponente. Die spezifischen Behandlungsinhalte sind nach den jeweiligen Schulen gerichtet. Eine gute Übersicht über Behandlungsinhalte geben Hoffman und Schauenburg (2000). 3.4.2 Pharmakotherapie Im Verbrauch der wichtigsten Arzneimittelgruppe, der Psychopharmaka, gab es in den letzten Jahren große Veränderungen, dies vor allem in der Gruppe der Tranquilizer, Neuroleptika und Antidepressiva. Nach Glaeske (2006) machten 1992 die Tranquilizer 44% der verordneten Psychopharmakagruppe aus, auf die Neuroleptika entfielen 24% und auf die Antidepressiva 32%. Diese Relation hat sich bis zum Jahr 2003 deutlich gewandelt: Auf die Tranquilizer entfielen nur noch 16%, auf die Neuroleptika weiterhin 23% und auf die Antidepressiva 60%. Damit gehören die Antidepressiva zu der am meisten gewachsenen Gruppe in der Arzneimittelversorgung. Meist werden die Antidepressiva (AD) in vier Gruppen unterteilt (Berger & van Calker, 2004): - Tri- und Tetrazyklische Antidepressiva (TZA) - Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) - Selektive Serotonin- Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) - „atypische Antidepressiva“ ( heterogene Restgruppe mit unterschiedlichen oder unbekannter Wirkmechanismen) Eine detaillierte Beschreibung der pharmakotherapeutischen Wirkmechanismen geben Möller (2000) sowie Berger und van Calker (2004). Fast alle AD bewirken eine Konzentrationserhöhung von Serotonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt. Dies erfolgt entweder durch: - Hemmung der Rückresorption der Neurotransmitter - Hemmung des abbauenden Enzyms (MAO) - Blockade von präsynaptischen Rezeptoren, die eine „Feedback“-Hemmung der Ausschüttung von Neurotransmittern vermitteln. Der Therapieeffekt der AD ist die stimmungsaufhellende und antriebssteigernde Wirkung. Dabei ist bei der Behandlung davon auszugehen, dass zumeist Nebenwirkungen auftreten und sich anschließend die erwünschten Therapieeffekte ausbilden (Möller, 2000). Hautzinger (1998) gibt an, dass durch die langfristige Einname von AD die Rückfallgefahr und das Wiederauftreten unipolarer depressiver Episoden vermindert werden kann. Ohne fortgesetzte Behandlung erleiden knapp 20% aller depressiven Patienten in einem Zeitraum von zwei Jahren keine erneute depressive Episode. Wird die Medi- 38 kation über ein oder mehr Jahre fortgesetzt überstehen 80% der ehemals depressiven Betroffenen diesen Zeitraum ohne Rückfall. 3.4.3 Effektstudien Hautzinger (1998, 2003) gibt an, dass sich in der empirischen Überprüfung die Kognitive Verhaltenstherapie bewährt hat, auch wenn die Effektstudien etwas niedriger als bei den Pharmakotherapien liegen (Grawe (2004). Allerdings ist das Rückfallrisiko bei psychologischen Therapien etwas geringer als bei der Pharmakotherapie (Grawe, 2004). In seiner Vergleichstudie zur Wirkung von Psychotherapie bei unipolarer Depression belegt Hautzinger (2003), dass die Psychotherapien in keiner Studie schlechter als die jeweiligen Vergleichsbedingungen abschnitten. Die kurzfristigen Effekte sind vergleichbar mit den Effekten einer Pharmakotherapie bzw. einer Kombination von Psychotherapie und medikamentöser Therapie. Zwischen den untersuchten Psychotherapieformen ergaben sich kaum Unterschiede. Bei Katamnesen zwischen ein und zwei Jahren schneiden die Psychotherapien meist besser ab als die Pharmakotherapie. Die Gruppe um DeJong et al. (1986) zit. n. Hautzinger (2003) sind bislang die einzigen, die stationär behandelte depressive Patienten in einer Wirksamkeitsstudie der Kognitiven Verhaltenstherapie untersucht haben. Insgesamt zeigte sich dabei, dass Patienten bei kognitiver und auch verhaltenstherapeutischer Intervention die deutlichsten Verbesserungen zeigten. Die weitgehend vergleichbaren Effekte der verschiedenen konzeptualisierten Psychotherapien liegen vor allem darin begründet, so der Autor, dass der konkrete therapeutische Umgang im Handeln in den Psychotherapien Ähnlichkeiten aufwiesen. So ist es insbesondere im Umgang mit depressiven Patienten notwendig, eine Reihe von Interaktions- und Interventionsweisen anzuwenden, damit der therapeutische Zugang und eine positive Veränderung überhaupt gelingen können. Die Ergebnisse dieser Studien sind jedoch sehr kritisch zu bewerten (Grawe, 2004), da hohe Abbruchraten die Effektstärke beschönigen, „Spontanremissionen“ nicht berücksichtigt werden und der Effektstärkenvergleich zwischen pharmakologischen und psychologischen Therapien auf nicht vergleichbaren Grundlagen beruht. 3.4.4 Wahl eines geeigneten Behandlungsverfahrens Eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines Therapieverfahrens spielt die Sichtweise des Patienten. Nach Berger und van Calker (2004) sollte bei einer schweren depressiven Störung eine antidepressive Medikation erfolgen, wenn die Patienten dies wünschen. Auf jeden Fall ist eine begleitende psychotherapeutische Basisbehandlung mit psychoedukativen Aspekten indiziert. Wenn möglich ist der Partner und/ oder die Familie mit einzubeziehen. Wenn Patienten mit leichterer Depression eine medikamen- 39 töse Therapie ablehnen, so die Autoren, ist es gerechtfertigt und erfolgsversprechend, sie ausschließlich psychotherapeutisch zu behandeln. Zur Wahl eines geeigneten Behandlungsverfahrens stellt die DGPPN (2000) in ihren Leitlinien die unten aufgeführten Kriterien auf. Kriterien zur Wahl eines Behandlungsverfahrens (DGPP,2000) Eine Therapie mit einem Antidepressivum muss (auch Monotherapie) immer erfolgen bei: • schwerer depressiver Episode • chronisch depressiver Episode • früherem schlechten Ansprechen auf alleinige Psychotherapie Eine alleinige psychotherapeutische Behandlung ist zu diskutieren bei: • leichter bis mittelschwerer Symptomatik • Kontraindikationen gegen antidepressive Pharmakotherapie • Ablehnung medikamentöser Therapie durch den Patienten Eine Kombinationstherapie sollte erwogen werden bei: • Fehlendem oder partiellem Ansprechen auf alleinige medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung • Dysthymia • Ausgeprägten psychosozialen Problemen • Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Essstörungen, Sucht • Wunsch des Patienten Die meisten Untersuchungen weisen nach Berger und van Calker (2004) darauf hin, dass eine Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie insbesondere im Langzeitverlauf gute Ergebnisse bringen. Eine ausführliche Beschreibung zur Kombination und Interaktion von Psycho- und Pharmakotherapie gibt Kampfhammer (2000). So scheinen sich die Vorteile einer Kombinationsbehandlung vor allem bei komplexen und schwer zu behandelnden depressiven Störungen zu zeigen. Hautzinger (2003) gibt an, dass die Kombinationsbehandlung zu einer erhöhten Akzeptanz der pharmakologischen Behandlung führt, die Klagen über die Nebenwirkungen zurückgehen und weniger Patienten die Behandlung frühzeitig abbrechen. Hingegen belegt Grawe (1994, 2004) in seiner Metaanalyse, dass der zwischenmenschliche Aspekt bei der Behandlung depressiver Patienten von größerer Bedeutung ist, als bisher angenommen wurde. 40 4 Komorbidität von Depression und Alkoholmissbrauch Die Problematik der Komorbidität von psychischen Störungen und Sucht hat in den letzten 15 Jahren zunehmend das klinische und wissenschaftliche Interesse geweckt. Moggi und Donati (2004) zeigten, dass die Zahl wissenschaftlicher Publikationen im letzten Jahrzehnt um das Fünffache angestiegen ist. Einrichtungen des medizinischen und psychosozialen Versorgungssystems sehen sich mit einer steigenden Anzahl Patienten konfrontiert, die sowohl eine Substanzstörung als auch eine psychische Störung aufweisen. Die Zunahme der Patientengruppe, die sowohl eine Depression als auch einen Alkoholmissbrauch aufweisen, wurde auch in unserem klinischen Alltag beobachtet. Dabei entsteht hinsichtlich einer adäquaten Behandlung das Spannungsfeld, einerseits der psychiatrischen Erkrankung und andererseits der Behandlung der Suchtstörung gerecht zu werden. 4.1 Begriffsbestimmung und Diagnostik Mit der Einführung deskriptiver und multiaxialer Klassifikationssysteme psychiatrischer Störungen ICD-10 und DSM-IV (siehe Kapitel 2) wurde es möglich, beim Vorliegen von zwei oder mehreren Syndromen auch mehrere Diagnosen zu stellen. Nach Marneros (2004) ist die gebräuchlichste Definition für Komorbidität „das gemeinsame Auftreten von zwei oder mehreren psychischen Störungen miteinander und/oder mit körperlichen Erkrankungen“. Eine für klinische und epidemiologische Zwecke geeignete Definition von Wittchen & Vossen (2000) bezeichnet: „…das Auftreten von mehr als einer spezifisch diagnostizierbaren psychischen Störung bei einer Person in einem definierten Zeitintervall“. Die Anwendung dieser Definition kann sich auf den Querschnittsbefund, die Längsschnittdiagnostik und ebenso auf die Charakterisierung der gesamten Lebensspanne des Patienten beziehen. Eine allgemein verbindliche Definition hat sich bisher nicht etabliert. Unter dem Begriff „Dualdiagnosen“ oder „Dualstörung“ (engl. „dual diagnosis“) wird oft ein „Spezialfall von Komorbidität“ verstanden. Drake et al. (1994) geben an, dass bisher kein Konsens für eine Bezeichnung speziell für das gleichzeitige Auftreten von psychischer Störung und Substanzmissbrauch gefunden wurde. Moggi und Donati (2004) gehen von dem Begriff der Doppeldiagnose (DD) aus: „Doppeldiagnose bezeichnet das gemeinsame Auftreten eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit von einer oder mehreren psychotropen Substanzen und mindestens einer anderen psychischen Störung bei einem Patienten“. Die Autoren bemerken ferner, dass der Doppeldiagnosebegriff fachlich unabhängig von dem Schweregrad einer Krankheit zu verwenden ist. Die Definition von DD wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Sub- 41 stanzstörungen und psychische Störungen ihrerseits keine einheitlichen Begriffe sind und mehrdimensional erklärt werden. 4.1.1 Klassifikation Vorab werden Aspekte der Klassifikation von Depression und Alkoholismus dargestellt, welche in Kapitel 4.3 näher erläutert werden. Nach chronologischen Aspekten wird zwischen primären (der Alkoholabhängigkeit vorausgehenden) und sekundären (der Alkoholabhängigkeit folgenden) depressiven Syndromen unterschieden (Soyka & Lieb, 2004). Nach kausalen Aspekten wird zwischen vom Alkohol abhängigen und unabhängigen depressiven Syndromen differenziert. 4.1.2 Besonderheiten der Diagnosestellung In Anbetracht des Komorbiditätskonzepts nach den bestehenden Klassifikationssystemen besteht die Möglichkeit, mehrere psychiatrische Diagnosen auf unterschiedliche Aspekte hin zu untersuchen. Es stehen hier zeitliche Beziehung und wechselseitige Einflussnahme hinsichtlich Verlauf, Behandlungsmotivation und Prognose zur Debatte. Wittfoot und Driessen (2000) geben an, dass hinsichtlich der zeitlichen Dimension unterschieden werden kann zwischen: - Simultaner Komorbidität (das gleichzeitige Vorhandensein mehrer Störungen) - Sukzessiver Komorbidität (dem zu unterschiedlichen Zeiten bei einer Person vorkommenden Auftreten verschiedener Störungen) Eine weitere Differenzierung erfolgt durch: - Interne Komorbidität (die vorliegenden Störungen gehören derselben diagnostischen Klasse an) - Externe Komorbidität (das Vorliegen von Störungen aus unterschiedlichen Klassen) Die Autoren geben weiter an, dass die Komorbidität grundsätzlich nicht auf das Vorhandensein von zwei Störungen begrenzt ist. 4.1.3 Alkoholinduzierte affektive Störung im Entzug Das Erkennen von alkoholinduzierten affektiven Störungen stellt eine Schwierigkeit in der Diagnostik dar. Bei abfallendem Alkoholspiegel im Blut, insbesondere nach erhöhtem Alkoholkonsum, kommt es häufig zu einer dysphorischen, depressiven Stimmung. Eine ähnliche Symptomatik, die jedoch wesentlich länger anhalten kann, findet sich im protrahierten Entzug (Wetterling & Veltrup 1997, Dittrich, Haller & Hinterhuber, 2006). Gedrückte Stimmung, geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Nervo- 42 sität gehören unter anderem zu diesem Symptomkomplex. Inwieweit diese relativ unspezifische Symptomatik schon die Diagnose einer Depression rechtfertigt, ist umstritten. Insgesamt ist davon auszugehen, so die Autoren, dass die Diagnose Depression im frühen Entzug oft zu häufig gestellt wird. Sie sollte jedoch nur dann bei Alkoholkranken gestellt werden, wenn die Symptomatik noch mindestens 14 Tage nach Beendigung des Alkoholkonsums eindeutig ausgeprägt ist (Dittrich, Haller & Hinterhuber, 2006 beziehen sich auf Wetterling, 1999). Der Zeitpunkt der frühest möglichen Diagnosestellung wird in der Fachliteratur unterschiedlich diskutiert. So geben Maier et al. (1997) einen Diagnosezeitpunkt bis 4 Wochen, Wetterling und Veltrup (1997) bis zu drei Monate nach dem Entzug an. Hier wird deutlich, dass das Auftreten depressiver Syndrome wesentlich vom Diagnosezeitpunkt abhängt. Nach exzessivem Alkoholkonsum sowie während Entzugsbehandlungen wurden nach Soyka und Lieb (2004) höhere Prävalenzraten festgestellt als während Entwöhnungsbehandlungen und längerer Abstinenz. In einer Studie mit 82 Alkoholabhängigen erfüllten 62% der Patienten vor einer Entzugsbehandlung die diagnostischen Kriterien für eine Major Depression, während nach der Entgiftung nur 13% der Patienten diese Kriterien erfüllten (Soyka & Lieb 2004, zit. nach Davidson, 1995). Nach Soyka und Lieb (2004) ist bezüglich der Klassifikation einer Komorbidität grundsätzlich zu beachten, dass sich eine depressive Symptomatik bei Alkoholabhängigen unter anderem aufgrund unterschiedlicher Ursachen entwickeln kann. Folgende Tabelle gibt einen Überblick. Ursachen depressiver Symptomatik bei Alkoholabhängigkeit • toxisch durch eine primäre Alkoholwirkung • als Folge des Alkoholentzugs • als Ausdruck einer durch länger andauernden Alkoholkonsum verursachten hirnorganischen Störung • als Symptom einer alkoholinduzierten organischen Erkrankung • durch Traumatisierung (reaktiv) • als Reaktion auf psychosoziale Probleme Festzuhalten bleibt, dass für eine geeignete Auswahl der therapeutischen Möglichkeiten die sorgfältige Klassifikation des gleichzeitigen Vorkommens von gegenwärtigem Alkoholmissbrauch /Abhängigkeit und affektiver Störung notwendig ist. Der Differenzierung von substanzinduzierten und substanzunabhängigen Störungen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 4.2 Epidemiologie Generell ist die Komorbititätsrate zwischen unipolarer Depression und Alkoholmissbrauch bzw. Abhängigkeit groß. An einer unipolaren Depression zu leiden verdoppelt 43 das Risiko, ein „Alkoholproblem“ zu entwickeln (Marneros, 2004). Maier et al. (1997) berichten über Prävalenzraten (Vorhandensein einer Depression) von 30%-60% in Populationen von Alkoholabhängigen. Primär depressive Syndrome werden in 2%12%, sekundär depressive Syndrome in 12%-51% verzeichnet. Schwierigkeiten bei der Erfassung ergeben sich bei der Wahl unterschiedlicher Klassifikationssysteme sowie bei der Auswahl der Stichproben und der methodischen Untersuchungsinstrumente. In der umfangreichen amerikanischen „Epidemiological Catchment Area Study (ECA)“ von 1990 zur Erfassung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung zeigte sich, dass 32% der Probanden mit einer affektiven Erkrankung Substanzmissbrauch betrieben. Es zeigte sich insbesondere eine hohe Komorbiditätsrate von affektiven Erkrankungen mit Alkohol- und Drogenmissbrauch (Soyka & Lieb, 2004 beziehen sich auf Regier et al., 1990). Patienten mit einer Dysthymie bzw. einer Major Depression wiesen ein um den Faktor 1,7 bzw. 1,8 erhöhtes Risiko für Alkoholmissbrauch gegenüber der Normalbevölkerung auf. Ebenso konnten in dieser Studie geschlechtsspezifische Unterschiede nachgewiesen werden. Alkoholkranke Männer erfüllten kaum häufiger die Kriterien einer Depression als andere Männer (5% vs. 3%), während alkoholkranke Frauen bedeutend häufiger als die Frauen aus der Normalbevölkerung depressiv waren (19% vs. 7%). Bei Männern ging die Alkoholabhängigkeit in 78% der Fälle der Erstmanifestation einer Depression voraus, hingegen bei Frauen nur in 34% der Fälle. Kessler et al. (1994) im Folgenden zitiert nach Moggi (2005) zeigten bei der National Comorbidity Survey (NCS), dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen depressive Störungen in der Vorgeschichte geeignete Prädiktoren für das Auftreten einer Alkoholabhängigkeit oder Alkoholmissbrach waren (Odds Ratio für Männer 2,67, für Frauen 4,10). Nach der ECA Studie (jeweils Lebenszeitprävalenzen) wiesen 5% der Personen mit einer Major Depression auch einen Alkoholmissbrauch auf (Odds Ratio 0,9), bei einer Dysthymie sind es noch 4,8% (Odds Ratio 0,8). Nach der NCS hingegen wiesen 9,1% der Personen mit einer Major Depression einen Alkoholmissbrauch auf (Odds Ratio 1,0). Mit einer Dysthymie weisen nach der gleichen Studie 8,6% (Odds Ratio 0,9) einen Alkoholmissbrauch auf. So scheint der Zusammenhang zwischen dysthymer Störung und Alkoholmissbrauch geringer zu sein als der Zusammenhang zwischen Major Depression und alkoholbedingter Störung. In der deutschen Studie von Hapke und Rumpf et al. (2002) wurden 4075 Personen einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe untersucht („Transitions in Alcohol Consumption and Smoking“, TACOS). 17% der Gesamtstichprobe gehörten den Gruppen Alkohol-Risikokonsum, Alkoholmissbrauch- und Abhängigkeit an. 60% dieser Alkoholkonsumenten wies mindestens eine zusätzliche psychiatrische Störung auf. Die Wahr- 44 scheinlichkeit, an einer weiteren nicht substanzbezogenen Störung zu erkranken ist für Risikokonsumenten verglichen mit Nicht-Risikokonsumenten um das 1,4-fache erhöht. Bei Personen mit Alkoholmissbrauch im Vergleich mit Nicht-Missbrauchern liegt das Risiko mit einer Odds Ratio bei 1,3. Das Risiko, zusätzlich an einer affektiven Störung erkrankt zu sein, war für Alkohol-Risikokonsumenten um das 1,5-fache erhöht (Bott & Meyer et al., 2002). Das Auftreten depressiver Symptomatik nach langer Abstinenz untersuchten Hasin und Grant (2002) zit. nach Soyka und Lieb (2004). Es wurden 6050 Alkoholkonsumenten auf den Zusammenhang von Alkoholabhängigkeit/Alkoholmissbrauch und späterer depressiver Störung untersucht. Die Probanden hatten innerhalb des letzten Jahres wenig bzw. gar nicht getrunken, nicht geraucht und keine psychotropen Substanzen konsumiert. Das Ergebnis zeigte ein um den Faktor 4 erhöhtes Risiko bei früherer Alkoholabhängigkeit /Alkoholmissbrauch, Episoden einer Major Depression zu entwickeln. Bakken et al. (2003) gehen in ihrer Studie der Frage nach, inwiefern sich Patienten mit primärem und sekundärem Substanzmissbrauch hinsichtlich des Auftretens von substanzinduzierten und substanzunabhängigen Störungen unterschieden. Es wurde festgestellt, dass 90% der Patienten während ihres Lebens zumindest eine substanzunabhängige Störung aufwiesen, 42% zeigten beide Störungsklassen (substanzinduziert und substanzunabhängig) und nur 5% wiesen ausschließlich substanzinduzierte Störungen auf. Die Autoren stellten fest, dass von denjenigen, die eine substanzunabhängige Störung aufwiesen, diese in 76% der Fälle zeitlich eindeutig vor dem Auftreten des Substanzmissbrauchs und in 17 % zeitlich deutlich danach auftrat. Das bedeutet, dass die Mehrzahl der substanzunabhängigen Störungen vor dem Substanzmissbrauch auftreten. Die Autoren zogen daraus die Schlussfolgerung, dass eine adäquate Behandlung der vorausgehenden psychischen Störung viele Patienten vor dem Substanzmissbrauch bewahren könnte. Schaub et al. (2006) bemerken, dass unter Einbezug der Forschungsergebnisse keine generelle Aussage getroffen werden kann, welche Störung die andere bedingt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass jede Störung für sich genommen einen Risikofaktor für die jeweils Andere darstellt und die Verursachung in beide Richtungen erfolgen kann. 4.3 Verlauf und Prognose Moggi (2004) gibt an, dass Patienten mit Doppeldiagnosen oft nicht angemessen behandelt werden und somit einen ungünstigen Verlauf aufweisen. Phasen von Besserung und Verschlechterung wechseln sich oft ab und es kommt wiederholt zu Hospitali- 45 sationen. So werden häufiger und länger ambulante und stationäre Versorgungsangebote im medizinischen und psychosozialen Bereich von Patienten mit Doppeldiagnosen in Anspruch genommen als von Patienten mit nur einer Diagnose. Oft folgt eine Abwechslung in der Behandlung von Substanzstörung und psychischer Störung – ohne dass eine anhaltende Verbesserung des biopsychosozialen Zustandes erreicht wird. Bei Substanzmissbrauch und einer hohen psychopathologischen Belastung suchen Patienten häufig zuerst eine ambulante und erst später eine ärztliche oder psychotherapeutische Einrichtung auf. Meist erhärtet sich im Verlauf der Behandlung der Verdacht auf den Substanzmissbrauch, der den Therapiefortschritt verhindert oder zu wiederholten Therapieabbrüchen führt. Verlauf und Prognose können günstig sein, wenn eine therapeutische Einbindung hinsichtlich beider Störungen gelingt (Lieb & Isensee, 2007, Brodbeck, 2007). Auch Patienten mit einem Substanzmissbrauch und geringer psychopathologischer Belastung weisen eine günstige Prognose auf. Hierbei sind im Verlauf der Behandlung Interventionen in Bezug auf den Missbrauch notwendig, um den Therapiefortschritt nicht zu gefährden. Patienten mit schwerer Substanzstörung und hoher oder auch geringer psychopathologischer Belastung weisen eher einen ungünstigen Verlauf auf. Dies resultiert aus häufigen Therapieabbrüchen, späten Konsultationen des Versorgungssystems und wiederholt erfolglosen Behandlungen (Moggi, 2004 bezieht sich auf Rosenthal & Westreich, 1999). Maier et al. (1999) konstatieren, dass die Komorbidität der Krankheitsbilder unipolare Depression und Alkoholismus eine ungünstige Wirkung auf den Verlauf der affektiven Störung hat. Die Bedeutung auf den Verlauf der Abhängigkeit wird jedoch kontrovers diskutiert. In Studien nach Holdcraft et al. (1998) und Greenfield et al. (1998) zit. n. Lieb und Isenseee (2007) konnte gezeigt werden, dass die Komorbidität von Depression und Alkoholismus mit einem leichteren Verlauf der Alkoholabhängigkeit assoziiert ist. Maier et. al (1999) wiesen nach, dass ein zusätzlich vorhandenes depressives Syndrom bei Alkoholabhängigkeit zum Aufnahmezeitpunkt einer Behandlung die Rückfallgefahr erhöhte bzw. den Zeitraum bis zum erneuten Trinken verkürzte. Ein klinisch erheblich relevantes Problem bei Alkoholismus und komorbiden depressiven Störungen ist die erhöhte Suizidalität (Wittfoof & Driessen, 2000). Für die Suizidrate bei Alkoholikern wurde ein Anstieg von 9,5% auf 17,3% gefunden, wenn zusätzlich eine depressive Störung vorlag. Ferner gaben die Autoren an, dass von 50 suizidierten Alkoholabhängigen 68% die Kriterien für eine Major Depression erfüllten. Auch Hintz et al. (2004) und Marneros (2004) berichten, dass das komorbide Auftreten von Major Depression und Alkoholabhängigkeit die häufigsten Diagnosen bei Personen darstellt, die Suizid verüben. Parallel dazu lässt sich zeigen, dass das Vorliegen einer Alkoholabhängigkeit bei Patienten mit einer depressiven Störung zu einem erheblich größeren 46 Ausmaß von negativem Selbsterleben führt (Wittfoof & Driessen, 2000). Die Autoren leiten daraus ein Modell ab, dem zufolge primäre und sekundäre komorbide depressive Störungen die Hauptrisikofaktoren für Suizidalität bei Alkoholismus sind. Somit käme den Faktoren der belastenden Lebensereignisse und interpersonalen Konflikte eine eher modifizierende Funktion zu: nämlich diejenige einer forcierten Umsetzung suizidaler Impulse. 4.4 Ätiologie In den folgenden Abschnitt werden neben den Modellvorstellungen auch Familienstudien und neurobiologische Aspekte der Komorbidität von Depression und Substanzmissbrauch beschrieben. 4.4.1 Modellvorstellungen von Komorbidität Während in der Fachliteratur zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Substanzstörungen oder affektiven Störungen fundierte Theorien vorliegen, gibt es für die Erklärung der Doppeldiagnosen erst einige, teilweise hypothetische Ätiologiemodelle. Generell ist es akzeptiert, dass monokausale Erklärungsansätze zu kurz greifen (Hintz et al., 2004). Hinsichtlich der Behandlungskonsequenzen geht es grundsätzlich um die Frage der Funktion der psychiatrischen Störung oder psychischen Belastung in Verbindung mit der Substanzstörung. Die nun folgenden vier Modellvorstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf Krausz et al. (2000), Reker und Kremer (2000) und Moggi (2007). Alle Störungsmodelle zu Doppeldiagnosen sind Konzepte, die beschreiben ob, und falls ja – wie eine Störung A mit der Störung B in Beziehung steht. Primäre affektive Erkrankung und sekundäre alkoholbezogene Störung Depressive Patienten schätzen zunächst den euphorisierenden Effekt des Alkohols, ohne die damit verbundene Labilisierung der gesamten Affektlage adäquat einschätzen und steuern zu können. Oft kippt die Stimmung bei steigendem Alkoholspiegel, so dass sich die depressive Symptomatik bis hin zur ausgeprägten Suizidalität verschlechtern kann. Das Einsetzen von Alkohol zur Beseitigung subjektiv als negativ erlebter Affekte kann zu Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit führen. Im Sinne dieser Selbstmedikation nutzen Patienten z.B. auch die schlafanstoßende Wirkung des Alkohols. Eine bestehende primäre psychiatrische Erkrankung erhöht generell das Risiko für ein Missbrauchsverhalten. Die psychopathologisch fassbare Diagnose ist dann nicht nur als ein Risikofaktor für eine sekundäre Abhängigkeitsentwicklung anzusehen, sondern sie beeinflusst auch die Art des Verlaufs sowie die gesamte Symptomatik. 47 Primäre alkoholbezogene Störung und sekundäre affektive Erkrankung Eine primär bestehende Abhängigkeitsproblematik kann zur Entwicklung einer sekundären psychiatrischen Erkrankung beitragen oder diese sogar induzieren. Offensichtlich wird das Störungsbild zunächst während eines Alkoholentzuges. Fortgesetzter Alkoholkonsum kann auf zweierlei Arten zu einer depressiven Symptomatik führen. Einerseits direkt über langfristige Effekte des Ethanols. Zum anderen indirekt über negative psychosoziale und persönliche Konsequenzen (Verschuldung, Vereinsamung, Trennung etc.). Dieser Bereich wird im Rahmen substanzinduzierter Störung diskutiert. Unabhängig voneinander gemeinsam auftretende affektive Erkrankung und alkoholbezogene Störung Als weitere Möglichkeit wird ein gleichzeitiges nebeneinander Vorkommen von psychiatrischer Störung und Subtanzmissbrauch vermutet, wobei keine kausale Beziehung bzw. Wechselwirkung zwischen beiden Störungen angenommen wird. Wenn depressive Störungen einerseits und Alkoholerkrankungen andererseits jeweils mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit auftreten, ist es evident, dass sie in einem gewissen Prozentsatz auch unabhängig voneinander gemeinsam auftreten. Jedoch selbst bei einem zufällig gemeinsamen Auftreten ist im Verlauf mit Wechselwirkungen zu rechnen, die den Gesamtverlauf beeinflussen. Treten Depression und Alkoholismus gemeinsam auf, so lernen diese Patienten den entlastenden Effekt des Alkoholkonsums, aber auch den labilisierenden Effekt des Entzuges kennen und reagieren darauf. Die relative Autonomie der beiden Störungsbilder erkennt man daran, dass eine antidepressive Behandlung zu einem gesteigerten Wohlbefinden des Patienten führt, der Verlauf der Abhängigkeitserkrankung dadurch aber häufig nicht beeinflusst wird. Gemeinsame Ursache der affektiven Erkrankung und alkoholbezogenen Störung Das Modell beschreibt eine gemeinsame Ätiologie beider Störungen. Es wird angenommen, dass Personen z.B. aufgrund eines genetischen Faktors eine Prädisposition für die Entwicklung sowohl einer Abhängigkeitserkrankung als auch einer psychiatrischen Erkrankung besitzen. Dieser Ansatz geht somit von der Annahme einer Störungsentität aus, wobei die alkoholbezogene Störung und die Depression lediglich unterschiedliche Ausprägungen dieser Entität darstellen. Hier wird von der Möglichkeit eines gemeinsamen genetischen Faktors, einer gemeinsamen biologischen Ätiologie oder von psychosozialen Faktoren ausgegangen. 48 Der Modellbildung von der Ursache einer Komorbidität kommt vor allem in der Diagnostik und der Zuführung zu einer geeigneten Behandlung eine wichtige Rolle zu, denn hier wird die komplexe und wechselseitige Kausalität offensichtlich dargelegt. 4.4.2 Modellvorstellung Depression und Substanzmissbrauch Die Untersuchungsergebnisse zur Ätiologie von Depression und Substanzmissbrauch ergeben ein weit weniger deutliches Bild als z. B. bei der Angststörung (Selbstmedikationshypothese, Teufelskreismodell). Moggi (2004) gibt an, dass die empirisch gefunden Zusammenhänge weniger spezifisch sind und auch durch andere Komorbiditätsformen hervorgerufen werden können. Zum Beispiel treten Angst und depressive Störungen häufig zusammen auf, so dass sich das substanzgebundene Suchtverhalten auch aufgrund eines missglückten Selbstmedikationsversuches der Angst entwickeln könnte. Auch der zeitliche Ablauf innerhalb der Komorbiditätsform von depressiver Störung und Alkoholmissbrauch ist nicht eindeutig. Es besteht somit kein integriertes Störungsmodell von Depression und Alkoholmissbrauch. 4.4.3 Ätiologie Depression und Substanzmissbrauch In der Beziehung zwischen Depression und Alkoholabhängigkeit / Alkoholmissbrauch werden in der Literatur unterschiedliche Aspekt in Betracht gezogen. Schuckit (1986) formulierte 5 Thesen über die Zusammenhänge zwischen Alkoholismus und Depressivität: Zusammenhänge zwischen Alkoholismus und Depressivität (Schuckit, 1986) • Alkoholkonsum kann kurzfristig depressive Verstimmungen triggern. • Nach längerem, exzessivem Trinken können depressive Syndrome auftreten. • Der Alkoholkonsum kann während primär affektiven Erkrankungen exazerbieren. • Depressive Syndrome und Suchterkrankungen können bei anderen psychiatrischen Erkrankungen auftreten. • Manche Patienten leiden sowohl an einer affektiven als auch an einer Suchterkrankung. Der Autor gibt dabei an, dass genetische Faktoren, Umweltfaktoren sowie aktuelle und biographische Lebenskonstellationen bei einer kausalen Betrachtung beider Erkrankungen immer mit in Betracht gezogen werden. Marneros (2004) bezieht sich im Folgenden auf Merkingans et al. (1996) und Schuckit (1997). Der Autor gibt in seiner Übersicht an, dass zumindest die Hälfte der unipolaren Depressionen bei Alkoholabhängigkeit hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs sekundär auftreten. Die Gruppe um Schuckit untersuchte retrospektiv ein Kollektiv von 2945 Alkoholkranken. Sie versuchten anhand von symptomatologischen, biographischen und anderen Unterscheidungsmerkmalen das Auftreten der „vom Alkohol unabhängigen“ und der „alkoholinduzierten“ Major Depression zu finden. Sie kamen zu dem Ergebnis, 49 dass die zeitliche Reihenfolge das entscheidende Kriterium ist und bestätigten somit die Primär-Sekundär-Unterscheidung. Dabei wurden keine stabilen psychopathologischen Unterscheidungsmerkmale zwischen primärer und sekundärer Major Depression bei Alkoholabhängigkeit gefunden. Jedoch waren diejenigen mit primärer Major Depression häufiger Frauen, verheiratet, mit weniger Alkoholbehandlungen, mehr Suizidversuchen in der Vorgeschichte und mehr Verwandten mit einer affektiven Störung. Im Verlauf einer Depression und Alkoholismus ist die Behandlung des Alkoholismus ein wichtiger Schritt für die Remission der Depression. In einer Verlaufsuntersuchung von Patienten mit Depression und Alkoholismus (Marneros, 2004 bezieht sich auf Hasin et al., 1996) zeigte sich, dass unabhängig davon, ob die Depression primär oder sekundär war, die Remission des Alkoholismus ein Prädiktor dafür war, dass die Depression remittierte. Umgekehrt war für das Wiederauftreten depressiver Symptome der „Alkoholstatus“ nicht im selben Maße prädiktiv. 4.4.4 Familienstudien Lange Zeit dominierten die Selbstmedikationshypothesen im Bereich der affektiven Erkrankung und des Alkoholmissbauchs. In den letzen Jahren tritt nun zunehmend die Annahme möglicher gemeinsamer prädisponierender Grundlagen in den Vordergrund. Dennoch sind die Ergebnisse uneinheitlich. Maier et al. (1997,1999) berichten über mehrere epidemiologische Studien, bei denen keine Beteiligung familiärer Risikofaktoren für unipolare Depression und Substanzstörung gefunden wurde. Es wurde lediglich eine mäßige Assoziation zwischen vererbbaren Komponenten beider Störungen gefunden (Merkingas et al., 1994 zit. nach Maier, 1997). Auch in Zwillingsstudien zeigte sich nur eine sehr mäßige Überlappung zwischen den genetischen Faktoren, die sowohl für Alkoholismus als auch für unipolare Depression verantwortlich sind. Gleichzeitig wurde auch keine Beteiligung von Umweltfaktoren festgestellt. Hingegen berichten Hintz und Mann (2005) und Hintz et al. (2004) auch von der Annahme gemeinsamer prädisponierender Grundlagen für die Komorbidität affektiver Störungen und Substanzstörungen. Dabei beziehen sie sich auf Pitts und Winokur (1966) und Winokur et al. (1970). Nach der Annahme einer engen Beziehung zwischen Depression und alkoholbezogener Störung wurde das Konzept der „Depressions-Spektrum-Erkrankung“ entwickelt. In dem Konzept repräsentieren affektive und alkoholbezogene Störungen lediglich unterschiedliche Ausprägungen einer genetisch vermittelten Störungsentität. Weitere Adoptionsstudien waren jedoch nicht mit dem Spektrum-Modell vereinbar. So wurden bei Töchtern von Alkoholabhängigen, die bei ihren biologischen Eltern lebten, höhere Depressionswerte als bei ihren adoptierten Schwestern ermittelt. Dies spricht wiederum eher für Umwelteinflüsse (Goodwin et al., 1977 zit. nach Hintz et al., 2004). 50 Generell bestehen uneinheitliche Ergebnisse bezüglich möglicher gemeinsamer Faktoren. Es bestehen jedoch Annahmen, dass möglicherweise unterschiedliche genetische Faktoren unabhängig oder gemeinsam die Prädisposition beider Störungsbilder beeinflussen. Hintz und Mann (2005) konstatieren, dass sich bei komorbiden Patienten hinsichtlich der jeweils vorhandenen Störung ein unvorteilhafter Verlauf abzeichnet. So steht die Komorbidität in Beziehung zur stationären Wiederaufnahme sowohl zur Behandlung der alkoholbezogenen Störung als auch der psychiatrischen Erkrankung, was wiederum zu dem „Drehtürphänomen“ der Psychiatrie beiträgt. Dennoch weisen die Autoren auf die Heterogenität der klinischen Zustandsbilder hin. Swedsen (1998) zit. nach Hintz und Mann (2005) konnten feststellen, dass das Vorliegen einer Depression oftmals nur zu einer moderaten Verschärfung der Alkoholproblematik beiträgt; jedoch eine Alkoholstörung zu einer deutlichen Verschlechterung depressiver Symptome führt. 4.4.5 Neurobiologische Aspekte Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Hintz und Mann (2005) sowie Dittrich et al. (2006). Eine ausführliche Beschreibung neurobiologischer und genetischer Aspekte geben Soyka und Lieb (2004). Der direkte Einfluss des Alkohols auf das cholinerge System scheint bei der Ätiologie von Depression und Alkoholmissbrauch eine entscheidende Rolle zu spielen. Zum einen unterdrückt akute Alkoholintoxikation die Aktivität des cholinergen Systems: langfristig führt chronischer Alkoholkonsum jedoch zu einer kompensatorischen Überfunktion. Somit entsteht eine Dysbalance des Systems, wie sie auch bei depressiven Personen festgestellt wurde. Ein weiterer Aspekt für das gleichzeitige Auftreten von Depression und Alkoholismus scheint eng mit Veränderungen des serotonergen Systems verbunden zu sein. Erniedrigte Serotoninwerte wurden bei depressiven wie bei alkoholkonsumierenden Patienten gefunden. Sowohl aktuell trinkende als auch abstinente alkoholabhängige Patienten zeigten erniedrigte Serotonin-Niveaus, was als Prädiktor zur Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit aufgefasst wird. Da bereits nicht-trinkende Kinder Alkoholabhängiger ein 5-HT-Defizit aufweisen, ist anzunehmen, dass es sich um eine gemeinsame Prädisposition handelt. Wobei ein defizitäres serotonerges System nicht allein depressions- und alkoholismusspezifisch ist, sondern ähnliche Prozesse auch bei Essstörungen, Zwängen oder aggressivem Verhalten beobachtet werden. Auch eine Dysfunktion des Dopaminsystems, die sowohl bei depressiven als auch bei alkoholabhängigen Personen beobachtet wurde, spielt möglicherweise als gemeinsame Ursache beider Störungen eine Rolle. 51 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach neurobiologischen Faktoren eine gemeinsame Ätiologie von Depression und Alkoholismus bestehen kann. 4.5 Behandlungsansätze Traditionell werden in der Therapie von Doppeldiagnosepatienten (DDP) drei Behandlungsmodelle vorgeschlagen: sequenzielle, parallele oder integrierte Behandlungsstrategien. In der Vergangenheit wurde fast immer das sequenzielle Modell praktiziert, was zur Folge hatte, dass Patienten mit Doppeldiagnosen (DD) häufig eine „PingpongBehandlung“ erfahren, indem sie zwischen zwei verschiedenen Behandlungssystemen hin- und herspringen müssen. Eine detaillierte Modellübersicht geben Drake und Mueser (2000). 4.5.1 Traditionelle Modelle Das sequenzielle Modell beschreibt, dass die zwei vorhandenen Störungen nacheinander behandelt werden. Zum Beispiel erfolgt erst das Stabilisieren der affektiven Erkrankung und dann Entwöhnung in einer suchttherapeutischen Einrichtung oder zuerst das Erreichen einer stabilen Abstinenz vom Suchtstoff, dann eine intensive psychiatrische Behandlung. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Forderung einer weitgehenden Remission der einen Störung als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der anderen Behandlung gilt. Dies kann dazu führen, dass Patienten „durch die Maschen“ beider Behandlungssysteme fallen, da sie die jeweiligen Eingangsvoraussetzungen nicht erfüllen (Gouzoulis-Mayfrank, 2003). Demgegenüber hat das parallele Modell durchaus Vorteile. Hier werden beide Störungen gleichzeitig, jedoch in getrennten Institutionen behandelt. Zum Beispiel Teilnahme an einer psychiatrischen Tagesklinik und gleichzeitige Inanspruchnahme von Gesprächen an einer Suchtberatungsstelle. Nach Gouzulis-Mayfrak (2003) besteht hier der Nachteil darin, dass die Betroffenen mit divergierenden Behandlungsphilosophien, Interaktionsstilen und Bewertungen sowie einander widersprechenden Ratschlägen konfrontiert werden. Häufig führen diese Probleme zu einer Verunsicherung der Patienten und können den parallelen Ansatz ähnlich ineffizient machen wie den sequenziellen Ansatz. Das integrierte Modell ermöglicht die Behandlung beider Störungen durch einen Therapeuten bzw. ein Therapeutenteam, welches über Erfahrung und Kompetenz in der Behandlung beider Störungen verfügt. Hierbei sollen die stützend-fürsorglichen Konzepte aus der psychiatrischen Krankenversorgung und die klassischen suchttherapeutischen Ansätze in einer Gratwanderung aneinander angepasst werden. Die Behandlung der psychiatrischen Erkrankung und die Förderung der eigenen Verantwortlichkeit 52 für die Genesung sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Befinden des Patienten flexibel gewichtet werden (Gouzulis-Mayfrak, 2003; Minkoff, 1994). Eine häufige Kontroverse für DDP stellt die Frage nach Abstinenz orientierten oder Abstinenz voraussetzenden Programmen dar (Minkoff, 1994). Es entsteht die Frage, ob Suchtmittelfreiheit als Voraussetzung zur Teilnahme am Programm zu sehen ist oder ob dies als angestrebtes Ziel betrachtet werden sollte. In traditionellen Programmen wird angenommen, dass Behandlungsprogramme ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn Suchtmittelabstinenz nicht zur Voraussetzung gemacht wird. Jedoch wurde auch deutlich, dass die Aufforderung zur Suchtmittelfreiheit gleich zu Beginn für viele Patienten mit DD ein Einlassen auf die Therapie verhindert. So sehen Mischprogramme zur Therapie von DDP die Suchtmittelfreiheit als anzustrebendes Ziel an und ermutigen die Patienten, durch schrittweise Verminderung der Suchtmittelmenge und der Häufigkeit des Suchtmittelgebrauchs, Fortschritte in Richtung dieses Ziels zu machen. Solche Programme können jedoch ungeeignet sein für Patienten, für die eine absolute Suchtmittelfreiheit erforderlich ist. In der Fachliteratur werden Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze diskutiert. Dabei spricht sich die Mehrheit deutlich für einen integrativen Ansatz bzw. für Mischprogramme aus (Drake & Mueser, 2000). Typischerweise gingen die ersten integrativen Behandlungsteams von der Allgemeinpsychiatrie aus, da es offensichtlich leichter ist, die dort bestehenden Konzepte um die Suchtperspektive zu erweitern. Entscheidend für die Vorteile des integrativen Ansatzes ist die Tatsache, dass der Substanzkonsum in allen Therapieaspekten berücksichtigt wird, und keine übertriebenen Heilungserwartungen an den Rückgang psychopathologischer Symptome oder den Abstinenzwunsch gestellt werden. 4.5.2 Pharmakotherapie Eine pharmakologische Behandlung erfolgt zur Linderung der akuten depressiven Symptomatik oder zur Verhinderung einer erneuten Exazerbation. Oftmals ist es erforderlich, die Patienten von der Notwendigkeit der medikamentösen Behandlung zu überzeugen und sie stets zu einer zuverlässigen Medikamenteneinnahme zu motivieren. Pharmakotherapeutisch werden trizyklische Antidepressiva und selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) eingesetzt. Unterschieden wird bei der Gabe zwischen depressiven Symptomen in oder während des Alkoholentzugs und depressiven Symptomen unter mehrwöchiger Alkoholkarenz. Kapfhammer (2004) berichtet von einer besseren Verträglich der SSRI gegenüber den Trizyklika bei alkoholentgifteten Patienten und führt dies auf eine verringerte Toleranz gegenüber bestimmten Nebenwirkungen (Tremor, Schlaflosigkeit) zurück. Generell sollte bei der Gabe von Antide- 53 pressiva bei depressiven alkoholkranken Personen das erhöhte Suizidrisiko beachtet werden. Anticravingsubstanzen und abstinenzunterstützende Medikamente können nach den gleichen Prinzipien wie bei „reinen“ Suchtpatienten gezielt eingesetzt werden, wobei hierzu nur sehr wenige Studien existieren (Gouzoulis-Mayfrank, 2003). Weitere pharmakologische Behandlungsstrategien bei Patienten mit DD gibt Siris (1994). 4.5.3 Spezifische Behandlungskonzepte Neben der Pharmakotherapie werden vor allem Psychoedukation und psychotherapeutische Ansätze in der Behandlung von DDP eingesetzt. Dabei werden häufig die kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätze genannt. Allerdings beziehen sich die meisten in der Literatur beschriebenen Konzepte auf Patienten mit der DD „Psychose und Sucht“. Wurden Behandlungskonzepte für Patienten mit der DD „Depression und Alkoholismus“ vorgestellt, so bezogen sich diese in den meisten Fällen auf Patienten in speziellen Suchtkliniken zum Beispiel in einer Übergangseinrichtung für Alkoholkranke (Zumbeck & Conrad, 2008) oder für Patienten im postakuten Entzug (Roider et al., 2007). Zumbeck und Conrad (2007) entwickelten ein kognitiv- verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm (elf Sitzungen), welches auf Akzeptanz und Wirksamkeit überprüft wurde. Das Programm beinhaltet psychoedukative Elemente sowie kognitivverhaltenstherapeutische Methoden zur Abstinenzmotivationsstärkung und zum Abbau depressiver Denkstrukturen. Die Autoren beschreiben eine Haltequote von 86% und eine im oberen Drittel liegende Einschätzung der Zufriedenheit (Zufriedenheitsskala) der Patienten. Weiter wird von einer Erhöhung der Zuversicht, mit unangenehmen Gefühlen suchtfrei umzugehen sowie über eine funktionalere Selbstaufmerksamkeit als Ergebnis berichtet. Eine Evaluation im Kontrollgruppendesign existiert derzeit noch nicht. Schönell und Closset (2002) beschreiben die Behandlung von Patienten mit Doppeldiagnosen (suchtgebundene Störung und psychiatrische Erkrankung) in der psychiatrischen Regelversorgung anhand einer Schwerpunktstation für komorbide Patienten. Als zentraler Bestandteil dieses Programms wird eine Motivationsgruppe (bis zu 15 Teilnehmer, zwei mal wöchentlich) genannt. Diese Gruppe wurde eingebettet in ein therapeutisches Gesamtprogramm, welches spezifische Probleme für DDP berücksichtigt. Zentraler Bestandteil war dabei das Besprechen von Substanzwirkungen, Wechselwirkungen mit psychopathologischen Syndromen, Konsummuster sowie das Eingehen auf substanzbezogenen Kognitionen (Grundannahmen nach Beck et al., 1997). Die Motivationsgruppe wurde mit einer Gruppe nicht-stoffgebundener Problematiken auf die Latenzzeit bis zur nächsten Wiederaufnahme verglichen und untersucht. Die Auto- 54 ren halten fest, dass sich hinsichtlich der Wiederaufnahmezeiten keine signifikanten Unterschiede gezeigt haben. Somit wird diese Behandlungsform hinsichtlich des Verbleibs außerhalb der Klinik als ebenso effektiv eingeschätzt wie die Standardbehandlung von Patienten ohne Suchtprobleme. Moggi (2004, 2007) beschreibt ein integratives Behandlungsprogramm für Personen mit DD, welches im ambulanten und/oder stationären Rahmen angewandt werden kann. Dabei wird zwischen allgemeinen und spezifischen Interventionsstrategien in unterschieden Therapiephasen unterschieden. Bei einer Anzahl von 30-50 Sitzungen werden Aspekte zur Krankheitseinsicht, Veränderungsmotivation, Verhaltensänderung, sowie Rückfallprävention und Gesundheitsförderung bearbeitet. Diese Behandlungsprinzipien wurden im stationären Suchtmittelentzug für DDP angewandt und evaluiert. Die Ergebnisse zeigten, dass DDP ein Jahr nach dem Aufenthalt in einem ca. vierwöchigen Entzugsprogramm eine signifikant höhere Abstinenzrate, häufiger keine psychiatrischen Symptome, längere Phasen ohne Hospitalisation sowie häufiger ambulante Nachbehandlungen aufwiesen als Patienten in Programmen ohne DD- Orientierung. Ein Behandlungsprogramm für Patienten mit einer Indikation für die Aufnahme auf einer psychosomatischen Abteilung mit gleichzeitigen Alkohol- oder Medikamentenproblemen (keine manifeste Abhängigkeit) wurde von Schuhler und Jahrreiss (1996) entwickelt. Der Studie lag ein Untersuchungsdesign zugrunde, das durch Kontrollgruppenpläne prüfte, ob eine beginnende oder fortgeschrittene Missbrauchsentwicklung zum Stillstand gebracht werden und weiterer Progredienz vorgebeugt werden konnte. Ein indikatives, zwölfstündiges Gruppentrainingsprogramm beinhaltete folgende Aspekte: Funktionalität des Suchtmittelabusus, subjektives Missbrauchsverständnis, Erfassung des Problembewusstseins, depressive Bewältigungsschemata und Stressverarbeitung. Es zeigte sich, dass 81% der an dem Therapieprogramm teilnehmenden Personen das Auslassen des Suchtmittels zur Lebensbewältigung gelang. Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch zu einer signifikanten Rückbildung der komorbiden psychischen Störungen und einem Anwachsen der Stressbewältigungskompetenzen; zusätzlich konnten positive Effekte hinsichtlich des Abbaus der depressiven Verarbeitung erzielt werden (Schuhler, 1998; Schuhler & Baumeister, 1999; Schuhler & Wagner, 2006). De Leon (2005) berichtet von spezifischen therapeutischen Behandlungszentren (Therapeutic Communities) für komorbide Patienten in den USA. Der Autor beschreibt damit eine niederschwellige Behandlungsmöglichkeit vor allem auch für Wohnsitzlose und chronisch mehrfachabhängige komorbide Menschen. 55 Ein spezifisches Konzept zur Behandlung depressiver Patienten mit Suchtproblematik, welches für stationäre psychiatrische Patienten entwickelt und angewandt wurde, konnte in der Literatur nicht gefunden werden. 4.5.4 Effektstudien Folgende Angaben beziehen sich im Wesentlichen auf Viehhauser (2005). Die ersten Studien zu Behandlung von DDP beschränkten sich zunächst auf die Anwendung traditioneller suchtspezifischer Interventionen, was in den 80er Jahren jedoch zu enttäuschenden Ergebnissen führte. Diese Studien beschränkten sich auf die Anwendung traditioneller sichtspezifischer Interventionen (z.B. 12-Schritte-Programm). In den frühen 90er Jahren begann man mit der Entwicklung integrativer Behandlungsprogramme und der systematischen Evaluierung. Trotz methodischer Einschränkungen weisen die Studien gemeinsam darauf hin, dass integrative Behandlungsprogramme effektiv und i.d.R. auch wirksamer sind als nicht integrative Konzepte. In einer groß angelegten Studie von Bartels et al. (1995) wurden insgesamt 148 DDP in einer Follow-up-Studie von 7 Jahren untersucht. Die Remissionsraten von Alkoholmissbrauch/ Abhängigkeit lagen mit 44% in der gleichen Größenordung wie bei „reinen“ Suchtpatienten. Hintz und Mann (2006) zitieren eine Untersuchung von Drake et al. (1998). Die Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass bei DDP mit schwerer psychischer Störung in traditionellen Behandlungen die jährliche Remissionsrate bei weniger als 5% lag, während sie bei vergleichbaren Patienten in integrativen Behandlungen ca. 10-20% betrug. Auch in denjenigen Untersuchungen, die explizit eine integrierte mit einer parallelen, therapeutischen Vorgehensweise verglichen haben, wurde eine signifikante Überlegenheit der integrierten Verfahren gegenüber den parallelen nachgewiesen (Viehhauser, 2005). Moggi (2007) beziehet sich auf Studien von Daley et al. (1998) und Brown et al. (1997), in denen Patienten mit Depression und Substanzabhängigkeit untersucht wurden. Die Gruppe um Delay konnte zeigen, dass durch zur ambulanten Behandlung motivierende Interventionen (nach Miller & Rollnik, 1999) die Therapieteilnahme deutlich verbessert wurde. Die Nutzung der Therapiesitzungen war 100% vs. 41%. Auch die Hospitalisationsdauer ein Jahr nach der Behandlung wurde verringert; im Durchschnitt zwei vs. zwölf Tage. Brown et al. berichteten in einer kontrollierten Studie, dass DDP in einer kognitiv-behavioral orientierten integrativen Behandlung im Vergleich zur Kontrollbedingung (Suchttherapie und Entspannung) eine stärkere Verbesserung der Depressionswerte (Beck Depressions-Inventar) aufwiesen. Die Effektstärken lagen bei 0,89 vs. 0,14. Zudem zeigten die Patienten 6 Monate nach der Behandlung eine höhere Absti- 56 nenzrate (47% vs. 13%) und konsumierten eine geringere Anzahl von „Drinks pro Tag“ (0,5 vs. 5,7). Nach dem bisherigen Forschungsstand wird davon ausgegangen, dass für Patienten mit Doppeldiagnosen gute Fortschritte erzielt werden können und dass im Hinblick auf die zu wählende therapeutische Vorgehensweise die integrative Behandlung eine effektive Methode darstellt. 57 5 Kurzinterventionskonzept Das im folgenden Kapitel vorgestellte Kurzinterventionsprogramm basiert auf den Grundlagen der „Punktabstinenz“ von J. Lindenmeyer (2001). Zentrales Merkmal ist, dass Patienten lernen, ihre kritischen Trinksituationen von unproblematischen zu differenzieren, um nach dem Prinzip der Punktabstinenz (kein Alkohol am ungeeigneten Ort, kein Alkohol zum ungeeigneten Zeitpunkt, kein Alkohol in bestimmten Situationen) das Behandlungsziel festzulegen. Das vorliegende Konzept integriert die bisher zusammengetragenen Erkenntnisse des Themenbereiches der Komorbidität von Depression und Alkoholmissbrauch. Die spezifischen Zusammenhänge zwischen Depression und Alkoholmissbrauch beruhen auf den allgemeinen Störungsmodellen von Moggi (2004). 5.1 Grundlagen des Programms Vor dem Hintergrund des eng miteinander verbundenen Auftretens von Depression und Alkoholmissbrauch entstand die Idee zur Entwicklung eines Behandlungskonzepts speziell für diese Patientengruppe. Im Rahmen der stationären psychiatrischen Behandlung depressiv erkrankter Menschen wurde bislang keine spezifische Behandlungsform angeboten. Lindenmeyer (2001) hält fest, dass Patienten mit einem problematischen Alkoholkonsum aufgrund ihrer psychischen oder physischen Beschwerden häufig Kontakt zum Gesundheitswesen haben. Meist kommt dabei ihre Alkoholproblematik nicht zur Sprache. In der Regel ist somit der Alkoholkonsum kein Gegenstand der Behandlung, vielmehr wird von den Betroffenen und den Behandelnden oft angenommen, dass sich bei erfolgreicher Behandlung der primären Beschwerden der Alkoholmissbrauch von alleine normalisieren wird. In einer beträchtlichen Anzahl der Fälle ist jedoch nicht von einer Besserung der Alkoholproblematik auszugehen. Dabei, so der Autor, würde aufgrund der unten aufgeführten Punkte, eine stationäre Behandlung ein strategisch sehr günstiges Zeitfenster für eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem komorbiden Alkoholmissbrauch darstellen: - Die Patienten sind aufgrund ihres Leidensdrucks besonders empfänglich für Ratschläge von außen. - Die Patienten sind vorübergehend ihrer Trinksituationen und Umgebung entzogen. - Die Einrichtungen verfügen über therapeutisch ausgebildetes Fachpersonal, um den Patienten eine kritische Selbstanalyse ihres Umgangs mit Alkohol zu ermöglichen 58 - Es ist zeitökonomisch und kostengünstig wenn Interventionen im Rahmen einer bereits stattfindenden Behandlung vorgenommen werden. Im Rahmen einer bereits stattfindenden stationären Behandlung, die dem Betroffenen eine aktive Auseinandersetzung mit seinem Erleben und Verhalten ermöglicht, setzt der Grundgedanke dieses Kurzinterventionskonzepts an. Innerhalb des bestehenden therapeutischen Angebots soll dem Patienten die Möglichkeit gegeben werden, sich mit seinem komorbiden Alkoholmissbrauch auseinanderzusetzen und Veränderungen im Erleben und Verhalten anzustoßen. Damit sollen Synergieeffekte des gesamttherapeutischen Angebots effektiver und effizienter genutzt werden. 5.1.1 Wirksamkeit von Kurzinterventionen Kurzinterventionen rücken die pragmatischen Aspekte einer Verhaltensänderung bezüglich des Umgangs mit Suchtmittel (z.B. Reduzierung der Trinkmenge) in den Vordergrund. Am häufigsten werden sie in der medizinischen Basisversorgung (Krankenhäuser, Arztpraxen) eingesetzt. Kurzinterventionen sind Maßnahmen von unterschiedlicher Dauer und Form. Zum Beispiel Kurzberatung (bis zu einer Stunde) und Behandlungen, die über mehrere Stunden gehen können, wobei die Maßnahmen, ambulant, stationär, ergänzend oder als einzige Intervention angeboten werden. Die Gesprächsführung orientiert sich an den personenzentrierten Prinzipien des Motivational Interviewing nach Miller und Rollnick (1999). Dabei finden die Interventionen meist in einem frühen Stadium des problematischen Konsums statt. Die Wirksamkeit von Kurzinterventionen wurde durch eine Metaanalyse bestätigt, die 54 randomisierte und kontrollierte Studien aus den Jahren 1970-1998 berücksichtigt (Kremer, 2003). Vor allem Menschen mit riskantem und missbräuchlichem Konsum von Suchtmittel (Nikotin, Alkohol, Medikamente) konnten von Kurzinterventionen profitieren. Zudem weisen mehrere deutsche Studien darauf hin, dass die zusätzliche Inanspruchnahme anderer unterstützender Maßnahmen (z.B. Suchtberatungsstelle) gesteigert wurde. Weiter gibt Kremer (2003) an, dass von 1993-1999 13 Studien durchgeführt wurden, die sich ausschließlich Kurzinterventionen bei Alkoholproblemen in Hausarztpraxen und Allgemeinkrankenhäusern widmeten. Es konnte in neun Studien positive Effekte im Sinne einer reduzierten Trinkmenge nachgewiesen werden. Schwieriger hingegen erweist sich die nachhaltige Implementierung der Konzepte in Hausarztpraxen sowie in Krankenhäusern im Sinne eines integrierten Versorgungsmodells (Löber & Mann, 2006). 59 5.1.2 Die Institution Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim wurde am 8. April 1975 als Landesstiftung des öffentlichen Rechts mit Mitteln des Bundes, des Landes BadenWürttemberg und der Stiftung Volkswagenwerk errichtet. Seine vier Kliniken mit 246 Betten und 52 tagesklinischen Plätzen gewährleisten die psychiatrische Versorgung der Mannheimer Bevölkerung. Die vier Klinken setzten sich aus der Psychiatrie/Psychotherapie, Suchtmedizin, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammen. Die Psychiatrische Klinik ist unterteilt in sog. Schwerpunktstationen: Krisenintervention/Aufnahme, Intensivstation, Depressionsstation (unipolar/bipolar), Schizophrenie/psychotisches Erleben, beschützte Stationen und gerontopsychiatrische Stationen. Die psychiatrische Station für affektive Erkrankungen besteht aus 24 Betten und wird von einem Oberarzt und zwei Stationsärzten geleitet. Zwei Diplom - Psychologen und ein Diplom - Sozialarbeiter sind der Station angegliedert. Die überwiegende Anzahl des Pflegeteams ist zum Fachpfleger/Fachschwester für Psychiatrie ausgebildet. 5.1.3 Der therapeutische Stationsalltag Das derzeitige therapeutische Stationsprogramm zur Behandlung der affektiven Erkrankung beinhaltet folgende Angebote: Therapeutisches Stationsprogramm Häufigkeit/Leiter Einzelvisiten täglich Arzt/Oberarzt Psychoedukative Gruppen 2-mal wöchentlich Diplom Psychologe Gruppenvisite 2-mal wöchentlich Arzt/Pflegeteam Progressive Muskelrelaxation (Jacobson) 1-mal wöchentlich Pflegeteam Genussgruppe 14-tägig Pflegeteam Bewegungsgruppe 14-tägig Physiotherapeut/Ergotherapeut Schlaftraining nach Bedarf Pflegeteam Arbeitsversuche auf Arbeitsversuchsplätzen, psychosoziale Betreuung nach Bedarf Diplom Sozialarbeiter Soziales Kompetenztraining Ergotherapeut Ergo- und Arbeitstherapie Ergotherapeut Gruppenaktivitäten auf Station, Meetings Pflegeteam In den Einzelvisiten findet die Erhebung des aktuellen psychopathologischen Befundes (Stimmung, Schlafstörungen, Suizidalität etc.) und die aktuelle Medikation durch die Ärzte (Stationsarzt, Oberarzt) statt. Dabei werden psychosoziale Belastungsfaktoren, Planung der Belastungserprobung sowie die Planung möglicher Therapien besprochen. Das Beck-Depressionsinventar (BDI deutsch: Hautzinger et al., 1995) erfasst den Schweregrad einer depressiven Episode. Die Kontrolle durch dieses Selbstbeurtei- 60 lungsinstrument erfolgt 1x wöchentlich. Die Wissensvermittlung grundlegender Zusammenhänge von depressiven Gefühlen, Gedanken und Handlungen findet durch Diplom - Psychologen in Form von psychoedukativen Gruppen statt. Das Aufzeigen von Selbstkontrollstrategien, das Erlernen kognitiver Techniken zur Verminderung negativer Gedanken und Steigerung positiver Gedanken, die Anleitung zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Pflichten und angenehmen Tätigkeiten gehören dabei genauso zu den Themeninhalten wie Zukunftsplanung, persönliche Lebensziele und Umgang mit unvorhersehbaren Lebensereignissen. Zweimal wöchentlich finden vom Arzt geleitete Gruppenvisiten statt. Ein Mitglied vom Pflegeteam ist in der Gruppe anwesend. Inhaltlich werden in den Gruppenvisiten aktuelle Befindlichkeiten besprochen. Es findet mit psychoedukativem Charakter die Vermittlung im Umgang mit Schlafstörungen, depressiven Episoden und Stressbewältigung statt. Sozial kompetente Verhaltensweisen werden eingeübt. In der Progressiven Muskelrelaxation (PMR nach Jacobson) lernen die Patienten die Grundübung des PMR. Dabei erhalten sie Hinweise auf alternative Möglichkeiten im Umgang mit Nervosität, vegetativen Dysregulationen und Schlafstörungen. Die Genuss- und Bewegungsgruppe findet einmal wöchentlich im Wechsel statt. In der Genussgruppe werden die Patient aufgefordert, über Zufriedenheitserlebnisse zu berichten: die Genussregeln und eine Liste mit angenehmen Aktivitäten wird mit den Patienten erarbeitet. Die Förderung von bewusster Wahrnehmung ist ein weiter inhaltlicher Schwerpunkt. Zur Bewegungsgruppe gehören Frühsport, Walking, Wirbelsäulengymnastik und die Benutzung des Kraftraums. Dabei stehen das Körpererleben, die Aktivierung und die Eigenverantwortung für die körperliche Gesundheit im Mittelpunkt. Ein gesundes Verhalten im Umgang mit Schlafstörungen und Schlafhygiene wird im Schlaftraining vermittelt. Geleitet von einer Pflegefachkraft findet es je nach Bedarf statt. Die Überprüfung physischer und psychischer Belastbarkeit im beruflichen Kontext und die Vorbereitung auf eine berufliche Wiedereingliederung durch Arbeitsversuche und Belastungserprobungen organisiert der Diplom - Sozialarbeiter. Dabei finden die Arbeitsversuche auf Arbeitsversuchplätzen in der Kommune statt. Bei Bedarf werden sozialrechtliche Angelegenheiten geklärt und die Patienten erhalten dabei psychosoziale Unterstützung. Das soziale Kompetenztraining hat die Förderung von Kommunikation, sozialen Kompetenzen und Kontaktfähigkeit zum Ziel. Das Beziehungserleben soll verbessert und die Selbst- und Fremdwahrnehmung geschult werden. In der Ergo- und Arbeitstherapie findet handwerkliches und kreatives Arbeiten in den Bereichen Bürotraining, Holzwerkstatt, Druckerei, Soziokreativgruppe, Alltagstraining statt. Ein Hauptanliegen ist die Förderung von Alltagsbewältigung und Anregung für Freizeitgestaltung. Bei den Gruppenaktivitäten auf der Station wird der Gruppenzusammenhalt gefördert und die Aktivität der Patienten gesteigert. Die ge- 61 meinsamen Gruppenaktivitäten und Gruppenbesprechungen (Meetings) dienen vor allem der Verhaltensbeobachtung auf der Station. Bei stabilisiertem Zustand und stabiler Affektlage besteht die Möglichkeit, Patienten zur allmählichen Steigerung der Belastbarkeit, tagsüber oder über Nacht in ihre häusliche Umgebung zu entlassen (Entscheidung des Arztes). Somit begeben sich die Patienten neben dem „beschützten“ stationären Rahmen in Alltagssituationen – wo die Verfügbarkeit von Alkohol gegeben ist. Die häusliche Belastungserprobungen stellen somit eine wichtige Situation für die Zielgruppe dieses Programms dar. Hier können durch die Verfügbarkeit von Alkohol und dem Erleben von möglichen kritischen Situationen erste Erfahrungen von den Patienten gesammelt werden. 5.1.4 Rahmenbedingungen Im Zeitraum von 01.07.2007 bis 30.06.2008 betrug die mittlere Liegedauer auf der Station für affektive Erkrankungen von Patienten der Zielgruppe (unipolare Depression) im Durchschnitt 33 Tage. (Dokumentation M. Lotz, 2008, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit) Diagnose Bezeichnung Tage F32.1 mittelgradig depressive Episode 32,3 F32.2 schwere depressive Episode 42,7 24 F33.1 rezidivierende depressive Episode (mittelgradig) 25,6 63 F33.2 rezidivierende depressive Episode (schwer) 34,2 64 33,0 175 Alle Fälle 24 Um einen kompletten Durchlauf des Programms zu gewährleisten, wird die Mindestzahl der Sitzungen auf zwei bis drei pro Woche mit 50 Minuten angesetzt. Somit ist das Programm zeitlich limitiert. Patienten im akuten Krankheitsstadium sind für die Durchführung des Kurzinterventionsprogramms nicht geeignet. Mit einer Besserung des Zustandes ist nach zwei bis drei Behandlungswochen zu rechnen. Somit kann die Teilnahme an fünf Sitzungen innerhalb der verbleibenden zwei bis drei Behandlungswochen gewährleistet werden. Die Anzahl und die Inhalte der Sitzungen können jedoch an die Belastbarkeit und Mitarbeit des Patienten angepasst werden. Hinsichtlich der Auswahl von Gruppen- oder Einzelsettings wurde das Kurzinterventionskonzept so modifiziert, dass es auf fünf Behandlungskontakte (je nach Mitarbeit und Belastbarkeit des Patienten) im Einzelsetting anwendbar ist. Die bisherige Beobachtung auf der Station zeigte, dass die Durchführung des Programms im Gruppensetting nicht möglich ist, da sich zu wenige Patienten der Zielgruppe zum gleichen Zeitraum auf der Station befinden. 62 Grundsätzlich ist es den Patienten für die Dauer des stationären Aufenthaltes untersagt, Alkohol zu konsumieren. Diese feststehende Regel hat den Vorteil, dass der Patient zu einer Trinkpause während der Behandlung „gezwungen“ wird. Die Trinkpause während der Behandlung ist sinnvoll, um dem Patienten eine kritische Auseinandersetzung mit seinem Alkoholkonsum zu ermöglichen sowie um einen Abstand zu seinem bisherigen Konsumschema zu erreichen. Die Trinkpause ermöglicht es dem Patienten, auszuprobieren, wie er damit zurechtkommt, wenn er die angenehme Wirkung des Alkohols in bestimmten Situationen nicht einsetzen kann. Und schließlich kann mit einer Trinkpause herausgefunden werden, ob es dem Patienten überhaupt möglich ist, auf Alkohol zu verzichten oder ob eine Therapiezuweisung in die Suchtklinik notwendig ist. Sollten die Patienten während des stationären Aufenthaltes Alkohol konsumieren, droht die disziplinarische Entlassung durch den Arzt – es sei denn, der Patient gibt eine glaubhafte Versicherung zur Abstinenz ab. Der Grund für dieses Vorgehen besteht hinsichtlich der hohen Interferenz von Alkohol und Medikamenten. Grundsätzlich besteht für alle Patienten im Haus die Möglichkeit der Teilnahme an einer offenen Gruppe für Patienten mit Suchtproblemen (1x wöchentlich). Für die Zugangsvoraussetzung spielt weder das Suchtmittel noch der Schweregrad der Abhängigkeit eine Rolle. Somit orientiert sich der inhaltliche Aufbau der Gruppe an den Möglichkeiten der Teilnehmer, wobei die Themen grob vorstrukturiert sind (Funktion des Suchtmittels, Stellenwert des Suchtmittels im Alltag, Alternativen zum Suchtverhalten, Information über örtliche Beratungsstellen und Motivierung zur Inanspruchnahme). Aufgrund der Heterogenität und der extrem unterschiedlichen komorbiden Krankheitsbilder ist das Eingehen auf die individuellen Suchtproblematiken nicht zu gewährleisten. Somit bleibt es bislang unklar, ob die Teilnahme an diesem bisherigen Angebot zu einer Veränderung im Suchtverhalten führt. 5.1.5 Ziele Ein Ziel der Kurzintervention liegt darin, Anreize zu schaffen, die dem Patienten helfen, einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Alkohol zu erlangen. Der Patient soll für seinen riskanten oder schädlichen Alkoholkonsum sensibilisiert werden, um eine mögliche Entwicklung einer manifesten Alkoholabhängigkeit zu verhindern. Dabei findet die Entwicklung eines individuellen Komorbiditätmodells besondere Berücksichtigung. Anstelle der klassischen Abstinenzparadigmas stellt das Konzept die Verringerung der Risiken und negativen Folgen durch den Alkohol in den Vordergrund. Es ermöglicht unter einer kritischen Abwägung von Vor- und Nachteilen, die Option, auf Alkohol in bestimmten Situationen zu verzichten. Im Gesamten wird dadurch in der Regel der Alkoholkonsum reduziert. Durch die Darstellung der Dynamik von Alkoholwir- 63 kungserwartung und Selbstwirksamkeit soll für den Patienten eine Entscheidungsbasis aufgebaut werden, die seine Änderungsabsicht hinsichtlich seines problematischen Konsumverhaltens stärkt. Durch eine Verknüpfung der therapeutischen Interventionen und Angebote im Stationsgeschehen mit dem Erarbeiten alternativer Ressourcen soll die Änderungsbereitschaft und Änderungskompetenz des Patienten gefördert werden. 5.1.6 Inhalte und Aufbau Das Interventionsprogramm ist aus verschiedenen Elementen aufgebaut. Psychoedukative Elemente dienen zur Vermittlung von behandlungsrelevanten Informationen. In einem verhaltenstherapeutischen Ansatz gilt es vor allem eine Integration von suchtspezifischen und komorbiden Themen herzustellen. Ablauf des Programms: Inhalte Zugangsvoraussetzung Diagnostik und Screening durch den Arzt (AUDIT), Ausgabe der Fragebogens SOKRATES 1. Sitzung Beziehungsaufbau, Darlegung der Vorgehensweise, Besprechung des Testergebnisses, Exploration zum Alkoholkonsum, Psychoedukation zu Alkohol, Ausgabe des Fragebogens IDTSA, Zusammenfassung. 2. Sitzung Psychoedukation zu Alkohol, Besprechung des Testergebnisses, Gegenüberstellung kritischer und unkritischer Trinksituationen, Psychoedukation zu Komorbidität, Hausaufgabe, Zusammenfassung. 3. Sitzung Besprechung der Hausaufgabe, Entscheidungsmatrix, Einschätzung von Alkoholwirkungserwartung und Selbstwirksamkeit, Erarbeitung konkreter Veränderungsmotivation, Zielformulierung, Zusammenfassung. 4. Sitzung Schaffung von Handlungsstrategien, Ressourcencheck, Umgang mit Rückschlägen, Ausgabe des SOKRATES, Zusammenfassung. 5. Sitzung Besprechung des Tests, Abschlussgespräch, Aufzeigen des regionalen Netzwerkangebotes, Patientenliteratur, Zusammenfassung Die Zuweisung der Patienten zur Behandlung erfolgt durch den Arzt und/ oder Psychologen. Hierfür ist der routinemäßige Einsatz von Screeningfragebögen zur Identifizierung der Zielgruppe innerhalb der ärztlichen Anamnese und Diagnostik erforderlich. Auf internationaler Ebene hat sich der „AUDIT“ (Alcohol Use Disorder Identification Test; Borbor et al., 1992) (siehe Anhang) bewährt. Bei der Terminvereinbarung für die erste Sitzung wird dem Patienten der Fragebogen SOKRATES (Wetterling & Veltrup, 1997) (siehe Anhang) ausgeteilt und gebeten, diesen zum vereinbarten Termin mitzubringen. Im Rahmen eines problematischen und abhängigen Trinkverhaltens erlaubt der Test die Einschätzung der Veränderungsmotivation nach den Phasen von Prochaska et al. (1992). In der ersten Sitzung stehen neben dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und der Darlegung der weiteren Vorgehensweise vor allem die Exploration des Patienten zu seinem Alkoholkonsum und seiner Sichtweise zu der Problematik im Mittelpunkt. 64 Durch aktive Wissensvermittlung (Psychoedukation) erhält der Patient Informationen über das Suchtmittel Alkohol. Die Vermittlung von behandlungsrelevanten Informationen hat dabei mehr als einen Instruierungseffekt. In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass durch Information und Aufklärung der Patienten Behandlungseffekte verbessert werden können (Lieb, 1994 zit. n. Schuhler & Vogelgesang, 2006). Informationsvermittlung kann dann zur Behandlung im eigentlichen Sinne werden. Zur Vorbereitung auf die nächste Sitzung wird dem Patienten der Fragebogen IDTSA (siehe Anhang) erklärt und mitgegeben. Der Einstieg der zweiten Sitzung erfolgt zunächst durch eine weitere psychoedukative Einheit über mögliche Folgen von Alkoholkonsum. Danach erfolgt die Besprechung des IDTSA (Lindenmeyer & Florin, 1998). Der Fragebogen erlaubt die Erstellung eines Profils der häufigsten Trinksituationen sowie die Differenzierung von kritischen und unproblematischen Trinksituationen. Anhand der herausgearbeiteten Risikobereiche erfolgt die Überleitung zu der Vorstellung (psychoedukativ) des individuellen Komorbiditätmodells des Patienten. Zur Vorbereitung auf die nächste Sitzung erhält der Patient die Anleitung eine Entscheidungsmatrix (Abwägung von Vor- und Nachteile seines Konsumverhaltens) (siehe Anhang) zu erstellen. Auf der Grundlage der vom Patienten erstellten Abwägung hinsichtlich seines Konsumverhaltens (Entscheidungsmatrix) werden mit dem Patienten die kurz- mittel und langfristigen Aspekte seines Verhaltens in speziellen Trinksituationen besprochen. Das Herausarbeiten der Selbstwirksamkeit steht dabei in der dritten und vertiefenden Sitzung im Vordergrund. Durch die Einsicht in die Dynamik wird der Patient befähigt, ein nun selbstbestimmtes Veränderungsziel zu formulieren. In der vierten Sitzung steht die Verknüpfung mit dem therapeutischen Stationsangebot und somit die Nutzung des Synergieeffektes im Vordergrund. Alternative Ressourcen werden als konkrete Handlungsstrategien herausgearbeitet, dabei wird betont, dass Rückschläge bei dem Versuch einer Verhaltensänderung menschlich und normal sind. Zur Vorbereitung auf die abschließende Sitzung wird erneut der Fragebogen SOKRATES ausgegeben. Die Veränderung der Motivation wird durch einen Vergleich des SOKRATES zwischen der ersten und der fünften Sitzung erfasst. Dabei kann als Abschluss eine Art Bilanzierung stattfinden, bei der sich der Patient vor allem mit der Fragestellung hinsichtlich seiner Zukunftsplanung befasst. Die Vermittlung von Patientenliteratur und das Aufzeigen des regionalen Netzwerkangebots bilden den Abschluss des Behandlungsprogramms. 65 Zum Abschluss der Sitzungen erfolgt jeweils eine gemeinsame kurze Zusammenfassung des Stundeninhalts und der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, die zu Dokumentationszwecken in ein Stundenprotokoll eingetragen werden. 5.1.7 Identifikation der Zielgruppe Bei der Identifikation der Zielgruppe entsteht die Frage, ob der Alkoholmissbrauch in der Routinediagnostik erkannt und der Patient dem Behandlungskonzept zugeführt werden kann. Wenn Patienten mit schädlichem Alkoholkonsum im Sinne einer Sekundärprävention möglichst frühzeitig einem spezifischen Behandlungsangebot zugeführt werden sollen, erweist sich der routinemäßige Einsatz von Screeninginstrumenten zur Identifizierung von Alkoholproblemen als geeignet. Barbor und Higgins-Biggle (2000) wiesen nach, dass durch den Einsatz von Kurzfragebögen mit 5 bis 10 Items alkoholbelastete Personen sehr zuverlässig identifiziert werden konnten. Um die Zuführung des Behandlungskonzepts zu gewährleisten, wäre somit der routinemäßige Einsatz von Screeningfragebögen zur Identifizierung der Zielgruppe innerhalb der ärztlichen Anamnese wünschenswert. Auf internationaler Ebene hat sich der „AUDIT“ (Alcohol Use Disorder Identification Test; Borbor et al., 1992) bewährt. Er wurde im Auftrag der WHO entwickelt, um speziell eine Identifikation von Personen mit riskantem Alkoholkonsum zu ermöglichen. Er enthält zehn Fragen, die mündlich oder schriftlich beantwortet werden können (Anhang A). Im Gegensatz zu den alternativen Fragebögen „CAGE“ (Mayfield et al, 1974) und „LAST“ (Rumpf et al., 1997) erhebt der AUDIT Angaben über das aktuelle Trinkverhalten und erlaubt somit eine medizinische Einschätzung, ob sich der Patient bereits auf einem körperlich bedenklichen Konsumniveau befindet. 5.1.8 Methode/ therapeutische Grundhaltung Das Kurzinterventionsprogramm ist ein zieloffenes Programm. Das bedeutet, dass der Patient sein Ziel, welches im Behandlungsverlauf herausgearbeitet wird, selbst bestimmt und formuliert. Das Behandlungsprogramm kann im Rahmen einer stationären psychiatrischen Behandlung im Einzelsetting angewandt werden. Eine wertschätzende Grundhaltung kennzeichnet diesen therapeutischen Ansatz. Die Behandlung fokussiert alkoholspezifische Problembereiche, spezifische Problembereiche (z.B. tiefliegende Partnerschaftsprobleme, Persönlichkeitsstörungen etc.) des Patienten werden empathisch wahrgenommen, können jedoch in diesem Rahmen nicht vertiefend bearbeitet werden. Sollten spezifische tiefliegende Problembereiche identifiziert werden, so wird an dieser Stelle auf entsprechende adäquate Behandlungsmöglichkeiten verwiesen. Die Vorgehensweise ist transparent, aktiv und strukturierend. Die strukturierende Vor- 66 gehensweise hat zum Ziel, einen systematischen Zugang zu der Problemlage des Patienten hinzuführen. Methodisch basiert die Umsetzung auf der Grundhaltung des Motivational Interviewing (MI). Das MI wurde im Zusammenhang mit der Beratung und Behandlung von suchtmittelabhängigen Menschen von Miller & Rollnick (1991) (deutsche Ausführung Miller und Rollnick, 1999) entwickelt. Grundsätzlich baut die Gesprächsführung auf humanistischen Therapieschulen auf und integriert unterschiedliche Konzepte und Methoden verschiedener Therapierichtungen (Miller & Rollnick, 1999). Miller schrieb 1983 aufbauend auf Arbeiten von Karl Roger und Milton Erickson die Motivierende Gesprächsführung als therapeutischen Ansatz für Menschen mit problematischem Trinkverhalten. Ziel ist die Förderung der intrinsisch motivierten Änderungsbereitschaft hinsichtlich des Trinkverhaltnes und der daraus resultierenden Probleme. Grundprinzipien motivierenden Gesprächsführung Empathie ausdrücken Eine empathische Grundhaltung des Behandlers, die es dem Patienten erleichtert, seine Zurückhaltung aufzugeben und sich zu öffnen. Diskrepanzen entwickeln Die Förderung der Wahrnehmung von Diskrepanzen zwischen Zielen und Wünschen des Patienten und seinem Suchtmittelkonsum. Beweisführung vermeiden Die Vermeidung von konfrontativen, moralisierenden und stigmatisierenden Argumentationen. Widerstand aufnehmen Die Wertung von Abwehr als Ausdruck einer Störung der Interaktion zwischen Patient und Behandler, die es zu bearbeiten gilt. Selbstwirksamkeit und Zuversicht fördern Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit wird als ein wichtiges Element erfolgreicher intentionaler Verhaltensänderungen angesehen und soll daher gefördert werden. Empathie ausdrücken. Durch das Stellen offener Fragen sowie durch aktives und reflektierendes Zuhören wird dem Patienten das Gefühl vermittelt, sein Verhalten und die dadurch entstehenden Probleme zu verstehen. Ohne negative Bewertungen wird der Patient in seinen Veränderungsbemühungen unterstützt. Das gegenwärtige Verhalten des Patienten wird als seine zurzeit beste Lösung im Umgang mit bestimmten Auslösesituationen verstanden. Diskrepanzen entwickeln. Eine wertfreie Betrachtung der Vorteile des gegenwärtigen Verhaltens und der damit assoziierten Nachteile unterstützt den Patienten in der Überwindung der Ambivalenz gegenüber einer Verhaltensänderung und dem Aufbau von Veränderungsmotivation. Negative Konsequenzen des Verhaltens werden gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet und Diskrepanzen zu kurz- oder langfristigen Zielen aufgedeckt. Beweisführung vermeiden. Es wird ausdrücklich darauf verzichtet, den Betroffenen durch Beweise und Konfrontationen von der Notwendigkeit einer Veränderung seines 67 Verhaltens zu überzeugen. Im Vordergrund stehen vielmehr die Entwicklung von Diskrepanzen und der Betonung der Entscheidungsfreiheit des Patienten. Dies ermöglicht die Vermeidung von Widerstand und die Entwicklung einer intrinsischen Veränderungsmotivation. Widerstand aufnehmen. Verschiedene Techniken der Gesprächsführung ermöglichen es, mit Widerstand von Patienten (z.B. Bagatellisieren, Schuldzuweisung an andere) umzugehen. Hierzu gehören beispielsweise die (überzogene) Reflexion, die Verschiebung des Fokus und die Zustimmung mit einer Zuwendung (z.B. Nein, ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit dem Trinken habe. – Also, so weit Sie das beurteilen können, gab es niemals irgendwelche Probleme wegen Ihres Trinkens.). Selbstwirksamkeit und Zuversicht fördern. Durch die Exploration bereits gelungener Verhaltensänderung und durch die Erarbeitung von Stärken und Ressourcen kann die Zuversicht des Patienten, eine Verhaltensänderung erfolgreich durchzuführen und aufrechtzuerhalten, gefördert werden. Die Selbstwirksamkeit ist ein entscheidender Faktor für die Veränderung des Trinkverhaltens. Aus dem Krankheitsverständnis der multifaktoriellen Genese und der Einzigartigkeit des Menschen ergibt sich das Anliegen des Konzepts: dem Patienten Verständnis und Einblick in die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Alkoholmissbrauch und Depression zu ermöglichen, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 5.2 Durchführung Die Zugangsvoraussetzung sowie die folgenden fünf Sitzungen beschreiben die die Inhalte des Kurzinterventionsprogramms im Einzelnen. 5.2.1 Zugangsvoraussetzung (Screening, AUDIT) Um eine Zuführung zum Behandlungskonzept zu gewährleisten, sind zunächst Diagnostik und Screening des Alkoholmissbrauchs durch den Arzt erforderlich. Zugang zum Behandlungskonzept • Diagnostik und Screening durch den Arzt AUDIT • Ausgabe und Erklärung des SOKRATES 68 Diagnostik und Screening durch den Arzt Um die Zuführung der Patienten zur Behandlung zu gewährleisten, ist es innerhalb der ärztlichen Anamnese erforderlich, dass gezielte Fragen zum aktuellen Alkoholkonsum und möglichen Alkoholmissbrauch an den Patienten gestellt werden. Um auf zeitaufwändige diagnostische Verfahren verzichten zu können, ist der routinemäßige Einsatz von Screeningfragebögen zweckmäßig. Seit Anfang der 70er Jahre sind Sreeningverfahren entwickelt worden, die auf den Selbstaussagen der Patienten beruhen. Obgleich eine Tendenz zur Leugnung bei Befragten mit Alkoholproblemen besteht, haben sich im Allgemeinen Selbstaussagen als reliabel und valide erwiesen (Rumpf et al. 2003). Auf internationaler Ebene hat sich der „AUDIT“ ( Alcohol Use Disorder Identification Test; Borbor et al., 1992) (siehe Anhang) bewährt. Der AUDIT ist ein Fragebogen zu Sreening- Diagnostik von alkoholbezogenen Störungen. Er wurde im Auftrag der WHO entwickelt, um speziell eine Identifikation von Personen mit riskantem Alkoholkonsum zu ermöglichen. Damit stellt er eine Weiterentwicklung gegenüber älteren Testverfahren dar, die hauptsächlich die Identifikation von manifesten Abhängigkeiten zum Ziel hatten (Rumpf et al., 2003). Nach Wetterling und Veltrup (1997) ist der AUDIT als Sreeningfragebogen besser geeignet als z.B. der CAGE (Mayfield et al., 1974) oder der SMAST (Selzer, et al., 1975), da er erlaubt, den momentanen Alkoholkonsum und die möglichen medizinischen Komplikationen abschätzen zu können. Zudem ist die Durchführung und Auswertung sehr zeitökonomisch. Der AUDIT enthält zehn Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien und einem Wertbereich von 0 bis 40 Punkten. Die Durchführung und Auswertung erfolgt durch den Arzt. Der empfohlene Trennwert (Cutoff) zur Identifizierung von Patienten mit Alkoholmissbrauch liegt bei 8 Punkten. Somit werden Patienten mit einem Wert von acht oder mehr Punkten der Behandlung zugewiesen. Ausgabe und Erklärung des SOKRATES Nachdem der Patient vom Arzt dem Behandler zugewiesen wird, erfolgt die Terminvereinbarung für die erste Sitzung. Um mit dem Patienten in der ersten Sitzung gezielt über die Motivation hinsichtlich einer Veränderung und Teilnahme an dem Kurzprogramm zu sprechen, wird dem Patient der Fragebogen SOCRATES-G (Wetterling & Veltrup, 1997) (siehe Anhang) ausgeteilt und er wird gebeten, diesen zum vereinbarten Termin mitzubringen. Im Rahmen eines problematischen und abhängigen Trinkverhaltes erlaubt der Test die Einschätzung der Veränderungsmotivation nach den Phasen von Prochaska et al. (1992) (vgl. Kapitel 2.4.2). 69 Der Fragebogen enthält 19 Items mit vorgegebenen Antwortkategorien (Auswertung siehe Anhang). Der Fragebogen sollte von dem Patienten spontan ausgefüllt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 5 Minuten. Das Ausfüllen des Fragebogens vor der ersten Sitzung hat den Vorteil, dass sich der Patient mit der Thematik befasst und auseinandersetzt und die Ergebnisse in der ersten Sitzung besprochen werden können. Zusätzlich kann aufgrund der Ergebnisse die Behandlung besser auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. 5.2.2 Sitzung 1 (Vorgehensweise, SOKRATES, Psychoedukation I) Die erste Sitzung kann unter den Hauptzielen Beziehungsaufbau, Exploration zum Alkoholkonsum und Informationsvermittlung zusammengefasst werden. Inhalte/ Ziele 1) 2) 3) 4) 5) Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung Darlegung der Vorgehensweise Exploration der Sichtweise des Patienten zu seinem Alkoholkonsum und Besprechung des SOKRATES Informationsvermittlung über Alkohol Teil I Ausgabe des Fragebogens IDTSA 1) Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung Die Atmosphäre eines therapeutischen Erstkontaktes wird oft von Unsicherheit seitens des zu Behandelnden geprägt. Für den Aufbau einer therapeutischen Beziehung bietet sich an, nach einer kurzen Begrüßung die Vorstellung des Therapeuten anzuschließen. Empathie und Wertschätzung kennzeichnen das Gespräch durch das Hineinversetzen in die Sprache, Denkweise und Erlebniswelt des Patienten. Folgende Aspekte sind beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung im Therapeutenverhalten besonders zu berücksichtigen (vgl. Lindenmeyer, 2001): Verständnis zeigen Es geht nicht darum, den Patienten von seiner Alkoholproblematik zu überzeugen und ihn zu einem Bekenntnis zu bewegen. Stattdessen geht es darum, sich in die Erlebniswelt des Patienten hineinzuversetzen und sich auf ihn einzustellen. Auch provokante oder offensichtlich unrichtige Äußerungen sollten zu diesem Zeitpunkt nicht hinterfragt werden. Sie sollten vom Therapeuten lediglich notiert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt dazu Stellung nehmen zu können. Kompetenz vermitteln Wenn der Patient das Wissen und die Erfahrung auf Seiten des Therapeuten erkennen kann, kann er Hoffnung und Vertrauen in eine Behandlung entwickeln. So geht es darum, dem Patienten zu vermitteln, dass er mit der besonderen Situation (spezifisches 70 Trinkverhalten des Patienten in Abgrenzung zur Alkoholabhängigkeit sowie der depressiven Symptomatik) vertraut ist. Entpathologisieren Dabei geht es darum, die gesunden Anteile des Patienten anzusprechen, um der Demoralisierung, die häufig bei Patienten mit schädlichem Alkoholkonsum besteht, entgegenzuwirken und stattdessen die Hoffnung auf einen Veränderungserfolg zu erhöhen. Jedoch sollte keine Verharmlosung des Problems angedeutet werden, weil der Patient dies schnell als mangelnde Kompetenz des Therapeuten missverstehen könnte. Primäre außerordentliche Belastungen abklären Die Abklärung extremer primärer Belastungen (z.B. Trennungs- und Verlusterlebnisse) hat Priorität, da sich der Patient sonst überhaupt nicht auf eine Behandlung konzentrieren bzw. einlassen kann. Patienten, die aufgrund einer depressiven Symptomatik stationär behandelt werden, weisen oftmals eine Reihe von sozialen und psychosozialen Problemen auf. Hier sollte der Therapeut nicht auf die Behandlung anderer Probleme fokussieren – auch wenn oft angenommen wird, dass nach der Lösung grundlegender, psychosozialer Probleme das Alkoholproblem von selbst verschwinden wird. Ziel der Behandlung ist der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol, auch wenn psychosoziale Belastungen und/ oder depressive Symptomatiken vorliegen. So geht es darum, Verständnis für die schwierige Situation des Patienten zu äußern und gemeinsam mögliche Szenarien theoretisch durchzuspielen. Auch bei unrealistischen Ansprüchen des Patienten sollte der Therapeut Verständnis zeigen, jedoch auch seine eigene Einschätzung rückmelden. 2) Darlegung der Vorgehensweise und des Hauptziels des Programms Da der Patient vom Arzt der Behandlung zugewiesen wird, sollte die Zuweisung vom Behandler aufgegriffen werden. Möglicherweise fühlt sich der Patient zu Unrecht in die Behandlung gedrückt oder er kann nicht nachvollziehen, was an seinem Alkoholkonsum änderungsbedürftig sein soll. Dem Patient soll verdeutlicht werden, dass er sich nicht für die Abstinenz entscheiden muss, sondern dass es bei dem Programm um einen bewussten Umgang mit Alkohol und um ein selbstbestimmtes Therapieziel geht. Um im Verlauf der Behandlung ein Therapieziel formulieren zu können, wird dem Patienten der Vorschlag unterbreitet, sein Trinkverhalten im Alltag zu analysieren. Dabei wird auf die Durchführung eines weiteren Tests, der dieses Ziel verfolgt, hingewiesen. Um eventuelle Widerstände und Ängste des Patienten abzubauen, wird ihm die Vorgehensweise erläutert. 71 „Sie werden während dieser Behandlung, die ca. 5 Einzelsitzungen umfasst, zunächst Informationen über das Suchtmittel Alkohol erhalten. Sie werden lernen, wie sich der Promillewert nach Alkoholkonsum errechnet, um so auch mögliche Gefahren besser einschätzen zu können. Danach können wir Ihr eigenes Trinkverhalten anhand von einem Test genauer betrachten. Dabei wird ein Profil erstellt, welches erlaubt, verschiedene Risikobereiche herauszuarbeiten. So können Sie ihr individuelles Ziel im Umgang mit dem Alkohol festlegen. Die herausgefundenen Risikobereiche können wir dann gemeinsam untersuchen, um kritische Situationen von unproblematischen Situationen zu unterscheiden. Hieraus lassen sich mögliche Konsequenzen für Ihre zukünftigen Handlungen und Handlungsstrategien ableiten. Somit bedeutet das Konzept der Punktabstinenz nicht, dass Sie gänzlich auf Alkohol verzichten müssen, sondern dass Sie erkennen lernen, wann ein ungeeigneter Zeitpunkt ist, was ein ungeeigneter Ort und wann eine Situation ungeeignet ist, um Alkohol zu konsumieren. Dabei werden wir Ihre depressive Symptomatik – soweit vorhanden - nicht außer Acht lassen, sondern mit in unsere Überlegungen einbeziehen. Zusätzlich erhalten Sie noch Informationen über den Zusammenhang von Depression und dem Einsatz von Alkohol. Zum Abschluss fassen wir unser Ergebnis noch mal zusammen und Sie erhalten von uns Informationen über weitere wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeiten, falls Sie diese benötigen.“ Durch das Besprechen des weiteren Vorgehens bleibt dem Patienten zunächst die Entscheidung des Einlassens auf die Behandlung offen. Sie dient dazu, dem Patienten durch Transparenz die Angst und Befürchtungen des „Ungewissen“ zu nehmen und mögliche Widerstände, die das Einlassen auf die Behandlung verhindern, zu verringern. Weiter soll dem Patienten verdeutlicht werden, warum es erfolgsversprechender ist, in manchen Situationen, die individuell vereinbart werden, gänzlich auf Alkohol zu verzichten (Prinzip der Punktabstinenz). Nachdem die Vorgehenswiese erläutert wurde, wird dem Patienten erklärt, dass die Behandlung nach seinen Bedürfnissen angepasst werden kann. Dafür werden jedoch Informationen benötigt, und wenn der Patient zur Mitarbeit bereit ist, erfolgt eine kurze Exploration zur genaueren Einschätzung des Patienten sowie die Besprechung des Testergebnisses. 3) Exploration der Sichtweise des Patienten zu seinem Alkoholkonsum und Besprechung des SOKRATES Für die weitere Behandlungsplanung sind die Abschätzung der Veränderungsbereitschaft sowie die Herausarbeitung der eigenen Sichtweise des Patienten zu seinem Konsum notwendig. Anhand des Ergebnisses des SOKRATES kann das Stadium der 72 Veränderungsbereitschaft nach den Phasen der Veränderungsmotivation von Prochaska et al. (1992) eingeordnet werden. Prochaska et al. postulieren verschiedene Stadien, in denen die Veränderung von Problemverhaltensweisen stattfinden: Stadien Verhalten Precontemplation fehlende Problembewusstheit Contemplation Nachdenklichkeit Determination Entschlossenheit Action Handlung, Verhaltensänderung Maintenance Aufrechterhaltung Precontemplation bezeichnet ein Stadium, in dem keine Veränderungsmotivation vorliegt. Der Alkoholkonsum wird nicht als problematisch wahrgenommen. Die Informationsverarbeitung bezüglich des Problems ist vermeidend. Das Stadium der Contemplation beinhaltet die Bewusstheit des Problems und ist durch die Abwägung von Vor- und Nachteilen des Problemverhaltens bzw. seiner Veränderung gekennzeichnet. Die wahrgenommenen negativen Konsequenzen des Problemverhaltens übersteigen in der Phase der Determination die positiven Konsequenzen deutlich, so dass es zu einer Handlungsabsicht kommt. Im Stadium Action findet eine aktive Verhaltensänderung statt. Maintenance bezeichnet die kontinuierliche Stabilisierung einer Verhaltensänderung mit dem Ziel, Rückfälle zu verhindern (Heidenreich et al. 2003) Deutsche Version der Stages of Change Readiness an Treatment Eagerness Scale. Zeigt sich anhand des Testergebnisses, dass der Patient noch keine Einsicht in seine problematische Verhaltensweise hat (Precontemplation), wird ihm dies entsprechend rückgemeldet. „Herr/Frau…, das Ergebnis des Tests zeigt, dass Sie Ihren Alkoholkonsum bisher eher als unproblematisch einschätzen und dass Sie sich bezüglich einer Änderung in Ihrem Trinkverhalten noch nicht so viele Gedanken gemacht haben.“ An dieser Stelle wird dann der Patient über die schleichende Entwicklung des Alkoholmissbrauchs/ Alkoholabhängigkeit informiert und es wird erläutert, dass der größte Teil dieser Entwicklung von ihm und seiner Umwelt unbemerkt bleibt. Sollte der Patient exaktere Belege für die Einschätzung des Behandlers zu seinem Alkoholkonsum fordern, wird auf die folgend geplante Analyse des Trinkverhaltens verwiesen. „Deshalb würde ich Ihnen anbieten, dass wir uns noch weiter mit Ihrem bisherigen Alkoholkonsum befassen und Sie zunächst noch weitere Informationen über Alkohol erhalten. Vielleicht entstehen bei Ihnen im Verlauf weitere Fragen, so dass Sie sich selbst ein genaueres Urteil bilden können. Was halten Sie davon?“ 73 Liegt bei dem Testergebnis das Veränderungsstadium der Contemplation vor, steht die Wertschätzung der Einsicht in die problematische Verhaltensweise zunächst im Vordergrund. „Herr/Frau… das Testergebnis zeigt, dass Sie sich Ihres Alkoholproblems durchaus bewusst sind und Sie sich schon mehrfach überlegt haben, an Ihrem Alkoholkonsum etwas zu verändern. Es ist beeindruckend, wie deutlich Sie Ihre Problematik selbst erkennen. Um Sie in Ihrer Veränderungsmotivation zu unterstützen, werden wir in den folgenden Sitzungen noch genauer herausfinden, was in Ihren kritischen Trinksituationen geschieht und alternative Umgangsweisen dazu erarbeiten. Sind Sie damit einverstanden? Sind aufgrund des Testergebnisses die Veränderungsstadien nicht klar herauszuarbeiten, werden mit dem Patienten folgende Fragen zur Vertiefung durchgegangen (Driessen et al., 1995 in Wetterling & Veltrup, 1997). - Besteht ein ausreichendes Problemverständnis bzw. ein subjektives Krankheitskonzept? - Leidet der Patient unter seinem erhöhtem Alkoholkonsum und/oder den Folgen? - Besteht ein – wenn auch unspezifischer – Wunsch nach Veränderung seiner Situation? - Besteht ein Wunsch nach konkreter Behandlung? - Besteht der Wunsch nach Abstinenzsicherung bzw. Rückfallbewältigung? - Besteht eine Ambivalenz hinsichtlich der Änderungsbereitschaft? Zusätzlich erleichtert das Vorliegen des Ergebnisses des Fragebogens AUDIT eine schnellere Einschätzung des Konsumverhaltens des Patienten. Um möglichst konkrete Informationen über das Trinkverhalten des Patienten und um über die persönlichen Verhältnisse mehr zu erfahren, wird eine Exploration zu folgenden Themen durchgeführt: Alkoholkonsum: bevorzugte Getränke, Menge, Trinkmuster (Unterschied zwischen Wochen und Werktagen, Tageszeit, Anlass), bisherige Reduktionsversuche oder Behandlungsversuche, Abstinenzzeiten. Soziale Situation: familiäre Situation, Kinder, Wohnsituation, finanzielle Lage z.B. Schulden. Berufliche Situation: Ausbildung, aktuelle Arbeitssituation, Krankschreibungen im letzten Jahr. 74 Weitere Problembereiche: außergewöhnliche aktuelle Ereignisse positiver und negativer Art. Eine wertschätzende Grundhaltung kennzeichnet das Gespräch. Hier gilt es, dem Patienten Raum für die Entfaltung seiner persönlichen Problematik zu geben, was die Vertrauensbildung fördert. Zum anderen sollte ein strukturiertes Vorgehen dem Patienten helfen, seine eigentliche Problematik im Umgang mit Alkohol zu erkennen, da diese im Mittelpunkt dieser Behandlung steht. Nach der Exploration und der Besprechung des Fragebogens gibt der Behandler eine Einschätzung des bisherigen Ergebnisses. Die Einschätzung und Rückmeldung dient dazu, dem Patienten eine von außen betrachtete, professionelle Sichtweise aufgrund der Befragung und der Testergebnisse darzulegen. Für Patienten, die nur eine geringe kritische Selbstreflexion zeigen, geht es bei der Rückmeldung der alkoholspezifischen Ergebnisse einerseits darum, die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung herauszubilden. Andererseits soll diese Diskrepanz jedoch durch den Behandler entpathologisiert werden, um interaktionellen Widerstand zu vermeiden (Lindenmeyer, 2001). Insgesamt benötigen diese Patienten Informationen, die es ihnen unter Wahrung ihres Selbstwertgefühls erlauben, ihre bisherige Einstellung zu ihrem Alkoholkonsum aufzugeben. Gleichzeitig benötigen sie interaktionellen Freiraum, um sich selbst entscheiden zu können. Für Patienten, die ihren Alkoholkonsum selbst kritisch betrachten, bedeutet dies einerseits nicht automatisch eine Veränderungsbereitschaft. Hier besteht häufig eine Ambivalenz nach dem Motto „ja, aber“. Im Vordergrund stehen hierbei Abwägungsprozesse, in deren Verlauf die Patienten entscheiden, wie sie sich in Zukunft verhalten möchten. Bei der Rückmeldung der alkoholspezifischen Ergebnisse geht es bei diesen Patienten somit einerseits darum, sie in ihrer kritischen Selbstreflexion gegenüber ihrem Konsumverhalten zu bestärken. Andererseits sollten auch möglichst viele beschämende Details des Patienten als normale Aspekte eines Alkoholproblems verdeutlicht werden, damit die kritische Selbstreflexion weniger aversiv erscheint. 4) Informationsvermittlung über Alkohol Teil I Um ein Problembewusstsein und ein Zielbewusstsein zu erreichen, benötigt der Patient zunächst Wissen über die Droge Alkohol und über die Einstufung von schädlichem Alkoholgebrauch und Alkoholabhängigkeit. Im Gegensatz zu früheren Annahmen nimmt die sog. Psychoedukation und Wissens- und Informationsvermittlung in der Behandlung einen immer größeren Stellenwert ein (Schuhler & Schmitz, 2006). Das Ziel dieser Maßnahme ist, das Wissen des Patienten gezielt über seine Störung anzurei- 75 chern. Die meisten Betroffenen wissen nur sehr wenig über die Wirkungsweise von Alkohol und haben eine unrealistische Vorstellung von der Alkoholwirkung. Mit der Wissensvermittlung wird der Patient für sein eigenes Trinkverhalten und dessen Folgen sensibilisiert, kann Risiken besser einschätzen und erhält somit die Möglichkeit, ein eigenes Problembewusstsein zu schaffen. Zusätzlich wird ihm der Druck einer Entscheidung hinsichtlich seines zukünftigen Konsumverhaltens zunächst genommen, da es sich um „reine Wissensvermittlung“ handelt. Anhand der folgenden drei Fragen wird der Patient über die wichtigsten Aspekte des Alkoholkonsums informiert: Fragen für Informationsvermittlung • Wann spricht man von Alkoholmissbrauch? • Wie errechne ich den Alkoholgehalt in Gramm und den Promillewert im Körper? • Wie entstehen die unangenehmen Nebenwirkungen nach Alkoholkonsum? Wann spricht man von Alkoholmissbrauch? Aufgrund der in der Literatur am häufigsten verwendetet diagnostischen DSM IV Kriterien, die ausführlicher und präziser die sozialen Folgen des Alkoholkonsums in den Vordergrund stellen (vgl. Kapitel 2.1.1), werden diese als Grundlage zur Informationsvermittlung verwendet. Im Anhang ist die Vorlage der aktiven Informationsvermittlung bzgl. des Alkoholmissbrauchs abgebildet. Anhand der aufgeführten Kriterien soll der Patient seinen Status Quo deutlicher erkennen und besser einschätzen können. Gleichzeitig soll ihm die geringe Chance eines allgemeinen Vorsatzes „künftig trinke ich einfach etwas weniger“ nahe gebracht werden. Wie errechne ich den Alkoholgehalt in Gramm und den Promillewerte? Im Anhang werden dem Patienten die Formel zur Berechnung des Alkoholgehaltes in Gramm sowie die Widmark-Formel zur Berechnung des Promillewertes vermittelt. Des Weiteren erhält der Patient eine Liste mit den Angaben gängiger alkoholischen Getränke und deren Reinalkoholmengen. Die Berechnung des Reinalkoholgehaltes und des Promillewertes hat zum einen zum Ziel, dass der Patient später die problematischen und kritischen Trinksituationen besser zu differenzieren bzw. einschätzen lernt. Zum anderen soll ein besseres Verständnis für die erforderliche Abstinenzspanne vor Arbeitsbeginn oder der Teilnahme am Straßenverkehr aufgebaut werden. Wie entstehen die unangenehmen Nebenwirkungen nach Alkoholkonsum? Die meisten Menschen erinnern sich (selbst wenn sie zu viel getrunken haben) nur an die angenehmen Wirkungen von Alkohol. Dabei tritt die unangenehme Nachwirkung 76 (sog. „Kater“) oft nach kurzer Zeit in den Hintergrund. Um die positive Wirkungserwartung des Patienten zu relativieren, das körperliche Suchtpotenzial von Alkohol zu verdeutlichen und die Toleranzsteigerung zu erklären, dient diese Informationsvermittlung der Zwei-Phasenwirkung von Alkohol (siehe Anhang ). 5) Zusammenfassung und Ausgabe des Fragebogens Zunächst wird der Patient für seine Beiträge, seine Offenheit und Mitarbeit gewürdigt. Schließlich ist es für den Patienten nicht selbstverständlich, über seinen schädlichen Alkoholkonsum zu sprechen. Der Patient hat nun einige Informationen über Alkohol erhalten. Zur Vorbereitung auf die nächste Sitzung, wird ihm der Fragebogen „Inventory of Drug Taking Situations“ (IDTSA) von Lindenmeyer und Florin (1998) (Anhang) erklärt und mitgegeben. Er wird gebeten, den Bogen zur nächsten Sitzung mitzubringen. Der Einsatz von Fragebögen zu Behandlungsbeginn ist erfahrungsgemäß solange kein Problem, wenn eine kurzfristige Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt und die Ergebnisse direkt in die Therapieplanung eingehen. Oftmals ist das aufwendige Ausfüllen sogar eine wichtige Motivationsstrategie. So bieten die Fragebögen dem Patienten die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Dem Patienten wird in folgender Weise der bisherige Stand rückgemeldet (vgl. Lindenmeyer, 2001): „Nach allem was ich bisher über ihren Umgang mit Alkohol erfahren habe, besteht bei Ihnen … .(Einschätzung) (Bsp. ein riskanter Umgang mit Alkohol). Um jedoch qualifiziert Stellung nehmen zu können und die Risikobereiche besser eingrenzen zu können, wäre es gut, wenn wir Ihr Trinkverhalten noch genauer untersuchen. Dies können wir in Form eines weiteren Tests tun, dessen Ergebnisse wir in der nächsten Sitzung besprechen. Sind Sie damit einverstanden?“ Zum Abschluss der Sitzung wird der Patient aufgefordert, offene Fragen zu stellen. Es erfolgt eine gemeinsame kurze Zusammenfassung des Stundeninhalts und der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, die zu Dokumentationszwecken in ein Stundenprotokoll eingetragen werden. Durch die gemeinsame Zusammenfassung des Stundeninhaltes werden die Intensität und die Transparenz der Behandlung für den Patienten erhöht. 5.2.3 Sitzung 2 (Psychoedukation II, IDTSA, Komorbiditätsmodell, Matrix) Die zweite Sitzung kann mit den Hauptzielen weitere Informationsvermittlung über Alkohol und Komorbidität sowie Differenzierung unterschiedlicher Risikobereiche zusammengefasst werden. 77 Inhalte/ Ziele 1) 2) 3) 4) 5) Aktive Informationsvermittlung Teil II Besprechung des IDTSA Gegenüberstellung von unproblematischen und kritischen Trinksituationen Vermittlung des individuellen Komorbiditätmodells Erklärung der Hausaufgabe 1) Aktive Informationsvermittlung Teil II Zu Beginn der 2. Sitzung erfolgt die Informationsvermittlung zu zwei Fragestellungen: Fragen für Informationsvermittlung • Wie sind die sozial üblichen Trinknormen im deutschen Sprachraum? • Was sind mögliche Folgen von Alkoholkonsum? Wie sind die sozial üblichen Trinknormen im deutschen Sprachraum? Im deutschen Sprachraum herrscht eine sog. „gestörte Trinkkultur“ (Lindenmeyer, 2001). Das heißt, es gibt keine klare Grenze zwischen normalem und kritischem Alkoholkonsum, vielmehr gelten die im Anhang aufgeführten „Trinkregeln“. Somit findet der größte Teil der Entwicklung eines Alkoholmissbrauchs unter Einbezug des allgemein üblichen Alkoholkonsums statt. Dabei werden deutliche Hinweise auf einen schädlichen Alkoholkonsum weder von dem Betroffenen noch von seiner Umwelt als bedenklich eingestuft. Die Vermittlung von „Trinkregeln“ soll dem Patienten verdeutlichen, dass man ohne aufzufallen ein Alkoholproblem entwickeln kann. Zudem soll die Eigenverantwortung für einen angemessenen Umgang mit Alkohol in der Zukunft betont werden, da die mögliche Orientierung an vorherrschenden Trinknormen nicht zuträglich ist. Durch eine offene Diskussion der sozial üblichen Trinknormen erhält der Patient die Möglichkeit, seinen Widerstand gegen die notwendige Veränderung seines Trinkverhaltens zu verringern. Zudem können Scham und Schuldgefühle wegen des schädlichen Konsums in der Vergangenheit abgebaut werden. Was sind mögliche Folgen von Alkoholkonsum? Das Ziel der Erläuterung der körperlichen Folgeschäden durch Alkoholkonsum (siehe Anhang) liegt darin, dem Patienten den sogenannten „Sleeper-Effekt“ deutlich zu machen. Körperliche Schäden durch Alkohol treten manchmal erst mit erheblicher Zeitverzögerung auf, auch dann, wenn der Patient sehr wenig oder sogar keinen Alkohol mehr konsumiert. Dabei ist hier nicht die Frage, ob Alkohol die Krankheit x auslöst. Vielmehr geht es um die Frage, wie stark sich die Wahrscheinlichkeit der Krankheit x mit zunehmenden oder fortgeführtem Alkoholkonsum erhöht? Es soll jedoch auch dem Patienten dargelegt werden, dass nicht nur die Trinkmenge, sondern auch das Trink- 78 muster entscheidend ist: Zum Beispiel jeden zweiten Abend ein Glas Wein zu trinken oder sich alle zwei Wochen „volllaufen“ zu lassen. Dem Patient soll vermittelt werden, was für Folgen zu erwarten sind, wenn er seinen schädlichen Alkoholkonsum fortsetzt. Dabei stehen nicht die kurzfristigen Folgen im Vordergrund, sondern es soll vor allem auf die schleichenden, mittelfristig eintretenden Folgen (physisch, psychisch, sozial) aufmerksam gemacht werden, da diese für den Betroffenen oft schwer erkennbar sind. Dadurch hat der Patient die Möglichkeit, die tatsächlichen Risiken seines bisherigen Alkoholkonsums zu realisieren und erhält eine Chance, sein Konsumverhalten kritisch zu reflektieren. 2) Besprechung des IDTSA Der IDTSA-G basiert auf dem im angloamerikanischen Raum verwendeten Fragebogen zur Rückfallprävention IDS-42 (Annis et al., 1987). Die deutsche Version von Lindenmeyer und Florin (1998) wurde dahingehend verändert, dass nach der Häufigkeit jeglichen Alkoholkonsums und nicht nur nach exzessivem Trinken gefragt wird. Zudem wurden Situationsbeschreibungen in eine logisch stringente Struktur überführt (Unterscheidung zwischen interpersonalen und interaktionellen Trinksituationen). Der Einsatz dieses Fragebogens in der Behandlung hat den Vorteil, dass in einer schnellen und einfachen Auswertung ein Profil der häufigsten Trinksituationen des Patienten dargestellt werden kann. Anhand der 50 Items lassen sich Risikosituationen und unproblematische Situationen differenzieren. Dies wiederum ist für das Ziel, einen verantwortungsvollen Umgang mit problematischem Alkoholkonsum von großer Bedeutung. Die unten aufgeführten acht Subskalen beschreiben die Risikobereiche, in denen das Auftreten von Trinksituationen wahrscheinlich ist. Alternative Testverfahren, wie z.B. der Trierer Alkoholismus Inventar (Funke et al., 1999), kommen aufgrund der zeitaufwändigen Auswertung nicht zum Einsatz. Acht Subskalen des IDTSA Interpersonale Trinksituationen: Interaktionelle Trinksituationen: Negative Gefühlszustände Soziale Konflikte Körperliche Beschwerden Geselligkeit Versuch, kontrolliert zu trinken Soziale Verführung Plötzliches Verlangen Angenehme Gefühlszustände Erfragt wird jeweils die Häufigkeit des Alkoholkonsums innerhalb des letzten Jahres auf einer fünf-stufigen Antwortskala. Die Auswertung ermöglicht die optische Erstellung eines Profils der häufigsten Trinksituationen (siehe Anhang). 79 Zunächst wird dem Patienten deutlich gemacht, dass es nicht um Charakter, Willen oder Selbstbeherrschung geht, sondern, dass es um das Konzept von kritischen Trinksituationen als entscheidende Variable geht (vgl. Tabelle oben). Es erfolgt eine Erläuterung zu unproblematischen und kritischen Trinksituationen (vgl. Lindenmeyer, 2001). „Heute weiß man, dass Problemtrinker nicht einfach zu viel Alkohol trinken, sondern dass ihr Umgang mit Alkohol je nach Situation sehr unterschiedlich sein kann. Oft trinken die Betroffenen bei der Hälfte aller Gelegenheiten Alkohol in vollkommen unproblematischer Weise. Situationen, in denen es eher leichter fällt, wenig oder gar nicht zu trinken, sind die unproblematischen Trinksituationen. Und dann gibt es kritische Trinksituationen. In ihnen neigen die Betroffenen zu übermäßigen und schädlichen Alkoholkonsum. Nun können wir anhand des Profils Ihre typischen Trinksituationen herausarbeiten.“ 3) Gegenüberstellung von unproblematischen und kritischen Trinksituationen Günstig ist es, wenn ein möglichst differenziertes Risikoprofil bei den Patienten besteht, bei denen sowohl seltene als auch hochfrequente Trinksituationen vorkommen. Somit können auch ressourcenorientiert normale Trinkbereiche hervorgehoben werden. Durch die Gegenüberstellung wird der Ist-Zustand des Patienten dargestellt, ohne dass er sich für ein definitives Behandlungsziel entscheiden muss (vgl. Lindenmeyer, 2001) „Man weiß heute, in welchen Situationen Menschen mit Alkoholproblemen am häufigsten zum Alkohol greifen. Für die Behandlung kann man das in 8 Risikobereiche unterteilen (vgl. Tabelle). Ihre häufigste Trinksituationen sind …Zum Beispiel am häufigsten trinken Sie bei unangenehmen Gefühlszuständen. Sie trinken dagegen eher selten Alkohol, wenn Sie körperliche Beschwerden haben.“ Die Gegenüberstellung als ressourcenorientierte Methode dient vor allem auch dazu, den Patienten auf seine Selbstwirksamkeit aufmerksam zu machen. Die Selbstwirksamkeit wird dann vertieft in der 3. und 4. Sitzung im Mittelpunkt stehen. Der Patient wird motiviert, seine eigenen kritischen Bereiche, in denen mögliche schädliche Folgen seines Alkoholkonsums eintreten können oder bereits eingetreten sind, herauszufinden. Zudem werden die gesunden Anteile des Patienten verdeutlicht und sein Selbstwertgefühl bestärkt. Anhand des vorliegenden Status Quo wird mit dem Patient auf die später folgende Zielformulierung hingearbeitet. In den unkritischen Risikobereichen wird sich der Patient ggf. dafür entscheiden, weiterhin Alkohol zu konsumieren. 80 4) Vermittlung des individuellen Komorbiditätmodells Die Überleitung zu der Darstellung eines individuellen Komorbiditätsmodells erfolgt anhand der herausgearbeiteten Risikobereiche. Das Ziel dabei ist, dem Patienten das auf ihn zutreffende Modell (siehe Tabelle) zu vermitteln. Störungsmodelle zu Komorbidität • Selbstmedikationsmodell • Exazerbationsmodell • Suchtfolgemodell • Mischmodelle Die einzelnen Modelle sind im Anhang ausführlich aufgeführt. Sozialer Rückzug, unangenehme Gefühle und eine geringe Selbstwirksamkeit sind gängige Trinkmotive. Setzt zum Beispiel der Patient den Alkohol im Sinne einer Selbstmedikation ein, wird ihm das Einsetzen von Alkohol zur Beseitigung subjektiv negativ erlebter Affekte verdeutlicht. Weist sein Risikoprofil eine deutliche Auffälligkeit im Bereich positive Gefühle auf, wird dem Patienten verdeutlicht, was sein kurzfristiger Nutzen von seinem Alkoholkonsum in diesem Moment darstellt und was mittelfristig darauf folgt bzw. zu erwarten ist oder er bereits schon erlebt hat. Die Mitteilung an den Patienten lautet wie folgt: „Wir haben festgestellt, dass Ihnen der Alkohol ganz besonders geholfen hat in Situationen, in denen Sie sich ganz besonders niedergeschlagen und traurig gefühlt haben. Aber andererseits schafft der Alkohol auch neue Probleme. Daher ist es zwar kurzfristig sehr hilfreich, aber mittel- und langfristig verstärkt der Alkohol ihre Depression.“ Das heißt, in jedem Falle werden die mittelfristigen und vor allem die immer wiederkehrenden Folgen herausgearbeitet. Dabei wird hervorgehoben, dass sich das Verhalten im Sinne einer teufelskreisartigen Eigendynamik verstärken kann. 5) Erklärung der Hausaufgabe Da im vorherigen Schritt die positiven und negativen Aspekte des Alkoholkonsums herausgearbeitet wurden, schließt sich folgend die Erklärung Hausaufgabe der VierFelder-Matrix (siehe Anhang) an. Dieses Arbeitsblatt ermöglicht die Beschreibung der Vorteile künftiger Abstinenz sowie die Nachteile von unverändertem Konsumverhalten. Dabei werden die kurz- und langfristigen Konfliktbestandteile hervorgehoben. Bei dieser Technik der kognitiven Therapie wird der Patient angeleitet, die Vor- und Nachteile seines Alkoholkonsums aufzulisten und umzubewerten. Die Vier-Felder-Matrix ermöglicht dem Patienten eine akkuratere und ausgewogenere Sicht seines Konsumverhaltens, denn oftmals neigen die Betroffenen dazu, die Probleme, die mit ihrem Suchtmit- 81 telkonsum verbunden sind, zu minimieren und die Vorteile zu maximieren. Ziel ist die Hinarbeitung auf eine individuelle Zielvorstellung des zukünftigen Konsumverhaltens durch den Patienten. Zum anderen soll der Patient auch Zeit zum Nachdenken finden und die neu erlernten Aspekte der psychischen Labilisierung/ Komorbidität, gesundheitlichen und sozialen Folgen aber auch den Bereich der Sinnfindung/ Lebensziele mit in seine Überlegungen einzubeziehen. Dabei wird der Patient aufgefordert, die zutreffenden Konfliktbestandteile in das Schema einzutragen. „Für das Bearbeiten der Entscheidungsmatrix tragen Sie bitte zunächst die für Sie zutreffenden kurzfristigen positiven Wirkungen des Alkohols in das entsprechende Feld ein. Überlegen Sie dann bitte, was die langfristigen negativen Folgen des Alkohols für Sie sind oder sein könnten. Im nächsten Schritt überlegen Sie bitte, was die befürchteten negativen Erlebnisse sind, wenn Sie keinen Alkohol mehr trinken würden. Zuletzt tragen Sie bitte die langfristig erhofften positiven Entwicklungen einer künftigen Abstinenz in das entsprechende Feld ein. Lassen Sie sich dabei genügend Zeit. Bei diesen Überlegungen geht es auch darum, innezuhalten, um sich die eigenen Lebensziele zu verdeutlichen. “ Um dem Patienten erneut vor Augen zu führen, dass er sich nicht für eine völlige Abstinenz entscheiden muss, kann es hilfreich sein, die Zielvorstellungen an diesem Punkt nochmals konkretisierend zu erörtern und ihm das Prinzip der Punktabstinenz zusammenfassend zu erklären. „Unter dem Prinzip der Punktabstinenz versteht man, dass jemand der Alkohol missbräuchlich einsetzt, in kritischen Situationen völlig auf Alkohol verzichtet, in unproblematischen Trinksituationen dagegen durchaus weiterhin Alkohol trinken kann. Das Prinzip bedeutet somit: kein Alkohol, um Gefühlszustände zu manipulieren, kein Alkohol an ungeeignetem Ort, kein Alkohol zu ungeeignetem Zeitpunkt, Alkoholmenge der max. Tagesobergrenze anpassen/ zwei Abstinenztage pro Woche.“ Zum Abschluss der Sitzung wird der Patient aufgefordert, offene Fragen zu stellen. Er wird für seine Beiträge, seine Offenheit und seine Mitarbeit gewürdigt. Es erfolgt eine gemeinsame kurze Zusammenfassung des Stundeninhalts und der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, die zu Dokumentationszwecken in ein Stundenprotokoll eingetragen werden. 5.2.4 Sitzung 3 (Selbstwirksamkeit, Wirkungserwartung, Zielformulierung) Die dritte Sitzung kann mit den Hauptzielen vertiefender Einschätzung zu Wirkungserwartung und Selbstwirksamkeit sowie der Zielformulierung zusammengefasst werden. 82 Inhalte/ Ziele 1) 2) 3) Besprechung der Vier-Felder-Matrix Einschätzung von Alkoholwirkungserwartung und Selbstwirksamkeit Erarbeitung konkreter Veränderungsmotivation und Zielformulierung 1) Besprechung der Vier-Felder-Matrix Bei der Besprechung des Arbeitsblatts 4-Felder-Matrix geht es darum, mit dem Patienten herauszufiltern, dass der Nutzen von Alkoholkonsum jeweils kurzfristig ist, langfristig jedoch die negativen Aspekte in den Vordergrund treten. Über das Abwägen von Vor- und Nachteilen entsteht eine Veränderungsmotivation im konkreten Sinne. Die in der zweiten Sitzung angesprochene Dynamik wird aufgrund der Bilanzierung und der Unterscheidung der kurz- und langfristigen Effekte vertieft. Dies ist insofern wichtig, als aufgrund der Einsicht in die eigene Dynamik eine Veränderungsmotivation entstehen kann, welche wiederum zur Zielbeschreibung bzw. zur Zielfindung führt. Mit dem Patient wird in folgender Weise das Arbeitsblatt besprochen: „Sie haben auf Ihrem Schema angegeben, dass häufige Trinksituationen im Bereich der unangenehmen Gefühlszustände vorkommen. Konkret haben Sie bemerkt, dass Sie Alkohol konsumieren, wenn Sie sich einsam und traurig fühlen. Wenn Sie dieses Verhalten beibehalten, wäre der kurzfristige Vorteil, dass Sie sich in dieser Situation für den Moment eine Erleichterung schaffen. Einen langfristigen Vorteil konnten Sie nicht finden. Bei einer Veränderung in Ihrem Konsumverhalten beschreiben Sie den kurzfristigen Nachteil darin, dass sie lernen müssten, diese Situation auszuhalten. Der langfristige Vorteil bestünde jedoch darin, dass Sie dauerhaft eine bessere Lebensqualität hätten, sich weniger zurückziehen würden und besser soziale Kontakte knüpfen könnten, ist das richtig?“ Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile künftiger Veränderungen im Konsumverhalten steht somit auch die Frage im Raum, ob sich der Aufwand der angestrebten Veränderung in einem angemessenen Verhältnis zu dem Nutzen der Veränderung verhält. Wichtig dabei ist nun, dem Patient zu verdeutlichen, dass nicht alle seine Probleme auf einen Schlag gelöst werden können, jedoch eine Zielentscheidung, einen Schritt in die richtige Richtung wäre. Die entsprechende Rückmeldung sieht folgendermaßen aus (vgl. Lindenmeyer, 2001): „Wissen Sie, es gibt da kein absolut ’Richtig’ und ’Falsch’. Entscheidend ist vielmehr, dass Sie Ihre bisherigen Trinksituationen untersuchen, um zu einer begründeten Entscheidung dahingehend zu gelangen, in welchen Situationen Sie künftig weiterhin Alkohol trinken werden und in welchen Situationen sie künftig besser auf jeglichen Alkohol verzichten. Lassen Sie uns das bitte gemeinsam für einige Ihrer Trinksituationen 83 (IDSTA) durchgehen, und die kurz- und langfristigen Folgen von Abstinenz vs. Weitertrinken gegeneinander abwägen.“ 2) Einschätzung von unrealistischer Alkoholwirkungserwartung und erkennen der Selbstwirksamkeit Über die Fragestellung, wann es dem Patienten gelingt, kleine Mengen (moderat) Alkohol zu trinken und sich dabei gut zu fühlen, findet eine Überleitung zum Thema der Selbstwirksamkeit statt. Bandura (1986) zit. nach Petry (1996) hat die Selbstwirksamkeit als einen kritischen und entscheidenden Faktor der Verhaltensänderung beschrieben. Nach seiner Theorie beeinflussen kognitive Erwartungen die Auftretenswahrscheinlichkeit und Beständigkeit menschlichen Verhaltens und damit auch die Bewältigung problematischer Verhaltensweisen. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist demnach die Überzeugung, dass man sich ein bestimmtes Verhalten aneignen und es ausführen oder eine Aufgabe bewältigen kann. Bezogen auf das Abstinenzprinzip wird dabei zwischen positiven Selbstwirksamkeitserwartungen (Selbsteinschätzung, die angestrebte Abstinenz aufrechterhalten zu können) und negativen Selbstwirksamkeitserwartungen (angenommene Unfähigkeit, das Problem nicht ohne Alkohol lösen zu können) unterschieden. Das bedeutet, dass innerhalb einer Behandlung negative Erwartungsmuster abgebaut und positive Erwartungsmuster gefördert werden sollen. Somit besteht das Ziel in diesem Behandlungsschritt darin, dem Patienten zu verdeutlichen, dass er Veränderungspotential in sich trägt und er durchaus in der Lage ist, an seinem Verhalten etwas verändern zu können. Es sollen ihm Fertigkeiten der Einflussnahme auf die Förderung und Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit vermittelt werden. Oft gehen Patienten davon aus, in bestimmten Situationen machtlos zu sein und nicht anders als mit Alkoholkonsum reagieren zu können. Dabei wird außer acht gelassen, dass es in unzähligen anderen Alltagssituationen dem Patienten gelingt, seine Gefühle und Gedanken ohne die Zuhilfenahme von Alkohol zu regulieren und sein Verhalten zu steuern. Weiter bestehen bei den Patienten oft unrealistische, positiv verzerrte Alkoholwirkungserwartungen. Mit Hilfe „ausbalancierten Placebodesigns“ konnte der Einfluss einer Alkoholwirkungserwartung nachgewiesen werden (Samson, 2000 zit. n. Lindenmeyer, 2005). Damit wurde festgestellt, dass die tatsächliche Wirkung von Alkohol nicht nur die Folge der unmittelbar chemischen Alkoholwirkung im Körper, sondern immer auch als Ergebnis von Wirkungserwartungen des Trinkenden ist. Bis zu einer mittleren Blutalkoholkonzentration verspürten Personen, die irrtümlicherweise annahmen, keinen Alkohol zu trinken, eine wesentlich geringere Alkoholwirkung. Hingegen verspürten Personen, die irrtümlicherweise annahmen, Alkohol zu trinken, auch eine tatsächliche Alkoholwirkung, obwohl sie alkoholfreie Getränke zu sich nahmen (Samson, 2000 zit. n. Linden- 84 meyer, 2005). Somit spielt der Erwartungseffekt von Alkohol eine große Rolle bei der Entstehung positiver Trinkmotive. Die Alkoholwirkungserwartung bezieht sich auf die im Folgenden dargestellten Bereiche des Verhaltens und Erlebens. Bereiche der Alkoholwirkungserwartung • Kognitive Effekte (z.B. freieres Denken) • Emotionale Effekte (z.B. Euphorisierung, Fröhlichkeit) • Soziale Effekte (z.B. Steigerung der Geselligkeit) • Affektregulation • Spannungsreduktion • Sexuelles Empfinden • Steigerung der Aggressivität Sie beinhalten die interpersonalen und intrapersonellen Trinksituationen, die im IDTSA aufgelistet sind. Anhand des Kreislaufs von Erwartungen und erlebter Wirkung können sich im Rahmen der Alkoholmissbrauchentwicklung die unterschiedlichen persönlichen Trinkmotive entwickeln. Dabei tritt die Erfahrung der Selbstwirksamkeit des Patienten immer mehr in den Hintergrund und die positive Alkoholwirkungserwartung in den Vordergrund. Durch das Herausarbeiten der erfolgreichen Bewältigung vergangener Risikosituationen (die mit dem Patienten bereits besprochen wurden und im IDTSA explizit dargestellt sind) soll der Patient für den Prozess seiner Selbstwirksamkeit sensibilisiert werden. Er wird aufgefordert, Situationen zu schildern, in denen es ihm gelang moderat zu trinken und auf die schädigenden Aspekte des Missbrauchs zu verzichten. Dabei soll verdeutlicht werden, dass es innere unangenehme Gefühlzustände und Risikosituationen gibt, bei denen der Patient auf seine Selbstwirksamkeit und Bewältigungsstrategien durchaus vertraut. Anhand einer kleinen, jedoch äußerst effektiven Übung, wird der Patient auf die Selbstwirksamkeit hinsichtlich seiner Stimmung aufmerksam gemacht: „Herr/Frau …. halten Sie Ihre Arme und Hände in die Luft und beginnen Sie, die Hände zu schütteln. Versuchen Sie, sich dabei traurig zu fühlen... . Es funktioniert nicht? Beugen Sie Ihren Oberkörper nach unten auf die Knie, lassen Sie Ihre Arme nach unten fallen und versuchen Sie, sich dabei glücklich zu fühlen…… . Auch das funktioniert nicht? Wie Sie sehen, erreichen Sie mit der Durchführung einer einfachen Aktivität eine Wirkung auf Ihre Stimmung.“ 3) Erarbeitung konkreter Veränderungsmotivation und Zielformulierung Durch das Herausarbeiten der Selbstwirksamkeit und der Gegenüberstellung von Situationen, in denen es dem Patienten nicht gelingt, Alkohol moderat einzusetzen, findet 85 eine Differenzierung der problematischen und unproblematischen Trinksituationen statt. Somit lernt der Patient seinen individuellen situativen Kontext seines unproblematischen (z.B. ausgewogener innerer Zustand, mit netten Menschen zusammen) sowie seines problematischen (z. B. unangenehme Gefühlszustände, alleine in der Wohnung) Alkoholkonsums kennen. Diese Differenzierung und auch das Erkennen der Vor und Nachteile sowohl kurz- als auch langfristig, sind entscheidend für eine Zielfindung. In folgender Weise wird dem Patienten dies rückgemeldet: „Wir haben nun festgestellt, dass Sie den Alkohol manchmal einsetzen, um einen inneren unangenehmen Gefühlszustand zu beeinflussen. Dabei haben Sie auf ihrem Arbeitsblatt vermerkt, dass dies Ihnen nur kurzfristig Hilfe leistet, langfristig jedoch kein Erfolg zu erwarten ist, ja sogar eher mit einer Verschlimmerung der unangenehmen Stimmung zu rechnen ist.“ Die im Folgenden aufgeführten Fragen, soll der Patient für sich beantworten, um die selbstbestimmte Zielformulierung zu erkennen. Fragen zur Absichtsplanung/ Zielfindung • Was kostet es mich, in manchen Situationen auf Alkohol zu verzichten? • Was bringt es mir, auf Alkohol in manchen Situationen zu verzichten? • In welchen Situationen ist es ganz besonders wichtig in Zukunft auf Alkohol zu verzichten damit ich noch handlungsfähig bleibe und mittel bis langfristig meine Probleme aktiv lösen kann? • In welchen Lebensbereichen möchte ich weiterhin Alkohol konsumieren? • Bei welchem inneren Gefühlszustand ist es risikoreich Alkohol zu konsumieren? • An welchem Ort sollte ich drohende negative Konsequenzen nach Alkoholkonsum beachten? • Fragen zur Absichtsplanung/ Zielfindung • Welche Erkenntnisse ziehe ich aus meinem neuen Wissen? Oftmals handelt es sich bei der Zielformulierung um eine Risikoabwägung noch nicht eingetretener aber möglicherweise eintretender Konsequenzen. Die Vier-Felder-Matrix dient als Entscheidungsgrundlage für die Zielformulierung. Somit werden alle Situationen, in denen der Patient künftig verbindlich auf Alkohol verzichten möchte, auf eine Punktabstinenzkarte (siehe Anhang) eingetragen. Zum Abschluss der Sitzung wird der Patient aufgefordert, offene Fragen zu stellen. Er wird für seine Beiträge, seine Offenheit und seine Mitarbeit gewürdigt. Es erfolgt eine gemeinsame kurze Zusammenfassung des Stundeninhalts und der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, die zu Dokumentationszwecken in ein Stundenprotokoll eingetragen werden. 86 5.2.5 Sitzung 4 (Strategien, Umgang mit Rückschlägen) Die vierte Sitzung kann mit den Hauptzielen Handlungsstrategien und Erkennen von Ressourcen zusammengefasst werden. Inhalte/ Ziele 1) 2) 3) 4) Schaffung von Handlungsstrategien Ressourcencheck Umgang mit Rückschlägen Ausgabe des Fragebogens SOKRATES 1) Schaffung von Handlungsstrategien Nachdem in der dritten Sitzung die konkrete Veränderungsmotivation und die Absichtsbildung im Mittelpunkt standen, erfolgt in der vierten Sitzung die Erarbeitung einer geeigneten Strategie, um eine dauerhafte Veränderung zu erreichen. Dabei fällt die Einhaltung der vereinbarten Veränderung (Punktabstinenz) den Patienten umso leichter, je mehr Alternativressourcen zu Verfügung stehen. Im Falle von depressiven Patienten kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund ihrer Komorbidität genau diese Ressourcen oft vernachlässigt wurden. Dies geschieht aufgrund der typischen negativen Denkmuster depressiver Patienten. Zum Beispiel durch negative Verallgemeinerungen wie „keiner liebt mich“, „nie gelingt mir etwas“ oder aber auch kognitive Fehler, die Selbstzweifel, Abwertungen der eigenen Person und eine negative Sicht der eigenen Lebenssituation und Zukunft beinhalten (Kühner & Weber, 2001). Diese automatisch ablaufenden Denkmuster hindern den Patienten bei der Ausführung positiver Handlungsalternativen. Depressive Patienten neigen somit dazu, ihre Inaktivität und ihren Rückzug als Beweis für ihre Unzulänglichkeit und ihre Hilflosigkeit zu interpretieren (Beck, 1997). Damit sind sie in einem Teufelskreis gefangen, in dem Selbstwirksamkeit des Individuums sinkt. Somit gilt es den Patient zu vermitteln, dass sie selbst durch eine kleine Aktivität eine Verbesserung des inneren Zustandes erreichen können. Hier kann auf die Übung und den Inhalt der vorangegangenen Sitzung zurückgegriffen werden. Dabei sollte jedoch auch deutlich werden, dass es Situationen gibt, in denen es nicht leicht ist, etwas zu verändern. An dieser Stelle kommt das umfangreiche therapeutische Stationsangebot zum Tragen. Hier kann der Patient über die gewonnenen Erfahrungen lernen, intensive, erholsame, bestätigende Erlebnisse (Schaffung alternativer Ressourcen) ohne Alkohol zu haben (vgl. Kapitel 5.1.3 Der therapeutische Stationsalltag). 87 Aktivität Inhalte Progressive Muskelrelaxation (Jacobson) Vermittlung der Grundübung von PMR; Hinweis auf alternative Möglichkeit zum Umgang mit Nervosität, vegetativen Dysregulationen und Schlafstörungen. Genussgruppe Anregung, über Zufriedenheitserlebnisse zu berichten; Erarbeitung der Genussregeln, Erarbeitung angenehmer Aktivitätenliste, Förderung von bewusster Wahrnehmung von Genuss. Bewegungsgruppen Frühsport, Walking, Wirbelsäulengymnastik, Kraftraum. Förderung des eigenen Körpererlebens und der Eigenverantwortung für die körperliche Gesundheit, Aktivierung. Schlaftraining Förderung der Schlafhygiene; gesundes Verhalten im Umgang mit Schlafstörungen erlernen. Arbeitsversuche auf Arbeitsversuchsplätzen Überprüfung physischer und psychischer Belastbarkeit im beruflichen Kontext. Vorbereitung auf die berufliche Wiedereingliederung. Soziales Kompetenztraining Förderung von Kommunikation, sozialen Kompetenzen, Kontaktfähigkeit und des Beziehungserlebens; Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung; Ergo- und Arbeitstherapie Handwerkliches und kreatives Arbeiten. Bürotraining, Holzwerkstatt, Druckerei, Soziokreativgruppe, Alltagstraining. Förderung von Alltagsbewältigung und Anregung für Freizeitgestaltung. Gruppenaktivitäten auf Station, Meetings Förderung von Aktivität und Gruppenzusammenhalt; Tagesstrukturierung; Verhaltensbeobachtung auf Station. Im Stationsalltag lernt der Patient alternative Handlungsstrategien kennen, die er im Alltag „draußen“ auf seinen problematischen Umgang mit Alkohol übertragen kann. Zum Beispiel kann der Patient in Trinksituationen, in denen er Alkohol zur Entspannung einsetzt, auf die Technik der Progressiven Muskelentspannung zurückgreifen. Dient der Alkoholkonsum in kritischen Situationen als Belohnungsmittel, kann über die Schaffung von Zufriedenheitserlebnissen auf die Inhalte der Genussgruppe zurückgegriffen werden. Die Verwendung der o.g. Aktivitäten dient dazu, dem Motivationsverlust, der Inaktivität und Beschäftigung mit depressiven Ideen entgegenzuwirken und die Entwicklung von Interessen und Handlungsalternativen zum Trinkverhalten zu fördern. Konkret wird dabei herausgearbeitet, wie es dem Patienten vor, während und nach der Aktivität geht, was dazu dient, den genauen Gefühlszustand zu erfassen. Der Patient wird somit zur Selbstbeobachtung angeregt. Thematisiert wird in diesem Zusammenhang auch, dass es schwer fallen kann, sich zu Aktivitäten aufzuraffen, dass aber auch Gefühle der Zufriedenheit und Stolz hinterher auftreten können. Dem Patient soll verdeutlich werden, dass je länger eine Erfahrung anhält, desto eher ist das Gefühl abrufbar, welches mit der Erfahrung verbunden ist. Als Beispiel dient folgende Formulierung: „Geht man zum ersten Mal zum Sport, weiß man noch nicht, wie gut es sich hinterher anfühlen wird. Geht man zum zweiten Mal zum Sport, hat man eine ungefähre Ahnung, wie es sich hinterher anfühlen wird. Wenn man zum hundertsten Mal zum Sport geht, weiß man ziemlich genau, wie gut es sich hinterher anfühlt und genau das hilft, um den inneren „Schweinehund“ zu überwinden.“ 88 Es soll hervorgehoben werden, dass Regelmäßigkeit ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung von erwünschter Veränderung ist. Die bevorzugte Aktivität sollte regelmäßig stattfinden und am besten ritualisiert in den Alltag eingebaut werden. 2) Ressourcencheck Neben den therapeutischen Angeboten auf der Station sollte auch geprüft werden, welche Aktivitäten und Alternativen bei dem Patienten bereits außerhalb des Stationsalltags vorhanden sind, oder ob alternative Ressourcen, die früher einmal vorhanden waren, wieder reaktiviert werden können. Somit soll der Patient angeleitet werden, entsprechende Aktivitäten von sich aus in seiner Freizeit zu unternehmen. Dies sollte während der stationären Behandlung außerhalb der offiziellen Behandlungszeiten geschehen. Wochenend- und Tageserprobungen ermöglichen dieses Vorgehen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Übertragbarkeit in den Alltag nach Beendigung der stationären Behandlung zu richten. Gerade bei depressiven Patienten entsteht häufig die Schwierigkeit von Entscheidungsambivalenzen. So können die Patienten nicht auf die oben dargestellten positiven Aktivitäten zurückgreifen, weil sie in der konkreten Situation nicht wissen, was das Richtige für sie ist (gehe ich lieber in die Badewanne oder ins Kino oder rufe ich besser einen Freund an?). In solchen Fällen kann es hilfreich sein, festgelegte Vorgaben auf einen Zettel zu schreiben und in eine Kiste zu tun. In einer entsprechenden Risikosituation kann der Patienten dann einen Zettel ziehen und weiß, dass diese Aktivität ihn in einen guten Gefühlszustand bringt und somit immer richtig ist. 3) Umgang mit Rückschlägen Jeder Mensch, der etwas verändern möchte, ist mit dem Phänomen Rückschläge konfrontiert. So ist davon auszugehen, dass es den meisten Menschen nicht gelingt, die vereinbarte Zielabsicht immer konsequent einzuhalten. In diesem Schritt geht es darum, dem Patienten eine andere Sichtweise im Umgang mit Rückschlägen zu vermitteln. Dabei werden Rückschläge als etwas durchaus Menschliches und Normales dargestellt. Es wird hervorgehoben, dass die Veränderung einer lang eingeschliffenen Verhaltensweise Geduld benötigt. Es geht darum, dem Patienten zu vermitteln, sich aufgrund eines Rückschlages nicht entmutigen zu lassen, sondern dass es sich lohnt, weiterhin an sich selbst zu arbeiten. Beispielhaft kann das Bild von Autobahnen und neuen Trampelpfaden benutzt werden: Man versucht einen neuen Pfad der Wegbeschreitung anzulegen und ertappt sich dabei, dass man schnell wieder auf der alten Autobahn landet. Somit sollen Verhaltensrückfälle und Überschreitungen des vorge- 89 nommenen Ziels als Gelegenheit verstanden werden, mehr über Risikosituationen zu lernen und das Bewältigungsverhalten zu optimieren. 4) Zusammenfassung und Ausgabe des Fragebogens SOKRATES Da dem Patienten zu Behandlungsbeginn der Fragebogen SOKRATES (Wetterling & Veltrup, 1997) vorgegeben wurde, wird dieser Fragebogen erneut zur Vorbereitung für die letzte Sitzung ausgegeben. Der Patient wird gebeten, den ausgefüllten Fragebogen zur letzten Sitzung mitzubringen. Zum Abschluss der Sitzung wird der Patient aufgefordert, offene Fragen zu stellen. Er wird für seine Beiträge, seine Offenheit und seine Mitarbeit gewürdigt. Es erfolgt eine gemeinsame kurze Zusammenfassung des Stundeninhalts und der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, die zu Dokumentationszwecken in ein Stundenprotokoll eingetragen werden. 5.2.6 Sitzung 5 (Abschlussgespräch, SOKRATES, Netzwerk) Die fünfte Sitzung kann mit dem Hauptziel Behandlungsabschluss und Aufzeigen des regionalen Netzwerkes zusammenfasst werden. Inhalte/ Ziele 1) 2) Abschlussgespräch und Besprechung des Fragebogens, Zusammenfassung Aufzeigen des regionalen Netzwerkangebotes und Ermutigung Unterstützungsangebote wahrzunehmen, Patientenliteratur 1) Abschlussgespräch und Besprechung des Fragebogens, Zusammenfassung Zunächst werden dem Patienten die Ergebnisse der Veränderungsmessung mitgeteilt. Da es sich dabei um Stadien der Veränderungsbereitschaft handelt, kann dem Patienten nochmals anhand des Ergebnisses sein Status Quo aufgezeigt werden. Dabei wird auf die Rückmeldung in der ersten Sitzung zurückgegriffen. Zeigt sich anhand des Testergebnisses, dass sich der Patient wieder in der Phase der Precontemplation befindet, wird ihm dies entsprechend rückgemeldet: „Herr/Frau…, das Testergebnis zeigt, dass Sie hinsichtlich einer konkreten Veränderung Ihres Alkoholkonsums noch nicht eindeutig eine Entscheidung treffen konnten. Dennoch haben Sie sich in den letzten Sitzungen mit der Thematik befasst. Das ist bemerkenswert. Da ich Ihren Alkoholkonsum als problematisch einschätze, wäre es gut, wenn Sie ein weiterführendes Behandlungsangebot in Anspruch nehmen, um sich weiter mit ihrem Alkoholkonsum auseinanderzusetzen:“ 90 Zeigt das Testergebnis die Phase der Contemplation wird dem Patienten das Ergebnis auf folgende Weise vermittelt: „Herr Frau…, das Testergebnis zeigt, dass Sie eindeutig Schritte zu Veränderung hinsichtlich Ihres problematischen Alkoholkonsums unternommen haben. Das ist sehr beeindruckend. Diese Motivation wird es Ihnen ermöglichen, die bearbeiteten Schritte in den Alltag umzusetzen.“ Gleichzeitig dient der SOKRATES dem Behandler dazu, einen möglichen Erfolg hinsichtlich einer angestrebten Veränderung zu dokumentieren. Das Abschlussgespräch kann in Form einer gegenseitigen Bilanzierung stattfinden. Dabei wird der Patient aufgefordert, kritisch Rückmeldung zu geben. Der Behandler zeigt dabei seine eigene Perspektive einer möglichen Veränderung des Trinkverhaltens des Patienten. Hier kann der Beginn der Behandlung in Erinnerung gerufen werden. Das Abschlussgespräch dient vor allem auch dazu, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, offene Fragen zu stellen und seine Sichtweise der Dinge darzustellen. Für eine Zusammenfassung können die Stundenprotokolle unterstützend eingesetzt werden. Die folgenden Fragestellungen erleichtern eine Wiederholung und Zusammenfassung der Behandlungssitzungen: Fragestellung zur Wiederholung/Zusammenfassung • In welchen kritischen Situationen strebt der Patient an, künftig auf Alkohol verzichten, in welchen Situationen wird er weiterhin Alkohol trinken? • Wo lauern in nächster Zeit die größten Risiken? • Konnte der Patient schon Erfahrungen mit der angestrebten Zielerreichung sammeln? • In welchen Punkten konnte Einigkeit zwischen Patient und Behandler erzielt werden, wo bestehen weiterhin unterschiedliche Auffassungen? • Was wird der Patient nach der Entlassung tun? Was soll sich im Verlauf der nächsten Wochen ereignen? Dem Patienten sollte Anerkennung für die gemeinsam geleistete Arbeit ausgesprochen werden. Bei positiver Veränderung sollten diese direkt dem Patienten zugerechnet werden (Lob aussprechen). Durch Betonung der Fähigkeiten des Patienten, sein Leben zu verändern und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wird die Selbstwirksamkeit unterstützt. Dabei unterstreicht das Ausdrücken von Hoffnung, Optimismus und Zuversicht die Selbstwirksamkeit des Patienten. 2) Aufzeigen des regionalen Netzwerkangebotes und Ermutigung Unterstützungsangebote wahrzunehmen Aufzeigen des persönliches Netzwerk und regionales Netzwerk. Einsamkeit und interpersonelle Konflikte sind zentrale Risikosituationen für viele Patienten. Einerseits ist 91 Einsamkeit ein sehr unangenehmes Gefühl (das kurzfristig mit dem Suchtmittel betäubt werden kann). Andererseits findet der Suchtmittelkonsum oft in Gesellschaft statt, was dem Patienten das Gefühl gibt, nicht mehr alleine zu sein und so die Einsamkeit in den Griff zu bekommen. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass alle Bemühungen zur Zielerreichung des Patienten durch ein soziales Netzwerk und Stützsystem gefördert werden können. Oftmals besteht ein solches soziales Stützwerk, ohne dass die Patienten bewusst davon Gebrauch machen. Hier gilt es den Patienten auf sein Netzwerk aufmerksam zu machen. Wer gehört zu meinem Netzwerk? Familie, PartnerIn, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Berater, Arzt? Gibt es in meinem Netzwerk Beziehungen und Kontakte, die nicht gut für mich sind, die mich nicht weiterbringen oder vielleicht sogar schaden? Dem Patienten soll verdeutlicht werden, dass er durch den Aufbau eines persönlichen Netzwerkes Hilfsquellen aufbauen kann, die unterstützend zu seiner Zielerreichung führen. Der Patient wird angeleitet, in problematischen Situationen Hilfe zu suchen (z.B. einen Freund anrufen), bevor Alkohol konsumiert wird. Erfahrungsgemäß ist es leichter, mit Menschen zusammen eine Veränderung zu erwirken als alleine. So soll der Patient ermutigt werden, das regionale, suchtspezifische Netzwerkangebot in Anspruch zu nehmen. Anschließende Kontakte zu anderen Einrichtungen, wie Suchtberatungsstellen, medizinische oder soziale Betreuungen sind wichtige Anlaufstellen für weitergehende Unterstützung. Zum Beispiel kann durch die Inanspruchnahme von Beratungs- und Behandlungsgesprächen in einer Suchtberatungsstelle oder bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten die Umsetzung der Änderungsziele systematisch unterstützt werden. Hinsichtlich eines Besuchs von Selbsthilfegruppen besteht derzeit noch oftmals die Problematik, dass die bestehenden Gruppen abstinenzorientiert sind. Das heißt, diese Selbsthilfegruppen lassen nur Personen zu, die bereit sind, komplett auf Alkohol zu verzichten. Durch die Zunahme von Programmen wie „Kontrolliertes Trinken“ (Körkel, 2003) oder eben der „Punktabstinenz“ (Lindenmeyer, 2001) und der Aufnahme von nicht abstinenzorientierten Programmen in Suchtberatungsstellen sind Selbsthilfegruppen für diese Patientengruppe erst im Aufbau. Dennoch sollte der Patient für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ermutigt werden, denn gerade für depressive Patienten besteht bzgl. Selbsthilfegruppen ein ausgebautes Netzwerksystem (z.B. Emotions Anonymous, Selbsthilfegruppen für emotionale Gesundheit). Weiterhin sollten dem Patienten mit dem Aufzeigen des regionalen Netzwerkes die Möglichkeiten offen gelegt werden, die er bei einem Nichtgelingen seiner Zielvorstellung bzgl. des Alkoholkonsums in Anspruch nehmen kann, um somit auch einer Verschlimmerung seines Missbrauchs und den möglichen Folgen, vorzubeugen. 92 Sollte der Patient an Literatur interessiert sein, können ihm Literaturtipps zur weiteren thematischen Vertiefung gegeben werden. Patientenliteratur • Schneider, R. (2001). Die Suchtfibel. Informationen zur Entstehung und Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Schneider-Verlag: Bartmannsweiler. • Wissenschaftliches Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) (2003). Alkoholabhängigkeit. DHS Info Band 1. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: Hamm. • Körkel, J. (2001). Rückfall muss keine Katastrophe sein. Blaukreuz Verlag: Wuppertal. • Lindenmeyer, J. (2005). Lieber schlau als blau. Entstehung und Behandlung von Alkoholund Medikamentenabhängigkeit. Beltz: Weinheim. • Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) (2008). Umgang mit Alkohol. Informationen Tests und Hilfen in 5 Phasen. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen- DHS: Hamm. In der Tabelle sind gängige Angaben über Patientenliteratur aufgeführt. Eine ausführliche Darstellung mit Angabe von Selbsthilfe-Kontaktadressen befindet sich im Anhang. Zum Abschluss sollte dem Patienten gegenüber nochmals eine authentische Wertschätzung ausgedrückt werden, die Optimismus für die Zukunft beinhaltet. 93 6 Evaluation des Behandlungskonzeptes Die Evaluation des Kurzinterventionsprogramms wird mittels eines leitfadengestütztem Experteninterviews durchgeführt. Diese Methode der qualitativen Sozialforschung wird zunächst allgemein charakterisiert, bevor im Anschluss ihre konkrete Anwendung im Kontext der vorliegenden Thematik beschrieben wird. 6.1 Grundlagen Qualitativer Sozialforschung Die qualitative Sozialforschung ist etwa ab 1970 als eine neue Form der empirischen Sozialforschung entwickelt worden. Bis zu diesen Zeitpunkt war bislang nur der quantitativ-standardisierte Forschungsansatz wissenschaftlich legitimiert (Lamnek, 2005). Charakteristisch für den quantitativen Forschungsansatz ist nach Bortz und Döring (2002) die „Quantifizierung“ bzw. Messung der Beobachtungsrealität in Form numerischer Daten. Ferner besteht ein hohes Maß an Kontrolle über die Untersuchungsbedingungen: quantitative Befragungen sind standardisiert verlangen vom Interviewten inhaltlich exakte Antworten und vom Interviewer ein standardisiertes Verhalten. Sie zielen somit darauf ab, von der in der gesamten Stichprobe erfolgten Beobachtung von Gesetzmäßigkeiten auf einzelne Personen schließen zu können (Deduktion: lateinisch deducere- Ableitung aus dem Allgemeinen auf das Besondere) (Bortz & Döring, 2002). Die qualitative Sozialforschung hingegen verzichtet auf Messungen. Sie arbeitet mit der Erfahrungsrealität. Dabei operieren qualitative Befragungen meist mit offenen Fragen, die dem Befragten einen Spielraum bzgl. der Antwort lassen. Die Interaktion zwischen Proband und Interviewer, sowie die Eindrücke des Interviewers werden somit als Informationsquelle benutzt (Flick, 2005). Qualitative Sozialforschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Die Erklärung individuellen Erlebens und Verhaltens soll für möglichst viele Menschen gültig sein (Induktion: lateinisch inducere- vom Besonderen auf das Allgemeine schließen) (Flick, 2005). Nach Bortz und Döring (2002) ist das Ziel qualitativer Sozialforschung demnach die Rekonstruktion der Bedeutung sozialer Wirklichkeiten, sozialer Abläufe und Deutungsmuster. Nachdem die qualitative Sozialforschung in ihren Anfängen als Modeerscheinung hinterfragt wurde, haben sich mittlerweile die qualitativen Methoden und die quantitativstandardisierten Methoden zu zwei eigenständigen Gebieten empirischer Sozialforschung etabliert. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen, in denen sich Anhänger beider Disziplinen gegenseitig die wissenschaftliche Legitimation absprechen. Eine nüchterne Betrachtung hingegen prüft, bei welchem Untersuchungsgegenstand und welcher Fragestellung welcher Forschungsansatz indiziert ist (Flick et al., 2005). Denn 94 beide Ansätze schließen einander keineswegs aus: „Durch den Einsatz von „naturalistischen“ Methoden, wie teilnehmende Beobachtung, offenen Interviews oder Tagebüchern, lassen sich erste Informationen zur Hypothesenformulierung für anschießende, standardisierte und repräsentative Erhebungen gewinnen….; hier bilden qualitative Studien wenn nicht die Voraussetzung für, so zumindest eine sinnvolle Ergänzung zu quantitativen Studien“ (vgl. Flick et al., 2005 S.25). 6.1.1 Prinzipien qualitativer Forschung Die Grundlage einer Methode bilden bestimmte Prinzipien, die eine Beurteilung und eine Auswahl von Untersuchungsstrategien anleiten sollen. Methodologische Prinzipien sind somit allgemeine Forderungen an die Untersuchungsstrategien und Methoden des Wissenschaftsgebietes (Gläser & Laudel, 2004). Die für den Qualitativen Forschungsansatz geltenden Prinzipien/ Standards werden im Folgenden nach Mayring (2002) beschrieben. Prinzipien/ Standards qualitativer Forschung • • • • • • • • • • • • Einzelfallbezogenheit Offenheit Forscher-Gegenstand-Interaktion (Kommunikation) Problemorientierung Deskription und Interpretation (Vorverständnis) Induktion Methodenkontrolle Introspektion Ganzheit Historizität Regelbegriff Quantifizierbarkeit Die Einzelfallbezogenheit beschreibt, dass Ergebnisse und die Verfahrensweisen sich wohl von den einzelnen Fällen wegbewegen können, jedoch immer wieder auf die Einzelfälle bezogen werden. „Im Forschungsprozess müssen immer auch Einzelfälle mit erhoben und analysiert werden, an denen die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen laufend überprüft werden kann“ (Mayring, 2002, S.27). Das Prinzip der Offenheit dem Untersuchungsgegenstand gegenüber wird als ein Hauptprinzip interpretativer Forschung dargestellt. „Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert“ (Mayring, 2002 S. 28). Nach qualitativem Denken darf die Beziehung des Forschers zu seinem Gegenstand (Forscher-Gegenstands-Interaktion) nicht statisch gesehen werden. „Forschung wird als Interaktionsprozess aufgefasst, in dem sich Forscher und Gegenstand verändern“ 95 (Mayring, 2002 S. 32). Qualitatives Denken soll problemorientiert direkt an der praktischen Problemstellung ihres Gegenstandsbereiches ansetzen und seine Ergebnisse wieder auf die Praxis beziehen. „Der Ansatzpunkt humanwissenschaftlicher Untersuchungen sollen primär konkrete, praktische Problemstellungen im Gegenstandsbereich sein, auf die dann auch die Untersuchungsergebnisse bezogen werden können“ (Mayring, 2002 S. 35). Es wird davon ausgegangen, dass humanwissenschaftliche Gegenstände immer gedeutet und interpretiert werden müssen; dies bedeutet, dass die Deutung nie voraussetzungslos möglich ist. Das eigene Vorverständnis beeinflusst somit immer die Interpretation (Grundsatz der Hermeneutik). „Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden“ (Mayring, 2002 S. 30). Qualitatives Denken lässt induktives Vorgehen explizit zu, um es dann aber auch zu kontrollieren und zu überprüfen. „In sozialwissenschaftlichen Untersuchungen spielen induktive Verfahren zur Unterstützung und Verallgemeinerung der Ergebnisse eine zentrale Rolle, sie müssen jedoch kontrolliert werden“ (Mayring, 2002 S. 36). Die Methodenkontrolle beschreibt als Standard: „Der Forschungsprozess muss trotz seiner Offenheit methodisch kontrolliert ablaufen, die einzelnen Verfahrensschritte müssen expliziert, dokumentiert werden und nach begründeten Regeln ablaufen“ (Mayring, 2002 S. 29). Ob die Introspektion, die Analyse des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns, eine wissenschaftliche Methode sei, wurde vor allem in der Psychologie lange diskutiert. Im qualitativen Denken wird sie wie folgt aufgenommen: „Bei der Analyse werden auch introspektive Daten als Informationsquelle zugelassen. Sie müssen jedoch als solche ausgewiesen, begründet und überprüft werden“ (Mayring, 2002 S. 31). Ein Merkmal der Subjektauffassung qualitativen Denkens ist die Betonung der Ganzheitlichkeit des Menschen. Der Standard lautet: “Analytische Trennungen in menschliche Funktion- bzw. Lebensbereiche müssen immer wieder zusammengeführt werden und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert und korrigiert werden“ (Mayring, 2002 S. 33). Die Vernachlässigung der historischen Dimension hat in den Humanwissenschaften zu bemerkenswerten Fehlinterpretationen geführt. „Die Gegenstandsauffassung im qualitativen Denken muss immer primär historisch sein, da humanwissenschaftliche Gegenstände immer eine Geschichte haben, sich immer verändern können“ (Mayring, 2002 S. 34). Das Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens fordert, dass die Wissenserhebung expliziten Regeln folgen muss. Nur dann können andere Wissenschaftler rekonstruieren, auf welchem Weg jemand zu dem Ergebnis gelangt ist. „Im humanwissenschaftlichen Gegenstandsbereich werden Gleichförmigkeiten nicht mit allgemein gültigen Gesetzen, sondern besser mit kontextgebundenen Regeln abgebildet“ (Mayring, 2002 S. 37). Eine wichtige Funk- 96 tion des qualitativen Denkens ist es, sinnvolle Quantifizierungen zu ermöglichen. Aufgrund dieses integrativen Verständnisses wird der Gegensatz qualitativ-quantitativ entschärft und Verbindungslinien aufgezeigt. „Auch in qualitativ orientierten humanwissenschaftlichen Untersuchungen können – mittels qualitativer Analyse – die Voraussetzungen für sinnvolle Quantifizierungen zur Absicherung und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse geschaffen werden“ (Mayring, 2002 S. 38). Diese Prinzipien qualitativen Denkens bilden die Grundlage zur Entwicklung qualitativer Untersuchungspläne und –verfahren. Mit Hilfe der Prinzipien kann jedoch auch überprüft werden, inwieweit humanwissenschaftliche Untersuchungen qualitatives Denken ausreichend berücksichtigen. 6.1.2 Qualitative Interviews Interviews gehören zu den gebräuchlichsten Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Der Begriff bezeichnet eine Gruppe von Verfahren, die entlang unterschiedlicher Dimensionen (Interviewsteuerung, Grad der Strukturierung, Standardisierung) geordnet werden können (Mey & Mruck, 2007). Häufig wird vom Qualitativen Interview gesprochen, als ob es ich dabei um ein Verfahren handelte. Dies ist jedoch insofern nicht der Fall, da unterschiedliche Forschungsstile, theoretische Ansätze /Schulen unterschiedliche Varianten qualitativer Einzelbefragungen hervorbringen. Mey und Mruck (2007) geben an, dass mittlerweile eine Fülle an Interviewvarianten und – Bezeichnungen existieren. Zudem gibt es Überschneidungen, die in verschiedenen Fachgebieten auf scheinbare Zusammenhänge verweisen. Im Folgenden werden drei Grundtypen qualitativer Interviews erläutert. Eine ausführliche Übersicht über Formen qualitativer Interviews gibt Lamnek (2005). 6.1.2.1 Narrative Interviews Das narrative Interview wurde in den 1970er Jahren, zunächst im Zusammenhang mit einer Studie über kommunale Machtstrukturen von Fritz Schütze entwickelt (Flick, 2005). In den darauf folgenden Jahren avancierte es als narrativ-biographisches Interview zu der zentralen Interviewtechnik innerhalb der Biographieforschung (Schütze, 1983 zit. n. Mey & Mruck, 2007). Das narrative Interview wird in der Regel ohne Leitfaden eingesetzt und in drei Phasen (Eröffnung, Nachfrageteil, Bilanzierung) unterteilt. Somit gehört es zu den offenen und auf Erzählung zielenden Verfahren. Bei der Anwendung wird sehr viel Wert auf die erzählgenerierende Eröffnungsfrage gelegt, die eine Stegreiferzählung hervorrufen soll. Jedoch auch im Nachfrageteil sollen durch sog. immanente Nachfragen, die an Brüchen oder an nicht nachvollziehbaren Erzählstellen einsetzen, weitere Erzählungen generiert werden (Mey & Mruck, 2007). Erst im 97 dritten Teil des Interviews wird auf eine abstraktere Darstellung abgezielt (insbesondere Argumentationen und Begründungen statt Erzählungen). Die Rolle des Interviewers besteht darin, interessiert zuzuhören und das Erzählverhalten unter anderem auch durch nonverbale Signale zu fördern. Im weiteren Interviewverlauf können die Interviewer dann zu interessiert Nachfragenden werden und erst zum Schluss (Bilanzierung) sollen sie aktiver in die Gesprächsgestaltung eingreifen (Mey & Mruck, 2007). 6.1.2.2 Diskursiv-Dialogische Interviews Der folgende Abschnitt bezieht sich im Wesentlichen auf die Darstellung von Mey und Mruck (2007). Die wichtigste Form des diskursiv-dialogischen Interviews ist das von Andreas Witzel (1982) entwickelte problemzentrierte Interview. Es findet in der sozialwissenschaftlichen Anwendung eine weite Verbreitung. Es grenzt sich insofern vom narrativen Interview ab, als die Interviewsituation wesentlich deutlicher als kommunikatives Geschehen verstanden wird. Während Fragen im narrativen Interview als störend oder als Ablenkung gelten, kommt dem Fragen nach Witzel eine aktive, gestaltende Explorationsfunktion zu. „Zu den Fragetypen, durch die das Interview gesteuert und gemeinsam mit den Befragten gestaltet werden kann, gehören insbesondere die allgemeinen Sondierungen, die im Dienste der Materialgenerierung stehen (Sachnachfragen und Erzählungsaufforderungen) und die spezifischen Sondierungen, die auf eine diskursive Verständnisgenerierung zielen (Zurückspiegelung, Verständnisfragen und Konfrontation)“ (vgl. Mey & Mruck, 2007, S. 252). Die Interviewform hat keinen festen Ablauf; die Interviewenden können schon sehr früh strukturierend in das Gespräch eingreifen, in Themen einführen oder Kommentare oder Bewertungen erbitten (Mey & Mruck, 2007). Ein für das Interview genutzter Leitfaden dient lediglich als Gedächtnisstütze. Zusätzlich kann ein Kurzfragebogen wahlweise vor oder nach dem Interview eingesetzt werden, mit dem wesentliche Rahmendaten erhoben werden können. Mey und Mruck (2007) geben an, dass sich einige Varianten des problemzentrierten Interviews herausgebildet haben, die jeweils mit einer etwas anderen Akzentuierung versehen werden: zum Beispiel episodisches Interview, themenzentriertes Interview, szenisches Interview, Tiefeninterview, personenzentriertes Interview, halbstrukturiertes Interview, Konfrontationsinterview, fokussiertes Interview, Struktur-Dilemma-Interview. Kennzeichnend für diese Verfahrensgruppen ist, im Vergleich mit dem narrativen Interview, die deutlich strukturierendere und aktivere Rolle des Interviewers. Die Ähnlichkeiten der einzelnen Verfahren gehen jedoch teilweise so weit, dass sie als „Spielarten“ des problemzentrierten Interviews gesehen werden können (Mey & Mruck, 2007). Als charakteristisch kann somit betrachtet werden, dass die diskursiv-dialogischen Inter- 98 views zum Anspruch haben, dass die einseitige und künstliche Situation des narrativen Interviews von einem offeneren Dialog abgelöst werden, was Witzel bereits mit der allgemeinen und speziellen Sondierung im Blick hatte (Mey & Mruck, 2007, Flick, 2005). 6.1.2.3 Experteninterviews Es lässt sich noch ein weiterer Interviewtyp abgrenzen, bei dem die Namensgebung nicht aus der Erhebungsart- oder Vorgehensweise resultiert, sondern aus der angezielten Untersuchungsgruppe (Akteure). Nach Mey und Mruck (2007) ist das von Michael Meuser und Ulrike Nagel (1991) eingeführte Experteninterview als Methode der Wahl zu nennen, wenn keine biographischen Inhalte im Mittelpunkt der Erhebung stehen, sondern die Interviewten werden als Akteure in dem von ihnen repräsentierten Funktionskontext angesprochen. Zum Beispiel wurden aus dem Teilgebiet der Sportsoziologie jugendliche Leistungssportler als Akteure befragt, um den sozialen Sachverhalt zu rekonstruieren, weshalb junge Athleten mit Doping beginnen. Dennoch kritisieren die Autoren, dass es trotz wissenssoziologischer Fundierung in der Forschungspraxis oft recht vage bleibt, wer als Experte anzusehen ist und wer nicht und schlagen deshalb bevorzugt den Begriff „leitfadenbasiertes Interview“ vor. Gläser und Laudel (2006) definieren die Begriffe „Experten“ und „Experteninterview“ in ihrer Verwendung folgendermaßen: “Experten sind Menschen, die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte besitzen, und Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschließen“ (vgl. Gläser & Laudel 2006, S. 10). Mieg und Näf (2005) verstehen im Zusammenhang mit dem Experteninterview unter einem Experten jemand, der aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen / Können verfügt. Die Autoren geben folgende Charakteristika für ein Experteninterview an: Experteninterview Hauptmotiv: sachliches Interesse Vorgehensweise: konstruktiv, Sachzusammenhänge werden erhellt, und dies nie gegen den Willen des Befragten Motivation des Befragten im Interview: Sachmotivation, Wissensvermittlung, Wissen und Können Darstellen k.-o.-Kriterium Befragter: Befragter ist keine Experte/hat keine Erfahrung k.-o.-Kriterium Interviewer: fachliche Inkompetenz von Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Experteninterview idealerweise von einem Sachinteresse getragen wird, und im gemeinsam verständigen Gespräch mit dem Experten die Sachverhalte erhellt und die Zusammenhänge aufgezeigt werden. Mieg und Näf (2005) gehen davon aus, dass der Experte von der Motivation geleitet wird, über sein spezifisches Fachwissen / Fachbereich zu berichten. Diese Sachmotivation 99 ist der eigentliche Antrieb für die bereitwillige Unterstützung durch die befragten Experten. Jedoch ist Voraussetzung, dass der Interviewer mittels angemessener Sprachund Themenwahl eine angeregte Befragungssituation aufrechterhalten kann. Dass heißt, auch der Interviewer muss sich für das Interview eine gewisse Sachkenntnis angeeignet haben. 6.1.3 Auswahl der Experten Grundsätzlich entscheidet die Auswahl der Interviewpartner über die Qualität der Informationen, die man erhält. Gläser & Laudel (2006) geben Leitfragen an, die der Expertenauswahl dienlich sind: Fragen zur Expertenauswahl 1. 2. 3. 4. Wer verfügt über die relevanten Informationen? Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben? Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben? Wer von den Informanten ist verfügbar? Die Verfügbarkeit und Bereitschaft potentieller Interviewpartner ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Experten; dies hängt wiederum unter anderem von ihrer Arbeitsbelastung ab. Nach Gläser und Laudel (2006) muss die Auswahl der Interviewpartner nicht vor dem Beginn der Erhebung abgeschlossen sein. So kann es durchaus geschehen, dass in den Interviews auf weitere Gesprächspartner hingewiesen wird. Die Vorüberlegung zu Auswahl der Experten sollte jedoch sichern, dass die wichtigen Typen von Informanten feststehen und für die Gespräche der Interviewleitfaden entwickelt wurde. Neben den Kriterien der langjährigen Erfahrung und dem besonderen Wissen zu einem bestimmten Sachverhalt geben Mieg & Näf (2005) noch zwei weitere Charakteristika zur Expertendefinition an. Zu der Expertenrolle gehören demnach Personen, die aufgrund ihrer Stellung an gesellschaftlichen oder institutionellen Entscheidungsprozessen und Gestaltungsprozessen beteiligt sind und Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung gesellschaftlich anerkannten Zugang zu einem bestimmten Tätigkeitsfeld haben (z.B. Medizinstudium, Arzt). 6.1.4 Interviewleitfaden Der Einsatz von Leitfragen in einem Interview kann mehrere Funktionen erfüllen. Im Vorfeld eines Interviews kann ein Leitfaden dem Forschenden helfen, das Wissen zu organisieren. Er dient als Orientierungsrahmen (Gedächtnisstütze) während des Interviews und kann nach dem Interview als „Checkliste“ eingesetzt werden (Mey & Mruck, 2007). Leitfragen sind somit keine theoretischen Fragen, sondern sind vielmehr auf das 100 Untersuchungsfeld gerichtet, und versuchen, die Informationen zu benennen, die erhoben werden müssen, um die Forschungsfrage zu beantworten (Gläser & Laudel, 2006). 6.1.5 Auswertung Die Auswahl der Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren sollte jeweils auf den Gegenstand und auf die Fragestellung der Untersuchung bezogen sein (Mayring, 2002). Die gängigste Methode zur Auswertung von Experteninterviews ist die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Der Autor unterscheidet drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: Grundformen Qualitativer Inhaltsanalyse • • • Zusammenfassende Inhaltsanalyse (und Kategorienbildung) Explizierende Inhaltsanalyse Strukturierende Inhaltsanalyse In der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird der Ausgangstext auf eine überschaubare Kurzversion reduziert, die nur noch die wichtigsten Inhalte umfasst. Die Zusammenfassung lässt sich weiter für die induktive Kategorienbildung nutzen. Die Kategoriedimension und das Abstraktionsniveau müssen vorher festgelegt werden, welches wiederum mit den theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse begründet werden muss (Mayring, 2002). Mit dieser Definition im Hinterkopf wird das Material Zeile für Zeile durchgearbeitet und passende Textstellen werden der entsprechenden Kategorie zugeordnet (Subsumption). Bei einem erneuten Durchgang wir überprüft, ob Veränderungen im Kategoriesystem vorgenommen werden müssen. Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmtem Thematik, deren weitere Auswertung in zwei Richtungen gehen kann: - Das gesamte Kategoriesystem kann in Bezug auf die Fragestellung interpretiert werden - Die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien kann quantitativ ausgewertet werden. Nach der Überprüfung auf Veränderungen und möglichen Korrekturen beginnt in einem weiteren Schritt die Analyse der einzelnen Interviews, die im Ergebnis in eine Verdichtung des Materials münden soll (Einzelanalyse). In jedem einzelnen Interview werden nur noch die wichtigsten Textstellen berücksichtigt und einer inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen (Lamnek, 2005). So entsteht ein neuer, stark gekürzter und konzentrierter Text. Sowohl die Zusammenfassung als auch die Einzelanalyse sind zentrale Techniken und Methoden der Inhaltsanalyse. Sie zählen gleichzeitig zur Datenaufbereitung sowie zur Datenauswertung. Aufgrund der zentralen Bedeutung wird folgend 101 der Umgang mit Reduktionen im Interviewtext beschrieben. Hier spielt der Umgang mit Propositionen (bedeutungstragende Aussage, die sich aus dem Text ableiten lässt) eine wichtige Rolle (vgl. Mayring 2002, S. 95): Umgang mit Propsitionen im Interviewtext (Mayring, 2002) • • • • • • Auslassen: Propositionen, die an mehreren Stellen bedeutungsgleich auftauchen, werden weggelassen. Generalisation: Propositionen, die durch eine begrifflich übergeordnete, abstrakte Proposition impliziert werden, werden durch diese ersetzt. Konstruktion: aus mehreren spezifischen Propositionen wird eine globale Proposition konstruiert, die den Sachverhalt als Ganzes kennzeichnet und die spezifischen Propositionen überflüssig macht. Integration: eine Proposition, die in einer bereits durch Konstruktion gebildeten globaleren Proposition aufgeht, kann wegfallen. Selektion: bestimmte zentrale Propositionen werden unverändert beibehalten, da sie wesentliche, bereits generelle Textbestandteile darstellen. Bündelung: inhaltlich eng zusammenhängende, im Text aber weit verstreute Propositionen werden als Ganzes in gebündelter Form wiedergegeben. Grundsätzlich gilt somit als Ziel der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse, das Allgemeinheitsniveau des Materials zunächst zu vereinheitlichen, um dann das Abstraktionsniveau schrittweise höher zu setzen (Mayring, 2000, 2002). Sie dient als Grundlage der Kategorienbildung. Die Anwendung erfolgt dann, wenn vorwiegend die inhaltlichthematische Seite des Materials von Interesse ist, da der konkrete Sprachkontext oder die Interviewsituation verloren gehen. Bei der Explizierenden Inhaltsanalyse werden unklare Textbestandteile (Begriffe, Sätze) dadurch verständlich gemacht, dass zusätzliche Materialien (z.B. durch die Quelle anderer Interviewpassagen oder Informationen über den Befragten) herangezogen werden (Bortz & Döring, 2002). Die Suche nach Explikationsmaterial soll dabei systematisiert werden. Wichtig für das systematische Vorgehen ist, dass aus dem Kontextmaterial eine erklärende Paraphrase gebildet wird die statt der fraglichen Stelle in den Text eingefügt wird. Ein erneuter Durchlauf der Kontextanalyse soll prüfen, ob das Explikationsmaterial ausreicht, oder ob neues Material bestimmt werden muss (Mayring, 2002). Ziel der Strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Dazu wird ein Kategorieschema erstellt, welches nach einem Probelauf verfeinert wird, bevor die Endauswertung erfolgt (Mayring, 2002). Das Kategorieschema kann nach formalen, inhaltlichen Aspekten oder nach bestimmten Typen erstellt werden; es kann jedoch auch eine Skalierung oder eine Einschätzung auf bestimmte Dimensionen angestrebt werden. Das Verfahren geht in drei Schritten vor (vgl. Mayring 2002, S. 118f): 102 1. Definition der Kategorie: es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen. 2. Ankerbeispiele: es werden konkrete Textstellen aufgeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. 3. Kodierregeln: es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Qualitative Inhaltsanalyse Texte systematisch analysiert, indem sie das Material mit Kategoriesystemen bearbeitet, wobei die Systeme theoriegeleitet am Textmaterial entwickelt wurden. Die Anwendung eignet sich zur systematischen Bearbeitung auch großer Mengen von Textmaterial. 6.2 Vorgehen in der vorliegenden Arbeit Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Methoden und Techniken qualitativer Inhaltsanalyse allgemein erörtert wurden, folgt die Beschreibung der methodischen Vorgehensweise in der vorliegenden Arbeit. 6.2.1 Auswahl der Methode Da bei der Datenerhebung ein Sachinteresse erfragt wird und Zusammenhänge erklärt werden sollen (vgl. Kapitel 6.1.2.3) wird in der vorliegenden Arbeit die Methode des Experteninterviews gewählt. So sollen bei der Evaluation des entwickelten Behandlungskonzepts, anhand des Wissens und der Erfahrung der Befragten, die einzelnen Sachverhalten hinsichtlich der Umsetzbarkeit des Programms und der Nutzen für den Patienten erfasst und ausgewertet werden. 6.2.2 Auswahl der Experten Grundsätzlich kommen unterschiedliche fachspezifische Berufsgruppen für die Durchführung des Kurzinterventionskonzeptes in Betracht. Aus diesem Grund wurden Personen dieser spezifischen Fachbereiche für das Interview ausgewählt. Hierbei handelt es sich um Ärzte, Sozialarbeiter und Psychologen. Zur expliziten Auswahl wurden die in Kapitel 6.1.3 beschriebenen Fragestellungen angewandt und die Personen konnten somit als Experten ausgewiesen werden. 103 Fachbereich Soziale Arbeit Herr A. Diplom- Sozialarbeiter (FH), 20 Jahre Berufserfahrung in Psychiatrischer Klinik auf unterschiedlichen Stationen (Sucht, affektive Erkrankungen, Schizophrenie, Tagesklinik). Herr M. Diplom- Sozialarbeiter (FH), Psychotherapeut (HPG, Heilpraktikergesetz), Systemischer Familientherapeut, Suchttherapeut (VDR), NLP- Practitioner, Weiterbildung KT-Trainer (Kontrolliertes Trinken). 18 Jahre Berufserfahrung in der ambulanten Suchttherapie. Zwei Jahre Berufserfahrung mit chronisch mehrfach Abhängigen und psychiatrischen Patienten. Fachbereich Psychologie Herr K. Dr. phil. Diplom- Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut (Schwerpunkt VT). Vier Jahre Berufserfahrung mit psychiatrischen Patienten. Frau H. Diplom- Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung (Schwerpunkt VT). Sechs Jahre Berufserfahrung in der stationären, teilstationären und ambulanten Suchtrehabilitation. Fachbereich Medizin Herr D. Professor Dr. med., 17 Jahre Berufserfahrung mit psychiatrischen Patienten. Oberarzt einer psychiatrischen Klinik. Herr P. Dr. med., drei Jahre Berufserfahrung in der Suchtklinik, zwei Jahre Berufserfahrung in der Allgemeinpsychiatrie. Zum Interviewzeitpunkt sind vier der Experten klinisch tätig, ein Experte ist im teilstationären Bereich tätig und ein Experte arbeitet im ambulanten Bereich. 6.2.3 Interviewleitfaden und Forschungsfrage Da in der geplanten Untersuchung im Interview einzelne, genau bestimmbare Informationen erhoben werden müssen, wurden die Fragen für den Leitfaden konkret ausformuliert und strukturiert (siehe Anhang). Für die Typisierung der Fragen wurden hauptsächlich Meinungsfragen gewählt. Meinungsfragen erlauben eine Ermittlung von Bewertungen, Handlungszielen und Motiven der interviewenden Person. Dies wiederum führt zu dem gewünschten Feedback des Experten und zur Informationssammlung, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendig ist. Forschungsfrage • • Ist das Konzept in der vorliegenden Form für eine Implementierung/Umsetzung im klinischen Alltag geeignet? Ist bei dem Einsatz des Kurzinterventionsprogramms mit einem Nutzen für den Patienten zu rechnen? Ziel der Untersuchung ist somit, das Kurzinterventionskonzept auf seine Umsetzbarkeit hin zu überprüfen und den daraus resultierenden Nutzen für den Patienten zu erfassen. Dazu wurde der Interviewleitfaden in allgemeine, inhaltliche und ergänzende Fragen unterteilt. Die allgemeinen Fragen beziehen sich auf die generelle Umsetzbarkeit, während die inhaltlichen Fragen die einzelnen Interventionen erfassen, die im Behandlungsprogramm beschrieben sind. 104 6.2.4 Durchführung des Interviews Zunächst wurden die Interviewpartner persönlich angesprochen und über den Rahmen und die Durchführung des Forschungsanliegens informiert. Nach einer mündlichen Einverständniserklärung wurde den Interviewpartnern das Behandlungskonzept mit Einwilligungserklärung und Anhang ausgeteilt und ein Interviewtermin vereinbart. Vor Beginn des Interviews erfolgte die schriftliche Einwilligung zur Datenerhebung. Dabei wurden die Interviewten hinsichtlich Archivierung der Tonbandaufzeichnung, Anonymisierung der Daten, Auswertung zu ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und zur Transkription informiert (siehe Anhang). 6.2.5 Auswertung der Interviews Um einerseits die Materialfülle bei der Datenaufbereitung zu reduzieren und gleichzeitig eine erste Generalisierung vorzunehmen wurde zunächst die Zusammenfassende Analyse als Technik eingesetzt (vgl. Kapitel 6.1.5). Dabei wurde die Zusammenfassung gleich vom Tonband aus vorgenommen. Bei der Auswertung von Experteninterviews steht die inhaltlich-thematische Seite des Datenmaterials im Vordergrund, was den Einsatz dieser Technik begründet. Im nächsten Schritt wurde eine weitere generalisierende Analyse vorgenommen. Der hohe Strukturierungsgrad des Interviewleitfadens diente dabei als Vorlage für eine Kategorienbildung. Der Leitfaden erfasst thematisch die einzelnen Interventionsschritte des Behandlungsprogramms. Durch die Generalisierung entsteht eine weitere Verdichtung des Materials, welches nun nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Interviews (bezogen auf die jeweiligen Fragen) hin untersucht wurde. So konnten die inhaltlichen Differenzen der einzelnen Aussagen herausgearbeitet und die Gemeinsamkeiten zusammengefasst werden. Die Verdichtung der thematisch gegliederten Expertenaussagen ermöglicht nun für die Ergebnisdarstellung eine Zusammenschau aller im Interview angesprochenen Themen. Den Abschluss bildet die Interpretation des Ergebnisses in Richtung der Forschungsfrage. Die vergleichende Darstellung, die anhand der oben beschriebenen Schritte zu einer Gesamtschau verdichtet wurde, wird im folgenden Kapitel aufgeführt. 6.2.6 Darstellung der Ergebnisse In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die zur Beantwortung der Untersuchungsfrage führen sollen. Es werden zunächst die einzelnen inhaltlichen Differenzen und Beurteilungen anhand der im Leitfaden festgelegten Kategorien dargestellt, bevor die Beurteilung der allgemeinen Umsetzbarkeit erfolgt. 105 Die Verständlichkeit des Kurzinterventionskonzepts wurde von den Experten überwiegend sehr positiv eingeschätzt. Ein logischer Konzeptaufbau sowie gut eingänglich formulierte Arbeitsaufträge für den Patienten wurden von den Experten positiv beurteilt. Jedoch wurde auch darauf hingewiesen, dass das Konzept zu ausführlich beschrieben ist. Ein Experte gab als Änderungsvorschlag an, lediglich Karteikarten mit Basisinformationen für den Behandler zu erstellen. Aus Sicht der Experten wurden der AUDIT und die Zugangsvoraussetzungen zum Konzept sehr unterschiedlich beurteilt. Drei der Experten schätzten den AUDIT als „gut einsetzbar“ „praktikabel“ und „leicht verständlich für den Patienten“ ein, also ein Fragebogen, „in dem alles erfragt wird“ und der „für ein Screening gut einsetzbar ist“. Hingegen beurteilten die klinisch arbeitenden Experten den Einsatz von Fragebögen aus organisatorischen Gründen eher als ungünstig. Explizit wurde an dem AUDIT kritisiert, dass er „sehr sensibel eingestellt ist und mit 8 Punkten sehr viele Patienten als positiv screent“. In diesem Zusammenhang würde von den klinischen Experten das ausführliche diagnostische Gespräch zum Alkoholkonsum für ein Screening bevorzugt eingesetzt werden. So soll die Zuweisung zum Behandlungskonzept aufgrund des klinischen Urteils erfolgen. Ein konkreter Vorschlag eines klinischen Experten lautete: „ Korrekterweise müssten alle Patienten den AUDIT bekommen, dies könnte über die Routinediagnostik zusammen mit dem Austeilen des BDI durch die Pflege erfolgen. In der Gesamtschau der Befunde, Labor, AUDIT und diagnostisches Gespräch, könnte dann eine Zuweisung zum Behandler erfolgen, die dann im Teamgespräch besprochen wird.“ Auch von einem weiteren Experten wurde das Teamgespräch als ergänzende Basis der Zuweisung des Patienten zum Behandler vorgeschlagen. Auch der Einsatz des SOKRATES wurde unterschiedlich eingeschätzt. Ein Vorteil wurde darin gesehen, dass das Ergebnis für die Therapie im Vorfeld eine gute Einschätzung der Motivation gibt und sich aus dem Ergebnis weitere Interventionen ableiten lassen. Auch die Übersichtlichkeit und Länge des Bogens wurde positiv beurteilt. Ein weiter Vorteil bildet die Möglichkeit der Evaluierung aufgrund der Vorher-NacherEinschätzung. Kritisch wurde der Fragebogen vor allem aus suchttherapeutischer Sicht beurteilt, da er zum einen mit festgeschriebenen Labels arbeitet (z.B. ich bin ein Alkoholiker) und zum anderen „für einen Patienten, der sich noch nie mit der Thematik befasst hat, schwierig zum Ausfüllen ist.“ Weiter wurde am Einsatz des SOKRATES als nachteilig bemerkt, dass die Phasen der Veränderung schwierig zu definieren sind und sich die Motivation erst im Verlauf der Behandlung herausstellt. Als einstimmiger Änderungsvorschlag wurde die Prüfung der Motivation des Patienten im Gespräch erwähnt. 106 Grundsätzlich wurde die Psychoedukation I (Alkoholmissbrauch, Berechnung des Promillewertes im Körper, Nebenwirkungen von Alkoholkonsum) nahezu von allen Experten als positiv und wichtig eingeschätzt. Jedoch wurde die Berechnung des Promillewertes als überflüssig eingestuft. Der Änderungsvorschlag war hier, besser auf allgemeine Aussagen wie z.B. „nach einem Glas Wein habe ich ungefähr 0,2 Promille“, zurückzugreifen. Ein Experte schätzte jedoch die Berechnung des Promillewertes als wichtig ein, da diese Berechnung später für Herausarbeitung der problematischen und unproblematischen Situationen wichtig sein kann. Außerdem, so der Experte, finden es Patienten durchaus auch spannend selbst den Promillewert errechnen zu lernen. Eine Expertenmeinung stellte heraus, dass Psychoedukation in diesem Kontext nicht als das Wichtigste zu ersehen ist. Hier lautet der Vorschlag, dem Patienten die Themen schriftlich mitzugeben und „von Beginn an mit dem Patienten die Risikobereiche zu erarbeiten und ihm das Rational der Punktabstinenz zu vermitteln.“ Weiterhin wurde von einem Experten angemerkt, sowohl aus ökonomischen als auch aus positiven gruppendynamischen Aspekten heraus die Psychoedukation in einem Gruppensetting zusammenzufassen. Als guter und wichtiger Bestandteil des Konzepts wurde der IDTSA von den Experten eingeschätzt. Positiv wurde auch die Platzierung des Bogens im Konzept gewertet, nämlich als eine stringente und logische Reihenfolge. „Man braucht den IDTSA, um Trinksituationen identifizieren zu können. Das ist ein sehr guter Ansatz. Über die Risikobereiche lassen sich außerdem gut Ziele ableiten.“ Kritisch wurde angemerkt, dass der Fragebogen nichts über den Schweregrad des Verhaltens aussagt, also über die Konsummenge. Ebenso wurde die Länge des Bogens als nachteilig eingeschätzt. Zur Erprobung wurde von einem Experten ein Testlauf gefordert. Sehr unterschiedlich wurde die Psychoeduaktion II (sozialübliche Trinknormen im deutschen Sprachraum, gesundheitliche Folgen von Alkoholkonsum) von den Experten bewertet. Aus überwiegend suchttherapeutischer Sicht wurden die Themenauswahl als adäquat und die Wichtigkeit als hoch eingestuft. Vor allem auch, „um ein Problembewusstsein im verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern und die prozesshafte Entwicklung bei der Entwicklung eines Alkoholproblems zu verdeutlichen“. Aus zeitökonomischen Gründen wurde hingegen von den klinischen Experten diese Intervention als kritisch eingestuft. Es wurde auf eine schriftliche Information an den Patienten verwiesen. Hinsichtlich der Trinknormen im deutschen Sprachraum wurde bemerkt, dass diese auch relativierend auf den Patienten wirken können und dass „diese Intervention relativ weit weg ist von dem Problem des Einzelnen“. 107 Als Ergänzung wurde das Thema Suchtgedächtnis, anschließend an die körperlichen Folgen vorgeschlagen, da Patienten dieses Thema, so der Experte, oft sehr interessant finden und schnell auf sich beziehen können. Das Suchtgedächtnis entsteht im Verlauf der Suchtentwicklung aufgrund dauerhafter Sensitivierung alkoholspezifischer Stimuli und bedeutet ein permanentes Rückfallrisiko auch nach längerer Abstinenz. Es handelt sich somit um neurostrukturelle Veränderungen im Belohnungssystem des Gehirns. Bei der Gegenüberstellung von problematischen und unproblematischen Trinksituationen anhand des IDTSA fielen die Expertenmeinungen überwiegend positiv aus. Als Gründe wurden hier genannt, „dass der Patient eine ressourcenorientierte, realistische Einschätzung über sich bekommt“, „er zur Selbstreflexion angeregt wird“ und „sein Blick auf sein Trinkmuster geschärft wird“. Problematisch wurde von einem Experten erachtet: „dass man das Ziel des Programms nochmals überdenken müsste, da diese Intervention sehr in die Tiefe geht, und es nicht gut ist, etwas zu beginnen und nicht zu Ende zu bringen.“ Nach dieser Expertenmeinung entsteht hier die Frage, „ob das Ziel eine richtige Behandlung ist, oder ob es Ziel ist, den Patienten in die richtige Behandlungsbahn zu bringen und ihm lediglich Impulse zu setzen.“ Hinsichtlich eines logischen Aufbaus wurde vorgeschlagen, das Thema der Selbstwirksamkeit (nächste Sitzung) näher an die Intervention der Gegenüberstellung heranzubringen, da es von der Thematik hier gut ansetzen kann. Als ein hauptsächlich guter und wichtiger Ansatz, der an dieser Stelle auch gut platziert ist, wurde von den Experten über die Vermittlung des Komorbiditätmodells berichtet. „Es ist wichtig, dass der Patient erkennt, wie seine Symptomatik aufrecht erhalten wird und dass er z.B. trinkt, um seine Stimmung zu beeinflussen.“ Nach einer Expertenmeinung spricht jedoch der knappe Zeitaspekt gegen diese Intervention. Weiter wurde angemerkt, dass „für manche Patienten ein Modell auch exkulpieren sein kann. So müsste man differenziert darstellen, wann das einzelne Modell passt oder auch im Einzelfall nicht passt“. Die Entscheidungsmatrix als Hausaufgabe für den Patienten wurde von den Experten überwiegend kritisch beurteilt. Nachteilig wurde angemerkt, dass „der Patient mit dieser Aufgabe überfordert ist“ und dass „Hausaufgaben oft gar nicht oder schlampig gemacht werden“. Zudem wurde die Platzierung der Entscheidungsmatrix als kritisch eingeschätzt, da sie als Motivationsklärung vor die Analyse der Trinksituationen, also vor den IDTSA gesetzt werden soll. 108 Positiv wurde hervorgehoben, dass der Patient sich aufgrund der Aufgabe auf die nächste Sitzung vorbereitet und sie für die konkrete Zielformulierung eine wichtige Entscheidungsgrundlage bietet. Es wurden folgende Änderungen aus Expertensicht vorgeschlagen: • Dem Patienten Hilfestellung, Muster, Beispiele für das Ausfüllen der Matrix geben • Die Matrix mit dem Patienten vorbesprechen • Die Matrix gemeinsam mit dem Patienten ausfüllen Als zentrale und ausschlaggebende Elemente im Behandlungskonzept wurden die Alkoholwirkungserwartung und Selbstwirksamkeit von den Experten eingeschätzt. „Ressourcenorientiert macht es dem Patienten bewusst, dass er selbst sein Verhalten steuern kann und er ein positives Verhaltensrepertoire hat“. Kritisch wurde angemerkt, „dass dies eine schwere Baustelle für depressive Patienten wegen verminderter Selbstwirksamkeit (Grunderkrankung) ist“. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, „an typischen Situationen des Patienten diese Thematik herauszuarbeiten“. Wie oben bereits vermerkt, wurde vorgeschlagen, dieses Thema näher an die Gegenüberstellung der Trinksituationen zu bringen. Die Aufforderung zur konkreten Zielformulierung wurde von den Experten überwiegend positiv eingeschätzt. Positiv hervorgehoben wurde, dass der Patient sich mit der Begründung auseinandersetzt, dass das Ziel konkret wird und nicht verpufft und dass der Patient sein Ziel selbst festschreibt. Kritisch wurde von einem Experten vor allem die Platzierung dieser Maßnahme beurteilt: „Konkrete Trinksituationen sollten zu Beginn besprochen und aufgeschrieben werden.“ Als ergänzender Vorschlag wurde hervorgehoben, dem Patienten zu vermitteln, dass es „kein allgemeingültiges Ziel und kein feststehendes Ziel“ gibt. „Die Autonomie des Patienten sollte hochgestellt werden.“ Aus Expertensicht wurde die Verknüpfung des therapeutischen Stationsalltags mit der Erarbeitung von Handlungsalternativen unterschiedlich eingeschätzt. Positiv hervorgehoben wurde, dass das Angebot auf Station strategisch gut genutzt werden kann und wertvolle Handlungsstrategien bietet. Auch die Platzierung im Behandlungskonzept wurde positiv hervorgehoben. „Diese Intervention ist sehr gut platziert. Patienten können hier Erfahrungen machen, die sie zu Hause weiter tragen und ausbauen können.“ Jedoch wurde auch kritisch bemerkt, dass die Umsetzung der Aktivitäten in den Alltag des Patienten schwierig ist, da sich der Patient selbst eine Tagesstruktur erarbeiten muss. 109 Als Ergänzungen gaben die Experten folgende Ideen an. • „Im Sinne der Ökonomie wäre es gut, dem Patienten zu vermitteln, wenn es ihm gelingt, auch kleine Dinge aus dem klinischem Alltag mit nach Hause zu nehmen, denn auch kleine Dinge haben einen immensen Effekt“. • „das Angebot soll genutzt werden, um auf ein konkretes Verhalten zurück zu kommen und dies im Sinne eines Verhaltensexperiments. Konkret machbare Verhaltensweisen sollen herausgearbeitet werden und die soll der Patient dann ausprobieren.“ • „Man müsste evtl. innerhalb des Behandlungskonzepts das Stationsangebot individuell ergänzen oder anpassen, ob der Patient noch etwas braucht, was er dort aus einer Gruppe zum Beispiel nicht mitnehmen kann.“ Die Aufnahme des Themenbereiches der Rückschläge wurde aus Expertensicht sehr deutlich als positiv bewertet. Zum einen gelingt es über dieses Thema auch, Scham und Schuldgefühle anzusprechen, zum anderen gilt es dem Patienten zu vermitteln, dass Rückschläge bei dem Versuch einer Verhaltensänderung etwas normales, sogar eher die Regel als die Ausnahme sind und dass etwas daraus gelernt werden kann. Hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang der Kontext, in den das Behandlungsprogramm eingebettet ist: „Man stellt sich vor, dass Patienten, die wegen einer Depression hier aufgenommen werden und dann in einem Programm für Alkohol landen, verdutzt und verschämt sein können.“ Die Expertenmeinung hinsichtlich des änderungssensitiven SOKRATES zeigt eine geteilte Darstellung. Vorteile liegen in der Erfassung der Veränderung, in der Schaffung eines Ausblickes, in der Feststellung, ob der Patient zu anderen Schritten bereit ist und in der Überprüfung der Behandlung. Als Nachteile wurden erwähnt: „Nicht einsetzbar aufgrund Zeitmangel“, „Verunsicherung auf Seiten des Patienten (weshalb noch mal den Bogen ausfüllen?“, „Unklare Zielbestimmung (was will der Behandler mit dem Ergebnis anfangen?)“. Hier wurde vorgeschlagen, die Veränderung in einem Gespräch zu erfragen: • „Welche Informationen waren besonders wichtig und neu?“ • „Wie hat sich das auf Ihre Veränderungsmotivation im Umgang mit Alkohol ausgewirkt?“ • „Welche Strategie wollen Sie anwenden?“ Eine einheitliche positive Darstellung in der Expertenmeinung zeigt die Ansicht über das Aufzeigen des regionalen Netzwerkes. Es wurde angemerkt, dem Patienten diese Informationen schriftlich mitzugeben, auf die Langfristigkeit bei der Zielerreichung hin- 110 zuweisen, evtl. den Patienten schon während des Aufenthaltes in eine Beratungsstelle schicken. Hier wurde auch auf eine „dosierte Informationsvermittlung hingewiesen, da man schnell auch Abwehr beim Patienten erzeugen kann.“ Um an die vorherige Sitzung anzuknüpfen und „um ein Gefühl dafür zu bekommen, was bei dem Patienten überhaupt hängenbleibt“ sowie zur systematischen Dokumentation wurde das zusammenfassende Protokoll von den Experten generell als positive Maßnahme eingeschätzt. Die oben aufgeführten Ergebnisse stellen aus Sicht der Experten die möglichen Vorund Nachteile sowie die möglichen daraus resultierenden Veränderungen dar. Sie beziehen sich auf die jeweils einzelnen Interventionen des Behandlungskonzepts. Nach dieser spezifischen, inhaltlichen Darstellung folgt nun die Erweiterung auf die Beantwortung der Untersuchungsfrage. Untersuchungsfrage (1): Ist mit einem Nutzen für den Patienten zu rechnen? Die Experten trugen unterschiedliche Begründungen zusammen, die für einen Nutzen des Patienten von dem Kurzinterventionskonzept sprechen. Sie werden in folgender Übersicht zusammengefasst. Begründungen des Nutzens für den Patienten aus Sicht der Experten • „Der Patient erhält die Chance, sich intensiv mit der Problematik auseinander zusetzen.“ • „Der Patient erhält Informationen, die er braucht, um ein Problembewusstsein im Umgang mit Alkohol zu entwickeln.“ • „Durch die Einführung des Themas in seinen Lebensbereich wird der Patient sensibilisiert. Vielleicht ist dies das erste Mal, dass er auf seinen Alkoholkonsum angesprochen wird. Und wenn dies in der Psychiatrie nicht geschieht, wo soll es dann geschehen?“ • „Ein Nutzen entsteht für den Patienten auch deshalb, weil man solche Patienten nie im klassischen Suchtbereich oder einem Selbsthilfeangebot erreicht, sondern nur im psychiatrischen Setting finden wird.“ • „Da es Patienten gibt, die eindeutig für das Programm in Frage kommen, liegt der Nutzen darin, dass das Konzept eine gute Erweiterung des therapeutischen Angebots darstellt.“ • „Aufgrund der Transparenz und Offenheit des Konzepts und der Entscheidungsfreiheit für den Patienten entsteht ein guter Nutzen.“ Der Nutzen für den Patienten bei einer Teilnahme am Behandlungsprogramm wurde einstimmig positiv eingeschätzt. Die Hauptbegründungen liegen in der Auseinandersetzung des Patienten mit der Thematik, der Schaffung eines Problembewusstseins und der Erweiterung des therapeutischen Angebotes. Ein weiterer Nutzen wird in der Installierung eines sekundärpräventiven Suchtangebots in der Psychiatrie gesehen. 111 Untersuchungsfrage (2): Ist das Konzept für eine Umsetzung geeignet? Die Frage der allgemeinen Umsetzbarkeit wurde mit der Frage nach den zu erwartenden Schwierigkeiten verknüpft. Dies ermöglicht die übersichtliche Ergebnisdarstellung in folgender Tabelle: Umsetzbarkeit/ Vorteile Schwierigkeiten Vorschlag Lohnenswert und grundsätzlich umsetzbar Motivation des Patienten über fünf Sitzungen aufrecht zu erhalten. Die Schwere des Krankheitsbildes (Komorbidität) wirkt einschränkend auf die Umsetzung. Wünschenswert, es auf der Station auszuprobieren. Gut umsetzbar aufgrund klarem Aufbau und Verständlichkeit. Gute Grundlage, um ein Verständnis für die Problematik zu entwickeln. Aufgrund der Fülle des Stoffes in drei Wochen evtl. nicht machbar. Gefahr, dass der Patient innerlich aussteigt. Anspruchsvolles Programm. Man wird nicht jeden damit erreichen können. Schön wäre ein Testlauf. Gut umsetzbar. Durch das Programm wird das Bewusstsein des Patienten geschärft und er wird für das Thema sensibilisiert. Ein ambitioniertes Programm. Zu viel an inhaltlichem Stoff für die kurze Zeit. Der Einsatz von Fragebögen ist aufgrund organisatorischer Probleme generell schwierig. Testlauf wünschenswert. Das Ziel müsste neu überlegt werden: Impulse setzten oder richtige Behandlung in der kurzen Zeit möglich? Man müsste das Programm inhaltlich entzerren (Themen rausnehmen). Prinzipiell umsetzbar. Wertvolles Instrument für die Station für affektive Erkrankungen. Elaboriertes Programm. Viel stofflicher Inhalt für kurze Zeit. Nicht spezifisch genug auf die konkrete Punktabstinenz zugeschnitten. Verhaltensnähere Umsetzung der Punktabstinenz, d.h. früher anhand Verhaltensexperimenten die Trinksituationen herausarbeiten. Sicher umsetzbar. Der Patient soll sein Muster erkennen und seine problematischen Situationen und soll dann selbst entscheiden, was er ändern will. Das ist ein guter Ansatz. Hauptproblem: wie kommt man an die Patienten, die am meisten davon profitieren, ohne dass der Behandler überrannt wird oder die Patienten von der Thematik abgeschreckt werden? Patienten können den Behandler absorbieren, ohne ernsthaft an einer Veränderung interessiert zu sein. Neben der Gesamtschau der Befunde (Labor, AUDIT, Anamnese) im Team klären, welcher Patient für das Programm in Frage kommt. So wie das Konzept angelegt ist gut umsetzbar. Die Mischung aus Wissensvermittlung, Analyse und eigene Ziele formulieren bildet einen guten Zugang für den Patienten. Patienten der Zielgruppe sind nicht so schnell belastbar. Auf die Schwierigkeit in der Behandlung von Suchterkrankungen (geringe Motivation, Abwehr) muss der Behandler sich einstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kurzinterventionsprogramm als gut umsetzbar eingestuft wird. Die Hauptprobleme liegen nach Expertenmeinung vor allem in der inhaltlichen Fülle des Stoffes, welcher in kurzer Zeit zu bewältigen ist, und in der Schwierigkeit, die Zielgruppe zu identifizieren. Aber auch den Patienten über den Behandlungszeitraum motivational zu erreichen („bei der Stange zu halten“) wird als eine Schwierigkeit bei der Umsetzung eingeschätzt. Nach Expertenmeinung wäre ein Testlauf wünschenswert. 112 In der abschließenden Frage an die Experten nach ergänzenden Anmerkungen und Ideen wurden bereits oben dargestellten Aspekte erneut aufgegriffen, so dass lediglich die neu genannten Aspekte im Folgenden aufgeführt werden. Für eine konkrete Umsetzung des Angebots, so ein Experte, wurde bisher nicht bedacht, dass das Programm eine Interaktion zwischen den unterschiedlichen Anwendern der Gesamtbehandlung des Patienten voraussetzt. „Man muss dem Patienten klarmachen, dass die Therapiebausteine vernetzt werden sollen, z.B. soll der Patient auch mit dem Arzt über seine Erarbeitung von Handlungsalternativen sprechen.“ Weiter wurde eingeschätzt, „dass ein gravierendes Alkoholproblem auf Station nicht übersehen wird, es jedoch in der Dringlichkeit, geordnet auf der Prioritätenliste, nach unten rutscht. Das Thema Komorbidität wird beachtet, aber es wird sehr wenig dazu getan.“ Zudem wurde angeführt, dass nicht ersichtlich wird, wer das Programm durchführt. „Schwierig ist es, wenn jemand keine Erfahrung mit der Thematik und mit Suchtpatienten hat. Dann müsste man mehr Theorie schreiben und mehr allgemein schreiben, was im Umgang mit Suchtpatienten wichtig ist und auf was man sich einstellen muss. Andererseits muss jemand der sehr lange suchttherapeutische Erfahrung hat, darauf achten, dass es sich um einen Alkoholmissbrauch und nicht um eine Abhängigkeit handelt.“ Die Ergebnisdarstellung zeigt, dass die Experten in vielen Punkten mit dem Konzept konform gehen und gute Möglichkeiten für die Umsetzung in den Alltag sehen. Schwierigkeiten bei der Umsetzung wurden von den Experten diskutiert und durch Änderungsvorschläge ergänzt. 113 7 Diskussion Das entwickelte Kurzinterventionskonzept für stationäre depressive Patienten mit einem komorbiden Alkoholmissbrauch wurde anhand Experteninterviews evaluiert. Die Einschätzung der sechs Experten zeigte, dass wesentliche Bausteine des Konzepts gut ein- und umsetzbar sind, wodurch die Patienten zu einer Veränderung ihres Alkoholkonsums befähigt werden. 7.1 Diskussion der spezifischen Elemente des Konzepts Aus Sicht der Experten wurden die Zugangsvoraussetzungen und der Einsatz des AUDIT als Screeninginstrument unterschiedlich beurteilt. Wetterling und Veltrup (1997) betonen, dass der AUDIT besser als der CAGE oder der MAST geeignet ist, den aktuellen Alkoholkonsum abzuschätzen. Neben dem AUDIT soll bei der Umsetzung des Programms vor allem das klinische Urteil des Arztes bei der Identifikation der Zielgruppe verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Die routinemäßige Durchführung des AUDIT für alle Patienten, das diagnostische Gespräch und das Besprechen mit allen, die am therapeutischen Prozess beteiligt sind (Teamkonferenz), soll die adäquate Zuführung des Patienten zum Konzept gewährleisten. Das Austeilen des AUDITS soll gemeinsam mit der ersten Ausgabe der depressionsspezifischen Fragebogen durch das Pflegeteam realisiert werden. Durch die größere Berücksichtigung der Informationen vom Arzt wird vermieden, dass durch den sehr sensibel eingestellten Fragebogen AUDIT, eine Vielzahl von Patienten positiv gescreent wird, die den möglicherweise knappen zeitlichen Ressourcen des Behandlers nicht entsprechen. Unterschiedliche Möglichkeiten im Umgang mit den Ergebnissen bietet der Einsatz des Fragebogens SOKRATES im therapeutischen Prozess. Neben einer motivationalen Einschätzung des Patienten und der Möglichkeit aus dem Testergebnis weitere Interventionen ableiten zu können, bietet er vor allem die Möglichkeit einer Evaluierung des Programms anhand einer Vorher-Nachher-Einschätzung. Die Schwierigkeit bei der Auswertung des Bogens besteht in der schwierigen prozessualen Definition der Veränderungsphasen. Die Veränderungsphasen können bei längeren Behandlungen leichter zu erfassen sein als bei dem vorliegenden Kurzinterventionsprogramm. Mit einem individuellen Ergebnis ist bei der Prüfung der Motivation des Patienten im Gespräch zu rechnen. Somit sollte der SOKRATES nur dann eingesetzt werden, wenn eine Evaluierung des Programms in Bezug auf die Veränderungsmotivation erforderlich ist. Um ein Problembewusstsein im verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol zu erlernen und um die prozessuale Entwicklung eines Alkoholproblems zu verdeutlichen 114 bilden die psychoedukativen Themen nach Meinung der Experten einen wesentlichen Bestandteil des Programms. Durch aktive Informationsvermittlung können Patienten für ihre problematischen Verhaltensweisen sensibilisiert werden und erhalten die Chance ein Problembewusstsein zu entwickeln (Schuhler & Baumeister, 1999, Schuhler & Vogelgesang, 2006). Der Vorschlag eines Experten, den Patienten ohne Vorinformationen und ohne Sensibilisierung mit der Thematik gleich zu Behandlungsbeginn mit seinen problematischen Trinksituationen zu konfrontieren, wird als ungünstig eingeschätzt, da die Gefahr besteht, eine Abwehrreaktion bei dem Patienten auszulösen und/oder ihn zu überfordern. Um die inhaltliche Fülle etwas zu reduzieren soll das Thema „Berechnung des Promillewertes im Köper“ nur bei näherem Interesse des Patienten ausführlicher erläutert werden. Die Psychoedukation im Gruppensetting bei einer ausreichenden Anzahl von Patienten durchzuführen ist sinnvoll. Dies hätte neben dem ökonomischen Aspekt auch den Nutzen, dass Patienten den gruppendynamischen Aspekt der gegenseitigen Unterstützung erfahren können. Eine ressourcenorientierte Einschätzung über problematische und unproblematische Trinksituationen erhält der Patient mit dem Fragebogen IDTSA. Aus Expertensicht wird der Bogen als wichtiges und zentrales Instrument des Programms gesehen, da auf das Ergebnis des Bogens bei den nachfolgenden Interventionen jeweils zurückgegriffen wird. Lindenmeyer (2001) betont vor allem die rasche Identifizierung der relevanten Trinksituationen einer Person. Um zusätzlich den Schweregrad des Alkoholmissbrauchs zu erfassen, ist die Erfragung der Alkoholkonsummenge als Ergänzung wichtig. Durch die Gegenüberstellung der problematischen und kritischen Trinksituationen wird - laut Experten - das Trinkmuster des Patienten erkennbar und es können Ressourcen des Patienten herausgearbeitet werden so, dass er eine realistische Einschätzung über sich selbst erhält. Hier sollen keine Änderungen im Konzept erfolgen. Im Sinne einer günstigen thematischen Weiterführung ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Thema der Selbstwirksamkeit gut an dieser ressourcenorientierten Methode ansetzen kann. Petry (2006) hebt die Wichtigkeit der positiven Selbstwirksamkeitserwartung im Hinblick auf mögliche Bewältigungsmaßnahmen und Handlungsalternativen hervor. Das Herausarbeiten der Alkoholwirkungserwartung und Selbstwirksamkeit stellt somit -auch aus Sicht der Experten- einen wichtigen Themenbereich in der Behandlung dar. Ob dieser Themenbaustein in der dritten Sitzung oder im Anschluss an die Gegenüberstellung der Trinksituationen erfolgt, muss individuell an die Mitwirkung des Patienten angepasst werden. Im Kontext der Grunderkrankung, der Depression, erlangt dieser Themenbereich für den Patienten noch mehr Bedeutung. Ein Testlauf kann zeigen, 115 welche thematische Reihenfolge eine gute Akzeptanz für den Patienten erbringen kann. Als wesentlich wurde erachtet, dass der Patient die mögliche Interdependenz und Dynamik seiner Erkrankungen erkennt. Hierfür ist die Vermittlung eines individuellen Komorbiditätmodells gewinnbringend. Im Sinne der Integrativen Therapie von Patienten mit komorbidem Alkoholmissbrauch hebt Moggi (2007) die Bedeutung der Förderung eines Problembewusstseins hervor. So soll dieser Behandlungsbaustein im vorliegenden Programm beibehalten werden. Um dem Patient zu verdeutlichen, dass er sich den kurzfristig positiven Wirkungen des Alkohols widersetzen muss, um die langfristig negativen Folgen des Alkoholmissbrauchs zu vermeiden, wird das Vier-Felder-Schema eingesetzt. Der Vorschlag eines Experten, diese Intervention vor die Bestimmung der Trinksituationen (IDTSA) zu setzen, soll nicht umgesetzt werden da die Entscheidungsmatrix als Hausaufgabe eine konkrete Grundlage für die spätere Zielformulierung darstellt. Somit soll die Platzierung an dieser Stelle des Programms beibehalten werden. Um eine Überforderung seitens des Patienten zu vermeiden, jedoch den positiven Effekt der Aufgabe zu nutzen, wird die Matrix mit dem Patienten gemeinsam erarbeitet. So erhält der Patient Hilfestellung beim Ausfüllen, es werden ihm Muster und Beispiele gegeben und der Patienten wird gebeten, Ergänzungen selbständig vorzunehmen. Einstimmig sprachen sich die Experten zum Verbleib des Punktes der konkreten Zielformulierung im Konzept aus. Die Vorteile der konkreten Zielformulierung liegen in der direkten Auseinandersetzung des Patienten mit der Begründung seiner Verhaltensänderung und in der Förderung der Autonomie des Patienten, da er sein Ziel selbst festschreibt. Nach Vorschlag eines Experten sollte die Zielformulierung an den Anfang des Behandlungsprogramms gesetzt werden. Diesem Vorschlag widerspricht die Tatsache, dass zu Behandlungsbeginn der Patient möglicherweise noch keine Chance hatte, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen und unter Umständen eine Zielformulierung noch gar nicht stattfinden kann, da möglicherweise noch wenig Problembewusstsein besteht und der Patient noch kein spezifisches Wissen über die Problematik hat. Eine wertvolle und gut nutzbare Strategie für die Erarbeitung von Handlungsalternativen ist die Einflechtung des therapeutischen Stationsalltags in das Behandlungsprogramm, hier waren sich die Experten einig. Ebenso erfolgt die Platzierung im Konzept einer logischen Reihenfolge nach der Zielformulierung. Eine sinnvolle Änderung ist hierbei, dem Patienten zu vermitteln, dass vor allem der Transfer von kleinen Dingen in den häuslichen Alltag des Patienten eine wichtige Rolle spielt und einen großen Effekt 116 hat. Das heißt, die Verknüpfungen sind auf kleine konkrete Beispiele im Sinne eines Verhaltensexperiments zu beziehen. Die Inhalte des Gesamtprogramms (Entspannung, Genuss, Aktivität) sollen als übergeordnete mögliche Handlungsstrategien herausgearbeitet werden. Der Umgang mit Rückschlägen stellt aus Sicht aller Experten ein sensibles und wichtiges Thema in der Behandlung dar. Es wird dem Patienten vermittelt, dass Rückschläge bei dem Versuch einer Verhaltensänderung normal sind und aus denen etwas Neues gelernt werden kann. Es bietet dem Patienten auch die Möglichkeit die bisher nicht explizit angesprochenen Scham- und Schuldgefühle zu thematisieren. Dieser Themenbereich bleibt somit unverändert im Konzept. Sollte keine Evaluierung des Programms hinsichtlich der Veränderungsmotivation erfolgen, ist aus zeitlichem Aspekt vom Einsatz des änderungssensitiven Fragebogens SOKRATES abzusehen. Zeitökonomischer ist die Erfassung der Veränderung und die Schaffung eines Ausblicks für den Patienten im Abschlussgespräch z.B. mit folgenden Fragen: • „Welche Informationen waren für Sie besonders wichtig und neu?“ • „Wie hat sich das auf Ihre Veränderungsmotivation im Umgang mit Alkohol ausgewirkt?“ • „Welche Strategien wollen Sie anwenden?“ Die Vermittlung des regionalen Netzwerkangebots und das zusammenfassende Protokoll am Ende jeder Sitzung wurden von den Experten einheitlich als positive Maßnahmen eingeschätzt und bedürfen somit keiner Änderung. 7.2 Diskussion der allgemeinen Elemente des Konzepts Die Verständlichkeit des Konzepts sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten wurde von den Experten sehr gut eingestuft. Diesbezüglich werden somit keine Änderungen im Programm vorgenommen. Der Hinweis von einem Experten, auf Karteikarten lediglich die Basisinformationen zu notieren, wird als ungünstig erachtet, da ein Behandler, der wenig praktische suchttherapeutische Erfahrung hat, detaillierte suchtspezifische Informationen zur Durchführung der Konzeptinhalte benötigt. Für die Durchführung des Programms wird erwartet, dass der Behandler eine qualifizierte Zusatzausbildung im Bereich Suchttherapie aufweist. 117 Die Experten trugen unterschiedliche Begründungen zusammen, die für einen Nutzen für den Patienten von dem Kurzinterventionskonzept sprechen. Die wesentlichen Begründungen liegen nach Expertenmeinung in folgenden Punkten: • Installierung eines sekundärpräventiven Suchtangebots in der Psychiatrie • Auseinandersetzung des Patienten mit der Alkoholthematik und der Schaffung eines Problembewusstseins • Erweiterung des therapeutischen Angebots. Die hohen Prävalenzzahlen für das gleichzeitige Auftreten von depressiven Störungen und Alkoholmissbrauch belegen die Notwendigkeit der Einführung eines suchtspezifischen Angebots für die betroffenen Patienten (John et al., 1996). Die Experten schätzen mit der Umsetzung des Programms in den klinischen Alltag einen positiven Nutzen für den Patienten ein. Somit bietet dieses sekundärpräventive Angebot für diese Patientengruppe eine adäquate Hilfe. Unter Berücksichtigung der Gesamteinbettung des Konzepts in das therapeutische Stationsangebot und dem oben dargestellten Nutzen für den Patienten ist das Programm nach Expertenmeinung gut umsetzbar. Nach Expertenmeinung ist mit folgenden möglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Programms zu rechnen: • die Schwierigkeit die Zielgruppe zu identifizieren • die inhaltliche Fülle des Stoffes, welche in kurzer Zeit zu bewältigen ist • den Patienten dauerhaft motivational zu erreichen. Um die Zielgruppe präziser zu identifizieren, wird, wie oben beschrieben, die Gesamtschau der Befunde (AUDIT, diagnostisches Gespräch und Laborwerte) im Rahmen der Teamkonferenz eingehend besprochen und es wird entschieden, wer dem Programm zugewiesen wird. Somit kann auch die Vernetzung, aller am therapeutischen Prozess Beteiligten (Pflege, Ärzte, Behandler, Sozialarbeiter Psychologen und Ergotherapeuten) besser berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollen verschiedene Instrumentarien und Methoden zur Auswahl bereitgestellt werden, um eine Anpassung an die individuelle Bereitschaft zur Mitarbeit des Patienten zu ermöglichen. Um einer Überforderung des Patienten zu vermeiden, ist darauf zu achten, eine begrenzte Anzahl von Elementen für die Behandlung einzusetzen. Wenn es gelingt, innerhalb der Behandlung auch bei wenig motivierten Patienten, mittels den oben beschriebenen Interventionen kleine Impulse zu setzen, kann dies schon als Erfolgt gewertet werden. Der Vorteil dieses Programms, das in den Stationsalltag eingebettet ist, ist darin zu sehen, dass sehr wahrscheinlich auch weniger motivierte 118 Patienten angesprochen werden und dadurch Hilfe erhalten. Diese Patientengruppe kann durch ein reguläres, ambulantes Suchthilfeangebot nicht oder nur sehr schwer erreicht werden. 7.3 Ausblick Grundsätzlich besteht das übergeordnete Ziel des Kurzinterventionskonzepts darin, dem Patienten einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinem problematischen Alkoholkonsum näher zu bringen. Bei der Evaluierung durch die Experten stellte sich heraus, dass dieses Ziel jeweils eng an die motivationale Situation des Patienten angepasst werden muss. So hängt diese Zielvorgabe eng mit der Veränderungsmotivation und Problemeinsicht des Patienten zusammen. Wie tief in die Behandlung eingestiegen werden muss, bzw. ob sich die Behandlung besser auf das Setzen von Impulsen und dem Lenken in die richtige Behandlungsbahn konzentrieren soll, lässt sich somit schwer festlegen und muss jeweils individuell für den einzelnen Patienten bestimmt werden. Die Schwierigkeit besteht somit darin, ein allgemein gültiges Konzept zu erstellen, welches gleichzeitig offen ist, die unterschiedlichen Behandlungsmodule an die Veränderungseinsicht des spezifischen Patienten anzupassen, gleichzeitig aber auch auf ganz konkrete, suchtspezifische Problematiken eingehen kann. Es gilt also den Spagat herzustellen, für einen gering motivierten Patienten Informationen zu bieten und Impulse zu setzen, und für den stark veränderungsmotivierten Patienten konkrete Instrumentarien und Methoden zur Zielerreichung bereit zu halten. Es setzt grundsätzlich suchttherapeutische Erfahrung voraus, die unterschiedlichen Stadien der Veränderungsmotivation der Patienten zu erkennen, um abzuschätzen, welche der Interventionen zielführend sind. Zum Beispiel erfordert es Erfahrung, wann ein Patient nicht für die Punktabstinenz geeignet ist, sondern das Behandlungsziel die Abstinenz sein muss. Der Behandler sollte somit eine suchttherapeutische Zusatzqualifikation wie sie z.B. der Verband deutscher Rentenversicherer (VDR) fordert, aufweisen. Das vorliegende Programm ist so konzipiert, dass das übergeordnete Behandlungsziel individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden kann. Um dies zu erreichen, muss eine große Variationsbreite an unterschiedlichen Instrumentarien und Methoden als Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Anpassen der verschiedenen Behandlungsbausteine an die Bedürfnisse und Ziele des Patienten setzt suchttherapeutische Erfahrung voraus. Um in Zukunft die Bedeutung des Themas der Komorbidität von Depression und Alkoholmissbrauch im klinischen Alltag zu fördern und stärker als bisher in den Fokus Behandlungsnotwendigkeit zu rücken, ist ein Testlauf und die Evaluierung des Kurzinterventionskonzepts notwendig. Die Installierung eines sekundärpräventiven Angebots im 119 psychiatrischen Kontext würde somit nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine Innovation innerhalb des bisherigen therapeutischen Angebots darstellen. 120 Literaturverzeichnis Agarwal, D.P. & Agarwal-Lozlowski, K. (1999). Genetische Aspekte von Alkoholismus und alkoholassoziierten Organschäden. In M.V. Singer & S. Teyssen (Hrsg.), Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen Diagnostik Therapie (S. 108-121). Berlin: Springer. Arend, H. (1999). Alkoholismus. Ambulante Therapie und Rückfallprophylaxe. Weinheim: Beltz. Bakken, K., Landheim, A.S., & Valgum, O. (2003). Primary and secondary substance misusers: do they differ in substance-induced and substance-independent mental disorders? Alcohol & Alcoholism, 38 (1), 54-59. Barbor, T., Higgins-Biddle, J. (2000). Alcohol screening and brief intervention: dissemination strategies for medical practice and public health. Addiction 95, 677-686. Bauer, M. (2004). Neurobiologie und Therapie depressiver Erkrankungen. Bremen: Uni-Med. Beck, A., Wright, F., Newman, C. & Liese, B. (1997). Kognitive Therapie der Sucht. Weinheim: Beltz. Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1996). Kognitive Therapie der Depression (5. Aufl.). Weinheim: Beltz. Berger, M. & Calker van, D. (2004). Affektive Störungen. In M. Berger (Hrsg.), Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie (S. 389-452). Urban & Fischer: München. Böhmer, J. Bühringer, G., Janik-Konecny, T. (1993). Ursachen von Sucht und Abhängigkeit. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. Expertise zur Primärprävention des Substanzmißbrauchs (Bd. 20). Baden- Baden: Nomos. Bortz, J., Döring, N. (2002). Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. Bott, K., Meyer, Ch., Rumpf, H-J., Hapke, U. & John, U. (2002). Psychiatrische Lebenszeitkomorbidität bei Abhängigkeit, Missbrauch und riskantem Konsum von Alkohol in der Allgemeinbevölkerung. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.), „Alkohol, Nikotin, Kokain…und kein Ende?“ Suchtforschung, Suchtmedizin und Suchttherapie am Beginn des neuen Jahrzehnts (S. 267-274). 14. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht). Lengerich: Pabst Science Publishers. 121 Brodbeck, J. (2007). Diagnostik von Komorbidität, psychischer Störung und Sucht. In F. Moggi (Hrsg.), Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht (S. 27-58). Bern: Huber. Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Bloomfield, K., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., Mefert-Diete, C., Rumpf, H.-J., Simon, R., & Töppich, J. (Hrsg.) (2000). Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland. Baden-Baden: Nomos. De Leon, G. (2005). Modified Therapeutic Communities for Co-Occuring Substance Abuse and Psychiatric Disorders. In R. Stohler & W. Rössler (Hrsg.), Dual Diagnosis. The Evolving Conceptual Framework (S. 137-156). Basel: Karger. Demmel, R. (2001).Motivational Interviewing: ein Literaturüberblick. Sucht, 47, 265266. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (2000) (Hrsg.). Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Behandlungsleitlinie Affektive Erkrankung (Bd. 5). Darmstadt: Steinkopf. Dilling, H., Mombur, W. & Schmidt, M. (Hrsg.) (2004). Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10). Klinisch-diagnostische Leitlinien (4. korrigierte u. erg. Aufl.). Bern: Huber. Dittrich, I., Haller, R. & Hinterhuber, H. (2006). Alkoholismus und Depression. Neuropsychiatrie, 20 (4), 232-239. Drake, R., McLaughlin, P., Pepper, B. & Minkoff, K. (1994). Doppeldiagnosen von psychischen Störungen und Substanzmißbrauch: Ein Überblick. Deutsche Übersetzung: Miericke, S., Krausz, M. In M. Krausz & T. Müller-Thomson (Hrsg.), Komorbidität. Therapie von psychischen Störungen und Sucht. Konzepte für Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation (S. 208-218). Freiburg: Lambertus. Drake, R., Mueser, K. (2000). Psychosocial Approaches to Dual Diagnosis. Schizophrenia Bulletin; 26 (1), 105-118. Edwards, G. (1997). Alkoholkonsum und Gemeinwohl. Strategien zur Reduzierung des schädlichen Gebrauchs in der Bevölkerung. Deutsche Übersetzung im Auftrag des Kuratoriums der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.. Stuttgart: Enke. Ennenbach, M. (2006). Identifikation von pathogenem Alkoholkonsum im betrieblichen Kontext einer Rehabilitationsklinik Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung als Datenbasis für die Konzeption eines Präventionsprogramms. Ludwig-MaximilianUniversität München Dissertation. (http://deposit.d-nb.de). 122 Feuerlein, W., Küfner, H. & Soyka, M. (1998). Alkoholismus – Mißbrauch und Abhängigkeit. Entstehung – Folgen – Therapie. Stuttgart: Thieme. Flick, U., Kardorff, v. E., Keupp, H., Rosenstiel, v. L. & Wolff, S. (2005). Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. Funke, W., Funke, J., Klein, M. & Scheller, R. (1987). Trierer Alkoholismus Inventar (TAI). Göttingen: Hogrefe. Glaeske, G. (2006). Psychopharmaka In G. Stoppe, A. Bramesfeld, F.-W. Schwartz (Hrsg.). Volkskrankheit Depression? Bestandaufnahme und Perspektiven (S. 99108). Heidelberg: Springer. Gläser, J., Laudel, G. (2006). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Gouzoulis – Mayfrank, E. (2003). Komorbidität Psychose und Sucht. Von den Grundlagen zur Praxis. Darmstadt: Steinkopf. Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K., Donati, R., Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe. Hapke, U., Rumpf, H.-J. & John, U. (2002). Früherkennung und Frühintervention bei Alkoholproblemen. In K. Mann (Hrsg.), Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen (S. 46-58). Lengerich: Pabst Science Publishers. Hautzinger, M. & Bailer, M. (2003). ADS- Allgemeine Depressionsskala. Göttingen: Beltz Test. Hautzinger, M. & Bronisch, Th. (2000). Symptomatik, Diagnostik und Epidemiologie. In N. Hoffman, & H. Schauenburg (Hrsg.), Psychotherapie der Depression (S. 1-13). Stuttgart: Thieme. Hautzinger, M. (1996). Depression. In J. Magraf. (Hrsg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Störungen (Bd. 2) (S. 121-133). Heidelberg: Springer. Hautzinger, M. (1998). Depression. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Hautzinger, M. (2003). Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen (6. Aufl.). Weinheim: Beltz. Hautzinger, M., Bailer, M., Worall, H. & Keller, F. (1995). Beck-Depressions-Inventar (BDI). Bern: Huber. 123 Heidenreich, T., Fecht, J. & Hoyer, J. (2003). Deutsche Version der Stages of Change and Readiness and Treatment Scale (SOCRATES-G). In A. Glöckner-Rist, F. Rist, & H. Küfner, (Hrsg.), Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 3.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. Hintz, T. & Mann, K. (2005). Comorbidity in Alcohol Use disorders: Focus on Mood, Anxiety and Personality. In R. Stohler & W. Rössler (Hrsg.), Dual Diagnosis. The Evolving Conceptual Framework (S. 65-91). Basel: Karger. Hintz, T. & Mann, K. (2006). Co-Occurring Disorders: Policy and Practice in Germany. The American Journal on Addiction, 15, 261-267. Hintz, T., Diehl, A. & Croissant, B. (2004). Psychische Komorbidität bei alkoholbezogenen Störungen. Psychoneuro, 30 (1), 42-48. Hoffman, N. & Schauenburg, H. (Hrsg.) (2000). Psychotherapie der Depression. Stuttgart: Thieme. Holz, A. & Leune, J. (1999). Versorgung Suchtkranker in Deutschland. In Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren (Hrsg.), Jahrbuch Sucht 2000. Geesthacht: Neuland. John, U., Hapke, U., Rumpf, H., Hill, A. & Dilling, H. (1996). Prävalenz und Sekundärprävention von Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit in der medizinischen Versorgung. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Bd. 71. Baden Baden: Nomos. Kapfhammer, H.-P. (2000). Zur Kombination und Interaktion von Psycho- und Pharmakotherapie. In N. Hoffman & H. Schauenburg (Hrsg.), Psychotherapie der Depression (S. 125-138). Stuttgart: Thieme. Kapfhammer, H.-P. (2004). Alkohol und Depression in der Konsultation-LiaisonPsychiatrie. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 5, 30-36. Kiefer, F. & Mann, K. (2007a). Diagnostik und Therapie der Alkoholabhängigkeit. Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie, 75, 33-46. Kiefer, F. & Mann, K. (2007b). Evidenzbasierte Behandlung der Alkoholabhängigkeit. Nervenarzt, 78, 1321-1331. Kiefer, F. (2002). Pharmakotherapeutische Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit. In K. Mann (Hrsg.), Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen (S. 91-106). Lengerich: Pabst Science Publishers. 124 Körkel, J., Projektgruppe kT (2003). EkT-Trainer-Manual. Ambulantes Einzelprogramm zum kontrollierten Trinken (EkT). Heidelberg: GK Quest Adademie GmbH. Kraus, L. & Augustin, R. (2005). Alkoholkonsum, alkoholbezogene Probleme und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. Sucht, 51, Suppl. 1, 29-39. Kraus, L. & Bauernfeind, R. (1998). Repräsentativerhebung zum Konsum psychotroper Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 1997. Sucht, 44, Suppl. 1. Krausz, M., Degkwitz, P. & Vertheim, U. (2000). Psychiatrische Komorbidität und Suchtbehandlung. Suchttherapie, 1, 3-7. Kremer, G. (2003). Motivational Interviewing als Kurzintervention bei Menschen mit Alkoholproblemen: Stand der Forschung und Praxis. Suchttherapie, 4, 125-131. Kruse, G., Körkel, J. & Schmalz, U. (2000). Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln. Bonn: Psychiatrie-Verlag. Kuhlmann, T. (2005). Motivational Interviewing und Frühintervention. Suchttherapie, 6, 35-38. Kühner, C. & Weber, I. (Hrsg.) (2001). Depression vorbeugen. Ein Gruppenprogramm nach R.F. Munoz. Göttingen: Hogrefe. Lachner, G. & Wittchen, H.-U. (1997). Familiär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit. In H. Watzl & B. Rockstroh (Hrsg.), Alkoholabhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen (S. 42-89). Göttingen: Hogrefe. Lamnek, S. (2005). Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. Weinheim: Beltz. Lieb, K. (2005). Affektive Störungen. In S. Brunnhuber, S. Frauenknecht, & K. Lieb (Hrsg.), Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie (S.145-174). München: Urban & Fischer. Lieb, R. & Isensee, B. (2007). Häufigkeit und zeitliche Muster von Komorbidität. In F. Moggi (Hrsg.), Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht (S. 27-58). Bern: Huber. Lindenmeyer, J. (2001). Der springende Punkt. Stationäre Kurzintervention bei Alkoholmissbrauch. Lengerich: Pabst Science Publishers. Lindenmeyer, J. (2005). Alkoholabhängigkeit. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. 125 Loeber, S. & Mann, K. (2006). Prävention bei Alkoholismus: Was wirkt? Psychiatrische Praxis, 33, 108-116. Maier W., Franke P. & Linz M. (1999). Mehrfachdiagnosen (Komorbidität). In M Gastpar, K. Mann & H. Rommelspacher (Hrsg.), Lehrbuch der Suchterkrankungen (S. 83-93). Stuttgart: Thieme. Maier, W. (1997). Mechanismen der familiären Übertragung von Alkoholabhängigkeit und Alkoholabusus. In H. Watzl & B. Rockstroh B. (Hrsg.), Alkoholabhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen (S. 91-109). Göttingen: Hogrefe. Maier, W., Linz, M. & Freyberger, H.-J. (19997). Komorbidität von Substanzstörungen und anderen psychischen Störungen. In M. Soyka & H.-J. Möller (Hrsg.). Alkoholismus als psychische Störung (S. 75-93). Bayer-ZNS-Symposium XII. Berlin: Springer. Mann, K. & Schwärzler, F. (2000). Alkoholabhängigkeit. In R. Thomasius (Hrsg.), Psychotherapie der Suchterkrankungen (S. 1-9). Stuttgart: Thieme. Mann, K. & Stetter, F. (2002). Die qualifizierte Entzugbehandlung von Alkoholabhängigen: Entwicklung und Evaluation. In K. Mann (Hrsg.), Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen (S. 59-72). Lengerich: Pabst Science Publishers. Mann, K. (1999). Konzepte der Alkoholismustherapie. In M.V. Singer & S. Teyssen (Hrsg.), Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen Diagnostik Therapie (S. 487-495). Berlin: Springer. Mann, K., Gann, H. & Günther, A. (2004). Suchterkrankungen. In M. Berger (Hrsg.), Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie (S. 389-452). München: Urban & Fischer. Marneros, A. (2004). Das neue Handbuch der Bipolaren und Depressiven Erkrankungen. Stuttgart: Thieme. Mayring, P. (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz. Mayring, P. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz. Mey, G. & Mruck K. (2007). Qualitative Interviews. In: G. Naderer & E. Balzer (Hrsg.), Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis. Grundlagen, Methoden und Anwendungen (S. 249-278). Wiesbaden: Gabler. Meyer, Ch. & John, U. (2008). Alkohol-Zahlen und Fakten zum Konsum. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.), Jahrbuch Sucht 2008 (S. 23-53). Geesthacht: Neuland. 126 Mieg, H.& Näf, M. (2005). Experteninterviews. Institut für Mensch-Umwelt-Systeme (HES), Zürich: ETH. Miller, W.R.& Rollnick, S. (1999). Motivierende Gesprächsführung. Ein Konzept zur Beratung von Menschen mit Suchtproblemen. Freiburg im Breisgau: Lambertus. Minkoff, K. (1994). Programmbestandteile eines integrierten Behandlungssystems für schwer psychisch erkrankte Patienten mit gleichzeitig bestehendem Suchtmittelmissbrauch. Deutsche Übersetzung: Miericke, S., Krausz, M. In M. Krausz & T. Müller-Thomson (Hrsg.), Komorbidität. Therapie von psychischen Störungen und Sucht. Konzepte für Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation (S. 63-79). Freiburg: Lambertus. Moggi, F. & Donati, R. (2004). Psychische Störungen und Sucht: Doppeldiagnosen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Moggi, F. (2005). Etiological Theories on the Relationship of Mental Disorders und Substance Use Disorders. In Stohler, R., Rössler, W. (Hrsg.). Dual Diagnosis. The Evolving Conceptual Framework (S. 1-14). Basel: Karger. Moggi, F. (2007). Ätiologiemodelle zur Komorbidität von Angst- und Substanzstörungen sowie von Depression und Substanzstörungen. In F. Moggi (Hrsg.), Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht (S. 27-58). Bern: Huber. Möller, H.J., Müller, W.E. & Volz, H.P. (2000). Psychopharmakotherapie- eine Leitlinie für Klinik und Praxis (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. Petry, J. (1996). Alkoholismustherapie. Materialien für die psychosoziale Praxis (3.erw. Aufl.). Weinheim: Beltz. Petry, J. (2006). Psychotherapie bei Suchtmittelmissbrauch und Abhängigkeit: Motivation und Motivierung. In: P. Schuhler & M. Vogelgesang (Hrsg.), Psychotherapie der Sucht. Methoden, Komorbidität und klinische Praxis (S. 130-150). Lengerich: Pabst Science Publishers. Reker, M. & Kremer, G. (2000). Alkohol. In T. Pohhlke, I. Flenker, M. Reker, Th. Reker, G. Kremer & A. Batra. (Hrsg.), Suchtmedizinische Versorgung. Alkohol Tabak Medikamente (Bd. 3) (S. 3-157). Berlin: Springer. Roider, S., Scheuber, A.-L., Härtel-Petri, R. & Wolfersdorf, M. (2007). Psychoedukation bei Sucht und Depression/ Angststörungen. Kurzinterventionen während qualifizierter Entgiftungsbehandlung. Psychiatrische Praxis 34, 49-51. 127 Rommelspacher H. (1999). Modelle der Entstehung und Aufrechterhaltung süchtigen Verhaltens. Neurobiologische Ansätze. In M. Gastpar, K. Mann & H. Rommelspacher (Hrsg.), Lehrbuch der Suchterkrankungen (S. 28-38). Stuttgart: Thieme. Rost, W.D. (1987). Psychoanalyse des Alkoholismus. Stuttgart: Klett. Rost, W.D. (1994). Der psychoanalytische Ansatz: Die Therapie der Grundstörung. In W. Scheiblich (Hrsg.), Sucht aus der Sicht psychotherapeutischer Schulen (S. 2639). Freiburg: Lambertus. Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U. & John, U. (2003). Deutsch Version des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-G-L). In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Küfner (Hrsg.), Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 3.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. Saß, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (2003). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen Textrevision. DSM IV-TR. Göttingen: Hogrefe. Schaub, A., Roth, E. & Goldmann, U. (2006). Kognitiv- psychoedukative Therapie zur Bewältigung von Depression. Ein Therapiemanual. Göttingen: Hogrefe. Schauenburg, H. & Zimmer, F.T. (2005). Depression. In W. Senf & M. Broda. (Hrsg.) Praxis der Psychotherapie. Ein integratives Lehrbuch. Stuttgart: Thieme. Schauenburg, H. (2000): Psychodynamische Psychotherapie. In N. Hoffmann & H. Schauenburg (Hrsg.), Psychotherapie der Depression (S. 44-62). Stuttgart: Thieme. Schauenburg, H. (2007). Depressive Störungen. In B. Strauß, F. Hohagen & F. Caspar (Hrsg.), Lehrbuch Psychotherapie Teilband 1 (S. 377-401). Göttingen: Hogrefe. Scherbaum, N. (1999). Grundprinzipien der Therapie. In M. Gastpar, K. Mann & H. Rommelspacher (Hrsg.), Lehrbuch der Suchterkrankungen (S. 94-103). Stuttgart: Thieme. Schmidt, L.G. (1999). Biologische Marker des Alkoholismus und alkoholassoziierter Organschäden. In M.V. Singer & S. Teyssen (Hrsg.), Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen Diagnostik Therapie (S. 122-129). Berlin: Springer. Schmidt. L.G. (1997). Frühdiagnostik und Kurzintervention beim beginnenden Alkoholismus. Deutsches Ärzteblatt, 94 (44), 2905-2908. Schneider, R. (2001). Die Suchtfibel. Informationen zur Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Hohengehren: Schneider. 128 Schönell, H. & Closset, J. (2002). Behandlung von Patienten mit Doppeldiagnosen in der psychiatrischen Regelversorgung. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.), „Alkohol, Nikotin, Kokain…und kein Ende?“ Suchtforschung, Suchtmedizin und Suchttherapie am Beginn des neuen Jahrzehnts (S. 473-479). 14. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht). Lengerich: Pabst Science Publishers. Schuckit M.A. (1986). Genetic and Clinical implications of alcoholism and affective disorders. American Journal Psychiatry 143, 140-147. Schuckit M.A. (1994). Alcohol and depression: a clinical perspective. Acta Psychiatrica Scandinavica Suppl. 377, 28-32. Schuhler, P. & Baumeister, H. (1999). Kognitive Verhaltenstherapie bei alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Diagnostik Behandlung Frühintervention. Materialien für die klinische Praxis. Weinheim: Beltz. Schuhler, P. & Jahrreiss, R. (1996). Die Münchwies-Studie. Berlin-Bonn: Westkreuz. Schuhler, P. & Schmitz, B. (2006), Psychotherapie bei Abhängigkeitserkrankungen und komorbider Persönlichkeitsstörung. In P. Schuhler & M. Vogelgesang (Hrsg.), Psychotherapie der Sucht. Methoden, Komorbidität und klinische Praxis (S. 175-204). Lengerich: Pabst Science Publishers. Schuhler, P. & Vogelgesang, M. (Hrsg.). (2006). Psychotherapie der Sucht. Methoden, Komorbidität und klinische Praxis. Lengerich: Pabst Science Publishers. Schuhler, P. & Wagner, A. (2006). Psychotherapie bei Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. In P. Schuhler & M. Vogelgesang (Hrsg.), Psychotherapie der Sucht. Methoden, Komorbidität und klinische Praxis (S. 151-174). Lengerich: Pabst Science Publishers. Schuhler, P. (1998). Kurz- und Langzeiteffekte eines Verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramm auf die körperliche und psychische Symptomatik depressiver Patienten mit Alkohol- bzw. Medikamentenabusus. Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 19 (1), 107-124. Schwoon, D. R. (2002). Differentialdiagnostik durch Selbstrating-Fragebogen (Hamburger-Alkoholismus-Skalen). In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.), „Alkohol, Nikotin, Kokain…und kein Ende?“ Suchtforschung, Suchtmedizin und Suchttherapie am Beginn des neuen Jahrzehnts (S. 464-472). 14. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht). Lengerich: Pabst Science Publishers. 129 Singer, M.V. & Teyssen, S. (Hrsg.). (1999). Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen Diagnostik Therapie. Berlin: Springer. Siris, S. G. (1994). Pharmakotherapie bei schizophrenen Patienten mit Drogenmissbrauch. In D. Schwoon & M. Krausz (Hrsg.). Psychose und Sucht. Krankheitsmodelle, Verbreitung, therapeutische Ansätze (S. 80-94). Freiburg: Lambertus. Soyka , M. (1999). Klinisch-psychiatrische Diagnostik des Alkoholismus. In M.V. Singer & S. Teyssen (Hrsg.), Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen Diagnostik Therapie (S. 130-140). Berlin: Springer. Soyka, M. & Lieb, M. (2004). Depression und Alkoholabhängigkeit – Neue Befunde zu Komorbidität, Neurobiologie und Genetik. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 3, 37-46. Soyka, M. (1997). Psychopharmaka bei Alkoholabhängigkeit- Indikationen, Interaktionen und Wirksamkeit. In M. Soyka & H.-J. Möller (Hrsg.), Alkoholismus als psychische Störung. (S. 137-159). Bayer - ZNS - Symposium XII. Berlin: Springer. Soyka, M. (1997a). Neuere Medikamentöse Ansätze in der Alkoholismustherapie. In H. Watzl & B. Rockstroh. (Hrsg.), Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen (S. 229-248). Göttingen: Hogrefe. Stoppe, G., Bramesfeld, A. & Schwartz, F.-W. (2006). (Hrsg.). Volkskrankheit Depression? Bestandaufnahme und Perspektiven. Heidelberg: Springer. Viehhauser, R. (2005). Komorbidität Psychose und Sucht. Eckpfeiler einer integrativen Therapie. Bayreuth: Rehabilitationsstätten Bernhard F. Bröckelmann KG. Wanke, K. & Bühringer, G. (1991) (Hrsg.). Grundstörung der Sucht. Berlin: Springer. Wetterling, T. & Veltrup, C. (1997). Diagnostik und Therapie bei Alkoholproblemen. Ein Leitfaden. Berlin: Springer. Wienberg, G. (2002). Versorgungsstrukturen von Menschen mit Alkoholproblemen in Deutschland - eine Analyse aus Public Health-Perspektive. In K. Mann (Hrsg.), Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen (S. 17-45). Lengerich: Pabst Science Publishers. Wittchen, H.-U. & Jacobi, F.J. (2006). Epidemiologie. In G. Stoppe, A. Bramesfeld, & F.-W. Schwartz (Hrsg.), Volkskrankheit Depression? Bestandaufnahme und Perspektiven (S. 15-37). Heidelberg: Springer. Wittchen, H.-U. & Vossen, A. (2000). Komorbiditätsstrukturen bei Angststörungen Häufigkeit und mögliche Implikation, In J. Magraf (Hrsg.), Lehrbuch der Verhal- 130 tenstherapie. Grundlagen- Diagnostik- Verfahren- Rahmenbedingungen (Bd. 1) (S. 329-345). Heidelberg: Springer. Wittchen, H.-U., Garcynski, E. & Pfister, H. (1998). Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Deutsche Bearbeitung. Göttingen: Hogrefe. Wittfoot, H., Driessen, M. (2000). Alkoholabhängigkeit und psychiatrische Komorbidität – ein Überblick. Suchttherapie, 1, 8-15. Wolfersdorf, M. (2006). Suizidalität. In G. Stoppe, A. Bramesfeld & F.-W. Schwartz (Hrsg.), Volkskrankheit Depression? Bestandaufnahme und Perspektiven (S. 257301). Heidelberg: Springer. Wolffgramm, J. (1997). Abhängigkeitsentwicklung im Tiermodell. In H. Watzl & B. Rockstroh, (Hrsg.), Alkoholabhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen (S. 25-41). Göttingen: Hogrefe. Zumbeck, S. & Conrad, E. (2008). Ein integriertes kognitiv-verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm für die Doppeldiagnose „Sucht und Depression“ – Untersuchung der Akzeptanz und Wirksamkeit. Pilotstudie. Sucht 54 (2),101-107. Erklärung Hiermit erkläre ich, die Masterthesis zum Thema „Entwicklung eines Kurzinterventionskonzepts für stationäre depressive Patienten mit komorbidem Alkoholmissbrauch“ eigenständig und nur unter Benutzung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt zu haben. Alle zitierten oder sinngemäß übernommenen Textstellen sind entsprechend gekennzeichnet und die Originalquellen vollständig angegeben. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder veröffentlicht. Mannheim, den ______________________ Gesine Rest ANHANG INHALT: Behandlungsprogramm: Audit SOKRATES Auswertung SOKRATES Aktive Informationsvermittlung Teil I o Wann spricht man von Alkoholmissbrauch? o Berechnung des Alkoholgehaltes in Gramm o Alkoholabbau im Körper o Wie entstehen die unangenehmen Nebenwirkungen nach Alkoholkonsum? IDTSA Auswertung IDTSA Aktive Informationsvermittlung Teil II o Wie sind die sozial üblichen Trinknormen im deutschen Sprachraum? o Was sind mögliche gesundheitliche Folgen von Alkoholkonsum? Störungsmodelle zu Komorbidität Entscheidungsmatrix Punktabstinenzkarte Patientenliteratur und Selbsthilfeverbände Stundenprotokoll Experteninterview: Interviewleitfaden Einwilligungserklärung Audit Fragebogen Quelle: Wetterling, T. & Veltrup, C. (1997). Diagnostik und Therapie von Alkoholproblemen. Ein Leitfaden. Springer: Berlin. Quelle: Wetterling, T. & Veltrup, C. (1997). Diagnostik und Therapie von Alkoholproblemen. Ein Leitfaden. Springer: Berlin. Auswertung SOCRATES Die deutsche Originalpublikation des SOSRATES-G (German) mit Auswertung befindet sich in: Wetterling, T., & Veltrup, C. (1997). Diagnostik und Therapie von Alkoholproblemen. Ein Leitfaden. Berlin: Springer. Der SOCRATES erlaubt die Abschätzung der Veränderungsbereitschaft eines Patienten. Mit Hilfe der Auswertung dieses Fragebogens können die Phasen nach dem Modell der Prochaska und DiClemente (1983) (siehe Kapitel 2.4.2) abgeschätzt werden: Veränderungsphase Fragen Precontemplation Vorahnungsphase 1,10,15 Contemplation Einsichtsphase 2,6,11,16 Determination Einsichtsphase 3,7,12,17 Action Aktionsphase 4,8,13,18 Maintenance Aufrechterhaltung 5,9,14,19 Zusätzlich können faktorenanalytische ermittelte Faktoren abgeschätzt werden (Miller et al., 1996 zit. n. Wetterling & Veltrup, 1997). Diese erlauben einen indirekten Rückschluss auf die Veränderungsbereitschaft, insbesondere der Absicht, Schritte auf eine Veränderung des Trinkverhaltens hin zu unternehmen. SOCRATES (Miller et.al., 1996) Fragen Taking Steps Schritte zur Veränderung 4,5,8,9,13,14 Unternehmen 18,19 Recognition Anerkennen der Problematik 1,3,7,10,12,15,17 Ambivalence Ambivalenz hinsichtlich der 2,6,11,16 Änderungsbereitschaft Zu werten sind die zustimmenden Antworten. Je deutlicher die Zustimmung des Patienten zu einer Frage, desto höher ist sie zu werten (Stimme voll zu = 2, Stimme zu = 1). Aktive Informationsvermittlung Teil I Wann spricht man von Alkoholmissbrauch? DSM-IV Kriterien für die Alkoholmissbrauch (305.00): Für eine Diagnose des Alkoholmissbrauchs muss mindestens sich eines von 4 Kriterien innerhalb eines 12-monatigen Zeitraumes manifestieren 1. Wiederholter Substanzgebrauch, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt. 2. Wiederholter Substanzgebrauch in Situationen, in denen es auf Grund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann. 3. Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch 4. Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz schädlicher oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Auswirkungen der psychotropen Substanz verursacht oder verstärkt werden. Alkoholmissbrauch liegt vor, wenn aufgrund des Alkoholkonsums Probleme in einem oder mehren der folgenden Bereiche bestehen oder zu erwarten sind. - Körperliche Gesundheit (z.B. Lebererkrankungen, Unfallverletzungen) - Seelische Wohlbefinden (z.B. depressive Zustände oder Ängste) - Berufliche Leistungen (z.B. Fehlzeiten Abmahnungen) - Soziale Beziehungen (z.B. Konflikte in der Familie) - Freizeit (z.B. vernachlässigen von Hobbys) - Finanzen (z.B. hohe alkoholbedingte Geldausgaben) - Legalität (z.B. Fahren unter Alkoholeinfluss, Gewaltdelikte) Patienten reagieren oft ungläubig, wenn ihnen gesagt wird, dass Missbrauch von Alkohol dann vorliegt, wenn: 1. zu unpassender Gelegenheit (Autofahren, Arbeit, Sport, Schwangerschaft) 2. bis zum Rausch 3. zu Besserung einer gestörten seelischen Befindlichkeit („Seelentröster“) 4. langfristig übermäßig, (d.h. tgl. Männer 30 g und Frauen 20g Reinalkohol) getrunken wird. Abgrenzung zu Alkoholgebrauch wenn: 1. nicht regelmäßig getrunken wird 2. zum Genuss und nicht zur Belohnung und Verwöhnung getrunken wird 3. wenn die Menge und Situation angemessen sind Eine festgelegte Tagesobergrenze die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) noch als unbedenklich eingestuft wird liegt bei 20 g Reinalkohol (Frauen) das entspricht ca. 0,5 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein 30 g Reinalkohol (Männer) 0,75 l. Bier und 0,3 l Wein Zu beachten gilt hierbei die wichtige Faustregel mindestens 2 Abstinenztage pro Woche einzuhalten. Wie errechne ich den Alkoholgehalt in Gramm und den Promillewerte? Berechnung des Alkoholgehalts in Gramm: Der Alkoholgehalt bestimmt sich aus der Flüssigkeitsmenge des Getränkes und dem enthaltenen Prozentanteil an Alkohol. Halb-Liter-Flasche Bier mit „Alc. 5%vol.“ Das heißt 5 % der Flüssigkeit in der Flasche Bier (des Volumens) sind reiner Alkohol Die Formel lautet: Alkoholmenge (ml)= Flüssigkeitsmenge (ml) x Alkoholprozent ------------------------------------------------------100 500 x 5 ------------- =25 ml 100 500 ml Bier enthalten also 25 ml reinen Alkohol. Wenn man den Alkoholanteil in Gramm (g) ermitteln möchte ist das spezifische Gewicht von Alkohol (0,8) zu berücksichtigen. 1 ml reiner Alkohol wiegt 0,8 g. Alkoholmenge (ml) x 0,8 Alkoholmenge (g) 25 x 0,8 = 20g Reinalkohol Berechnung des Promillewerts Die Berechnungsformel (Widmark-Formel) für den bei Alkoholkonsum entstehenden Promillewert lautet: Alkoholabbau im Körper Die Ausscheidung und Verarbeitung von Alkohol im Körper geschieht mit 0,1 bis 0,15 Promille in der Stunde sehr langsam. Über den Urin werden maximal 5%, über Haut und Atem 3% ausgeschieden. Die Leber verstoffwechselt 92 % des Alkohols. Entscheidend ist, dass der Abbau von Alkohol in der Leber durch nichts beschleunigt werden kann. Während sich der Betroffene nach wenigen Stunden bereits wieder nüchtern fühlt, kann der Restalkohol im Blut noch weit über der in verschiedenen Situationen zulässigen Höhe liegen. Für die Teilnahme am Straßenverkehr gilt der Promillewert von 0,3 bei dem keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Wobei zu beachten ist, dass bei einem Unfall stets die relative Fahrtüchtigkeit geprüft wird. Alkoholgehalt gängiger Getränke in Volumenprozent und Gramm Alkohol Volumenprozent (Vol.%) Gramm Alkohol in: Gramm Alkohol in: Bier (4,8) 12,7 (0,33l) 19,2 (0,5l) Wein/Sekt (12,5) 25 (0,25l) 75 (0,5) Cognac (40) 6,4 (2 cl) 12,8 (4 cl) Ouzo (38) 6,1 (2cl) 12,2 (4cl) Ramazotti (30) 4,8 (2cl) 9,6 (4cl) Amaretto (20-28) 3,2-4,5 (2cl) 6,4-9 (4cl) Wodka (37,5- 55) 6-8,8 (2cl) 12-17,6 (4cl) Wie entstehen die unangenehmen Nebenwirkungen nach Alkoholkonsum? Oftmals trinken die Menschen Alkohol, weil sie sich neben dem Geschmack eine angenehme Wirkung versprechen. Tatsächlich stimuliert Alkohol das Belohnungszentrum im menschlichen Gehirn. Hier entsteht die Zwei-Phasenwirkung: nach der angenehmen Hauptwirkung entsteht eine Nachwirkung in Form einer unangenehmen Erregung und dysphorischen Stimmung. Bei starkem Alkoholkonsum ist die Nachwirkung als sog. „Kater“ bekannt: man ist gereizt, geräusch- und lichtempfindlich und hat Magenprobleme. Den wenigsten Menschen ist allerdings bewusst, dass die unangenehme Wirkung bei jeder Alkoholeinnahme besteht, selbst wenn sie von dem Betroffenen unterhalb von 0,6 Promille subjektiv nicht erlebt oder zumindest nicht auf Alkohol zurückgeführt wird. Man bezahlt also jede positive Alkoholwirkung immer mit einer unangenehmen Nachwirkung. In dieser Zeit ist der Schlafrhythmus gestört, die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit herabgesetzt und die psychische Belastbarkeit verringert. Diese unangenehme Nachwirkung stellt das Suchtpotenzial von Alkohol dar. Wenn man in dieser Phase erneut trinkt, dann werden zum einen größere Alkoholmengen benötigt um eine angenehmen Effekt zu erzielen, weil man sich zunächst durch die Nachwirkungen „hindurchtrinken“ muss (Toleranzsteigerung). Zum anderen können sich die beiden Nachwirkungen nunmehr addieren zu einem immer unangenehmeren Gefühl bis hin zu den von Alkoholabhängigen erlebten körperlichen Entzugserscheinungen. Quelle: Lindenmeyer, J. (2001). Der springende Punkt. Stationäre Kurzintervention bei Alkoholmissbrauch. Lengerich: Pabst Science Publishers. Aktive Informationsvermittlung Teil II Wie sind die sozial üblichen Trinknormen im deutschen Sprachraum? Oftmals werden deutliche Hinweise auf einen schädlichen Alkoholkonsum wie gezieltes Wirkungstrinken zu Bewältigung persönlicher Schwierigkeiten, Steigerung der Trinkmenge bis hin zum häufigen Rausch lange Zeit weder von dem Betroffenen noch von seiner Umwelt bedenklich angesehen. Vor dem Hintergrund einer „gestörten Trinkkultur“, in der es keine klaren Grenzen zwischen normalem und unnormalem Alkoholkonsum gibt, gelten vielmehr „unausgesprochene Trinkregeln“. 1) Regelmäßiger Alkoholkonsum ist normal Etwa 85 % der Bevölkerung trinkt regelmäßig Alkohol. Alkohol ist in der Regel das erste Suchtmittel, mit dem ein Mensch in seiner Jugend in Berührung kommt. Kein anderes Suchtmittel ist derart im Alltag verankert wie Alkohol. 2) Alkohol gehört dazu Zwar gibt es hier zu Lande keinen Trinkzwang, trotzdem ist es in einer Vielzahl von Situationen üblich, Alkohol zu trinken. Die 5 häufigsten Trinksituationen sind Geselligkeit, Fernsehen, Kneipen, Mahlzeiten (außer Frühstück) und der Arbeitsplatz. 3) Alkohol tut gut Ganz allgemein herrscht hier zu Lande eine positive Einstellung gegenüber alkoholischen Getränken und ihren Wirkungen. Alkohol wird üblicherweise nicht allein wegen seines Geschmacks getrunken, sondern für eine Vielzahl von Situationen als angenehmes Lösungs- oder Hilfsmittel angesehen. 4) Trinke so viel wie dein Nachbar Es gibt hier zu Lande kleine klare Vorstellung darüber, wie viel Alkohol man trinken kann und ab wann man besser aufhören sollte. Stattdessen hängt es von der Trinksituation und v.a. dem Alkoholkonsum des Mittrinkenden ab, welche Alkoholmengen als angemessen angesehen wird. Menschen mit einem schädlichen Alkoholkonsum fühlen sich daher automatisch zu Leuten hingezogen, die ähnlich viel trinken wie sie selbst. 5) Alkoholtrinken ist Privatsache Ganz allgemein herrscht hier zu Lande die Auffassung, dass man sich in den Alkoholkonsum von anderen Menschen besser nicht einmischen sollte. Entsprechend erfahren selbst Menschen mit einem offensichtlichen Alkoholproblem oft lange Zeit keine kritische Rückmeldung von ihrer Umwelt. Quelle: Lindenmeyer, J. (2001). Der springende Punkt. Stationäre Kurzintervention bei Alkoholmissbrauch. Lengerich: Pabst Science Publishers. Was sind mögliche gesundheitliche Folgen von Alkoholkonsum? Alkohol ist für den menschlichen Körper ein Schadstoff. Wenn Alkohol in den Körper gelangt erreicht er fast jede Zelle. Fettgewebe und Knochen sind von ihm am wenigsten betroffen, das Gehirn mit seiner starken Durchblutung am allerstärksten. Die Stärke der Durchblutung ist jedoch nicht allein ausschlaggebend für die Schädlichkeit des Alkohols in dem betreffenden Organ. Ebenso wichtig ist die Höhe des Energieumsatzes. Der ist im Gehirn, im Herzen und in der Leber besonders hoch. Organe wie Niere und Lunge, die zwar auch stark durchblutet sind, aber nicht so leicht Sauerstoffmangel leiden, sind gegen Alkoholschäden besser gefeit. Die Schädigung der Organe erfolgt auf vier verschiedene Weisen: Erstens ist Alkohol selbst ein Zellgift und wirkt als Stressor auf den gesamten Organismus: der Blutdruck steigt; Cortison, Fett und Zucker werden vermehrt in den Blutkreislauf gebracht. Zweitens wird für seine Beseitigung aus dem Körper Energie verbraucht, die den Organen für ihre eigentliche Tätigkeit fehlt. Durch die Verbrennung des Alkohols in der Leber können bis zu 80 % des verfügbaren Sauerstoffs beansprucht werden, so dass Alkohol wie ein „Stoffwechselparasit“ wirkt. Die Zellen des Herzens und der Hirnrinde habe den höchsten Sauerstoffverbrauch, so dass sie besonders darunter leiden. Drittens bringt Alkoholmissbrauch eine Fehlernährung des Körpers mit sich, so dass häufig die Eiweißbausteine, Mineralstoffe und wichtigen Vitamine in der Nahrung fehlen. Die Fehlernährung hat ihren Grund außerdem in einer zunehmenden Unfähigkeit des Dünndarms, wichtige Stoffe aufzunehmen (Vitamin B1, Folsäure, später auch Natrium und Wasser). Viertens schädigen hochgiftige Stoffe, die beim Abbau des Alkohols in der Leber entstehen (z.B. Acetaldehyd), die Nervenzelle und sonstiges Körpergewebe. Dasjenige Organ, das immer durch Alkoholmissbrauch zumindest geringfügig geschädigt wird, ist die Leber. Die Schäden reichen von der Leberschwellung und der Fettleber, die wieder ausheilen können, bis hin zur Leberzirrhose. Diese Schrump- fung kann zwar durch Abstinenz zum Stillstand gebracht, nicht aber wieder rückgängig gemacht werden. Das andere Organ, das bei jedem Alkoholmissbrauch in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das Zentralnervensystem. Es besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark mit einem Netz von rund 100 Milliarden Nervenzellen. Die Zellen des 15001600 Gramm wiegenden Gehirns, von denen bei jedem starken Trinken etliche Tausend absterben, können nicht wieder belebt werden. Allerdings verfügt der Mensch über so viele Milliarden von Gehirnzellen, dass dieser Schwund erst nach längerer Zeit für andere bemerkbar wird. Der Betreffende selbst merkt von diesem schleichenden Verlust sogar oft überhaupt nichts. Die Wirkungen des Alkohols auf den Gesamtorganismus zusammengefasst: Körperlich Gehirn Nerven und Hirnzellen sterben ab, Krampfanfälle; bleibende Gehirnschäden z.B. Hirnschrumpfung; sinkende geistige Leistungsfähigkeit. Herz und Kreislauf Herzmuskelschwäche, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen. Speiseröhre und Magen Magenschleimhautentzündung, Krampfadern in der Speisröhre, Rückfluss von Magensaft in die Speiseröhre, Sodbrennen. Leber Fettleber, Leberentzündung; Leberzirrhose, Ödeme, Blutgerinnungsstörungen, Krampfadern und Hämorrhoiden. Bauchspeicheldrüse Chronische Bauchspeicheldrüsenstörung mit Folge von Diabetes; akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Geschlechtsorgane Frauen: Zyklus-Umregelmäßigkeiten, während der Schwangerschaft Gefahr der Schädigung des Embryos. Männer: verringerte Bildung des Sexualhormons Testosteron; Erhöhung des weiblichen Sexualhormons Östrogen. Knochen und Gelenke Gelenkschmerzen, Gichtauslösung. Nerven Schädigung der Nervenbahnen (Polyneuropathie). Niere Erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen. Lunge Erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen und Infektionen. Psychisch Leistungsverhalten Kognitive Dysfunktionen in den Bereichen Gedächtnis, räumliche Wahrnehmung, Reaktionsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, feinmotorische Geschicklichkeit. Persönlichkeit Erhöhte Depressivität, instabile Stimmungslage, vermindertes Selbstwertgefühl, verminderte Frustrationstoleranz, vermehrtes aggressives Verhalten, Verminderung der Fähigkeit der Bewältigung psychosozialer Aufgaben. Sozial und familiär Gestörte Beziehung zu den Mitmenschen, Abnahme des Verantwortungsgefühls, Vernachlässigung sozialer und haushaltlicher Bereiche, Fernbleiben von der Arbeit, Führerscheinverlust, gehäufte Betriebs- und Verkehrsunfälle, Abstieg im Beruf, Straffälligkeit. Quelle: Schneider, R. (2001). Die Suchtfibel. Informationen zur Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten. Schneider Verlag, Baltmannsweiler. S. 124 ff Störungsmodelle zu Komorbidität Selbstmedikationsmodell Darunter wird der Versuch verstanden, die Symptome oder das Leiden einer psychischen Störung mit Suchtmittelkonsum zu lindern. Ein Beispiel ist ein Patient, der an einer Sozialphobie leidet, der versucht mit Alkohol seine Ängste zu lindern und sein Vermeidungsverhalten zu überwinden. Exazerbationsmodell Darunter wird die Verschlimmerung von Symptomen psychischer Störungen durch das substanzgebundene Suchtverhalten verstanden. Ein Beispiel ist ein Patient mit einer primären Depression, der Alkohol missbraucht und dadurch die Symptome seiner Depression aufrechterhält oder noch verschlimmert. Suchtfolgemodell Darunter werden substanzinduzierte Symptome von psychischen Störungen verstanden. Ein Beispiel ist ein Kokain konsumierender Patient, der unter depressiven Verstimmungen leidet, die dann auftreten, wenn die Kokainwirkung nachlässt. Das ist keine Doppeldiagnose, sondern die Symptome sind Folgesymptome, die bei anhaltender Abstinenz verschwinden. Mischmodelle Darunter werden Störungsmodelle verstanden, die eine funktionale Wechselwirkung zwischen den beiden Störungen im Sinne eines Teufelskreises enthalten. Symptome psychischer Störungen führen zu verstärktem Suchtmittelkonsum, der seinerseits die psychischen Symptome zwar kurzfristig lindert, aber langfristig zu deren Verschlimmerungen und zur allgemeinen Verschlechterung des biopsychosozialen Zustandes führt. Ein Beispiel ist ein Patient mit Posttraumatischer Belastungsstörung, der durch Alkoholkonsum zwar kurzfristig Symptome wie seine Übererregung verringert, damit aber die Posttraumatische Belastungsstörung aufrechterhält und später eine Depression entwickelt. Quelle: Moggi, F., Donati, R. (2004). Psychische Störungen und Sucht: Doppeldiagnosen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Entscheidungsmatrix Quelle: Petry, J. (1996). Alkoholismustherapie. Materialien für die psychosoziale Praxis. Weinheim: Beltz.. Punktabstinenzkarte In den folgenden Situationen werde ich künftig keinen Alkohol mehr trinken: Situation Begründung 1 2 3 4 5 6 Quelle: Lindenmeyer, J. (2001). Der springende Punkt. Stationäre Kurzintervention bei Alkoholmissbrauch. Lengerich: Pabst Science Publishers. Patientenliteratur und Selbsthilfeverbände Ratgeber für Betroffene und Angehörige Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) (2008). Umgang mit Alkohol. Informationen Tests und Hilfen in 5 Phasen. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen- DHS: Hamm. Feuerlein, W., Dittmar F., Soyka, M. (1999).Wenn Alkohol zum Problem wird: Hilfreiche Informationen für Angehörige und Betroffene.Stuttgart: Trias Hüllinghorst, R., Hoffman, K. (1998).Alkoholprobleme: So können Sie helfen. Stuttgart: Trias Körkel, J. (2001). Rückfall muss keine Katastrophe sein. Blaukreuz Verlag: Wuppertal. Lindenmeyer, J. (2005). Lieber schlau als blau. Entstehung und Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Weinheim: Beltz. Schneider, R. (2001). Die Suchtfibel. Informationen zur Entstehung und Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Schneider-Verlag: Bartmannsweiler. Wissenschaftliches Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) (2003). Alkoholabhängigkeit. DHS Info Band 1. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: Hamm. Weitere Kontakte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) www.bzga.de Telefon 0221/ 892031 Das BZgA-Telefon beantwortet Fragen zur Suchtvorbeugung. Bei Alkohol oder anderen Abhängigkeitsproblemen bietet das BZgA-Telefon eine erste persönliche Beratung mit dem Ziel, Ratsuchende an geeignete lokale Hilfe- und Beratungsangebote zu vermitteln. Deutsche Hauptselle für Suchtfragen e.V. (DHS) www.dhs.de Telefon 02381/ 9015-0 Die Telefon seelsorge bietet kosntenlose und anonyme Beratung rund um die Uhr und kann geeignete Beratungsstellen nennen Tel 0800-111 0111 oder 0800-111 0222 Selbsthilfe und Abstinenzverbände Anonyme Alkoholiker (AA) Interessengemeinschaft e.V. Telefon 08731/ 325730 www.anonyme-alkoholiker.de Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. Telefon: 030/26 309 157 www.awo.org Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Bundesverband e.V. Telefon 0561/ 78 03 13 www.freundeskreis-sucht.de Blaues Kreuz in Deutschland e.V. Telefon 0202/ 620 03-0 www.blaues-kreuz.de Kreuzbund e.V. Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige Telefon 02381/ 672 72-0 www.kreuzbund.de Datum: Stundenprotokoll Behandler: Patient: Inhalte und Themen der Sitzung Hausaufgaben Anmerkungen für nächste Sitzung geb. Interviewleitfaden A Allgemeine Fragen zum Konzept 1. Wie schätzen Sie aufgrund Ihrer Erfahrung die Umsetzbarkeit des Kurzinterventionskonzepts in den klinischen Alltag ein und mit welchen Schwierigkeiten wäre bei der Umsetzung zu rechnen? 2. Sehen Sie aus Ihrer klinischen Erfahrung heraus einen Nutzen für den Patienten? B Inhaltliche Fragen zum Konzept 3. Wie schätzen Sie die allgemeine Verständlichkeit des Konzepts hinsichtlich des Transfers, Sprache, Arbeitsaufträge, Zielrahmen für den Patienten ein? Gibt es Änderungsvorschläge? 4. Wie schätzen Sie die Akzeptanz (aktive Teilnahme, Interesse, Motivation) möglicher Teilnehmer ein? 5. Um die Zielgruppe zu identifizieren, sind der Einsatz des Screeningfragebogens AUDIT sowie das explizite Ansprechen auf den Alkoholkonsum des Patienten seitens des Arztes vorgesehen. Wie schätzen Sie diese diagnostische Vorgehensweise ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 6. Der Patient wird gebeten, den ausgefüllten Fragebogen SOKRATES zur ersten Sitzung mitzubringen. Der Test erlaubt eine Einschätzung der Veränderungsmotivation des Patienten. Das Testergebnis wird dem Patienten zurückgemeldet. Was halten Sie von dem Einsatz dieses Fragebogens? Gibt es Änderungsvorschläge? 7. In der ersten Sitzung erhält der Patient einen psychoedukativen Themenblock zu Alkoholmissbrauch, Berechnung des Promillewerts im Körper und Nebenwirkungen von Alkoholkonsum. Wie schätzen Sie den Nutzen dieser Themenbereiche ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 8. Um häufige Trinksituationen des Patienten zu erfassen und um problematische von unproblematischen Risikobereichen zu differenzieren, wird der IDTSA eingesetzt. Was halten Sie von dem Einsatz des IDTSA? Gibt es Änderungsvorschläge? 9. Die zweite Sitzung beginnt mit einem weiteren psychoedukativen Themenblock über sozialübliche Trinknormen im deutschen Sprachraum und mögliche gesundheitliche Folgen von Alkoholkonsum. Wie schätzen Sie die Auswahl der psychoedukativen Inhalte ein? Gibt es Änderungsvorschläge? 10. Anhand des IDTSA werden mit dem Patienten die unproblematischen und kritischen Trinksituationen gegenübergestellt. Halten Sie diese Gegenüberstellung zweckmäßig? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 11. Ein weiterer Schritt ist die Vermittlung eines individuellen Komorbiditätsmodells. Wie schätzen Sie diese psychoedukative Vorgehensweise ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 12. Schätzen Sie das Erteilen von Hausaufgaben, in diesem Fall das Erarbeiten einer Entscheidungsmatrix (Vor- und Nachteile der Veränderung des Trinkverhaltens auf kurz- und langfristige Sicht), als eine sinnvolle Intervention ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 13. In der dritten und vertiefenden Sitzung wird auf die Alkoholwirkungserwartung und die Selbstwirksamkeit des Patienten eingegangen. Schätzen Sie die Bearbeitung dieser Themenbereiche als zielführend ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 14. Am Ende der dritten Sitzung wird der Patient aufgefordert, sein Veränderungsziel im Umgang mit Alkohol konkret zu formulieren und aufzuschreiben. Sehen Sie Vor- oder Nachteile dieser Maßnahme? Gibt es Änderungsvorschläge? 15. Um alternative Handlungsstrategien zum Alkoholkonsum zu erarbeiten, wird in der vierten Sitzung auf die Angebote des therapeutischen Stationsalltags zurückgegriffen und diese Ressourcen miteinander verknüpft. Wie schätzen Sie diese Strategie ein? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 16. Ein Themenbereich deckt den Umgang mit Rückschlägen bei dem Versuch einer Verhaltensänderung im Umgang mit Alkohol ab. Was halten Sie von der Aufnahme dieses Themenbereiches in das Konzept. Gibt es Änderungsvorschläge? 17. Um eine mögliche Veränderung hinsichtlich der Veränderungsmotivation zu dokumentieren, wird der änderungssensitive Fragebogen SOKRATES erneut eingesetzt. Halten Sie diese Vorgehensweise für zweckmäßig. (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 18. Den Abschluss der Behandlung bilden das Aufzeigen des regionalen Netzwerkangebotes (Anlaufstellen, Selbsthilfegruppen) und die Ermutigung, diese in Anspruch zu nehmen sowie Literaturhinweise. Halten Sie diese Vorgehensweise für zielführend? (Begründung). Gibt es Änderungsvorschläge? 19. Am Ende jeder Sitzung wird der Stundeninhalt gemeinsam vom Behandler und Patienten zusammengetragen und protokolliert. Wie schätzen Sie diese Intervention ein. Gibt es Änderungsvorschläge? C Ergänzende Frage 20. Haben Sie ergänzende Anmerkungen, Ideen, Vorschläge? Einverständniserklärung Das vorliegende Behandlungskonzept wurde im Rahmen der Abschlussarbeit (Masterthesis) des postgradualen Masterstudienganges (M.Sc.) an der Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (KatHO NRW), Abteilung Köln, entwickelt. Anhand der Auswertung des leitfadengestützten Experteninterviews erfolgt die Evaluation des Behandlungskonzeptes. Die Interviews werden auf Tonband aufgenommen, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit fünf Jahre aufbewahrt. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben, die Sie im Rahmen des Interviews machen, anonymisiert und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken auf Band aufgenommen und ausgewertet werden. Mannheim, den…………… Unterschrift…………………………….