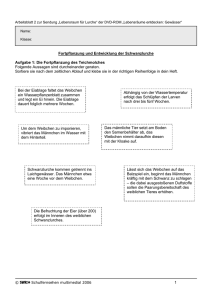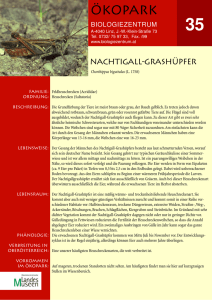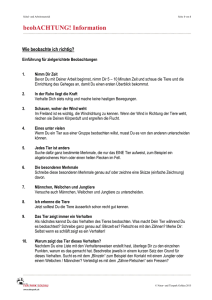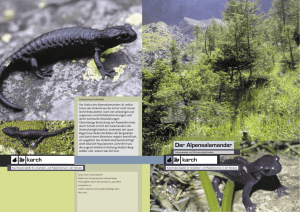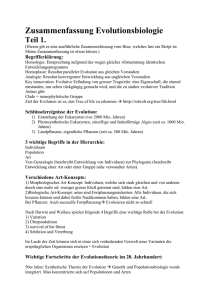Skript zur Vorlesung
Werbung

Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch ♦ Vorlesung 7 Molekulare Uhren. Die Molekulare-Uhr-Hypothese wurde von Zuckerkandl & Pauling (1962) auf der Basis des Befunds formuliert, dass sich Aminosäuresequenzunterschiede von SäugetierHämoglobinen als eine lineare Funktion der Divergenzzeiten der untersuchten Arten erwiesen. Eine Eichung erfolgte hier durch Fossilien. (Diese Daten waren die Grundlage für Kimuras Formulierung der neutralen Theorie, s.o.) Auch in seinem zusammenfassenden Buch „The Neutral Theory of Molecular Evolution“ von 1983 geht Kimura von Substitutionsraten aus, die konstant pro (absoluter) Zeit sind, was eigentlich ja nicht im Einklang mit den Annahmen der neutralen Theorie ist, die ja von konstanten Rate pro Generation ausgeht (s.o.), wobei die Generationen naturgemäß sehr unterschiedlich lang sein können (Maus versus Elefant). Ganz grundsätzlich verhalten sich DNASequenzen im Verlauf der Evolution uhrartig, also je mehr „evolutionäre Zeit“ vergangen ist, desto unterschiedlicher sind die Sequenzen. Anderseits liegen meistens aber keine Verhältnisse vor, bei denen man wirklich von einer, in allen Verwandtschaftslinien und zu allen Zeiten völlig gleichmäßig „tickenden“, molekularen Uhr („strict clock“) ausgehen kann. Eine von mehreren diskutierten Ursachen für eine solche „nachlässige“ Uhr („sloppy clock“) ist ein möglicher Einfluss von unterschiedlichen Generationsdauern. Die ITS-Bereiche (Spacer zwischen Kerngenen für ribosomale RNA) werden in der Pflanzensystematik sehr häufig für Stammbaumrekonstruktionen und auch molekulare Zeitabschätzungen verwendet. Offensichtlich (Kay et al. 2006) gibt es hier möglicherweise schon einen Einfluss der Lebensform bzw. Generationsdauer auf DNA-Substitutionsraten: “We find that herbaceous lineages have substitution rates almost twice as high as woody plants, on average.” ♦ „The evil scientist from America“. 1983 erschien Kimuras zusammenfassendes Werk “The Neutral Theory of Molecular Evolution” (in der Übersetzung von 1987 „Die Neutralitätstheorie der molekularen Evolution“). Der kalifornische Genetiker John H. Gillespie, gleichsam ein Gegenspieler von Kimura, für den die natürliche Selektion auch auf molekularer Ebene die entscheidende Kraft darstellt, verfasste 1984 im Fachblatt Science eine entsprechende Buchbesprechung, mit einem für Kimura beleidigenden Passus: “Throughout one gets the sense that Kimura is using the book as a vehicle to establish for himself a niche in the history of science.” Die „Fehde“ zwischen Kimura und dem von ihm angeblich mit „the evil scientist from America” titulierten Gillespie war eröffnet. Der (populärwissenschaftliche) Zeitungsartikel "Scientists in Open War over Neutral Theory of Genetics" informiert hier über Einzelheiten: http://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/evolution/ public/papers/blum1992/blum1992.html. Der inzwischen pensionierte Gillespie veröffentlichte folgende Bücher: „The Causes of Molecular Evolution“ (1994) und „Population Genetics: A Concise Guide“ (2004). Historisch gesehen war das Konzept Kimuras einer großen Bedeutung von selektionsneutralen Mutationen nicht neu: Morgan (1932) für morphologische Merkmale; Freese (1962), Sueoka (1962), Robertson (1967) und Crow (1968) für Proteine. Es war jedoch Kimura, der maßgeblich die entsprechende Theorie dazu ausarbeitete und popularisierte. ♦ Populationsstrukturen & Genstammbäume. Die Koaleszenztheorie (coalescent theory) ist ein retrospektiver Ansatz der Populationsgenetik dessen mathematische Theorie in den frühen 1980er Jahren entwickelt wurde. Ursprünglich stellte die Theorie eine Erweiterung klassischer Konzepte zur neutralen Evolution allein durch genetische Drift dar. Später wurden dann auch mathematische Modelle entwickelt, die z.B. Mutationen, Selektion oder Genfluss beinhalten. Im Prinzip handelt es sich um Allelgenealogien, die oft wie ein Stammbaum dargestellt sind („Futuyma“: Abb. 10.1.). Dieser genealogische Ansatz kann Hinweise auf die Größe, Struktur und Geschichte von Populationen geben. In kleinen Populationen ist die genetische Drift wirksamer als in großen: Nach 2N (haploid) Generationen kann man erwarten, dass ein Allel fixiert ist. Wenn auch noch Mutationen auftreten, kann man erwarten, dass in der größeren Population eine größere Haplotypendiversität vorhanden ist als in kleinen Populationen („Futuyma“: Abb. 10.17). Im Mittel beträgt die Koaleszenzzeit eines “Zufalls–Kopienpaars” N Generationen (s.o.). Der Sequenzunterschied zwischen zwei Haplotypen, die von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, ist dann S = 2 × Ne × u, wobei u die Anzahl von Mutationen pro Generation ist; Faktor „2“ wieder weil jeder Haplotyp „auf seinem Weg“ Mutationen angehäuft hat. Wenn man nun eine Haplotypendiversität gemessen hat, kann man die Formel nach Ne umformen. Avise et al. (1988) haben 34 mtDNA-Haplotypen in 127 Exemplaren des Rotschulterstärlings (Agelaius phoeniceus) − der in N-Amerika häufig und weit verbreitet ist − detektiert. Diese gemessene (mittlere) Haplotypendiversität „passt“ nach „S = 2 × Ne × u“ zu einer (effektiven) Populationsgröße von ca. 36.700 und nicht zur tatsächlichen heutigen Populationsgröße von ca. 20 Mio. (weiblichen) Vögeln. Dieser Befund wurde so gedeutet, dass Ne während der letzten Eiszeiten in Refugien, vor nur 10.000 Jahren entsprechend klein war. Birmingham & Avise (1986) 1 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch fanden 17 mtDNA-Haplotypen in 79 Exemplaren des “spotted sunfish” (Lepomis punctatus, SO-USA). Im resultierenden Gen-Stammbaum bildeten die Haplotypen zwei deutliche Gruppen, die mit der Geographie korrelieren (östliche versus westliche Gruppe). Interpretation der Autoren: Die beiden Regionen sind vermutlich von zwei voneinander isolierten Vorläuferpopulationen besiedelt worden. In der westlichen Gruppe fand man in einer Population drei verschiedene Haplotypen, die im Genstammbaum nicht nächst verwandt erscheinen: Ein Hinweis auf Genfluss zwischen den Populationen. ♦ Sexualität. Die Prozesse der Syngamie (Fusion von Gameten) und Meiose (Reduktionsteilung) bilden die Basis der Sexualität im wissenschaftlich-biologischen Sinn. Bei der (bi)sexuellen geschlechtlichen Fortpflanzung herrscht dabei oft Oogamie vor: Haploide Eizellen (unbewegliche, weibliche Keimzellen) werden von haploiden Spermazellen (begeißelte, männliche Keimzellen) befruchtet, wobei die diploide Zygote (= befruchtete Eizelle) entsteht, die unter Zellteilung zum (diploiden) Embryo wird. ♦ Asexuelle Fortpflanzung. Bei einigen Pflanzenarten kann es zur Agamospermie, einer Samenbildung ohne sexuelle Vorgänge kommen (Apomixis im engeren Sinne): Der Embryo entwickelt sich dann aus einer unbefruchteten, unreduzierten Eizelle (Parthenogenese) oder aus einer unreduzierten Embryosackzelle (Apogamie). In der Gattung Poa (Poaceae), den Rosaceengattungen Rubus bzw. Sorbus und in den Asteraceengattungen Hieraceum und Taraxacum kommt auffallend häufig Apomixis vor. Wegen der vorliegenden Apomixis in der Gattung Hieraceum gelang es Mendel hier nicht, seine an Erbsenpflanzen gefundenen Gesetzmäßigkeiten wieder zu finden. (Mendel, 1869: Ueber einige aus künstlicher Befruchtung gewonnenen Hieracium-Bastarde.) Auch bei Tieren ist eine Entwicklung ohne Spermium möglich (Parthenogenese, Jungfernzeugung): Meist entsteht der Embryo aus einer unreduzierten Eizelle (diploide Parthenogenese), z.B. bei Blattläusen oder Rotatorien. Aus reduzierten Eizellen (haploide Parthenogenese) können z.B. bei Bienen Männchen hervorgehen. Neben solcher eingeschlechtlichen Fortpflanzung gibt es auch rein vegetative, also ungeschlechtliche Fortpflanzungen, bei denen die Nachkommen aus somatischem Gewebe entstehen, z.B. bei der Ausläuferbildung der Erdbeere oder der Knospung von Hydra. (Apomixis im weiteren Sinne umfasst Agamospermie und vegetative Fortpflanzung.) ♦ Parthenogenese & Apomixis. Durch Parthenogenese und Apomixis können sich Organismen vergleichweise schnell in einem günstigen Lebensraum vermehren (z.B. Blattläuse). Der Nachteil einer aufwändigen sexuellen Fortpflanzung ist hier gleichsam umgangen, allerdings auf Kosten der Vorteile von Sexualität (s.u). Reine Parthenogenese kommt deswegen faktisch nicht vor: Daphnien („Wasserflöhe“, Crustacea, etwa 150 Arten, Süßwasser, weltweit) vermehren sich von Frühjahr bis Sommer fast rein parthenogenetisch. Im Winter oder bei anderen ungünstigen Umweltbedingungen, wie Trockenheit, werden dann auch Männchen geboren und dann können durch Befruchtung hervorgegangene Dauereier die Ungunstzeit überstehen. Beim apomiktischen Löwenzahn (Taraxacum) gibt es einen „sexual-asexual cycle“ zwischen sexuellen Diploiden und obligat apomiktischen Triploiden, bei denen wahrscheinlich teilapomiktische, tetraploide Formen eine Rolle spielen: In einer holländischen Taraxacum-Population fanden sich 31% diploide, 68% triploide und 1% tetraploide Individuen (Verduijn et al. 2004). ♦ Who Needs Sex (or Males) Anyway? Eine seltsame Ausnahme (!) im Organismenreich sind die Bdelloida, eine Ordnung der Rädertierchen mit etwa 400 Arten (Süßgewässer, feuchtes Moos, nasse Erde): In diesem Verwandtschaftskreis gibt es vielleicht seit 40 Mio. Jahren keinerlei Sexualität, sondern nur parthenogenetische Fortpflanzung. Sehr rätselhaft ist insbesondere, wie „trotzdem“ diese 400 Arten entstehen konnten. Die Rädertierchen haben offensichtlich „irgendwie“ fremde DNA aus Bakterien, Pilzen und Pflanzen in ihr Genom aufnehmen können und also durch so genannten horizontalen Gentransfer genetische Variation erzeugt. Den Artikel „Who Needs Sex (or Males) Anyway?” finden Sie hier: http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0050099. Den Artikel “Massive Horizontal Gene Transfer in Bdelloid Rotifers” hier: http://www.sciencemag.org/content/320/5880/1210. ♦ Sexualität & Evolution. Der Befund, dass Parthenogenese und Apomixis bei Arten (meist) nicht in Reinform auftritt (s.o.) und es keine gleichsam uralten großen Verwandtschaftskreise mit „reiner“ Parthenogenese bzw. Apomixis gibt, verdeutlicht, dass Sexualität in der Evolution der Lebewelt offenbar eine wichtige Rolle gespielt hat und spielt. Leben gibt es vielleicht seit 3,8 Mrd. Jahren, Eukaryoten vielleicht seit „etwa“ 2 Mrd. Jahren und Sexualität ist vielleicht etwa bis 1 bis 1,5 Mrd. Jahre alt. ♦ 2 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Kosten der Sexualiät. Un- bzw. eingeschlechtliche Fortpflanzung hat Vorteile bei stabilen Umwelten, da so mit „bewährten“ Genotypen schnell große Populationen etabliert werden können. Ein Vorteil von Sexualität ist, dass durch intra- und interchromosomale Rekombination schnell neue Genotypen entstehen, und so möglicherweise eine schnelle Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen erreicht werden kann. Das Populationswachstum ist allerdings vergleichsweise langsam. „Two-fold cost of sex“: Wenn es nur parthenogenetische Mütter gibt, verdoppelt sich die Population in jeder Generation, wenn jede Mutter zwei Töchter hat. In einer Population mit zwei Geschlechtern besteht die Hälfte aus „nutzlosen“ Männchen, die direkt keine Kinder bekommen. Das Tafelbild hierzu in der Vorlesung war ähnlich dieser Abbildung: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolsex-dia1a.png. Neben den Kosten zwei Geschlechter vorzuhalten, entstehen durch (zweigeschlechtliche) Sexualität generell weitere Kosten: Mehr oder weniger aufwändige Partnersuche, Überproduktion von Spermien, evtl. Geschlechtskrankheiten. ♦ Vorteile der Sexualität − Fisher-Muller-Modell & „Muller’s ratchet“. Obwohl sich ein asexueller Genotyp in einer sexuellen Population mit ihren hohen Kosten wegen seiner schnellen Vermehrung eigentlich durchsetzen müsste (s.o.), scheinen doch die Vorteile der Sexualität diese Kosten grundsätzlich „wert zu sein“, weil so eben eine schnellere Anpassung an veränderte Umweltbedingungen möglich ist: Nach der Fisher-Muller-Theorie (Fisher 1930, s.o.; Muller 1932) können positive Mutationen an verschiedenen Loci durch Crossing-over schneller auf einem Chromosom vereint werden als in asexuellen Populationen, wo dies nur durch seltene, nacheinander erfolgende Mutationen möglich wäre. Ein Nachteil der Asexualität ist gleichsam komplementär hierzu („Muller’s ratchet“): In asexuellen Populationen akkumulieren sich irreversibel schädliche Mutationen (Muller 1932), wie bei einer Ratsche, die sich durch die Sperrklinken nur in eine Richtung dreht. (Den Begriff „ratchet“ verwendete Muller allerdings erst 1964.) Hermann Joseph Muller (1890−1967): USamerikanischer Genetiker, 1946 Nobelpreis für die Entdeckung, dass Röntgenstrahlen Mutationen hervorrufen können. ♦ Aktuelleres zum Thema. Hier die Titel von zwei aktuelleren Veröffentlichungen, die kurz angesprochen wurden: Lass-Hennemann et al. (2010) Effects of stress on human mating preferences: stressed individuals prefer dissimilar mates. Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 277: 2175−83; Pennisi (2011) Evolutionary Time Travel. Science 334, 893−895. (Nur mal so.) ♦ Sexuelle Selektion & Darwin. Das Konzept der sexuellen Selektion geht auf Darwin (1859) zurück: „ … a few words on what I call Sexual Selection. This depends not on a struggle for existence, but on a struggle between the males for possession of the females; the result is not death to the unsuccessful competitor, but few or no offspring.“ Im Artenbuch geht er allerdings nur auf wenigen Seiten auf das Thema ein. Merkmale, die für ihn durch den Einfluss von sexueller Selektion entstanden sind: Hirschgeweih (als Waffe), Löwenmähne (als Schutz bei Kämpfen gegen andere Männchen) oder auch die Oberschwanzdeckfedern des Pfauenrads, die das Männchen für die Weibchen attraktiv machen (“weapons, means of defence, or charms”). Sehr viel ausführlicher führt er seine Theorie dann in seinem Buch von 1871 „The Descent of Man and Selection in Relation to Sex“ aus: “The sexual struggle is of two kinds; in the one it is between individuals of the same sex, generally the males, in order to drive away or kill their rivals, the females remaining passive; whilst in the other, the struggle is likewise between the individuals of the same sex, in order to excite or charm those of the opposite sex, generally the females, which no longer remain passive, but select the more agreeable partners.” Mit Hilfe der sexuellen Selektion konnte er Merkmale erklären, die nicht mit der natürlichen Selektion vereinbar sind, wie einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus und die Evolution von exzessiven Strukturen. ♦ Sexuelle Selektion (geschlechtliche Zuchtwahl). Sexuelle Selektion ergibt sich durch eine innerartliche Konkurrenz um Geschlechtspartner. Es kann sich dabei einmal um eine intrasexuelle Selektion handeln: Sehr häufig konkurrieren dabei Männchen untereinander um („limitierte“) Weibchen („Männerkampf“). Der Gewinner reproduziert sich erfolgreicher als die anderen und seine vererbbaren Merkmale − inklusive denen, die beim Konkurrenzkampf zur Überlegenheit führten − werden so selektiert. Zum anderen gibt es intersexuelle Selektionen: Häufig werden dabei Männchen von den („limitierten“) Weibchen ausgesucht („Damenwahl“). Der Auserwählte reproduziert sich so erfolgreicher als die anderen und seine vererbbaren Merkmale − inklusive derer die zu seiner Wahl führten − werden so selektiert. Darwin sah die Triebkraft der weiblichen Partnerwahl in einem besonderen „Sinn für Schönheit“ der Weibchen. Sexuelle Selektion hat ihre Ursache grundsätzlich im großen Spermien-zu-Eizellen-Verhältnis: Ein Männchen kann (theoretisch) viele Weibchen befruchten und büßt wenig Fitness ein, falls sich darunter ein „schlechtes“ Weibchen befindet. Alle (wenigen) 3 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Eizellen eines Weibchens können theoretisch von nur einem Männchen befruchtet werden, mit einem „Fitness-GAU“, falls der „Typ nichts taugt“. ♦ Intrasexuelle Selektion − Konkurrenz zwischen Männchen & Spermien. Häufiger konkurrieren Männchen um Weibchen. Die intrasexuelle Selektion beeinflusst dabei Merkmale, die bei der innerartlichen Konkurrenz um den Zugang zum Geschlechtspartner eine Rolle spielen, wie z.B. sensorische bzw. motorische Fähigkeiten (Partnersuche), Körpergröße und Lautäußerungen (Imponierverhalten), Waffen (z.B. Geweihe für Kommentkämpfe). So evolvierte Merkmale können eine Ursache für Geschlechtsdimorphismus sein: Unterschiedliches Aussehen von Männchen und Weibchen einer Art; bezieht sich auf sekundäre Geschlechtsmerkmale. Weiterhin gibt es Anpassungen, die bewirken, dass sich die Paarungschancen der Konkurrenten verschlechtern, z.B. durch Revierverteidigung gegen eindringende Männchen bei einigen Vogelarten oder Partnerinnenbewachung. Wenn Weibchen sich potentiell mit mehreren Männchen paaren können, kommt es prinzipiell zu Spermienkonkurrenz: Konkurrenz zwischen den Spermien von zwei oder mehr Männchen, um eine gegebene Anzahl von Eizellen. Beispiele für „defensive SpermienkonkurrenzMerkmale“: Partnerinnenbewachung durch Revierverteidigung gegen eindringende Männchen bei einigen Vogelarten, Sphragis-Bildung: Ein vom Männchen bei der Kopulation abgegebenes Sekret führt zu einer Verstopfung bzw. Verklebung des weiblichen Genitaltrakts (Beispiele bei: Primaten, Bienen, Ratten, Mäuse, Reptilien, Skorpione, Insekten, Spinnen). Beispiele für „offensive Spermienkonkurrenz-Merkmale“: Rivalen aus dem Feld schlagen durch größere Spermienmengen (evtl. auch in größeren Hoden) oder die aktive Beseitigung von fremden Sperma, z.B. durch löffelartige Penisse bei einigen Libellen. ♦ Intersexuelle Selektion – Sexuelle Selektion durch Partnerwahl. Weitere Sexualdimorphismen, wie das schon genannte Prachtgefieder des Pfaus (Pavo cristatus), können durch intersexuelle Selektion erklärt werden: Individuen eines Geschlechts konkurrieren darum, durch Individuen des anderen Geschlechts zur Paarung ausgewählt zu werden. Nach dem Konzept des Elternaufwands („parental investment“) wählt dasjenige Geschlecht aus, welches die höheren Ausgaben – zu Kosten eigener Fitness – in den Nachwuchs investiert. Zumeist sind es die Weibchen, die einen höheren Aufwand betreiben, die eben dann unter den gegeneinander konkurrierenden „auffälligen“ Männchen ihren Partner auswählen. Beim Thorshühnchen (Phalaropus fulicarius, arktischer Schnepfenvogel) ist allerdings das Weibchen auffälliger „gekleidet“ und verteidigt aggressiv ihr Männchen, das sich um die Brut kümmert („Futuyma“: Abb. 15.28). Das Prachtgefieder des Pfaus als darwinistisches Paradebeispiel für ein Merkmal, dass für die „Damenwahl“ entscheidend ist, wurde kürzlich herausgefordert (Takahashi et al. 2008, Peahens do not prefer peacocks with more elaborate trains): Aus den Ergebnissen einer sieben Jahre andauernde Studie folgerten die Autoren, dass die Pfauenhennen nicht nach der Prächtigkeit (Augenanzahl, Symmetrie, Federnlänge) auswählen, sondern wohl nach anderen Merkmalen. ♦ Partnerwahl − Direkte Vorteile für Weibchen. Weibchen wählen nach der Ausprägung sekundärer sexueller Merkmale. Zum einen kann damit ein indirekter Fitnessgewinn verbunden sein (s.u. SexySon- bzw. Gute-Gene-Theorie) zum anderen können präferierte Merkmalsausprägungen aber auch einen direkten „materiellen“ Gewinn für das Weibchen und dessen Nachkommen bedeuten (z.B. Hochzeitsgeschenke, ressourcenreiches Revier, elterliche Fürsorge, Revierverteidigung). Hill (1991): Hellere Hausgimpel-Männchen (Hinweis auf gute Versorgung mit Carotinoiden) werden bevorzugt und bringen der Brut mehr Futter als andere Männchen. Traditionell wurde die Bedeutung solcher direkter Vorteile im Rahmen der sexuellen Selektion als größer eingeschätzt als die Bedeutung von indirekten Fitnessgewinnen (s.u.). Møller & Jennions (2001) fanden (aber) in einer breit angelegten Metanalyse “How important are direct fitness benefits of sexual selection?”, dass zum Teil aber solche direkten Gewinne wohl nur wenig bedeutender sind, als indirekte Fitnessgewinne (s.u.) durch Weibchenwahl. ♦ Runaway-Selektion − Sexy-Son-Hypothese. Das Konzept der Runaway-Selektion geht auf Ronald Aylmer Fisher (s.o.) zurück und erklärt, wie es durch intersexuelle Selektion zu exzessiven Strukturen wie z.B. den langen Oberschwanzdeckfedern des Pfaus kommen kann, obwohl diese unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Selektion eigentlich „viel zu groß“ sind: Zunächst evolviert ein Merkmal durch natürliche Selektion; die Federlänge nimmt zu. Das Merkmal spielt dann zusätzlich auch eine Rolle bei der sexuellen Selektion und die Federlänge nimmt bis zu einer Größe zu, die unter dem Aspekt der natürlichen Selektion optimal lang ist. Die Federlänge nimmt nun trotzdem durch fortwährende sexuelle Selektion weiterhin zu („runaway process“) und zwar so lange, wie die Söhne der wählerischen Weibchen fitter sind, als die Söhne der anderen Weibchen (Sexy-Son-Hypothese, s.u.). Fischer (1930): „ ... the modification of the plumage character in the cock proceeds under two selective influences (i) an initial advantage not due to sexual preference, which advantage may be 4 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch quite inconsiderable in magnitude, and (ii) an additional advantage conferred by female preference. The intensity of preference will itself be increased by selection so long as the sons of hens exercising the preference most decidedly have any advantage over the sons of other hens, whether this be due to the first or to the second cause. The importance of this situation lies in the fact that the further development of the plumage character will still proceed, by reason of the advantage gained in sexual selection, even after it has passed the point in development at which its advantage in Natural Selection has ceased.“ (Hierzu hat Fischer übrigens mal kein mathematisches Modell entwickelt.) ♦ Sexy-Son-Hypothese „im engeren Sinne“. Der Begriff “Sexy-Son-Hypothese” wird mit dem Modell von Fischer (s.o.) gleichgesetzt. Der Begriff selbst geht aber auf Weatherhead & Robertson (1979) zurück: Offspring Quality and the Polygyny Threshold: “The Sexy Son Hypothesis”. Hier geht es darum, zu erklären, warum Weibchen bei polygynen Arten (Polygynie = „Vielweiberei“) die attraktivsten Männchen wählen, obwohl die sich bei der „Erziehung“ des eigenen Nachwuchses weniger einbringen werden/können, was ja eigentlich zunächst einen Nachteil für das Weibchen darstellt. Für Weatherhead & Robertson wird dieser Fitnessverlust aber durch die zukünftigen attraktiven Söhne mit ihrer im Vergleich zu unattraktiven Söhnen höheren Fitness wieder wettgemacht: „ … it was postulated that females mating with attractive males suffering reduced reproductive success could ulitimately gain an advantage through the success of their „sexy sons“. Diese Arbeit lieferte Hinweise auf „sexy Söhne“ beim fakultativ polygynen Star: Gwinner & Schwabl 2005, Evidence for sexy sons in European starlings (Sturnus vulgaris). ♦ Gute-Gene-Hypothese. Im Fischer-Modell (s.o.) führt die Wahl durch das Weibchen zu einer erhöhten Attraktivität bzw. Fitness des männlichen Nachwuchses und damit zu einem indirekten Fitnessgewinn der Weibchen über ihren männlichen Nachwuchs. Nach der Gute-Gene-Hypothese führt die Wahl bestimmter Männchen zu einer höheren Viabilität des gesamten Nachwuchses. Die Idee ist hier, dass Weibchen selektieren, um genetische Vorteile für alle Nachkommen zu erlangen. Bei den präferierten Merkmalen geht es nicht um die Attraktion an sich, sondern sie sind gleichsam „nur“ ein Indikator für „gute Gene“ ganz allgemein. Es gibt verschiedene Spielarten dieser Theorie. ♦ Handicap-Hypothese. Die Handicap-Hypothese ist der früheste („etwas um die Ecke gedachte“) Gute-Gene-Ansatz und geht auf den israelischen Zoologen Amotz Zahavi (*1928) zurück: Exzessive Merkmale, wie z.B. (wieder mal) die Pfauenschleppe sind "Handicap-Merkmale", die anzeigen, dass das Männchen, welches trotz dieser Beeinträchtigung überlebensfähig ist, wohl schon insgesamt „verdammt“ gute Anlagen besitzen muss. Zahavi (1975): “The excessive tail plumes of the peacock which seem to attract the females are obviously deletorious to the survival of the individual. The more brilliant the plumes the more conspicuous the male to predators, and the longer the plumes the more difficult it may be for the male to escape predators or to move about during everyday activity. Hence, only the best males would be able to sustain the handicap.“ Ein Aspekt der Handicap-Hypothese ist auch, dass diese Merkmale gleichsam „ehrlich“ sind; eine Pfauenschleppe kann man nicht fälschen. (Anekdote hierzu aus dem „Egoistischem Gen“ von R. Dawkins: „Ich halte nicht viel von der Theorie, obwohl ich meiner Skepsis nicht mehr ganz so sicher bin, wie ich es war, als ich sie zum ersten Mal hörte. Ich wies damals darauf hin, daß die logische Konsequenz davon die Entwicklung von Männern mit nur einem Bein und einem Auge sein müßte. Zahavi, der aus Israel kommt, gab auch prompt zurück: „Einige unserer besten Generäle haben nur ein Auge!““ ♦ Handicap-Hypothese − Verhaltensbiologie. Der Handicap-Ansatz kann möglicherweise auch „seltsame“ Verhaltensweisen erklären: Kostenintensives Hilfeverhalten steigert das soziale Ansehen des Helfenden und bringt evtl. auch Vorteile bei der Partnersuche. Das „provokante“ Prellspringen („stotting“) von Antilopen als Signal an den Löwen, dass man im Gegensatz zu den anderen keine einfache Beute ist. Hypothesen des US-amerikanischen Evolutionspsychologen Geoffrey Miller (*1965) sind sogar, dass die intersexuelle Selektion beim Menschen möglicherweise zur Entstehung der Handicaps „Sprache“, „Moral“, „Kunst“, „Witz“ und „Kreativität“ beitrugen. Miller (2001): Die sexuelle Evolution. Partnerwahl und die Entstehung des Geistes. ♦ Gute Gene gegen Parasiten. Hamilton und Zuk (1982) fanden Hinweise bei nordamerikanischen Vogelarten, dass diese Paarungspartner mit genetisch bedingten Resistenzen gegen Parasiten durch Prüfung von Merkmalen (z.B. strahlendes Federkleid) auswählen. Barber et al. (2001): Weibchen des Dreistachligen Stichlings (Gasterosteus aculeatus, N-Halbkugel) wählen Männchen nach der Intensität der Rotfärbung ihrer Bäuche aus. Der Anteil von infizierten „Stichlingskindern“, die zuvor Bandwurmlarven „ausgesetzt“ waren, korrelierte mit der Bauchfärbung des Vaters: Die Nachfahren der stärker gefärbten Stichlinge zeigten eine höhere Infektionsresistenz („Futuyma“: Abb. 15.27). ♦ 5 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Fluktuierende Asymmetrie. Fluktuierende Asymmetrie körperlicher Merkmale − im Gegensatz zu einer funktionellen Asymmetrie, wie z.B. dem Herz „auf dem rechten Fleck“ − gelten als phänotypischer Marker für die genotypische „Beschaffenheit“ von Individuen. Fluktuierende Asymmetrien gelten gleichsam als Anzeichen von genetischer Schwäche, da das „normale symmetrische“ Entwicklungsprogramm nicht richtig ausgeführt werden konnte. Eine umfassende Verallgemeinerung dieses Gute-Gene-Ansatzes ist sicher nicht möglich: Experimente mit künstlich erzeugten Bildern von völlig symmetrischen Menschengesichtern zeigen, dass solche Gesichter nicht als attraktiver empfunden werden, als die unbearbeiteten, natürlicherweise etwas unsymmetrischen Gesichter; Hirschkühe bevorzugen − entgegen früherer Annahmen − Hirsche mit größerem Geweih und „legen dabei wohl keinen größeren Wert“ auf die Symmetrie. ♦ Gute-Gene „versus“ Sexy-Sons. Die „sexy sons“ und die „good genes“ sind als Grenzfälle eines Kontinuums eines indirekten genetischen Nutzens durch Partnerwahl zu verstehen. Eine aktuelle Metaanalyse von 90 Studien (55 Arten) ergab eher Hinweise auf die Vererbbarkeit der männlichen Attraktivität, die allerdings nicht zu verbesserten Life-history-traits der Nachkommen führten; Merkmale, die direkt zur Fitness eines Individuums beitragen: Prokop et al. 2012, Meta-analysis suggests choosy females get sexy sons more than "good genes". Evolution 66: 2665−73. Ob das wirklich verallgemeinerbar ist, wird sich zeigen. In solchen Artikeln steht daher eigentlich immer so etwas wie – in diesem Fall – das hier: „We pinpoint research directions that should stimulate progress in our understanding of the evolution of female choice”. ♦ Filmchen. Wie wählerisch Weibchen sein können und was Männchen „alles so machen“, um zu gefallen zeigen diese Filme über die Laubenvögel („bowerbirds“), die in Neuguinea und N-Australien vorkommen: http://www.youtube.com/watch?v=v_BurGW2rPU&feature=related („traurig“); http://www.youtube.com/watch?v=tJ32_ijdmLo („Happy End“). (Interessant sind übrigens auch Aufnahmen von so genannten femrobot-Experimenten, die man ebenfalls auf Youtube finden kann.) ♦ Aufgaben ♦ Was ist in dem Zeitungsartikel "Scientists in Open War over Neutral Theory of Genetics“ (s.o.) jounalististisch-vereinfacht dargestellt? ♦ Was sind sogenannte „Killerspermien“? ♦ In vielen monogamen Papageienarten sind beide Geschlechter auffällig gefärbt. Eine Folge von sexueller Selektion? ♦ 6