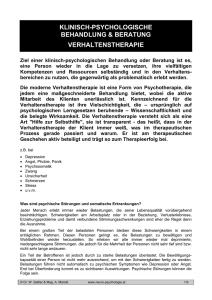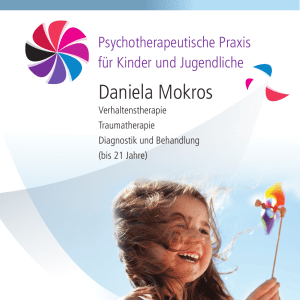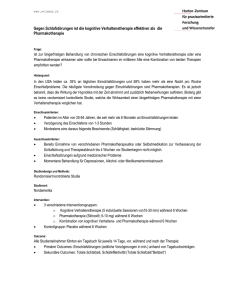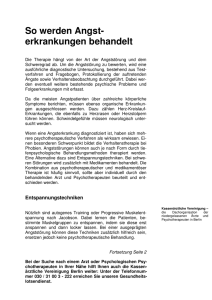Kognitive Verhaltenstherapie
Werbung

Einführung in Psychotherapeutische Schulen I Kognitive Verhaltenstherapie Vorlesung WS 2007 Institut für Psychologie KFU Graz Materialien zur Vorlesung Dr. Alois Kogler A Historischer Überblick Im Zeitraum 1950 - 1960 entstanden in Amerika (Lindsley, Skinner, Mowrer, Dollard und Miller), Südafrika (Wolpe, Lazarus, Rachman) und England (Shapiro, Yates, H.G. Jones, Eysenck) Zentren, die sich mit verhaltenstherapeutischen Themen auseinander setzten. Interessant dabei ist, dass an verschiedenen Orten ungefähr zur gleichen Zeit wichtige Grundlagen und Methoden der Verhaltenstherapie unabhängig voneinander entwickelt wurden. Eine eindeutige Gründerfigur lässt sich daher nicht nennen. 1953 wurde der Begriff „behavior therapy“ von O.R. Lindsley (operant conditioning methods in chronic schizophrenia), B. Skinner & R.L. Solomon (traumatic avoidance learning) erstmals verwendet. Im deutschsprachigen Raum setzte sich die Verhaltenstherapie auf akademischem Boden erst ab Ende der 60er Jahre durch. Weiterentwicklung der VT in den 60er und 70er Jahren 1. Einbeziehung des inneren Verhaltens Die Reiz-Reaktions-Modelle der Verhaltenserklärung werden von Mahoney (1974) als nichtvermittelnd bezeichnet, da nach dieser Vorstellung der Organismus lediglich als „black box“ aufgefasst wird, über den keine objektiven Informationen möglich, aber auch nicht nötig sind. Andere Lerntheoretiker nahmen aber schon „innere Zustände“ mit in ihre Forschungsprogramme auf. Getreu ihrer behavioristischen Herkunft stellten sie die Hypothese auf, dass die von ihnen untersuchten inneren Vorgänge den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen wie direkt beobachtbares Verhalten. Durch die Entwicklung der psychologischen Forschung wurden Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Vermittlungsmodelle in der Theorie und der Praxis immer wichtiger, weil sich die ausschließliche Anwendung nichtvermittelnder Verfahren als praktisch unzulänglich erwiesen hatte. Mahoney (1974) und andere Psychologen sprechen von vermittelnden Verhaltensmodellen oder von „Mediatorentheorien“. Diese besagen, dass ein Umweltreiz automatisch eine vermittelnde innere Reaktion auslöst, die denselben Verstärkerprinzipien unterworfen ist wie sichtbare Reaktionen. „Inner events“ / „innere Ereignisse“ (oder Mediatoren) werden als verdeckte Reaktionen auf äußere Reize betrachtet, die ihrerseits als verdeckte Stimuli offene Reaktionen auslösen. Bei den untersuchten vermittelnden inneren Ereignissen handelt es sich in erster Linie um Kognitionen (Gedanken, Vorstellungen usw.), da von der Annahme ausgegangen wird, dass kognitive Prozesse anderen Vermittlungsprozessen (z.B. emotionalen oder motivationalen Prozessen) vorgeordnet sind. Die Verhaltenstherapie als angewandte Experimentalpsychologie berücksichtigt heute innere ebenso wie äußere Ereignisse. Behavioristen unterscheiden sich von Psychologen anderer Richtung darin, dass sie an Schlussfolgerungen über innere Ereignisse sehr strenge Maßstäbe legen, sich ihrer so sparsam wie möglich und nur dann bedienen, wenn sie zu guten Erklärungen und überprüfbaren Hypothesen führen. Der Übergang zur kognitiven Verhaltenstherapie Verhalten ist, wie gesagt, ein umfassender Begriff. Er schließt sowohl offenes als auch nicht sichtbares (verdecktes) Tun und Lassen ein. Zu Aversionstherapien Aversive Therapieformen zählen zu den umstrittenen Methoden der Behandlung. In Zusammenhang mit Verfahren der verdeckten Sensibilisierung und der Token Economy nach Azrin und Ayllon (1968) wurden verdeckte Varianten der Aversionstherapie entwickelt. Bestrafungstherapie – aversive Kontrolle oder Gegenkonditionierung – wurde bei der Behandlung von Homosexualität angewendet. Aversionstherapeutische Behandlungen sind mit hohen emotionalen Kosten für die Patienten verbunden. Noch 1973 galt unter Verhaltenstherapeuten die Aversionstherapie bei Homosexualität als Methode der Wahl (Davison & Wilson 1973). Mitte der 70er Jahre begann – aufgrund der für die Sicherstellung ihrer Rechte kämpfenden Homosexuellenvereinigungen - ein Umdenken in der Verhaltenstherapie. Die naive Überzeugung, dass der Klient die Ziele der Behandlung selbst bestimmt, ließ sich nicht mehr aufrecht erhalten. Auch der Therapeut bringt im Prozess der Zielfindung seine Wertvorstellungen ein. ⇒ Psychotherapie allgemein und Verhaltenstherapie im besonderen sind machtvolle Instrumente der Beeinflussung von Menschen. In der Ausbildung müssen die ethischen und rechtlichen Grenzen der Anwendung besonders deutlich gemacht werden. Grawe et al. (1994, S. 393-394) bewerten in ihrer Therapie-Effizienz-Studie die Aversionstherapien wie folgt: „Insgesamt kann als gesichert angesehen werden, dass man mit gezieltem Einsatz aversiver Reize einen hemmenden Einfluss auch auf verschiedene klinisch relevante Verhaltensweisen und Reaktionen ausüben kann. Dies hätte wohl auch kaum jemand bezweifelt, erweisen sich solche Mittel doch auch im sonstigen Leben als geeignet zur Unterdrückung unerwünschten Verhaltens. Es stellt sich nur die Frage, ob man diese Mittel wirklich zu klinischen Zwecken einsetzen sollte. Wir wollen nicht von vornherein ausschließen, dass auch einmal der Einsatz aversiver Methoden gerechtfertigt erscheinen kann, wenn gar kein anderes Mittel vorhanden zu sein scheint, um einem Patienten aus einer ausweglos erscheinenden Lage zu helfen. Dies ist jedoch bei den Anwendungen, über die wir hier berichtet haben, durchaus nicht der Fall. Für Phobiker gibt es sehr gut bewährte Techniken der Angstbehandlung wie die Systematische Desensibilisierung, kognitive Therapietechniken und insbesondere die Techniken der Reizkonfrontation (s. die Ergebnisberichte zu diesen Verfahren). Auch bei Zwängen steht mit der "response prevention" (s. den Bericht zur Reizkonfrontation) ein außerordentlich gut bewährtes Behandlungsverfahren zur Verfügung. Für die Therapie von Alkoholikern sind umfassende Behandlungsprogramme entwickelt worden, bei denen das gesamte psychische und soziale Umfeld des Alkoholtrinkens in die Therapie einbezogen wird. Für diese umfassenderen Behandlungsprogramme sind weitaus bessere Wirkungen festgestellt worden als für die Behandlung mit Aversionstechniken (s. dazu den Ergebnisbericht "verhaltenstherapeutische Alkoholikerprogramme"), vor allem auch in Veränderungsbereichen außerhalb des eigentlichen Trinkens. Dass Stottern nicht mit einer aversiven Konditionierung verbessert werden kann, ist nach den vorherrschenden Erklärungsmodellen dieser Sprechstörung von vornherein zu erwarten gewesen. Glücklicherweise stehen für die Behandlung des Stotterns andere, bewährte Behandlungsansätze bereit (van Riper & Irwing, 1970; Fiedler & Standop, 1978), bei denen die soziale Dimension des gestörten Sprechens im Vordergrund steht. Das Ausklammern der sozialen Dimension des jeweils behandelten Problems in den Studien zur Aversionstherapie ist besonders krass bei den Studien zur Behandlung der männlichen Homosexualität. Wenn man es nicht schwarz auf weiß nachlesen könnte, würde man kaum glauben, dass wirklich jemand auf die Idee kommen könnte, sexuell gleichgeschlechtlich orientierte Menschen auf diese Weise von ihrer Andersartigkeit zu "heilen". Unserer Ansicht nach liegen die meisten referierten Anwendungsformen aversiver Behandlungstechniken jenseits der Grenze des ethisch Vertretbaren, und zwar aus drei Gründen, die jeder allein schon ausreichen würden, um auf die Anwendung dieser Techniken zu verzichten: 1. Es werden z.T. außerordentlich fragwürdige Therapieziele angestrebt ohne eine gründliche Auseinandersetzung mit den dadurch aufgeworfenen Wertfragen. 2. Das psychische und soziale Umfeld der jeweiligen Störung wird ausgeklammert und der diesbezügliche wissenschaftliche Erkenntnisstand bleibt unberücksichtigt. 3. Es wird ignoriert, dass es zu all diesen Störungen bereits Behandlungen gibt, die im Symptombereich eine mindestens ebenso gute, oft sogar bessere Wirkung erzielen, die zusätzlich aber auch in anderen Bereichen positive Veränderungen bewirken, in denen sie von den Autoren der Studien zu Aversionstherapien offenbar nicht einmal angestrebt wurden. Wir haben den analysierten Studien keine einleuchtenden Begründungen dafür entnehmen können, wieso diese anderen Behandlungsmöglichkeiten bei den betreffenden Patienten nicht wahrgenommen wurden. Für die klinische Versorgung dieser Patienten wäre dies in den meisten Fällen zweifellos besser gewesen. Es ist aber auch kein legitimes Forschungsinteresse erkennbar, das die Durchführung solcher Studien wie der hier berichteten notwendig oder wünschenswert erscheinen ließe. Man kann sich beim Studium dieser Untersuchungen des Eindrucks nicht erwehren, dass hier das Recht von Patienten auf die bestmögliche Behandlung nicht ernstgenommen und auch sonstige Wertfragen in unverantwortlichem Maße außer acht gelassen wurden. Die Studien zur Aversionstherapie stellen damit ein höchst unerfreuliches Kapitel der Psychotherapieforschung dar.“ 2. Modell-Lernen und Soziales Lernen Eine weitere Innovation in der Verhaltenstherapie kam mit der Einbeziehung der Theorien des Modelllernens in den 60er Jahren: das Soziale Lernen diente als neues Erklärungsmodell für menschliche Lernprozesse. Die sozialen Lerntheorien leiteten sich nicht aus tierexperimentellen Studien ab, sondern gingen von spezifisch menschlichen Fähigkeiten und Lebensumständen in der sozialen Umwelt aus. Im Vordergrund stand dabei das sogenannte Lernen am Modell, bei dessen Erforschung Albert Bandura Pionierarbeit leistete. Beim Modellernen handelt es sich ebenso wie beim Konzept des verdeckten Konditionierens um einen vermittlungsorientierten Ansatz, der die Prozesse zwischen Reiz und Reaktion beschreibt. Bandura (1965; 1968) zeigte auf, dass die bloße Beobachtung des Verhaltens eines Vorbildes (Modells) ausreicht, um neue Reaktionen in das Verhaltensrepertoire aufzunehmen, ohne dass der Beobachtende Selbstbekräftigung erfährt. Entscheidend ist, dass die vom Modell ausgehenden Stimuli vom Beobachter intern kodiert und gespeichert werden. Die beobachtende Person kann sich aufgrund der Beobachtung neues Verhalten aneignen, bzw. kann die Ausführung vorhandener Reaktionen erleichtert oder gehemmt werden. Bei den späteren Ausführungen des Verhaltens dienen diese gespeicherten Informationen dann als Mediatoren. Ferner können durch die Beobachtung eines Modells beim Beobachter schon vorhandene Verhaltensweisen gestärkt oder geschwächt werden, je nachdem, ob die beobachteten Konsequenzen positiven oder negativen Charakter haben (Bandura, 1976). Der Begriff der „Beobachtung des Verhaltens“ muss beim Modelllernen sehr weit gefasst werden: Damit ist nicht nur die Wahrnehmung eines Verhaltens einer vorhanden Person gemeint. Beobachtung schließt vielmehr auch Beschreibungen, symbolische Darstellungen (graphisch, filmisch) und ähnliches ein. Damit diese Wahrnehmung fremden Verhaltens in eigene Reaktionen transformiert werden kann, müssen beim Beobachter verschiedene Prozesse vorausgesetzt werden, die als grundlegend für das Zustandekommen von Modelllernen angesehen werden. Es sind dies Aufmerksamkeitsprozesse, Behaltensprozesse, symbolische Kodierungsprozesse, motorische Reproduktionsprozesse, motivationale Prozesse. Das Modelllernen ist in verschiedenen therapeutischen Prozessen wichtig. Aber es ist theoretisch schwer einzuordnen. Dies zeigt sich in den unterschiedlichen Ansätzen, die zu seiner Erklärung Verstärkungstheorien, herangezogen werden: Zwei-Faktoren-Theorien, Instinkttheorien, Kognitiv-Soziale Assoziationstheorien, Lerntheorien. Die Grundlagen müssen noch geklärt werden. Methoden der kognitiven Umstrukturierung Die Forschung zur behavior modification ist immer differenzierter geworden und über die Reiz-Reaktions-Modelle hinausgegangen. Kognitionen wurden nicht mehr als vermittelnde Ereignisse betrachtet, sondern als strukturierende und steuernde Komponenten für emotionale, motivationale, physiologische und motorische Vorgänge verstanden. Der Paradigmenwechsel in der Verhaltenstherapie erfolgte aufgrund der stärkeren Beachtung der „inneren Ereignisse“ - Gedanken, Wahrnehmungen, Urteile und Selbstaussagen - , um offenes und verdecktes gestörtes Verhalten zu verstehen und zu modifizieren (Mahoney, 1974). Bekannt sind die Ansätze von Albert Ellis (1962; 1970; 1973) und Aaron T. Beck (1967; 1970; 1976), die die Bedeutung kognitiver Prozesse bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung psychischer Störungen deutlich machten. Beide Psychologen sehen ihre Ansätze als Alternative zur Psychoanalyse, der beide ursprünglich verpflichtet waren. Der Begriff Kognition umfasst die Prozesse des Wahrnehmens, Erkennens, Begreifens, Urteilens und Schließens. Die kognitive Psychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen (aber auch Tiere) ihre Erfahrungen strukturieren, wie sie ihnen einen Sinn unterlegen, indem sie Umweltreize in verwertbare Informationen transformieren. Menschen können nicht auf alle Reize reagieren, die in jedem Augenblick auf sie einstürmen. Aber wie filtern Individuen diesen überwältigenden „Input“? Wie setzen sie ihn in Worte oder Bilder um, wie formen sie Hypothesen, kurz, wie gelangen sie zur Wahrnehmung dessen, was um sie herum vorgeht? Kognitive Psychologen glauben, dass sich beim Lernen Komplexeres abspielt als die passive Bildung von neuen Reiz-Reaktions-Verknüpfungen. In der Sicht der kognitiven Psychologie interpretiert der Lernende eine Situation bewusst und aktiv im Lichte dessen, was er in der Vergangenheit erworben/gelernt hat. Neue Information wird in ein organisiertes Netzwerk vorhandenen Wissens, oft auch als Schemata bezeichnet, eingepasst. Widerspricht die neue Information dem Schema, so wird dieses im erforderlichen Ausmaß neu organisiert. In der Experimentalpsychologie gewinnt die Erforschung kognitiver Prozesse immer mehr an Gewicht. Dennoch fehlt es manchen kognitiven Verfahren noch an ausreichender theoretischer Fundierung. Experiment „Der Mann stand vor dem Spiegel und kämmte sich. Er überprüfte sorgfältig, ob die Rasur wirklich einwandfrei geraten war, und band sich dann die konservative Krawatte um, für die er sich entschieden hatte. Beim Frühstück studierte er die Zeitung sorgfältig und erörterte bei einer Tasse Kaffee mit seiner Frau die Möglichkeit, eine neue Waschmaschine anzuschaffen. Dann führte er einige Telefongespräche. Als er das Haus verließ, ging ihm durch den Kopf, dass seine Kinder im Sommer wohl wieder in das private Ferienlager würden fahren wollen. Als das Auto nicht ansprang, stieg er aus, warf die Tür zu und machte sich sehr ärgerlich in Richtung Bushaltestelle auf den Weg. Nun würde er zu spät kommen“ (Bransford und Johnson, 1973, S. 415). Lesen Sie die Geschichte noch einmal, fügen aber vor „Mann“ das Wort „arbeitslos“ ein. Dann lesen Sie sie ein drittes Mal und ersetzen „Mann“ durch „Börsenmakler“. Achten Sie darauf, auf welch unterschiedliche Weise Sie den Text aufnehmen. Fragen Sie sich, welchen Zeitungsteil diese Männer lesen. Wäre diese Frage Teil eines Fragebogens gewesen, hätten Sie den arbeitslosen Mann vielleicht die Stellenanzeigen, den Börsenmakler den Wirtschaftsteil lesen sehen. Tatsächlich wird in der Geschichte mit keinem Wort erwähnt, was der Mann liest. Ihre Antworten hätten zwar nicht den Tatsachen entsprochen, wären aber in jedem Fall sinnvoll und vorhersagbar gewesen.“ (Zit. In D. Neal, 1988, S. 57) ⇒ Die Wichtigkeit der Adjektiva! Bewertungen.... Therapeuten müssen darauf achten! Wir handeln also, so die kognitive Hypothese, aufgrund von internen Schlüsselreizen. Wenn jemand berührt wird, wird die Reaktion davon abhängen, welche Gedanken dabei auftreten. Wenn die Person annimmt, dass der andere zuschlagen wird, wird sie möglicherweise aggressiv reagieren, es kann aber auch sein, dass sie ausweicht oder versucht, das Gegenüber in ein Gespräch zu verwickeln. Die Reaktion hängt ab von Denkmustern und Bewertungen der Situation. Umgekehrt wird die Person freundlich reagieren, wenn sie erwartet, dass das Gegenüber nett ist, oder unfreundlich, wenn sie glaubt, dass dies ein Annäherungsversuch ist. 3. Selbstverbalisationsverfahren Meichenbaum und Mitarbeiter verbanden ebenfalls kognitive und behavioristische Ansätze und entwickelten zwischen 1971 und 1975 mehrere Methoden, die als Selbstverbalisationsverfahren (Selbstinstruktionstraining, Stress-Impfungstraining) bekannt wurden. Selbstinstruktionstraining Indikation: zur Ausformung von Verhalten und zur Bewältigung der Verhaltensschritte. Wurde ursprünglich bei impulsiven Kindern verwendet. Bei Erwachsenen gegen problematische innere Monologe. Vorgehen: Modelldarbietung mit begleitendem lautem Sprechen Nachahmung des Modells, wobei das Modell laut spricht Nachahmung des Modells, wobei der Klient laut spricht Nachahmung, wobei der Klient flüsternd spricht Nachahmung mit verdeckter Sprache Stressimpfungstraining Indikation: Damit kann jeder lernen, Stresssituationen angemessener zu bewältigen. Dabei geht es um das Training von Strategien, wie man Problemsituationen schneller erkennen kann und durch alternative, kognitive und motorische Maßnahmen sie bewältigen kann. Es läuft in 3 Phasen ab: - soll Einsicht in das Verhalten ermöglichen und Bewältigungsmöglichkeiten aufzeigen. Dazu genaue Verhaltensanalyse nötig, was Klient in kritischen Situationen zu sich selbst sagt, welche Gedanken und Bilder ihm durch den Kopf gehen. Klient beschreibt die körperlichen Symptome und Therapeut erklärt das Stressmodell. - auf kognitiver und motorischer Ebene mit eigenen Problemen auseinandersetzen. Verschiedene Methoden einüben, die sich sowohl auf das Handeln als auch auf die gedankliche Auseinandersetzung beziehen. - 5 Schritte sind zu tun: a) Unterrichtsphase: Erklärung der Methode, Auslösebedingungen suchen, Konsequenzbedingungen suchen b) Vorbereitung auf ein stressauslösendes Ereignis: Was hast du zu tun? Denk einfach darüber nach, was du machen kannst. Mach dir keine Sorgen. Kummer nützt nichts. c) Konfrontation und Umgehen mit dem stressauslösenden Ereignis Du kannst deine Furcht mit dem Verstand überwinden Entspanne dich. du hast dich unter Kontrolle. Atme einmal tief durch d) Auseinandersetzung mit dem Gefühl, überwältigt zu werden Mach eine Pause, wenn sich die Furcht einstellt Konzentrier dich auf das Jetzt. Was hast du zu tun? e) Selbstverstärkung Es hat geklappt Es war gar nicht so schlimm, wie du geglaubt hast Du hast es geschafft - gelernte Bewältigungstechniken in die Praxis umsetzen. 4. Selbstmanagementverfahren Eine der interessantesten Entwicklungen in der Verhaltenstherapie stellt die Selbstkontrolle (Kanfer, 1979; Mahoney, 1972) dar. An diesem Konzept ist die Weiterentwicklung der VT exemplarisch zu sehen. Skinner’s Auffassung von Selbstkontrolle: Ein Individuum übt Selbstkontrolle aus, wenn es sich seine Umgebung so einrichtet, dass nur ganz bestimmte kontrollierende Reize vorhanden sind. Jemand, der abnehmen möchte, entfernt aus seiner Wohnung alle Nahrungsmittel, die dick machen, und meidet Restaurants, wenn er hungrig ist. Verhalten bleibt eine Funktion der Umwelt, aber die Umwelt wird vom Individuum kontrolliert. Eine ähnliche verhaltenspsychologische Sicht der Selbstkontrolle spiegelt sich in Banduras (1969) Erklärung des aversiven Konditionierens. Der Klient widersteht einer Versuchung, indem er sich bewusst die negativen Erfahrungen in Erinnerung ruft. Das Individuum schafft sich symbolische Reize, die ihrerseits das Verhalten kontrollieren. Eine andere Möglichkeit der Selbstkontrolle besteht darin, sich selbst Maßstäbe oder Standards zu setzen und sich jede Verstärkung zu versagen, bis man diese Maßstäbe erreicht hat. Wenn jemand sich Ziele setzt und mit sich selbst vereinbart, sich erst nach deren Erreichen zu belohnen, und wenn er diese Vereinbarung ohne sichtbaren äußeren Zwang einhält, kann man sagen, er habe Selbstkontrolle ausgeübt. Kanfer et al. (1991) sehen es als Kernstück der Selbstmanagement-Therapie an, die Klienten in die Lage zu versetzen, ihr Leben wieder ohne therapeutische Hilfe zu gestalten. Selbstkontrolle kann mit jeder therapeutischen Technik verbunden werden. Einzige Bedingung ist, dass der Klient selbständig an sich arbeitet, nachdem ihm der Therapeut das Verfahren erklärt hat. Alle Auffassungen von Selbstkontrolle beinhalten drei Kriterien: 1. Das Verhalten lässt sich mit wenigen äußeren Kontrollen erklären. 2. Sich selbst zu kontrollieren, ist so schwierig, dass es den Betroffenen eine gewisse Anstrengung kostet. 3. Der/die Betroffene führt das Verhalten überlegt und nach bewusster Entscheidung aus. Selbstmanagement ist im Licht der multiplen Regulation menschlichen Verhaltens in Abhängigkeit von Alpha, Beta und Gamma – Variablen zu verstehen. Ziel der therapeutischen Intervention ist es, das Ausmaß an Selbstregulation und Selbstkontrolle (Beta) im Kontinuum mit den anderen beiden Größen zu optimieren. Alpha-Variablen: Einflüsse der externen, physikalischen Umgebung (z.B. Wohnsituation, soziale Situation Beta- Variablen: interne, kognitive Prozesse (Gedanken, Erwartungen, Schemata, Befürchtungen)- sie sind Kernbestandteil der Selbstregulation Gamma-Variablen: biologisch- somatische Ausstattung des Menschen (Regulation des Blutdrucks, Wach- und Schlafrhythmus, Ernährung..) Kanfer geht im Vorgehen von 3 aufeinanderfolgenden Schritten aus: 1.Selbstbeobachtung und Selbstregistrieren 2.Selbstbewertung und Vergleich mit Standards 3.Selbstbelohnung und Selbstbestrafung Methoden: Selbstbeobachtung durch schriftliche Aufzeichnung eigenen Verhaltens mithilfe von Verhaltenstagebüchern, Strichlisten, Stoppuhren, Stimuluskontrolle, kognitive Umstrukturierung Die Selbstkontrolle ist eine Herausforderung für das behavioristische Paradigma, denn sie setzt den Menschen als jemanden voraus, der unabhängig handelt, sich um etwas bemüht, plant und entscheidet. In jedem Fall ist der Mensch in dem Moment, wo die Kontrolle einsetzt, der Initiator der Handlung. Durch die Therapie sollen die Automatisierten Prozesse in Kontrollierte Prozesse übergehen. Wichtig, die automatisierten Prozesse zu unterbrechen. Symptome sind automatisierte Prozesse. Selbstmanagementtherapie: 1. Zielsetzung 2. Selbstbeobachtung lernen 3. Neue Verhaltensweisen lernen 4. Sichere Situationen aufbauen 5. Kleine Schritte DENKREGELN: 1. Denken Sie verhaltensnah 2. Denken Sie lösungsorientiert 3. Denken Sie positiv 4. Denken Sie in kleinen Schritten 5. Denken Sie flexibel 6. Denken Sie zukunftsorientiert ÄNDERUNGSMOTIVATION: Stufenmodell Prozess der Zielerreichung Beispiele therap. Methoden 1. Entwickeln von Zielen Selbstüberzeugung (Wie kann es anders sein?) - (kognitive und emotionale Ebene) Informationsvermittlung, Modelllernen 2. Entwicklung instrumentellen Gedankenexperiment, Kognitives Üben zielorientierten Verhaltens 3. Entscheidung Verdecktes Problemlösen, Stressimpfung Ziel – Werteklärung, in vivo Exploration von Zielzuständen vor der Entscheidung -----------------------------------------------------------------------------------------nach der Entscheidung 4. Engagement für Veränderung Zielsetzung In vivo Exploration von Handlungsmustern 5. Ausführung Rollenspiel, Soz. Kompetenztraining, Kontingenzmanagement, Desensibilisierung, Graduierte Aufgabenstellung 6. Feed - foreward Verbalisierte Wiederholungen, Entwickeln von Regeln, Übungen 7. Aufrechterhaltung Rückfallstraining Der Sinn des Lebens ist die Motivation, der alles andere untergeordnet ist. ZIEL UND WERTEKLÄRUNG : geht oft gut mit Phantasiespielen ( Zauberstab, Meteor, ) Fragen des Klienten: sollten für Therapieerfolg positiv beantwortet werden 1. Wie wird es sein, wenn ich mich ändere? Patienten helfen, sich realistische Veränderungen vorzustellen. 2. Wird es mir besser gehen, wenn ich mich ändere? Wie wird es mir besser gehen? 3. Was habe ich dabei zu gewinnen? 4. Kann ich es schaffen? 5. Was wird es mich “kosten”, das zu erreichen? (Was gebe ich alles dafür auf?) 6. Kann ich diesem Therapeuten (und der Therapiesituation) trauen, das zu erreichen? Methoden zur Erhöhung der Motivation: 1. Definieren Sie begrenzte und erreichbare Ziele, die an den Werten des Klienten orientiert sind. 2. Entautomatisieren Sie eingefahrene Gedankengänge und Handlungsabläufe 3. Verringern Sie Angst vor Veränderung 4. Fordern Sie Vorstellungen der zukünftigen Zielzustände 5. Nutzen Sie real und in der Vorstellung Rollenspiel und Rollenveränderung 6. Fordern Sie Selbstbeobachtung und Einschätzung der erreichten Fortschritte 7. Benutzen Sie Therapiekontrakte 8. Nutzen Sie die therapeutische Beziehung ( z.B. durch paradoxe Interventionen, soz. Unterstützung, spez. Anleitung) 9. Bauen Sie in die Alltagsroutine Auslöser für neue Verhaltensweisen ein und sorgen Sie dafür, dass Feedback aus gewohnter Umgebung kommt. 10. Lassen Sie den Klienten kleine (und “sichere”) Erfahrungen machen, um den Erwerb oder die Ausübung neuer Fähigkeiten auszuprobieren und zu unterstützen. 11. Beziehen Sie unterstützende soziale Netze mit ein. 12. Fördern Sie kleine Erfolgserlebnisse und den Gebrauch verbaler Wiederholung mit Selbstverstärkung. 13. Fördern Sie die Fähigkeiten zu positiver Selbstverstärkung und vergrößern Sie positive Reaktionen auf eigenes Verhalten. 14. a) Nutzen Sie bereits vorhandene begleitende Verstärker b) Assoziieren Sie neue mit bereits etablierten Verstärkern c) Nutzen Sie altruistische Motivationen d) Vermindern Sie die Anziehungskraft problematischen Verhaltens 15. a) Nutzen Sie die “Fuß - in - der - Tür - Technik” b) Setzen Sie die Aufgaben in einen Zusammenhang mit den Therapiezielen 16. Benutzen Sie spezifische Verhaltenstechniken, um Aktionen zu vereinfachen und Hindernisse für den Fortschritt auszuräumen. 17. Maximieren Sie den Anteil des Klienten beim Treffen von Entscheidungen und beim Problemlösen in allen vorher angeführten Punkten. EMOTIONEN - AFFEKTE Katharsis kann schädlich sein, wenn ich nicht weiß, was ich als Therapeut damit mache. Daher muss ich vorher überlegen. 1. Gefühlssituation vorbereiten 2. Lösche Erwartung vor Bestrafungen 3. Hilfe bieten, dass Klient sich selbst über sich informiert. ”Denken Sie nicht an den weißen Bären” 4. Fördere Distanz vom traumatischen Erlebnis 5. Unterstütze das Erlebnis mit verbalen Hinweisen für bessere Kontrolle 6. Die Therapeut - Klient Beziehung wird verstärkt. 7. Unterstütze die Erleichterung, das Gefühl losgeworden zu sein. Kanfer’s ELF GESETZE DER PSYCHOTHERAPIE 1. Bringe einen Patienten nicht dazu, gegen sein Eigen-Interesse zu handeln. Wer das Eigen-Interesse des Patienten verstehen will, muss die Welt des Patienten und dessen Erfahrungen mit bestimmten Ereignissen aus dessen Perspektive verstehen. Auch dann, wenn TherapeutIn mit dieser Wahrnehmung nicht übereinstimmt oder eine Reaktion emotional unpassend oder irrational findet. (TherapeutIn muss Bescheid wissen über health beliefs, implizite Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen und Lebensziele). Erst, wenn Th das Eigeninteresse des Kl versteht, kann man daran gehen, die Ziele, Motive und Verhaltensmuster des Kl zu verändern. 2. Denke zukunftsorientiert, suche nach Lösungen, fokussiere auf die Stärken des Patienten, und sei konkret bei Verhaltensweisen, den auslösenden antecedenten Bedingungen und den Auswirkungen. Laien neigen dazu, sich auf Probleme und Schwächen zu konzentrieren, in der Vergangenheit zu verweilen, und nach Ursachen zu suchen (“wenn ich nur wüßte, warum ich so bin”), vage und sehr allgemein zu sprechen (“ich war angefressen”), und unklare Ziele (“Glück”) zu suchen. Die Therapie zielt darauf ab, mit entsprechenden Lösungen eine bessere Zukunft vorzubereiten, indem sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten der PatientInnen nutzt, spezifische Aktionsmuster so zu verändern, dass gewünschte Ergebnisse herauskommen. 3. Du bist nur ein gut ausgebildeter Experte. Spiele nicht Gott oder Schicksal, indem Du die Verantwortung für das Leben des Patienten übernimmst. . Das Wertvollste an Professionalität besteht darin, dass wir unser Können, Wissen und unseren guten Willen für die Patienten einbringen. Wir können weder für sie Aufgaben übernehmen, noch die Verantwortung für ihre Handlungen oder Fehler. Manchmal reicht es aber nicht, dass wir unser Bestes geben. Die Kräfte in der Umgebung oder Entwicklung des Patienten sind stärker als wir. Der Erfolg oder Misserfolg in der Therapie hängt nicht nur von den Fähigkeiten, dem Wissen oder irgendeiner höheren göttlichen Qualität ab. 4. Säge nicht den Ast ab, auf dem der Patient sitzt, ohne ihm vorher eine Leiter gegeben zu haben. Finde heraus, welche Funktionen das pathologische Verhalten, die irrationale Einstellung oder die emotionale Reaktion hat. Wenn du dem Patienten keine alternativen Methoden für die Erreichung seiner Ziele anbieten kannst (ihm/ihr eine Leiter geben), oder wenn du ihm nicht klar machen kannst, dass er auf den Ast gar nicht zu klettern braucht, dann will und kann der Patient nicht zusammenarbeiten. 5. Der Patient hat immer Recht. Der Patient hat höchstwahrscheinlich hunderte und tausende Stunden damit verbracht, seine/ihre Gedankenmuster oder Reaktionen zu rechtfertigen, und er/sie hat gute Gründe gegen jeden Versuch des Therapeuten, sie sofort zu verändern. Versuche deshalb nicht, den Wert eines wichtigen Ziels herabzuwürdigen oder dagegen zu argumentieren. Ebenso nicht gegen die wahrgenommene böse Absicht eines Partners oder gegen die Wahrheit anderer irrationaler Meinungen oder Reaktionen. Akzeptiere stattdessen, dass die Sicht des Patienten möglich, ABER, dass sie vielleicht nicht richtig ist. TherapeutIn wird versuchen, Meinungen, Ziele oder Einstellungen durch Fragen, Experimentieren oder andere Arten zu modifizieren. Versuche dann, den Patienten mit seiner Irrationalität oder Inkonsistenz zu konfrontieren. 6. Wenn du kein Symptom gesehen hast, weißt du nicht, was wirklich los ist. Beschreibungen sind ungenau und irreführend. Ein “totales soziales Desaster” kann in Wirklichkeit eine leichte Unbeholfenheit, ein “hartnäckiger Zwang” kann in der Nähe von wiederholtem, aber durchaus angemessenem vernünftigem Denken, das eben mehrmals täglich auftritt, liegen. Wer sagt, dass er physisch eingeschränkt sei, weicht vielleicht nur ein wenig von seiner Maximalleistung ab. Wenn du es nicht direkt beobachten kannst, dann musst du den Patienten dazu bringen, sein Verhalten in der Therapie zu zeigen, im Rollenspiel, in der Selbstdarstellung, in der Aufzeichnung. Wenn möglich, ist es auch günstig, Beschreibungen des Verhaltens von Informanten zu bekommen. 7. Du kannst einen Patienten nicht behandeln, der in der Sitzung nicht anwesend ist. Deshalb muss es das erste Ziel sein, den Patienten in die Therapie zu bekommen. Du musst verhindern, dass er frühzeitig abbricht, und Versuchen widerstehen, einen anderen Patienten als Vermittler für die Behandlung eines Familienangehörigen oder einer anderen Person einzusetzen. Du kannst eine Partnerschaft oder Familienbeziehung, wo beide nicht anwesend sind, eher verändern, wenn du einen Teil des Systems veränderst, als das ganze zu verändern. Häufig aber reicht das nicht für eine Veränderung aus. 8. Richte das Augenmerk auf Verbesserungen während der kommenden Woche und ziele nicht auf Perfektion in der Zukunft. Spezifische, limitierte und möglichst naheliegende Ziele sollen formuliert werden anstelle breiter, allgemeiner und entfernter Hoffnungen und Phantasien. Die Dinge verändern sich mit der Zeit, und Ziele verändern sich während der Therapie. Wichtig ist, dass es dem Patienten in der nächsten Woche besser geht als in der vorherigen. 9. Gib dem Patienten nicht mehr Information als er verarbeiten kann. Mache kurze Bemerkungen (nicht mehr als 10 bis 15 Sekunden auf einmal), sprich zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen bestimmten Punkt an, und wiederhole ihn mehrmals. Sei redundant, mache eher Fehler der Redundanz als ständig zu neuen Ideen zu springen und die Aufnahmekapazität des Patienten zu überfordern. 10. Wenn du während einer Sitzung härter gearbeitet hast als der Patient, dann machst du etwas falsch. Therapiesitzungen dienen dazu, den Klienten zu aktivieren. Er / sie ist mit einem Problem konfrontiert, und arbeitet daran, das Unbehagen zu reduzieren. Konsequenterweise sind sie es und nicht du, die betroffen und aktiv sein müssen. Sie können nicht passive Zuhörer sein, während du dich um eine Lösung abmühst. 11. Geniere dich nicht, dem Patienten für seine/ihre Besserung Anerkennung zu zollen. Anerkenne, dass er/sie den Erfolg mit einer kleinen Unterstützung von dir zustande brachte. Erfolg zeugt Erfolg. Die Patienten brauchen mehr positives Reinforcement als Therapeuten. Ihr Selbstwert, nicht der der Therapeuten, muss während der Therapie gestützt werden. Die Selbstkontrolle ist eine Herausforderung für das behavioristische Paradigma, denn sie setzt den Menschen als jemanden voraus, der unabhängig handelt, sich um etwas bemüht, plant und entscheidet. In jedem Fall ist der Mensch in dem Moment, wo die Kontrolle einsetzt, der Initiator der Handlung. Allgemeines zu Kognitiven Verfahren: Die Kognitive Therapie stellt eine enge Verbindung zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten her. Wenn die Gedanken dem Lebensalltag entsprechen, haben die Menschen keine Probleme damit. Wenn bestimmte Gedankenmuster aber nicht zu den Realitäten des Lebens passen, können psychische Störungen die Folge sein. Allgemein gesprochen, versuchen kognitiv orientierte Verhaltenstherapeuten die Denkprozesse ihrer Patienten zu ändern, um so auch ihre Emotionen und ihr Verhalten zu beeinflussen. Wichtig sind (neue) Handlungsmuster. Sie sollen Verhaltensänderungen bewirken. Kognitive Verhaltenstherapeuten berücksichtigen die mentalen Prozesse ihrer Klienten. Sie interessieren sich dafür, wie der einzelne die Welt wahrnimmt. Nicht was von außen auf Menschen einwirkt, kontrolliert ihr Verhalten, vielmehr werden Gefühle und Verhaltensweisen davon bestimmt, wie Individuen die Welt sehen. „Nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die Ansichten, die sie von den Dingen haben“, behauptete der griechische Philosoph Epiktet im ersten Jahrhundert. Die Verhaltenstherapie weist insofern Ähnlichkeiten zu den existentiell-humanistischen Therapien auf. Zentrales Thema von Therapeuten wie Rogers und Perls ist, dass man den Klienten aus dessen eigenen Bezugsrahmen oder dessen eigener phänomenologischer Welt heraus verstehen müsse, denn es sei diese Wahrnehmung der Welt, die Leben und Verhalten kontrolliere. Zimmer (1984) stellt fest, dass die kognitiven Theorien durch ihre subjektive Sicht ein Defizit der Verhaltenstherapie ausfüllen konnten. Dennoch sind die kognitiven Therapien ebenso wie die frühen behavioristischen Ansätze in ihren Aussagen begrenzt, und dies gilt insbesondere auch für Emotionstheorien und Emotionen bearbeitende Verfahren. Die weitere Forschung wird Alternativen finden müssen, die der Analyse und Veränderung psychischer Störungen von Menschen auf allen Erlebens- und Verhaltensebenen gerecht werden. Mahoney hat (1978) die Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie formuliert: 1. Der menschliche Organismus reagiert vor allem auf die kognitive (‚innere’) Repräsentation, also die Darstellung oder Abbildung seiner Umgebung, und nicht auf die Umgebung selbst. 2. Diese kognitiven Repräsentationen sind funktional mit den Lernprozessen verbunden. 3. Menschliches Lernen ist zum Großteil kognitiv vermittelt. 4. Gedanken, Gefühle und Verhalten sind interaktiv, sie bedingen einander. „Aus diesen allgemeinen Aussagen lassen sich bestimmte Voraussagen ableiten. Wenn diese Annahmen stimmen, dann müssten kognitive Phänomene wie Überzeugungen oder Erwartungen bessere Vorhersagen für menschliches Verhalten liefern als externe Variablen. Wenn es beispielsweise eine Diskrepanz zwischen Kognitionen eines Menschen und der ihn umgebenden Realität gibt, dann beeinflussen die Kognitionen die Gefühle und das Verhalten stärker als die externe Realität“ (Mahoney, 1978, S. 70f.). Therapie Bei der Durchführung einer Verhaltenstherapie sind drei Fragenkomplexe zu beachten, die von Kanfer & Saslow (1969) formuliert wurden: 1. „Welches sind die Bedingungen unter denen dieses Verhalten erworben wurde und welche Faktoren erhalten es momentan aufrecht?“ (= Problemanalyse) 2. „Welche besonderen Verhaltensmuster verlangen eine Veränderung hinsichtlich ihrer Auftrittshäufigkeit, ihrer Intensität, ihrer Dauer oder der Bedingungen, unter denen sie auftreten?“ (= Zielanalyse) 3. „Welche sind die praktikabelsten Mittel, um die erwünschten Veränderungen bei diesen Individuen zu erzielen (Veränderungen der Selbsteinschätzung des Patienten? “ Umgebung, des Verhaltens oder der (=Therapieplanung) (zit. in Kanfer, Reinecker, Schmelzer, 1991, S. 101). Therapie verfolgt eine Veränderung im Verhalten, in den Emotionen und Einstellungen eines Klienten, weil diese Bereiche für ihn oder für seine Umgebung gegenwärtig zum Problem geworden sind. Die Therapie wird als geplantes, problemorientiertes, systematisches und zielgerichtetes Vorgehen verstanden und sie ist zeitlich begrenzt. Es werden Methoden angewandt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Therapieziele sollen gemeinsam von Therapeuten und Klienten gesucht und definiert werden. Sie sollen also nicht vorgegeben werden oder an irgendwelchen idealen Persönlichkeitsmodellen orientiert sein, sondern in jedem Einzelfall individuell vereinbart. Sie spiegeln aber in gewisser Weise die persönlichen Einstellungen und Normen von Klient und Therapeut wieder. Im Sinn der Hilfe zur Selbsthilfe sollen grundlegende Fertigkeiten der Problembewältigung erworben werden (solche Fertigkeiten bestehen z.B. in der Selbstbeobachtung, in der Analyse der Problemsituationen, einer sogenannten Zielanalyse, der Suche nach Lösungen und der Überprüfbarkeit eigeninitiierter Lösungsversuche). Bei der Verfolgung des Therapiezieles ist es meistens notwendig, Teilziele zu formulieren, um handlungsrelevante Schritte einleiten zu können. Hier wird deutlich, dass Verhaltenstherapie als Prozess zu verstehen ist, im Sinne von Zielfindung, Zielvereinbarung und praktischer Therapieziel-Umsetzung. Es werden innere ebenso wie äußere Ereignisse berücksichtigt. Weniger die Ätiologie eines Problemverhaltens liegt im Vordergrund, sondern die Variablen, die es gegenwärtig aufrechterhalten. Die „funktionale Analyse“ besagt, dass die Entstehung und Aufrechterhaltung eines Problems von bestimmten Bedingungen abhängt. Diese sind zu analysieren und im Falle einer Intervention zu verändern. Mit der funktionalen Analyse werden die Ursachen einer Störung in den vorausgehenden und nachfolgenden Bedingungen eines Verhaltens gesucht. Das Denkmodell der funktionalen Analyse besagt, dass man eine Veränderung des Problems nicht erwarten kann, wenn man nicht bereit oder in der Lage ist, die Bedingungen dieses Problems zu verändern. Der Bereich der Bedingungen schließt soziale und physikalische Ereignisse ebenso ein wie biologisch-physiologische und kognitive, das heißt geistige Prozesse. Das Ergebnis einer funktionalen Analyse bildet das „hypothetische Bedingungsmodell“. Die im hypothetischen Bedingungsmodell angeführten Faktoren bilden für den Verhaltenstherapeuten mögliche Ursachen eines Problems, die im Laufe einer Intervention im Einzelfall zu verändern sind. Bei der Beschreibung des Problems sollen folgende Ebenen unterschieden werden: subjektiv-kognitive Ebene, Verhaltensebene, physiologische Ebene. Der Therapeut muss auch in den persönlichen Beziehungen des Klienten nach Hinweisen dafür suchen, warum dieser an seinem Problem festhält, obwohl er doch unmittelbar darunter leidet. Ein theoretischer Rahmen hilft dem Therapeuten bei seinen Überlegungen, ist aber keineswegs alleiniger Garant für Erfolg. „Der Kliniker macht sich in der Tat mit einer bestimmten Haltung an die Arbeit, mit einem theoretischen Rahmen, innerhalb dessen er die komplexen Daten, mit denen er es zu tun hat, ordnet. Doch dieser Rahmen reicht nicht aus. Wie jeder angewandte Wissenschafter muss auch der Kliniker das therapeutische Skelett mit Fleisch füllen. Jeder individuelle Fall konfrontiert ihn mit Problemen, die ein Wissen verlangen, das über grundlegende psychologische Prinzipien hinausgeht“ (Lazarus und Davison, 1971, S. 203). Das 7-Phasen-Modell nach Kanfer 1. Eingangsphase oder Orientierungsphase: Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen 2. Aufbau von „Änderungsmotivation und vorläufige Auswahl von Änderungsbereichen“ 3. Verhaltensanalyse, Problemklärung / Problemanalyse und funktionales Bedingungsmodell 4. Therapiezielklärung, Zielanalyse und Vereinbaren therapeutischer Ziele 5. Planung, Auswahl und Durchführung spezieller Methoden 6. Evaluation therapeutischer Fortschritte 7. Endphase: Erfolgsoptimierung und Abschluss der Therapie. „Follow-up“/Katamnese Problembeschreibung Analyse der Lebensbedingungen Abklärung körperlicher und geistiger Beeinträchtigung Beschreibung lebensgeschichtlicher Entwicklung Problemanalyse Welche Problembereiche sind veränderungsbedürftig Welche Gründe sind für die Problemaufrechterhaltung von Bedeutung Präzise Beschreibung des Problems Erfassung und Beschreibung situationaler Bedingungen des Verhaltens Bisheriger Umgang mit dem Problem und Grad der Beeinträchtigung Genese und Entwicklung des Problems Erstellung eines hypothetischen Bedingungsmodells für das Problem Erfassung des „Health-Belief-Model“ und der Attributionen des Patienten (= „Mikroanalyse“) Analyse des Zusammenhangs mehrerer Probleme; Systemische Analyse; Probleme im „Lebenskontext des Patienten“ Methoden für die (= „Makroanalyse“) Diagnose: Exploration, Verhaltensbeobachtung, Verhaltenstest, Rollenspiel, Fragebogen, Diagnostikverfahren usw. Zielfindung: Information aus Problemanalyse Klärung motivationaler Aspekte: Persönliche Änderungswünsche Analyse der sozialen Rahmenbedingungen: Derzeitige Lebensbedingungen Erwartungen der Sozialpartner Normen und Wertvorstellung des Patienten und Therapeuten Therapeutische Möglichkeiten Therapieplanung „Welches sind geeignete praktische Methoden, um angestrebte Veränderungen bei einer Person zu erzielen?“ (Kanfer & Saslow, 1969) Planung des Therapieverlaufs Vermittlung eines plausiblen Ätiologie- und Therapiemodells (PM) Ansatzpunkte der Therapeutin/des Therapeuten Verfahren zur Problemveränderung Reihenfolge der Anwendung Ansatzpunkte: beim Patienten, bei Bezugspersonen, an den Rahmenbedingungen Endphase / Stabilisierung und Transfer / follow up Mittels Attribution wird versucht, Behandlungserfolge über das Ende der Therapie hinaus zu stabilisieren. Selbstattribution besagt, dass es nicht ohne Einfluss auf zukünftiges Handeln bleibt, wie jemand sich selbst ein gegenwärtiges oder vergangenes Verhalten erklärt. Die Klienten sollen ein Gefühl größerer Selbstverantwortung bekommen. Wenn Therapeuten die Klienten anregen, neue Fertigkeiten selbständig zu erproben und sich selbst herausfordernden Situationen zu stellen, wird sich bei diesen verstärkt der Eindruck einstellen, es selbst geschafft zu haben. Sie werden unabhängiger von Therapie und Therapeuten, und die Behandlungsergebnisse bleiben stabiler. ............................................................................................. bis hierher Prüfungsstoff Methoden der Verhaltenstherapie (Fliegel et al, Standardmethoden der Verhaltenstherapie) Dem/der Verhaltenstherapeuten/in stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die aber nicht als voneinander abgegrenzte Therapieformen anzusehen sind, sondern sie bilden zusammen ein Ganzes. Ein Verhaltenstherapeut wählt aus diesem Repertoire diejenigen Vorgehensweisen aus, die ihm am besten für die Probleme des Patienten zu passen scheinen. Sehr oft wird er mehrere dieser Vorgehensweisen innerhalb ein und derselben Therapie anwenden. Rollenspiel Operante Methoden Entspannungsverfahren Training sozialer Kompetenz Konfrontationsverfahren Systematische Desensibilisierung und Angstbewältigungstraining Biofeedback Selbstverbalisationstraining Paradoxe Intervention Rational-emotive Therapie Kognitives Bewältigungstraining Problemlösetraining Kognitive Therapie nach Beck Depressionstherapie nach Lewinsohn Genusstraining Verhaltenstherapeutische Alkoholikerprogramme Verhaltenstherapeutische Sexualtherapie Breitspektrumverhaltenstherapie Verhaltensorientierte Familientherapie (Aversionstherapie) Abschließende Bemerkungen Die moderne (kognitive) Verhaltenstherapie wird oft als Breitbandverhaltenstherapie bezeichnet (Lazarus, 1971), da in der Therapie nacheinander gleichzeitig mehrere Verfahren zur Anwendung kommen, um möglichst alle wichtigen kontrollierenden Variablen zu erfassen. Charakteristisch für die Verhaltenstherapie ist mehr ihr prinzipieller methodischer Standpunkt, als der Rückgriff auf spezielle theoretische Konzepte oder Techniken. Die Verhaltenstherapie weist eine enge Beziehung zu Grundlagen und Anwendungsfeldern der Psychologie auf. Die im Kern psychologische Fundierung der Verhaltenstherapie ermöglicht eine Orientierung an methodologischen und Forschungsaspekten der Psychologie ebenso wie eine Offenheit gegenüber neuen Anwendungsfeldern für verhaltenstherapeutisches Denken (Beispiel: Verhaltensmedizin). Seit Jahrzehnten Gruppenverfahren werden von entwickelt, Psychologen erprobt und und evaluiert. Verhaltenstherapeuten Dabei haben sich auch deutliche Modifikationen und Unterschiede zu den „klassischen“ Formen der Gruppendynamik gezeigt. Ein besonderes Kennzeichen der Verhaltenstherapie in Gruppen ist, dass für verschiedene Störungen jeweils spezifische Gruppenprogramme entwickelt wurden. Den aktuellen Stand dieser Forschungen und Verfahren zeigt Fiedler (1996) auf. Diskussionspunkte Der Ausdruck kognitiv-behavioral wird oft missverstanden. Er besagt nicht, dass in der Verhaltenstherapie nur dem Verhalten und in der Kognitiven Therapie nur den Kognitionen Beachtung geschenkt wird, während das Erleben, die Emotionen, Motivationen usw. ausgeklammert oder nicht berücksichtigt werden. Mit kognitiv-behavioral sind vielmehr die beiden vorherrschenden Paradigmata oder theoretischen Betrachtungsweisen gemeint, auf deren Grundlage diese Therapiemethoden konzipiert wurden. Effektivität Studien belegen, Veränderungen dass die durchaus durch stabil sind verhaltenstherapeutische und Langzeitstudien Behandlung keine erzielten Hinweise auf Symptomverschiebungen zeigen. Im Gegenteil: Die erfolgreiche Behandlung spezifischer Probleme bewirkt häufig - insbesondere bei konsequenter Verfolgung des Problemlöseansatzes - eine positive Veränderung anderer Probleme, und die Verhinderung neuer Probleme. Beziehung zwischen Klient und Therapeut Eine gute therapeutische Beziehung ist schon deswegen wichtig, da eine Verhaltenstherapie ohne die Bereitschaft des Klienten mitzuarbeiten nicht möglich ist. Der Therapeut muss die KlientInnen zur Mitarbeit gewinnen, wenn die therapeutischen Techniken die gewünschte Wirkung zeigen sollen. Direktives versus einfühlsames Vorgehen Bei bestimmten Symptomen (schweren Ängsten, Zwängen) sind Konfrontations- oder Reizüberflutungsverfahren sehr effizient (siehe Grawe,1994). Der Therapeut ist bei stärkerer Konfrontation mit den Angstobjekten im Feld anwesend. Dabei wirkt er zum Teil angstreduzierend, manchmal hilft er, die Aufmerksamkeit des Klienten auf die Angst zu richten (Reizüberflutung), und diese bei Vorstellungsübungen manchmal noch ins Irreale zu übersteigern (Implosion). Dieses Vorgehen belastet Klienten und Therapeuten sehr. Bei Implosion (in der Vorstellung) oder bei Reizüberflutung (in vivo) kann es manchmal notwendig sein, maximale Angst auszuhalten, bis Erschöpfung eintritt, damit Habituation einsetzen kann. Dies gelingt nur dann, wenn ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Patient und Therapeut besteht und Konzept und Vorgehen dem Patienten erklärt und von diesem auch akzeptiert werden. Der „strenge aber einfühlende“ Therapeut ist hier gefordert. Diese Form der therapeutischen Haltung wird vielfach kritisiert. Aber das strenge strukturelle Vorgehen muss einer vertrauensvollen Beziehung nicht widersprechen. In einem post hoc Vergleich von Therapeuten-Bewertungen erfolgreich und nicht erfolgreich mit Reizüberflutung behandelter Klienten (Rabavilas et al., 1979) korrelierten positiv mit dem Therapieerfolg: Respekt und Verständnis, Interesse und Sympathie für den Patienten sowie Eingehen auf seine Abhängigkeitsbedürfnisse. Weiterhin bewerteten die Patienten positiv: explizite Regeln, direktes Vorgehen und gleichzeitig starke Ermutigung. Negativ korrelierten: eine permissive Haltung und Toleranz für Vermeidungsverhalten. Diese empirischen Daten decken sich auch mit der Studie von Sloane et al. (1975), in der verhaltenstherapeutische und psychoanalytische Vorgehensweisen miteinander verglichen wurden (94 Patienten, davon etwa 65% mit starken Ängsten). Dabei zeigte sich, dass die Verhaltenstherapeuten als warm und vertrauenswürdig, aber auch als aktiv und direktiv eingeschätzt wurden. Die Daten sind ein Beleg dafür, „dass bei bestimmten Klienten und spezifischen Verfahren die Variablen der Gesprächstherapie nicht hinreichen, um eine wirkungsvolle Therapie sicher zu stellen“ (Zimmer, 1983, S. 157). I Manipulation und Anpassung Der verhaltenstherapeutische Prozess läuft in enger Zusammenarbeit zwischen KlientIn und TherapeutIn ab. Die Schritte sind offen und transparent. Klienten werden so früh wie möglich zur Eigenkontrolle angeleitet. Viel stärker als jede andere Therapierichtung hat die Verhaltenstherapie durch ihre Konzepte der sorgfältigen Problemanalyse die Möglichkeit, auch die sozial und materiell vermittelten Bedingungen der psychischen Probleme aufzudecken und aufzuzeigen. Welche Konsequenzen der Klient aber aus diesen Einsichten zieht, ist letztlich seine alleinige Entscheidung. Seine Entscheidungen werden sich auch in den Zielen der Therapie niederschlagen. Wie emanzipatorisch die therapeutischen Konsequenzen sind, das hängt sicherlich zumindest in zweiter Linie auch mit den Einstellungen des Therapeuten zusammen. Das planende, rationale und vor allem transparente Vorgehen im Sinne von Spezifität und Funktionalität bei Therapiedurchführung Diagnose, sowie Therapiezielbestimmung, der verwendeten Interventionsfestlegung Terminologie („Reiz“, und „Verstärker“, „Löschung“, „Modifikation“) der Verhaltenstherapie reizen eher zur Kritik. Der Verhaltenstherapie ist besonders von psychoanalytischer Seite vorgehalten worden, ihre Behandlung führe zu Symptomverschiebung, da sie nur an den Symptomen, nicht aber an den zugrundeliegenden Ursachen arbeite. Viele Missverständnisse sind durch unterschiedliche inhaltliche Belegung der Begriffe (insbesondere „Symptom“) entstanden. Während die Psychoanalyse davon ausgeht, dass das direkt erfassbare Symptom nur Ausdruck einer tieferliegenden Störung (z.B. unbewusster Konflikt) ist, bezeichnet die Verhaltenstherapie mit „Symptom“ die psychische Störung selbst. Letztlich hat jede Therapie - von der Psychoanalyse bis zur Psychochirurgie - die Modifikation von Verhalten zum Ziel. Literaturliste Ader, R. & Cohen, N. (1981). Conditioned immunopharmacological responses. In R. Ader (Ed.), Psychoneuroimmunology (281-319). New York: Academic Press. Ader, R. & Cohen, N. (1993). Psychoneuroimmunology: Conditioning and stress. Annual Review of Psychology, 44, 53-85. Alvarez-Borda, B., Ramírez-Amaya, V., Pérez-Montfort, R., & Bermúdez-Rattoni, F. (1995). Enhancement of antibody production by a learning paradigm. Neurobiology of Learning and Memory, 64, 103-105. Ayllon, T. & Azrin, N. H. (1965). The measurement and reinforcement of behavior of psychotics. Journal of Experimental Analysis of Behavior, 8, 357-383. Azrin, N.H. & Ayllon, T. (1968). The token economy. A motivational system for therapy and rehabilitation. Englewood Cliffs. Bain, A.: Thought control in everyday life. New York 1928. Beck, A.T.: Cognitive therapy and emotional disorders. New York, 1976. Beck, A.T.: Cognitive Therapy: Nature and relation to behavior therapy. Behavior Therapy 1970/1, 184-200. Beck, A.T.: Wahrnehmung der Wirklichkeit und Neurose. Kognitive Psychotherapie emotionaler Störungen. München 1979. Bykow, K. M. (1957). The cerebral cortex and the internal organs. New York: Academic Press. Cautela, J.R.: Covert sensitization. Psychological Reports 20, 1967, 462. - Covert extinction. Behavior Therapy 2, 1971, 192-200. - Covert reinforcement. Behavior Therapy 1, 1970. Coe, C. L. (1999). Psychosocial factors and psychoneuroimmunology within a lifespan perspective. In D. P. Keating & C. Hertzman (Eds.), Developmental health and the wealth of nations: Social, biological and educational dynamics (201-219). New York: The Guilford Press. Davidson, D. & Neale, J.: Klinische Psychologie. Psychologie Verlags Union, München, 1988. DGVT - Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.): Verhaltenstherapie. Theorien und Methoden. DGVT, Tübingen, 1986. Edwards, A. E. & Acker, L. E. (1962). A demonstration of the long-term retention of a conditional galvanic skin response. Psychosomatic Medicine, 24, 459-463. Egger, J.: Psychologie in der Medizin. Medizinische Psychologie, Psychosomatik, Psychotherapie. Wiener Universitätsverlag WUV: Wien 1993. Ellis, Albert & Hoellen, Burkhard. (1997). Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie – Reflexionen und Neubestimmungen. Pfeiffer, München 1997. Fiedler, P., Persönlichkeitsstörungen, Psychologie Verlags Union. Weinheim: 1994. Fiedler, P., Verhaltenstherapie in und mit Gruppen. Psychologische Psychotherapie in der Praxis. Psychologie Verlags Union. Weinheim: 1996. Fliegel, St. et. al.: Verhaltenstherapeutische Standardmethoden. Urban & Schwarzenberg, München, 1981. Grawe, K., Donati, R., Bernauer, F., Psychotherapie im Wandel - Von der Konfession zur Profession. Hogrefe, Göttingen, 1994. Grawe, K., Psychologische Therapie. Hogrefe, Göttingen: 2000. Harris, B. (1979). Whatever happened to Little Albert? American Psychologist, 34, 151-160. Hoffmann, M., Die Klient-Therapeut-Beziehung in den kognitiven Therapien. In: Zimmer (Hrsg.). Die therapeutische Beziehung. edition psychologie, Weinheim, 1983. Homme, L. (1965). Perspectives in psychology. XXIV. Control of coverants, the operants of mind. Psychol. Record 15. Jacobson, E. Progressive relaxation. Chicago 1929. Lazarus, Arnold (Hrsg.), Angewandte Verhaltenstherapie, Klett, Stuttgart 1976. Lückert, H-R, Lückert I., Einführung in die Kognitive Verhaltenstherapie. Reinhardt, München 1994. Mahoney, M. J.: The self-management of covert behavior: a case study. Beh. Therapy 2, 1971. Mahoney, M. J.: Kognitive Verhaltenstherapie. Neue Entwicklungen und Integrationsschritte. München, 1977. Margraf, J., Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Bd. 1 und Bd. 2. Springer, Berlin 1996 und 1997. Pawlow, I. P. (1927). Conditioned reflexes (G. V. Anrep, Trans.). London: Oxford University Press. Poulos, C. X. & Cappell, H. (1991). Homeostatic theory of drug tolerance : A general model of physiological adaptation. Psychological Review, 98, 390-408. Rachman, S.: Systematic desensitization. Psychological Bulletin 1967, 67, 93-103. Reinecker, H.: Grundlagen der Verhaltenstherapie. Psychologie Verlags Union, München, 1987. Revenstorf, D.: Psychotherapeutische Verfahren. Verhaltenstherapie. Urban-Taschenbücher, Kohlhammer, Stuttgart, 1982. Siegel, S. (1984). Pavlovian conditioning and heroin overdose: reports by overdose victims. Bulletin of the Psychonomic Society, 22, 428-430. Siegel, S., Hinson, R.E., Krank, M. D. & McCully, J. (1982). Heroin „overdose“ death: The contribution of drug-associated environmental cues. Science, 216, 436-437. Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan. Sloane, R. B., Staples, F. R., Cristol, A. H., Yorkston, N. J., Whipple, K. (1975). Psychotherapy versus behavior therapy. Harvard University Press, Cambridge. (Deutsch: Analytische Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Enke, Stuttgart, 1981). Staats, A. W. & Staats, C. K. (1958). Attitudes established by classical conditioning. Journal of Abnormal and Social Psychology, 57, 37-40. Suchman, A. L., & Ader, R. (1989). Placebo response in humans can be shaped by prior pharmacological experience. Psychosomatic Medicine, 51, 251. Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and man. Psychological Review, 55, 189-208. Tolman, E. C. & Honzik, C. H. (1930). “Insight” in rats. University of California Publications in Psychology, 4, 215-232. Vogel, H. et al., Verhaltenstherapeutische Fallberichte, Ausbildungsmanual 4, dgvt, Tübingen, 1994. Watson, J. B. (1919). Psychology from the standpoint of a behaviorist. Philadelphia: Lippincott. Watson, J.B. & Raynor, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3, 1-14. Wolpe, J.: The practice of behavior therapy. New York 1969. Wolpe, J.: The systematic desensitization treatment of neuroses. J. Nerv. Mental. Dis., 132, 1961, 189-203. Wolpe, J.: The role of muscular relaxation in desensitization therapy. Beh. Res. 6, 1968. Ziesing, F., Pfingsten, U., Selbstveränderung – Verhaltenstherapie selbst erfahren. Ausbildungsmanual 3, dgvt, Tübingen 1997. Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. 16 (2004). Psychologie. Berlin: Springer. Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. 7(1999). Psychologie. Berlin: Springer. Zimmer, D. (Hrsg.), Die therapeutische Beziehung. edition psychologie, Weinheim, 1983. Über Verhaltenstherapie: Kogler, M., & Kogler, A. (2005). Die Verhaltenstherapie. Stuttgart: Kreuz. Paulus, J., Verhaltenstherapie – Der kurze Weg zum Wohlbefinden. Campus, Frankfurt a. M., 1998. Schuster, K., Abenteuer Verhaltenstherapie, dtv, München 1999. Schorr, A.: Die Verhaltenstherapie. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beltz-Verlag, Basel, 1984. Zeig, Jeffrey (Hrsg.), Psychotherapie – Entwicklungslinien und Geschichte. dgvt, Tübingen, 1991. Korunka, C., Begegnungen: Psychotherapeutische Schulen im Gespräch. Facultas, Wien: 1997. Zeitschriften: Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, Pabst Science Publishers, Lengerich. Verhaltenstherapie, Verlag Karger, Basel. Neue Formen kognitiv-behavioraler Therapie In: Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis 2/2000 VT und Yoga VT des Sich-Sorgens und Grübelns Psychotherapie und Synergetik