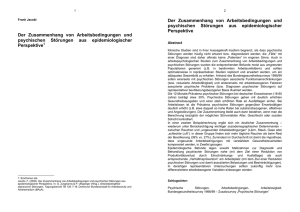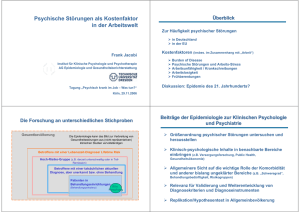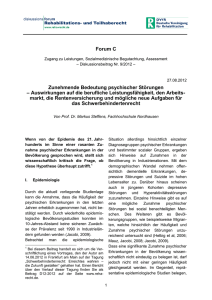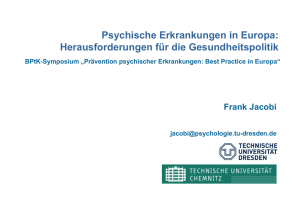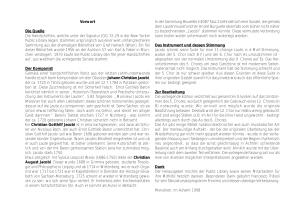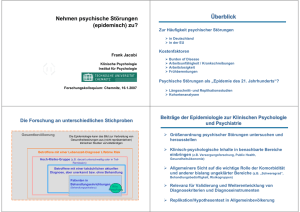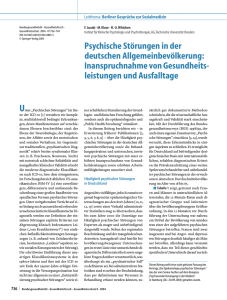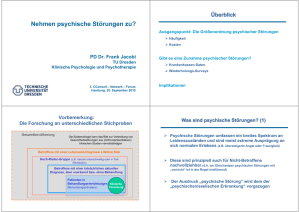2.1. «Diagnoseträger» und Patienten: Zur Epidemiologie
Werbung

2.1. «Diagnoseträger» und Patienten: Zur Epidemiologie behandelter und unbehandelter psychischer Störungen in Deutschland Frank Jacobi & Hans-Ulrich Wittchen 1. Was ist überhaupt ein «Fall»? Vor der diagnostischen Frage «Wo liegt das spezielle Problem dieses Patienten?» im Rahmen der Therapieplanung steht aus epidemiologischer bzw. störungs-diagnostischer Perspektive die Frage danach, was überhaupt als «Fall» zu betrachten sei. Epidemiologie und Diagnostik psychischer Störungen hatten im Verlauf der letzten Jahrzehnte hierbei mehrere Probleme zu lösen. Erstens musste die notorische Unreliabilität klassischer diagnostischer Konzepte überwunden werden, um einen verlässlichen Begriffsrahmen zu schaffen, der weitere differenziertere Forschung und die Entwicklung immer störungsspezifischerer Therapien erst ermöglicht. Der enorme Fortschritt seit der Einführung moderner Klassifikationssysteme ist unübersehbar. So wurde etwa die störungsspezifische Forschung enorm stimuliert: es stehen mittlerweile zum Beispiel für Angststörungen im Sinne des DSM-IV (APA, 1994) weit effektivere Behandlungsmethoden zur Verfügung als noch zu Zeiten der «Angstneurose», wobei sich heute Behandlungsstrategien und Interventionen für eine Panikstörung unterscheiden von denjenigen für die Generalisierte Angststörung; einer Sozialphobie liegen andere Störungs- und Behandlungsmodelle zugrunde als einer Tierphobie oder einer Blutphobie oder einer Trennungsangst etc.. 16 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen Andererseits erlaubte die Einführung operationalisierter Kriterien, mit denen psychische Störungen in den modernen Klassifikationssystemen definiert werden, dass die Größenordnung psychischer Störungen erstmals einigermaßen breit und verlässlich abgeschätzt werden konnte: die Entwicklung klinischer strukturierter oder standardisierter Interviews (z. B. DIS, Robins et al., 1981; CIDI, Robins et al., 1988, Wittchen et al., 1991; SCID) ermöglichte epidemiologische Studien, die nicht die unmittelbare Diagnostik bei einem Patienten zur Fallkonzeption, sondern die Fallfindung selbst zu Ziel haben. Auch wenn Reliabilität im allgemeinen als eine notwendige Bedingung für Validität betrachtet wird, und auch wenn es einige Befunde dazu gibt, dass standardisierte Diagnostik einem reinen klinischen Urteil bei der Fallfindung überlegen ist, soll hierbei nicht unerwähnt bleiben, dass insbesondere unter klinisch orientierten Kollegen der standardisierte, kriterienorientierte Ansatz im Sinne klassifikatorischer Diagnostik durchaus umstritten ist. Als Kritik wird z. B. angeführt, dass die klassische Kunst der Psychopathologie durch profanes Symptomzählen ersetzt würde, oder dass die unmittelbare Relevanz für die Behandlung durch diese Art von Diagnostik häufig nicht mehr gegeben sei (z. B. Brugha, Bebbington & Jenkins, 1999; Faravelli et al., in press) – ein halbstrukturiertes Vorgehen mit klinischer Urteilsbildung sei daher einem standardisierten Ansatz als gold standard vorzuziehen. Wittchen, Üstün und Kessler (1999) stellen dem gegenüber heraus, dass der theoretische Vorteil eines halbstandardisierten klinischen Ansatzes nur wenig empirisch unterfüttert ist und dass damit insbesondere in nicht-klinischen, großangelegten epidemiologischen Studien möglicherweise mehr Probleme geschaffen als gelöst werden. Eine Synthese beider Ansätze ist wahrscheinlich dann am meisten reliabel und valide, wenn ein obligatorisches standardisiertes Vorgehen im Sinne der internationalen Diagnosekriterien um offene Fragen und dimensionale Einschätzungen (z. B. zum Schweregrad von Symptomen oder zur Hierarchisierung von Syndromen) – möglichst durchgeführt von klinisch ausgebildeten Interviewern – ergänzt wird als umgekehrt. Der neben dem hier skizzierten Fortschritt durch moderne reliablere Diagnostik zweite notwendige Schritt, um sich der Frage «Was ist überhaupt ein Fall?» zu nähern, betrifft das Setting, in dem die Fallfindung stattfindet. Psychische Störungen wurden bis ins vergangene Jahrzehnt hinein hauptsächlich in klinischen Populationen im psychiatrischen und primärärztlichen Bereich gezählt und weitergehend untersucht. In Deutschland lagen bis zum 1998/99 durchgeführten Bundesgesundheitssurvey – Zusatzsurvey «Psychische Störungen» – auf Bundesebene nur äußerst eingeschränkt interpretierbare administrative Daten zur Häufigkeit einer eingeschränkten Anzahl psychischer Störungen «Diagnoseträger» und Patienten 17 vor (hauptsächlich Schizophrenie, Depression, Alkoholabhängigkeit und Suizid). Abgesehen vom allgemein wissenschaftlich eher zweifelhaften Wert solcher Statistiken muss man davon ausgehen, dass selbst wenn Diagnostik und Datenqualität valide gewesen wären, dieses Bild nur unvollständig sein kann. Goldberg & Huxley (1980) stellten erstmals heraus, dass Personen mit psychischen Störungen oft gar keine psychiatrische oder psychologische Hilfe aufsuchen. Fälle, die beim Spezialisten landen, sind daher nicht vollständig repräsentativ und für die Charakterisierung psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung nicht hinreichend geeignet. Die Antwort auf die Frage «Was ist also nun ein Fall?» sollte daher mehrere Personengruppen einschließen: • diejenigen mit der Diagnose einer oder mehrerer psychischen Störungen (DSM-IV), die beim Spezialisten Hilfe aufsuchen oder auf andere Art im Gesundheitssystem auffallen und registriert werden; • diejenigen, die psychiatrische oder psychologische Hilfe wegen psychischer Probleme aufsuchen, ohne die Kriterien für die Diagnose einer psychischen Störung zu erfüllen (sei es, weil nicht sorgfältig oder umfassend genug diagnostiziert wurde, oder weil auf diesen Einzelfall einfach keine Diagnose vollständig passt); • sowie diejenigen mit der Diagnose einer oder mehrerer psychischen Störungen (DSM-IV), die nicht auffallen (sei es, weil sie niemals Hilfe deswegen aufsuchen, oder sei es weil sie, z. B. beim Hausarzt, nicht erkannt werden). 2. Die Bedeutsamkeit reliabler Fallfindung in der Epidemiologie Eine Person, die wegen psychischer Probleme einen Spezialisten aufsucht, wird wohl eher selten abgewiesen, nur weil sie die falsche Symptomkonstellation für eine DSM-IV-Diagnose aufweist, d. h. im klinischen Setting ist die Frage der Fallfindung nicht so bedeutsam wie in der epidemiologischen Forschung. In großen epidemiologischen Studien in der Allgemeinbevölkerung wie der Early Developemental Stages of Psychopathology (EDSP; Wittchen et al., 1998; Lieb et al., 2000) oder dem bereits erwähnten Zusatzsurvey «Psychische Störungen», der im Rahmen des letzten Bundesgesundheitssurvey durchgeführt wurde (Wittchen & Jacobi, 2001; Jacobi et al., 2002; Jacobi et al., 2004) ist die mög- 18 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen lichst umfassende reliable Erfassung und Verrechnung von Symptomkonstellationen und Diagnosen hingegen unerlässlich, wenn (verschieden von klinischer Praxis) durch eine Makro-Perspektive und der Aggregation von mehr oder weniger eingehend beobachteten Einzelfällen folgende Arten von Fragestellungen untersucht werden: 2.1 Gesundheitsberichterstattung Wir finden es bemerkenswert, dass nun auf Grundlage des Bundesgesundheitssurveys erstmals repräsentative Daten psychischer Störungen für die erwachsene Bevölkerung vorliegen. Damit haben bereits die reinen Prävalenzzahlen einen gesundheitsberichterstatterischen Wert per se und gehen über reines «Erbsen zählen» hinaus. Die Größenordnung psychischer Störungen (über 30% der 1865jährigen in der Allgemeinbevölkerung erhalten (mindestens) eine 12-MonatsDiagnose!), verbunden mit den dadurch entstehenden individuellen Belastungen und gesellschaftlichen Kosten sollte – wissenschaftlich korrekt – nicht zuletzt deswegen besonders herausgestellt werden, um die Allokation von Ressourcen für die Versorgung und die Versorgungsforschung, aber auch für die klinischpsychologische Forschung und Ausbildung positiv zu beeinflussen. Zudem kann man, wie im Pharmabereich bereits vorexerziert, durch die Schaffung von awareness Erkennens- und Behandlungsraten bei psychischen Störungen steigern. Dies nützt nicht nur Psychiatern und Psychotherapeuten als Anbietern, sondern es darf auch von einem gesamtgesellschaftlichen Nettonutzen ausgegangen werden. 2.2 Beitrag zu psychopathologischem Verständnis und diagnostischer Methoden Die psychologische Störungs-Diagnostik hat zwar in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte zu verzeichnen, ist aber selbst ständiger Gegenstand weiterer Forschung. Wichtige Themen sind die Optimierung diagnostischer Kriterien und deren Erfassung (z. B. Ein- und Ausschlusskriterien bei Komorbidität, oder populationsbezogene thresholds, z. B. geschlechtsspezifisch oder über verschiedene (Sub-) Kulturen hinweg), verstärkte Ergänzung kategorialer Bewertungen um dimensionale Einschätzungen (Wittchen, in press), Minimierung von Artefakten wie z. B. Unterschätzung psychischer Störungen aufgrund von Nicht-Berichten von Symptomen, sozialer Erwünschtheit (Ref.) «Diagnoseträger» und Patienten 19 etc.). Hierbei kann epidemiologische Forschung übrigens auch der klinischen Praxis nützen, etwa wenn diagnostische Instrumente in einer repräsentativen Stichprobe validiert und normiert werden. 2.3 Testen von Hypothesen, die in kleineren klinischen Studien und anderen Settings entwickelt wurden Oftmals werden in Studien aus klinischen Settings Zusammenhänge beobachtet, bei denen es lohnenswert erscheint, diese nochmals in einer repräsentativen Stichprobe zu replizieren, um das Verständnis dieses Zusammenhangs zu vertiefen. Gerade bei der Beforschung des gemeinsamen Auftretens von körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen ist es z. B. interessant, ob eine im Allgemeinkrankenhaus gefundene hohe Komorbidität auf einem «wahren», allgemein erhöhten gemeinsamen Auftreten oder eher auf einem help seeking bias beruht. Beispielhafte Studien in Kollaboration mit dem Bundesgesundheitssurvey, die nur dadurch möglich waren, weil jeweils eine hinreichend ähnliche standardisierte Diagnostik psychischer Störungen betrieben wurde, betreffen Zusammenhänge von psychischen Störungen und Asthma (Goodwin, Jacobi & Thefeld, 2003), Diabetes (Petrak et al., 2003), oder muskuloskelettalen und kardiovaskulären Erkrankungen (Baumeister et al., in press). Auch für Untersuchungen aus dem Bereich der Arbeitspsychologie über Zusammenhänge von Arbeitsbedingungen und psychischen Störungen ist eine nachvollziehbare, reliable Fallfindung unerlässlich. 2.4 Beiträge zum ätiologischem Verständnis psychischer Störungen Eine epidemiologische Königsdisziplin ist die Erforschung ätiologischer Mechanismen. Im Rahmen einer längsschnittlichen Studie mit mehreren Erhebungswellen müssen dabei insbesondere auch die Reliabilität der um Jahre auseinander liegenden diagnostischen Befragungen der Probanden sichergestellt und der Einsatz adäquater Instrumente langfristig geplant werden. Beispielhafte Studien aus dem oben erwähnten EDSP-Projekt belegen z. B. einen spezifischen Einfluss von Rauchen auf Panik (Isensee et al., 2003), oder nicht nur eine erhöhte Prävalenz von psychischen Störungen bei Kindern von Depressiven, sondern auch einen ungünstigeren Verlauf (Lieb et al., 2002). 20 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen 3. Epidemiologie behandelter und unbehandelter psychischer Störungen in Deutschland Im Folgenden sollen schlaglichtartig drei zentrale Ergebnisse des Bundesgesundheitssurvey 1998/99 berichtet werden. Design und Methoden des Forschungsprojekts sind andernorts ausführlich dargestellt (Jacobi et al., 2002). Zusammenfassend sei hier erwähnt, dass es sich um eine repräsentative Stichprobe der deutschen 18-65jährigen handelt (N=4181), bei denen Substanzstörungen, mögliche psychotische Störungen, affektive Störungen, Angststörungen, somatoforme Störungen, sowie Essstörungen mittels des M-CIDI (DIA-X; Wittchen & Pfister, 1997) erhoben wurden. Der Datensatz kann übrigens beim Erstautor als Public Use File für weitere eigene Auswertungen bezogen werden (vgl. Jacobi, 2003). 3.1. Psychische Störungen sind häufig! Etwa 20% der Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren erfüllen die Kriterien für mindestens eine psychische Störung (DSM-IV) in den vergangenen vier Wochen; die 12-Monats-Prävalenz beträgt etwa 31% und die Lebenszeit-Prävalenz etwa 43% (Jacobi et al., 2004). Die häufigste Störungsgruppe bilden die Angststörungen (12-Monats-Prävalenz Frauen: 20%, Männer 9%), gefolgt von depressiven Störungen (12-Monats-Prävalenz Frauen: 14%, Männer 8%), somatoformen Störungen (12-Monats-Prävalenz Frauen: 15%, Männer 7%) und substanzbezogenen Störungen (12-Monats-Prävalenz Frauen: 2%, Männer 7%). Nur 60% der Fälle haben nur eine Diagnose; etwa 10% erfüllen die Kriterien für vier oder mehr Diagnosen. In Tabelle 1 (entnommen aus Bijl et al., 2003) sind zum Vergleich neben den deutschen Daten auch diejenigen aus vergleichbaren Studien aus Canada, Chile, den Niederlanden und den USA aufgeführt (WHO, International Consortium of Psychiatric Epidemiology). Aus Gründen der Vergleichbarkeit über alle Studien hinweg betreffen die Zahlen dort nur die 18-54jährigen (für Deutschland: N=3219) und sind niedriger, weil nur die affektiven, Angst- und Substanzstörungen einbezogen wurden; zudem wurden nicht alle Angstdiagnosen berücksichtigt, die im Bundesgesundheitssurvey erfasst wurden. Trotz dieses «Diagnoseträger» und Patienten 21 reduzierten Diagnosespektrums liegt die 12-Monats-Prävalenz immer noch bei 23% und nimmt damit einen mittleren Platz ein (Chile: 17% bis USA: 29%). Bezüglich des Schweregrades nehmen Bijl et al. (2003) eine grobe Einteilung vor, indem alle Unterdiagnosen einen Punktwert von 1 (z. B. spezifische Phobie) und 4 (z. B. Manie) erhalten und die Probanden darauf hin gemäß aller ihrer einzelnen Diagnosen (bei Komorbidität aufsummiert) in noncases (keine Diagnose), mild (1-2 Punkte), moderate (3-4 Punkte) und serious (5-20 Punkte) eingeteilt werden. Eine solche zusätzliche Unterteilung macht insofern Sinn, als dass es in der Tat große Unterschiede innerhalb aller Fälle (im Sinne von: denjenigen mit mindestens einer Diagnose) hinsichtlich Rollenbeeinträchtigung und anderer Schweregrads-Kriterien gibt. Auch hier nimmt Deutschland mit 5.4% schwerer Fälle einen mittleren Platz ein (Chile: 3.3% bis USA: 8.2%). Aus diesen Zahlen wird einerseits ersichtlich, dass «die» Prävalenz so nicht existiert, sondern dass es sehr wichtig ist, Zeitraum, Altersgruppe, einbezogene Störungen, Hierarchien (Beispiel: ab wann wird eine komorbide Dysthymie nicht mehr mitgezählt?) und gegebenenfalls einen – wie auch immer definierten – Schweregrad vollständig darzustellen. Andererseits kann für Deutschland festgehalten werden, dass ein substanzieller Anteil der Bevölkerung auch bei sehr restriktiver Fallfindung von psychischen Störungen betroffen ist (z. B. moderate oder severe Diagnosen im obigen Sinne allein aus dem Bereich der Angst-, depressiven und Substanzstörungen im letzten Jahr bei über 10%; zum Vergleich (ebenfalls 18-54jährige): Diabetes und koronare Erkrankungen: je ca. 1%, Bluthochdruck: ca. 7%, muskulo-skelletale Erkrankungen: ca. 18%). 3.2 Psychische Störungen werden selten behandelt! Eben dargestellte Ergebnisse beziehen sich auf die Häufigkeit psychischer Störungen gemäß DSM-IV- Kriterien, erfasst mit einem standardisierten klinischen Interview (CIDI). Entsprechend der eingangs angestellten Überlegungen macht es einen Unterschied, ob man diese Gesamtgruppe, oder nur diejenigen, die auch Behandlung aufsuchen als «Fälle» betrachtet, oder ob man auch diejenigen hinzurechnen soll, die Behandlung aufsuchen, obwohl sie nicht in das untersuchte DSM-IV-Spektrum fallen. Weniger als 40% derjenigen mit einer Diagnose berichteten, auch irgendwann einmal in ihrem Leben eine im weitesten Sinne psychiatrische oder psychosoziale Behandlung gehabt zu haben (Wittchen & Jacobi, 2001). Die Behandlungsquoten hingen dabei erwartungsgemäß stark von der Art der Störung, sowie vor allem vom Grad der Komorbidität ab (Jacobi et al., 2004). 22 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen Zusammenfassend: Deutschland hatte 1999 insgesamt etwa 43% erwachsene «Diagnoseträger» (Lebenszeit-Prävalenz mindestens einer der im Bundesgesundheitssurvey erfassten Diagnosen; 12-Monats-Prävalenz: 31%), davon über 60% ohne jegliche Behandlung. Von den insgesamt etwa 22% «Patienten», die jemals zumindest eine minimale, im weitesten Sinne psychiatrische oder psychosoziale Behandlung erhielten, hatten ca. 26% keine Lebenszeit-Diagnose und ca. 43% keine 12-Monats-Diagnose aufzuweisen. Tabelle 2, ebenfalls entnommen aus Bijl et al. (2003), listet die Behandlungsquoten wieder im internationalen Vergleich, sowie nach Schweregrad und Anteil der Fachbehandlungen auf. Es fällt auf, dass Deutschland (20%) zusammen mit Chile (17%) einen Spitzenplatz einnimmt, was die Prävalenz von im weitesten Sinne psychiatrischer oder psychosozialer Behandlung insgesamt betrifft (d. h. einschließlich derer, die auch ohne Diagnose eine Behandlung berichteten). Dieser Spitzenplatz kommt vor allem durch vergleichsweise häufige Behandlungen bei noncases (Deutschland: 14%) und mild cases (Deutschland: 30%) zustande, aber auch bei den serious cases liegt Deutschland (zusammen mit den Niederlanden) vorne (67%). Während in den anderen Ländern etwa jeder zweite mit einer Behandlung eine Fachbehandlung angibt (psychiatrische oder psychologische Einrichtung vs. primärärztlicher oder komplementärer Sektor), sind es in Deutschland etwa 70%. Der untere Teil der Tabelle 2 verdeutlicht, dass im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland unter denen mit einer Behandlung (aufgrund psychischer Probleme im weitesten Sinne) kein Zusammenhang zwischen Schweregrad und Fachbehandlung zu finden ist. 3.3 (Aktive) Psychische Störungen gehen mit hohen gesellschaftlichen Kosten einher! Dass psychische Störungen «teure» Störungen sind, ist spätestens seit der WHOStudie zum burden-of-disease (Murray & Lopez, 1996) weitgehend bekannt. Dort wurden die Kosten, bei denen die Depression einen vorderen Rangplatz unter allen Krankheiten einnimmt, jedoch nicht anhand «harter» Daten (z. B. direkte Kosten durch Behandlungen oder indirekte Kosten durch Produktivitätsminderung) ermittelt, sondern anhand von Schätzungen aufgrund expertengestützter Schweregrad-Indizes (z. B. quality adjusted life years). Versorgungspolitisch besonders interessant sind aber monetär bewertbare Analysen. «Diagnoseträger» und Patienten 23 Indirekte Kosten auf repräsentativer Basis können nun ebenfalls erstmals für Deutschland anhand des Bundesgesundheitssurveys abgeschätzt werden. Abbildung 1: Abb. 1: Ausfalltage bei aktuellen und remittierten psychischen Störungen Ausfalltage 25 20 15 10 5 0 niemals psychische remittierte psychische aktuelle psychische Störung gehabt Störung Störung (12-Monate) Abbildung 1 (Jacobi & Zoike, 2003) liefert dazu zwei wichtige Befunde. Erstens berichten Personen mit der 12-Monats-Diagnose einer psychischen Störung doppelt so viele Ausfalltage («An wievielen Tagen waren Sie in den vergangenen 12 Monaten so krank, dass Sie Ihrer üblichen Tätigkeit nicht nachgehen konnten?») verglichen mit Personen, die niemals die Diagnose einer psychischen Störung erhielten. Zweitens weisen remittierte Fälle (d. h. Lebenszeitdiagnose, aber keine 12-Monats-Diagnose) die gleiche Anzahl von Ausfalltagen auf wie Personen ohne Lebenszeitdiagnose. Hierbei muss allerdings angemerkt werden, dass über die Krankheitsverläufe und die Ursache von Remissionen (Behandlung vs. «spontan») in dieser querschnittlichen Untersuchung nur sehr eingeschränkte Aussagen gemacht werden können. Dennoch finden sich derartige Ergebnisse auch in Psychotherapiestudien, in denen die Kosten psychischer Störungen vor und nach psychotherapeutischer Behandlung verglichen wurden (Baltensperger & Grawe, 2001; Hiller, Fichter & Rief, 2003; Jacobi, 2002). Psychische Störungen gelten heute als gut behandelbar. Insbesondere aufgrund des zweiten Ergebnisses, dass remittierte psychische Störungen keine erhöhten Ausfalltage mehr produzieren, sollte unter gesundheitsökonomischer Perspektive das Erkennen und Behandeln psychischer Störungen bei der Allokation von Ressourcen im Gesundheitssystem mehr beachtet werden. 24 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen 4. Schwierigkeiten und Auffälligkeiten: MakroPerspektive vs. individuelles Leiden Im vorliegenden Beitrag wurde ausgehend von der Frage «Was ist überhaupt ein Fall?» beispielhaft aus epidemiologischer Perspektive dargestellt, dass psychische Störungen häufig sind, häufig nicht behandelt werden und mit hohen indirekten gesellschaftlichen Kosten einhergehen (wenn aktuell mindestens eine Diagnose nach DSM-IV vorliegt). Um Aussagen dieser Art legitim zu formulieren, sind repräsentative Studien in der Gesamtbevölkerung mit einer umfassenden, reliablen und transparenten Diagnostik von «Fällen» eine notwendige Bedingung. Natürlich kann die Diagnostik psychischer Störungen im klinischen Kontext dabei nicht stehen bleiben. Umfassende Verhaltens-, Problem- und Zielanalysen, sowie dimensionale, am klinisch geschulten Blick vorgenommene Einschätzungen, Fragebogendaten und nicht standardisierte Problemschilderungen sind selbstverständlich in der Therapieplanung ebenso notwendig wie die hier fokussierte Störungsdiagnostik im klassifikatorischen Sinne – denn die Bedeutung von Symptomen, Schwierigkeiten und Auffälligkeiten ist auch bei Menschen mit gleichen Diagnosen oft sehr verschieden. Literatur American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition. Washington, DC: American Psychiatric Press. Baltensperger, C. & Grawe, K. (2001). Psychotherapie unter gesundheitsökonomischem Aspekt. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 30 (1), 10-21. Baumeister, H., Höfler, M., Jacobi, F., Wittchen, H.U., Bengel, J. & Härter, M. (im Druck). Psychische Störungen bei Patienten mit muskuloskelettalen und kardiovaskulären Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. Bijl, R. V., de Graaf, R., Hiripi, E., Kessler, R. C., Kohn, R., Offord, D. R., Üstün, T. B., Vicente, B., Vollebergh, W. A. M., Walters, E. E., & Wittchen, H.-U. (2003). The Prevalence Of Treated And Untreated Mental Disorders In Five Countries. Health Affairs, 22(3), 122-133. Brugha, T., Bebbington, P. E., & Jenkins, R. (1999). A difference that matters: comparisons of structured and semi-structured psychiatric diagnostic interviews in the general population (editorial). Psychological Medicine, 29, 1013-1020. Faravelli, C., Abrari, L., Bartolozzi, D., Cecchi, C., D' Adamo, D., Lo Iacono, B., Ravaldi, C., Scarpato, M. A., Truglia, E., & Rosi, S. (in press). The Sesto Fiorentino Study: background, methods and preliminary results. Lifetime prevalence of psychi- «Diagnoseträger» und Patienten 25 atric disorders in an Italian community sample using clinical interviewers. Psychotherapy and Psychosomatics. Goldberg, D., & Huxley, P. (1980). Mental illness in the community: the pathway to psychiatric care. London: Tavistock. Goodwin, R., Jacobi, F. & Thefeld, W. (2003). Mental disorders and asthma in the community. Archives of General Psychiatry,60, 1125-1130. Hiller, W., Fichter, M.M., Rief, W. (2003). A controlled treatment study of somatoform disorders including analysis of health care utilization and cost-effectiveness. Journal of Psychosomatic Research, 54, 369-380. Isensee, B., Wittchen, H.-U., Stein, M. B., Höfler, M., & Lieb, R. (2003). Smoking increases the risk of panic. Findings from a prospektive community study. Archives of General Psychiatry, 60(7), 692-700. Jacobi, F. (2003). Public Use Files als Perspektive für die klinisch-psychologische Forschung. In R. Ott & C. Eichenberg (Hrsg.), Klinische Psychologie und Internet, 367380. Göttingen: Hogrefe. Jacobi, F. (2002). Kosten-Effektivitäts- und Kosten-Nutzen-Analyse psychologischer Angstbehandlung. Hochschul-Schriften-Server der SLUB Dresden: http://hsss.slubdresden.de/hsss/servlet/hsss. urlmapping.MappingServlet?id=1024939677062-1825. Jacobi, F., Wittchen, H.-U., Müller, N., Hölting, C., Sommer, S., Höfler, M., & Pfister, H. (2002). Estimating the prevalence of mental and somatic disorders in the community: Aims and methods of the German National Health Interview and Examination Survey. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 11 (1), 1-19. Jacobi, F., Wittchen, H.-U., Hölting, C., Höfler, Müller, N., M., & Pfister, H. & Lieb, R. (2004). Prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in the general population: Results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychological Medicine. Jacobi, F. & Zoike, K. (2003). Die gesellschaftlichen Kosten durch Ausfalltage bei psychischen Störungen. Poster auf dem Kongress «Psychosoziale Versorgung in der Medizin» in Hamburg vom 28.09. - 30.09.2003. Lieb, R., Isensee, B., von Sydow, K., & Wittchen, H.-U. (2000). The Early Developmental Stages of Psychopathology Study (EDSP): A methodological update. European Addiction Research, 6(4), 170-182. Lieb, R., Isensee, B., Höfler, M., Pfister, H., & Wittchen, H.-U. (2002). Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring. A prospective-longitudinal community study. Archives of General Psychiatry, 59(4), 365-374. Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (Eds.) (1996). The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability for diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Geneva: World Health Organization. Petrak, F., Hardt, J., Wittchen, H.-U., Kulzer, B., Hirsch, A., Hentzelt, F., Juhrsch, K., Jacobi, F., Egle, U. T., & Hoffman, S. O. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in an onset cohort of adults with type 1 diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 19(3), 16-22. Robins, L. N., Helzer, J. E., Croughan, J. & Ratcliff, K.S. (1981). National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule: its history, characteristics and validity. Archives of General Psychiatry, 38, 381-389. Robins, L. N., Wing, J., Wittchen, H.-U., Helzer, J. E., Babor, T. F., Burke, J., Farmer, A., Jablenski, A., Pickens, R., Regier, D. A., Sartorius, N., & Towle, L. H. (1988). The Composite International Diagnostic Interview: An epidemiological instrument 26 Frank Jacobi & Hans Ulrich Wittchen suitable for use in conjunction with different diagnostic systems and in different cultures. Archives of General Psychiatry, 45, 1069-1077. Wittchen, H.-U., & Jacobi, F. (2001). Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland. Eine klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundesgesundheitssurveys 1998. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 44(10), 993-1000. Wittchen, H. U., Nelson, C. B., & Lachner, G. (1998). Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. Psychological Medicine, 28, 109-126. Wittchen, H. U., & Pfister, H., editors. (1997). Manual und Durchführungsbeschreibung des DIA-X/M-CIDI. (Manual of DIA-X/M-CIDI). Frankfurt: Swets & Zeitlinger. Wittchen, H.-U., Üstün, T. B., & Kessler, R. C. (1999). Diagnosing mental disorders in the community. A difference that matters? Editorial. Psychological Medicine, 29(5), 1021-1027. World Health Organization. (1993). Tenth revision of the international classification of diseases, Chapter V (F): Mental and behavioral disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneve: World Health Organization. Tabelle 1: 12-Monats-Prävalenz von affektiven, Angst- und Substanzstörungen in fünf Ländern (Bijl et al., 2003) Deutschland (N=3,219) % SE I. Störung (DSM-IV) affektive Störung Angststörung Substanzstörung irgendeine Störung Canada (N=6,320) % SE Chile (N=2,181) % SE Niederlande (N=6,030) % SE USA (N=5,384) % SE 11.9 11.9 5.2 22.8 0.5 0.5 0.5 0.7 4.9 12.4 7.9 19.9 0.5 0.6 0.5 0.8 9.0 5.0 6.6 17.0 1.3 1.3 0.9 1.8 8.2 13.2 9.9 24.4 0.5 0.7 0.5 1.0 10.7 17.0 11.5 29.1 0.6 0.6 0.5 0.7 77.2 10.8 6.6 5.4 0.7 0.6 0.4 0.3 80.1 12.4 3.6 3.9 0.8 0.6 0.4 0.4 83.0 8.1 5.5 3.3 1.8 1.1 0.8 0.6 75.6 14.1 4.2 6.1 1.0 0.6 0.3 0.3 70.9 13.8 7.0 8.2 0.7 0.4 0.4 0.5 II. Schweregrad keine Diagnose leicht mittel schwer Quelle: World Health Organization, International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Master Data File Tabelle 2: Beziehungen zwischen Schweregrad und Behandlung psychischer Störungen in fünf Ländern (Bijl et al., 2003) Deutschland % SE Canada % SE Chile % SE Niederlande % SE USA % SE I. Anteil derjenigen, die jemals irgendeine Behandlung erhielten keine Diagnose leicht mittel schwer gesamt 14.1 29.6 38.7 67.0 20.2 0.8 1.6 3.3 3.0 0.8 3.4 10.4 27.7 52.3 7.0 0.4 1.7 4.7 5.1 0.5 14.4 12.3 50.2 47.9 17.3 1.1 2.7 6.3 8.0 1.2 7.6 13.3 43.0 66.3 13.4 0.4 1.2 3.4 2.6 0.5 6.3 11.3 26.3 37.1 10.9 0.4 1.4 3.2 2.3 0.5 II. Behandlung beim Spezialisten (unter denjenigen mit irgendeiner Behandlung) keine Diagnose leicht mittel schwer gesamt 65.4 74.5 68.2 79.8 69.8 2.5 3.7 4.1 3.0 1.7 46.8 40.6 50.8 61.6 50.6 4.9 6.6 7.7 8.5 3.7 34.5 16.4 48.2 44.6 36.5 7.2 8.7 13.9 7.7 4.9 43.2 41.4 47.3 60.0 48.5 2.4 4.9 4.6 3.2 1.6 42.3 46.3 50.6 62.9 50.0 4.9 6.2 4.6 3.2 2.8 Quelle: World Health Organization, International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Master Data File