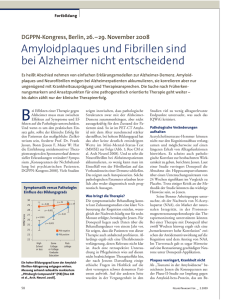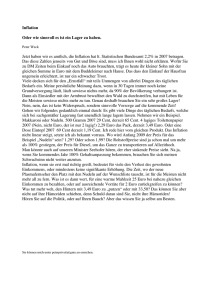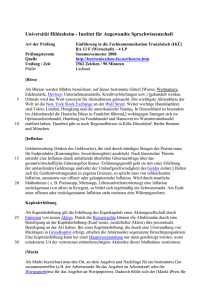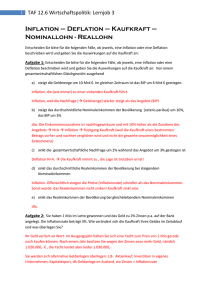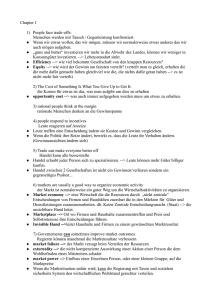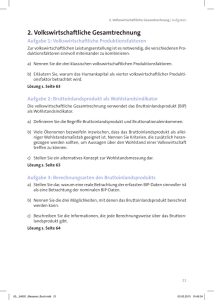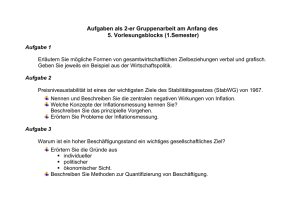Prof. Dr. Peter Bofinger Professor für Volkswirtschaftslehre im
Werbung

BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 28.05.1998 Prof. Dr. Peter Bofinger Professor für Volkswirtschaftslehre im Gespräch mit Klaus-Joachim Jenssen Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Ich begrüße Sie bei Alpha-Forum, verehrte Zuschauer, unser Gast ist heute Professor Peter Bofinger, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. Er ist dies schon seit 1992 - eine schon relativ lange Zeit, wenn man bedenkt, daß Professor Bofinger erst 43 Jahre alt ist. Er ist am 18. September 1954 in Pforzheim geboren. Sie waren dann im Saarland zum Studieren - warum eigentlich ausgerechnet im Saarland? Ja, das war eigentlich Zufall. Ich wollte ursprünglich in Mannheim studieren, aber in dem Jahr, in dem ich in Mannheim mein Studium beginnen wollte, wurde dort der Numerus Clausus neu eingeführt. Und alle, die nicht bei der Bundeswehr waren, kamen einfach nicht zum Zug. So bin ich in Saarbrücken gelandet. Sie sind aber zweifellos nicht Ghostwriter von Oscar Lafontaine. Nein, das bin ich nicht, aber er ist ein guter Bekannter von mir. Neigen Sie in der Wirtschaftspolitik eher zur Richtung der Sozialdemokraten, oder würden Sie deren Wirtschaftspolitik nicht unterschreiben wollen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Meine Spezialität ist ja die Währungspolitik, in anderen Fragen der Wirtschaftspolitik tendiere ich eher zu einer mittleren Linie. Ich denke, daß vieles, was die CDU macht, sehr vernünftig ist, ich denke, daß auch einiges, was die SPD macht, vernünftig ist. Aber ich habe mich bisher parteipolitisch noch nicht festgelegt. Das Geld, die Geldpolitik und speziell das europäische Währungssystem beschäftigt Sie ja bereits seit Ihrer Studienzeit in Saarbrücken. Was fasziniert Sie eigentlich an dieser Thematik? Ich denke, daß es deshalb eine spannende Thematik ist, weil sehr viel passiert: Es ist ein Gebiet, in dem sich eigentlich ständig die Daten ändern, in dem ständig neue Ereignisse eintreten und in dem vieles in Bewegung ist. Als ich mich damit zum ersten Mal befaßt habe, das war Mitte der siebziger Jahre, hätte ich gar nicht gedacht, wie faszinierend und spannend diese Thematik ist. Aber Sie haben Saarbrücken ja schon angesprochen: Ich hatte damals in Saarbrücken die Möglichkeit, mit einem Professor zusammenarbeiten, der eine faszinierende Art hatte und dessen Hauptgebiet genau die Fragen der Währungspolitik und der Währungstheorie waren. Dieser Professor hat mich eigentlich für das Thema begeistert. Ich muß sagen, daß ich bis heute nicht bereut habe, mich darauf eingelassen zu haben. Sie sind dort richtiggehend infiziert worden. Vielleicht war das auch die Internationalität von Saarbrücken, die das befördert hat, denn Frankreich ist doch ziemlich nahe. Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Das kann man sagen. Dieses deutsch-französische Zusammenleben, das in Saarbrücken ja sehr deutlich ausgeprägt ist, hat mich sicher auch inspiriert, und es war damals die Fakultät in Saarbrücken ein sehr lebhafter Platz, an dem viele qualifizierte Ökonomen gearbeitet haben. Ich denke, es war sehr gut, daß ich dort studieren konnte. Sie sind ja mitten im Wirtschaftswunder geboren, zu einer Zeit, in der Ludwig Erhard Wirtschaftsminister gewesen ist und zusammen mit Finanzminister Schäffer der D-Mark Weltgeltung verschafft hat. Damals hat der Dollar 4,20 DM gekostet, wenn ich mich richtig erinnere, das britische Pfund am Anfang sogar 16 DM und später dann 13 bis 14 DM. Die Währungen waren noch an das Gold gebunden, es gab überhaupt feste Wechselkurse. Die italienische Lira gehörte zu den stabilsten Währungen der Welt. Das war also eine völlig andere Zeit. 1954 war die D-Mark gerade einmal sechs Jahre alt. Bedauern Sie gar nicht, daß die D-Mark mit 50 Jahren buchstäblich zum alten Eisen geworfen wird? Man sieht das ja oft falsch, wenn man sagt, die D-Mark wird verkauft oder sie wird beerdigt oder begraben - es gab da im ZDF diese Sendung ”Mordfall D-Mark”. Ich denke, das ist eine falsche Sicht. Denn worum es wirklich geht, ist ja, daß diese Währungsordnung, die sich in Deutschland gerade in der Phase des Wirtschaftswunders bewährt hat, auf Europa ausgedehnt wird. Es geht ja darum, daß die Prinzipien, die wir für richtig befunden und die sich bei uns bewährt haben, auch von den anderen Ländern übernommen werden, und daß diese Länder erkannt haben, daß dies eine Art ist, wie man eine Geldpolitik gestalten kann, die erfolgreich ist und auch Wachstum sichert. Und das wird jetzt europaweit gemacht. Deswegen ist es eigentlich kein Abschied oder kein In-Ruhestand-Gehen der D-Mark, sondern man könnte sagen, daß das, was wir als deutsche Währungsordnung haben, nun europäische Aufgaben wahrnimmt. Die D-Mark wird also sozusagen nur in Euro umbenannt? Sozusagen. Und hat jetzt einfach ein größeres Aufgabengebiet. Nun gibt es ja 154 Professoren, die nach wie vor heftigst gegen den Euro eintreten. Das sind Wirtschaftsprofessoren - und die sollten wohl genug über die ganzen Hintergründe wissen. Auf der anderen Seite haben Sie 54 Professoren pro Euro aktivieren können. Es ist schon auffällig, daß da zwei so leidenschaftliche Schulen aufeinanderprallen. Sind Sie ein EuRomantiker? Wissen Sie, das mit dem Euro ist vielleicht so ähnlich, wie wenn man ein Arzneimittel beurteilt: Nehmen Sie das Beispiel Aspirin, das ist ein gutes Mittel gegen Kopfschmerzen. Es hat aber auch Risiken und Nebenwirkungen. Und die Frage ist jetzt, wenn Sie es beurteilen: Konzentrieren Sie sich auf die Wirkungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreffen, oder nehmen Sie den Beipackzettel und lesen Sie das, was unter Risiken und Nebenwirkungen steht? Das heißt, Sie sagen, es gibt Magenblutung und was sonst noch alles an Schrecklichem bei Aspirin auftreten kann. Ich habe ein wenig den Eindruck, daß in der Diskussion um den Euro, auch wie sie teilweise von meinen Kollegen geführt wird, eigentlich fast nur die Risiken und Nebenwirkungen gelesen und in der Öffentlichkeit verbreitet werden, dagegen aber nicht gesagt wird, wofür dieses Ding eigentlich nützlich ist. Dadurch bekommt die Diskussion auch eine erhebliche Schieflage. Das heißt, meine Kollegen haben nicht unrecht so wie eben ein Arzt, der seinem Patienten sagt, wenn du Aspirin nimmst, dann kannst du Magenblutung bekommen. Aber es ist nicht besonders wahrscheinlich und auch nicht die Hauptwirkung, die dieses Medikament hat. Sie sind ja vom ”Spiegel” buchstäblich als Euro-”fighter” und von der ”Zeit” als Häretiker bezeichnet worden. Auf solche merkwürdigen Beinamen habe Bofinger: Jessen: Bofinger: ich soeben angespielt mit dem Wort EuRomantiker. Auf der anderen Seite habe ich mir einmal Ihre Thesen in den verschiedenen Veröffentlichungen genauer angesehen: Ich habe den Eindruck, daß Sie gar nicht so vorbehaltlos für den Euro sind. Sie sagen, wir müssen die MaastrichtKriterien noch einmal überdenken, wir müssen den Vertrag auch fortschreiben, wir müssen da noch einiges ergänzen. Sie sind also nicht bedingungslos auf der Seite derer, die diesen Vertrag damals gemacht haben. Nein, nein. Ich denke, daß man durch die etwas panikartige Diskussion, die man in Deutschland führt, den Blick dafür verliert, was man an vernünftigen Regelungen noch im Rahmen des Vertrages von Maastricht machen könnte. Eine Idee, für die ich seit einiger Zeit werbe, ist, daß man ähnlich dem Stabilitäts- und Wachstumspakt einen Pakt schafft, der die Länder verpflichtet, ihre Staatsverschuldung nicht nur kurzfristig, sondern überwiegend langfristig zu machen. Das ist ja eine ganz wichtige Maßnahme, um die europäische Geldpolitik vor der Fiskalpolitik zu schützen. Ich habe noch weitere Ideen entwickelt, die ebenfalls in der Diskussion nur sehr schwer zu vermitteln sind: daß man z. B. in der Bankenaufsicht die Staatsschulden ähnlich behandeln sollte wie die privaten Schulden, d. h., daß die Banken verpflichtet werden, Vorkehrungen zu treffen, daß sie dann, wenn sie einen hohen Bestand an Staatskrediten haben, entsprechend Eigenkapital zur Verfügung stellen oder ihre Kredite diversifizieren. Das wäre auch eine ganz wichtige Maßnahme aus meiner Sicht, daß man von privater Seite aus Grenzen für die Staatsverschuldung aufbauen würde. Aber es ist sehr schwierig, das in der Diskussion in Deutschland zu vermitteln, weil man einfach ganz extrem auf die sechzig Prozent- oder auf die drei Prozent-Marke fixiert ist und man dabei einfach aus den Augen verliert, was man eigentlich an vernünftigen Dingen noch tun könnte. Nun ist in der Diskussion über die elf Teilnehmerstaaten deutlich geworden, daß man bei zwei Teilnehmerstaaten doch ziemliche Bauchschmerzen bekommen kann: Italiener und Belgier haben eben doppelt so hohe Staatsschulden, wie sie eigentlich haben sollten. Ich habe nachgelesen, daß Belgien jährlich zwei Prozent Überschuß - und das 10 Jahre lang erwirtschaften müßte, dann wäre das Land aus dem Gröbsten heraus, ohne daß es schon auf plus minus null wäre. Letztes Jahr aber wies Belgien ein Defizit von 2,1 Prozent auf - gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Bei Italien lauten die Zahlen: 3,1 Prozent Überschuß bis ins Jahr 2007, um die Schulden abzubauen. Das Defizit aber beträgt 2,5 Prozent, und seit 1993 hat Italien nur 2,5 Prozent Schuldenabbau geschafft, sagen die Statistiker und dabei sind schon einige Sondermaßnahmen mit berücksichtigt, die man nicht jedes Jahr ergreifen kann. Man kann nicht andauernd staatliche Firmen privatisieren, denn irgendwann gibt es keine staatlichen Firmen mehr. Ist diese Gegenüberstellung, die ich aus den Zahlen herausgearbeitet habe, nicht doch ein alarmierendes Zeichen? Es ist so, daß der Schuldenstand nur einer von fünf Indikatoren ist. Wir haben in diesem Fall vier Indikatoren, die sehr ordentlich aussehen. Gerade bei der Inflationsrate, die ja für die Sparer und für die Bevölkerung das Wichtigste ist, haben alle Länder ganz hervorragende Ergebnisse. Das sollte man vielleicht zuerst einmal sehen, denn man übersieht - um noch einmal auf das Thema Risiken und Nebenwirkungen zurückzukommen die großen Stabilitätserfolge, die alle Länder erzielt haben und die noch vor einigen Jahren niemand für wahrscheinlich gehalten hätte. Das wird fast übersehen, indem man direkt auf den einzelnen Indikator springt, der nicht so gut aussieht. Aber auch da muß man sich die Sache genau ansehen. Warum hat Italien seinen Schuldenstand nicht zurückgeschraubt? Das ist eine Frage, die man sich stellen muß: Woran liegt das eigentlich? Haben die Italiener das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen, oder Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: wo kommt dieses Problem her? Man kann zunächst einmal sehen, daß die Ausgabenquote im italienischen Haushalt zurückgegangen ist: Der Anteil der Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen - so wie in keinem anderen Land. Warum ist dann der Schuldenstand nicht auch zurückgegangen? Man muß dabei sehen, daß diese Schuldenstandsgröße ja ein Quotient ist, bei dem im Zähler der Schuldenstand steht und im Nenner das nominelle Sozialprodukt. Und dabei muß man berücksichtigen, daß Italien in den letzten Jahren eine sehr schwache Entwicklung des realen Wachstums hatte und auch keine sehr starken Preissteigerungsraten. Das heißt, dieser Nenner hat sich nicht dynamisch entwickelt, und das liegt daran, daß Italien Stabilitätsbemühungen unternommen hat. Wenn Sie die Inflationsrate senken, dann hat das zunächst den Effekt, daß Sie ein schwaches Wachstum haben, weil Sie bremsen - und die Inflationsrate sinkt dann natürlich auch. Das heißt, der Nenner dieser Quote hat sich für den Schuldenstand ungünstig entwickelt. Der Zähler aber wird auch sehr stark von den Zinsen bestimmt, und die Zinsen waren in Italien in den letzten Jahren extrem hoch. Auch das ist wiederum ein Reflex der Konsolidierungsbemühungen: Wenn Sie von einer hohen auf eine niedrige Inflationsrate kommen wollen, dann müssen Sie die Zinsen erhöhen. Das heißt, Italien hätte eigentlich gar keine andere Entwicklung haben können. Aus meiner Sicht ist diese Schuldenquote ein Spätindikator, der auf Konsolidierungserfolge relativ spät und erst allmählich reagiert. Ich finde das überhaupt nicht überraschend. Ich weiß nicht, ob es der Schuldenquote wirklich geholfen hätte, wenn Italien eine noch stärkere Rückführung der Defizite versucht hätte, denn ein noch niedrigeres Defizit hätte noch weniger reales Wachstum bedeutet. Das heißt, der Nenner wäre wieder entsprechend kleiner gewesen. Dann wären auch die Bremsspuren zu stark für die italienische Wirtschaft gewesen. Genau. Deswegen meine ich, daß man das ein wenig differenzierter sehen muß. Wir haben ja so ein bißchen das Problem in unseren Diskussionen, daß Italien immer alles Schlechte in der Wirtschaftspolitik unterstellt wird, indem man sagt, Italien habe eigentlich nichts anderes im Kopf, als Inflation zu betreiben. Ich dagegen meine, Italien hat große Sparanstrengungen unternommen. Es ist nicht realistisch zu erwarten, daß man diese Quoten so schnell reduzieren kann. Sie haben ja in einem Gutachten mit dem Titel ”Stabilitätskultur in Europa", das die Sparkassen bei Ihnen bestellt haben und das vermutlich bald auch als Buch erhältlich ist, kürzlich ausführlich dargestellt, daß die Staatsschulden eigentlich gar nicht so sehr das Problem sein können: Sie seien gar nicht so gefährlich für die Geldwertstabilität, weil immer dann, wenn sich der Staat das Geld nicht bei der eigenen Notenbank holen kann, sprich ”auf Teufel komm’ raus” Geld drucken kann, sondern sich dieses Geld auf dem Kapitalmarkt holen muß, dies dann praktisch keine Auswirkungen auf die Inflation habe. Können Sie uns das ein wenig näher erläutern, weil das ja für den Normalbürger nicht so ganz einsichtig ist. Man meint ja immer, dieser Vorgang ergäbe eine besonders hohe Inflationsrate. Auf der anderen Seite ist es schon auffällig: Wir haben zur Zeit hohe Staatsschulden und gleichzeitig eine extrem niedrige Inflationsrate. Wir haben ja, was auch die Bundesbank beklagt, einen Anstieg des Staatsschuldenstandes in ganz Europa in den letzten Jahren gehabt, und trotzdem haben wir jetzt in Europa die niedrigsten Inflationsraten, die wir je hatten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß es in der ganzen Nachkriegszeit irgendwann einmal eine Phase gegeben hat, in der alle Länder in Europa gemeinsam eine so niedrige Inflationsrate gehabt hätten. Das zeigt also zunächst einmal, daß die hohe Staatsverschuldung Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: überhaupt keinen Druck auf die Inflationsrate ausübt. Wir haben auch das Beispiel Belgien, das in diesem Fall immer wieder zitiert werden muß. Belgien wird wegen seines hohen Schuldenstands kritisiert. Aber man kann auf der anderen Seite sehen, daß Belgien seit über elf Jahren einen absolut festen Wechselkurs gegenüber der D-Mark hatte. Das heißt, es gibt in diesem Fall überhaupt keine Spannungen in den Wechselkursen. Und Belgien hatte zudem auch noch eine niedrige Inflationsrate. Was wir bei der Staatsverschuldung immer im Kopf haben - daß sie nämlich inflationstreibend ist -, sind die Erfahrungen vieler Hyper-Inflationen, bei denen es in der Tat so gewesen ist, daß die hohe Staatsverschuldung die Inflation ausgelöst hat. Nur, diese Bedingungen der Hyper-Inflation ergaben sich immer nur in Zeiten, in denen sich der Staat direkt bei der Notenpresse verschulden konnte. Aber diese Gefahr haben die Autoren des MaastrichtVertrags gesehen, und deswegen wird ganz ausdrücklich diese Art des Schuldenmachens untersagt. Das heißt, dieser direkte Inflationskanal, der wirklich extrem gefährlich ist, besteht unter Maastricht-Bedingungen gar nicht. Nun eine Lernfrage, die ich im Vorfeld nicht recherchiert habe: War es nur Deutschland, das das bisher ausgeschlossen hat, oder gab es das in anderen Ländern auch schon? In anderen europäischen Ländern gab es Regelungen dieser Art bisher nicht, das heißt, wir haben da tatsächlich etwas eingeführt in Europa, das disziplinierend wirkt. Auch da wird ja oft nur die negative Seite gesehen, indem man sagt, die Staaten können uferlos Schulden machen. Wir haben durch den Vertrag von Maastricht mehr Fiskaldisziplin geschaffen, indem wir jetzt dieses Verbot einer Finanzierung bei der Notenbank haben. Wichtig in Richtung der Fiskaldisziplin ist auch, daß die Staaten nunmehr ihre Schulden nicht mehr über die Inflation entwerten können: Wenn sie eine nationale Währung haben, dann machen sie eine hohe Staatsverschuldung - und wenn ihnen diese über den Kopf wächst, dann machen sie ein wenig Inflation und die Schulden sind entwertet. Diese Option haben aber alle europäischen Länder aufgegeben, denn sie haben ja nunmehr keine nationale Notenbank mehr, der sie sagen könnten, nun macht ein wenig Inflation. Ein dritter Punkt, der auch oft übersehen wird, ist der, daß wir keine Kapitalverkehrskontrollen mehr haben. Die Kapitalverkehrskontrollen waren auch ein Instrument, das die Staaten in der Vergangenheit benutzt haben, um die Bevölkerung zu zwingen, ihr Geld beim eigenen Staat anzulegen. Wenn z. B. ein Staat sehr hohe Schulden macht wie Italien in den siebziger und achtziger Jahren und gleichzeitig seinen Bürgern verbietet, ihr Geld im Ausland anzulegen, was sollten die Leute denn dann anderes tun, als inländische Staatsanleihen zu kaufen? Auch das ist durch den Vertrag von Maastricht nun ausgeschlossen, es gibt keine Kapitalverkehrskontrollen mehr. Und das heißt auch, daß für die öffentlichen Haushalte nun ein klarer Wettbewerb auf internationalen Kapitalmärkten gegeben ist, der sie ebenfalls zu mehr Fiskaldisziplin zwingt. Das legt ja fast den Schluß nahe, daß von den Maastricht-Kriterien einige aus Ihrem Blickwinkel unwichtig und andere sehr wichtig sind: Das heißt, Inflation, niedrige Zinsen sind sehr wichtig, während Staatsverschuldung eher nicht so wichtig zu sein scheint. Ich denke schon, daß man sich bemühen muß, die Neuverschuldung in Grenzen zu halten. Wichtig ist eine nachhaltige und mittelfristige Zurückhaltung bei den Defiziten der Haushalte, das steht außer Zweifel. Ein problematischer Punkt ist die Höhe des Schuldenstands. Es wird ja immer von der Nachhaltigkeit gesprochen, und wie wichtig sie sei. Wenn Sie sich einmal das wissenschaftliche Schrifttum ansehen, dann werden Sie feststellen, es gibt in der ganzen ökonomischen Literatur keine Definition von Nachhaltigkeit. Das ist also einfach ein Leerwort, das wir in der Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: aktuellen Diskussion verwenden. Wir wissen aber aufgrund von ökonomischen Theoremen nicht, ob 60 Prozent, ob 100 Prozent oder vielleicht sogar nur 10 Prozent richtig ist. Das ist sicher etwas, worüber man ihn den nächsten Jahren intensiver nachdenken muß: Was ist eigentlich die richtige Schuldenquote? Es könnte ja sein, das man z. B. ein Land wie Italien in eine Finanzierungsstruktur hineinzwingt, die für das Land gar nicht gut ist. Man muß ja schließlich ganz klar sehen, daß dieser Wert von 60 Prozent nicht wissenschaftlich hergeleitet ist, das war lediglich der Durchschnitt aus dem Jahr 1990. Man hat gesagt, den nehmen wir - und der soll nun für alle gut sein. Ob das so ist oder nicht, das weiß man nicht. Ich meine, man sollte einmal eine fundierte Diskussion über die gesamte öffentliche Schuldensituation führen, wozu nach meiner Ansicht auch gehören müßte, daß man sich nicht nur auf den Schuldenstand konzentriert, sondern auch danach fragt, was eigentlich die Sachvermögens-Aktiva des Staates sind: Inwieweit ist da ein ständiges Versilbern möglich, oder gibt es Grenzen? Wichtig ist sicher auch, und das hat die Bundesbank angemahnt, was es noch an nicht-bilanzierten Verpflichtungen gibt: Das wären z. B. die ganzen Pensionsverpflichtungen, die man damit auch einmal in den Blick bekommt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, nach der Fristigkeit der Staatsverschuldung zu fragen. Ich denke, daß eine langfristige Staatsverschuldung geldpolitisch sehr viel weniger bedenklich ist als eine kurzfristige. Denn wenn alle Länder sehr kurzfristig verschuldet sind, dann werden sie immer geneigt sein, Druck auf die Notenbanken auszuüben, die kurzfristigen Zinsen niedrig zu halten. Denn ein Anstieg der kurzfristigen Zinsen heißt ja, daß der Schuldendienst massiv ansteigt. Es ist ohnehin die Frage, ob man nicht als vernünftiger Finanzminister die neu aufgelegten Anleihen wirklich auf die 20 Jahre abstellen sollte. Ich denke, daß das sicherlich eine Tendenz ist, die von vielen Ländern genützt wird. Gerade Italien ist nun dabei, die Fristenstruktur seiner Verschuldung zu verbessern. Italien war traditionell immer sehr kurzfristig in seiner Verschuldung, aber jetzt bei diesen extrem niedrigen, historisch niedrigen Zinsen ist es für Italien sicher eine sinnvolle Lösung, einen möglichst großen Anteil der Verschuldung auf die niedrigen Zinsen abzustellen. Damit ist natürlich auch die Nachhaltigkeit der Defizite gesichert, denn wenn man das alles kurzfristig macht, besteht natürlich die Gefahr, daß mit den Zinsen auch das Defizit wieder steigt. Man müßte wohl ohnehin die Staatsverschuldung, Sie haben das vorhin schon angedeutet, an etwas anderem messen als nur am Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich daran denke, wieviele Rohstoffe - oder eben auch gar keine, je nachdem - in einem Land vorhanden sind, oder wieviel Bildungspotential oder geistiges Potential oder wieviel Industrie vielleicht aufgebaut werden könnte mit dem Geld, das man da eventuell mit einer riesigen Zukunftsperspektive aufnimmt - das alles läßt sich ja nur sehr schwer messen. Das ist vermutlich das, was Sie eben ausdrücken wollten. Wir stehen hier wirklich noch an einem Anfang. Unser Denken hat sich so sehr auf diese beiden willkürlich herausgegriffenen Zahlen verengt, daß dies wachstumspolitisch nicht sinnvoll sein kann. Ich denke, daß wir hier als Ökonomen noch einen erheblichen Beitrag leisten müssen: wir müssen einen breiteren Analyserahmen zur Verfügung stellen als wir ihn derzeit haben. Es ist mir bei der Lektüre Ihres Buches aufgefallen, daß es ohnehin große Lücken in der volkswirtschaftlichen Diskussion oder Forschung gibt. Denn auch die Entstehung von Inflation, so wie Sie sie in diesem Buch beschrieben haben, kenne ich so jedenfalls noch nicht: Sie sagen ganz deutlich, der erste ganz große Inflationsschub entstand 1973/74 mit der Ölkrise, der zweite mit der zweiten Ölkrise 1980/81. Parallel dazu gab es Bofinger: Jessen: Bofinger: den fatalen Drang von Gewerkschaftern oder auch von nicht organisierten Arbeitnehmern, sich das Geld, das man soeben für die OPEC-Staaten ausgegeben hat, vom Arbeitgeber zurückzuholen. Es ist natürlich so, daß man die D-Mark nicht zweimal ausgeben kann, das mußten wir schmerzhaft lernen. Das heißt, in Ihrem Buch kann man Dinge lesen, die noch gar nicht richtig andiskutiert worden sind in den letzten 20 Jahren. Mir ging es in diesem Buch genau darum, das Phänomen zu ergründen, warum in Italien in den siebziger und achtziger Jahren die Inflation so hoch gewesen ist - wobei man ja dazu sagen muß, daß in Italien in den fünfziger und sechziger Jahren die Inflationsrate ähnlich hoch war wie bei uns. Die Unterschiede traten also erst in der Phase der siebziger und achtziger Jahre auf, während man davor eigentlich für ganz Europa sagen konnte, daß die Inflationsraten relativ eng beieinander lagen - so wie sie das heute auch wieder tun. Die Rate lag damals auf einem etwas höheren Niveau, aber es gab keine gravierenden Unterschiede. Das Interessante ist die Frage, warum das später so stark auseinander gelaufen ist. Viele meiner Kollegen, aber auch die öffentliche Diskussion sagte, daß die Italiener einfach mehr Inflation haben wollen. Salopp ausgedrückt könnte man sagen: So wie die Deutschen ihre Knödel lieben, so lieben sie auch die Geldwertstabilität, und die Italiener lieben eher Pizza, Rotwein und die Inflation. Ich empfand das eigentlich immer als eine sehr unbefriedigende Erklärung. Auch das Argument, die Deutschen hätten eine so starke Aversion gegen die Inflation, weil sie zwei Geldentwertungen erlebt haben, finde ich nicht sehr überzeugend. Denn wenn ich meine Studenten frage, wann denn das gewesen sei, dann wissen die meisten es gar nicht mehr. Ich habe den Eindruck, daß die Erinnerung an die Inflation auch nicht mehr so präsent ist in der Öffentlichkeit. Deswegen habe ich mir im Rahmen dieses Buches überlegt, woher es eigentlich kommt, daß einige Länder eine höhere Inflationsrate haben als andere Länder. Ich denke, daß dafür zwei Dinge wichtig waren. Das eine ist sicher das Verhalten der Gewerkschaften, also überhaupt die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir kamen zu dem Ergebnis: Wenn ein relativ aggressives Verhalten zwischen diesen beiden Seiten des Tarifvertrages vorhanden ist, dann wirkt das inflationsfördernd. Wobei wir aber auch festgestellt haben, daß das sehr stark auf die Zeit der siebziger Jahre bezogen war. Es war damals eine Zeit der leergefegten Arbeitsmärkte, in der auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften sehr groß war. Man kann nun für alle Länder feststellen, daß in den neunziger Jahren die Streikaktivität sehr deutlich zurückgegangen ist, daß sich also auch in Ländern wie Italien, Portugal oder Spanien, in denen in den siebziger Jahren extrem aggressive Verteilungskämpfe stattgefunden haben, die Situation doch erheblich beruhigt hat. Das kann man natürlich auch gut erklären, denn wir haben heute den massiven Druck durch die Globalisierung, der von außen einwirkt und der natürlich auch die Kartelle der nationalen Gewerkschaften untergräbt. Ich muß als italienischer Unternehmer nicht mehr die Arbeitsleistungen quasi von italienischen Gewerkschaften beziehen, sondern ich kann, wenn mir das zu teuer ist, sie eben aus Ungarn oder aus Tschechien oder von woher auch immer beziehen. Das heißt, diese Machtposition der Gewerkschaften ist im Ganzen geschwächt worden. Deswegen meine ich, daß wir auf absehbare Zeit derartige Verteilungskämpfe nicht mehr bekommen werden, und deswegen ist auch eine sehr gute Chance gegeben, daß der Euro eine stabile Währung wird. Sie schreiben, daß in diesen Jahren die Fiskalpolitik auch keine große Rolle gespielt hat. Die Staaten haben dies de facto nicht so sehr beeinflussen können, sondern es lag damals vor allem an einem mangelnden sozialen Konsens - oder am etwas besseren Konsens bei denen, die mit niedrigeren Inflationsraten zu Rande kamen. Ich denke, daß da nicht nur der soziale Konsens, sondern ganz eindeutig Jessen: Bofinger: Jessen: die Geldpolitik eine Rolle gespielt hat. Man kann ziemlich gut sehen, daß die Geldpolitik entscheidend dafür war, ob manche Länder eine relativ niedrige Inflationsrate hatten - man muß dabei auch sehen, daß selbst wir in Deutschland eine Inflationsrate von 7 Prozent hatten und daß das sogar relativ gut gewesen ist, denn andere Länder wie Italien hatten eine Inflationsrate von bis zu 20 Prozent. Das ist ja auch logisch, denn das ist es eben, was Geldpolitik bewirken kann: Geldwertstabilität oder Inflation, je nachdem, wie sie ausgestaltet ist. Für uns war es dann zentral danach zu fragen, warum denn in den einzelnen Ländern die Geldpolitik anders gewesen ist. Dabei kommt man dann auf ein Phänomen, das nun nicht besonders neu ist: Die Geldpolitik war in den Ländern stabilitätsorientiert, in denen die Geldpolitik unabhängig war, und sie ging dort eher in Richtung Inflation, wo sie politisch abhängig gewesen war. Das führte uns eigentlich auf den zentralen Punkt in der ganzen Geschichte, indem wir sagten, ob es Inflation gibt oder nicht, hängt davon ab, welchen Zeithorizont die Akteure haben. Das ist also keine Frage der Vorliebe für Inflation oder Stabilität, sondern das ist eine Frage des Zeithorizonts. Wir kamen zu folgendem Ergebnis: Wenn die Akteure lange Zeithorizonte haben, dann bekommt man eher Geldwertstabilität, wenn die Akteure eher kurze Zeithorizonte haben, dann bekommt man eher Inflation. Denn so wirkt ja auch inflatorische Politik: Wenn Sie mit Inflation operieren, dann heißt das, daß Sie kurzfristig ein Strohfeuer entzünden - Sie können kurzfristig Beschäftigungseffekte erzielen, aber man weiß, und das wissen eigentlich alle, daß diese Effekte relativ schnell verpuffen, und danach haben Sie Ihr altes Beschäftigungsproblem und dazu noch ein Inflationsproblem. Das heißt, wenn jemand mit Inflation operiert, dann muß das jemand sein, der einen kurzfristigen Zeithorizont besitzt. Wir haben dann versucht, das durch die instabilen politischen Verhältnisse in Italien, gerade in den siebziger und auch in den achtziger Jahren, zu erklären. Das heißt, wir hatten Regierungen mit einer sehr kurzen Lebenszeit, und natürlich ist so eine Regierung geneigt, wenn es um das Überleben geht, auch einmal kurzfristig Inflation zu machen. Wenn es dann auch noch eine politisch abhängig Notenbank gibt, dann kann man sie dazu benutzen. Wir sehen eben jetzt die große Veränderung darin, daß die Geldpolitik in Europa durch die europäische Zentralbank politisch unabhängig sein wird. Das heißt, selbst wenn in Italien, was ja nicht mehr so ganz der Fall ist, wieder politisch instabilere Verhältnisse einsetzen sollten, dann kann die italienische Regierung nicht mehr zur Notenbank gehen und sagen: ”Mach ein wenig Inflation für uns, damit wir die nächste Wahl gewinnen". Das Wichtige ist also, daß durch die europäische Zentralbank in ganz Europa ein langer Zeithorizont in den geldpolitischen Entscheidungsprozessen eingetreten ist. Bedeutet das eigentlich letzten Endes den Tod der Inflation aus Ihrer Sicht? Keynes ist also kein Thema mehr? Man soll natürlich immer, gerade wenn man für Geldpolitik zuständig ist, unter jedem Kieselstein nachsehen, ob es da nicht doch noch Inflation geben könnte. Ich meine, es wäre wahrscheinlich falsch, nun eine völlige Entwarnung zu geben. Man muß vielleicht immer noch damit rechnen, daß wir eventuell Rohstoff-Preisschocks erleben können, durch die es vielleicht auch einmal wieder zu mehr Inflation kommen kann. Aber das Umfeld für Inflation ist in den nächsten Jahren eigentlich so, daß man nicht mit inflationären Gefährdungen rechnen muß. Bei der jetzigen Inflationsrate in Deutschland muß man ja berücksichtigen, daß dabei 0,75 Prozent rein statistischer Art sind, das hat die Bundesbank soeben ermittelt. Wenn Sie noch ein wenig den Druck berücksichtigen, den die Asienkrise bewirkt, dann würde ich sagen, daß wir eher ein deflationäres als ein inflationäres Risiko haben. Dieses Thema wollte ich mit Ihnen auch gerne besprechen. Ich habe das neulich einmal mit Professor Donges diskutiert, hier bei Alpha-Forum. Er ist Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: der Meinung, daß wir gar nicht dazu neigen. Ich habe doch das starke Gefühl, daß wir dazu neigen, denn wir haben ja eine Komponente, die die Inflation hoch hält. Das ist die, wie ich glaube, unvernünftige Verhaltensweise des Staates, also genauer gesagt der Gebietskörperschaften, der Gemeinden und der Länder: Da werden Steuern neu erhoben, Gebühren in extremer Weise angehoben, teilweise weit über die Kosten hinaus. Das heißt, hier ist ein Inflationsfaktor vorhanden, der, wie ich als Laie meine, sogar für zwei Prozent gut wäre. In Wirklichkeit haben wir in allen anderen Bereichen Tendenzen einer Preissenkung: Das wäre ja fast schon eine Deflation. Es ist schwierig, dies nun genau zu quantifizieren. Ich denke, wir sind kurz davor, in den Bereich der Preissenkung zu kommen. Klar, die statistischen Meßprobleme sind erheblich, und Sie sprachen von den administrierten Preisen. Ich denke, es ist relativ eindeutig, daß wir jetzt durch die AsienKrise eine Senkung der Lohnkosten in diesen Ländern bekommen haben und diese Länder stehen ja auch im internationalen Wettbewerb. Das übt natürlich einen Lohnsenkungsdruck auch auf alle anderen Regionen aus. Das betrifft China und auch die GUS-Länder, die ja alle in ihren Lohnkosten plötzlich deutlich höher liegen als die asiatischen Länder. Natürlich wirkt dieser Lohnkostendruck auch auf Deutschland zurück. Von daher ist meiner Ansicht nach eher das Risiko einer deflationären statt einer inflationären Richtung vorhanden. Auch die europäische Währungsunion ist etwas, das eher zu einem Lohndruck nach unten führen wird, denn natürlich wird nun transparenter, wie ich meine Lohnpolitik führe. In der Vergangenheit war es ja immer so, daß wir nationale Lohnabschlüsse hatten und es dabei nie so ganz klar gewesen ist, was das nun für die internationale Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, weil da immer noch die Änderungen im Wechselkurs mit berücksichtigt werden mußten. Wir haben aber nun die Erfahrung, daß zwischen den Ländern, bei denen die Wechselkurse schon fest waren, z. B. zwischen Deutschland und den Niederlanden oder auch zwischen Deutschland und Frankreich, folgendes passierte: Sowohl in Frankreich wie auch in den Niederlanden kann man beobachten, daß die Gewerkschaften in den letzten Jahren bestrebt waren, sich deutlich unterhalb der deutschen Zuwachsraten zu bewegen. Das heißt, dort wo das Spielfeld klar abgegrenzt war, gab es eher einen Prozeß des Angleichens nach unten als ein Angleichen nach oben. Von daher halte ich die Aussage von manchen Euro-Kritikern, daß wir eine Angleichung an das deutsche Lohnniveau bekommen würden, für falsch, denn dies ist die völlig falsche Tendenz. Ich denke, es wird eher umgekehrt sein: Wenn wir Angleichungsprozesse bekommen, dann bekommen wir eher Angleichungsprozesse nach unten. Aber es wird sich schon auch irgendwie ausgleichen. Denn sonst würden ja den ärmeren Ländern oder den Ländern mit einem niedrigeren Lebensstandard alle Leute davonlaufen. Natürlich haben wir erhebliche Produktivitätsunterschiede in Europa und in der Welt. Deutschland ist ein Land, das sehr produktiv ist und effizient produziert. Wir sind daher mit den Menschen, die derzeit beschäftigt sind, auch bei diesem Lohnniveau international wettbewerbsfähig. Das können wir an der hohen Exportentwicklung sehen. Diejenigen, die beschäftigt sind, sind bei diesen Löhnen so produktiv, daß man die Waren gut verkaufen kann. Das wird ja wohl auch in der ganzen Diskussion etwas überzeichnet. Immerhin kann Bayer oder BASF hier auf sehr stattliche Fabriken zurückgreifen und verkauft, wie wir wissen, mit glänzenden Gewinnen ins Ausland. Es gibt sicher keinen Grund, hier in Panik zu verfallen. Natürlich muß man sehen, daß diese Gewinne mit den Beschäftigten gemacht werden, die wir Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: heute haben. Um profitabel zu sein, mußten die Unternehmen in den letzten Jahren doch viele Arbeitskräfte freisetzen. Das waren eben Arbeitskräfte, die bei diesem Lohnniveau nicht mehr international konkurrenzfähig gewesen waren. Ich denke, daß die Aufwertungen der Jahre 1992, 1993 und 1995 eine erhebliche Rolle gespielt haben. Diese Aufwertungen haben unser Lohnkostenniveau merklich nach oben getrieben. Sie haben die Unternehmen gezwungen, so lange zu rationalisieren, bis die Produktivität wieder dem Lohnkostenniveau entsprochen hat. Diejenigen Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz haben, können bei diesem Lohnniveau vernünftige Löhne erwirtschaften, aber schlecht ist es natürlich für diejenigen, die entlassen wurden. Es ist ja auch eine Ihrer Hauptthesen pro Euro, daß diese ganzen Aufwertungseffekte herausfallen - man hat dann keinen Schock mehr zu gewärtigen. Auf der anderen Seite sagt der bayerische Landeszentralbankchef, daß diese Wechselkurse immer so eine Art Warnfunktion eingenommen haben und letzten Endes eine Art Kontrollinstanz waren: daß in dem einen Land etwas nicht so gut läuft und die Währung deshalb schwächer wird, es dagegen in einem anderen Land besser läuft und damit auch die Währung stärker wird. Das stimmt aber eben nur teilweise. Das Problem dabei ist, daß wir sehr häufig jetzt auch Phasen hatten, in denen diese Warnfunktion oder Schiedsrichterfunktion völlig versagt hat. Das Beispiel dafür ist gerade Frankreich oder Belgien. Diesen Ländern wurde 1992/93 von den Devisenmärkten mit einem massiven Abwertungsdruck quasi die rote Karte gezeigt, obwohl damals die fundamentalen Daten Frankreichs mindestens genauso gut waren wie die fundamentalen Daten in Deutschland, und es überhaupt keinen Grund gegeben hätte für eine solche Attacke. Diese Attacke hat aber gerade für Frankreich erhebliche Probleme mit sich gebracht. Frankreich mußte jetzt, um seinen Wechselkurs gegenüber der D-Mark zu halten, die Zinsen merklich anheben. Das heißt, in Frankreich wurde 1992/93 eine extrem restriktive Geldpolitik betrieben, weil diese rote Karte gezeigt worden war. Das Ergebnis ist natürlich auch ein erheblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in Frankreich gewesen. Überhaupt kommt in Ihren Argumenten häufiger zu Tage, daß Sie es allmählich als prekär ansehen, obwohl Sie Geldpolitiker sind, wenn wir zuviel sparen. Wir rutschen in eine Situation hinein, die das Sparen nicht mehr so ganz verträgt. Oder habe ich das falsch interpretiert? Das haben Sie, glaube ich, etwas falsch gesehen. Ich meine, es ist gut zu sparen, die Frage ist dabei aber immer, wo gespart wird. Zunächst einmal ist es für die Unternehmen nie so besonders gut, wenn die privaten Haushalte sehr viel sparen. Denn wenn die privaten Haushalte sehr viel sparen, dann heißt das, daß das Geld nicht in Form von Erlösen bei den Unternehmen landet. Das Geld landet statt dessen bei den Banken. Die Banken müssen dieses Geld dann wieder in Unternehmenskapital transformieren, und das ist eigentlich immer ungünstig. Gut ist es für eine Volkswirtschaft, wenn die Unternehmen selbst sparen. Unser ganzes Wirtschaftswunder in den fünfziger Jahren lebte davon, daß die privaten Haushalte wenig gespart haben. Sie hatten einen hohen Nachholbedarf, es gab die Freßwelle und alle möglichen anderen Wellen. Das heißt, alles, was die Haushalte in den fünfziger Jahren an Einkommen bekamen, haben sie direkt wieder ausgegeben. Das Geld landete bei den Unternehmen, und die Unternehmen haben gespart. Die Unternehmen konnten erheblich investieren und den Kapitalstock ausbauen. Das heißt also, das Unternehmenssparen ist das, was volkswirtschaftlich gut ist. Das private Sparen ist eher nachteiliger zu sehen, weil es die Transformationsleistungen durch das Finanzsystem braucht. Ich habe da nur aus einem ”Welt”-Interview zitiert. Da sagten Sie, daß das Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: starke Festhalten an dieser Grenze von drei Prozent Defizit unsinnig sei, weil die Gefahr bestünde, daß wir kaputt gespart werden würden. Ja, das ist richtig, aber damit meinte ich natürlich die Fiskalpolitik und nicht die Haushalte. Bei der Fiskalpolitik besteht immer das Problem, daß diese Defizitwerte zwei Dinge spiegeln: zum einen das, was der Staat selbst an Entscheidungen trifft – ob er also die Steuern erhöht oder nicht, ob er bestimmte Ausgaben tätigt oder nicht. Und zum anderen spiegelt das Defizit auch, wie sich die Konjunkturlage entwickelt. Wenn wir eine relativ ungünstige Konjunktur haben, dann heißt das, das Defizit geht zunächst einmal ganz von sich aus hoch, weil der Staat eben weniger Steuern einnimmt und er höhere Ausgaben für die Arbeitslosigkeit hat. Wenn er jetzt in der Situation einer ungünstigen Konjunktur partout versucht, ein bestimmtes Defizitziel zu erreichen, dann verhindert er das, was wir als einen automatischen Stabilisator des Budgets bezeichnen. Das heißt, dann besteht die Gefahr, daß er die Situation verschärft, weil er jetzt in einer Phase mit schlechter Konjunktur zusätzlich seine Ausgaben zurückführt und damit zusätzlich die Konjunkturschwäche verstärkt. Deswegen haben viele Ökonomen in der ganzen Diskussion der letzten Jahre gesagt, daß es nicht sinnvoll ist, auf einen Defizitwert in absoluter Form zu zielen, sondern daß es vernünftig wäre, Defizitwerte zu nehmen, die konjunkturbereinigt sind. Man spricht dann auch von strukturellen Defiziten. Wie sehen Sie denn die Rolle des Euro in den nächsten Jahren im gesamten Weltsystem? Wird das eine sehr kräftige Währung werden? Viele sind ja skeptisch und sagen, der Euro wird schwach, der Dollar wird ganz stark. Die Amerikaner, das las ich zu meiner Verwunderung, glauben, der Dollar sei so stark, daß der Euro sie gar nicht tangiert. Das wundert mich ehrlich gesagt schon, ich sehe eher die Gefahr, daß der Dollar ins Rutschen kommt. Es ist so, daß wir uns als Ökonomen immer schwer tun, kurz- und mittelfristige Wechselkursprognosen zu machen. Nur zur Erinnerung: Die DMark hat ja gegenüber dem Dollar Schwankungen aufgewiesen von 1,80 DM zum Beginn der achtziger Jahre über 3,47 DM im Jahr 1985 und dann wieder niedriger bei 1,40 DM im Jahr 1987. Das heißt, es gibt enorme Kapriolen an den Devisenmärkten. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund dafür, warum man diese Kapriolen in Europa ausschließen sollte. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, wie sich der Euro-Dollarkurs entwickeln wird, dann muß man sich einfach bewußt sein, welche Eventualitäten entstehen können. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, was so die Fundamentalfaktoren für die beiden Währungen sind. Ich finde, für den Euro spricht, daß das Euro-Land einen unglaublich hohen Leistungsbilanz-Überschuß von über 100 Milliarden Dollar hat, während die USA ein Leistungsbilanz-Defizit von 200 Milliarden Dollar haben. Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus für den Euro. Ich finde, es ist auch wichtig, die allgemeine Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zu berücksichtigen. Sie bringen ja mit den sehr niedrigen Zinsen, die wir im Augenblick haben, zum Ausdruck, daß sie den Euro als eine sehr stabile Währung einschätzen. Es sind ja immer noch über 70 Prozent der Bevölkerung dagegen. Es sind, wie wir ja schon zu Beginn sagten, viele Ihrer Professorenkollegen dagegen. Was sind denn kurzgefaßt noch einmal die Hauptthesen, die man ihnen entgegenhalten muß. Der Euro ist gut, weil ... Ich würde das so sehen: Schauen Sie sich einmal an, was die Bevölkerung in der Form als Anleger macht. Da sind die Menschen dem Euro gegenüber durchaus positiv eingestellt. Denn die Menschen sind bereit, ihr Geld weiterhin bei uns in Deutschland anzulegen - ein Geld, das dann ab 1999 der Euro sein wird. Sie haben auch überhaupt keine Tendenzen zu einer Flucht in Sachwerte. Das wäre auch ein Prozeß, den man befürchten Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: Bofinger: Jessen: müßte, wenn es ein Mißtrauen in die Währung gäbe, denn die Zinsen sind sehr niedrig. Das wäre also eigentlich die Idealkonstellation für eine Flucht in Sachwerte. Aber das liegt bei uns nicht vor. Ich meine, daß die Bevölkerung in ihrer Eigenschaft als Anleger von Geld eigentlich dem Euro gegenüber sehr optimistisch eingestellt ist. Von daher sollte man diesen Umfragen gar nicht so sehr viel Vertrauen entgegenbringen. Und die Professoren haben sich dann geirrt mit ihren Argumenten – oder sind das einfach nur notorische Schwarzseher? Nein, es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe. Sie schauen einfach nur auf den Beipackzettel, was unter Risiken und Nebenwirkungen steht und vergessen ganz die Hauptwirkung des Medikaments. Die Hauptwirkung ist, daß wir Europa vor Aufwertungsschocks schützen und insgesamt eine sehr stabile Währungsverfassung bekommen werden. Was wird mit dem Yen passieren? Was wird mit dem Schweizer Franken passieren? Das ist auch interessant – das werde ich z. B. immer wieder gefragt. Ich denke, der Schweizer Franken hat jetzt eine Obergrenze, eine Schmerzgrenze erreicht. Die Schweiz ist ein Land, das von allen Ländern im Westen die schlechteste Wachstumsentwicklung in den neunziger Jahren hatte. Das heißt, die Schweiz leidet massiv unter diesem harten Frankenkurs und ich denke, daß die Schweiz auch alles tun wird, um eine weitere Aufwertung des Franken zu vermeiden. Die Briten haben ja auch einen extrem hohen Pfundkurs. Das sind Dinge, die sich auch sehr negativ auswirken können. Ich würde sagen, daß der Glanz dieses ”Modells Blair” bald verblassen wird. Es zeichnet sich schon jetzt ein massives Leistungsbilanz-Defizit, in Großbritannien ab. Die Industrie hat Schwierigkeiten im Exportgeschäft, und mit dem Kurs von 3,07 DM wird Großbritannien nicht mehr sehr lange glücklich sein. Das Fazit lautet also: für die Außenseiter außerhalb der Währungsunion wird es sehr schwer werden – es sei denn, sie sind so groß wie die USA und Japan, das sich hoffentlich wieder erholt. Ich denke, die Außenseiter der Währungsunion werden sich wegen ihrer Wechselkurse noch sehr viel mehr darum bemühen müssen, stabile Verhältnisse einzuhalten, als das bisher der Fall gewesen ist. Und unsere Finanzminister werden schauen müssen, daß sie alles richtig austarieren und möglichst wenig Einfluß nehmen auf die europäische Zentralbank. So ist es. Ja, meine Damen und Herren, das war Alpha-Forum. Wir sprachen mit Herrn Professor Peter Bofinger, dem Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. © Bayerischer Rundfunk