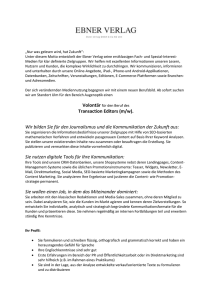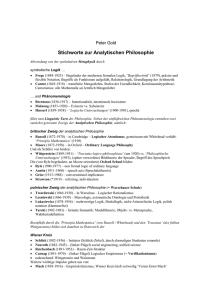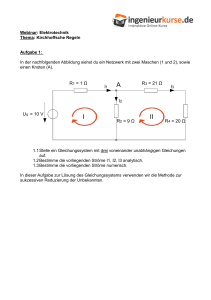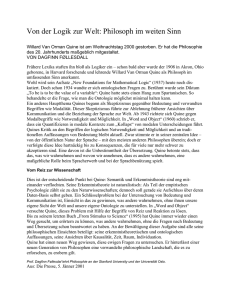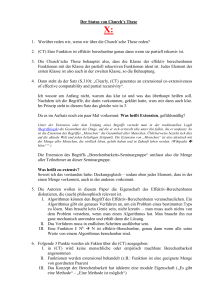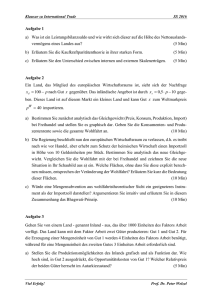Lexikon der Erkenntnistheorie
Werbung

A priori zwei sehr prominente Vertreter dieser Argumentationsstrategie. BonJour (1998) ist der Auffassung, dass jede Widerlegung argumentativer Natur ist und dass ein Argument nur dann gerechtfertigte Konklusionen hervorbringt, wenn die Schlussregel a priori als gültig erkannt wird. Dann wäre jedes Argument gegen apriorisches Wissen erkenntnistheoretisch inkonsistent: Wenn die Konklusion wahr wäre, dann wäre sie nicht gerechtfertigt (und könnte nicht gewusst werden). Die Überzeugungskraft dieses Selbstaufhebungsarguments hängt jedoch vollkommen von BonJours Konzeption der Rechtfertigung ab. Er glaubt nämlich, dass tatsächlich gültige Schlüsse nicht ausreichen, um von gerechtfertigten Prämissen zu gerechtfertigten Konklusionen zu gelangen. Seiner Auffassung nach muss man die Gültigkeit der Schlüsse zusätzlich auch noch erkennen. Damit erweist er sich als Anhänger eines erkenntnistheoretischen Internalismus – eine Position, die in der gegenwärtigen Erkenntnistheorie heftig umstritten ist. G. Bealers Selbstaufhebungsargument (1993) hängt dagegen nicht vom Internalismus ab. Er glaubt, dass jedes Argument gegen apriorisches Wissen (oder apriorische Rechtfertigung) von Prämissen abhängt, die wir nur a priori rechtfertigen können. So enthalten die meisten dieser Argumente bestimmte Annahmen über erkenntnistheoretische Prinzipien; und die können wir nach Bealer eben nur a priori erkennen. Aber auch diese Annahme kann von radikalen Empiristen, die apriorische Erkenntnisquellen völlig ablehnen, natürlich bestritten werden, sofern sie in der Lage sind, das Wissen von den Erkenntnisprinzipien empirisch zu erklären. Der Erfolg der empiristischen Strategie wird hier ganz davon abhängen, inwiefern es ihnen wirklich gelingt, das fragliche Wissen ohne Rückgriff auf apriorische Quellen zu erklären. Probleme apriorischer Erkenntnis. Empiristen haben die Möglichkeit apriorischer Erkenntnis aber auch direkt angegriffen, indem sie eine Reihe von Problemen für diese Art der Erkenntnis benannt haben: (1.) Von W. V. O. Quine stammt der Einwand, dass es keine apriorische Erkenntnis geben könne, weil keine wie auch immer gerechtfertigte Meinung unrevidierbar oder unanfechtbar sei. Dieser Einwand setzt jedoch voraus, dass apriorische Gründe unanfechtbar sind, und das widerspricht den vorangehenden Überlegungen. Eine fehlbare und deshalb anfechtbare Rechtfertigung a priori ist nämlich durchaus möglich. (2.) Empiristen aller Art haben immer wieder eingewandt, dass apriorische Erkenntnisse obskur und unerklärlich sind. Zum einen ist vollkommen unklar, welche psychologischen Prozesse ihnen zugrunde liegen. Der Vorschlag, dass hier das Verstehen der eigenen Begriffe eine zentrale Rolle spielt, könnte bestenfalls apriorisches Wissen von analytischen Wahrheiten erklären, nicht aber von den interessanteren synthetischen Wahrheiten a priori über die Welt. Zum anderen gibt es offenbar keinen direkten kausalen Einfluss der mathematischen, logischen oder philosophischen Gegenstandsbereiche auf unser rationalistisches Denkvermögen. Doch damit bleibt die Zuverlässigkeit apriorischer Erkenntnis letztlich unerklärt. Sofern es rationalistische Erklärungsansätze gibt, schränken sie den Umfang apriorischen Wissens erheblich ein. So kann unser Begriffsverständnis bestenfalls erklären, wie wir die Wahrheiten erkennen können, die allein aufgrund von Bedeutung wahr sind und deshalb nicht von der Welt handeln. Kant hat mit seinem transzendentalen Idealismus genau diese Lücke füllen wollen, aber nur um den Preis, dass er die Objektivität der Welt preisgegeben hat. Sofern diese Welt nämlich durch Denkhandlungen konstituiert ist, kann man sehr gut verstehen, wie man durch reines Nachdenken die Struktur der Welt erkennen kann. (3.) Selbst wenn man verstehen könnte, wie sich rationale Intuitionen auf eine objektive geistunabhängige Welt beziehen können, so wird deren Zuverlässigkeit doch massiv dadurch in Frage gestellt, dass in neuerer Zeit durch empi- 17 Analytisch rische Studien nahegelegt wird, dass diese Intuitionen relativ auf Kulturen, Bildungsniveau und Hintergrundtheorien sind. Nachdem die Philosophie zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend vom Empirismus dominiert wurde, lässt sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein deutliches Wiedererstarken rationalistischer Entwürfe erkennen. Vertreter des neuen Rationalismus sind u. a.: Bealer, Boghossian, BonJour, Chalmers, Jackson, Peacocke und Sosa. Die Herausforderung für den Empirismus besteht im Wesentlichen darin, vermeintlich apriorische Wissensarten (wie mathematisches, logisches und philosophisches Wissen) empiristisch zu erklären. Rationalisten müssen dagegen vorrangig versuchen, das Erklärungsproblem zu lösen, welches die apriorische Erkenntnis von einer unabhängigen Wirklichkeit aufwirft. 18 Lit.: Bealer, George: „The Incoherence of Empiricism“, in: S. Wagner / R. Warner (Hg.): Naturalism: A Critical Appraisal, Notre Dame, Ind.; University of Notre Dame Press, 1993. S. 163–196. – BonJour, Laurence: In Defense of Pure Reason, Cambridge, Ma.: Cambridge University Press, 1998 (vorzüglich lesbare Verteidigung des Rationalismus aus aktueller Perspektive, der Klassiker der Gegenwartsphilosophie zum Thema). – Casullo, Albert: A Priori Justification, Oxford: Oxford University Press, 2003 (anspruchsvolles Buch, das sehr gute Überlegungen zur Definition apriorischer Rechtfertigung enthält und die Argumente für und wider relativ neutral darstellt). – Descartes, René: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Hamburg: Meiner, 1992. – Devitt, Michael: „There is no A Priori“, in: Matthias Steup / Ernest Sosa (Hg.): Contemporary Debates in Epistemology, Malden, Ma.: Blackwell, 2005. S. 105–115. – Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, hg. v. Jens Timmermann, Hamburg: Meiner, 1998. – Kitcher, Philip: The Nature of Mathematical Knowledge, Oxford: Oxford University Press, 1983 (Versuch einer empiristischen Rekonstruktion der Mathematik). – Kitcher, Philip: „A Priori Knowledge Revisited“, in: P. Boghossian / C. Peacocke (Hg.): New Essays on the A Priori, Oxford: Clarendon Press, 2000. S. 65–91. – Kornblith, Hilary: Knowledge and Its Place in Nature, Oxford: Clarendon Press, 2002 (sehr gut lesbarer Versuch einer empiristischen Rekonstruktion der Philosophie). – Kripke, Saul: Name und Notwendigkeit, Frankfurt / M.: Suhrkamp, 1993. – Quine, W. V. O.: „Two Dogmas of Empiricism“, in: ders., From a logical Point of View, Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1953. S. 20, 46 (fallibilistische Kritik am Apriori). T. G. Analytisch Mit Kant ist der Begriff der Analytizität ins Zentrum der Erkenntnistheorie gerückt (Kritik der reinen Vernunft A 7–10, B 11–14). Er war der Meinung, dass die grammatikalische Struktur ,S ist P‘ eine Grundform des Urteils ist. Das Urteil ist analytisch, wenn der Gehalt des Prädikats P im Inhalt des Subjekts S enthalten ist, das heißt, wenn der Inhalt von S kleiner als der Inhalt von P ist oder beide gleichwertig sind, wie zum Beispiel im Urteil „Alle Körper sind ausgedehnt“. Nach einer anderen Auffassung Kants ist ein Urteil analytisch, wenn seine Wahrheit durch Reduktion auf das Widerspruchsprinzip bestimmt werden kann. Ein Urteil ist synthetisch, wenn der Inhalt von P über den Inhalt von S hinausgeht. Nach Kant kann dann das Urteil ,S ist P‘, zum Beispiel „7 + 5 = 12“, nicht auf das Prinzip des Widerspruchs reduziert werden. Wichtig war für Kants Ansatz die Trennung der Unterscheidung zwischen analytisch und synthetisch einerseits von der Unterscheidung zwischen a priori ( A priori) und a posteriori andererseits. Dies war eine neue Einsicht, denn Humes Begriff des Tatsachensatzes und des Satzes über die Beziehung zwischen Ideen, so wie auch Leibniz’ Unterscheidung zwischen den vérités de raison und den vérités de fait, können als analytisch bzw. synthetisch oder als a priori bzw. a posteriori interpretiert werden. Beide Unterscheidungen Kants ergeben zusammen vier Arten von Urteilen oder Sätzen: analytisch a priori, analytisch a posteriori, synthetisch a priori und synthetisch a posteriori. Weil alle analytischen Sätze tautologisch sind, sind sie auch a priori. Es gibt keinen Grund, um innerhalb der analy- Analytisch tischen Sätze die apriorischen von den aposteriorisch gültigen zu unterscheiden. Die Logik besteht aus analytischen Urteilen, die Mathematik (Arithmetik und Geometrie) enthält synthetische Wahrheiten a priori (zum Beispiel „7 + 5 = 12“, „der Raum ist dreidimensional“). Das Gleiche gilt für die mathematische Physik (Newtons Gesetze). Die experimentellen Wissenschaften enthalten vor allem synthetische Urteile a posteriori. Kant war der Meinung, dass seine Theorie der synthetischen Urteile a priori, die also das Wissen erweitern und von der Erfahrung unabhängig sind, den Gegensatz zwischen Empirismus und Rationalismus überwindet und die kopernikanische Wende in der Philosophie einleitet. Die Unterscheidung zwischen Analytizität und Synthetizität, die im 19. Jahrhundert u. a. durch Bolzano und Frege diskutiert wurde, wurde im 20. Jahrhundert intensiv geführt. Sie erschien nicht nur für die Erkenntnistheorie wichtig, sondern auch für die Philosophie der Logik und der Mathematik, für die Philosophie der Sprache und für die Philosophie der Wissenschaften (Proust 1989, Woleński 2004, Wille 2007). Bolzano definiert den analytischen Satz als einen Satz, der unabhängig von Veränderungen in nichtlogischen Elementen richtig bleibt. Nach Frege dagegen kann die Wahrheit jedes analytischen Satzes allein auf Grund der Regeln der Logik und durch Definitionen nachgewiesen werden. Frege hat die Aussagen der Mathematik, mit Ausnahme der Geometrie, als analytische betrachtet. Die Geometrie dagegen ist eine Wissenschaft, die synthetische, a priori wahre Aussagen enthält. Die Mathematik als System analytischer Sätze liegt dem Logizismus in der Philosophie der Mathematik zugrunde, der auf Frege zurückgeht und durch Russell, Wittgenstein (mit einigen Einschränkungen) und Carnap entwickelt wurde ( Mathematisches Wissen). W. V. O. Quines Aufsatz Zwei Dogmen des Empirismus (Quine 1953) präsentiert einflussreiche Argumente gegen die Unterscheidung von analytischen und synthetischen Sätzen. Sie ist Gegenstand einer lebhaften Diskussion bis zum heutigen Tag (Woleński 2004, Russell 2008). Kants Definition des Begriffs analytischer Satz gilt heute als zu eng. Im 20. Jahrhundert wurden andere Definitionen von analytisch vorgeschlagen (cf. Delius 1963, Woleński 2004). B. Mates (Mates 1951) hat folgende Arten von Bestimmungen des Begriffs analytisch unterschieden (das Prädikat „ist analytisch“ ist in der Regel eine Abkürzung von „ist analytisch wahr“): (a) Die Aussage A ist analytisch dann und nur dann, wenn A in jeder möglichen Welt wahr ist. (b) Die Aussage A ist analytisch dann und nur dann, wenn A unmöglich falsch sein kann. (c) A ist analytisch dann und nur dann, wenn non-A in sich widersprüchlich ist. (d) A ist analytisch dann und nur dann, wenn A auf Grund der Bedeutung und unabhängig von den Tatsachen wahr ist. (e) A ist analytisch dann und nur dann, wenn A eine logische Wahrheit ist oder in eine logische Wahrheit durch Substitution von Synonymen umgewandelt werden kann. (f) A ist analytisch dann und nur dann, wenn A in jeder Zustandsbeschreibung wahr ist. (g) A ist analytisch dann und nur dann, wenn A auf Grundlage der Definitionen der nichtlogischen Terme in A auf eine logische Wahrheit reduziert werden kann. (h) A ist in einer Sprache L analytisch dann und nur dann, wenn A allein auf Grund der semantischen Regeln von L wahr ist. Man kann zeigen, dass die Definitionen von (a) bis (c) und (f) gleichwertig sind. Wenn A analytisch im Sinne von (a) ist, ist A auch im Sinne von (f) analytisch, weil die möglichen Welten als die maximalen Sachverhalte berücksichtigt werden können. Auf der anderen Seite ist die Falschheit von A dann ausgeschlossen und die Negation von A ist in sich widersprüchlich. Der Übergang von (c) bis zu (b) und dann bis zu (a) und (f) liegt auf der Hand. Die Definitionen von (a) bis (h) verwenden unterschiedliche Begriffe: In (a), (b) und (f) sind es semantische Begriffe. Diese Definitionen kann man zusammen folgendermaßen ersetzen: Die 19 Analytisch 20 Aussage A ist analytisch dann und nur dann, wenn A in jedem Modell wahr ist. Die Definition (c) hat syntaktischen Charakter, weil die Kategorie des Widerspruchs zur Syntax einer Sprache gehört. Obgleich es Versuche gab, Begriffe wie Bedeutung, Synonymität, Definition oder semantische Regel auf semantische Begriffe und Regeln zu reduzieren (im Wiener Kreis sogar auf die Syntax), gilt heute eine solche Behandlung als unmöglich, denn die Semantik wird rein referenziell verstanden, das heißt als Referenztheorie sprachlicher Ausdrücke auf Objekte in der Welt. Daher verwenden die Bestimmungen (d), (e), (g) und (h) wesentlich pragmatische Begriffe. Dies soll am Beispiel (g) erklärt werden. Wenn wir die Implikation durch Disjunktion und Implikation bestimmen, das heißt, wenn wir anerkennen, dass der Satz „wenn A, dann B“ mit dem Satz „es ist nicht wahr, dass A oder B“ gleichbedeutend ist, liegt unsere Definition vollständig im Rahmen der Logik: Diese Struktur basiert auf der logischen Wahrheit im Umfang der Aussagenlogik (Aussagenkalkül). Dies ist nicht der Fall (siehe unten) im Satz: (1) Jeder Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Wenn wir die Definition von Junggeselle als unverheirateter Mann voraussetzen, kann (1) folgendermaßen reduziert werden: (2) Jedes S ist S, das heißt zum Identitätsgesetz. Andererseits ist diese Definition nicht von der Logik erzwungen; aber sie passt zum umgangssprachlichen Gebrauch. Der Ausgangspunkt für die Kritik am Begriff der Analytizität ist für Quine die Beobachtung, dass wir fünf Gruppen von analytischen Aussagen bilden können: (A) die Gesetze der Logik; (B) Exemplifikationen von Gesetzen der Logik mit Hilfe der Sätze aus der natürlichen Sprache, zum Beispiel: „London liegt an der Themse oder London liegt nicht an der Themse“; (C) Lehrsätze der reinen Mathematik; (D) Sätze wie „Jeder Junggeselle ist unverheiratet“; (E) Sätze wie „Kein Bereich kann gleichzeitig ganz rot und grün sein“. Nach Quine sind die Aussagentypen (A) bis (C) unproblematisch, weil er als Anhänger des Logizismus anerkennt, dass die Mathematik auf die Logik und Mengenlehre reduzierbar ist. Für die Analyse dieser Fälle brauchen wir jedoch den Begriff der analytischen Aussage nicht, denn wir können sie als logische Wahrheiten oder deren Substitutionsfälle auffassen. Es gibt allerdings keine befriedigende Methode zur Bestimmung der Analytizität in den Gruppen (D) und (E), das heißt durch ihre analytische Reduktion auf logische Wahrheiten auf Grund der Substitution von Synonymen. Quine hat eine Reihe von Definitionen des Analytischen untersucht und folgende Probleme darin festgestellt: (i) der Begriff der Bedeutung ist unklar; (ii) Definitionen können keine Quelle der Synonymität sein, weil Definitionen ihrerseits Synonymität voraussetzen; (iii) die Austauschbarkeit salva veritate mit Hilfe des Extensionalitätsprinzips von Ausdrücken ist eine zu schwache Bedingung, um die Synonymität zu definieren, weil Ausdrücke, die sich auf die gleiche Sache beziehen, nicht immer gleichbedeutend sein müssen; (iv) Synonymität und Austauschbarkeit synonymer Ausdrücke salva veritate setzen Analytizität voraus, das heißt etwas, das wir im Falle von intensionalen Kontexten erst bestimmen möchten; (v) die Definition der analytischen Aussage als wahr in allen Zustandsbeschreibungen ist schlecht, da der Begriff der Notwendigkeit immer vage ist; (vi) der Begriff der semantischen Regel ist ohne eine vorausgesetzte Definition der Synonymität vage und unklar; (vii) selbst wenn man akzeptiert, dass der Begriff der semantischen Regel für die Kategorie der Analytizität primär ist, erhalten wir keine Definition des Begriffs „analytischer Satz“, sondern nur die Definition des Begriffs eines „analytischen Satzes in der Sprache L“. Dies sind sehr schwerwiegende Einwände, weil sie zeigen, dass die vorgeschlagenen Definitionen von Analytizität entweder den Fehler idem per idem begehen, oder ignotum per ignotum oder obscurum per obscurum, Analytisch oder es wird nicht direkt der Analytizitätsbegriff definiert, sondern Analytizität in einer Sprache. Obwohl es nach Quine unmöglich ist, Analytizität im Allgemeinen auch in Bezug auf künstliche Sprachen zu definieren, können wir in jedem Satz (im Sinne der Arten [D] und [E]) die synthetischen und analytischen Bestandteile unterscheiden. Dieser These liegt der semantische Holismus zugrunde, also die These, dass die Bedeutungsträger keine einzelnen Sätze, sondern die ganze Sprache sind. Quine hat sich in seiner Kritik der Analytizität von anderen allgemeinen philosophischen Überzeugungen wie Nominalismus und Anti-Essentialismus leiten lassen, was in seiner Kritik des Notwendigkeitsbegriffs und seiner Verwendung der Definition des Analytischen erkennbar ist. Quine war ein Befürworter des Behaviorismus und forderte, dass der Bedeutungsbegriff, so wie auch seine Derivate, unter Verwendung von Begriffen, die im Einklang mit dieser Theorie stehen, untersucht und analysiert wird. Wenn Synonymität von Ausdrücken auf Grund behavioraler Kriterien definiert wird, das heißt, grob gesagt, nach den menschlichen Reaktionen auf diese Ausdrücke, dann kennzeichnet die Identität der Reaktionen (je ähnlicher, desto genauer) der Sprachnutzer das gleiche Verständnis der Ausdrücke. Synonymität besteht dann allerdings nur annähernd, was nach Quine zum Indeterminismus der Übersetzung führt und nicht hinreicht, den traditionellen Begriff der Analytizität zu legitimieren. Dieser behavioristische Begriff des Analytischen steht nicht im Widerspruch zur These, dass es keine klare Grenze zwischen analytischen und synthetischen Sätzen gibt. Die Dichotomie von analytisch und synthetisch wird durch einen Gradualismus ersetzt. Unabhängig von Quines Kritik begegnet die Dichotomie zusätzlichen Problemen. Insbesondere ist eine Vielzahl von logischen Systemen (zweiwertige Logik, modale Logik, mehrwertige Logik etc.) nur schwer mit der einheitlichen Auffassung der Analytisch-synthetisch-Unterscheidung in Einklang zu bringen. Außerdem haben die Postulate der theore- tischen Systeme (z. B. physikalische Theorien) analytische und synthetische Bestandteile (dies ist eine vom Holismus unabhängige Frage). Quines Einwände und andere Schwierigkeiten mit dem Begriff des Analytischen provozierten unterschiedliche Reaktionen (Woleński 2004). Die strikte Dichotomie von analytischen und synthetischen Sätzen wurde mit folgenden Argumenten verteidigt. (I) Ein logischer Zirkel in der Bestimmung eines Begriffs ist nicht notwendig schädlich und betrifft auch andere philosophische Begriffe, denn einige Begriffe treten nicht einzeln, sondern nur in Paaren auf: Analytizität und Synonymität, zum Beispiel, oder Analytizität und Notwendigkeit sollten als semantisch verwandte Begriffe behandelt werden. (II) Quine hat einer akzeptablen Analytizitätstheorie zu enge Bedingungen auferlegt, indem sie das Prädikat „analytischer Satz in L“ erklären muss, wobei die Variable L eine beliebige, natürliche oder künstliche Sprache sein kann. Typische semantische Strukturen dagegen werden nicht mit solch universeller Breite formuliert. (III) Die Definition des Begriffs analytisch muss in der Metasprache von L formuliert werden; dort sind auch die Bedingungen ihrer Angemessenheit zu prüfen, wie im Fall einer semantischen Definition von Wahrheit ( Wahrheit). (IV) Eine präzise Definition der analytischen Aussage ist in einer natürlichen Sprache unmöglich, denn sie ist dafür zu instabil und zu zweideutig. Daher kann der Begriff der analytischen Aussage in L, wobei L die Umgangssprache bezeichnet, nur angenähert expliziert sein. (V) Die Sprachpraxis zeigt, dass kompetente Sprecher einer Sprache einige Sätze allein aufgrund ihrer Bedeutung als wahr akzeptieren oder ablehnen. Die Diskussion Quines und andere Argumente gegen die universelle Dichotomie von analytischen und synthetischen Sätzen führte zur Annahme der Ansicht, dass das Prädikat „ist analytisch“ relativiert werden muss, zum Beispiel auf die Sprache, auf die Theorie, auf das begriffliche Schema usf. Selbst wenn in einem Kontext „A ist ein analytischer Satz in …“ bestimmt ist, muss man zusätzlich ana- 21