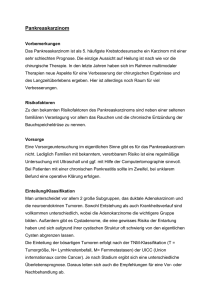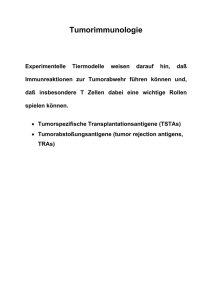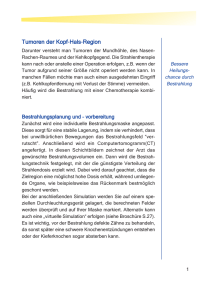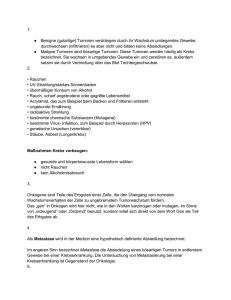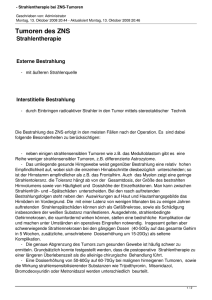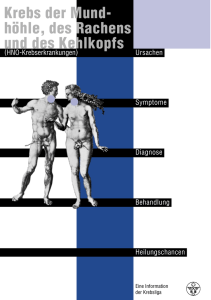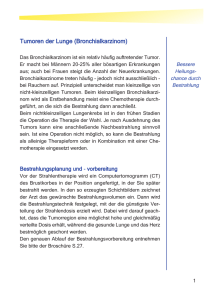Mit schweren Ionen gegen hartnäckige Tumoren
Werbung

M E D I Z I N R E P O R T Onkologie Mit schweren Ionen gegen hartnäckige Tumoren Das Universitätsklinikum Heidelberg erhält das europaweit erste Schwerionen-Synchroton für die Strahlentherapie. S also nicht gleichmäßig ausgeleuchtet, erläuterte Schlegel, sondern in viele kleine Teilchen-Strahlen zerlegt und mit jeweils unterschiedlicher Intensität punktgenau bestrahlt. In der Nähe von Risikoorganen ist die Bestrahlung weniger intensiv und im Tumorgewebe stärker. Dabei wird der Tumor mit mehreren intensitätsmodulierten Strahlenbündeln von verschiedenen Richtungen ins Visier genommen und somit optimal erfasst. In den letzten Jahren wurden klinische Erfahrungen mit der SchwerionenTherapie an der Anlage der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt gesammelt. Bestrahlt werden Patienten mit strahlenresistenten Tumoren der Schädelbasis – Chordome, Chondrosarkome und adenoidzystische Fotos: DKFZ chwere Teilchen sind die neuen Gewebe im Eingangsbereich der StrahHoffnungsträger in der radiologi- lung und hinter dem Tumor wird geschen Krebstherapie. So sprechen schont, was eine Dosissteigerung geauf die Bestrahlung mit Schwerionen genüber der Photonentherapie um 15 bis Tumoren an, bei denen die herkömmli- 35 Prozent erlaubt. Die Röntgenstrahlen che Photonentherapie nicht effizient hingegen sind elektromagnetische Welgenug ist. Diese Art der Bestrahlung len, die ihr Dosismaximum schon nach macht es möglich, Tumoren gezielt zu drei Zentimetern Eindringtiefe treffen, die inoperabel sind oder nur erreichen und danach kontinuierzum Teil entfernt werden können, weil lich fallen. Tiefer liegende Tumosie in gefährlicher Nähe lebenswichti- ren bekommen nicht die optimale ger strahlensensibler Organe liegen. Strahlendosis. Ein weiterer Vorteil der Schwerionen: Werden nun die durch „schweSie sind im Vergleich zur Photonen- oder re“ Teilchen erzeugten StrahlenProtonenbestrahlung biologisch wirksa- bündel mit Computerprogrammer – das heißt, sie schädigen das Erbgut der Tumorzellen irreversibel und verursachen somit den gewünschten Zelltod. Das geModell der Heidelberger lingt auch bei Tumorzellen, die Schwerionen-Anlage, die inwenig oder keinen Sauerstoff ternational neue Maßstäbe enthalten, und jenen, die wenig im Bereich der Strahlentherapie setzen wird teilungsaktiv sind, also langsam wachsen. Der Medizinphysiker Prof. Dr. Wolfgang Schlegel vom Karzinome. Eine OptiDeutschen Krebsforschungszenon ist die intensitätsmotrum erläutert die physikalidulierte Schwerionenschen Eigenschaften der Schwertherapie möglicherweise ionen: Sie und andere „schwere“ auch bei ProstatakarziAtomkerne (zum Beispiel Wasnomen und Weichteilserstoff, Kohlenstoff oder Helisarkomen. Studien aus Vorbereitung eines Patienten für die Intensitätsmodulierte Radiotheum) unterscheiden sich von den rapie, die eine bessere Anpassung der Bestrahlungsfelder und der Do- Japan und den USA, wo Röntgenstrahlen dadurch, dass sisverteilung an die Tumorgeometrie ermöglicht diese Anlagen bereits die Atomkerne – wenn sie mit betrieben werden, haBeschleunigern auf hohe Geschwindig- men räumlich und mit exakt vorausbe- ben bei Weichteilsarkomen und Prostakeit gebracht werden – ein Bündel von rechneter Energie und Reichweite ge- takarzinomen wesentlich bessere TheraTeilchenstrahlen bilden, das äußerst ex- steuert, kann bei Tumoren in jeder pieerfolge gezeigt als bei den konvenakt geradlinig verläuft und kaum seit- Form, Größe und Tiefe im Gewebe tionellen Therapieverfahren. lich abstrahlt. punktgenau die nötige Strahlendosis apDoch zunächst ein Blick zurück: Im Der Strahl durchdringt das gesunde pliziert werden. Dezember 1997 wurden erstmals in EuGewebe und gibt bei immer langsamer Diese hochpräzise Bestrahlung ge- ropa Krebspatienten in Darmstadt mit werdender Geschwindigkeit erst am lingt mit „intensitätsmodulierten Raster- schweren Ionen bestrahlt. Schon bald Ende seiner Reichweite die maximale scanverfahren“: Die Intensität der zeigte sich, dass die guten klinischen ErEnergie ab („Bragg Peak“) und bricht Strahlendosis wird innerhalb eines Be- gebnisse, die mit dieser Bestrahlung bei dort abrupt ab. Der Effekt: Das gesunde strahlungsfeldes „moduliert“. Es werde Patienten im kalifornischen Berkeley A 1718 Jg. 101 Heft 24 11. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt T H E M E N in den Jahren von 1957 bis 1992 erzielt worden waren, in Deutschland noch verbessert werden konnten. Zunächst wurden im Rahmen eines seit 1994 laufenden gemeinsamen Projektes des Deutschen Krebsforschungszentrums, der Radiologischen Universitätsklinik Heidelberg und des Forschungszentrums Rossendorf bei Dresden Patienten mit nicht operierbaren oder nur teilweise operierten Tumoren im Rahmen von klinischen Studien behandelt. Unter Leitung des Strahlentherapeuten und Physikers Prof. Dr. Dr. med. Jürgen Debus, jetzt Direktor der Radiologischen Universitätsklinik in Heidelberg, wurden an der Forschungsanlage jährlich 70 Patienten therapiert – mit ausgezeichneten Erfolgen: Zwischen 70 bis 90 Prozent liegt die Heilungsrate bei Patienten mit Schädelbasistumoren wie Chordomen oder niedriggradigen Chondrosarkomen. Aufgrund dieser guten klinischen Ergebnisse ist nun in Heidelberg mit dem Bau einer Bestrahlungseinheit mit einem Schwerionen-Synchroton begonnen worden. Sie soll 2006 fertig gestellt sein und wird die erste Anlage dieser Art für den Klinikbetrieb europaweit sein. Das Zentrum wird über ein Synchroton von 20 Metern Durchmesser zur Beschleunigung der Teilchen verfügen. Dabei sollen Energien von 50 bis 430 MeV erzeugt werden mit möglichen Eindringtiefen in den Tumor bis zu 30 Zentimetern. In der Schwerionenanlage wird es darum gehen, in klinischen Studien zu ermitteln, welche Art der Teilchenbestrahlung – etwa Helium-, Sauerstoffoder Kohlenstoffionen – für welche Tumorentität und für welchen Patienten am besten geeignet ist. So scheinen Weichteilsarkome besonders gut auf Sauerstoffionen und kindliche Tumoren des Bauchraums auf Heliumionen anzusprechen. Das 72 Millionen Euro teure Projekt wird zu gleichen Teilen vom Bund und vom Heidelberger Klinikum finanziert. Jährlich sollen etwa 1 000 Patienten – meist ambulant – behandelt werden. Die Kosten würden pro Patient etwa 20 000 Euro betragen und damit „im unteren Bereich“ der üblichen operativen und medikamentösen Krebstherapien liegen, erläuterte Ingeborg Bördlein Debus. A 1720 D E R Z E I T KOMMENTAR D Für die praktische Ärzteausbildung ie Ärzteausbildung erfolgt seit über hundert Jahren an den medizini- erscheint das skandinavische Modell beschen Fakultäten der Deutschen sonders geeignet. Vormittags erfolgt die Universitäten. Wilhelm von Humboldt praktische Arbeit im Krankenhaus und (1767–1835) verstand Bildung als uni- nachmittags der theoretische Unterricht. verselle Bildung „universitas literarum“ Dabei werden die klinischen Fächer und forderte die Einheit von Forschung nacheinander gelehrt. Für die Innere Medizin und die Chirurgie sind acht Monate und Lehre in völliger Freiheit. Die Medizinerausbildung folgt bis vorgesehen, für die kleineren Fächer reiheute diesem Ideal. Der Studierende der chen ein bis drei Monate. Der Vorteil läge Medizin gestaltet sein Studium sehr frei, gegenüber dem jetzigen System darin, lediglich eingeschränkt durch Pflichtvor- dass man wenigstens einen Monat jedes lesungen, Übungen und Kurse, die den Fach einmal praktisch und theoretisch Studenten nur wenig einengen. Der gelernt hat, während man gegenwärtig Medizinstudent kann deshalb seinen die kleinen Fächer gern links liegen lässt. Neigungen nachgehen, und er wendet Mit dem erfolgreichen Abschluss der letzten Klasse hätte dann dem Mediman dann das zinstudium nicht Medizinstudium Staatsexamen die Zeit und bestanden. Mühe zu, die Mit dieser notwendig wäre. FachhochschulDurch die ausbildung wäre Freiheit des Mefür die Masse dizinstudiums der künftigen erhält die Masse Ärzte eine hinder Medizinstudierenden nicht die notwendige umfas- reichende Ausbildung für den Arztberuf sende Ausbildung, die der Arztberuf er- sichergestellt. Eine Weiterbildung an fordert. Der Medizinische Fakultätentag einer Universität wäre für wissenschaftforderte deshalb schon vor Jahren, dass lich Interessierte jederzeit möglich. das Ziel des Medizinstudiums nicht mehr Auch gäbe es Promotionsmöglichkeit an der selbstständig tätige Arzt, sondern le- jeder Medizinischen Fakultät. Eine weitere Verbesserung wäre gediglich der zur Weiterbildung fähige Arzt geben, wenn man das Beispiel der Bunsein solle. Obwohl das gegenwärtige Ausbil- deswehrhochschulen kopieren würde, dungssystem der Mediziner für eine nämlich die Einführung von Trimestern kleine Gruppe von Studierenden her- bei Begrenzung der Ferien auf jährlich vier vorragende Ausbildungsmöglichkeiten Wochen. Bei einem vierjährigen Studium bietet, müssen wir sehen, dass für die stünden zwölf Trimester zur Verfügung, große Masse der Studenten die Effekti- die sicher ausreichen würden. Man hätte vität dieser Ausbildung nicht ausreicht. damit eine Verkürzung um zwei Jahre erEine erhebliche Verbesserung der Me- reicht, mit erheblichen individuellen und dizinerausbildung könnte erreicht wer- volkswirtschaftlichen Verbesserungen. Selbstverständlich müsste man dann den, wenn man sich die Erfahrungen der angelsächsischen und skandinavischen die Medizinstudenten finanziell unterLänder ansehen würde und auch das stützen, da für Erwerbsarbeit neben dem Prinzip der deutschen Fachhochschulen Studium keine Zeit bliebe. Zunächst wäre kopieren würde: eine Verschulung des zu prüfen, wie hoch sich die Einsparung Medizinstudiums. Die Studenten wür- durch die Verkürzung der Studienzeit um den in Lerngruppen (Klassen) zusam- zwei Drittel rechnen würde. Alternativ mengefasst und hätten klare Lernziele wäre ein Unterstützungsdarlehen denkmit ständiger Leistungsüberprüfung. bar, das nach Beendigung des Studiums Die nächste Klasse könnte erst nach in Raten zurückgezahlt werden könnte. bestandener Prüfung der niedrigeren In Skandinavien ist es darüber hinaus Klasse erreicht werden. Der Lehrkörper möglich, schon nach Abschluss der bestünde aus hauptamtlichen Lehr- Ausbildung in einem klinischen Fach in kräften, die keinesfalls Professorenrang diesem Fach als Assistent eingesetzt zu Prof. Dr. med. Rolf Bialas, Hamburg werden. haben müssten. Vorbild Fachhochschulen Jg. 101 Heft 24 11. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt