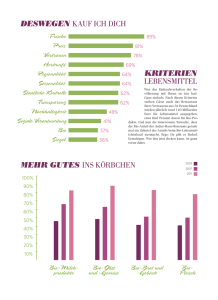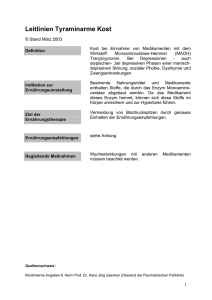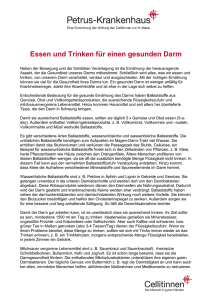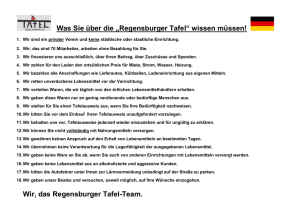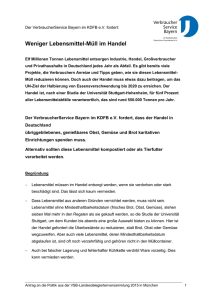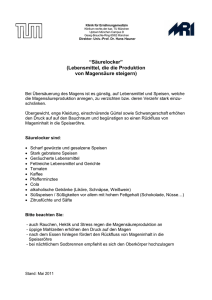Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln
Werbung

Ernährungsforschung Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln FORSCHUNG Ernährungsforschung Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln FORSCHUNG BILDUNG Vorwort Vorwort Unsere Ernährung hat Auswirkungen auf den Gesund­ heitszustand und die Lebenserwartung eines jeden Menschen. Das Leben gesundheitsbewusst und kör­ perlich, geistig und sozial aktiv zu führen, kann helfen, Krankheiten zu vermeiden. Insbesondere Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein­ zelne Krebsarten stehen in einem engen Zusammen­ hang mit unserem Lebensstil. Besonders besorgniserre­ gend ist, dass auch immer mehr jüngere Menschen von diesen Zivilisationskrankheiten betroffen sind. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat deshalb die Förderinitiative „Funktionelle Ernährungsforschung“ auf den Weg gebracht. Ziel ist, genauere Erkenntnisse über die Wechselwirkungen von Lebensmitteln und menschlichem Organismus zu gewinnen und so ein fundiertes Wissen über die Zu­ sammensetzung der Nahrung sowie die Funktionalität einzelner Nahrungsbestandteile auf physiologischer, zellulärer und molekularer Ebene zu erlangen. Die vorliegende Broschüre stellt die Projekte der Förderinitiative und die erzielten Forschungsergebnisse zu funktionellen Lebensmitteln vor. Neue Erkenntnisse der Ernährungsforschung tragen dazu bei, ernährungs­ und lebensstilabhängigen Erkrankungen gezielt vor­ beugen zu können. Das BMBF baut seine Aktivitäten auf diesem For­ schungsgebiet weiter aus. Mit dem „Aktionsplan Prä­ ventions- und Ernährungsforschung“ bündeln wir alle relevanten Forschungsansätze. Das Ziel: Die Gesund­ heit und das Wohlbefinden der Menschen in unserem Land weiter zu verbessern. Gleichzeitig stärken wir damit aber auch die internationale Wettbewerbsfähig­ keit der akademischen sowie der industriellen Ernäh­ rungsforschung in Deutschland. Prof. Dr. Johanna Wanka Bundesministerin für Bildung und Forschung Inhalt 1 Inhalt Funktionelle Ernährungsforschung 3 Die Projekte im Überblick 6 Mehr Geschmack trotz weniger Salz: Auf der Suche nach wirkungsvollen Salzgeschmacksverstärkern 7 Mit einer chemischen Formel fing es an Prof. Frank Döring leitet Deutschlands ersten Lehrstuhl für Molekulare Ernährung 11 Übergewicht und Diabetes: Wie Fette und Kohlenhydrate das Erkrankungsrisiko beeinflussen 14 „Ernährung kann zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen“ Im Gespräch mit Prof. Gerald Rimbach, Universität Kiel 16 Die Heilkraft der Beeren: Vom Wirkstoff zum funktionellen Lebensmittel 18 Pflanzenfarben für Darm und Hirn: Anthocyane schützen Zellen vor Stress 22 Wenn harmlose Mikroben zum Problem werden Prof. Dirk Haller erforscht die Wechselwirkungen von Darm und Bakterien 24 Lupinen für die Gefäßgesundheit: Ballaststoffe aus den Samen der Hülsenfrucht senken den Cholesterinspiegel 27 Dreifach funktionelle Brötchen: Weizen-Aleuron und probiotische Bakterien verringern das Darmkrebsrisiko 29 „Wir schaffen eine Schnittstelle zwischen Ernährungsforschung und Lebensmittelindustrie“ Im Gespräch mit Prof. Hannelore Daniel, ZIEL-TUM-Akademie 33 Achtung Angreifer! Wie sich die Darmschleimhaut gegen Krankheitserreger wehrt 35 Kohl gegen Krebs: Brokkoli & Co könnten zur Vermeidung von Tumorerkrankungen beitragen 37 Gesunder Genuss: Kaffee enthält zahlreiche Substanzen mit gesundheitsfördernden Wirkungen 41 Derselbe Ernährungsstil ist nicht für jeden gesund Prof. Joachim Spranger untersucht die molekularen Grundlagen von Diabetes 45 Mit Hochdruck gegen Durchfall: Ein neues Verfahren soll heilende Wirkstoffe reiner und kostengünstiger herstellen 48 „Funktionelle Ernährungsforschung erfordert die Zusammenarbeit von Akademia und Industrie“ Im Gespräch mit Prof. Dr. Joachim Schmitt, Hochschule Fulda 50 Metabolisches Syndrom: Wie pflanzliche Proteine und Ballaststoffe den Krankheitsverlauf beeinflussen 52 Kontaktadressen 54 2 � 3 FunktioneLLe ernährunGsForschunG Funktionelle Ernährungsforschung Was ist gesunde ernährung? ist für jeden Men­ schen dasselbe essen gesund? Was sollten speziel­ le Gruppen wie zum Beispiel kinder, ältere Men­ schen, Berufstätige, genetisch vorbelastete oder kranke Menschen essen, damit sie gesund bleiben oder nicht noch stärker erkranken? Zur Beant­ wortung dieser Fragen bedarf es wissenschaftlich fundierter kenntnisse über die vielfältigen Wech­ selwirkungen zwischen nahrungsbestandteilen und körperfunktionen. Die Generierung dieses Wissen fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit der Maßnahme „Funktionel­ le ernährungsforschung“: hierbei werden die komplexen Einflüsse von Lebensmitteln auf die menschliche Gesundheit untersucht und damit die Grundlage für die entwicklung funktioneller Lebensmittel mit speziellem Zusatznutzen ge­ schaffen. Deutschland ist ausreichend mit Lebensmitteln versorgt. Die Verbraucher können aus einem äußerst vielseitigen Angebot an qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln auswählen. Dennoch leiden immer mehr Bundesbürger an Krankheiten, die durch falsche Ernährung ausgelöst oder mitbedingt werden: Etwa sechs Millionen Menschen sind zuckerkrank, weit über 300.000 erkranken jedes Jahr an Krebs, und ebenso viele erleiden einen Herzinfarkt. Neben einer wach­ senden Zahl von übergewichtigen und fettsüchtigen Erwachsenen sind vermehrt Kinder und Jugendliche von Adipositas und diversen Folgeerkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien der jüngsten Zeit kommen zu dem Schluss, dass auch die Entstehung von Krebserkrankungen und chronischen Entzündungs­ prozessen insbesondere des Darms durch die Ernäh­ rung beeinflusst werden kann – zum Guten wie zum Schlechten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung für den Einzelnen und für die Gesellschaft, die viel­ fältigen Einflüsse bestimmter Lebensmittel und ihrer Bestandteile auf den Stoffwechsel und die Körperfunk­ tionen des Menschen genauer zu verstehen. Um die dazu notwendigen Anstrengungen voran­ zutreiben, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Reihe von Fördermaßnahmen zur Ernährungsforschung initiiert. Die Ernährungs­ forschung ist auch Teil der Hightech-Strategie für Deutschland, mit der die Bundesregierung durch Forschung und Innovationen neue Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen will. Die im Jahr 2002 begonnene Aktion „Netzwerke der Molekularen Ernährungs­ forschung: Lebensmittel zur Gesunderhaltung des Menschen – Krankheitsprävention durch Ernährung“ dient der strukturellen Stärkung einer ganzheitlich ausgerichteten Ernährungsforschung, die sich durch eine fachübergreifende Zusammenarbeit von Medizi­ nern, Biologen, Ernährungswissenschaftlern, Lebens­ mittelchemikern und Lebensmitteltechnologen aus­ zeichnet. Um die Nachhaltigkeit dieser Netzwerke zu sichern, wurden an mehreren Universitäten zusätzliche Professorenstellen und Arbeitsgruppen eingerichtet, die über den Förderzeitraum hinaus Bestand haben. Weiter gehend unterstützt das BMBF im Zuge eines Wettbewerbs zum Forschungsschwerpunkt „Mole­ kulare Grundlagen der humanen Ernährung“ sieben selbstständige Nachwuchsgruppen. Sie ermöglichen es jungen Wissenschaftlern, bislang ungeklärte Mechanis­ FunktioneLLe ernährunGsForschunG 4 men der molekularen Wirkung von Nahrungsbestand­ teilen auf den Stoffwechsel zu charakterisieren und deren Potenzial zur Prävention ernährungsassoziierter Krankheiten auszuloten. Die Initiative „Ernährungsforschung – für ein gesundes Leben“ dient ebenfalls dazu, die Forschungs­ kompetenz im Bereich der akademischen und indus­ triellen Ernährungsforschung in Deutschland weiter auszubauen. Die Fördermaßnahme gliedert sich in Für funktionelle Lebensmittel gibt es in Deutschland und in der EU bislang keine lebensmittelrechtlich verbindliche Definition. 1995 wurde auf Anregung der EU-Kommission eine gemeinsame Arbeitsgruppe über die Wissenschaft funktioneller Lebensmittel in Europa („Functional Food Science in Europe“, kurz: FUFOSE) eingerich­ tet. 1999 wurde folgender FUFOSE-Konsensus ver­ öffentlicht, an den sich unter anderem die amtliche Lebensmittelüberwachung anlehnt: „Ein Lebensmittel kann als ‚funktionell‘ angesehen werden, wenn es über adäquate ernährungsphysio­ logische Effekte hinaus einen nachweisbaren posi­ tiven Effekt auf eine oder mehrere Zielfunktionen im Körper ausübt, sodass ein verbesserter Gesundheits­ status oder gesteigertes Wohlbefinden und/oder eine Reduktion von Krankheitsrisiken erreicht wird. Funktionelle Lebensmittel werden ausschließlich in Form von Lebensmitteln – und nicht wie Nahrungs­ ergänzungsmittel in arzneimittelähnlichen Darrei­ chungsformen – angeboten. Sie sollen Bestandteil der normalen Ernährung sein und ihre Wirkungen bei üblichen Verzehrsmengen entfalten. Ein funktio­ nelles Lebensmittel kann ein natürliches Lebensmit­ tel sein oder ein Lebensmittel, bei dem ein Bestand­ teil angereichert bzw. hinzugefügt oder abgereichert bzw. entfernt worden ist. Es kann außerdem ein Lebensmittel sein, in dem die natürliche Struktur einer oder mehrerer Komponenten modifiziert oder deren Bioverfügbarkeit verändert wurde. Ein funkti­ onelles Lebensmittel kann für alle oder für definierte Bevölkerungsgruppen funktionell sein, zum Beispiel definiert nach Alter oder genetischer Konstitution.“ Produkte, die mit Vitaminen oder Mineralstoffen angereichert werden, zählen nicht zu den funktio­ nellen Lebensmitteln, da sie – über die Deckung des Nährstoffbedarfs hinaus – keine zusätzliche gesund­ heitsfördernde Wirkung haben. Als funktionelle Zu­ taten im strengeren Sinne haben derzeit besonders die präbiotischen Ballaststoffe sowie probiotische Mikroorganismen die größte Marktbedeutung; sie werden zur Anreicherung von Milchprodukten, Spei­ seeis, Getränken und Säuglingsnahrung eingesetzt. Intensiv erforscht werden darüber hinaus verschie­ dene Gruppen der sekundären Pflanzenstoffe. Die Bedingungen für die Auslobung eines funktionellen Zusatznutzens regelt die seit dem 1. Juli 2007 gel­ tende europäische Health-Claims-Verordnung. Prototyp eines funktionellen Lebensmittels: Dieser Gemüseburger enthält Ballaststoffe aus Lupinensamen, die cholesterinsenkend wirken. 5 FunktioneLLe ernährunGsForschunG Geschulte Sensorik-Prüfer beurteilen die geschmacklichen Qualitäten funktioneller Lebensmittel. Module mit unterschiedlichen Themenschwerpunk­ ten: Das erste Modul „Biomedizinische Ernährungs­ forschung“ konzentriert sich auf die molekularen und physiologischen Wirkungsbeziehungen zwischen Ernährung und Gesundheit – mit dem Ziel, passge­ naue funktionelle Lebensmittel zu entwickeln und entsprechende Ernährungsempfehlungen zu formu­ lieren. Ein weiteres Modul fördert „Innovationen und neue Ideen für den Ernährungssektor“; dazu wurden in einem Ideenwettbewerb Mittel für die Förderung von Nachwuchsgruppen und Forschungsprojekten bereitgestellt. Auch diese Initiative dient dem Ziel, die Ernährungs- und Gesundheitssituation in Deutschland zu verbessern und sowohl den Ernährungswissenschaf­ ten als auch der Ernährungswirtschaft Impulse für eine verstärkte Innovationstätigkeit zu geben. Die genannten Förderprogramme knüpfen an die Initiative „Funktionelle Ernährungsforschung“ an, die im Herbst 2006 begonnen wurde und nach dreijähriger Laufzeit zum Abschluss gekommen ist. Die insgesamt 13 Verbünde und ein Einzelvorhaben widmen sich einem breiten Spektrum von Fragestellungen – von der Aufklärung grundlegender Wirkzusammenhänge bis zur Entwicklung von Lebensmittel-Prototypen mit speziellem Zusatznutzen. Wichtiger Partner der Funkti­ onellen Ernährungsforschung ist die Industrie: Ins­ gesamt 29 kleine und mittelständische Unternehmen aus der Lebensmittelbranche beteiligten sich an den Verbundprojek ten und investierten etwa 4,3 Millionen Euro für vorwettbewerbliche Forschung in die vom BMBF mit 13 Millionen ausgestattete Fördermaßnah­ me. Durch diese Kooperation von akademischer und Industrieforschung wird sichergestellt, dass die erziel­ ten Forschungsergebnisse gleichermaßen für Wissen­ schaft und Wirtschaft zugänglich gemacht und so rasch wie möglich in Technologien und Produkte umgesetzt werden können. Das Förderprogramm zur Funktionellen Ernäh­ rungsforschung zeichnet sich durch seine große Vielfalt an Fragestellungen, Untersuchungsmethoden und Anwendungspotenzialen aus. Mehrere Projek­ te befassen sich mit der Prüfung und Bereitstellung bislang wenig genutzter Pflanzenstoffe, die der Ent­ wicklung von Fettleibigkeit und Diabetes vorbeugen können. Ein anderer Forschungsschwerpunkt liegt in der Untersuchung potenziell gesundheitsfördernder Eigenschaften verschiedener Pflanzeninhaltsstoffe und deren Eignung zur Prävention oder Linderung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Ge­ fäßerkrankungen oder Prostatakrebs. Weitere Projekte befassen sich mit dem Einfluss von Mikroorganismen auf Entzündungen des Magen-Darm-Trakts, mit der Identifizierung von Salzgeschmacksverstärkern zur Anwendung in kochsalzarmen Lebensmitteln oder mit der Sicherheitsprüfung von Lebensmitteln mithilfe von Biosensoren. Ziele und Ergebnisse sämtlicher Forschungsprojekte werden auf den folgenden Seiten vorgestellt. Die Projekte iM ÜBerBLick 6 Die Projekte im Überblick Universität Kiel S. 11, 16 3 KIEL HAmBURG Deutsches Institut für Lebensmittel­ technik (DIL) S. 48 Tchibo GmbH S. 41 Deutsches Institut für Ernährungs­ forschung (DIfE) Potsdam-Rehbrücke S. 7, 14, 45, 52 QUAKENBRÜCK Universität Potsdam S. 18 POTSDAM MüNSTERganzseitige Projektkarte – wird noch ergänzt Universität Münster S. 22 JENA Universität Jena S. 29 Deutsches Krebsforschungs­ zentrum (DKFZ) S. 35, 37 HEiDELBERG Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung S. 27 Wissenschaftszentrum Weihenstephan an der TU München S. 24 FREISING ZIEL-TUM-Akademie an der TU München S. 33 Kontaktadressen der Projektkoordinatoren finden Sie auf Seite 54. 7 Mehr GeschMack trotZ WeniGer saLZ Mehr Geschmack trotz weniger Salz: Auf der Suche nach wirkungsvollen Salzgeschmacksverstärkern salz – genauer gesagt: natriumchlorid – ist für alle wesentlichen Lebensfunktionen unverzichtbar. in modernen Gesellschaften übersteigt die aufnahme von kochsalz jedoch um ein Vielfaches die phy­ siologischen Bedürfnisse des körpers und erhöht das risiko von Gefäßerkrankungen, schlaganfall und herzinfarkt. in einem vom BMBF geförderten Verbundprojekt suchen ernährungswissenschaftler gemeinsam mit Lebensmittelchemikern und einem führenden aromahersteller nach substanzen, die den salzgeschmack verstärken: sie sollen eine re­ duzierung des kochsalzgehaltes in Lebensmitteln ermöglichen, ohne deren Geschmacksqualitäten zu beeinträchtigen. „Auf Arbeit folgt fast immer auch eine Belohnung“, sagt Wolfgang Meyerhof mit Blick auf sein Studienobjekt. Der Wissenschaftler leitet die Abteilung Molekulare Genetik am Deutschen Institut für Ernährungsfor­ schung (DIfE) und beschäftigt sich mit jenen biologi­ schen Strukturen, die sich im Laufe der Evolution als Teil eines besonderen Belohnungssystems entwickelt haben: die Geschmackssinneszellen. „Der Salzgehalt von Speisen geht mit Wohlgeschmack einher. Und dieser Wohlgeschmack ist die Belohnung, die uns dazu antreibt, salzhaltige Nahrungsmittel zu erschließen und zu verzehren“, erklärt Meyerhof. Leider scheint der Körper nicht zu merken, wann er sich zu viel des Guten holt. Zahlreiche Studien belegen, dass ein dauerhaft überhöhter Salzkonsum – zusammen mit weiteren Risikofaktoren – das Auftreten von Bluthochdruck und schwerwiegender Folgeerkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt fördert. „Umgekehrt lässt sich zeigen, dass eine Redu­ zierung des Kochsalzkonsums diese Symptomatiken wieder verbessern kann“, betont Meyerhof. Deshalb mahnen Ernährungswissenschaftler schon seit Langem, den täglichen Salzkonsum – also auch den Salzgehalt in verarbeiteten Lebensmitteln – drastisch Geschmackstest in einer Sensorikkabine. in Wasser gelöste potenzielle Salzgeschmacksverstärker werden mit standardisierten Kochsalzlösun­ gen verglichen. Rotes Licht in der Testkabine dient dazu, mögliche Farbeffekte der Proben zu kaschieren. Mehr GeschMack trotZ WeniGer saLZ 8 Der Salzgeschmack wird beim menschen vermutlich durch das als ionenkanal fungierende ENaC-Protein vermittelt. in einer Geschmackspore (im linken Bild durch einen ENaC-Antikörper braun gefärbt) befindet sich eine Vielzahl solcher ionenkanäle an der Spitze von Geschmackssinneszellen; diese bilden zusammen eine zwiebelförmige Geschmacksknospe (durch gestrichelte Linie umgrenzt). Zahlreiche Geschmacksknospen (braune Strukturen im mittleren Bild) liegen eingebettet im Epithel einer Geschmackspapille, die von einer grabenartigen Einbuchtung umgeben ist (im rechten Bild im Gewebeschnitt). in den Einbuchtungen gelangt das im Speichel gelöste Natrium des Kochsalzes zu den ENaC-Kanälen. zu senken. Doch mit einfachem Weglassen ist es nicht getan; schwächer gesalzene Speisen empfindet der Ver­ braucher als fad und kauft sie nicht mehr. Daher sucht Wolfgang Meyerhof zusammen mit seinen Verbundpart­ nern nach einer Alternative: „Wir wollen Stoffe isolieren und charakterisieren, die eine geringe Salzkonzentrati- Wo sich das salz versteckt Nach Lebensmitteln mit besonders hohem Salz­ gehalt gefragt, tippen die meisten Verbraucher auf Salzstangen, Chips und andere Snacks. Tatsächlich aber steuern solche Produkte nur etwa 5 % zu der Salzmenge bei, die mit der Nahrung in den Körper gelangt. Das meiste Salz nehmen wir indirekt zu uns. Extrem salzhaltig ist beispielsweise traditionell hergestellte Pizza mit Salami, denn sie kombiniert zwei besonders starke Kochsalzquellen: 35 % der täglich aufgenommenen Salzmenge versteckt sich in Brot und anderen Getreideprodukten – insbesondere auch in süßen Backwaren –, weitere 25 % in Fleischund Wurstprodukten. Gewöhnliches Brot enthält be­ zogen auf seinen mehlanteil 1,5 % Kochsalz. Schon ein verringerter Gehalt von 1 % wird vom durch­ schnittlichen Verbraucher als geschmacklos emp­ funden; dagegen schneidet Brot mit einem erhöhten Salzgehalt von 2 % bei vielen Testpersonen besser ab als normal gesalzenes Brot. Diese Vorlieben vereiteln die Bemühungen von Ernährungswissenschaftlern, den derzeitigen Kochsalzverzehr der Bundesbürger nennenswert zu senken. on wie eine vergleichsweise höhere Salzkonzentration schmecken lassen, also den Salzgeschmack verstärken.“ Mit der Suche nach geeigneten Substanzen be­ schäftigt sich Thomas Hofmann, der den Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik an der TU München innehat und dort zugleich die Abteilung Bioanalytik des Zentralinstituts für Ernährungs- und Lebensmittelforschung leitet. Hofmann hat bereits im Jahr 2003 einen überaus wirkungsvollen Geschmack­ modulator namens Alapyridain entdeckt. Er ist ein Pro­ dukt aus der Maillard-Reaktion: So nennt man Stoffe, die beim Kochen und Braten roher Lebensmittel durch komplexe chemische Reaktionen aus Kohlenhydraten und Aminosäuren entstehen und häufig geschmacksoder geruchsaktiv wirken. Daher konzentrierte sich der Chemiker auch diesmal zunächst auf Maillard-Produk­ te: „Wir haben ausgewählte Zucker und Aminosäuren ‚ex food‘, also im Reagenzglas, erhitzt und aus den Reaktionsprodukten Extrakte hergestellt. So konnten wir eine Vielzahl von Extrakten erzeugen, von denen jeder mehrere Hundert Einzelsubstanzen enthält.“ Zwei dieser Extrakte zeigten in sensorischen Tests salzge­ schmacksmodulierende Effekte. Als weitere Quelle für potenziell wirksame Sub­ stanzen nutzen Hofmann und seine Kollegen Prote­ inhydrolysate, zu denen etwa Soja- oder Fischsoßen zählen. Diese Stoffgemische werden durch enzymati­ sche Spaltung von Eiweißen hergestellt und enthalten als Abbauprodukte eine Vielzahl unterschiedlicher Peptide. Thomas Hofmann: „Handelsübliche Prote­ 9 Mehr GeschMack trotZ WeniGer saLZ Unreife Eizellen des südafrikanischen Krallenfrosches (links, im Blick durch ein Binokular gezeigt) sollen in ihrer Zellmembran das ENaC-Protein ausbilden, das vermutlich den Salzgeschmack beim menschen vermittelt. Dazu wird mithilfe feiner Glaskapillaren die genetische Vorlage in Form der RNA für das Protein ins innere jeder Eizelle injiziert (rechtes Bild). inhydrolysate sind bekanntlich sehr würzig. Deshalb wollten wir überprüfen, ob es darin Peptide gibt, die den Salzgeschmack modulieren. Außerdem haben wir mittels enzymatischer sowie saurer Hydrolyse auch eigene Proteinhydrolysate aus Lebensmittelproteinen hergestellt. So erhält man extrem komplexe PeptidMischungen, die wir chromatografisch in Fraktionen aufgetrennt haben.“ Zusätzlich verfügen die Münchner Lebensmittelchemiker über 400 unterschiedliche Pep­ tide, die aus je zwei oder drei Aminosäuren bestehen. „Einige Hundert dieser zahlreichen Substanzen haben wir in unserem Bioassay auf ihre Wirkung als Salzgeschmacksverstärker getestet“, berichtet Wolfgang Meyerhof. Dabei kamen speziell präparierte FroschOozyten zum Einsatz, die genau jene Rezeptoren in sich trugen, die beim Menschen vermutlich die Wahrneh­ mung des Salzgeschmacks ermöglichen. Oozyten sind unbefruchtete Eier, die vergleichsweise groß und robust sind und eine entscheidende Eigenschaft haben: Sie blockieren ihre zelleigene Boten-RNA, um die Bildung von Proteinen zu verhindern – schließlich werden diese ja erst nach der Befruchtung zur Versorgung des Embryos gebraucht. Von außen eingeschleuste RNA ist von dieser Blockade ausgenommen. Das machen sich die Ernährungsforscher am DIfE zunutze: Sie injizieren die genetische Vorlage für ein Protein namens ENaC, das aller Wahrscheinlichkeit nach den Salzgeschmack beim Menschen vermittelt (siehe nebenstehenden Kasten). Die so behandelten Oozyten enthalten in ihrer Zell­ membran Ionenkanäle – eben die ENaCs –, durch die Natrium-Ionen fließen können. salzig, sauer, süß und bitter … … sowie „umami“ (japanisch für fleischig, herzhaft, wohlschmeckend) – das sind die fünf bislang bekannten Grundqualitäten des Geschmackssinns. Sie lösen zusammen mit Gerüchen, Tast- und Temperaturwahrnehmungen jene Empfindung aus, die wir als Geschmack bezeichnen. Die je­ weils zuständigen Sinneszellen befinden sich, zu Geschmackspapillen gebündelt, in der Zunge und in den Schleimhäuten der mundhöhle. Für die Qua­ litäten bitter, süß und umami sind die molekularen Strukturen, die als Rezeptoren fungieren und Sin­ nessignale weiterleiten, mittlerweile gut charakteri­ siert. Dagegen sind die Details der Wahrnehmung von sauer und salzig bis heute ungeklärt. Als wahr­ scheinlichster Kandidat für den Salzrezeptor bei Säugetieren gilt ein in den Epithel-(= Schleimhaut-) zellen von Zunge und Rachenraum ausgebildeter Natriumkanal, kurz ENaC. Dieser Kanal wird von einem Protein gebildet, das aus vier Untereinheiten (2 x α, 1 x β, 1 x γ) besteht und auch in den Epi­ thelien der Niere oder Lunge wichtige Funktionen erfüllt. Wie Wolfgang meyerhof und Kollegen zei­ gen konnten, ist das ENaC-Protein beim Menschen abgewandelt: Anstelle der γ-Untereinheit enthält es eine leicht veränderte δ-Form. Das modifizierte Kanalprotein kommt in den Geschmackspapillen von Zunge und Rachenraum vor und vermittelt dort vermutlich die Salzwahrnehmung. 10 Wolfgang Meyerhof erklärt, wie sein Testsystem funktioniert: „Wir legen unsere Oozyten in eine Koch­ salzlösung zwischen zwei Elektroden und messen den Strom, der durch die Zellmembran fließt. Dann geben wir unsere Testsubstanz dazu und sehen nach, ob sich die Leitfähigkeit der Membran ändert. Falls der Strom­ fluss größer wird, schließen wir daraus, dass unsere Substanz den ENaC-Kanal aktiviert – also genau den Verstärkungseffekt hat, den wir uns wünschen.“ Tatsächlich lösten in diesem Bioassay unerwar­ tet viele Substanzen einen stärkeren Stromfluss aus, erzählt Meyerhof: „Keiner von uns hat damit gerechnet, dass es so viele positive Hits geben würde. Jetzt sind wir damit beschäftigt, sämtliche Kandidaten näher zu betrachten.“ Auffällig ist die Vielfalt der wirksamen Strukturen; sie umfassen Maillard-Reaktionsprodukte ebenso wie basische und saure Peptide. „Es ist durchaus möglich, dass wir es mit mehreren Funktionsprinzipien zu tun haben; darüber können wir bislang nur speku­ lieren“, so der DIfE-Forscher. Trotz der erfreulich hohen Trefferzahl sind die Projektpartner noch längst nicht am Ziel. Denn der eigentliche Bewährungstest jeder Substanz besteht darin, ob er wirklich den Salzge­ schmack beim Konsumenten verstärkt. Um dies herauszufinden, hat Thomas Hofmann 15 Freiwillige darin geschult, die Intensität zweier Kochsalzlösungen mit und ohne Zusatz einer Testsub­ stanz zu vergleichen. „Dabei kam heraus, dass eine 50 millimolare Kochsalzlösung zusammen mit einem unserer Kandidaten genauso salzig schmeckt wie eine 70 millimolare reine Kochsalzlösung – das ist also eine Steigerung von 40 %“, berichtet der Münchner Wis­ senschaftler. Ähnliche sensorische Experimente führt Jakob Ley in den Labors der Symrise GmbH & Co KG in Holzminden durch. Das weltweit agierende Unter­ nehmen ist auf die Herstellung von Aromastoffen und funktionellen Inhaltsstoffen für Lebensmittel speziali­ siert; als kompetenter Industriepartner koordiniert es das aus dem BMBF-Verbundprojekt hervorgegangene Folgevorhaben und trägt 50 % dessen Kosten. Jakob Ley erklärt, worin sich seine Studien von denen an der TU München unterscheiden: „Wir lassen die Reinsub­ stanzen nicht nur in Kochsalzlösung testen, sondern auch in klarer Brühe, Ketchup sowie brauner und Béchamel-Soße – also in Modellsystemen, die fertigen Nahrungsmitteln ähnlicher sind. Die darin enthaltenen anderen Aroma- und Geschmacksstoffe sowie Stärke Mehr GeschMack trotZ WeniGer saLZ und weitere Dickungsmittel können den Salzge­ schmack und auch dessen Verstärkung offenbar mehr oder weniger stark beeinflussen.“ Tatsächlich bewerten die Testpersonen die Salzigkeit vieler Testsubstanzen je nach Darreichungsform durchaus unterschiedlich. Diskrepanzen zeigen sich auch zwischen den senso­ rischen Studien und dem Bioassay. Einige Substanzen, die beim Oozyten-Test besonders gut abgeschnitten hatten, fielen bei den Probanden glatt durch. „Dass die Abweichungen so groß waren, hatten wir nicht erwar­ tet“, sagt Wolfgang Meyerhof, „deshalb sind wir nun dabei, mögliche Ursachen abzuklären.“ Insgesamt zieht der Ernährungsforscher eine positive Bilanz: „Wir haben zahlreiche Stoffe identifi­ ziert, die in beiden Testsystemen verstärkend auf den mutmaßlichen Salzrezeptor einwirken.“ Nun arbeitet sein Münchner Kollege Hofmann daran, ausgewählte Substanzen chemisch so zu modifizieren, dass sie ihre erwünschte Wirkung bei deutlich geringerer Konzen­ tration erreichen. Ein vielversprechender Kandidat ist bereits gefunden und zur Patentierung angemeldet. Acht mit menschlichem ENaC-Protein ausgestattete Frosch-Oozy­ ten werden parallel getestet. Dazu liegt jede Eizelle in einer mess­ kammer (Bildmitte) und wird mit Perfusionslösung umspült. Jede Oozyte wird von zwei Elektroden rechts und links der Messkammer penetriert, um die Spannung der Zellmembran konstant zu halten. Die Zugabe von Testsubstanzen zur Perfusionslösung verändert die membranleitfähigkeit. Die sich daraus ergebenen Stromänderungen werden aufgezeichnet und dienen als maß der Zellantwort. 11 Mit einer cheMischen ForMeL FinG es an Mit einer chemischen Formel fing es an Prof. Frank Döring leitet Deutschlands ersten lehrstuhl für Molekulare Ernährung Was muss ich essen, um beim 5000-Meter-Lauf zu punkten? sportlicher ehrgeiz motiviert Frank Döring schon als schüler, sich mit ernährungsfra­ gen zu beschäftigen. heute hat der geborene Friese an der universität kiel Deutschlands erste Profes­ sur für Molekulare ernährung inne. Damit gehört der Wissenschaftler zu den Pionieren einer neuen Forschungsrichtung namens nutrigenomik. er will verstehen, wie Lebensmittelbestandteile den Fett­ stoffwechsel und damit verbundene krankheiten beeinflussen und welche Rolle dabei der indivi­ duellen genetischen ausstattung eines Menschen zukommt. Mit einer chemischen Formel namens ATP fängt es an. Das Kürzel steht für Adenosintriphosphat und bezeich­ net die universelle Energiewährung aller Lebewesen. „Das tauchte in allen Ernährungs- und Trainings­ büchern auf, und ich wollte verstehen, was dahin­ tersteckt“, erinnert sich Frank Döring. Damit ist sein Interesse an eben jenen beiden Disziplinen geweckt, die er heute in seiner Professur vereint: Ernährungswissen­ schaft und Molekularbiologie. So zielstrebig sein beruf­ licher Werdegang im Rückblick erscheint, so untypisch hat er begonnen. „Anders als viele Studierende hab‘ ich erst mal was Vernünftiges gemacht“, sagt Döring. Geboren 1962 in Hooksiel, Friesland – Hauptschul­ abschluss – Berufsausbildung Verkäufer (Rundfunk, TV) – Karstadt Wilhelmshaven, so steht es in seiner Vita. „Dann Realschulabschluss nachgeholt, Abitur gemacht und an der Uni Gießen mit Oecotrophologie angefan­ gen“, ergänzt Döring: „Doch außer Sprachen hätte ich eigentlich alles studieren wollen.“ Die Grundlagen der angewandten Informatik fesseln ihn ebenso wie die erkenntnistheoretischen Vorlesungen von Gerhard Vollmer und Odo Marquard. „Aber ich war realistisch genug, die Philosophie als Spielbein zu betrachten. Mein Standbein war immer die Ernährungswissen­ schaft“, betont der Forscher. Als Zusatzfach belegt er Angewandte Biochemie, denn er will schon damals, im Jahr 1989, Ernährung auf der molekularen Ebene verstehen. Mit dem Diplom in der Tasche, geht er ans Göttinger Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie und schreibt dort seine Doktorarbeit über ein spezielles Gen der Bäckerhefe. „Eine solche Phase sehr starker Spezialisie­ rung als Ergänzung zu einem breiten Hauptstudium empfehle ich jedem Ernährungswissen­ schaftler“, sagt Frank Döring heute. 1995 zieht es den frisch Promovierten wieder zurück in sei­ Frank Döring, Universität Kiel ne Disziplin, zurück an die Universität Gießen. Damals beschäftigt sich das Gros seiner Kollegen mit klassischer Ernährungsphy­ siologie. Dagegen verknüpft Hannelore Daniel – als eine der Ersten ihres Fachs – ernährungswissenschaft­ liche Fragestellungen mit molekularen Ansätzen. Ihr Labor ist somit genau die richtige Adresse für Frank Döring, der die Molekularbiologie in Göttingen von der Pieke auf gelernt hat und überdies Spaß an der Lehre hat: „Damals wie heute sage ich meinen Studenten: Wenn ihr den Fettstoffwechsel verstehen wollt, dann müssen wir uns mal genauer ansehen, welche Gene da beteiligt sind und welche individuellen Unterschiede sich durch einzelne Genvarianten ergeben.“ Gemeinsam mit Hannelore Daniel will Döring he­ rausfinden, wie Nährstoffe von körpereigenen Biomolekülen aufgenommen und durch die Darmschleimhaut transportiert werden. Dazu exprimiert und charakteri­ siert er die Gene, die den Transport kurzer Eiweißmo­ leküle, sogenannter Peptide, vermitteln. Die Ergebnisse präsentiert er im Jahr 2000 in seiner Habilitations­ schrift – und wird dafür von der Deutschen Gesell­ schaft für Ernährung mit dem Hans Adolf Krebs Preis für herausragende Grundlagenforschung geehrt. An­ schließend wechselt er an die TU München, wo Daniel inzwischen eine Professur für Ernährungsphysiologie angenommen hat (siehe Interview auf Seite 33). Zusammen gehen die beiden Pioniere der Frage nach, wie sich ein Mangel an Zink auf den menschli­ chen Organismus auswirkt. Denn das Spurenelement 12 Mit einer cheMischen ForMeL FinG es an An weißen Blutkörperchen vom menschen, sogenannten monocyten (a und b unter dem Lichtmikroskop, c und d mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert), werden die Zusammenhänge zwischen Fettstoffwechsel und Entzündungsreaktionen untersucht. ist ein wesentlicher Bestandteil sogenannter Tran­ skriptionsfaktoren, die die Expression von Genen steuern. „Wir wollten wissen, welche Gene von Zink reguliert werden. Also haben wir Prototypen von DNA-Chips genutzt, mit denen wir an die 10.000 Gene screenen konnten. Überraschenderweise kam dabei heraus, dass Zink an der Regulation des Fettstoffwech­ sels beteiligt ist“, berichtet der Wissenschaftler. Im Jahr 2002 sind solche Chips eine kleine Revolution; heute gehören sie zur molekularbiologischen Standardaus­ rüstung und erlauben die Analyse ganzer Genome. „Genau genommen haben wir damals schon Nutri­ genomik betrieben – lange bevor dieses Schlagwort erfunden wurde“, so Döring. Mit finanzieller Unterstützung des BMBF gründet der Nachwuchswissenschaftler eine eigene Arbeits­ gruppe an der Universität Kiel, um dort das neue Forschungsfeld „Molekulare Ernährung“ einzuführen. Überzeugt von diesem innovativen Ansatz entschließt sich das Land Schleswig-Holstein bereits zwei Jahre später, eine neue Professur mit dieser Widmung – es ist die erste in Deutschland – zu schaffen und Frank Döring zu berufen. Der Lehrstuhlinhaber erklärt, worum es dabei geht: „Im Mittelpunkt steht die Frage: Was macht Nahrung mit den Genen und warum kann die gleiche Ernährung bei verschiedenen Personen unterschiedlich wirken?“ Solche individuellen Un­ terschiede findet Döring bei Patienten mit Typ-IIDiabetes: Mit einer neuen Generation von Genchips und anderen Hochdurchsatztechnologien gelingt es ihm nachzuweisen, dass zuckerkranke Menschen sehr unterschiedlich auf den Verzehr gesättigter Fettsäu­ ren reagieren – je nachdem, welche Variante eines bestimmten Risikogens sie besitzen. Und er kann diese Unterschiede auf eine veränderte Genregulation zurückführen. Was für Diabetes gilt, lässt sich auch für viele andere Volkskrankheiten zeigen: Die Träger bestimmter Genvarianten können Stärke und Verlauf ihrer Leiden durch ihre Essgewohnheiten stärker senken als andere. „Das führt uns zum Konzept einer personalisierten Ernährung und zur Entwicklung funktioneller Lebens­ mittel“, erklärt Döring. Dieses Konzept verfolgt ein vom BMBF finanziertes Forschungsvorhaben zur Gefäßge­ sundheit unter Leitung von Dörings Kieler Kollegen Gerald Rimbach (siehe Interview auf Seite 16). Im Fokus dieses Vebundprojekts stehen die gesundheitsför­ dernden Effekte des Pflanzenfarbstoffs Quercetin. Wie 13 Mit einer cheMischen ForMeL FinG es an sich zeigte, profitieren gefäßkranke Patienten unter­ schiedlich stark von der regelmäßigen Einnahme dieser Wirksubstanz – je nachdem, welche von vier möglichen Varianten eines ApoE genannten Gens sie besitzen. „ApoE3-Träger können ihr Ateriosklerose-Risiko durch Quercetin möglicherweise stärker reduzieren als ApoE4Träger“, betont Döring, der die Blutzellen der Probanden mittels Genexpressionsanalysen untersucht hat. Eine Vielzahl von mittelständischen und großen Unterneh­ men aus der deutschen Lebensmittelindustrie beteiligt sich im Rahmen des Verbundprojekts an der Entwick­ lung quercetinangereicherter Produkte. Sie könnten künftig als funktionelle Lebensmittel einen Beitrag zur Gefäßgesundheit bestimmter Risikopatienten liefern. Noch weiter in die Zukunft zielt ein weiteres BMBFProjekt unter Federführung von Frank Döring. Unter dem Titel „Vision Epifood“ treibt es die Entwicklung einer zweiten Generation von funktionellen Lebens­ mitteln voran, die auf strukturelle Veränderungen der Erbsubstanz abzielen. Mit diesem Forschungsansatz be­ tritt der Ernährungswissenschaftler abermals Neuland Durch markierung mit einem grün fluoreszierenden Protein lässt sich ein an der Aktivierung von Fettsäuren beteiligtes Enzym in der Zelle lokalisieren (rot: mitochondrien, blau: Zellkern). und ist damit auch im Kieler Exzellenzcluster „Entzün­ dung an Grenzflächen“ vertreten. Mit leistungsfähigen Genchips gelingt es nachzuweisen, dass zucker­ kranke Menschen sehr unterschiedlich auf den Verzehr gesättigter Fettsäuren reagieren – je nachdem, welche Variante eines bestimm­ ten Risikogens sie besitzen. „Nutriepigenomik“ heißt die vielversprechende Disziplin, die sich mit den dauerhaften und genom­ weiten Veränderungen genetischer Aktivität befasst. Im konkreten Fall geht es darum, einen verringerten Kalorienbestand vorzutäuschen. Denn es gibt klare Hinweise, dass eine eingeschränkte Kalorienzufuhr die Gesundheit nachhaltig fördert und das Leben verlän­ gert, indem sie den Fettstoffwechsel sowie Entzün­ dungsvorgänge in Organismen beeinflusst. Die mole­ kularen Grundlagen dieser Wechselwirkungen sollen an Fruchtfliegen, Mäusen, Schweinen und schließlich auch an Menschen erforscht werden. Parallel dazu su­ chen die Verbundpartner nach pflanzlichen Extrakten, die dem Körper mittels epigenetischer Effekte einen verminderten Kalorienbestand vortäuschen. Frank Döring betont den Grundlagen- und Anwendungsbe­ zug dieses ehrgeizigen Vorhabens: „Einerseits wollen wir verstehen, wie Nahrungsenergie unser Epigenom dauerhaft verändern kann. Andererseits soll unsere Forschung übergewichtigen Menschen helfen, die auf­ grund entzündlicher Prozesse besonders gesundheits­ gefährdet sind. Molekulare Ernährungsforschung hat also einen erkenntnisstiftenden und praktischen Sinn.“ 14 ÜBerGeWicht unD DiaBetes Übergewicht und Diabetes: Wie Fette und Kohlenhydrate das Erkrankungs­ risiko beeinflussen ob ein Mensch im Laufe seines Lebens an adipo­ sitas oder Diabetes erkrankt, hängt zum teil von seinem Lebensstil – insbesondere der ernährung – ab, zum teil aber auch von seiner genetischen ausstattung. Wissenschaftler des Deutschen ins­ tituts für ernährungsforschung (Dife) in Potsdam spüren Genvarianten auf, die in abhängigkeit von bestimmten nahrungsbestandteilen das Diabetes­ risiko beeinflussen. Ihr überraschender Befund: kohlenhydrate spielen eine bedeutendere rolle als Fette. „Entscheidend für die Entstehung von Übergewicht und Diabetes ist nicht nur, wie viel und was wir essen, sondern auch, wie wir die aufgenommene Nahrung in unserem Körper umsetzen“, sagt Hans-Georg Joost, wissenschaftlicher Direktor des DIfE. Dass es dabei große Unterschiede gibt, lässt sich eindrucksvoll an verschiedenen Mausstämmen beobachten (siehe Bild): Die „New Zealand obese“-Maus nimmt durch fettrei­ ches Futter sehr schnell an Gewicht zu, wird adipös und erkrankt schließlich an Typ-2-Diabetes. Dagegen Mäuse des „New Zealand obese“-Stamms (links) nehmen bei einer fettreichen Diät schnell an Gewicht zu und erkranken schließlich an Diabetes. Dagegen bleiben Artgenossen des „Swiss Jim Lambert“Stamms (rechts) wegen eines Gendefekts bei gleicher Ernährung schlank. nehmen Mäuse des „Swiss Jim Lambert“-Stamms trotz einer ebenso fettreichen Diät kaum zu und haben kei­ nen überhöhten Blutzuckerspiegel. Durch gezielte Rückkreuzungsexperimente zwi­ schen diesen beiden Mausstämmen konnten HansGeorg Joost und sein DIfE-Kollege Hadi Al-Hasani das Gen identifizieren, das die Nager trotz fettreicher Kost schlank bleiben lässt und vor Diabetes schützt. Dieses Gen interagiert mit allen bisher bekannten Diabetes­ genen und spielt zugleich eine wesentliche Rolle bei der Regulation des Fett- und Glucosestoffwechsels. „Wir haben diese äußerst zeitaufwendigen Experimente vor mehr als zehn Jahren begonnen und nun – auch mit finanzieller Förderung des BMBF – zu einem guten Ende gebracht“, freut sich Joost. Doch damit nicht ge­ nug: Zusammen mit Stephan Scherneck vom DIfE hat der Mediziner ein weiteres neues Risikogen für Typ­ 2-Diabetes identifiziert und zudem den Mechanismus seiner Regulation entdeckt: „Wir konnten zeigen, dass die Wirkung des Risikogens Zfp69 bei einigen Maus­ stämmen durch ein Transposon, das heißt ein Erb­ gutfragment viralen Ursprungs, abgeschwächt wird“, erklärt Joost. Das neu entdeckte Diabetesgen lässt sich auch beim Menschen nachweisen. Von der Aufklärung der Genfunktionen erhoffen sich die Forscher daher wichtige Impulse für die Vorbeugung und Behandlung von Übergewicht und Diabetes. In dem vom BMBF geförderten Projekt zur Funk­ tionellen Ernährungsforschung will Hans-Georg Joost nun herausfinden, ob sich die Entstehung von Diabetes bei „New Zealand obese“-Mäusen durch Nahrungs­ komponenten modifizieren lässt. Zahlreiche Studien weisen auf einen günstigen Einfluss von Omega3-Fettsäuren wie der Linolensäure hin, die vor allem in Seefischen und bestimmten Pflanzenölen enthalten sind. Ob diese Öle sich tatsächlich zur Vorbeugung von Diabetes eignen, sollte durch Fütterungsversu­ che an den zu Übergewicht und Diabetes neigenden Mäusen überprüft werden. „Unser Industriepartner, die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, hat drei verschiedene Rapssorten mit unterschied­ lich hohen Gehalten an Linolensäure zur Verfügung gestellt. Das daraus gewonnene Öl sowie Leinöl haben 15 ÜBerGeWicht unD DiaBetes Ein Acrylamidgel wird mit DNA-Proben beladen. Damit lässt sich der Verlauf von Rückkreuzungsexperimenten zwischen unterschiedlichen mausstämmen verfolgen. wir getestet. Als Kontrolle diente Distelöl, das weniger als ein halbes Prozent Linolensäure enthält“, so Joost. Eine Gruppe Mäuse bekam elf Wochen lang eine Diät, die 40 % reines Schweinefett enthielt; bei den anderen Gruppen war gut ein Drittel des Fettanteils durch eines der Pflanzenöle ersetzt. Das Ergebnis des Versuchs war überraschend: „An­ ders als erwartet, hatte die Fettart keinen Einfluss auf die Diabetesentstehung – alle Mäuse wurden gleicher­ maßen dick und zuckerkrank“, fasst Joost zusammen. Daher richtet sich das Augenmerk der DIfE-Forscher nun auf andere Nahrungskomponenten, vor allem auf Kohlenhydrate. Zunächst wurden Mäuse mit einer Diät gefüttert, die völlig frei von Kohlenhydraten war; eine Kontrollgruppe bekam mit Kohlenhydraten versetztes Futter. Nach 17 Wochen waren die Mäuse beider Grup­ pen gleichermaßen übergewichtig. Hinsichtlich des Gesundheitsstatus unterschieden sich die Tiere jedoch deutlich: Die meisten der mit Fetten und Kohlenhy­ draten gefütterten Mäuse wiesen bereits nach acht Wochen übermäßig hohe Blutzuckerwerte auf; nach Abschluss des Versuchs waren zwei Drittel dieser Tiere an Diabetes erkrankt. Dagegen blieben die kohlenhy­ dratfrei ernährten Nager von hohen Blutzuckerwerten und Diabetes verschont. Durch vergleichende Untersuchungen der Insu­ lin produzierenden Inselzellen beider Mausgruppen konnte Hadi Al Hasani zur Aufklärung der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen beitragen: Demnach beeinflussen die Kohlenhydrate die Aktivität zahlreicher Gene, die auch beim Menschen mit der Di­ abetesentstehung in Zusammenhang gebracht werden. Der Großteil dieser Gene wird bei Kohlenhydratzufuhr verstärkt abgelesen; infolgedessen werden vermehrt solche Enzyme hergestellt, die den oxidativen Stoff­ wechsel in den Inselzellen anregen und zu oxidativem Stress führen. „Der Stress lässt die Zellen schneller altern und früher sterben. Damit zeigen unsere Daten, dass Kohlenhydrate besonders in Zusammenhang mit einer fettreichen Ernährung kritisch zu sehen sind. Sie schädigen die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse und begünstigen so Diabetes“, erklärt Al Hasani. „Eine kohlenhydratfreie, fettreiche Ernährungswei­ se wie in unseren Versuchen ist für Menschen nach­ teilig und auch nicht praktikabel“, merkt Hans-Georg Joost an: „Dennoch sollten wir in unseren Ernährungs­ empfehlungen ein größeres Gewicht auf die Effekte der Kohlenhydrate legen. Mit anderen Worten: Personen mit erhöhtem Diabetesrisiko sollten Nudeln statt Kartoffeln und Vollkorn- statt Weißbrot essen, da sie so einen schnellen und übermäßigen Anstieg der Blutzu­ ckerwerte vermeiden können.“ GesPräch Mit ProF. riMBach, uniVersität kieL 16 „Ernährung kann zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen“ im Gespräch mit Prof. Gerald rimbach, universität kiel Welche aspekte der Gefäßgesundheit untersuchen sie? Gerald Rimbach, Universität Kiel Unterschiedliche Varianten von Genen des Lipid­ stoffwechsels beeinflussen die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine besondere Funktion kommt hierbei dem Apolipoprotein E zu, das in drei Formen – ApoE2, ApoE3 und ApoE4 – ausgeprägt ist. Man weiß seit Längerem, dass die Träger von ApoE4 ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben – vor allem, wenn weitere Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel oder fettreiche Ernährung dazukommen. Eine bessere Kenntnis dieser Zusammenhänge könnte einer personali­ sierten Ernährung den Weg weisen. herr Professor rimbach, wie kann die ernährung zur Gefäßgesundheit beitragen? Wie häufig sind die verschiedenen apoe-Varianten in der Bevölkerung? Ernährung ist ganz allgemein eine der wichtigsten Strategien zur Prävention von Krankheiten. Hin­ sichtlich der Gefäßgesundheit deuten epidemiolo­ gische Befunde darauf hin, dass eine mediterrane Ernährung, die reich an Obst und Gemüse – und damit auch an sekundären Pflanzenstoffen – ist, zur Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen kann. Unsere Forschung konzentriert sich auf die Flavonoide, als Modellsubstanz haben wir das Quercetin ausgewählt. Es ist in vielen hei­ mischen Obst- und Gemüsesorten enthalten; wir gewinnen es aus natürlichen Quellen, nämlich aus den Schalen von Zwiebeln und Äpfeln. Am häufigsten ist das ApoE3 vertreten, der E4- Ge­ notyp findet sich höchstens bei 20 % der Bevölke­ rung, in Reinform – also bei homozygoten Allelträ­ gern – sogar nur bei einem von hundert. Interessanterweise gibt es ein geografisches Ge­ fälle: Im Norden leben mehr ApoE4-Träger als im Süden. In den mediterranen Ländern haben die Menschen also nicht nur die „bessere Ernährung“ im Hinblick auf die Gefäßgesundheit, sondern auch den „besseren Genotyp“. Bei sehr alten Men­ schen findet man übrigens nur selten den ApoE4Genotyp – offenbar weil dieser infolge eines erhöh­ ten Erkrankungsrisikos abnimmt. Was hat Quercetin mit der Gefäßgesundheit zu tun? Wie messen Sie den Einfluss von Quercetin auf entzündliche Prozesse? Bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankun­ gen spielen entzündliche Prozesse eine entschei­ dende Rolle, und Quercetin zeichnet sich – dies konnten wir in eigenen Zellkulturstudien zeigen – durch eine entzündungshemmende Wirkung aus. Da liegt die Verbindung. Zunächst haben wir über Genchip-Analysen un­ tersucht, welche Gene reagieren, wenn sie mit dem Flavonoid in Kontakt gebracht werden. Dabei zeig­ te sich, dass Gene, die an chronisch entzündlichen Reaktionen beteiligt sind, durch Quercetin eher abgeschaltet werden. Außerdem haben wir das 17 GesPräch Mit ProF. riMBach, uniVersität kieL Äpfel und viele andere Obst- und Gemüsesorten lagern in ihren Schalen große Mengen Quercetin ein, um sich vor Fraßschädlingen zu schützen. menschliche Gen für ApoE3 oder ApoE4 in weiße Blutzellen eingebaut und mit Mäusen gearbeitet, die humanes ApoE3 und ApoE4 bilden. Wir lassen Quercetin auf diese Zellkulturen einwirken oder füttern damit die transgenen Mäuse und untersu­ chen anschließend anhand verschiedener Bio­ marker die Stärke entzündlicher Prozesse. Solche Biomarker haben wir auch bei Hochrisikopatienten gemessen, die sechs Wochen lang täglich eine Kapsel mit 150 Milligramm Quercetin gegessen haben. Welches sind die wesentlichen erkenntnisse aus ihren studien? Sowohl die ApoE3- als auch die ApoE4-transgenen Mäuse reagieren auf die Zufuhr von Quercetin mit einer Entzündungshemmung – allerdings spricht der E3-Genotyp wesentlich stärker auf den Wirkstoff an. Das bedeutet für die Träger der E4-Genvariante: Sie besitzen einerseits den RisikoGenotyp im Hinblick auf ihre Gefäßgesundheit und können diese andererseits auch weniger stark durch Ernährung beeinflussen. Positiv werten wir die Hu­ manstudie an den Risikopatienten: Bei ihnen senkte die tägliche Einnahme von Quercetin – unabhängig vom Genotyp – zwei bedeutende Risikofaktoren in der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankun­ gen, nämlich den systolischen Blutdruck und die Konzentration an oxidiertem LDL-Cholesterin. Ein weiterer wichtiger Befund ergibt sich aus den Dosis­ Wirkungs-Studien: Selbst in sehr hohen Dosen konnten wir keine toxischen Effekte beobachten. Dies erscheint wichtig, wenn man auf eine künftige Anreicherung funktioneller Lebensmittel abzielt. Welche erfahrungen haben sie bei der ent­ wicklung funktioneller Produktprototypen gemacht? Quercetin hat – wie auch einige andere Flavonoide – eine Bitternote. Es hat eine Menge an Technologie und Know-how erfordert, diese Bitternote durch lebensmitteltechnologische Verfahren abzudecken – doch für einige Produkte wie Müsliriegel oder Backwaren ist es unseren Industriepartnern zusam­ men mit den Lebensmitteltechnologen gelungen. Aus unserem BMBF-Netzwerk zur Funktionellen Ernährungsforschung haben sich auch Patentan­ meldungen ergeben. Die Basis für die Entwicklung gesundheitsbezogener Lebensmittel scheint also gelegt, und es gibt ernsthafte Überlegungen unserer Industriepartner, hier mit eigenem Engagement anzuknüpfen. An dem Forschungsvorhaben beteiligen sich die Univer­ sität Kiel mit verschiedenen Arbeitsgruppen (Molekulare Prävention, Lebensmittelwissenschaft, Tierernährung und Stoffwechselphysiologie, Humanernährung, Lebens­ mitteltechnologie) sowie das max Rubner-institut in Kiel. In enger Kooperation mit den akademischen Partnern arbeiten sechs Unternehmen – Kampffmeyer Food Inno­ vation GmbH, A.C.T. FOODS, Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA, Cremilk GmbH, Carl Kühne KG (GmbH & Co.) und Rudolf Wild GmbH & Co. KG – an der Entwicklung geschmacklich ansprechender Produkte mit erhöhtem Gehalt an Quercetin, die als Prototypen funktioneller Lebensmittel für die Gefäßgesundheit dienen. 18 Die heiLkraFt Der Beeren Die Heilkraft der Beeren: Vom Wirkstoff zum funktionellen Lebensmittel Die gesundheitsfördernden Wirkungen von Beeren­ inhaltsstoffen aus der Gruppe der Flavonoide sind durch zahlreiche wissenschaftliche studien belegt. Dagegen sind die Wirkmechanismen dieser stoffgruppe weitgehend unbekannt. Wie die Pflanzenstoffe im menschlichen Organismus verstoffwechselt werden, welche rolle dabei die Darmmikrobiota spielt und wo genau die einzelnen substanzen ihre Wirkung entfalten, untersucht ein Forschungsverbund aus akademischen arbeitsgrup­ pen und industriepartnern. im Fokus steht eine bislang wenig erforschte klasse der Flavonoide, die Procyanidine. „Procyanidine – Vom besseren Verständnis der Wir­ kung zur Entwicklung funktioneller Lebensmittel“ heißt das vom BMBF geförderte Forschungsvorhaben unter Leitung von Sabine Kulling, die am Max RubnerInstitut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe arbeitet. Der Name ist Programm: Das Projekt reicht von grundlagenorien­ tierten bis zu anwendungsbezogenen Fragestellungen. Entsprechend unterschiedlich sind die Expertisen der Projektpartner. Peter Winterhalter, Leiter des Instituts für Lebensmittelchemie der TU Braunschweig, entwi­ ckelte Methoden, um die Naturstoffe zu charakteri­ sieren, in Reinform zu isolieren und in ausreichender Menge bereitzustellen. Am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrücke untersucht die Mikrobiologin Annett Braune, wie ernährungsphysiologisch wichtige Procyanidine von Darmbakterien ab- und umgebaut werden. Sabine Kulling betrachtet den Metabolismus sowie die Bio­ verfügbarkeit einzelner Komponenten im menschli­ chen Organismus und untersucht deren Wirkung auf Darmkrebszellen. Esther Mayer-Miebach und Diana Behsnilian prüfen – ebenfalls am Max Rubner-Institut in Karlsruhe –, ob und wie unterschiedliche Verar­ beitungstechniken den Gehalt an Procyanidinen in Lebensmitteln beeinflussen. Als Rohstoffe dienen Traubenkernextrakt und Aroniabeeren (siehe Kasten), die von zwei Industrie­ partnern bereitgestellt werden. Die Kelterei Walther GmbH in Arnsdorf bei Dresden, ein Familienunterneh­ men, das sich seit Jahrzehnten auf Nischenprodukte wie Aronia konzentriert, liefert die Aronia-Beeren, den daraus gewonnenen Direktsaft sowie den werthaltigen Pressrückstand (Trester); die BREKO GmbH in Bremen, die auf funktionelle Ingredienzien aus Trauben spezia­ lisiert ist, stellt den Traubenkernextrakt. Dass anthocy­ anhaltige Früchte gesundheitsfördernde Eigenschaften haben, wird seit Langem vermutet. Sowohl die Volksmedizin als auch wissenschaftliche Studien liefern dafür zahlreiche Hinweise. „Welche Aroniabeeren sind besonders reich an Procyanidinen, denen ge­ sundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben werden. im Rahmen des BmBF-Forschungsvorhabens wird das Verhalten dieser Verbindungen im menschlichen Organismus untersucht. Deutschlands größte Aroniaplantagen liegen in Sachsen. Die heiLkraFt Der Beeren 19 aroniabeeren Schwarze Eberesche oder Apfelbeere heißt sie im Volksmund, Aronia melanocarpa lautet ihr wissen­ schaftlicher Name. Tatsächlich gleichen die üppigen weißen Blütendolden der Aroniapflanze denen der Eberesche. Der Saft reifer Aroniabeeren ist beson­ ders reich an Procyanidinen: 664 milligramm sind in 100 Gramm frischen Früchten enthalten, mehr als 30-mal so viel wie in der gleichen menge Holun­ derbeeren. Der zu den Rosengewächsen zählende Strauch ist in Nordamerika heimisch; Anfang der 1970er-Jahre wurde er in der damaligen DDR großflächig angepflanzt und Aroniabeeren über­ wiegend in Form ihrer Extrakte zur Farbgebung bei Lebensmitteln verwendet. Auch heute noch werden die holzigen Pflanzen in Sachsen kultiviert; zwischen Dresden und Meißen liegt das größte Aroniaanbau­ gebiet Deutschlands. Die Beeren werden getrocknet oder als Saft, daneben auch als Tee, Gelee, Sirup, Likör und Obstwein angeboten. Substanzen im Einzelnen die beobachteten Effekte verursachen, ist noch unklar“, sagt Sabine Kulling, „denn dazu muss man reine Verbindungen testen – und die lassen sich oft nur mit großem Aufwand in ausrei­ chenden Mengen gewinnen.“ In den Beeren kommen die Procyanidine als ein komplexes Gemisch vor: Neben den beiden Einzelbau­ steinen – den Monomeren Catechin und Epicatechin – gibt es Oligomere aus zwei bis zehn und Polymere aus noch mehr dieser monomeren Bausteine, die zudem unterschiedlich verknüpft sein können. Peter Winterhalter ist es nun zusammen mit seiner Dokto­ randin Tuba Esatbeyoglu gelungen, mithilfe moderner chromatografischer Methoden und semisynthetischer Verfahren ein breites Spektrum an Procyanidinen aus Aronia- und Traubenkernextrakt zu isolieren. Durch diese Pionierarbeit konnten sie den Verbundpartnern die sechs bedeutendsten Dimere, ein Trimer sowie je eine Fraktion aus oligo- und polymeren Procyanidinen in ausreichender Menge und mit hohem Reinheitsgrad zur Verfügung stellen. Was geschieht mit diesen Verbindungen, wenn sie mit der Nahrung in den menschlichen Körper gelangen? Um ihren Metabolismus aufzuklären, verfolgen die Potsda- Ein Teil der wertvollen Procyanidine bleibt nach der Saftgewinnung im Pressrückstand (Bilder oben und mitte). Am max Rubner-institut in Karlsruhe wurden geeignete Verfahren ermittelt, um den Trester zu einem Pulver (unten) zu verarbeiten, das sich als Lebensmittelzu­ satz verwenden lässt. 20 Die heiLkraFt Der Beeren mer Wissenschaftlerinnen verschiedene Ansätze. Sabine Kulling betrachtet zusammen mit ihrer Doktorandin Ste­ fanie Wiese die Rolle der körpereigenen fremdstoffmeta­ bolisierenden Enzyme: Mit einem geeigneten Testsystem aus Leberhomogenaten konnten sie nachweisen, dass die endogenen Enzyme vorrangig monomere Procyanidine umsetzen, kaum aber die längerkettigen. Was genau die Mikroorganismen mit ihnen an­ stellen, will Maren Kutschera, Doktorandin am DIfE, zusammen mit Annett Braune herausfinden. Um eine repräsentative Mischung der menschlichen Darmmi­ krobiota in ihrer natürlichen Zusammensetzung zu bekommen, bat sie gesunde Testpersonen um frische Stuhlproben. Dann versetzte sie Suspensionen dieser Proben – und parallel dazu verschiedene Reinkulturen von verbreiteten Darmbakterien – mit gereinigten Ein­ zelsubstanzen aus dem Braunschweiger Labor oder mit Extrakten aus Aroniabeeren und Traubenkernen. Das Experiment lief bis zu sieben Tage; während der gesam­ ten Zeit wurden Proben entnommen und analysiert. Ergebnis: „Alle Procyanidine werden umgesetzt, jedoch dauert es bei den Oligo- und Polymeren deutlich länger als bei den Di- und Trimeren“, so Braune. Der Abbau erfolgt in einer Art Kaskade: Erst werden die größeren Einheiten in Monomere zerlegt; dann entstehen daraus bis zu 20 kurzlebige Zwischenprodukte, aus denen am Ende hauptsächlich eine phenolische Säure, die 3-(3-Hydroxyphenyl-)Propionsäure, gebildet wird. Allerdings kommt dieser Prozess nicht immer zum Ende. „Wenn wir den Traubenkernextrakt in hö­ heren Konzentrationen einsetzen, ist die Umsetzung unvollständig – das weist darauf hin, dass am Abbau beteiligte Bakterien von den Inhaltsstoffen in ihrem Wachstum behindert werden“, sagt Braune. Weniger empfindliche Arten könnten davon möglicherweise profitieren – was eine veränderte Zusammensetzung der Mikrobiota zur Folge hätte. Welche Bedeutung dies für den menschlichen Organismus hat, müssen weite­ re Versuche zeigen. Tatsächlich reagieren verschiedene Bakterienarten sehr unterschiedlich auf den procyani­ dinreichen Traubenkernextrakt, fand Braune heraus: „Wir isolierten Darmbakterien, deren Wachstum ge­ hemmt wurde, und andere, die mit dem Extrakt besser wuchsen. Welche Spezies in den Stuhlproben – und somit im Darm – an der Spaltung der Procyanidine in die Monomere beteiligt sind, wissen wir noch nicht“, so die Mikrobiologin. Mithilfe dieses Gegenstromverteilungs-Chromatografen gelang es Lebensmittelchemikern der TU Braunschweig, etwa 900 milligramm hochreines Procyanidin B1 sowie dieselbe menge eines oligomeren Procyanidins zu gewinnen und für die Humanstudien zur Verfügung zu stellen. Parallel zu Braunes Studien untersuchte Sabine Kulling, wie die einzelnen Procyanidine im menschli­ chen Organismus verstoffwechselt werden. „Wir woll­ ten wissen, was wirklich im Blutkreislauf ankommt“, betont die Lebensmittelchemikerin. Dazu erklärten sich sieben gesunde Männer bereit, Gelatinekapseln mit verschiedenen Procyanidinen, die von den Braun­ schweiger Kollegen isoliert und gereinigt worden waren, einzunehmen. „Die Probanden bekamen jeweils eine einmalige Dosis Epicatechin, in der zweiten Phase ein Dimer und schließlich noch eine Oligomerfraktion. Die Mengen wurden auf ihr Körpergewicht standardi­ siert und entsprachen etwa dem natürlichen Procyani­ din-Gehalt von zwei Äpfeln“, so Achim Bub vom MRI, der als Mediziner die Studie leitete. Vor der Einnahme und während der folgenden 48 Stunden wurden die Testpersonen mehrmals um Blut-, Urin- und Stuhl­ proben gebeten. Aus diesem umfangreichen Datensatz konnte Stefanie Wiese am Lehrstuhl für Lebensmittel­ chemie der Universität Potsdam mittels gaschroma­ tografischer und massenspektrometrischer Verfahren den Stoffwechsel der Procyanidine nachvollziehen. Das Fazit: „Wir konnten im Blut unserer Probanden die Die heiLkraFt Der Beeren 21 Mono- und Dimeren nachweisen, aber keine Oligome­ ren. Außerdem fanden wir darin die gleichen Produkte, die unsere Kollegen am DIfE als Hauptmetabolite der Darmbakterien beschrieben haben, nämlich verschie­ dene phenolische Säuren“, so Kulling. Die Oligomere könnten vor allem im Dickdarm ihre gesundheitsfördernde Wirkung entfalten. Darauf deutet eine weitere Versuchsserie der Potsdamer Forscherin hin, in der sie den Einfluss der Procyanidine auf huma­ ne Dickdarmepithel-Zelllinien untersucht hat: Dabei hatte eine Zelllinie ähnliche Eigenschaften wie normale, gesunde Darmepithelzellen, die andere war dagegen chemisch zur Krebszelle transformiert. Eindeutiges Ergebnis: „Die monomeren und dimeren Procyanidine bewirken bei keiner der beiden Zelllinien messbare Ver­ änderungen. Dagegen hat die Fraktion der Oligomeren einen deutlich wachstumshemmenden Effekt auf die tumorigenen Darmkrebszellen, während sie die nicht transformierten Zellen kaum beeinflusst“, sagt Kulling. Diese potenziell antikanzerogene Wirkung zeigte sich auch, wenn statt der Oligomerenfraktion ein Trauben­ kernextrakt der Firma BREKO GmbH verwendet wurde. Die gesundheitsfördernden Beereninhaltsstoffe sind vorwiegend in den Zellwänden der Fruchtschalen und -kerne enthalten. Was bei der Herstellung von Aroniasaft mit ihnen geschieht, haben Esther MayerMiebach und Diana Behsnilian vom MRI in Karlsru­ he untersucht. Die beiden Chemikerinnen konnten zeigen, dass ein Teil der Procyaninide und Anthocyane unversehrt in den Saft gelangt, der größte Teil aber im Pressrückstand bleibt. Deshalb wollten sie den Trester zu Pulver verarbeiten, das sich als Lebensmittelzu­ satz verwenden lässt. Dazu haben sie verschiedene Verfahren wie Gefrier- oder Konvektionstrocknung sowie eine Kombination aus Warmluft- und Mikro­ wellentrocknung verglichen und das Trockenprodukt anschließend zermahlen. Wie sich zeigte, wurden die Inhaltsstoffe in keinem Fall zerstört. Alternativ wurde der Trester mit Wasser befeuchtet und dann mit einer speziellen Rührwerkskugelmühle im Nassmahlverfahren zerkleinert. Dabei erhält man wesentlich kleinere Partikel – und damit eine höhere Ausbeute an herauslösbaren und folglich analysierba­ ren Procyanidinen. „Wir gehen davon aus, dass diese Feinzerkleinerung der Zellwände auch das Heraus­ lösen der Procyanidine während der Verdauung im Um die Darmbakterien in ihrer natürlichen Zusammensetzung untersuchen zu können, werden frische Stuhlproben von gesun­ den Testpersonen aufbereitet (oben). Damit die Bakterien unter sauerstofffreien Bedingungen – ähnlich wie im menschlichen Darm – wachsen können, werden alle notwendigen Arbeiten an der Anaerobierbox ausgeführt (unten). Magen-Darm-Trakt unterstützt. Wenn wir das Aronia­ pulver zusätzlich mit heißem Wasser extrahieren und den Extrakt trocknen, können wir die gewünschten Inhaltsstoffe insgesamt fünffach konzentrieren“, er­ klärt Mayer-Miebach. Der Polymerisierungsgrad der Procyanidine – sprich: ihre Kettenlänge – wird durch die unterschiedlichen Zerkleinerungs- und Trock­ nungsverfahren nicht beeinträchtigt. „Wir können nun mehrere Trockenprodukte zur Verfügung stellen, die sich zu funktionellen Lebensmitteln mit den wertvol­ len Beereninhaltsstoffen weiterverarbeiten lassen“, fasst Mayer-Miebach zusammen. „Denkbar wären verschiedene Backwaren. Derzeit arbeiten wir an der Herstellung eines mit Aroniapulver angereicherten Produktprototypen.“ 22 PFLanZenFarBen FÜr DarM unD hirn Pflanzenfarben für Darm und Hirn: Anthocyane schützen Zellen vor Stress rotwein und Blaubeeren, schwarzer holunder und buntes herbstlaub verdanken ihre Farben den Anthocyanen. Ausschließlich Pflanzen stellen diese komplexen chemischen Verbindungen her und schützen sich damit vor Fraßfeinden und sonnen­ brand. Doch auch der Mensch kann von ihnen profitieren: Sie können oxidativen Stress sowie entzündungen und bakterielle krankeitserreger eindämmen. ein interdisziplinärer Forschungsver­ bund hat nun den positiven Einfluss zahlreicher anthocyane auf chronische Darmentzündungen gezeigt sowie neue Wirkmechanismen aufgedeckt, die vor neurodegenerativen erkrankungen schüt­ zen können. „Unser Ziel war es, die Wirkung von Beereninhaltsstof­ fen auf das menschliche Gehirn zu testen“, sagt Philipp Sand, Neurowissenschaftler am Universitätsklinikum Regensburg. „Doch zunächst wollten wir uns davon überzeugen, dass von den Prüfsubstanzen keine Gefahr für unsere Studienteilnehmer ausgeht. Denn es gibt bisher zu wenige toxikologische Untersuchungen, die die Unbedenklichkeit dieser Stoffe belegen“, so der Arzt. Gemeinsam mit der Lebensmittelchemikerin Andrea Dreiseitel untersuchte er die Wechselwirkungen ver­ schiedener Anthocyane und ihrer Abbauprodukte mit fünf ausgewählten Enzymen, die als wichtige Schaltstellen im menschlichen Metabolismus gelten und auch im Gehirn aktiv sind. „Dabei zeigten sich nur sehr schwache Interaktionen, die wir für unbedenklich halten“, so Sands Fazit. In weiteren Enzymtests konnten die Regensburger Wissenschaftler neue positive Effekte der Pflanzenstoffe beobachten. „Wir fanden neben den bekannten antioxidativen Wirkungen noch eine ganze Reihe weiterer zellulärer Mechanismen, die sich gesund­ heitsfördernd auswirken können“, betont Philipp Sand. Einige der etwa zwei Dutzend Testsubstanzen hemmen bereits in geringer Dosierung wichtige Enzyme des Gehirnstoffwechsels – namentlich zwei Monoaminooxidasen, eine Phospholipase sowie einen Komplex aus eiweißspaltenden Enzymen namens Proteasom – und könnten somit dem Fortschreiten von Parkinson und anderen degenerativen Erkrankungen entgegenwirken. „Verglichen mit der Hemmwirkung von bereits zugelassenen Arznei­ mitteln sind die Effekte der Naturstoffe schwach ausgeprägt“, räumt der Forscher ein, „doch durch ihre entzündungshemmenden und neuroprotektiven Funktionen können sie zur Prävention von Gehirner­ krankungen beitragen und herkömmliche therapeu­ tische Maßnahmen ergänzen.“ Die transkranielle magnetstimulation gibt Auskunft über die neuronale Erregbarkeit bestimmter Hirnareale. mit dieser methode soll der Einfluss von Beereninhaltsstoffen untersucht werden. PFLanZenFarBen FÜr DarM unD hirn 23 mäuse mit chronischer Darmentzündung profitieren von Anthocyanen im Futter: Die Darmwand behandelter Tiere (links) enthält weniger Ent­ zündungszellen (violett) als die der unbehandelten Kontrolltiere (rechts) und zugleich deutlich mehr Becherzellen (weiße Bläschen), die den für die Darmfunktion unverzichtbaren Schleim produzieren. Wie das Gehirn gesunder Menschen auf die Zufuhr von Anthocyanen reagiert, soll sich in einer Dop­ pelblindstudie an 66 jungen Männern und Frauen erweisen. Die Probanden werden vier Wochen lang täglich eine Ration Heidelbeerextrakt einnehmen, der eine natürliche Mischung der Wirkstoffe enthält. Un­ mittelbar vor und nach der Studie sowie einen Monat später wollen die Regensburger Forscher mit elektro­ physiologischen und bildgebenden Verfahren prüfen, ob sich die neuronale Erregbarkeit der Testpersonen oder Form und Größe bestimmter Areale in ihrem Gehirn verändert haben. Eine weitere Humanstudie plant Gerhard Rogler am Universitätsspital Zürich. Dabei soll sich zeigen, ob die Beereninhaltsstoffe einen heilenden Effekt auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. „Patienten mit einer mäßig ausgeprägten Colitis ulce­ rosa werden dreimal täglich 100 Gramm getrocknete Heidelbeeren essen, die unser Industriepartner Symrise zu einem schmackhaften Müsliriegel verpresst hat“, so Rogler. Der Gastroenterologe ist zuversichtlich, dass seine Patienten von der Behandlung profitieren: „Wenn wir Mäusen mit akuten oder chronischen Darment­ zündungen getrocknete Heidelbeeren ins Futter geben, dann geht es ihnen anschließend deutlich besser“, berichtet Rogler. Die kranken Nager nehmen weniger ab als unbehandelte Artgenossen, ihr Darm ist weniger entzündet, er blutet weniger, die Darmschleimhaut enthält weniger entzündungsfördernde Signalstoffe, und die Mäuse haben wesentlich weniger Durchfall. In welcher Form die Substanzen ihre heilsame Wirkung im Darm entfalten, wissen die Forscher noch nicht genau. Allerdings ist bekannt, dass die Anthocy- ane eine sehr geringe Bioverfügbarkeit haben. HansUlrich Humpf am Institut für Lebensmittelchemie der Universität Münster will deshalb herausfinden, wie die chemisch komplexen Verbindungen im Verdauungs­ trakt verstoffwechselt werden. Als Modellorganismus dienen ihm Schweine, denn deren Verdauungssystem ist dem menschlichen sehr ähnlich. „Dazu nehmen wir die Bakterienflora aus dem Darm frisch geschlachteter Bioschweine in Kultur. Darauf träufeln wir einzelne Anthocyane und messen nach zwei, vier und sechs Stunden die gebildeten Metabolite. Dabei zeigt sich, dass die Anthocyane schnell von den Darmbakterien abgebaut werden und am Schluss nur kleine phenoli­ sche Verbindungen übrig bleiben“, erklärt der Forscher. Welche Abbauprodukte schließlich ins Blut ge­ langen, will der Lebensmittelchemiker an lebenden Schweinen untersuchen. „Die Tiere bekommen eine Woche lang einen anthocyanhaltigen Fruchtextrakt zu fressen. Während dieser Zeit nehmen wir laufend Blut-, Urin- und Kotproben. So wollen wir uns ein Bild von den Stoffwechselvorgängen machen“, erklärt Humpf. In welcher natürlichen Zusammensetzung die wertvol­ len Inhaltsstoffe in Früchten vorkommen, konnte Peter Schreier aufklären: Der Initiator und Koordinator des BMBF-Verbundprojekts – er ist inzwischen emeritiert – hat am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität Würzburg Methoden entwickelt, um die in Heidelbeeren enthaltenen Anthocyane quantitativ nachzuweisen. Dabei entdeckte er, dass aus Griechen­ land stammende Trockenbeeren weniger gehaltvoll sind als skandinavische Früchte. Der Grund: Die stärke­ re Sonneneinstrahlung in südlichen Ländern zerstört beim Trocknen der Beeren einen Teil der wertvollen Inhaltsstoffe. 24 Wenn harMLose MikroBen ZuM ProBLeM WerDen Wenn harmlose Mikroben zum Problem werden Prof. Dirk haller erforscht die Wechselwirkungen von Darm und Bakterien immer mehr Menschen entwickeln eine chronisch entzündliche Darmerkrankung; allein in Deutsch­ land leben rund 300.000 Patienten mit Morbus crohn oder colitis ulcerosa. Bislang lassen sich diese Leiden nur lindern, aber nicht heilen – denn bislang weiß man zu wenig über ihre ursachen. eine wichtige rolle kommt an sich harmlosen Darmbakterien zu, die jedoch das körpereigene immunsystem zu entzündlichen reaktionen anre­ gen können. Dirk Haller will herausfinden, welche molekularen Mechanismen dieser fatalen Fehlre­ aktion zugrunde liegen. Schon als Gymnasiast interessiert sich Dirk Haller für die Naturwissenschaften, doch geht es ihm dabei in erster Linie um den Menschen. „Diese grundlegend medizinische Orientierung war mir immer wichtig“, sagt der gebürtige Schwarzwälder, Jahrgang 1968. Heute leitet Haller in Personalunion die Abteilung Biofunktionalität im Zentralinstitut für Ernährungs­ und Lebensmittelwissenschaft (ZIEL) und den Lehr­ stuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel an der TU München-Weihenstephan. In Deutschland ist dieses Fach nur ein weiteres Mal vertreten, an der Universität Hohenheim. In dieser renommierten Hochschule im Süden Stuttgarts nimmt Dirk Hallers wissenschaftliche Karriere ihren Anfang. 1990 schreibt er sich dort für ein Studium der Lebensmitteltechnologie ein. Das Lehrangebot empfindet der junge Student zunächst als frustrierend, „weil es zu ingenieurwissen­ schaftlich ausgerichtet war und wenig Bezug zu Krank­ heiten hatte“. Deshalb entscheidet er sich, zusätzlich Ernährungswissenschaften zu studieren. Besonders an­ getan ist er von der Mikrobiologie, die sich sowohl mit Krankheitskeimen als auch mit gesundheitsfördernden Bakterien befasst. Hier wird der künftige Ernährungs­ forscher mit den Fragen konfrontiert, die ihn bis heute beschäftigen: Was genau passiert im Darm, wenn Nahrungsbestandteile, Bakterien und der körpereigene Stoffwechsel aufeinandertreffen? An einem besseren Verständnis dieser grundlegen­ den Zusammenhänge sind auch die großen Lebens­ mittelhersteller interessiert, allen voran die Schweizer Firma Nestlé S. A. Sie lockt Dirk Haller – er hat gerade mit Bravour sein Doppeldiplom absolviert – mit einer spannenden Aufga­ be in ihr großzügig ausgestattetes For­ schungszentrum am Genfer See. Im Rahmen seiner Doktorarbeit entwickelt er dort ein Modellsystem, das die Darmschleimhaut und Dirk Haller, TU München-Weihen­ stephan ihre Wechselwirkungen mit Mikroben nachstellen soll. „Damals herrschte noch das Dogma, dass die nicht pathogene Mikrobiota quasi als unbeteiligte Masse im Darm herumliegt“, erin­ nert sich Haller. „Wir waren mit die Ersten, die zeigen konnten, dass diese Bakterien mit dem Darmepithel kommunizieren und es aktivieren.“ Der amerikanische Mediziner Balfour Sartor leitet aus den neuen Erkenntnissen eine provokante Hypo­ these ab: Wenn gewöhnliche Darmbakterien mit der Darmschleimhaut Signale austauschen, dann können sie womöglich auch Immunfunktionen und somit Krankheitsprozesse beeinflussen – zum Guten ebenso wie zum Schlechten. „Sartor postulierte schon sehr früh, dass an sich harmlose Bakterien die chronische Entzündung bei Darmerkrankungen vorantreiben“, erinnert sich Dirk Haller, „und er hatte damals schon keimfreie Tiermodelle, um solche mikrobiellen Wech­ selwirkungen gezielt zu untersuchen.“ Fasziniert von diesem Ansatz, geht Haller nach seiner Promotion im Jahr 2001 mit einem Stipendium aus dem damals neu aufgelegten Emmy Noether-Programm der DFG in Sartors Labor nach North Carolina. „Das hätte auch schiefgehen können“, lacht Hal­ ler, „doch zum Glück konnten wir unsere Hypothese belegen und haben damit einigen Wirbel gemacht.“ An die Verblüffung der Fachkollegen kann er sich noch gut erinnern: Wenn harmlose Bakterien Entzündungen im Darmepithel auslösen können, so die naheliegende Fra­ ge, warum sind wir dann nicht alle krank? Dirk Haller betrachtet es als Herausforderung, diese komplexen Wenn harMLose MikroBen ZuM ProBLeM WerDen Zusammenhänge zu verstehen. Trotz seiner Erfolge in den USA zieht es den Nachwuchswissenschaftler schon nach zwei Jahren zurück nach Deutschland. Von Stutt­ gart und München umworben, entscheidet er sich für Bayern. Denn der neu gestaltete Life Science Campus in Weihenstephan bietet ein exzellentes Forschungsum­ feld; Grund genug für Haller, später einen Ruf an die University of Alberta und einen weiteren an die ETH Zürich auszuschlagen. Inzwischen hat in seiner Disziplin ein Dogmen­ wechsel stattgefunden: „Heute herrscht Konsens darüber, dass nicht pathogene Bakterien im Darm ganz wesentlich die Integrität und Durchlässigkeit der Darmschleimhaut verändern können. Außerdem weiß man, dass Probiotika die Freisetzung entzündungsför­ dernder Signalmoleküle modulieren sowie die Überle­ bensfähigkeit der Darmepithelzellen beeinflussen“, so der Ernährungsforscher. Zu diesen Signalmolekülen zählt das Protein IP-10; es fördert die übermäßige Produktion von Immunzellen und verursacht so eine chronische Darmentzündung. Bleibt die Frage, war­ um manche Menschen von diesem Prozess verschont bleiben, während andere dauerhaft erkranken. „Nicht pathogene Darmbakterien können nur Personen mit entsprechender genetischer Vorbelastung schädigen“, erklärt Haller. Das belegen vergleichende Versuche an gesunden Mäusen und solchen, die aufgrund bekann­ ter Genveränderungen Morbus-Crohn-ähnliche Symp­ tome entwickeln. Infiziert man beide Mäusegruppen mit denselben Darmbakterien, so erkranken nur die genetisch vorbelasteten Tiere. Hält man die Nager aber unter sterilen Bedingungen – also frei von Darmbakte­ rien –, so bleiben beide Gruppen gesund. 25 Ein europäischer Forschungsverbund, dem auch Dirk Haller angehört, sucht derzeit nach den Faktoren und Wirkmechanismen, mit denen gewöhnliche Darmbak­ terien die krankhaften Prozesse bei genetisch vorbelaste­ ten Patienten in Gang setzen. Als sicher gilt der Einfluss verschiedener eiweißspaltender Enzyme, sogenannter Proteasen. Allerdings befasst sich Haller nicht nur mit den negativen Effekten der Mikrobiota. In einem vom BMBF geförderten Verbundprojekt erforscht er den – positiven – Einfluss probiotischer Mikroorganismen auf Entzündungen des Magen-Darm-Trakts. Projektpartner sind der Humanbiologe Michael Schemann von der TU München sowie die Firma Nestlé, vertreten durch Hallers einstige Chefin Stefanie Blum. „Wir wollen durch dieses BMBF-Projekt grundle­ gende Wirkprinzipien in der Wechselwirkung zwischen probiotischen Bakterien, Darmepithel und enterischem Nervensystem aufzeigen. Kurz gesagt geht es um die Frage: Was macht ein Bakterium probiotisch?“, so Hal­ ler. Dazu untersucht er mit seinen Partnern, welchen Einfluss verschiedene Bakterienarten und -stämme der Gattungen Bifidobakterium und Lactobacillus auf den Gesundheitszustand von Mäusen mit genetischer Anfälligkeit für chronische Dünn- oder Dickdarm­ entzündungen haben. Experimente mit speziellen Zellkulturen aus Darmepithelzellen ergänzen die Tierversuche. „In beiden Fällen haben wir geschaut, ob sich durch die Bakterien bestimmte Entzündungs­ prozesse reduzieren lassen und wenn ja, auf welcher Ebene man das messen kann. So sind wir auf das IP-10 aufmerksam geworden und konnten zeigen, dass einige Bakterienstämme seine Produktion hemmen“, erklärt der Wissenschaftler. Mit Fluoreszenzfarbstoffen behandelte Gewebeschnitte zeigen Unterschiede in der Darmschleimhaut von gesunden Mäusen (links) und solchen, die an einer chronischen Darmentzündung leiden (rechts). Bei den kranken mäusen ist die Darmoberfläche durch tiefe Einbuchtungen stark vergrößert; ihre Zellen enthalten deutlich mehr Stressproteine (grün) als die gesunder mäuse. Blau bezeichnet die Lage der Zellkerne. 26 Tatsächlich unterscheiden sich die Bakterien sehr stark in ihrer Wirkung: Positive Effekte zeigen nur wenige der getesteten Mikroben, darunter ein Lactobacillus-casei-Stamm, der bereits als Probiotika zur unterstützenden Behandlung von chronischen Entzündungen im Dickdarm eingesetzt wird. Au­ ßerdem sind positive Effekte im Dünndarm weniger stark ausgeprägt als im Dickdarm. „Das passt zu der Beobachtung, dass sich eine Dünndarmentzündung mit Probiotika nur schwer beeinflussen oder gar behandeln lässt“, sagt Haller. Im nächsten Schritt wollen die Forscher das für die Effekte zuständige Wenn harMLose MikroBen ZuM ProBLeM WerDen entzündungshemmende Molekül identifizieren. Bisher deutet alles darauf hin, dass es sich um eine Protease handelt. Ihre krankheitslindernde Wirkung könnte darauf beruhen, dass sie das IP-10 spaltet und damit außer Gefecht setzt. „Sollte sich unsere Vermu­ tung bestätigen, dann hätten wir erstmals eine Prote­ ase, die vor entzündlichen Prozessen schützt, statt sie zu fördern“, betont Haller und gibt sich optimistisch: „Diese Entdeckung könnte uns dem Ziel einer effek­ tiven und risikofreien Behandlungsmöglichkeit für chronisch entzündliche Darmerkrankungen einen Schritt näher bringen.“ Probiotische Bakterien – im Bild Kolonien von Lactobacillus casei auf Kulturmedium – können Entzündungsprozesse im Darm abschwächen. 27 LuPinen FÜr Die GeFässGesunDheit Lupinen für die Gefäßgesundheit: Ballaststoffe aus den Samen der Hülsenfrucht senken den Cholesterinspiegel Lupinen sind wegen ihrer Blütenpracht beliebte Gartenpflanzen. Weniger bekannt ist hierzulande, dass einige Lupinensorten für den menschlichen Verzehr geeignet sind: sie enthalten unter an­ derem wertvolle Ballaststoffe, die zur senkung des cholesterinspiegels beitragen können. auf dieses gesundheitsfördernde Potenzial der hül­ senfrüchte konzentriert sich ein Verbund aus zwei akademischen Forschungsgruppen und sechs industriepartnern. Das Ziel ist die entwicklung cholesterinsenkender und zugleich geschmacklich ansprechender Lebensmittel. „Ballaststoffe aus Hülsenfrüchten sind aufgrund ihrer Zusammensetzung aus unlöslichen und löslichen Fasern sehr wertvoll. Außerdem schmecken sie nicht so rau und trocken wie Getreidefasern“, sagt die Koordinatorin des Forschungsvorhabens, Katrin Hasenkopf. Damit hat die Lebensmittelchemikerin vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising zwei gute Gründe, sich für die Nutzung dieser neuartigen Ballaststoffquelle einzusetzen: Zum einen haben sich lösliche Ballaststoffe in zahlreichen klinischen Studien als cholesterinsenkend erwiesen und eignen sich somit zur Prävention von Gefäßerkrankungen. Zum anderen lassen ein angenehmes Mundgefühl sowie ein neutraler Geschmack darauf hoffen, dass Produkte aus Lupinenfa­ sern vom Verbraucher angenommen werden. „Zunächst haben wir nach einer Faser gesucht, die eine starke Gallensäurenbindung aufweist und sich gut verarbeiten lässt“, erzählt Katrin Hasenkopf. Denn diese Bindungskapazität hat direkten Einfluss auf den Blut­ fettspiegel: Zur Herstellung von Gallensäuren, die zur Unterstützung der Fettverdauung in den Dünndarm abgesondert werden, benötigt der Körper Cholesterin. Je mehr Gallensäuren an Ballaststoffe gebunden und mit ihnen ausgeschieden werden, umso stärker sinkt daher die Cholesterinmenge im Blut. Mithilfe eines In­ vitro-Systems, das die wesentlichen Abbauprozesse im menschlichen Verdauungstrakt simuliert, untersuchten Hasenkopfs Mitarbeiter die Gallensäurenbindung von Lupinen werden bislang hauptsächlich als Zierpflanzen und zur Bodenverbesserung eingesetzt. Zum Verzehr geeignete Sorten finden neuerdings auch wegen ihrer gesundheitsfördernden Ballaststoffe Beachtung. Lupinen, Erbsen und Sojabohnen. Alle drei Hülsen­ früchte zeigten die gewünschte Fähigkeit; am besten schnitten die Samen der Blauen Lupine (Lupinus angustifolius) ab. Nun galt es herauszufinden, ob die Gallensäurenbindung durch die Verarbeitung der Lupinensamen beeinflusst wird. Die Extraktionsprozesse hatten keine negativen Auswirkungen; als kritisch erwiesen sich jedoch hohe Temperaturen, wie sie bei der thermi­ schen Trocknung auftreten. „Hier ist eine Gefrier- oder Sprühtrocknung vorzuziehen“, so die Fraunhofer-For­ scherin. Je feiner die Fasern vermahlen werden, umso besser vermögen die Partikel Gallensäuren zu binden – offenbar spielt hier die Oberflächenvergrößerung eine entscheidende Rolle. „Komplizierter verhält es sich bei der hydrolytischen Spaltung durch Säure oder 28 LuPinen FÜr Die GeFässGesunDheit Wie sich aus Lupinensamen möglichst schonend die wertvollen Bal­ laststoffe isolieren, trocknen und vermahlen lassen, haben Forscher am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in aufwendigen Testreihen ermittelt. Fünf Industriepartner des Verbundprojekts stellten aus Lupinenfa­ sern eine breite Palette schmackhafter Lebensmittel her, darunter diese Brühwurst. Deren gesundheitsfördernde Effekte belegte eine Studie an Patienen mit erhöhten Blutfettwerten. Enzyme“, betont Hasenkopf: „Einige Prozesse begüns­ tigen die Bindungsfähigkeit, andere behindern sie. Die maßgeblichen Mechanismen kennen wir noch nicht.“ Die Kost war so bemessen, dass jede Person täglich 25 Gramm der Ballaststoffe zu sich nahm. Allerdings wussten die Probanden nicht, wann sie welche Speisen erhielten. Die Herstellung der angereicherten Lebens­ mittel oblag den Industriepartnern: Brühwürste und Aufschnitt machte die Metzgerei Pointner; Gemü­ sebratlinge kamen von der Albert Hess GmbH und eine Art Knäckebrot von der Gutena Nahrungsmittel GmbH; die Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Pro­ duktions- und Vertriebs KG entwickelte Baguettebrote sowie Tortellini mit verschiedenen Füllungen und So­ ßen, und die Dr. August Oetker GmbH Nahrungsmittel KG steuerte lupinenfaserhaltige Getreideprodukte bei. Parallel zu diesen verfahrenstechnischen Test­ reihen begann Anita Fechner am Lehrstuhl für Ernäh­ rungsphysiologie der Universität Jena mit einer ersten Humanstudie. Die Probanden – insgesamt 76 gesunde junge Frauen und Männer – sollten zwei Wochen lang Milchprodukte oder Fruchtsäfte mit eingerührten Ballaststoffen aus Sojabohnen oder Lupinen essen und deren Geschmack und Mundgefühl bewerten. Außerdem wurden die physiologischen Effekte einer täglichen Dosis von 25 Gramm beurteilt. Ergebnis: Im sensorischen Test ging die Bestnote abermals an die Blaue Lupine. „Der Fettstoffwechsel dieser jungen und gesunden Studienteilnehmer wurde von den getesteten Lupinenfasern nicht beeinflusst“, betont Anita Fechner. In einer weiteren Humanstudie bat die Jena­ er Ernährungswissenschaftlerin dann genau jenen Personenkreis um Mithilfe, der künftig von choleste­ rinsenkenden Lebensmitteln profitieren könnte: ältere Menschen mit moderat erhöhten Bluttfettwerten. Die Probanden – 18 Männer und 36 Frauen – sollten nacheinander jeweils vier Wochen lang, unterbrochen von je sieben Tagen Pause, drei verschiedene Diäten essen: Sie bestanden aus Lebensmitteln, die entweder mit Ballaststoffen aus Lupinen oder aus Zitrusfrüch­ ten angereichert waren oder keinen Ballaststoffzusatz enthielten. Die Studie belegt einen eindeutigen Zusammen­ hang zwischen der Faserquelle und dem Blutfettspiegel der Probanden. Das aus medizinischer Sicht unbedenk­ liche HDL-Cholesterin blieb in seiner Konzentration unverändert; dagegen konnten zwei unerwünschte Komponenten (LDL-Cholesterin und Triglyceride) durch den Verzehr der mit Lupinenfaser zubereiteten Kost deutlich gesenkt werden – und zwar signifikant stärker als durch die Kontrollfaser. Die positive Bilanz wird noch durch folgende Beobachtungen verstärkt: Nur 6 der ursprünglich 60 Probanden brachen die Studie vorzeitig ab; alle Teilnehmer hatten die Diät gut vertragen, sie als bekömmlich empfunden – und dabei noch ein bis zwei Kilo abgenommen. 29 DreiFach FunktioneLLe Brötchen Dreifach funktionelle Brötchen: Weizen-Aleuron und probiotische Bakterien verringern das Darmkrebsrisiko Ballaststoffe gelten aufgrund ihrer gesundheits­ fördernden eigenschaften als unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen ernährung. Be­ sonders ballaststoffreiche Lebensmittel wie Voll­ kornprodukte werden jedoch von breiten teilen der Bevölkerung nicht in nennenswerten Mengen verzehrt. ein vom BMBF gefördertes Verbundpro­ jekt hat sich daher zum Ziel gesetzt, neuartige Le­ bensmittel mit dreifach funktionellen eigenschaf­ ten zu entwickeln: sie sollen die schutzwirkungen einer bislang ungenutzten Ballaststoffquelle – des Weizen-Aleurons – mit den positiven Einflüssen probiotischer Darmbakterien kombinieren. Dickdarmkrebs ist in Deutschland die zweithäufigste Krebserkrankung mit Todesfolge; zusammen mit an­ deren Tumorerkrankungen verursacht das Leiden etwa ein Drittel aller Todesfälle in der westlichen Welt. Mit einer ballaststoffreichen Ernährung ließe sich das än­ dern, betont Michael Glei vom Institut für Ernährungs­ wissenschaften der Universität Jena: „Wenn die Men­ schen ihre Ballaststoffaufnahme verdoppeln würden, dann könnten sie ihr Risiko für Darmkrebs um etwa 40 % reduzieren.“ Glei beruft sich auf die Ergebnisse einer umfangreichen epidemiologischen Langzeitstu­ die namens EPIC, in der eine halbe Million Menschen im Alter zwischen 25 und 70 Jahren aus zehn europä­ ischen Ländern über ihre Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsgeschichten befragt wurden. „Esst mehr Ballaststoffe!“, empfiehlt deshalb auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, konkret: mindestens 30 Gramm pro Tag. „Durch die Kombination von Getreideprodukten, Gemüse und Obst könnte man dieser Empfehlung sehr leicht nachkommen. Vor allem Vollkornprodukte ent­ halten durch ihren Kleiegehalt eine Menge Ballaststoffe, doch diese Backwaren werden von der Allgemeinheit Stuhlproben enthalten Bakterien, die normalerweise im menschlichen Dickdarm leben. mit ihrer Hilfe lässt sich eine Art „Dickdarm im Labor“ nachstellen – und der Abbau unverdaulicher Aleuron-Bestanteile untersuchen. DreiFach FunktioneLLe Brötchen 30 Zum einen enthält es einen hohen Anteil an Ballast­ stoffen, zum anderen sind an eben diese Ballaststoffe sogenannte Phenolsäuren wie die Ferulasäure gebunden, die wegen ihrer Rolle als Antioxidantien geschätzt werden. Die dritte Komponente bilden zwei Stämme der probiotischen Bakterienarten Lactobacillus rhamnosus und Bifidobacterium lactis, die für ihren positiven Einfluss auf die Darmgesundheit bekannt sind. Das aleuron Das Aleuron liegt als einlagige Schicht aus auffällig großen Zellen – die Stärke der Lage beträgt 40 bis 60 mikrometer – zwischen Stär­ kekörper und Schale des Weizenkorns (unten mit dem Mikroskop aufgenommen, oben mit dem Rasterelektronenmikroskop). nicht besonders gern verzehrt. Also haben wir nach ei­ ner anderen Ballaststoffquelle Ausschau gehalten und sind auf das Weizen-Aleuron gekommen“, erzählt Mi­ chael Glei, der das BMBF-Projekt „Triple Plus – drei­ fach funktionelle Eigenschaften von Lebensmitteln“ koordiniert. Das Weizen-Aleuron (siehe Kasten) liefert gleich zwei der drei Komponenten, denen gesund­ heitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben werden: umhüllt als dünne Schicht den Mehlkörper von Getreidekörnern und anderen pflanzlichen Samen. Als Hauptbestandteil der Kleie wird es beim Mahlen und Sieben des Mehls normalerweise größtenteils entfernt. Die Aleuronschicht enthält neben Vita­ minen und Proteinen große Mengen an bakteri­ ell abbaubaren (fermentierbaren) Ballaststoffen, insbesondere Arabinoxylane. Dies zeichnet sie vor den übrigen Kleiebestandteilen des Korns aus, die überwiegend nicht fermentierbare Ballaststoffe, na­ mentlich Zellulose, enthalten. Arabinoxylane gelten auch deshalb als ernährungsphysiologisch wertvoll, weil sie zur Verknüpfung mit verschiedenen Biomo­ lekülen neigen, die als Antioxidantien schützend in zellschädigende Prozesse eingreifen. Ob diese drei Komponenten halten, was sich Ernährungswissenschaftler von ihnen versprechen, wird in dem BMBF-Projekt geklärt. Verbundpartner sind das Forschungszentrum Karlsruhe, das Max Rubner-Institut Detmold sowie die KAMPFFMEYER Food Innovation GmbH, ein Tochterunternehmen von Europas größter Mühlengruppe mit Hauptsitz in Ham­ burg. Um die Kleie aufzuschließen und das Aleuron zu gewinnen, bedarf es spezieller Mahltechniken. Die weltweit beste Technik beherrscht die von KAMPFF­ MEYER beauftragte Schweizer Firma Bühler AG; sie stellt den Jenaer Wissenschaftlern Aleuron in hoher Reinheit für ihre Studien zur Verfügung. Welche Reak­ tionen das mit der Nahrung aufgenommene Aleuron in der menschlichen Darmwand auslösen kann, unter­ suchen die Forscher an gesunden Darmzellen und an Zelllinien des Darmes, die verschiedene Krebsstadien repräsentieren. „Allerdings können wir das gemahlene Aleuron nicht einfach auf die Zellen geben und nach­ sehen, was es dort bewirkt. Denn wir wollen ja der Situ­ 31 DreiFach FunktioneLLe Brötchen ation möglichst nahekommen, die im menschlichen Verdauungstrakt herrscht“, erklärt Glei. zugesetzt, um einen möglichen Einfluss der probioti­ schen Bakterien abzuschätzen. Daher haben Gleis Doktorandinnen Anke Boro­ wicki und Katrin Stein ein Testsystem entwickelt, das die Passage durch Mund, Magen, Dünn- und Dickdarm möglichst realitätsnah nachahmen soll. Darin set­ zen sie das Aleuron Schritt für Schritt verschiedenen Verdauungsenzymen aus, lassen Gallensäuren einwir­ ken und verändern den pH-Wert entsprechend den Verhältnissen im Körper. Durch diesen künstlichen Verdauungsprozess entstehen Spaltprodukte aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, welche sich anschließend mit einer Dialysemembran abtrennen Nach dieser insgesamt 32-stündigen Prozedur wird das inzwischen stark fermentierte Aleuron auf Eis gesetzt, um seine weitere Zersetzung zu verhindern. Danach wird die Masse mehrmals zentrifugiert, bis man einen klaren Fermentationsüberstand erhält. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Überstand alle wichtigen Substanzen enthalten sind, die im Körper mit der Darm­ schleimhaut in Kontakt kommen“, sagt Michael Glei. Brötchen und Schokokeks, zubereitet von der KAmPFFmEYER Food innovation GmbH in Hamburg. Beide Produkte sind Prototypen funktioneller Lebensmittel: Sie enthalten Weizen-Aleuron. lassen. Um die zurückgebliebenen, nicht verdaulichen Ballaststoffe aufzuschließen, werden sie mit Stuhl­ proben von gesunden Freiwilligen versetzt – und sind damit genau jenen Bakterien ausgesetzt, die auch im menschlichen Dickdarm für ihren Abbau sorgen. Einem Teil der Proben wurden zusätzlich Kulturen von Lactobacillus rhamnosus und Bifidobacterium lactis Wie schmeckt ein aleuron-Brötchen? Lecker – und kaum anders als ein ganz normales Weißmehlbrötchen! So lautet das Urteil freiwilliger Testpersonen, die das herkömmliche mit dem neuen Produkt vergleichen sollten. Neben den AleuronBrötchen bewerteten die Probanden neun weitere Prototypen von dreifach funktionellen Backwaren. „Wir haben eine Milchschnitte aus Aleuron-Teig mit süßer Creme oder herzhafter Fleisch- oder Käsefül­ lung entwickelt, außerdem Misch- und Toastbrot, ein Knäckebrot mit Käsefüllung oder Kekse mit Pro­ biotika in der Schokofüllung“, sagt Michael Gusko, Geschäftsführer der KAMPFFMEYER Food Innova­ tion GmbH. Das Hamburger Unternehmen hat als Industriepartner neben Finanzmitteln vor allem sein Know-how in das BmBF-Projekt eingebracht. in den innovativen Backwaren waren bis zu 8 % des Getreidegehalts durch gemahlenes Aleuron ersetzt – also genauso viel, wie in Vollkornmehl enthalten ist. „Wir möchten die breite Bevölkerung mit Pro­ dukten ansprechen, die wie herkömmliche Brötchen oder Toastbrot schmecken, aber gesünder sind“, so Gusko. Zwar gibt es derzeit nur wenige Lebensmit­ telhersteller, die über die nötigen Technologien zur Produktion der Aleuron-Backwaren verfügen. Doch Michael Gusko ist optimistisch: „Wir haben gezeigt, dass wir diese dreifach funktionellen Lebensmittel herstellen können – und dass sie extrem gut schmecken.“ Welche Substanzen dies sind, untersucht Gerald Brenner-Weiss zusammen mit seiner Kollegin Kerstin Scheu am Institut für Funktionelle Grenzflächen des Forschungszentrums Karlsruhe. Als Kontrolle dient 32 den Wissenschaftlern ein Fermentationsüberstand, der mit demselben In-vitro-Verdauungssystem aus Stuhlproben ohne Zugabe des Aleurons gewonnen wurde. Das Fazit ihrer umfangreichen Analysen: Im fermentierten Aleuron sind dreimal mehr kurzkettige Fettsäuren enthalten als in der Kontrolle; eine davon – das Butyrat – ist sogar auf das Fünffache angewachsen. Die erhöhte Säurekonzentration spiegelt sich in einem erniedrigten pH-Wert wider. Gleichzeitig fällt ein deutlich geringerer Gehalt an sekundären Gallensäu­ ren auf; sie entstehen beim mikrobiellen Abbau der primären Gallensäuren und sind wegen ihrer krebsfördernden Eigenschaften gefürchtet. „Mit der Nahrung aufgenommenes Aleuron könnte im Darm chemopräventiv wirken, also die Entstehung oder Weiterentwicklung von Entartungen im Darm verhindern“, schließt Michael Glei aus den Analysen seiner Karlsruher Projektpartner. Diese Chemoprä­ vention wirkt auf mehreren Ebenen: Hohe Butyrat­ konzentrationen fördern das Wachstum der gesunden Darmzellen, hemmen aber gleichzeitig die Entwick­ lung bereits entarteter Zellen – ein Paradoxon, das man DreiFach FunktioneLLe Brötchen seit Langem kennt, aber noch nicht vollständig versteht. Zudem wirkt sich der niedrige pH-Wert günstig auf die Zusammensetzung der Darmmikrobiota aus: Er be­ vorzugt säureliebende Bakterien wie die probiotischen Kulturen und schwächt vor allem jene Mikrobenarten, die für den Abbau der primären in die – kanzeroge­ nen – sekundären Gallensäuren sorgen. Die übrigen Gallensäuren werden im Dickdarm größtenteils von den Ballaststoffen des Aleurons gebunden und letztlich mit ihnen ausgeschieden. Besonders beeindruckend sind die chemopräventi­ ven Effekte, die Anke Borowicki und Katrin Stein direkt an den Zellkulturen beobachten konnten: Die Zellen steigern die Aktivität wichtiger Entgiftungsenzyme (namentlich Katalase und Glutathion-S-Transferase) auf das Doppelte, wenn sie mit fermentiertem Aleuron in Kontakt gebracht werden. Diese Enzyme sind an der Beseitigung von reaktiven Verbindungen beteiligt und schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Außerdem wird das Erbgut der Zellen weniger geschädigt, wenn zu­ vor das fermentierte Aleuron auf sie einwirkt; dies zeigt eine Behandlung der Zellen mit Wasserstoffperoxid, mit der sich absichtlich DNA-Schäden erzeugen lassen. „Sämtliche chemopräventiven Effekte werden schon vom Aleuron alleine ausgelöst. Einige von ihnen treten leicht verstärkt auf, wenn wir während des In-vitroVerdauungsprozesses zusätzlich die probiotischen Bakterienstämme zugeben“, betont Michael Glei und fasst die wichtigsten Ergebnisse der Versuche zusam­ men: „Gesunde Darmzellen sind in ihrer Vitalität nicht beeinträchtigt. Dagegen werden Krebszelllinien zweier unterschiedlicher Krebsstadien massiv am Wachstum gehindert oder sogar zum Absterben gebracht. Das sieht man nicht nur an den molekularen Markern, sondern schon mit bloßem Auge: Die Tumorzellen wachsen in der Kulturschale nur halb so dicht, wenn wir sie mit dem Fermentationsüberstand behandeln.“ Die Länge des „Kometenschweifes“ im Comet-Assay lässt auf den Grad einer DNA-Schädigung schließen. Der Bildausschnitt zeigt Verbände mit ungeschädigter (Mitte) und geschädigter DNA (oben und unten). Besonderen Wert legt der Jenaer Ernährungswis­ senschaftler auf folgenden Befund: Bei den Zellen des früheren Krebsstadiums ist der Effekt größer als bei den stärker entarteten Zellen. Damit steige die Chance, den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, so Glei: „Diese vielen chemopräventiven Effekte sprechen dafür, dass Weizen-Aleuron mit oder ohne Ergänzung durch probi­ otische Bakterien die Darmgesundheit fördern und einer Entartung der Schleimhautzellen entgegenwirken kann.“ 33 GesPräch Mit ProF. DanieL, ZieL-tuM-akaDeMie „Wir schaffen eine Schnittstelle zwischen Ernährungsforschung und Lebensmittelindustrie“ im Gespräch mit Prof. hannelore Daniel, Wissenschaftliche Leiterin der ZieL-tuM-akademie Lebensmittel, ernährung, Gesundheit an der tu München Wo liegen die größten herausforderungen für die Lebensmittelhersteller? Hannelore Daniel, Technische Universität München Frau Prof. Daniel, was hat sie zur Gründung der ZieL-tuM-akademie veranlasst? Die Tatsache, dass die deutsche Lebensmittelindus­ trie in vielen Bereichen den Anschluss an aktuelle Entwicklungen in der Ernährungsforschung verlo­ ren hat. Deutschland hat fast ausschließlich kleine und mittelständische Unternehmen, darunter viele traditionsreiche Familienunternehmen. Weniger als 10 % aller Unternehmen betreiben überhaupt regelmäßig Forschung und Entwicklung. Allein die Firma Nestlé investiert zehnmal so viel in F&E wie alle deutschen Unternehmen zusammen. Welches Ziel verfolgt die akademie? Wir wollen den Unternehmern klarmachen, dass sich die Ernährungswissenschaften enorm verändert und weiterentwickelt haben. Auch die Anforderungen an die Lebensmittel werden sich in den nächsten 20 Jahren dramatisch ändern. Wer sich damit nicht auseinandersetzt, wird früher oder später ein Nischendasein führen. Die meisten Unternehmen haben traditionel­ le Rezepturen und wissen oft gar nicht, welche Nährstoffe ihr Produkt enthält – Hauptsache, es schmeckt gut und verkauft sich. EU-weite Kenn­ zeichnungsvorschriften und neue rechtliche Bestimmungen für funktionelle Inhaltsstoffe und Health-Claims setzen die Unternehmen nun unter Druck. Häufig fehlt ihnen aber das nötige Wissen zur Beurteilung der Qualität und Wirkung bestimmter Inhaltsstoffe oder zu den rechtlichen Bestimmungen. Genau dieses Wissen wollen wir vermitteln. Welche inhalte vermittelt die akademie? Unsere Seminare beinhalten vier unabhängige Module, die einzeln oder im Paket gebucht werden können. Im ersten Modul geht es um die Frage, was menschliche Ernährung eigentlich ist. Wir wissen heute, dass Ernährungsfaktoren für wich­ tige Organsysteme spezifische Funktionen haben – jenseits von der Versorgung mit Nährstoffen und Kalorien. Generell vermitteln wir zunächst die Grundlagen zum Verständnis beispielsweise des Magen-Darm-Trakts oder des kardiovaskulären Systems. Dann fragen wir danach, welche Bedeu­ tung Ernährungsfaktoren in der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronischen Entzündungsprozessen im Darm haben. Das klingt wie eine art schnellstudium der ernährungswissenschaften … Wenn Sie so wollen. Aber wir vermitteln nicht nur Grundlagen, sondern fragen auch: Was haben uns die Studien der letzten Jahre wirklich gebracht? Im Modul drei lernen die Teilnehmer, welche Methoden es gibt. Doch am Ende steht die Frage: Wo stehen wir heute, nachdem wir mit all diesen GesPräch Mit ProF. DanieL, ZieL-tuM-akaDeMie 34 Methoden ins Genom hineinleuchten oder nachse­ hen können, was irgendein Polyphenol in unserem Körper tut? Wir geben Bewertungen ab, welche Zu­ sammenhänge belegt sind und welche nicht. Denn da wird bekanntlich auch viel Unsinn verbreitet – insbesondere über funktionelle Lebensmittel. Wir zeigen auf, welche Evidenzen es dafür gibt, dass man zum Beispiel über Veränderungen der Fettsäurezusammensetzung in Lebensmitteln tat­ sächlich protektiv auf das kardiovaskuläre System einwirken kann. zeigt, dass die Teilnehmer äußerst zufrieden damit sind, wie glaubwürdig unsere Referenten ihr Fach­ wissen weitergeben, aber auch individuell bewer­ ten und strittige Fragen kontrovers diskutieren. Diese offene Atmosphäre wird von den Teilneh­ mern besonders geschätzt. Wie können die teilnehmer das Gelernte umsetzen? Im Modul vier geht‘s um praktische Fragen: Was erwartet der Konsument? Wie entwickeln sich die Märkte? In welchem Rechtsrahmen bewegen wir uns mit Supplementen, mit funktionellen Lebensmitteln oder mit dem Nutrition Profiling? Wir sagen den Unternehmen: Wenn ihr diesen oder jenen Health-Claim ausloben wollt, dann müsst ihr folgende Studien machen, zu folgenden Kosten. Damit vermitteln wir den Leuten Kompe­ tenzen für die eigene Entscheidung. Geben sie auch hilfestellungen bei der Produktentwicklung? Als universitäre Einrichtung ist das nicht unser Auftrag. Aber wir machen den Unternehmen klar, dass sie sich mit den Nährstoffprofilen in ihren Produkten beschäftigen, ihre Rezepturen durchgehen und sich fragen müssen: Was kann ich tun, damit ich die Fettzusammensetzung in meinem Produkt ändern, zu viel Salz oder Zucker rausnehmen oder es mit funktionellen Inhalts­ stoffen anreichern kann – und dabei immer noch ein schmackhaftes Lebensmittel schaffe, das sich verkauft? Das ist ein wesentlicher Teil der Pro­ duktentwicklung. Wie wird ihr angebot aufgenommen? Die Nachfrage ist überwältigend! Wir haben Teil­ nehmer aus kleinen und mittelständischen, aber auch aus den ganz großen Unternehmen, außer­ dem Leute, die in der Beratung tätig sind, beispiels­ weise bei Krankenkassen oder als Selbstständige. Die Auswertung unserer Evaluations-Fragebögen Seminarteilnehmer bei der Auswertung von Laborexperimenten Die ZiEL-TUm-Akademie, im November 2007 mit finanzi­ eller Unterstützung des BmBF gegründet, greift mit ihrem Weiterbildungsprogramm aktuelle Entwicklungen in der Ernährungs- und Lebensmittelforschung auf. Die wissen­ schaftliche Leitung obliegt Prof. Dr. Hannelore Daniel, die zugleich der Abteilung Biochemie am Zentralinstitut für Ernährungs- und Lebensmittelforschung (ZIEL) vorsteht und den Lehrstuhl für Ernährungsphysiologie an der Tech­ nischen Universität münchen (TUm) innehat. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter der Lebensmittelbranche und des Handels sowie an Beratungsfachkräfte im Bereich Ernährung und Gesundheit. Das 27-köpfige Akademie­ kollegium besteht aus Ernährungs- und Naturwissen­ schaftlern, medizinern, Ökonomen, marketingexperten und Anwälten. Ein Teil der Referenten ist am ZiEL oder an der TUM beschäftigt; dazu kommen Gastdozenten aus dem deutschsprachigen Raum sowie Experten aus der industrie. www.wzw.tum.de/ziel/akademie/ 35 achtunG anGreiFer! Achtung Angreifer! Wie sich die Darmschleimhaut gegen Krankheits­ erreger wehrt Mit der nahrung gelangen nicht nur nährstoffe in den körper, sondern auch krankheitserreger. aufgrund einer angeborenen immunität sind die Zellen der Darmschleimhaut jedoch in der Lage, ein breites spektrum an pathogenen Bakterien und Viren sehr schnell zu erkennen und unschädlich zu machen. am Deutschen krebsforschungszentrum heidelberg (DkFZ) werden Proteine des Darm­ epithels näher untersucht, die an dieser unmittel­ baren schutzantwort beteiligt sind. sie sollen nun auch als Biosensoren dienen, um die sicherheit von nahrungsmittelbestandteilen zu testen. Worin besteht seine Funktion? Hilft das Protein, den Krankheitsprozess zu lindern, oder trägt es etwa dazu bei, ihn zu verstärken oder gar erst auszulösen? Wichti­ ge Hinweise auf seine Wirkung gibt die Häufung einer bestimmten Variante des DMBT1-Gens bei MorbusCrohn-Patienten: Gesunde besitzen überwiegend eine Genvariante, die dem Protein eine starke Bindungs­ fähigkeit an Bakterien verleiht; es erkennt bestimmte chemische Strukturen – sogenannte Phosphatreste – an deren Oberfläche und bindet sich an sie, sodass die Bakterien verklumpen und an einer Infektion gehindert werden. Dagegen findet sich bei chronisch Erkrankten überdurchschnittlich häufig eine Gen­ variante für ein DMBT1-Protein mit vergleichsweise geringer Bakterienbindungsfähigkeit. „Dieser geneti­ sche Unterschied könnte für die Betroffenen einen ver­ minderten Schutz vor Bakterien zur Folge haben und hierdurch die Ausprägung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen begünstigen. Dagegen sind die Träger der häufigeren Genvariante vermutlich besser vor Bakterien und entzündlichen Prozessen geschützt“, so Mollenhauer. Zu den bekannten Schutzfaktoren der Darmschleim­ haut zählt ein Protein namens DMBT1. „Norma­ lerweise kommt dieses Protein im Darm in sehr geringen Mengen vor; vermutlich soll damit erreicht werden, dass die reguläre bakterielle Mikroflora in einer gewissen Balance gehalten wird. Nur nach einer Infektion oder Entzündung wird das entsprechende Gen hochreguliert und sehr viel Protein hergestellt“, Für eine Schutzwirkung des Schleimhautproteins sagt Jan Mollenhauer, der das BMBF-Projekt am spricht auch der Vergleich von normalen Mäusen mit Deutsches Krebsforschungszent­ rum leitet und seit März 2008 eine Professur am Institut für Medi­ zinische Biologie der Universität Odense in Dänemark innehat. Wie Mollenhauer und seine Kollegen zeigen konnten, ist das Schutzpro­ tein bei Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gleichsam im Dauerein­ satz: „Im Oberflächenepithel – also direkt dort, wo Bakterien mit den Darmzellen Kontakt haben – findet bei diesen Erkrankungen eine drastische Hochregulation des DMBT1-Gens statt. Daraus schlie­ ßen wir, dass das Protein hier eine mit Antikörpern lässt sich das Schutzprotein DmBT1 in Gewebeschnitten braun anfärben. Links bedeutende Funktion ausübt“, so der Darm eines gesunden menschen (maßbalken: 100 μm), rechts der eines Morbus-CrohnMollenhauer. Patienten (maßbalken: 200 μm). achtunG anGreiFer! 36 solchen, deren DMBT1-Gen inakti­ viert worden war. Nachdem Tieren beider Stämme mit dem Trinkwas­ ser eine entzündungsfördernde Substanz namens Dextransulfat verabreicht worden war, stellten die Nager mit intaktem DMBT1-Gen große Mengen des Proteins her und entwickelten weniger ausgeprägte Darmentzündungen als jene mit dem inaktivierten Gen. „Da haben wir uns gefragt: Wie übt das Protein seinen Schutzeffekt aus? Bindet es vielleicht an das Dextransulfat, so wie es an die Bakterien bindet?“ Durch ein einfaches Experiment schaffte sich der DKFZ-Forscher Klarheit: „Bakterien verklumpen, wenn wir sie mit dem Protein in Kontakt bringen. Sobald man Dex­ transulfat dazugibt, lösen sie sich wieder. Offenbar konkurriert der Stoff mit den Bakterien um diesel­ ben Bindungsstellen am Protein.“ im Darm einer normalen maus (links) gibt sich das DmBT1-Protein durch seine rote Färbung zu erkennen. im Darm der maus rechts fehlt das Protein, weil das zugehörige Gen inaktiviert wurde. Durch den Vergleich der beiden mausstämme lässt sich die Funktion von DmBT1 erforschen. Die maßbalken entsprechen jeweils 100 μm. Die Ursache für dieses Kon­ kurrenzverhalten sind die zahlreichen Sulfatgruppen des Dextransulfats, die den Phosphatgruppen auf der Bakterienoberfläche strukturell sehr ähnlich sind. „Das hat uns zu der Überlegung geführt, ob womöglich auch sulfatierte Nahrungsmittelkomponenten mit dem Protein um bakterielle Bindungsstellen konkurrieren und dadurch dessen Schutzfunktion hemmen.“ Che­ misch nah verwandt mit dem Dextransulfat ist das aus Rotalgen gewonnene Carragen. Der Naturstoff findet in der Lebensmittelindustrie vielseitige Verwendung als Gelier- und Dickungsmittel in Wurst, Marmela­ den, Milch- und Lightprodukten, Babynahrung oder Eiscreme. Nach der Europäischen Öko-Verordnung ist Carragen unter der Nummer E 407 auch als Zusatzstoff für Biolebensmittel zugelassen. Die DKFZ-Forscher konnten nachweisen, dass Carragen die bakterielle Bindungsaktivität des Schutz­ proteins DMBT1 genauso hemmt wie Dextransulfat. Jan Mollenhauer regt daher an, man solle mögliche Auswirkungen dieser Nahrungsmittelkomponente auf den Verlauf chronisch entzündlicher Darmerkrankun­ gen genauer untersuchen. „Unser Interesse konzen­ triert sich aber auf einen anderen Aspekt“, erklärt der Wissenschaftler: „Wir haben gesehen, dass Carragen ebenso wie Dextransulfat zu einer Hochregulation des DMBT1-Gens und damit zu einer vermehrten Produktion des Schutzproteins in Darmzellen führt. Wenn aber Gene so empfindlich auf potenziell schäd­ liche Substanzen reagieren – dann ließen sie sich doch vielleicht industriell nutzen, um damit auch andere Lebensmittelbestandteile auf ihre Schädlichkeit oder Unbedenklichkeit zu testen.“ Tatsächlich gelang es Mollenhauer, ein solches Testsystem herzustellen – allerdings benutzte er dazu aus verschiedenen Gründen nicht das Gen für DMBT1, sondern jenes für ein Signalmolekül, das bei der Immun­ abwehr eine ähnliche Rolle spielt wie das Schutzpro­ tein. Gekoppelt an ein sogenanntes Reportergen – es zeigt an, ob und in welchem Ausmaß das eigentlich in­ teressierende Gen aktiv ist – und eingeführt in mensch­ liche Darmtumorzellen, fungiert es nun als Biosensor, der zwischen schädlichen und unschädlichen sulfatier­ ten Lebensmittelbestandteilen unterscheiden kann. 37 kohL GeGen kreBs Kohl gegen Krebs: Brokkoli & Co könnten zur Vermeidung von Tumorerkrankungen beitragen Prostatakrebs ist bei deutschen Männern die zweithäufigste Krebserkrankung mit Todesfolge. Zahlreiche studien deuten darauf hin, dass be­ stimmte inhaltsstoffe des Brokkoli – namentlich Glucosinolate und selen – das erkrankungsrisiko senken können. Diesen Zusammenhang umfassend zu untersuchen ist Ziel eines Verbundprojekts unter Leitung des Deutschen krebsforschungs­ zentrums heidelberg. Die dabei gewonnenen erkenntnisse sollen dazu beitragen, funktionelle Lebensmittel mit einem erhöhten Potenzial zur Prävention von krebs zu entwickeln. Industriepartnern Unilever Deutschland und Frucht­ saft Bayer. Die Forschungsmethoden reichen von der Auswertung epidemiologischer Daten über kontrollier­ te Anbaustudien natürlicher Brokkolisorten und analy­ tische Studien zur Bioverfügbarkeit der Glucosinolate bis hin zu Zellkulturexperimenten, Tierversuchen und Humanstudien. Clarissa Gerhäuser vom Deutschen Krebsfor­ schungszentrum (DKFZ) in Heidelberg koordiniert das Verbundprojekt und leitet zugleich die Versuchsreihen an Zellkulturen und Mäusen. Als Testmaterial dienten Extrakte aus Brokkoli, Brokkolisprossen und -samen, die das gesamte Spektrum an Glucosinolaten und an- Brokkoli und andere Kohlpflanzen sind reich an gesundheitsfördernden inhaltsstoffen. Gesundheitsvorsorge beginnt mit einer ausgewoge­ nen Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist. In den letzten Jahren mehren sich die Hinweise auf eine krebsvorbeugende Wirkung bestimmter Pflanzen­ inhaltsstoffe, die besonders in Brokkoli und anderen Kohlpflanzen enthalten sind: die Glucosinolate. Ob sich Brokkoliprodukte als funktionelle Lebensmittel zur Prävention von Prostatakrebs und anderen Tumorer­ krankungen eignen, untersucht ein Konsortium aus vier akademischen Forschungseinrichtungen und den deren Inhaltsstoffen in ihrer natürlichen Zusammen­ setzung enthalten – so wie es auch beim Essen in den Körper gelangt. Dazu wurde der Brokkoli mit Wasser homogenisiert und ohne weitere Aufbereitung dem Kulturmedium von Prostatakrebszelllinien zugesetzt. Zum Vergleich kamen verschiedene Einzelsubstanzen zum Einsatz, die beim Abbau der Glucosinolate im Verdauungstrakt entstehen. In verschiedenen Testsys­ temen zeigten die so behandelten Zellen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen deutliche Reaktionen: Kohl gEgEn KrEbs 38 Sowohl die Einzelsubstanzen als auch der Gesamtex­ trakt aktivierten wichtige Enzyme der antioxidativen Abwehr wie NAD(P)H:Chinon-Reduktase, Thiore­ doxin-Reduktase und Glutathion-Peroxidase. War der verwendete Brokkoli zuvor mit Selen gedüngt worden (siehe Kasten), so zeigte sich dies in einer gesteigerten Aktivität selenabhängiger Enzymsysteme – ohne dass dadurch eine Störung der anderen Stoffwechselprozes­ se zu beobachten war. selen fördert die körpereigene krebsabwehr Als Bestandteil zahlreicher Enzyme ist Selen unver­ zichtbar für wesentliche Körperfunktionen, insbe­ sondere für ein aktives immunsystem. Verschiedene Studien lassen darauf schließen, dass Selen vor Krebserkrankungen schützen kann. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem selenhaltigen Enzym Glu­ tathionperoxidase zu: Es unterstützt den Körper bei der Entsorgung von Giftstoffen, die beim Fettstoff­ wechsel anfallen, und schützt die Zellmembranen vor der Zerstörung durch reaktive Sauerstoffmole­ küle. indem man Brokkolipflanzen mit Selen düngt und sie so gezielt mit dem Spurenelement anrei­ chert, hofft man sich dessen gesundheitsfördernde Effekte besser nutzbar zu machen. Allerdings sind in den Pflanzen die gleichen Biomoleküle dafür zuständig, sowohl Selensalze als auch Schwefelsalze aufzunehmen und zu transportieren. „Daraus ergab sich die Befürchtung, dass eine Selenatzudüngung möglicherweise so in den Stoffwechsel der Pflanzen eingreift, dass die Biosynthese der schwefelhal­ tigen Glucosinolate gestört wird“, erklärt Thomas Rausch vom institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Heidelberg. im Rahmen des BmBF-Ver­ bundprojekts hat Rausch diese Vermutung überprüft – und konnte sie nicht bestätigen: „Wenn man die Selendüngung so dosiert, dass die Endkonzentration im Brokkoli für den Konsumenten unbedenklich ist, dann wird die Biosynthese der Glucosinolate nicht gestört – im Gegenteil: Selenat aktiviert eine ganze Reihe von Sulfattransportern und führt dazu, dass der Schwefelgehalt im Spross ansteigt.“ Leider wird aus dem überschüssigen Schwefel kein zusätzliches Glucosinolat gebildet, wie Rauschs Studien zeigten: „Nun suchen wir nach den Flaschenhalsreaktionen, die einer gesteigerten Glucosinolatsynthese entge­ genstehen.“ Auf einem Versuchsfeld wird Brokkoli via Blattdüngung mit Selen angereichert. Dagegen können sich verschiedene Abbauproduk­ te der Glucosinolate – namentlich Isothiocyanate und Indolderivate – sehr wohl gegenseitig in ihrer Wir­ kung hemmen, wie Clarissa Gerhäuser zusammen mit Gerlinde Pappa und weiteren DKFZ-Wissenschaftlern in früheren Zellkulturstudien herausfand: „Jede der beiden Reinsubstanzen kann für sich genommen das Wachstum von Krebszellen hemmen. Dagegen wirken beide zusammen antagonistisch, das heißt, sie behin­ dern sich gegenseitig, sodass der wachstumshemmen­ de Effekt aufgehoben wurde.“ Möglicherweise erklärt dieses Phänomen auch die widersprüchlichen Ergebnisse der Tierversuche, die Gerhäuser im Rahmen des BMBF-Projekts durchführte. Als Versuchstiere dienten Mäuse, denen menschliche Prostatakrebszellen unter die Haut gespritzt worden waren; das Tumorwachstum lässt sich an der Zunahme von Gewicht und Volumen messen. Die Mäuse beka­ men Pellets zu fressen, denen 20 % handelsüblicher Brokkoli oder Grünkohlextrakt zugesetzt worden war. Doch anders als erhofft konnte keines der beiden Lebensmittel das Tumorwachstum bremsen. „Das zeigt, 39 kohL GeGen kreBs dass man von In-vitro-Testergebnissen in Zellkultur nicht ohne Weiteres auf die Wirkung eines komple­ xen Lebensmittels auf das Tumorwachstum schließen kann“, betont Gerhäuser. „Wir vermuten, dass auch hier wachstumshemmende und -fördernde Mechanismen zusammenspielen und sich gegenseitig in ihrer Wir­ kung aufheben.“ Ob und wie sich der Genuss von Brokkoli auf den menschlichen Organismus auswirkt, untersuchte Achim Bub vom Max Rubner-Institut in Karlsruhe. Zunächst sollte geklärt werden, inwiefern die Art der Zubereitung die Bioverfügbarkeit der Glucosinolate beeinflusst. Dazu bekamen zwölf freiwillige Testper­ sonen – alles junge, gesunde Männer – im Abstand von einer Woche jeweils 200 Gramm Brokkoli zum Früh­ stück: entweder als rohes oder blanchiertes Gemüse, als Püree oder als Saft, zubereitet von der Fruchtsaft Bayer GmbH & Co. KG aus Ditzingen. Den Probanden wurde im Stundentakt Blut und Urin abgenommen und an die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmit­ telchemie in Garching bei München weitergeleitet; dort analysierte Johanna Hauder als Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Veronika Somoza ihren Gehalt an Sulforaphan und anderen Glucosinolatabkömmlin­ gen. Die höchsten Wirkstoffwerte fanden sich im Blut jener Probanden, die rohen Brokkoli gegessen hatten; deutlich niedriger lagen sie nach dem Genuss von blanchiertem Brokkoli, am niedrigsten nach dem Ver­ zehr von Saft. Achim Bub hat eine Erklärung für die unterschiedliche Bioverfügbarkeit der Wirksubstan­ zen: „Um die Glukosinolate aufzuschließen, braucht der Körper ein pflanzliches Enzym, das erst beim Zerkleinern des Brokkoli freigesetzt wird. Das passiert beim Kauen genauso wie beim Zerschneiden, Pres­ sen oder Pürieren. Zu langes Erhitzen zerstört dieses Enzym – daher die geringen Werte beim blanchierten Gemüse.“ In einer weiteren Studie mit gesunden, jungen Männern sollte sich die Funktionalität des Brokkoli erweisen. Dazu gab Achim Bub den insgesamt 125 Probanden vier Wochen lang täglich 200 Gramm blanchiertes oder püriertes Testgemüse zu essen, das entweder aus gewöhnlichem oder aus eigens mit Selen gedüngtem Brokkoli zubereitet war. Ein weiterer Teil der Testpersonen sollte Kapseln mit Gemüseextrakt einnehmen; eine Kontrollgruppe bekam wirkstofffreie Kapseln. Die Analysen zeigten, dass – verglichen mit der Kontrollgruppe – durch die Selenaufnahme mit Brok­ koli die Aktivität wichtiger Entgiftungsenzyme wie der Glutathionperoxidase erhöht wird. Somit können durch regelmäßigen Brokkoliverzehr wesentliche Me­ chanismen der Körperabwehr gestärkt werden. menschliche Prostatakrebs-Zelllinien werden im inkubator unter physiologischen Temperatur-, pH- und Feuchtebedingungen gehalten. 40 kohL GeGen kreBs im Tumorgewebe von mäusen lässt sich mithilfe spezifischer Antikörper die Expression eines Zellwachstumsmarkers (dunkelbraune Färbung der Zellkerne) nachweisen. Das Gewebe von mäusen, deren Futter glykosinolatreiche Grünkohlsprossen enthielt (linkes Bild) unterscheidet sich nicht von Gewebe aus Kontrolltieren, die Futter ohne Grünkohlzusatz gefressen hatten (rechtes Bild). Jakob Linseisen vom Helmholtz-Zentrum München ging der Frage nach, ob sich diese gesundheitswirksa­ men Effekte glucosinolathaltiger Gemüsepflanzen auch unter Alltagsbedingungen nachweisen lassen. Vor seinem Wechsel nach Bayern war der Ernäh­ rungswissenschaftler am DKFZ mit der Leitung einer groß angelegten epidemiologischen Studie namens EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) betraut. In dieser europaweit größten Kohortenstudie lassen insgesamt 25.000 Frauen und Männer aus dem Raum Heidelberg seit nunmehr 17 Jahren ihren Gesundheitszustand und ihre Ernäh­ rungsgewohnheiten aufzeichnen. „Wir prüfen anhand dieser Daten, ob es bei den Männern einen Zusammen­ hang zwischen dem Risiko für Prostatakrebs und der Zufuhr von Selen und Glucosinolaten gibt“, sagt Jakob Linseisen. Kohortenstudien haben den Vorteil, dass die erfragten Informationen über den Ernähungszustand aus einer Zeit stammen, zu der die Befragten – auch jene, die in späteren Jahren an Krebs erkranken – noch gesund waren, und geben deshalb Hinweise auf mögli­ che präventive Effekte des Lebensstils. Um möglichst genau abzuschätzen, welche Mengen an Glucosinolaten die Teilnehmer der EPIC-Heidel­ berg-Studie gewöhnlich zu sich nehmen, gingen die Helmholtz-Forscher folgendermaßen vor: Zunächst sammelte Linseisens Doktorandin Astrid Steinbrecher alle bis dato veröffentlichten Messdaten zum Gehalt von 26 unterschiedlichen Glucosinolaten in insgesamt 18 verschiedenen Gemüsepflanzen. Besonders hohe Werte fand sie in Brokkoli und weiteren Kohlsorten, aber auch in einer Reihe von Kulturpflanzen, die in vielen wissenschaftlichen Studien oft nicht in Be­ tracht gezogen wurden. So trug der Verzehr von Ret­ tich, Radieschen, Kresse, Senf und Kapern zusammen ein Fünftel zur Gesamtmenge der aufgenommenen Glucosinolate bei. Verknüpft man die Daten zum Glu­ kosinolatgehalt in Lebensmitteln mit den tatsächlich verzehrten Mengen einzelner Lebensmittel, so lässt sich berechnen, welche Mengen an Glucosinolaten die befragten Personen zu sich genommen hatten. Laut dieser Rechnung nahmen die Männer in der EPIC­ Heidelberg-Studie jeden Tag durchschnittlich 14,2 Milligramm der Wirkstoffe zu sich – das entspricht einem Achtel der Menge, die Achim Bubs Probanden täglich zum Frühstück bekamen. „Diese Informationen zur Glukosinolataufnah­ me bei knapp 12.000 Männern aus der EPIC-Kohorte haben wir genutzt, um nach einem Zusammenhang mit dem Auftreten von Prostatakrebs zu suchen“, so Linseisen. Dazu wurde jeder Mann einer von vier Untergruppen zugeteilt – je nachdem, ob er viel oder wenig Glucosinolate zu sich genommen hatte. Dann wurde die Anzahl derjenigen Männer ermittelt, die in den Jahren seit Beginn der Studie an Prostatakrebs erkrankt waren. Jakob Linseisen: „Dabei haben wir einen eindeutigen Zusammenhang gefunden: In der Gruppe mit der höchsten Glucosinolatzufuhr lag die Erkrankungsrate 30 % niedriger als in der Gruppe mit der geringsten Zufuhr. Dieser Unterschied ist beacht­ lich – und statistisch signifikant.“ 41 GesunDer Genuss Gesunder Genuss: Kaffee enthält zahlreiche Substanzen mit gesundheitsfördernden Wirkungen kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen: sie konsumieren den Muntermacher in größeren Men­ gen als Mineralwasser oder Bier. neben seiner be­ kanntesten komponente, dem koffein, enthält das naturprodukt substanzen mit nachweislich posi­ tivem Einfluss auf lebenswichtige Zellfunktionen. in einem vom BMBF unterstützten Forschungspro­ jekt soll der bislang unbekannte Wirkmechanismus von zwei gesundheitsfördernden inhaltsstoffen aufgeklärt werden. Darauf aufbauend wird eine kaffeekomposition mit optimierten Gehalten dieser Bestandteile entwickelt. Fernziel ist ein nicht nur genussvolles, sondern auch funktionelles Getränk zur Prävention von krankheiten, die mit oxidativem stress einhergehen. Als traditioneller Filterkaffee zubereitet oder als Mok­ ka, Capuccino oder Latte Macchiato serviert – das brau­ ne Pulver wird wegen seines aromatischen Geschmacks und der stimulierenden Wirkung weithin geschätzt und ist nach Wasser das am häufigsten konsumierte Getränk weltweit. Ob es unserem Körper eher schadet oder nutzt, wird kontrovers diskutiert. Einige Studien nähren den Verdacht, dass ein überdurchschnittlicher Kaffeekonsum negative Folgen für die Gesundheit haben kann: Er soll dem Körper Wasser entziehen, Schlafstörungen verursachen, den Magen übersäuern und durch eine Erhöhung des Blutdrucks das Herz­ Kreislauf-System schädigen. Neuere Untersuchungen lassen jedoch den Schluss zu, dass Kaffee lediglich von Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen besser gemieden werden sollte, jedoch selbst nicht als Ursache dieser Erkrankungen in Betracht kommt. Zugleich mehren sich die wissenschaftlichen Hinweise auf eine Reihe von gesundheitsfördernden Effekten des Heißgetränks. So zeigen verschiedene Studien, dass ein moderater Kaffeegenuss das Risiko senkt, Parkinson, Alzheimer, Typ-II-Diabetes oder koronare Herzerkrankungen zu entwickeln. Möglicher­ weise schützt Kaffeekonsum sogar vor Krebserkran­ kungen: Die Mehrzahl der diesbezüglichen Untersu­ chungen findet Hinweise darauf, dass er das Risiko für den Ausbruch von Dickdarm-, Brust- und Leberkrebs verringern kann. Vermutlich entfaltet das Getränk diese Schutzwirkung, indem es freie Sauerstoffradikale bindet und so davon abhält, wichtige Biomoleküle und insbesondere die Erbsubstanz zu schädigen. Welche der zahlreichen – teils noch nicht identifizierten – Kaffeeinhaltsstoffe diese antioxidativen, chemopräventiven und antikanzerogenen Effekte im Einzelnen bedingen, ist bis heute ebenso wenig verstanden wie die Mecha­ nismen, die den Wirkungen zugrunde liegen. In den kirschförmigen Früchten des Kaffeestrauches reifen je zwei Kaffeebohnen heran. Wächst der Kaffee nahe am Äquator, hat man regelmäßig Früchte und Blüten am selben Zweig. „Wir wollen dazu beitragen, diese Wissenslücken zu schließen. Außerdem möchten wir herausfinden, wie die Prozessbedingungen geändert werden müssten, um Kaffees zu entwickeln, die mit positiven Inhalts­ stoffen angereichert sind“, betont Gerhard Bytof. Als Wissenschaftlicher Referent der Tchibo GmbH koor­ diniert der Biologe ein ehrgeiziges Vorhaben, das im Rahmen der BMBF-Initiative „Funktionelle Ernäh­ rungsforschung“ gefördert wird. „Coffeeprevention: Identifizierung, Prüfung und Optimierung der gesund­ heitsfördernden Eigenschaften von Kaffee“ lautet der Name des Projekts, an dem sich Wissenschaftler der Technischen Universitäten München, Kaiserslautern, Hamburg-Harburg und Karlsruhe sowie der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Garching bei München beteiligen. 42 GesunDer Genuss Das Konsortium konzentrierte sich auf zwei Kaffee­ inhaltsstoffe, die bereits in zahlreichen Studien ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften unter Beweis gestellt haben: Chlorogensäure (CGA) und N-Methylpy­ ridinium (NMP). Frühere Studien anderer Arbeitsgrup­ pen zeigten: Beide Wirkstoffe sind offenbar in der Lage, wichtige Entgiftungsenzyme zu aktivieren sowie freie Sauerstoffradikale abzufangen und somit die Zelle vor oxidativer Schädigung zu schützen. Parallel zu diesen Entdeckungen wurde Ende der 1990er-Jahre ein Signal­ weg entschlüsselt, der mit dem Kürzel Nrf2/ARE (EpRE) benannt wurde. Ihm kommt eine elementare Rolle beim Schutz der Zelle vor Angriffen durch oxidative Agentien zu. Könnte es nicht sein, dass die Kaffeeinhaltsstoffe CGA und NMP ihre positiven Wirkungen durch Ein­ flussnahme auf diesen Signalweg entfalten? Diese Frage stellte sich die Lebensmittelchemikerin Ute Böttler an der TU Karlsruhe in ihrer Doktorarbeit. Daher be­ handelte sie zwei unterschiedliche Zellkulturen – von menschlichen Dickdarmzellen und von Lymphozyten – zunächst mit den beiden Reinsubstanzen sowie mit Extrakten aus den drei im Handel erhältlichen Kaffee­ sorten Arabica Columbia, Arabica Brasil und Robusta India. Dann verglich sie die Genaktivität der Zellen mit derjenigen in unbehandelten Kontrollen. Das Ergebnis: Tatsächlich entpuppten sich beide Wirkstoffe als po­ tente Aktivatoren des Nrf2/ARE (EpRE)-Signalwegs; sie setzten sowohl in Reinform als auch als Kaffee-Extrakt die Enzymkaskaden in Gang, mit denen die Zellen freie Radikale und andere Giftstoffe unschädlich machen. „Die gezeigten Effekte stellen sich in Konzentrationen ein, die bei einer Aufnahme von fünf Tassen Kaffee am Tag durchaus in den Epithelien des Darmes erreicht werden könnten“, berichtet Ute Böttler. Im nächsten Schritt galt es zu klären, ob die in Zellkulturen beobachteten Schutzwirkungen auch im menschlichen Organismus auftreten. Dazu entwi­ ckelte Tchibo in Zusammenarbeit mit Rudolf Eggers vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik der TU Hamburg-Harburg zwei neuartige Studienkaffees: Einer war – dank einer speziell darauf ausgerichte­ ten Röstung – reich an CGA und arm an NMP, beim anderen verhielt es sich umgekehrt. Die genaue Analyse und Mengenbestimmung der Wirkstoffe wurde im Labor des Lebensmittelchemikers Thomas Hofmann an der TU München vorgenommen. In der folgenden Durch die Röstung werden die Bestandteile der Rohkaffeebohne zu großen Teilen zersetzt oder umgewandelt; dadurch entstehen an die tausend unterschiedliche neue Substanzen, die entscheidend zum Aroma und Geschmack des Kaffees beitragen. Humanstudie tranken 35 Studenten der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Gar­ ching – nach einer 14-tägigen kaffeefreien „Washout“-Phase – vier Wochen lang täglich drei Tassen des CGA-reichen Studienkaffees. Nach einer weiteren kaffeefreien Pause von zwei Wochen konsumierten sie ausschließlich den NMP-reichen Studienkaffee. Wäh­ rend der gesamten Testperiode ließen sich die jungen Männer regelmäßig Blut- und Urinproben abnehmen. 43 GesunDer Genuss Welchen Veränderungen die Kaffeebohne während einer Röstung unterworfen ist, macht die hier gezeigte Sequenz von Querschnitten ungerös­ teter bzw. zunehmend stark gerösteter Kaffeebohnen deutlich. „Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, mussten sie außerdem konsequent auf Rotwein, Tee und Scho­ kolade verzichten, weil darin ebenfalls antioxidative Wirkstoffe enthalten sind“, erläutert Gerhard Bytof. Die Auswertung der Blutproben übertraf alle Erwartungen: „Beide Studienkaffees lösen eine anti­ oxidative Abwehrkaskade aus und machen die Zellen abwehrbereiter“, fasst Bytof die Testergebnisse mit verschiedenen Biomarkern zusammen. Außerdem verringerte sich durch den Kaffeegenuss signifikant das Ausmaß an Schäden an der Erbsubstanz DNA. Dies zei­ gen Messungen von Christine Janzowski, TU Kaisers­ lautern, mithilfe des sogenannten Comet-Assays, der schadhafte DNA-Abschnitte in einem Gelbett sichtbar macht (siehe Bild Seite 32): Die Probanden hatten in ihren Blutzellen signifikant weniger schadhafte DNA – erkennbar an einem schwächer ausgeprägten „Kome­ tenschweif“ –, wenn sie Kaffee konsumiert hatten als während der zweiwöchigen Abstinenzzeit. Die Freude über den deutlich nachweisbaren Schutzeffekt der bei­ den Studienkaffees ist aber nicht ganz ungetrübt: „Das Aroma und der Geschmack dieser Testsorten lassen noch etwas zu wünschen übrig“, räumt Gerhard Bytof ein. „Hier müssen wir unsere Expertise bei der Schaf­ fung genussvoller Kaffees noch intensiver nutzen.“ auf die röstung kommt es an Kaffeebohnen enthalten an die tausend identifi­ zierte Inhaltsstoffe sowie mehrere Dutzend bislang unbekannte Substanzen. ihr Anteil verändert sich durch den Röstprozess: Lipide, Mineralien und Koffein durchlaufen die Hitzebehandlung weitge­ hend unbeschadet. Dagegen werden viele Stoffe durch die hohen Temperaturen von bis zu 260 Grad Celsius zersetzt oder umgewandelt. So werden beispielsweise die in grünen Rohbohnen enthaltene Saccharose oder das Eiweiß im Rohkaffee während der Röstung nahezu vollständig abgebaut. Gleich­ zeitig entstehen durch die thermischen Kräfte zahlreiche neue Substanzen, die in der Rohbohne nicht vorkommen, aber entscheidend zum Aroma des Kaffees beitragen. im mittelpunkt des BmBF-Projekts stehen die beiden gesundheitsfördernden Kaffeeinhaltsstoffe Chlorogensäure (CGA) und N-Methylpyridinium (NmP). Verschiedene Kaffeesorten enthalten unterschiedliche Anteil dieser Wirkstoffe: Manche Robusta-Sorten sind reicher an CGA, aber oft ärmer an der NMP-Vorläufersubstanz Trigonellin als Ara­ bica-Sorten. Die mengenverhältnisse verschieben sich noch zusätzlich durch den Röstungsprozess. Chlorogensäuren haben in Rohkaffee einen Anteil von 7–12 % ; nach der thermischen Zersetzung bleibt davon nur etwa die Hälfte übrig. Außer­ dem enthält gerösteter Kaffee um mindestens ein Drittel weniger Trigonellin als der entsprechende Rohkaffee – dafür aber umso mehr NMP, das beim Abbau von Trigonellin entsteht. Demnach verhal­ ten sich die beiden Wirkstoffe CGA und NMP bei der Röstung konträr: Wenn der Anteil des einen steigt, sinkt die menge des anderen. Die Kunst besteht nun darin, verschiedene Kaffeesorten mit entsprechenden Trocken- und Röstverfahren zu kombinieren, um eine optimale Kombination beider Wirkstoffe zu erzielen. Dieses Manko sollte in einer zweiten Humanstu­ die – betreut von Gerhard Eisenbrand am Institut für Lebensmittelchemie und Umwelttoxikologie der TU Kaiserslautern – durch einen neuartigen Studienkaffee behoben werden: Er enthält CGA und NMP in 44 höheren Konzentrationen als handelsübliche Sor­ ten. Das Ergebnis der Studie ist in doppelter Hinsicht erfreulich. Zum einen konnte sie die positiven Einflüsse auf die Zellgesundheit weitgehend bestätigen. Zum an­ deren wurde der Studienkaffee von den Probanden gut angenommen. „Wir haben uns hinsichtlich der Sen­ sorik deutlich verbessert“, betont Bytof, „jetzt arbeiten wir daran, den Gehalt an antioxidativen Wirkstoffen zur Stärkung der zellulären Abwehrmechanismen zu erhöhen und den Kaffee dabei zu dem zu machen, was er aus unserer Sicht vor allem ist: ein Genussmittel, das diesen Namen verdient.“ GesunDer Genuss Das ist leichter gesagt als getan. Denn die beiden wesentlichen Komponenten verhalten sich beim Röst­ vorgang gegensätzlich: CGA wird durch starke Hitze zersetzt, während sich NMP erst bei hohen Tempera­ turen bildet. Doch Gerhard Bytof setzt auf innovative Trocken- und Rösttechniken. Er ist zuversichtlich, dass sich ein Kaffee mit allen gewünschten Eigenschaften entwickeln lässt. Mit einem derartigen Produkt könnte Tchibo künftig einen Beitrag zum Schutz vor oxidati­ vem Stress und einer Vielzahl damit einhergehenden Leiden wie Diabetes oder Krebserkrankungen leisten. Zur Analyse von Kaffeeinhaltsstoffen werden die Proben in der Ionenquelle des Massenspektrometers zunächst durch Anlegen einer Spannung in feine geladene Tröpfchen (blau) vernebelt. Das Lösungsmittel wird durch Heizer (gelb) verdampft, die verbleibende Probensubstanz in ein Hochvakuum (schwarzer Punkt mitte) gezogen und dort nach molekülmasse aufgetrennt. 45 DerseLBe ernährunGsstiL ist nicht FÜr jeDen GesunD Derselbe Ernährungsstil ist nicht für jeden gesund Prof. joachim spranger untersucht die molekularen Grundlagen von Diabetes Wie nimmt unsere Nahrung Einfluss auf den Stoff­ wechsel – und damit auch auf unseren Gesund­ heitszustand? joachim spranger will das komplexe Wechselspiel zwischen ernährung und Metabolis­ mus besser verstehen. in seiner Forschungsarbeit untersucht der endokrinologe die molekularen Mechanismen, die zur entstehung von Diabetes und adipositas beitragen. als arzt bemüht er sich darum, dass dieses Wissen möglichst rasch den betroffenen Patienten zugutekommt. „Es genügt nicht, im Experiment neue Erkenntnis­ se über bestimmte Mechanismen zu gewinnen. Wir müssen anschließend auch den Nachweis führen, dass diese Mechanismen für den Menschen relevant sind“, sagt der Mediziner, der seit 2008 an der Berliner Charité eine Heisenberg-Professur für Endokrinolo­ gie, Diabetes und Ernährungsmedizin innehat. Dieser translationale Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch Sprangers beruflichen Werdegang. Nach seinem Medizinstudium an den Universitäten Bochum und Newcastle upon Tyne in Großbritannien praktiziert der gebürtige Kölner zunächst als Assistenzarzt am Universitätsklinikum Bochum. Seine Patienten leiden an hormonellen Störungen und Stoffwechselentglei­ sungen, vor allem an Diabetes und Adipositas. Daher untersucht er schon in der Doktorarbeit die Bedeutung einzelner Signalstoffe bei der Entstehung dieser Krank­ heitsbilder. Im Jahr 2000 wechselt Spranger als Wissenschaft­ licher Mitarbeiter an das Deutsche Institut für Ernäh­ rungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrücke und befasst sich mit der Frage, wie das Ernährungsverhal­ ten die hormonelle Antwort des Körpers beeinflusst: Wie interagieren Kohlenhydrate, Eiweiße oder andere Nahrungskomponenten mit den hormonellen Regula­ tionsmechanismen in der Leber, im Muskelapparat und insbesondere im Fettgewebe? Gibt es dabei Unterschie­ de zwischen normalgewichtigen und übergewichtigen Personen? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus im Hinblick auf das Risiko, an Diabetes oder Adipositas zu erkranken? Dieses Bündel von Fragen lässt sich nicht durch einen einzigen Forschungsan­ satz lösen. Entsprechend vielseitig sind die Techniken, mit denen Joachim Spranger nach Antworten sucht. Experimente an Zellkulturen und Mäusen, ergänzt durch klinische Studien, liefern wichtige Erkennt­ nisse: Eine bedeu­ tende Rolle bei der Entstehung von Diabetes kommt demnach jenen Signalmolekülen Joachim Spranger, Charité-Universitätszu, die bei entzünd­ klinikum Berlin lichen Prozessen beteiligt sind. „Ob jemand zuckerkrank wird oder nicht, bestimmen aber nicht nur die Entzündungsmarker an sich. Entscheidend ist vielmehr das Muster der von ihnen modulierten Entzündungsantwort“, so Spranger. Diese Einsicht führt den Arzt zu folgender Über­ legung: Sollte sich mithilfe individueller Megaboli­ tenmuster womöglich vorhersagen lassen, ob jemand krank wird oder gesund bleibt? Schon heute erlauben einzelne Parameter – wie beispielsweise der Choles­ terinwert eines Patienten – eine grobe Einschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Betroffene einen Herzinfarkt oder Diabetes bekommen wird. „Mittler­ weile können wir im Blut mehr als tausend Metabo­ liten messen. Damit sollte sich das Erkrankungsrisiko präziser vorhersagen lassen als mit einigen wenigen Molekülen“, so Sprangers Idee. „Nutrigenomik“ heißt dieser Forschungsansatz, der die Wirkung bestimmter Nahrungsmittel auf individuelle genetische Unter­ schiede zurückführen und so erklären will, warum derselbe Ernährungsstil den einen gesund erhält, den anderen jedoch krank macht. Im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme BioProfile Nutrigenomik und im Rahmen eines großen EU-Forscherverbundes vergleicht Joachim Spranger die Metabolitenprofile von Diabetespatienten und gesunden Probanden. Im nächsten Schritt will er versuchen, in einer Zelle einzelne Stoffwechselwege zu identifizieren, die die Funktionalität dieser Zelle beeinflussen. Als Untersu­ chungsobjekte dienen ihm Fett-, Leber- und Muskel- 46 DerseLBe ernährunGsstiL ist nicht FÜr jeDen GesunD Gemahlene maisstärke in 800-facher Vergrößerung, mit Polfilter aufgenommen zellen sowie die Insulin produzierenden Betazellen aus der Bauchspeicheldrüse. 2006 bewirbt sich Joachim Spranger für ein Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungs­ gemeinschaft DFG, um damit einen Forschungsauf­ enthalt an der Universität Cambridge in England zu finanzieren. „Wir hatten schon Schulen für unsere Kinder ausgesucht“, erinnert sich der Forscher. Doch dann kommt alles anders: Die Charité bietet ihm an, eine Heisenberg-Professur einzurichten, und die DFG wandelt sein Stipendium in eine Heisenberg-Professur um. Gleichzeitig bewilligt ihm das BMBF im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs „Molekulare Grundlagen der humanen Ernährung“ eine Nachwuchsgruppe. Also verwirft Spranger seine Pläne – und bleibt in Deutschland, wo er vom DIfE an die Charité wechselt. Dort will er herausfinden, welche Stoffwechselwege an der Entstehung der Insulinresistenz beteiligt sind. Parallel dazu sucht er nach Möglichkeiten, wie fettlei­ bige und zuckerkranke Menschen den Verlauf ihrer Krankheit günstig beeinflussen können. „Die wichtigste therapeutische Maßnahme ist allgemein bekannt: mehr bewegen und weniger essen“, sagt Joachim Spran­ ger. Doch in der Praxis erlebt Spranger tagtäglich, wie schwer es den Betroffenen fällt, diesen einfachen Rat umzusetzen: „Die meisten Menschen bringt man leider nicht dazu, ihren Lebensstil zu ändern. Deshalb muss man auch andere Lösungswege in Betracht ziehen. Einer davon könnte darin bestehen, die Lebensmittel zu verändern“, so der Arzt. Ob sich diese Idee verwirklichen lässt, untersucht Joachim Spranger nun in einem vom BMBF geförderten Verbundprojekt zur Funktionellen Ernährungsfor­ schung. Dabei soll zunächst geprüft werden, welche Kohlenhydrate sich günstig auf den Glucosestoffwech­ sel auswirken. Zur Auswahl stehen Kartoffeln der Sorte Desirée sowie sechs Züchtungen der Firma Bayer BioScience GmbH, die aufgrund gentechnischer Eingriffe unterschiedliche Mengenverhältnisse von Amylose und Amylopectin enthalten. Diese beiden Stärkekohlen­ hydrate unterscheiden sich im Aufbau ihrer Moleküle: Amylose bildet lange Ketten, die von den menschlichen Verdauungsenzymen nur sehr langsam in ihre Zucker­ DerseLBe ernährunGsstiL ist nicht FÜr jeDen GesunD 47 bestandteile gespalten werden; Amylopectin ist stärker verzweigt und lässt sich leichter abbauen. Als Kontrolle dient Maisstärke, die von Natur aus einen vergleichs­ weise hohen Anteil der schwer verdaulichen Amylose enthält. Effekte auf den Stoffwechsel hat“, freut sich Spranger. Ob diese positiven Wirkungen längerfristig anhalten, soll sich in weiteren Studien erweisen, bei denen die Probanden sieben Tage lang Gerichte aus den Testkar­ toffeln essen werden. „Weil Amylose im Darm schlechter gespalten und resorbiert wird, steigt der Blutzuckerspiegel weniger schnell an“, erklärt Spranger. Je höher der Amylosean­ teil einer Kartoffelsorte, umso günstiger sollte sie sich also auf den Blutzuckerstoffwechsel – und damit auf den Diabetesverlauf – auswirken, so die Vermutung der BMBF-Forscher. Um dies zu überprüfen, wurden junge, gesunde Probanden gebeten, Stärke, Chips oder Pommes frites zu essen, die eigens aus den transgenen Kartoffeln hergestellt worden waren. Vor, während und nach den Mahlzeiten wurde den Probanden Blut abgenommen und dessen Gehalt an Blutzucker, Insulin und verschiedenen Sättigungshormonen bestimmt. Fazit: „Wir haben eine Kartoffelsorte iden­ tifiziert, deren Stärke metabolisch sogar vorteilhafter ist als die Maisstärke und nicht nur während der Mahlzeit, sondern auch noch am Folgetag günstige Joachim Spranger weiß, dass gentechnisch mo­ difizierte Lebensmittel bei deutschen Konsumenten derzeit auf geringe Akzeptanz stoßen. „Vielleicht ändert sich das, wenn wir zeigen können, dass funktionelle Produkte aus transgenen Kartoffeln gut schmecken und sich gleichzeitig zur Vorbeugung von Diabetes eignen“, meint der Mediziner. Ob seine Vision ei­ nes Tages Realität wird, hängt nicht zuletzt von der Sicherheit solcher neuartiger Lebensmittel ab. Deshalb beteiligt sich ein Team um Lothar Willmitzer vom Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiolo­ gie in Potsdam an dem BMBF-Projekt. Neben anderen sicherheitsrelevanten Aspekten wird dabei gründlich überprüft, ob die genveränderten Kartoffeln – neben den erwünschten Einflüssen auf den Zuckerstoffwech­ sel – weitere, möglicherweise ungünstige Wirkungen auf den menschlichen Metabolismus haben. Vielen menschen fällt es schwer, ihre Essgewohnheiten zu ändern. Funktionelle Lebensmittel – beispielsweise Kartoffeln mit veränderter Stärke­ zusammensetzung – könnten möglicherweise zu einer gesünderen Ernährung beitragen. 48 Mit hochDruck GeGen DurchFaLL Mit Hochdruck gegen Durchfall: Ein neues Verfahren soll heilende Wirkstoffe reiner und kostengünstiger herstellen karotten – weich gekocht oder fein gerieben – gel­ ten seit Langem als bewährtes Mittel gegen Durch­ fall. Wissenschaftliche untersuchungen konnten diesen heilbringenden effekt bestätigen und als Wirksubstanzen die oligogalacturonsäuren (oGas) ausmachen. Sie entstehen, wenn der in Pflanzen weitverbreitete Zellbaustoff Pektin in kleinere einheiten zerlegt wird. am Deutschen institut für Lebensmitteltechnik wird ein neuartiges Verfahren zur Pektinspaltung erprobt, das die oGas reiner und kostengünstiger als bisher bereitstellen soll. Zahlreiche Krankheitskeime lösen Durchfallerkrankun­ gen aus, weil sie sich an die Darmwand anheften und sie mit Giftstoffen schädigen. Oligogalakturonsäuren können das verhindern, indem sie genau jene Rezep­ toren blockieren, die den Mikroben als Kontaktstellen dienen. Folglich finden die Erreger keinen Halt und werden ausgeschieden. Diese Zusammenhänge sind seit Mitte der 1990er-Jahre bekannt. Seither gibt es Überle­ gungen, funktionelle Lebensmittel mit OGAs herzustel­ len, um damit Darminfektionen vorzubeugen oder zu behandeln. „Bevor man diese Substanzen der Nahrung zusetzen kann, müssen sie gut charakterisiert und auf ihre Unbedenklichkeit geprüft werden“, sagt Stefan Töpfl vom Deutschen Institut für Lebenmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück. Dieser Aufgabe widmet sich nun ein von Töpfl koordinierter Forschungsverbund, an dem sich die TU München, das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin sowie zwei Industriepartner beteiligen. Kernstück des Projekts ist die Entwicklung eines neu­ artigen Verfahrens zur Spaltung von Pektin. Denn die der­ zeit praktizierten Methoden – enzymatische oder che­ mische Hydrolyse mittels starker Säuren – haben ihre Schwächen: Enzyme arbeiten zwar sehr spezifisch, aber langsam und mit geringer Ausbeute. Dagegen verläuft die saure Hydrolyse zwar schnell, aber unspezifisch – und be­ lastet ihr Endprodukt mit großen Mengen Salz, das beim Neutralisieren der Säure anfällt. Stefan Töpfl und seine Kollegen haben nun eine Biomassespaltanlage entwickelt, die mit überkritischem Wasser arbeitet (siehe Kasten). Oligogalakturonsäuren verhindern die Anheftung pathogener Bakterien (schwarze Striche) an menschliche Darmzellen (im Bild als Zellkulturen, mit roten Zellkernen) und wirken somit Durchfaller­ krankungen entgegen. Die Pilotanlage besteht aus einem Durchflussreaktor, der 25 Liter pro Stunde fasst (siehe Bild Seite 49). Überkritisches Wasser existiert bei hohem Druck (über 221 bar), kombiniert mit großer Hitze (mehr als 374 Grad Celsius). Unter diesen Bedingungen verhält es sich wie eine Art Zwitter: Manche seiner Eigenschaften sind typisch für Flüssigkeiten, manche für Gase. Daraus ergeben sich besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel lösen sich in überkritischem – anders als in gewöhnlichem Wasser – organische Substanzen, darunter auch Pektin. Außerdem bilden sich darin besonders viele geladene Teilchen, die seine hydrolytische Wirkung erhöhen. Bisher wird überkritisches Wasser vor­ wiegend zur Entsorgung von Giftmüll und anderer schwer abbaubarer Abfallstoffe eingesetzt. Als Rohstoff dient Zitruspektin, ein Gemisch aus ver­ schieden langen Molekülketten, deren Glieder überwie­ gend aus einem Zucker namens Galakturonsäure beste­ hen. „Durch Steuerung der Prozessbedingungen können wir 80 Hydrolysatmischungen herstellen, die sich in der Zusammensetzung ihrer Spaltprodukte unterscheiden“, berichtet Stefan Töpfl. Mit hochDruck GeGen DurchFaLL Ob die Hydrolysate die Anheftung von Krankheits­ keimen an menschliche Darmzellen hemmen und wie stark der erwünschte Effekt jeweils ausgeprägt ist, prüft Töpfl an Zellkulturen (siehe Bild Seite 48). „Wir lassen die Spaltprodukte einige Minuten lang auf die Darmzellen einwirken und waschen sie wieder ab. Dann geben wir pathogene E.-coli-Bakterien dazu und zählen unter dem Mikroskop aus, wie viele Keime sich an die Zellen heften“, erklärt der Ingenieur. Das Ergebnis: Die Hydrolysate verringern die Anheftung der Bakterien um 20 bis 80 % . Am wirkungsvollsten sind Mischungen, die einen hohen Anteil an OGAs aus drei bis acht Zuckern enthalten. Bestätigt werden Töpfls Befunde durch ein neuartiges Testsystem, das am Lehrstuhl für Medizinische Elektronik der TU München entwickelt wurde. Dazu wer­ den die Darmzellen auf einem Chip mit bioelektrischen Mikrosensoren kultiviert, die den Sauerstoffverbrauch und die Säurefreisetzung sowie zellmorphologische Größen erfassen. „Damit können wir in Echtzeit messen, ob und wie sich der Zustand der Zellen nach Kontakt mit pathogenen Bakterien verändert und inwiefern sich diese Reaktionen durch OGAs abschwächen lassen“, erklärt Martin Brischwein von der TU München. Allerdings haben die Hydrolysate auch uner­ wünschte Nebenwirkungen. „Bei Prozesstemperaturen 49 über 230 Grad Celsius entstehen giftige Spaltprodukte, die nicht nur die Bakterien hemmen, sondern auch die Darmzellen schädigen“, betont Thorsten Buhrke vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin, der im Auftrag des DIL eine Reihe von toxikologischen Tests durchgeführt hat. Die Konsequenz aus diesem Fund: „Entweder muss man die Hydrolyse bei niedrigeren Temperaturen laufen lassen – auch wenn das den Durchsatz verringert. Oder man braucht ein Aufreini­ gungsverfahren zum Abtrennen der unerwünschten Bestandteile – was machbar, aber kostenaufwendiger ist“, erläutert Töpfl. An der wirtschaftlichen Gewinnung von toxiko­ logisch unbedenklichen OGAs aus Pektin sind zwei mittelständische Firmen interessiert, die neben Finanz­ mitteln auch ihr Know-how in das BMBF-Projekt ein­ bringen: Herbstreith & Fox KG Pektin Fabriken gewinnt aus Resten der Obst- und Gemüseverarbeitung Pektin als Dickungsmittel für Lebens- und Arzneimittel. Von den hochwertigen Hydrolysaten erhofft sich die Firma eine Erweiterung ihrer Produktpalette. Nutrichem diät+pharma GmbH stellt dietätische und funktionelle Lebensmittel sowie Sondennahrung her und ist damit ein potenzieller Vertreiber für OGAs mit nachgewiese­ ner physiologischer Wirksamkeit. In dieser Pilotanlage wird ein neuartiges Verfahren zur Pektinspaltung erprobt: Mithilfe von überkritischem Wasser sollen Oligogalakturonsäu­ ren reiner und kostengünstiger als bisher bereitgestellt werden. GesPräch Mit ProF. schMitt, hochschuLe FuLDa 50 „Funktionelle Ernährungsforschung erfordert die Zusammenarbeit von Akademia und Industrie“ Im Gespräch mit Dr. Joachim Schmitt, Professor für die Technologie pflanzlicher Lebensmittel an der hochschule Fulda begünstigen. Doch letztlich wissen wir noch viel zu wenig über so komplexe Krankheitsbilder wie Diabetes; ein einfaches Ursache-Wirkungs-Denken greift zu kurz. Hier herrscht noch ein enormer For­ schungsbedarf. Welches sind aus ihrer sicht die drängensten Fragen? Joachim Schmitt, Hochschule Fulda herr Dr. schmitt, was kann die Funktionelle ernährungsforschung leisten? Wir haben es mit einem grundsätzlichen Dilemma zu tun: Unsere Kultur unterscheidet sich sehr stark von der Lebensweise, für die unser Körper ursprünglich gebaut wurde. Die meisten Menschen bewegen sich zu wenig und arbeiten mehr mit dem Kopf als mit den Muskeln. Für die Ernährungsforschung ergeben sich daraus zwei wichtige Zielrichtungen: Erstens muss sie Antworten darauf geben, welche Nährstoffe wir brauchen, um unter den veränderten Anforde­ rungen gesund und leistungsfähig zu bleiben. Zwei­ tens muss sie der Tatsache Rechnung tragen, dass wir im Geiste immer noch Jäger und Sammler sind und unser Geschmackssinn entgegen dem physio­ logischen Bedarf auf sehr fette, süße und salzhaltige Nahrung abgestellt ist. erklärt das die Zunahme ernährungsbedingter krankheiten? Vieles deutet darauf hin, dass mangelnde Bewegung und zu süße, zu fettreiche Ernährung die zuneh­ mende Verbreitung verschiedener Volkskrankheiten Wir müssen verstärkt nach Möglichkeiten suchen, durch geeignete Ersatzstoffe die biologisch veran­ kerten Geschmacksvorlieben auszuleben, ohne uns mit den damit verbundenen Mengen an Kalorien oder Salz zu belasten. Denn es ist nicht damit getan, Produkte anzubieten, die einfach 30 % weniger Salz oder Fett enthalten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil der Bevölkerung solche salz- oder fettreduzierten Produkte nicht annimmt. Die Leute lieben eben diesen Fetteindruck! Da stellt sich die Frage: Wie können wir diesen Eindruck auch bei fettarmen Produkten erzeugen? Neueste Ergeb­ nisse aus der Rezeptorforschung deuten darauf hin, dass es einen Geschmackssinn für Fett geben könnte. Wenn sich das bestätigt, sollte sich auch ein Fetter­ satzstoff finden lassen – ähnlich den Süßstoffen, die als Ersatz für Zucker inzwischen gut etabliert sind. Nach solchen Modulatoren wird zurzeit in Industrie und Akademia gesucht. Der Staat bietet dabei für grundlegende Projekte finanzielle Hilfe an. Warum brauchen solche Forschungskonsortien staatliche unterstützung? Derartige Projekte kosten mehrere Millionen Euro. Und sie beinhalten immer auch ergebnisoffene Grundlagenforschung – denn man muss erst neues Wissen schaffen, bevor man daraus etwas ableiten und gestalten kann. Die Industrie, die auf Gewinne angewiesen ist, kann solche großen Forschungsvor­ haben nicht alleine schultern. Da kommt das BMBF als Lenkungsinstanz ins Spiel, indem es Denkim­ 51 GesPräch Mit ProF. schMitt, hochschuLe FuLDa pulse aus der akademischen Forschung aufgreift und sie zum Förderschwerpunkt macht. Dass dieses Modell ganz ausgezeichnet funktioniert, zeigt die Geschichte der Glycobiotechnologie, aus der letzt­ lich unser Wissen über die Präbiotika stammt. können sie das genauer erklären? Glycoproteine sind eine Klasse von Zuckermole­ külen auf der Außenhaut von Zellen. Inzwischen weiß man, dass sie das Kommunikationssystem des Körpers schlechthin sind, doch Ende der 1990er­ Jahre war das eher ein exotisches Thema. Professor Werner Reutter von der Charité in Berlin hatte ein erkenntnistheoretisches Interesse an diesen Strukturen; damit kam er zu Milupa und regte an, auch in der Muttermilch nach ihnen zu suchen. Wir wussten damals nichts von diesen Stoffen und erhofften uns Ideen für neue Produkte. So entstand ein Verbundprojekt, an dem weitere Industriever­ treter und Universitäten beteiligt waren. Das BMBF finanzierte ein teures Analysegerät, mit dem wir schließlich Hunderte verschiedene Oligosaccharide in der Muttermilch nachweisen konnten. Das war eine große Überraschung. Was fängt man mit so einer Überraschung an? Man fragte sich natürlich, wozu diese vielen Zu­ ckermoleküle gut sind. Schließlich kam man zu der Erkenntnis, dass sie die Darmbakterien ernähren – und entwickelte daraus das Konzept der Präbio­ tika. Milupa machte sich sofort daran, dieses neue Wissen bei der Herstellung der Babynahrung zu nutzen. Denn die Formelnahrung soll ja möglichst gut die Funktionen der Muttermilch ersetzen, und das betrifft auch die Zusammensetzung der Darm­ mikrobiota im kindlichen Organismus. Tatsächlich haben wir schon wenige Jahre nach dem Projekt Oligosaccharide aus Pflanzen und Kuhmilch identifizieren können, die sich günstig gewinnen lassen und als Präbiotika die gewünschte Funktion erfüllen: Sie fördern eine Mikrobiota, die ähnlich zusammengesetzt ist wie bei Kindern, die gestillt werden. Diese verbesserte Babynahrung ist inzwi­ schen auf dem Markt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus einem zunächst ergebnisoffenen Forschungsprojekt, das mit öffentlichen Mitteln mitfinanziert ist, Schritt für Schritt ein funktionel­ les Produkt entsteht. Wo sehen sie die herausforderungen der kommenden sechs jahre? Auf dem Gebiet der Babynahrung müssen wir uns noch stärker an den vielfältigen Funktionen der Muttermilch orientieren. Wir wissen, dass darin Stoffe enthalten sind, die gegen Bakterien wirken oder das Immunsystem stimulieren – aber sie sind noch nicht identifiziert. Eine ebenso große Herausforderung ist es, wirkungsvolle Salzge­ schmacksverstärker zu finden, um den übermäßi­ gen Salzkonsum zu drosseln. Bislang gibt es keine akzeptablen Ersatzstoffe. Industrie und akademi­ sche Forschungseinrichtungen arbeiten daran, auch mit Förderung des BMBF. Der erste Schritt ist getan – so wie damals mit den Glycoproteinen. Glycoproteine sind Eiweiße (Proteine), an die eine oder mehrere Kohlenhydratgruppen gebunden sind. 52 MetaBoLisches synDroM Metabolisches Syndrom: Wie pflanzliche Proteine und Ballaststoffe den Krankheitsverlauf beeinflussen eine steigende Zahl von Menschen leidet am me­ tabolischen syndrom, das durch Übergewicht und Diabetes sowie Bluthochdruck und erhöhte Blut­ fettwerte gekennzeichnet ist. ein Forschungsver­ bund aus Medizinern, ernährungswissenschaftlern und Lebensmittelherstellern will dazu beitragen, die diesem krankheitsbild zugrunde liegenden Me­ chanismen aufzuklären. Darauf aufbauend sollen neue gesundheitsfördernde und zugleich kosten­ günstige und einfach zu nutzende Lebensmittel entwickelt werden, die die Insulinempfindlichkeit der körperzellen bei Übergewichtigen verbessern und einer Gewichtszunahme und Leberverfettung entgegenwirken können. „Profimet – Wirkung von Proteinen und Ballaststoffen auf Parameter des metabolischen Syndroms“ heißt das Verbundprojekt unter Leitung des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrü­ cke. „Wir wollen den Einfluss dieser beiden Nahrungs­ komponenten – einzeln und in Kombination – auf den Stoffwechsel verstehen“, sagt der Projektkoordinator Martin O. Weickert vom DIfE, der mittlerweile als Chef­ arzt für Endokrinologie und Diabetes des Universitäts­ klinikums Coventry und Warwickshire und assoziierter Professor der Universität Warwick in England arbeitet. Dass schon der tägliche Verzehr von 30 Gramm unlös­ licher Ballaststoffe aus Weizen oder Hafer deutliche gesundheitsfördernde Effekte hat, konnte Weickert bereits in mehreren Kurzzeitstudien an jungen, gesun­ den Frauen zeigen: „Schon am zweiten Versuchstag verringerte sich der nach einer Mahlzeit gemessene Blutzuckeranstieg um ein Drittel. Dagegen blieb der In­ sulinspiegel im Vergleich zum Vortag unverändert oder sank sogar etwas ab. Das lässt vermuten, dass unlösli­ che Ballaststoffe die Insulinwirkung deutlich verstär­ ken und hierüber das Risiko für Diabetes und Gefäßer­ krankungen senken können“, erklärt Weickert. In einer Studie an übergewichtigen und adipösen Frauen zeigte sich, dass eine über drei Tage eingehaltene Diät mit sehr hohem Ballaststoffanteil eine Verbesserung der Gesamtkörper-Insulinempfindlichkeit bewirkt. „Diese Daten liefern wichtige Einsichten in die bislang weitgehend unbekannten Mechanismen hinter den positiven Effekten der unlöslichen Ballaststoffe“, sagt Andreas F. H. Pfeiffer, der als Leiter der Abteilung Klinische Ernährung am DIfE maßgeblich an dem Profimet-Projekt beteiligt ist. Aufbauend auf diesen Er­ gebnissen betreute das Team um Weickert und Pfeiffer eine 18 Wochen andauernde, kontrollierte Verzehr­ studie mit 115 übergewichtigen Männern und Frauen. Die Probanden wurden darin geschult, ihre Mahlzeiten über den gesamten Zeitraum der Studie so auszuwäh­ len, dass darin entweder ein möglichst hoher Anteil an Ballaststoffen oder an Proteinen enthalten war. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten sie als Teil ihres Früh­ stücks und Abendessens spezielle Milchshakes sowie Crêpes oder Waffeln zu sich nehmen, die entweder mit 50 Gramm Proteinen aus Erbsen und Molke oder mit 30 Gramm Ballaststoffen aus Getreide oder mit einer Mischung aus beidem (25 und 15 Gramm) angerei­ chert waren. Eine vierte Probandengruppe diente als Kontrolle und bekam die entsprechenden Produkte als Placebo ohne zugesetzte Testkomponenten. In regel­ mäßigen Abständen untersuchten die DIfE-Forscher, Für eine Stoffwechselstudie in der Abteilung Klinische Ernährung wird einer Teilnehmerin Blut abgenommen. MetaBoLisches synDroM 53 gestrebten Diäten – auf höchstens 22 % Proteinanteil und sind damit weniger aussagekräftig“, sagt Pfeiffer. Sein Kollege Weickert fasst erste Ergebnisse der aufwendigen Profimet-Studie zusammen: „Die prote­ inreiche Diät scheint eine Änderung der Körperzusam­ mensetzung zu bewirken und damit auch verschiedene Stoffwechselprozesse günstig zu beeinflussen, während die Hochballaststoffdiät möglicherweise die Insulin­ empfindlichkeit verstärkt.“ Allerdings seien wesentliche Schlüsseldaten der Studie derzeit noch nicht ausgewer­ tet, insbesondere die Insulinempfindlichkeit der Leber sowie bestimmte molekulare Signalwege im Muskel­ gewebe, so der Arzt: „Die Betrachtung dieser Parame­ ter spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir mögliche günstige Effekte der hier untersuchten Diäten im Gesamtzusammenhang beurteilen wollen.“ mit einer Backmischung aus der Tüte können sich die Teilnehmer einer Verzehrstudie nach Belieben Waffeln oder Crêpes zubereiten. Die vom Institut für Getreideverarbeitung hergestellte Rezeptur ent­ hält – obwohl sich Konsistenz und Geschmack nicht unterscheiden – wahlweise geringe oder sehr hohe Anteile an Proteinen und/oder Ballaststoffen. wie sich in den vier Probandengruppen verschiedene Parameter wie Insulinempfindlichkeit, Glukosestoff­ wechsel oder Körperfettverteilung infolge der unter­ schiedlichen Diäten veränderten. An der Bereitstellung der Testlebensmittel waren zwei Industriepartner aus Sachsen – die Firmen ano­ nanährmittel C.L. Schlobach GmbH und KATHI Rainer Thiele GmbH in Halle – sowie das Institut für Getreide­ verarbeitung (IGV) in Nuthetal beteiligt. Am IGV wurde großer Wert darauf gelegt, dass alle Produkte, egal ob mit und ohne Zusatz von Proteinen oder Ballaststoffen, möglichst ähnlich in ihrer Konsistenz, ansprechend im Geschmack und zudem in mehreren Geschmacks­ richtungen verfügbar waren. Die ballaststoffreichen Produkte enthielten überwiegend unlösliche Getrei­ defasern; die Proteinprodukte wurden aus Molke und Erbsen hergestellt, weil die darin enthaltenen Eiweiße nach heutigem Wissensstand eine günstige Amino­ säurezusammensetzung aufweisen. „Mithilfe dieser sorgfältig gefertigten Testlebensmittel konnten wir sicherstellen, dass die Probanden der „Proteingruppe“ tatsächlich Mahlzeiten mit einem Proteinanteil von mindestens 30 % zu sich nahmen. Bisherige Lang­ zeitstudien zur Wirkung proteinreicher Kost basieren dagegen – aufgrund mangelnder Einhaltung der an­ Für die Gewinnung pflanzlicher Proteine sieht Andreas Pfeiffer ein enormes Potenzial: „Bei der Pro­ duktion von Kartoffelstärke und Rapsöl fallen allein in Deutschland große Mengen Protein an, und auch die Samen zahlreicher Lupinensorten sind eine bislang ungenutzte Proteinquelle. Unsere Industriepartner ha­ ben bereits Konzepte für Plätzchen und einige andere Produktprototypen entwickelt, die mit Lupinenprotein angereichert sind.“ Der dunkle Milchshake schmeckt nach Schokolade, der hellere nach Vanille. Ob die Getränke 50 Gramm unlösliche Ballaststoffe aus Getreidefasern enthalten oder nicht, können die Teilnehmer der Profimet-Studie weder an deren Eigengeschmack noch eindeutig am „mundgefühl“ unterscheiden. kontaktaDressen 54 Kontaktadressen Bioassayunterstützte Identifizierung von Salzgeschmacksverstärkern zur entwicklung kochsalzarmer Lebensmittel (s. 7) Prof. Dr. Wolfgang Meyerhof Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE) Arthur-Scheunert-Allee 114–116 14558 Nuthetal Optimierte Pflanzenöle und Omega-3-Fettsäuren in der Prävention von hyperlipidämie, insulinresistenz und typ-2- Diabetes (s. 14) Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Joost Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE) Arthur-Scheunert-Allee 114–116 14558 Nuthetal Funktionelle Lebensmittel für die Gefäßgesundheit – vom nutraceuti­ cal zur personalisierten ernährung (s. 11 und 16) Prof. Dr. Gerald Rimbach Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Heinrich-Hecht-Platz 10 24118 Kiel Procyanidine – vom besseren Verständnis der Wirkung zur entwicklung funktioneller Lebensmittel (s. 18) Prof. Dr. Sabine Kulling Max Rubner-Institut Haid-und-Neu-Straße 9 76131 Karlsruhe Präventive gesundheitsfördernde Wirkung neuer Lebensmittel auf Anthocyan- und Procyanidin-Basis: Validierung antiinflammatorischer und neuroprotektiver effekte (s. 22) Prof. Dr. Hans-Ulrich Humpf Institut für Lebensmittelchemie Universität Münster Corrensstraße 45 48149 Münster Einfluss probiotischer Mikroorganismen auf Entzündungen des Magen-Darm-trakts (s. 24) Prof. Dr. Dirk Haller Technische Universität München Z I E L-TUM-Akademie Weihenstephaner Berg 1 85350 Freising analyse der Gallensäurebildung von Ballaststoffen aus Leguminosen zur entwicklung cholesterinsenkender Lebensmittel (s. 27) Dr. Katrin Hasenkopf Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung Giggenhauser Straße 35 85354 Freising Dreifach funktionelle eigenschaften von Lebensmitteln durch präbioti­ sche Ballaststoffe, antioxidantien des Weizen-aleurons und probioti­ sche Butyratbildner (s. 29) PD Dr. michael Glei institut für Ernährungswissenschaften, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät Friedrich-Schiller-Universität Jena Dornburger Straße 24 07743 Jena entwicklung der tuM – akademie für ernährungs- und Lebens­ mittelwissenschaft (s. 33) Prof. Dr. Hannelore Daniel Technische Universität München Z I E L-TUM-Akademie Weihenstephaner Berg 1 85350 Freising auswirkungen von nahrungsmittelkomponenten auf Wirtsfaktor-Mik­ roben-interaktionen und Generierung von Biosensoren zur Überprüfung der sicherheit von nahrungsmittelkomponenten (s. 35) Prof. Dr. Jan Mollenhauer Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark, J. B. Winsløws Vej 5000 Odense C Denmark Glucosinolat- und selenangereicherter Brokkoli als funktionelles Lebensmittel zur Prävention von Prostatakrebs (s. 37) Dr. Clarissa Gerhäuser Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg Coffeeprevention: Identifizierung, Prüfung und Optimierung gesundheitsfördernder eigenschaften des kaffees (s. 41) Dr. Gerhard Bytof Tchibo GmbH Suederstraße 293 20537 Hamburg komplexe kohlenhydrate und menschlicher Metabolismus: unter­ suchungen über die Wirkung von qualitativ und quantitativ unter­ schiedlichem stärkegehalt in kartoffeln und mögliche implikationen für populationsbasierte Präventionsstrategien (s. 45) Prof. Dr. Joachim Spranger Deutsches Institut für Ernährungsforschung Arthur-Scheunert-Allee 114–116 14558 Nuthetal Gewinnung und charakterisierung von oligogalacturonsäuren sowie untersuchungen zur inhibierung der anheftung pathogener keime und cytotoxine an intestinalzellen mittels in-vitro-testsystemen (s. 48) Prof. Dr.-Ing. Stefan Töpfl Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) e.V. Prof.-v.-Klitzing-Straße 7 49610 Quakenbrück Profimet – Wirkung von Proteinen und Ballaststoffen auf Parameter des metabolischen syndroms (s. 52) Dr. Martin O. Weickert University Hospitals Coventry and Warwickshire Clifford Bridge Road Coventry CV2 2DX United Kingdom Impressum Herausgeber Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Biotechnologie 11055 Berlin Bestellungen schriftlich an Publikationsversand der Bundesregierung Postfach 48 10 09 18132 Rostock E-Mail: [email protected] Internet: http://www.bmbf.de oder per Tel.: 030 18 272 272 1 Fax: 030 18 10 272 272 1 Stand unveränderter Nachdruck, Stand 2010 Gestaltung W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld Hauke und Jessica Sturm, Berlin Bildnachweis Titel: Getty Images, 3, 5: Symrise, 4: Tofu und mehr/Albert Hess GmbH, 7, 52: G. Olias, DIfE, 8, 9, 10: Frauke Stähler, DIfE, 11, 13 u.: S. Onur, Universität Kiel, 12, 13 o.: F. Döring, Universität Kiel, 14, 15, 21: DIfE Potsdam-Rehbrücke 16, 45, 50: privat, 17: Lebensmittelfotos.com, 18: S. Kulling, Universität Potsdam, 19: MRI Karlsruhe, 20: P. Winterhalter, TU Braunschweig, 22: Scholz, Universitätsklinikum Regensburg, 23: H. Piberger, Universitäts­ klinikum Regensburg, 24, 25, 26: Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel, TU München, 27, 28: Fraunhofer-IVV, Freising, 29: K. Stein/A. Borowicki, Universität Jena, 30, 31: Kampffmeyer Food Innovations GmbH, 32: A. Borowicki, Universität Jena, 33, 34: ZIEL-TUM-Akademie, 35, 36: J. Mollenhauer, DKFZ, 37: iStockphoto, 38: T. Rausch, HIP Universität Heidelberg, 39, 40: DKFZ, 41, 42: Tchibo GmbH, 43: R. Eggers, Institut für Thermische Verfahrenstechnik TU Hamburg-Harburg, 44: Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik, TU München, 46: Jan Homann, 47: iStockphoto, 48, 49: DIL Quakenbrück, 51: The Lorenz Bahlsen Snack World, 53: M. O. Weickert, DIfE Text und Redaktion Norbert Grust (wbv); Dr. Monika Offenberger (Autorin); Dr. Henrike Boermans, Dr. Daniel Dreesmann und Wiebke Müller (Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH) Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundes­ ministerium für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahl­ helfern während eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung ver­ wendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwah­ len sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Unter­ sagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. BILDUNG