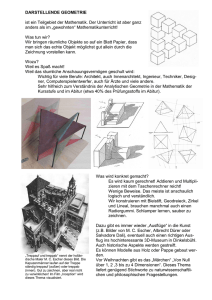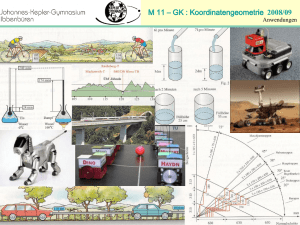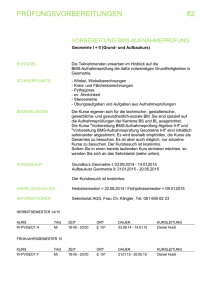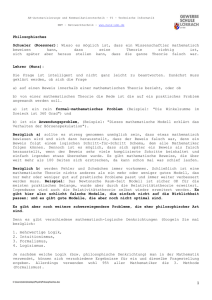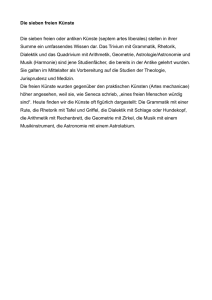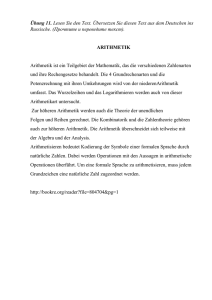Philosophie und Mathematik
Werbung
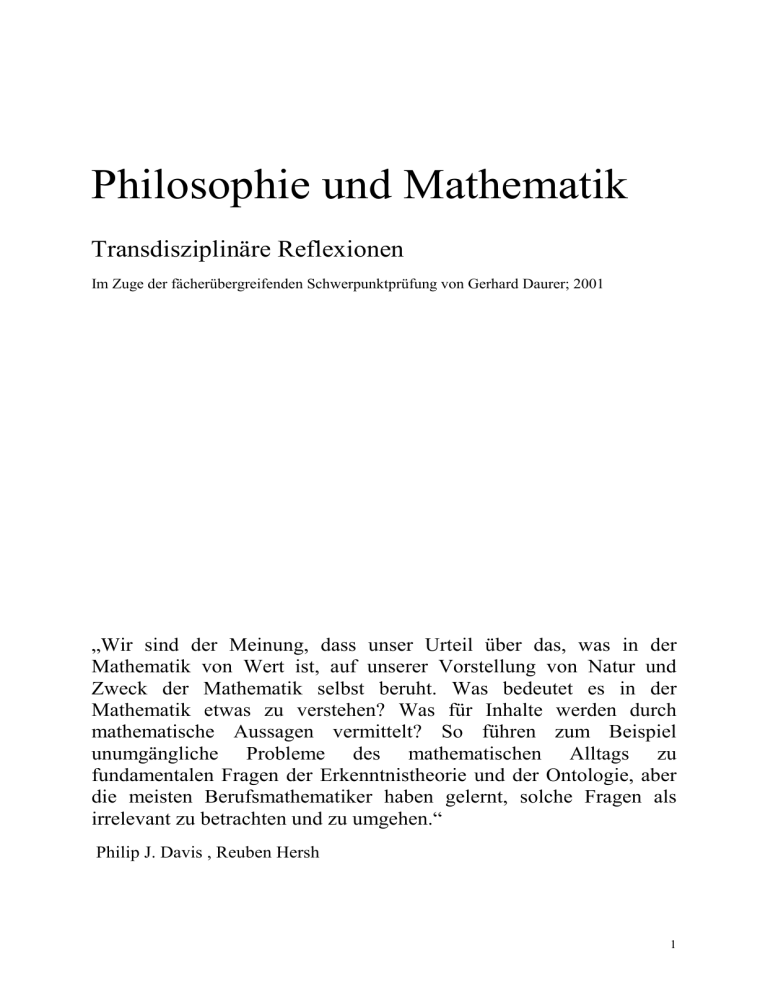
Philosophie und Mathematik Transdisziplinäre Reflexionen Im Zuge der fächerübergreifenden Schwerpunktprüfung von Gerhard Daurer; 2001 „Wir sind der Meinung, dass unser Urteil über das, was in der Mathematik von Wert ist, auf unserer Vorstellung von Natur und Zweck der Mathematik selbst beruht. Was bedeutet es in der Mathematik etwas zu verstehen? Was für Inhalte werden durch mathematische Aussagen vermittelt? So führen zum Beispiel unumgängliche Probleme des mathematischen Alltags zu fundamentalen Fragen der Erkenntnistheorie und der Ontologie, aber die meisten Berufsmathematiker haben gelernt, solche Fragen als irrelevant zu betrachten und zu umgehen.“ Philip J. Davis , Reuben Hersh 1 Was ist Mathematik? Die einfachste (aber auch naive) Definition ist: „Die Mathematik ist die Wissenschaft von Quantität und Raum“, also die Mathematik handle in ihrem geometrischen Teil von den geometrischen Figuren und im übrigen von den Eigenschaften der Zahlen. Diese „klassische“ Definition steht neben einer Unzahl von anderen, von denen uns noch einige in späteren Abschnitten begegnen. Unsere Verlegenheit vor dieser Frage steckt schlichtweg in der Vielzahl unterschiedlichster Definitionsversuche. Der Wechsel der Definitionen ist kein Ergebnis irgendwelcher Willkür, sondern hat seinen realen Grund im Wandel dessen, was von den Mathematikern jeweils betrieben wurde. Wir finden Mathematik historisch nicht nur mit verschiedenen Inhalten von verschiedener Tiefe vor, sondern auch mit sehr unterschiedlicher Gestalt/Struktur, betrieben in sehr unterschiedlichem Stil. Nur so viel: die Frage was Mathematik sei lässt sich in die Themen „Gegenstand der Mathematik“ und „Tätigkeit des Mathematikers“ aufteilen. Während manche die Tätigkeit überbewerten (formalistisch), legen andere das Hauptgewicht auf die Gegenstände (platonistisch). Wir werden beide Standpunkte im folgenden immer wieder in einer geradezu ideologischen Entgegensetzung vorfinden. Einige neuere Richtungen leugnen dagegen das es einen Gegenstand der Mathematik überhaupt gibt (Empirismus, Logizismus); auch dazu später mehr. Eine modernere Antwort, die verschiedene Standpunkte vereinigt, ist die Auffassung der Mathematik als Wissenschaft der kalkülbezogenen Handlungen, wobei zur Tätigkeit des Mathematikers gehört Kalkülregeln gemäß zu verfahren (und Kalkülregeln sind die Regeln zum Anschreiben von Ziffern genauso wie die des Differentialkalküls), als auch auf Kalkülregeln, ihre Ergebnisse, Voraussetzungen und Beziehungen untereinander zu reflektieren. Kalkül bedeutet: Methode zur systematischen Lösung bestimmter Probleme. Die mathematische Denkwiese Die mathematische Denk- und somit Vorgehensweise könnte man vielleicht so umschreiben: Man formuliert ein Problem, man versucht im Problem dargelegte Daten mit Bekanntem(oder als bekannt Vorausgesetztem) zu verknüpfen und diese bekannten Fakten in Aussagen für solche Schritte verwertbar zu machen, die einer Lösung des Problems näherkommen. Man denke nur an den Beweis durch vollständige Induktion – „die mathematische Schlussweise in ihrer reinsten Form“, “ein Werkzeug, welches uns erlaubt, vom Endlichen zum Unendlichen fortzuschreiten“ (Poincaré 1904,10/12) - ,mit der wiederholten Anwendung des Schlusses von der Gültigkeit der Wenn-dann-Aussage A → B, somit der Gültigkeit der darin auftretenden Aussage A auf die Gültigkeit von B. Das Vorgehen nach Regeln steht keineswegs in Konflikt mit Einfallsreichtum, sondern eröffnet diesem bei der „Erfindung“ effektiver Anwendungen gegebener Regeln gerade ein neues Betätigungsfeld. Weiters gehört es zum Sinn solcher Ergebnisse, für weitere mathematische Schlüsse verwendet zu werden. „Mathematik ist die Wissenschaft notwendige Schlüsse zu ziehen.“ (C.S.Peirce) ,und somit ein deduktives System: ein deduktiver Prozess (oder Beweis) – der Erste wird übrigens Thales von Milet zugeschrieben - ist nichts anderes als, bei den Axiomen beginnend, Schritt für Schritt einen logischen Gedankengang zu entfalten (in strenger und formaler Sprache) wodurch man zu einem unbestreitbaren Satz (Theorem) gelangt. Die Methode der Axiomatisierung wird uns noch eingehend beschäftigen. „Euklid allein hat Schönheit rein geschaut“ (Edna Millay): Es ist klar das diese Form der „reinen Erkenntnis“ immer große Bewunderung und sogar erkenntnistheoretische Bedeutung erlangt hat, auch im Vergleich zum minder anspruchsvollen naturwissenschaftlichen Beweis der nie absolute Geltung beanspruchen kann. Die mathematische Denkweise ist auch vom Wechselspiel von Konstruktion und Abstraktion geprägt; der Konstruktion immer neuer mathematischer Objekte auf einer Stufe der 2 Betrachtung und dem Übergang zu einer neuen Stufe durch eine Abstraktion, deren Ergebnis neue mathematische „Objekte“ sind. Axiomatisierung Der axiomatische “Aufbau“ ist eine Entdeckung der griechischen Antike. Das für fast zwei Jahrtausende hindurch gültige Paradigma dazu, die Elemente des Euklid (ca.300 v.Chr.), sind bereits der Höhepunkt einer langen Kette von Versuchen zur heute nach dem Autor so benannten „Euklidischen Geometrie“. Das auf Beweis beruhende Wissen (apodiktisch) muss nach Aristoteles „aus solchem entspringen, das wahr, ein erstes und Unvermitteltes , bekannter und früher als alles zu Beweisende und Grund für das Bewiesene ist“; dem entsprechen die Axiome (Prinzipien). Ein deduktives System von Sätzen organisiert diese durch mögliche Übergänge in Gestalt eines Schlusses von Sätzen, die dabei als Prämissen fungieren, auf einen anderen Satz, der Konklusion (vgl. Beweis).Seine Grundbausteine sind die Axiome, die nicht in Frage gestellten Grundlagen. Diese Organisation ist ein kaum überschätzbarer Fortschritt, da sie eine potentiell unendliche Menge von Sätzen als Folgerungsmenge endlich vieler Sätze (Axiomen) erfasst. Das axiomatische Vorgehen liefert sozusagen das Gerüst des Aufbaues, es sagt nichts über die vollständige logische Analyse der hergeleiteten Sätze. In diesem Sinne werden Euklids Elemente allgemein als Versuch verstanden das zeitgenössische mathematische Wissen in einem einzigen Werk mit einem einheitlichen „Methodenarsenal“ zu fassen. Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung bildeten sich Teildisziplinen, gleichberichtigt zu Euklids Fundamentaldisziplin Geometrie, die ebenso Axiomatisierungsversuche unternahmen. Auf diese Versuche wird weiter unten eingegangen, ebenso auf die Grenzen der axiomatischen Methode. Das Anwendungsproblem Der Grund der Anwendbarkeit der Mathematik auf reale Verhältnisse stelle ein äußerst tief liegendes Problem dar, dessen Schwierigkeiten auf allgemein erkenntnistheoretischem Boden liegen. Felix Klein (1849-1925) Die Mathematik wirkt „attraktiv“, weil sie als Modellfall scheint. Am Beispiel der Mathematik hofften die Philosophen tieferen Einblick in die Struktur, die Mittel und Voraussetzungen von Erkenntnis überhaupt zu gewinnen (sofern man ihr erfahrungsunabhängige, „apriorische“ Geltung zuschrieb). Der Grund ist die hohe „Evidenz“ mathematischer Aussagen, ebenso die Zuverlässigkeit ihrer empirischen Anwendungen. Worin bestehen nun diese empirischen Anwendungen? In der Antike (und schon in vorgriechischen Zeiten) wird man wohl an Längenberechnungen denken, wie z.B. Pythagoras als er die Höhe einer Pyramide aus der Länge ihres Schattens berechnete, oder an die Berechnungen des Eratosthenes. In der Neuzeit denkt man vor allem an die Ingenieurskunst und die Naturwissenschaften, die die Mathematik oft heranziehen, besonders in der Mechanik, der „mathematischen Physik“. Heute verfolgen wir eine „Mathematisierung unserer Welt“ - man denke nur an die Entwicklung elektronischer Großrechenmaschinen, die ja auf formale Sprachen basieren - die ohne den analytischen und theoretischen Beitrag der Mathematik zu den anderen Wissenschaften nicht möglich wäre. Jedoch sind diese unbestrittenen Erfolge zunächst nur Indiz der Zuverlässigkeit mathematischer Sätze, liefern jedoch keine Erklärung dafür und erlauben auch keinen Rückschluss auf das Zustandekommen und die Beschaffenheit mathematischer Erkenntnis oder apriorischer Erkenntnis überhaupt. Es gilt zwischen „Anwendungen der Mathematik in der Mathematik“ und Anwendungen der Mathematik in den Naturwissenschaften, wie Physik oder Biologie, zu unterscheiden: Diese bezeichnet man als reine, jene als angewandte Mathematik. Reine Mathematik stellt den 3 Anspruch die edelste und reinste Form des Denkens darzustellen, da sie aus der reinen Vernunft hervorgeht, kaum der Außenwelt bedarf und ihr deshalb auch nichts schuldig ist. Dieser Zweig, der darauf verweist das Anwendungen etwas Hässliches an sich haben („der Geist steht über dem Fleisch“) wird auch Hardyismus bezeichnet: „Ich habe nie etwas gemacht, das <nützlich> gewesen wäre. Für das Wohlbefinden der Welt hatte keine meiner Entdeckungen je die geringste Bedeutung, und daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. (..) Nach allen praktischen Maßstäben ist der Wert meines mathematischen Lebens gleich Null, und außerhalb der Mathematik ist es ohnehin trivial.(...) Was man für mich und jeden Mathematiker wie mich vorbringen kann, ist das folgende: ich habe etwas zur Erkenntnis beigetragen, und dieses Etwas hat einen Wert, der sich nur in seinem Umfang, nicht aber in der Art von dem unterscheidet, was die großen Mathematiker oder andere, bedeutende und unbedeutende Künstler geschaffen haben, die etwas, das an sie erinnert hinterließen.“ Godfrey Harold Hardy (1877-1947) Der Nutzen muss somit hinter der Eleganz und der Tiefe zurückstehen. In der angewandten Mathematik steht der Nutzen im Vordergrund. Es ist in vielerlei Hinsicht schwieriger auf diese Art zu arbeiten, da die Fakten zahlreicher und weniger scharf umrissen , die Präzision und ästhetische Ausgewogenheit der reinen Mathematik unerreichbar sind. Die Mathematik gilt hier eher als Metatheorie (z.B. Optimierungs- und Wahrscheinlichkeitstheorie), als stark strukturierte Sprache, die in die vorliegende Datenvielfalt Ordnung bringen soll – ohne jede Rücksicht auf einheitliche mathematische Begriffbildung, axiomatische Erfassung oder gar Fragen der formalen Widerspruchsfreiheit. Auf diese Weise haben heute nahezu alle Teildisziplinen „Anwendungen“ gefunden wodurch sich die in der Wissenschaftssystematik tradierte und institutionalisierte Trennung zwischen reiner und angewandter Mathematik als überholt darstellt. Diese Feststellung hat logischerweise auch große Auswirkung auf die Philosophie der Mathematik, verändert sich doch das bild der Mathematik, da es seine Umrisse „verschwimmen“ lässt. Doch zurück zur oben gestellten Frage oder anders (Albert Einstein): Wie ist es möglich, dass die Mathematik, die doch ein von aller Erfahrung unabhängiges Produkt des menschlichen Denkens ist, auf die Gegenstände so vortrefflich passt? Kann denn die menschliche Vernunft ohne Erfahrung durch bloßes Denken Eigenschaften der wirklichen Dinge ergründen? Einstein selbst gab die vielzitierte Antwort: Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit Die verschiedenen philosophischen Richtungen geben hier verschiedene Antworten. Für die Vertreter „empiristischer“ oder „materialistischer“ Standpunkte gibt es keinerlei Grund zur Verwunderung: Wir haben die Mathematik ja aus der Wirklichkeit, folglich „gehorcht“ sie dieser auch (wie die Physik).“So weit Mathematik empirisch fundiert ist, ist sie auch empirisch anwendbar.“, oder „Mathematik ist anwendbar auf Wirklichkeit, weil sie sich von vornherein nach der Wirklichkeit richtet“. Erst bei intermathematischen Prozessen kommen Schritte anderer Art hinzu (Definitionen, Deduktionen,...).Für diese müsste aber erst gezeigt werden, dass sie empirisch anwendbar sind. Dem empirischen Ansatz von z.B. John Stuart Mill (vgl. unten) würde dieser Nachweis grobe Probleme bereiten. Zudem tritt das Problem für Standpunkte auf, die Mathematik als apriorische Wissenschaft betrachten. Ihre Formulierung müsste analog zur obigen lauten: „Mathematik ist anwendbar auf Wirklichkeit, weil sich die Wirklichkeit von vornherein nach der Mathematik richtet.“ Besser ließe sich dieser platonische Standpunkte wie folgt formulieren: 4 Mathematik ist anwendbar auf Wirklichkeit, weil sich Mathematik und Wirklichkeit beide nach den gleichen „Gesetzen“ richten. Nun stellt sich aber die Frage was diese „Gesetze“ sind, worauf Kant und in jüngerer Zeit die Neukantianer Antworten gaben (kritizistischer Ansatz): Mathematische Erkenntnis sei zweifellos synthetisch (da unsere Intuitionen von Raum und Zeit inhärente Eigenschaften des menschlichen Geistes sind). Diese Geltung mathematischer Sätze wird von der „transzendentalen Ästhetik“, der Wissenschaft von der Möglichkeit von Sinneserkenntnis überhaupt, beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die sogenannte „reine Anschauung“, die das an den empirischen Anschauungen umfassen soll, was nicht Empfindung ist, sondern die Form der Verknüpfungen unserer Empfindungen zu Wahrnehmung, somit die Ordnungsform des überhaupt "Gegebenen". Diese Formen, in die eingepasst jede uns mögliche empirische Anschauung überhaupt erst vorkommen kann, sind Räumlichkeit und Zeitlichkeit, wir können sie als „reine Anschauung“ vor dem Eintreffen von Empfindungen untersuchen. Unsere Erkenntnis der Zeit wird in der Arithmetik systematisiert, welche auf der Intuition des Aufeinanderfolgens basiert. Unsere Erkenntnis des Raumes wird in der Geometrie systematisiert. Räumlichkeit und Zeitlichkeit wird weiters durch eine „Notwendigkeit des Verbundenseins“ mit den Erscheinungen charakterisiert: „Wir können uns zwar graue und nicht-graue Elefanten vorstellen, nicht aber räumliche und nicht-räumliche.“ (Körner 1955,22). Somit haben Räumlichkeit und Zeitlichkeit objektive Gültigkeit, die Wirklichkeit unterliegt also den gleichen Ordnungsprinzipien wie die Mathematik (die sich unter Absehen von aller Empirie nur mit der reinen Anschauung befasst). Die meisten anderen Philosophen und Mathematiker entscheiden sich jedoch für einen analytischen Charakter der Mathematik, da z.B. die Feststellung „die Gerade ist die kürzeste Verbindung zweier Punkte“ eher analytisch anmutet (es wird nur behauptet, was im Subjektsbegriff bereits steckt). In der „neueren“ Literatur findet man noch die Auffassung des „Neo-Positivismus“ oder „logischen Empirismus“, vertreten durch die Mitglieder des sog Wiener Kreises: Sie lehnen das Problem in der gestellten Form überhaupt ab, da sie Mathematik als ein System von Zeichen mit ausschließlich syntaktischen(d.h. zwischen den Zeichen selbst bestehenden) Beziehungen auffassen und somit behaupten: der Anwendungsbereich der Mathematik sei nur das Zeichensystem der Sprache. Warum sich manche Zeichensysteme wunderbar auf Gegenstände und Beziehungen der Wirklichkeit anwenden lassen (und andere nicht) wird nicht geklärt, die Frage ist also nur an eine andere Stelle verschoben. Nach Bertrand Russel (1872-1970) ist Mathematik genauso weit auf die Erfahrungswelt anwendbar, als diese mit den Beziehungen zwischen den Formeln isomorph (strukturgleich) ist. Man setzt also einfach “empirische“ Konstanten anstelle von Variablen und versichert sich ob diese gedeuteten Formeln erfüllt sind. Wieder bleibt die Frage wie diese Strukturgleichheit überhaupt möglich ist. Viktor Kraft (1880-1975), ein Vertreter des Wiener Kreises, wollte den Stanpunkt des logischen Empirismus verbessern: Damit es möglich wird, eine Sprache zur Darstellung der Welt anzuwenden, müssen Ähnlichkeiten in der Welt bestehen. Wenn jedes Objekt oder Ereignis gerade nur einmal auftritt, hätte es nicht einmal einen Sinn, ihnen Namen zu geben, weil diese nicht wieder verwendbar wären. In dem darzustellenden Material muss also Allgemeines, mindestens Klassen, herzustellen sein. Das ist die Bedingung auch schon für die Anwendbarkeit einer Sprache. Es muss also Ordnung und Gesetzmäßigkeit in der Wirklichkeit geben. Dennoch scheint das Anwendungsproblem in der gegenwärtigen Philosophie von einer Lösung weit entfernt. 5 Das alter Griechenland Die Wurzeln der Philosophie der Mathematik, wie der Mathematik selbst liegen im alten Griechenland. Für die Griechen bedeutete Mathematik Geometrie, die Philosophie der Mathematik somit Philosophie der Geometrie. Für Plato war der Anspruch der Philosophie ein Wissen um ewige und notwendige Wahrheiten zu etablieren. Für Plato war das Konzept der Geometrie ein Schlüsselelement seiner Vorstellung der Welt, er spricht von Geometern und Rechenkünstlern im Sinne von Jägern, „weil sie ihre Figuren und sonstigen Zeichen nicht nach Belieben hervorbringen, sondern nur erforschen, was schon da ist. Sie erfinden nicht, sie entdecken! (Platon, Euthydemos) Nicht nur mit Bezug auf diese Stelle heißt die Lehre, dass die mathematischen Gegenstände eine „ideale“, vom Menschen, menschlicher Erkenntnis und insbesondere menschlichem Handeln unabhängige Existenz „an sich“ haben, heute meist Platonismus. Heute bedeutet dieses Grund-Dogma die Annahme, mathematische Objekte wären real (einige bekannt, viele unbekannt), wären unveränderlich, existierten außerhalb des Raumes und der Zeit physischer Existenz. Das Platon selbst auch nur den meisten heute unter diesem Namen gefassten Einzelstandpunkte zugestimmt hätte, ist eher zweifelhaft (vieles was heute als „platonisch“ gilt geht auf Neuplatoniker wie Proclus (410-485) zurück). Außerdem hätte Platon der Idee einer vorgegebenen Unendlichkeit, die heute im platonischen Ideenhimmel vertreten ist, nie zugestimmt. Rationalismus Für die Rationalisten spielte die Geometrie eine ähnliche rolle wie für Plato, da sie die Vernunft als Hilfsmittel ansahen a priori sicheres Wissen zu erlangen. „Die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt 180º“ (dieser Satz war Spinozas Lieblingsbeispiel einer zweifellos wahren Aussage). Mathematik, die Erkenntnis des Guten bei Plato, wurde bei den Rationalisten zur Erkenntnis Gottes. “Die Himmel verkünden die Ehre Gottes, und das Firmament zeigt seiner Hände Werk.“ Bei Descartes ist die Deduktion (neben der Intuition) die einzige Tätigkeit unseres Intellekts, sie ist: „alles, was sich aus bestimmten anderen, sicher erkannten Dingen mit Notwendigkeit ableiten lässt“. Durch sein cogito ist die fundamentale Wahrheit des mathematisch-geometrischen Aufbaus des kartesischen Gedankensystems garantiert. Er schreibt (Disc.2,11): Die langen Ketten von einfachen und leicht einzusehenden Vernunftgründen, deren sich die Geometer bedienen, um zu ihren schwierigen Beweisen zu gelangen, hatten mich darauf geführt, mir vorzustellen, dass alle Dinge, die unter die Erkenntnis der Menschen fallen können, untereinander in der selben Beziehung stehen. Dieses Vorhaben, die mathematische Methode auf die Welt als Ganzes anzuwenden, ist für Descartes die so bezeichnete geometrisch-analytische Erkenntnismethode. Die große Errungenschaft dieser Methode (des Rationalismus überhaupt) war, die Erfindung der analytischen Geometrie. Die Existenz mathematischer Objekte bedeutete für Leibniz oder Newton auch keine Probleme, da sie die Existenz eines göttlichen Geistes als selbstverständlich ansahen. Schwierigkeiten bot eher die Rechtfertigung nichtidealer materieller Gegenstände. Empirismus Als der Empirismus auftauchte konnte er sich ob der naturwissenschaftlichen Erfolge auf der Grundlage experimenteller Methoden durchsetzen. Der Glaube an das materielle Universum als fundamentale Realität wurde zur üblichen Betrachtungsweise. Die Empiristen meinten alles Wissen entspringe der Beobachtung; nur durch die Mathematik gerieten sie in 6 Verlegenheit. John Stuart Mill stellte jedoch eine empirische Theorie mathematischen Wissens auf, nach der Mathematik eine Naturwissenschaft wie alle anderen sei: Mathematische Gegenstände sind für Mill der konkreten Erfahrung entnommene Abstrakta, also allgemeinste Eigenschaften oder Beschaffenheiten der Wirklichkeit. Dadurch kommt man zu Definitionen und auch zu Aussagen, die man aufgrund ihrer Herkunft als „experimentelle Wahrheiten“ genannt hat. Jedes Zahlzeichen „2“ , „3“ usw. bezeichnet ein physisches Phänomen, und bezeichnet „nebenher“ eine Eigenschaft die der Gesamtheit von Dingen zukommt, die wir mit dem Zahlzeichen benennen. Diese Eigenschaft ist die charakteristische Weise, in der die Gesamtheit aufgebaut ist und zerlegt werden kann. Veranschaulichung – Zerlegungsmöglichkeiten und Zusammensetzungsmöglichkeiten dreier Körperdinge (3=2+1): ○○ ○ ○ = ○ + ○ = ○ = + ○○ = ○ ○ ○ ... Gottlob Frege (1848-1925) hat diese Auffassung mit drastischen Gegenbeispielen und Argumenten kritisiert, vor allem im Falle der Zahlen 0 und 1, aber auch für sehr große Zahlen, denn „wer sollte je die Tatsache beobachtet haben, die in der Definition der Zahl 777 865 ausgesagt wird?“. Nichtsdestotrotz hat man immer wieder auf empiristische Vorstellungen zurückgegriffen, wo es um die Frage der empirischen Wirklichkeit ging (vgl. das Anwendungsproblem). Der Euklid-Mythos In den philosophischen Kontroversen blieb die Geometrie unangetastet. Es hält sich immer noch (sogar noch bis ins 19. Jhdt. – durch z.B.: Carl Friedrich Gauss ) die Definition der Mathematik die Plato und Aristoteles geprägt haben (vgl. das alte Griechenland). Alle Standpunkte gingen davon aus, dass das geometrische Wissen – speziell die Errungenschaften Euklids – kein Problem darstellt, selbst wenn alles andere Wissen problematisch sein sollte. Diese Tatsache kann getrost als Euklid-Mythos bezeichnet werden. Er las den Satz . Bei G_ , sagte er (er neigte hie und da zu emphatischen Flüchen, um der Sache etwas Würze zu geben) das ist unmöglich! So las er den Beweis, der ihn auf einen anderen Satz verwies; er las auch diesen Satz. Dieser verwies ihn auf einen anderen, den er ebenfalls las. Et sic deinceps, bis er schließlich eindeutig von jener Wahrheit überzeugt war. Dadurch verliebte er sich in die Geometrie.“ Hier wird vom Empiristen Thomas Hobbes (1588-1679) berichtet. Für die Rationalisten war die Geometrie das beste Beispiel, um ihre Weltanschauung zu bestätigen ( Spinoza versuchte sogar eine „Geometrie der Gefühle“ darzulegen; mit zweifelhaftem Erfolg). Für die meisten Empiristen war sie eher ein peinliches Gegenbeispiel, das es zu ignorieren oder wegzuerklären galt. Selbst am Kulminationspunkt der klassischen Philosophie, bei Kant (vgl. das Anwendungsproblem, Kant), gibt es nur die eine, die euklidische Geometrie, der EuklidMythos bleibt also zentrales Element. Das Kantsche Dogma des Apriori übte bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein einen bestimmenden Einfluss auf die Philosophie der Mathematik aus. Alle drei Grundlagenschulen (Platonismus, Konstruktivismus, Formalismus) waren bemüht, die besondere Rolle, die Kant ihm zuwies, für die Mathematik zu retten. Geometrie gilt also nach wie vor als der sicherste Wissenszweig, andere bereits entwickelte Bereiche (z.B. Differential- und Integralrechnung) bezogen ihre Legitimation aus der Verknüpfung zur Geometrie. 7 19. Jahrhundert In diesem Jahrhundert kam es zu mehreren „Katastrophen“. Eine war die Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien. Weiters die rasante Entwicklung der Analysis, die die geometrische Intuition überrundete, wie die Entdeckung von raumfüllenden Kurven, oder von stetigen nicht differenzierbaren Kurven. Diese harten Schläge für die geometrische Intuition, der einzigen soliden Grundlage der Mathematik, dieser Verlust von Gewissheit in der Geometrie war philosophisch nicht tragbar, denn damit war der Verlust jeder Gewissheit menschlicher Erkenntnis überhaupt verknüpft. Die Mathematiker, angeführt von Richard Dedekind (1831-1916) und Karl Weierstraß (1815-1897), stellten sich der Herausforderung, machten sich zur Aufgabe, die Mathematik auf ein neues Fundament zu stellen: die Arithmetik. Gleichberechtigt geworden, aber doch eher als praktische Kunst denn als Wissenschaft angesehen, war sie seit der frühen Neuzeit als nicht axiomatische, sondern „kalkulatorische“ (rechnende) Disziplin. Dedekind machte als erster den Versuch sie zu axiomatisieren. Das Peano-Dedekindsche Axiomensystem der Arithmetik Dedekind äußerte sich 1880 über seine Motive und Grundideen. Zum ersten wollte er Grundeigenschaften der als anschaulich gegeben angesehenen natürlichen Zahlenreihe aufsuchen, also solche die sich nicht aus den übrigen ableiten lassen, aus denen aber alle anderen Eigenschaften der Grundzahlenreihe folgen. Zweitens wollte er deren Zusammenhänge noch deutlicher hervorheben lassen, also den strukturellen Aspekt sichtbar machen. Peano verfeinerte Dedekinds Arbeit (1) (2) (3) (4) (5) 1 ist eine natürliche Zahl ; 1 ε Ν zu jeder Zahl a ε Ν gibt es genau einen Nachfolger a′ ε Ν für alle a ε Ν gilt a′ ≠ 1 es seien a , b ε Ν. Aus a′ = b′ folgt a = b es sei M ⊂ Ν , 1 ε M. Aus m ε M folge m′ ε M. Dann gilt M = Ν Alle fünf Axiome sind notwendig und vollständig. Man sagt auch, die natürlichen Zahlen mit den genannten Eigenschaften und Relationen bilden ein Modell des Axiomensystems. Nun nachdem die natürlichen Zahlen „axiomatisiert“ waren, musste man daran gehen eine Konstruktion des Kontinuums zu geben, d.h. des Systems der reellen Zahlen, um zu zeigen, wie es von den natürlichen Zahlen ausgehend aufgebaut werden konnte. Zu diesem Zweck schlugen Dedekind, Weierstraß und Georg Cantor drei verschiedene Methoden vor. Alle drei verwendeten eine unendliche Menge rationaler Zahlen, um eine reelle zahl zu definieren oder zu konstruieren. So führte das Bemühen, die Analysis und Geometrie zurückzuführen, dazu, unendliche Mengen in die Grundlagen der Mathematik einzuführen. Die Mengenlehre war von Cantor als ein selbstständiger Zweig der Mathematik entwickelt worden. Es schien, dass die Idee einer Menge so einfach und fundamental war, dass sie zum Aufbau der ganzen Mathematik dienen konnte. Selbst die Arithmetik konnte über die Mengenlehre erfasst werden, denn Frege zeigte, wie die natürlichen Zahlen aus der leeren menge konstruierbar sind, indem Operationen der Mengenlehre verwendet werden. Anfänglich erschien die Mengenlehre fast ident mit der Logik. Die mengentheoretischen Relationen der Inklusion, A ist eine Teilmenge von B, ist anders geschrieben ja immer die logische Relation der Implikation: „Wenn A, dann B“. So schien es also möglich, die Logik der Mengenlehre als Grundlage der gesamten Mathematik zu etablieren. Hier bezieht sich „Logik“ auf die fundamentalen Gesetze der Vernunft den Grundlagen unseres Universums. Z.B. das Gesetz des Widerspruchs oder die Regeln der Implikation. Könnte man zeigen, dass die ganze 8 Mathematik nur eine Weiterführung der Gesetze der Logik ist, wäre damit gewissermaßen der Platonismus bestätigt, da dies der übrigen Mathematik die Gewissheit der Logik verleihen müsste. Dies versuchten Alfred North Whitehead (1861-1947) und Bertrand Russell (18721970), in ihrem logiszistischen Programm, dargelegt in der berühmten Principia Mathematica („das beste Beispiel für ein unlesbares Meisterwerk“). Es war jedoch Russel selbst, der entdeckte, dass der scheinbar so transparente Begriff der Menge Fallgruben bereithielt. Trugschlüsse, Paradoxien, Antinomien Die heute wohl berühmteste Antinomie, ist die eben angesprochene Russellsche: Die Menge aller Mengen ist offenbar ein Ding, dass sich selbst als Element enthält, wir bezeichnen solche Mengen als „R-Mengen“. Weiters wollen wir all jene Mengen die sich nicht selbst als Element enthalten als „M-Mengen“ bezeichnen. Ist M eine R-Menge? Nein. Ist M keine R-Menge? Wiederum nein. Die Definition von M widerspricht sich also selber. Wie kann man auf so eine Situation reagieren? (1) Man könnte bestreiten, dass diese Antinomien die „wirkliche“ Mathematik (wie die Analysis) überhaupt tangieren, da die verwendeten Begriffsbildungen (oder Schlüsse) nur in der Mengenlehre vorkämen. Es wäre somit die Aufgabe der Mengentheoretiker die Axiome ihrer Disziplin so abzuändern, dass sie als Grundlage der gesamten Mathematik wieder ernsthaft in Betracht gezogen werden könne. (2) Man könnte die in der Schlussform verwendeten Begriffsbildungen als inkorrekt ablehnen. Allein die Schlussweisen der Mengenlehre müssten präziser formuliert werden. (3) Man könnte die Antinomien als Paradoxien und somit als nicht ernstzunehmende „Sätze“ abstempeln. Was ist nun genau unter Paradoxien und Antinomien zu verstehen? Mit modernen Antinomien verwandte Konstrukte findet man bereits in der Antike, aber eher als Scherzfragen. Ernstgenommen finden wir sie eigentlich erst im Mittelalter wo man z.B. bei der Erörterung von Unendlichkeitsvorstellungen auf sie zurückgriff. Wie konnten Antinomien trotz des Zögerns sie vorbehaltlos ernst zu nehmen, am Beginn des 20. Jahrhunderts eine so starke Wirkung entfalten, ja sogar eine Grundlagenkrise der Mathematik auslösen? Zu Beginn schien es als ob die Antinomien einen gemeinsamen Fehler aufwiesen: Bildet man die Menge aller Mengen, so ist dies die Umfassendste. Doch wie zu jeder Menge kann man mittels Cantors Diagonalverfahren deren Potenzmenge bilden, die dann größer wäre – ein offensichtlicher Widerspruch. Es scheint, dass die Bildung je aller Mengen einfach zu weit geht und durch eine Größenbegrenzung für zulässige Mengen, und geeigneten Mitteln ausgeschlossen werden müsse. Dies würde aber z.B. die Russellsche Antinomie gar nicht berühren, es sei denn man verbiete ausnahmslos jede Zusammenfassung aller Mengen einer Art, was für den Aufbau schon der Analysis einen sehr weit gehenden Eingriff bedeuten würde. Vielleicht könnte eine terminologische Klärung von Nutzen sein: Fehlschlüsse interessieren nur dann, wenn sie als „Trugschlüsse“ absichtsvoll herbeigeführt sind, als „Sophismen“ in eine vermeintlich legitime Schrittweise eingeschmuggelt, wie: (a=3/2b)⇒(4a=6b) ⇒(14a-10a=21b-15b) ⇒(15b-10a=21b-14a) ⇒(5(3b-2a)=7(3b-2a)) ⇒(5=7) Sind derartige Trugschlüsse i. a. leicht durchschaubar, so sind Paradoxien im traditionellen Sinn der Erwartung zuwiderlaufende Darstellungen, wie die zenonischen Paradoxien (vgl. unten, unendliche Bereiche), oder die Tatsache, dass ein eng um den ganzen Äquator gelegtes Band nach Verlängerung um nur einen Meter plötzlich um 1/2π m (also 16 cm) abstehen würde. Es scheint wichtig, von dieser Vielfalt von originellen Pointen und scheinbaren 9 Widersprüchen Antinomien auch terminologisch abzuheben als formal widersprüchliche Folgerungen, die dem ungeschulten Denken einwandfrei erscheinen, obwohl der finale Widerspruch zeigt, dass sie es nicht sein können. Poincaré glaubte das entscheidende Kriterium für die Ungeeignetheit einer Aussageform als definierende Bedingung für eine Menge gefunden zu haben: die illegitimen (imprädikativen) Bedingungen sind von der Art ¬(x ε x) oder (x ε x), sie verlangen einen circulus vitiosus. Auch bei der bekannten Lügner-Antinomie stellt die Aussage „Alle Kreter lügen immer“, von einem Kreter getätigt, eine Allaussage dar, die sich somit auch selbst enthält, also imprädikativ definiert und somit unzulässig ist (eine genauere Darstellung würde hier zu weit gehen). Von nun an ist bei einem formalen Aufbau der Mathematik auf viele Vorsichtsmaßnahmen zu achten, deren Umsetzung mancherlei Probleme mit sich bringt (z.B. musste die einfache zur verzweigten Typentheorie ausgebaut werden). Diese „Einschränkungen“ wurden zu einem gewaltigen Hindernis für das „Arithmetisierungsprogramm“ und erst recht für eine „logiszistische“ Grundlegung der Mathematik die daraufhin scheitern musste. Die Grundlagenkrise Die Antinomien schlugen wie ein Gewitter in die eben erst beruhigte mathematische Atmosphäre der Jahrhundertwende hinein und ihre Wirkung war vielfach geradezu niederschmetternd A. Fraenkel (1928, 210) Die dargestellten Antinomien zeigten, dass die intuitive Logik in Tat und Wahrheit keineswegs sicherer war als die klassische Mathematik, im Gegenteil, sie konnte Widersprüche erzeugen, wie sie in der Geometrie oder Arithmetik nie vorkommen. Dies war die Grundlagenkrise, die zentrale Frage in den berühmten Kontroversen die das erste Viertel des 20. Jahrhunderts erschütterten. Es gab deren drei Lösungsansätze: der Logizismus; der Formalismus; der Konstruktivismus Das Programm des Logizismus und sein Scheitern wurden im letzten Abschnitt bereits skizziert. Das Frege-Russel-Whitehead-Projekt, eine Neuformulierung der Mengenlehre, wobei Antinomien ausgeschlossen blieben, war zu einer so komplizierten Struktur geworden, dass es schwerlich mit Logik im philosophischen Sinne („als Richtlinie zum korrekten Schließen“) zu identifizieren war. Damit wurde auch die Vorstellung von Mathematik als gewaltige Tautologie zur Logik unhaltbar. Russel schrieb (portraits from memory): Ich wollte Gewissheit in der Weise in der Menschen Religion wollen. Ich glaubte, dass Gewissheit in der Mathematik eher zu finden ist als anderswo. Doch ich entdeckte, dass viele mathematische Beweisführungen, welche meine Lehrer mir beibringen wollten, voller Trugschlüsse waren und dass, falls Gewissheit in der Mathematik überhaupt zu entdecken war, dies in einem neuen mathematischen Gebiet, mit solideren Grundlagen sein müsste als diejenigen, die man bisher für sicher gehalten hatte. Doch als die Arbeit fortschritt, wurde ich immer wieder an die Fabel vom Elefanten und der Schildkröte erinnert. Nachdem ich einen Elefanten konstruiert hatte, auf dem die mathematische Welt ruhen konnte, begann der Elefant plötzlich zu schwanken, und ich machte mich daran eine Schildkröte zu konstruieren, um den Elefanten aufrecht zu halten. Doch die Schildkröte hatte keinen besseren Stand als der Elefant, und nach ungefähr zwanzig Jahren harter, zäher Arbeit kam ich zu dem Schluss, dass ich nichts mehr tun konnte, um die mathematische Erkenntnis gewiss zu machen. Das Programm des Formalismus stellt das zweite große mathematische Dogma dar: Es gibt keine mathematischen Objekte, Mathematik besteht allein aus Formeln, Symbolketten, die keine Auskunft über etwas geben. Mathematik ist ein „Spiel ohne Inhalt“, mathematische Erkenntnisse sind nur ableitbar, somit höchstens richtig, aber niemals wahr. Erst wenn man einer Formel eine physikalische Interpretation gibt erhält sie einen Inhalt, und einen Wahrheitswert. Mathematik ließe sich als „Lehre von den formalen Systemen“ umschreiben In der Frage der Existenz und Realität vertreten Platonisten und Formalisten entgegengesetzte 10 Standpunkte, in den Argumentationsprinzipien besteht zwischen ihnen keine Uneinigkeit. Die „formalistische Grundlegung“ der Mathematik, der Neuaufbau auf der Basis eines durch einen Widerspruchsfreiheitsbeweis abgesicherten Vollformalismus, war das Programm eines bedeutenden Mannes: David Hilbert (1862-1943) Sein Programm setzte sich aus drei Schritten zusammen: (1) Man führe eine formale Sprache und Schlussregeln ein, die ausreichen, das jeder richtige Beweis eines klassischen Satzes dargestellt werden kann, die von Axiomen ausgeht, wobei jeder Schritt mechanisch überprüfbar sein muss (dies war zu einem großen Teil bereits von Frege, Russel, Whitehead geleistet worden). (2) Man entwickle eine „Metamathematik“, eine Theorie deren Gegenstand die gesamte Mathematik in einer Gestalt sein sollte, in der alle ihre Sätze aus endlich vielen Ausgangssätzen mittels logischer Schritte hergeleitet werden können (für den Gesamtbereich der Mathematik formuliert hat diese Forderung etwas utopisches).. (3) Man beweise mittels rein endlicher Argumente, dass ein Widerspruch, zum Beispiel 1 = 0, in diesem System nicht hergeleitet werden kann. Auf diese Weise hätte die Mathematik eine sichere Grundlage – im Sinne, dass ihre Widerspruchsfreiheit garantiert wäre. David Hilbert (Über das Unendliche): Meine Theorie hat zum Ziel, die definitive Sicherheit der mathematischen Methode herzustellen... . Es soll zugegeben werden, dass der Zustand in dem wir uns gegenwärtig angesichts der Paradoxien befinden, für die Dauer unerträglich ist. Man denke: In der Mathematik, diesem Muster von Sicherheit und Wahrheit führen die Begriffsbildungen und Schlüsse, wie sie jedermann lernt, lehrt und anwendet, zu Ungereimtheiten. Und wo soll sonst Sicherheit und Wahrheit zu finden sein, wenn sogar das mathematische Denken versagt? Dieser Ausspruch liest sich ganz ähnlich wie der von Russel weiter oben, während aber die logiszistische Interpretation versuchte, die Mathematik auf festen Boden zu stellen indem sie sie in eine Tautologie verwandelte, versuchte die formalistische dasselbe indem sie ein Spiel ohne Inhalt aus ihr machte, gemäß der Auffassung der Mathematik als ein System von Handlungsschemata für den Umgang mit von jedem Inhalt freien Figuren nach genau angegebenen Regeln. Hilberts Aussagen ihm seien „im genauen Gegensatz zu Frege und Dedekind die Gegenstände der Zahlentheorie die Zeichen selber“ oder „am Anfang (..) war das Zeichen“ illustrieren diesen Unterschied. Das beweistheoretische Programm Hilberts tritt somit erst in Kraft, nachdem die Mathematik in eine formale Sprache übertragen und ihre Beweise so geschrieben sind, dass eine Maschine sie kontrollieren kann (unter Formalisierung versteht man den Prozess, durch den die Mathematik für die mechanische Verarbeitung vorbereitet wird; Bsp. Computerprogramm). Wie sich zeigte war, Gewissheit auch zu diesem Preis nicht zu haben. 1930 zeigte Kurt Gödel (1906-1978), dass das Hilbertsche Programm unhaltbar ist. Grenzen der axiomatischen Methode Der heutige Erkenntnistheoretiker kann an den Resultaten der logischen und mathematischen Grundlagenforschung nicht mehr vorbeigehen. Insbesondere sind viele der innerhalb der Metamathematik gewonnenen Ergebnisse von einer so außerordentlichen theoretischen Bedeutung und Tragweite, dass deren genaues Studium für jeden, der erkenntnistheoretische Untersuchungen betreiben will, welche auf der Höhe der Zeit stehen, ganz unerlässlich ist. Durch jene Ergebnisse gewinnen wir tiefste Einblicke in die Endlichkeit unseres Denkvermögens, in die Reichweiten und die Grenzen des axiomatisch-deduktiven Vorgehens ... Wolfgang Stegmüller (1959) Die für eine Philosophie der Wissenschaften wichtigste dieser metamathematischen Ergebnisse betreffen die sog. Unvollständigkeit zahlreicher axiomatisch aufgebauter Disziplinen, beispielsweise schon der Arithmetik. Die Unvollständigkeit besagt (am Beispiel 11 der Arithmetik), dass durch Herleitungen aus einem Axiomensystem der Arithmetik nicht alle Sätze gewonnen werden können, die in der inhaltlichen, „voraxiomatischen“ Arithmetik wahre Sätze über Grundzahlen sind. Dies ist in der Tat ein gewichtiges Resultat, da wir die Herleitbarkeit aller wahren Aussagen über die Gegenstände einer Disziplin als Hauptziel der Axiomatisierung erachtet haben. Der im Vollformalismus verwirklichte Präzisierungsgrad reicht also aus, um Unvollständigkeitsergebnisse, wie den berühmten Unvollständigkeitssatz Gödels, zu begründen: „Wenn ein formales mathematisches und widerspruchsfreies Axiomensystem in der Lage ist, die Arithmetik der Zahlen 1,2,3,4,5, ... zu beschreiben, dann kann dieses Axiomensystem nie vollständig sein.“ ⇒ Wenn Zermelos Axiomensystem widerspruchsfrei ist, dann kann es nie vollständig sein. Ernst Zermelo (1872-1953), schuf 1908 das Axiomensystem, auf das Hilbert sein Programm aufbaute. Er versuchte nachzuweisen, dass das vorgeschlagene System widerspruchsfrei und vollständig ist. Zermelos Axiome haben die Mathematik so umfassend zu begründen, dass man aus ihnen jedes Problem, zumindest prinzipiell, einer Lösung zuführen kann. Seit Gödels Satz wissen wir jedoch, dass es stets ein mathematisches Problem (in der Sprache dieses Axiomensystems formuliert) gibt, welches mit den Mitteln des Systems weder positiv noch negativ gelöst werden kann. Weiters, dass jedes widerspruchsfreie, formale System, das stark genug wäre, die elementare Arithmetik einzuschließen, seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen könnte. Gödels Satz brachte zwar Hilberts Programm zu Fall, befreite dafür die Mathematik von der Illusion eine Wissenschaft zu sein, die rein mechanisch nachvollziehbar wäre. Die dritte im Grundlagenstreit etablierte Schule war der Konstruktivismus. Um ihn behandeln zu können müssen wir uns zunächst Bereichen der Mathematik widmen, denen wir bis jetzt ausgewichen sind: Unendliche Bereiche Eine weitere charakteristische Eigenschaft mathematischen Denkens ist: Die Entwicklung und Untersuchung von Methoden, die unendliche Bereiche einem endlichen Intellekt so zugänglich zu machen, dass präzise und begründbare Aussagen über sie möglich werden. Oder auf den Charakter der Mathematik überhaupt ausgeweitet: „Will man ein kurzes Schlagwort, welches den lebendigen Mittelpunkt der Mathematik trifft, so darf man wohl sagen: sie ist die Wissenschaft vom Unendlichen“ (Weyl, 1926). Als erstes betrachten wir das Problem der „unendlich kleinen (infinitesimalen) Größen“, das bereits in der Antike den Zwiespalt zwischen Prozess und Entität (Wesenheit) darlegte. In der frühen griechischen Antike wurden die Grundzahlen durch Vervielfachung der Eins erzeugt gedacht (nur die Eins selbst erhielt gelegentlich einen irritierenden Sonderstatus). Man fragte sich ob ähnliches nicht auch für geometrische Strecken gelte. Aber da man jede Strecke beliebig klein vorgeben kann, gibt es keine „Einheitsstrecke“, mit der sich alle geometrischen Strecken messen ließen. Und aus der Unmöglichkeit, die Wurzel aus Zwei als Bruch darzustellen, was schon den Phytagoreern bekannt war, und somit ihrer These von der Ganzzahligkeit aller Verhältnisse im Kosmos entgegengesetzt (diese Tatsache wird oft als erste mathematische Grundlagenkrise bezeichnet), folgt die Nichtvergleichbarkeit von Seite und Diagonale z.B. eines Quadrats. Die frühen griechischen Mathematiker fragten sich ob man nicht die Punkte auf einer Strecke als deren Elemente auffassen könnte, obwohl Punkte keine Ausdehnung besitzen. Oder konnte man doch durch Aneinanderreihung unendlich vieler Punkte („unendlich kleine Strecken“) eine Strecke erhalten? Zenon aus Elea (5.Jh. v. Chr.) zeigte in mehreren „zenonischen Paradoxien“ die Widersprüchlichkeit einer solchen Auffassung. Wohl können wir eine Strecke halbieren, die 12 Hälften wieder halbieren, immer wieder ohne Ende. Aber gerade wegen dieser Unendlichkeit ist es unmöglich eine Strecke „von unten“ beginnend aufzubauen. Die wohl bekannteste Paradoxie ist die von „Achill und der Schildkröte“. Gibt Achill der Schildkröte fairerweise einen Vorsprung, so hat er schon verloren, denn er kann die Schildkröte nie mehr einholen, er muss ja immer erst bis zu einem Punkt eilen, den die Schildkröte bereits verlassen hat, so dass die beiden immer durch eine, zwar kleiner werdende, aber dennoch endliche Strecke getrennt scheinen. Diese Überlegung ist wahrlich paradox, scheint sie auf den ersten Blick geradezu plausibel, führt aber dennoch zu einem falschen Ergebnis. Eine „Auferstehung“ erlebte die Idee von infinitesimalen Größen, genauer einer Zahl, die die archimedische Eigenschaft nicht erfüllt (eine zahl die größer ist als Null, aber trotzdem kleiner als Eins bleibt, egal wie oft man sie zu sich selbst addiert), im ausgehenden 17. Jh., durch Leibniz (1646-1716), Newton (1643-1727) und L´Hôpital (1661-1704), in der Begründung der Infinitesimalrechnung, die (so wird behauptet) eine zweite „Grundlagenkrise“ loslöste. Man macht sich den Zusammenhang leicht an Darstellungen klar, die sich bis heute in anschaulich orientierten Lehrbüchern der Differential- und Integralrechnung finden (vgl. Schulübungen zu Differentialrechnung Ι, 7.Klasse; zu Integralrechnung, 8.Klasse). Gegeben sei z.B. die Funktion y = x im Intervall [0,a]; analog zur Schulübung wird die endliche Basis ∆x der Trapeze (die dem Graphen um- und eingeschrieben werden) zur unendlich kleinen Basis dx, und somit die Fläche als aus lauter unendlich schmalen Trapezen aufgebaut gedacht. Zu welcher Fläche sie sich „summieren“ lehrt die Integralrechnung: ∫x dx (in den Grenzen 0 und a) Genauso ist diese Vorgehensweise für nicht geradlinige Kurven anwendbar, wenn dx eben „unendlich klein“ wird. Es kann kein Zweifel sein, dass diese Vorgehensweise nichts als geschickte Mogelei ist. Leibniz behauptete nicht, dass infinitesimale Größen wirklich existierten, nur dass man ohne in einen Irrtum zu verfallen, so argumentieren könne als ob sie existierten. Im Jahre 1734 erschien eine niederschmetternde Kritik der Infinitesimalrechnung von Berkley: Er erklärte das Leibnizsche Verfahren (die Differentialrechnung) nach dem schlussendlich z.B. 32 + 16 dt gleich sein soll wie 32 als unverständlich; noch dazu wird zu Beginn der Rechnung der Bruch ds/dt als ungleich Null angesehen. „Es wird auch nichts nützen zu sagen, dass das vernachlässigte Glied eine äußerst kleine Größe ist, denn dann hätten wir nicht die exakte Geschwindigkeit, sondern nur eine Approximation“. Im 19. Jh. Konnte Weiestraß mit Hilfe seiner heute üblichen „Epsilon-Delta“ Definition (die Geschwindigkeit wird danach nur als Grenzwert betrachtet) die infinitesimalen Methoden aus der Analysis vertreiben (ähnlich ging bereits Aristoteles mit seinem Ausschöpfungsverfahren vor). Nichtsdestotrotz haben Physiker und Ingenieure nie aufgehört sie zu benützen. Zu ergänzen bleibt, dass mit Abraham Robinson (1918-1974) und seiner „Erfindung“ – der Nichtstandardanalysis – infinitesimale Größen wieder Einzug in die Mathematik fanden. Heute ist ihr Begriff nicht länger eine widersprüchliche Redensart, sondern ein präzis definiertes Konzept, das so legitim ist wie jedes andere in der Analysis. Kehren wir zurück ins 19.Jh., zu Georg Cantor, der als Begründer der Mengenlehre bereits erwähnt wurde. Im oben erwähnten Zwiespalt, wie man „das Unendliche“ beurteilen sollte, als Entität oder als Eigenschaft eines Prozesses, gilt Cantor als Verfechter der These, z.B. π als eine unendliche Dezimalzahl aufzufassen, als abgeschlossene Wesenheit. Cantor hatte mit herber Kritik, wie z.B. von Leopold Kronecker zu kämpfen, der meinte Unendlichkeiten wären keinesfalls als existent und manipulierbar zu betrachten, denn wer hat je die ganze Zahlenfolge von π gesehen; am Besten man belastet sich nicht mit so vagen Begriffen. Bereits Galilei (1564-1642) fiel auf, dass man der Reihe der natürlichen Zahlen mit einfachen Mitteln die Quadratzahlen, die ungeraden Zahlen usw. zuordnen kann (es gibt genauso viele gerade Zahlen wie Grundzahlen, und ebenso viele ungerade Zahlen). Er lehnte ab bei Unendlichem mit Attributen wie der Gleichheit zu argumentieren; mit Cantor hat die Mathematik 13 Möglichkeiten gefunden in unendlichen Bereichen von „größer“, „kleiner“, und „gleich“ zu sprechen; natürlich nicht im gleichen Sinn wie bei endlichen Bereichen. Cantor hat jeder Menge von Objekten eine Mächtigkeit zugeordnet (wobei die Mächtigkeit einer endlichen Menge einfach die Anzahl ihrer Elemente ist). Die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen hat er mit א0 (Aleph Null, die erste Kardinalzahl) bezeichnet, ebenso alle Reihen die sich den natürlichen Zahlen eindeutig zuordnen lassen, wie die Quadrat-, die Prim, sogar ganze und rationale Zahlen. Solche Mengen heißen abzählbar, da man ihre Elemente der Reihe nach durchnummerieren kann und dabei jedes ihre Elemente eine Zahl als Nummer erhält. Er zeigte weiters, dass diese Zahl sehr eigentümlichen arithmetischen Gesetzen folgt; z.B. ist א0 + א0 = א0 ; א0 + 1 = א0 Die neuen „tranfiniten“ Zahlen, unterscheiden sich gerade in diesen Gesetzen von den finiten Zahlen. Weiters postuliert Cantor eine zweite Art der Unendlichkeit c (für continuum), die durch eine Strecke dargestellt wird, oder durch die Menge aller reeller Zahlen, die ja wie Cantor bewies nicht in einer Folge erschöpfend aufgezählt werden können. Die Reaktionen auf Cantors Behauptungen waren verschieden. Hilbert bezeichnete die transfinite Arithmetik „als die bewundernswerteste Blüte mathematischen Geistes und überhaupt eine der höchsten Leistungen rein verstandesmäßiger menschlicher Tätigkeit“. Wittgenstein machte hingegen nur desillusionierende, fast karikierende Bemerkungen: „<Ich habe etwas Unendliches nach Hause geschafft.> Man könnte antworten: <Guter Gott! Wie hast du es denn tragen können?> - Ein Lineal mit einem unendlichen Krümmungsradius.“ Nun endlich zum Konstruktivismus Die dritte Schule, die der konstruktiven oder intuitionistischen Mathematik, geht v. a. auf einen Mann zurück: Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) Unser Ausschweifen ins Reich des Unendlichen erklärt sich dadurch, dass hier Brouwer ein Extrem, entgegengesetzt zu Cantor oder Hilbert vertrat. Brouwer und Hilbert waren durchaus verfeindet – „Krieg zwischen Fröschen und Mäusen“, lautete Einsteins Urteil. Im oben angeführten Zwiespalt zwischen der Beurteilung des Unendlichen als Entität, oder als Eigenschaft eines Prozesses, vertritt Brouwer klar letztere Position. Eine unendliche Dezimalzahl x ist dann gegeben, wenn man x stets als endliche Dezimalzahl mit beliebig vielen Stellen nach dem Dezimalpunkt erfassen kann. Nie spricht Brouwer aber von allen Ziffern von x nach dem Dezimalpunkt. Man könnte meinen dieser ideologische Streit wäre Spiegelfechterei. Er hat aber enorme Auswirkungen auf so grundlegende Feststellungen wie: jede Zahl ist entweder 0, positiv oder negativ. Brouwer meinte ein Gegenbeispiel gefunden zu haben: wir verwenden π um eine verwandte reelle Zahl π´ (Pi Strich) zu definieren. Man entwickle π bis man eine Folge von 100 aufeinanderfolgenden Nullen findet. Bis dorthin soll π´ ident entwickelt werden. Angenommen man findet 100 aufeinangerfolgende Nullen ab der Stelle n, breche man π´ hier ab. Ist nun Q = π - π´ negativ, null positiv? Die Konstruktivisten argumentieren, dass keine der drei Aussagen wahr ist; erst wenn einer feststellt welcher Fall zutrifft. Folglich ist mathematische Wahrheit zeitabhängig und subjektiv. Oder allgemeiner: Jede Folgerung in Bezug auf eine unendliche Menge ist mangelhaft, wenn sie sich auf den Satz vom ausgeschlossenen Dritten bezieht. Ein anderes Beispiel: P bezeichnet die Aussage: „In der Dezimalbruchentwicklung von π kommt keine Folge von 100 Nullen vor“. P´ bezeichnet das Gegenteil. Ist die Aussage <entweder P, oder P´> wahr? Die meisten Mathematiker würden aufgrund des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten bejahen. Damit ist der Konstruktivist nicht einverstanden, für ihn ist die Entwicklung von π ein „Fabelwesen“. 14 Der Konstruktivist sieht die klassische Mathematik als ein Durcheinander von Mythos und Realität; ihm ist ohne den Mythos wohler. Brouwer beharrt darauf: Nimmt man das Unendliche als Begriff ernst, muss sich unsere Logik auf das Wesen dieses Begriffs einstellen – auch wenn sich dadurch skurrile Folgen ergeben, was einer radikalen Umgestaltung der Mathematik gleichkäme. Das Werk und die Ideen Brouwers lösten keineswegs eine Welle der Bekehrung zur konstruktiven Mathematik ein, auch weil die Schulung der jungen Mathematikstudenten möglichst rasch und unproblematisch verlaufen sollte, was mit Brouwers, sich gegen die Alltagslogik auflehnenden Gedanken sicher nicht leicht machbar wäre. Mathematik heute Der typische Mathematiker ist ein versteckter Platonist, mit formalistischer Maske die er aufsetzt, wenn es der Anlass erfordert. Somit an Werktagen Platonist, an Sonntagen Formalist Was die Grundlagen betrifft, so glauben wir an die Realität der Mathematik, doch wenn uns die Philosophen mit ihren Paradoxa attackieren, verkriechen wir uns schleunigst hinter den Formalismus und sagen <Mathematik ist nichts anderes als die Kombination bedeutungsloser Symbole>, und dann kommen wir mit dem ersten und zweiten Kapitel der Mengenlehre. Sobald man uns dann in Ruhe lässt, gehen wir wieder zu unserer Mathematik zurück, und betreiben sie wie wir sie immer betrieben haben, nämlich mit dem Gefühl, das jeder Mathematiker hat, dass er mit etwas Realem arbeitet. Dieses Gefühl ist vermutlich eine Illusion, aber eine sehr bequeme. J.A. Dieudonne (1970, S.145) In den fünfziger Jahren war der Formalismus zur vorherrschenden Haltung in Lehrbüchern und anderen Verlautbarungen geworden. Als Philosophie der Mathematik ist er mit der Denkweise aktiver Mathematiker nicht vereinbar; für positivistische Wissenschaftsphilosophen stellt sich dieses Problem nicht. Da sie vor allem auf die theoretische Physik ausgerichtet waren, sahen sie die Mathematik v.a. als Werkzeug, nicht als eigenständiges, lebendiges Gebilde Der Konstruktivismus blieb eine Häresie. An den Platonismus glaubten und glauben fast alle Mathematiker, pflegen ihn wie eine UntergrundReligion, obgleich er öffentlich kaum erwähnt wird. In den letzten Jahren begann die Vorherrschaft des Formalismus zu schwinden, eine Hinwendung zum Anwendbaren ist zu beobachten. Diese Darstellung soll vor allem zwei Dinge: Gut lesbar sein, auch für unmathematische Menschen, und fünf voneinander unabhängige Maturafragen enthalten. Der Autor beteuert nur einen Ausschnitt eines Ausschnitts aus Büchern zu geben, die beteuern nur einen Ausschnitt des Ausschnitts der Materie zu geben. Weitere Themenvorschläge: Mathematik, Logik, Metamathematik; Zählen und Zahlbegriff; Der Strukturbegriff in der Mathematik; Geometrie als Theorie der Formen; Gibt es eine Fundamentaldisziplin der Mathematik?; Zahlenmystik; Nichteuklidisch Geometrien – Parallelenaxiom; Zermelos Axiomensystem; Lakatos; Kontinuumhypothese; Intuition in der Mathematik 15