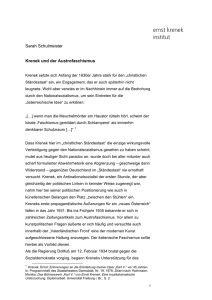Philipp Weber - Ernst Kreneks Auseinandersetzung mit dem
Werbung
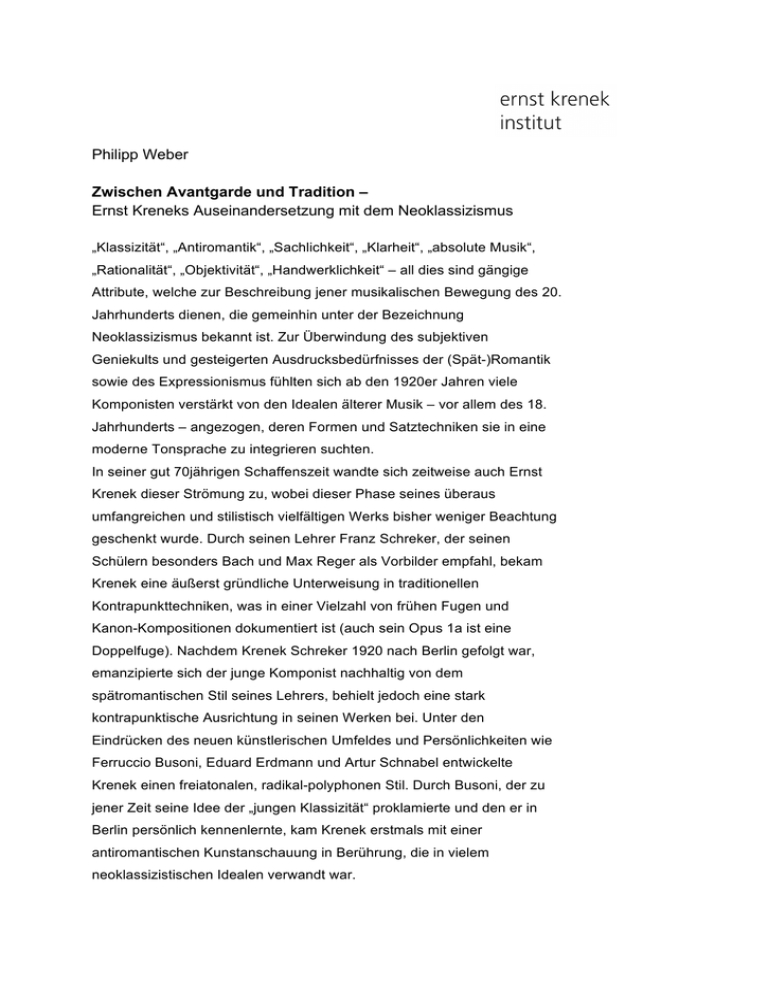
Philipp Weber Zwischen Avantgarde und Tradition – Ernst Kreneks Auseinandersetzung mit dem Neoklassizismus „Klassizität“, „Antiromantik“, „Sachlichkeit“, „Klarheit“, „absolute Musik“, „Rationalität“, „Objektivität“, „Handwerklichkeit“ – all dies sind gängige Attribute, welche zur Beschreibung jener musikalischen Bewegung des 20. Jahrhunderts dienen, die gemeinhin unter der Bezeichnung Neoklassizismus bekannt ist. Zur Überwindung des subjektiven Geniekults und gesteigerten Ausdrucksbedürfnisses der (Spät-)Romantik sowie des Expressionismus fühlten sich ab den 1920er Jahren viele Komponisten verstärkt von den Idealen älterer Musik – vor allem des 18. Jahrhunderts – angezogen, deren Formen und Satztechniken sie in eine moderne Tonsprache zu integrieren suchten. In seiner gut 70jährigen Schaffenszeit wandte sich zeitweise auch Ernst Krenek dieser Strömung zu, wobei dieser Phase seines überaus umfangreichen und stilistisch vielfältigen Werks bisher weniger Beachtung geschenkt wurde. Durch seinen Lehrer Franz Schreker, der seinen Schülern besonders Bach und Max Reger als Vorbilder empfahl, bekam Krenek eine äußerst gründliche Unterweisung in traditionellen Kontrapunkttechniken, was in einer Vielzahl von frühen Fugen und Kanon-Kompositionen dokumentiert ist (auch sein Opus 1a ist eine Doppelfuge). Nachdem Krenek Schreker 1920 nach Berlin gefolgt war, emanzipierte sich der junge Komponist nachhaltig von dem spätromantischen Stil seines Lehrers, behielt jedoch eine stark kontrapunktische Ausrichtung in seinen Werken bei. Unter den Eindrücken des neuen künstlerischen Umfeldes und Persönlichkeiten wie Ferruccio Busoni, Eduard Erdmann und Artur Schnabel entwickelte Krenek einen freiatonalen, radikal-polyphonen Stil. Durch Busoni, der zu jener Zeit seine Idee der „jungen Klassizität“ proklamierte und den er in Berlin persönlich kennenlernte, kam Krenek erstmals mit einer antiromantischen Kunstanschauung in Berührung, die in vielem neoklassizistischen Idealen verwandt war. Prägend für Kreneks konkreten Kompositionsstil jener Zeit war jedoch vor allem der Schweizer Musiktheoretiker Ernst Kurth und dessen Buch Grundlagen des linearen Kontrapunkts: Eine Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie, wie Krenek u.a. in einem Interview betonte: „Es war ein sehr aufregendes Buch, es hat auf meine Idee der Autonomie der Musik, einer Musik, die also ihr eigenes Leben führt, eingewirkt. Auch die Musik, die ich damals geschrieben habe, war stark davon beeinflußt.“1 Prinzipien der Motiv- und Melodiegestaltung und Linienführung, die Kurth in Bachs Stil identifizierte, kommen tatsächlich in Kreneks frühen Kompositionen – allerdings in radikal modernem Kontext – zur Anwendung. So findet sich auf dem „Höhepunkt“ des hochkontrapunktischen Streichquartetts Nr. 1 op. 6 (1921) eine ausgedehnte Doppelfuge, in der die vertikalen Zusammenklänge als das zufällige Resultat höchst unabhängig agierender Linien erscheinen. Im Folgejahr schrieb Krenek ein Werk, das die gleichen Elemente innerhalb einer bis dato völlig vernachlässigten, barocken Form aufweist: das Concerto grosso (Nr. 1 op. 10; Krenek verwendet hier die typische Ritornellform, Imitations-, Kanon- und Fugentechniken und greift im 2. Satz auch auf das barocke Modell der Passacaglia mit ihrem unablässigen Ostinato im Bass zurück. Ähnliche Tendenzen finden sich in den Folgewerken: der Symphonischen Musik Nr. 1 op.11 sowie der Toccata und Chaconne für Klavier op. 13. Als Anhang zur atonalen Toccata schrieb Krenek noch die humorvolle Kleine Suite op.13a, die das Thema des Hauptwerkes sowohl in traditionellen Tanzcharakteren, so etwa in einer tonalen Allemande im Bachstil, einer Sarabande, einer Gavotte und in einem Walzer, als auch in einem modernen Foxtrott erscheinen lässt. Mit Ausnahme dieser größtenteils tonalen Suite erklingen die neoklassizistischen Tendenzen in Kreneks Werken der Berliner Zeit unter der Oberfläche einer avantgardistischen, oft expressiven Tonsprache und sind für den Hörer nicht immer auf Anhieb erkennbar. Die Periode 19211923, in der besonders auch Kreneks erste Symphonien und Opern im Vordergrund stehen, wird daher gewöhnlich als „freiatonale 1 Aus Eberhardt Klemm: Gespräch mit Ernst Krenek, in: Jahrbuch Peters 1980, Hg. Eberhardt Klemm, Leipzig: Edition Peters, 1980, S. 209. Phase“ bezeichnet und erst die darauf folgende als die „neoklassizistische“.2 Zu Beginn seiner zweijährigen Zeit in der Schweiz (Ende 1923-1925), die von dem bedeutenden Kunstmäzen Werner Reinhart finanziert wurde, war es vor allem der Einfluss Igor Strawinskys und dessen Pulcinella Suite (er hörte das Werk im Dezember 1923 anlässlich der Winterthurer Uraufführung seines Klavierkonzerts op. 18), der bei Krenek ein verstärktes Interesse am neoklassizistischen Komponieren auslöste: „Und ich sah und hörte Strawinsky, der gerade mit seiner Pulcinella-Suite das Zeitalter des ‚Neoklassizismus‘ einleitete. Sofort war ich versucht, seinem Beispiel zu folgen. Ich schrieb ein paar Stücke, die sich dieser stilistischen Manier annäherten, also dem konzertanten Barock-Stil des 17. und 18. Jahrhunderts, und sie erhielten auch die entsprechenden Titel Concertino und Concerto grosso. Sie sind natürlich völlig anders als meine beiden Symphonien und die Oper. Sie sind knapper in der Form, leichter in der Substanz, spielhaft und weniger aggressiv.“3 Im Unterschied zu den Kompositionen der Berliner Zeit näherte sich Krenek in den genannten Werken Concerto grosso Nr. 2 op. 25 und Concertino für Flöte, Violine, Cembalo und Streichorchester op. 27 nun auch in Textur, Gestik sowie konzertanter Musizierfreude der Barockmusik, wobei die Tonalität wieder an Bedeutung gewinnt. So sind beide Kompositionen, wie Krenek auch in seinen Memoiren Im Atem der Zeit erwähnt, teilweise deutlich dem Charakter Bachs Brandenburgischen Konzerten nachempfunden. Schon das 4. Streichquartett, das erste in der Schweiz vollendete Werk, trägt deutlich neoklassizistische Züge. Die ursprüngliche Version des finalen Satzes bewegt sich ganz in klassischen melodischen und rhythmischen Mustern und greift Elemente aus Mozarts Jupitersinfonie auf.4 Zu diesen im engeren Sinne neoklassizistischen Werken gehört ebenfalls die Kleine Suite für Klarinette und Klavier, op. 28, die Krenek seinem Förderer Werner Reinhart, der auch Klarinettist war, widmete. Wie schon die Kleine Suite op. 13a enthält diese neben barocken Satztypen wie Präludium, Air, Bourrée auch einen „Modernen Tanz“, der foxtrottartige Rhythmen aufweist. 2 So u.a. bei Lothar Knessl: Ernst Krenek, Wien: Verlag Elisabeth Lafite, 1967. Ernst Krenek: Ernst Krenek. Der wandelbare Komponist, in: Das musikalische Selbstportrait. Von Komponisten, Dirigenten, Instrumentalisten, Sängerinnen und Sängern unserer Zeit, Hg. Josef Müller-Marein und Hannes Reinhardt, Hamburg: Nannen-Verlag GmbH, 1963, S. 182 4 Da der offensichtlich klassizistische Stil des Schlusssatzes Krenek später zu weit ging, verfasste er eine zurückhaltendere Version und übernahm von der ersten lediglich die Coda. 3 In der Schweiz hatte Krenek die Gelegenheit, Strawinsky, den eigentlichen Inaugurator des Neoklassizismus, persönlich näher kennenzulernen. Man traf sich nicht nur im Hause Reinhart, sondern auch in Genf, wo Krenek Ende November des Jahres 1924 Strawinskys Aufführungen seines Concerto pour piano et orchestre d’harmonie und dessen Octuor pour instruments à vent hörte. Der Bläserklang dieser Werke beeindruckte Krenek so sehr, dass er schon während seines anschließenden Aufenthalts in Paris als offensichtliche Hommage für Strawinsky mit der Komposition seiner Symphonie pour instruments a vent et batterie op. 34 begann. Das Pariser Kulturleben übte nachhaltigen Eindruck auf Krenek aus: „In Paris bekam ich den Eindruck, daß Musik nicht nur wild und expressionistisch zu sein hat und abgekehrt und einsam, sondern, daß sie sich auch an die Gesellschaft wenden kann, an das Publikum, und versuchen kann, Anschluß zu erreichen an die Gemeinschaft.“5 Auch wenn Krenek hier mit dem französischen Neoklassizismus und mit Vertretern der Komponistengruppe „Les six“ wie Darius Milhaud und Arthur Honegger in Berührung kam, so führten diese Begegnungen doch weniger zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der klassischen und barocken Musik, die ihm zunehmend akademisch vorkam, als vielmehr zu einer Wiederentdeckung der Tonalität und einer Hinwendung zum Publikum. Diese neue Tendenz gipfelte schließlich in der Oper Jonny spielt auf. Der enorme Erfolg dieses Werkes, das Kreneks romantische Kompositionsphase einleitete, stellte die zuvor entstandenen neoklassizistischen Kompositionen gewissermaßen in den Schatten. Jedoch ist ihre Bedeutung für das künstlerische Gesamtwerk Kreneks wie auch für die Bewegung des Neoklassizismus im Allgemeinen nicht gering zu schätzen. Das Zweite Concerto grosso etwa fand in den zwanziger Jahren weite Verbreitung und beeinflusste auch andere Komponisten bis hin zu Béla Bartók, der das Werk 1925 in Prag hörte und sich ab Mitte der 1920er Jahre selbst mit dem Neoklassizismus auseinandersetzte. 5 Ernst Krenek: Im Gespräch mit Hans Bünte, in: Porträts aus dem Musikerleben, Hg. Karl B. Schnelting, Frankfurt am Main: Fischer, 1987, S. 59. Philipp Weber schloss 2008 sein Magisterstudium der Musikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg ab. Es folgten verschiedene Praktika, u.a. beim Schottverlag in Mainz sowie der Abschluss eines weiterführendes Zertifikatsstudium in BWL an der Fernuniversität in Hagen 2010. Seit 2009 promoviert er unter Betreuung von Prof. Dr. Claudia Maurer-Zenck über das Thema „Ernst Kreneks neoklassizistische Kompositionen“ am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg.

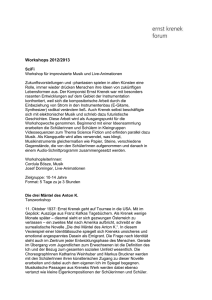
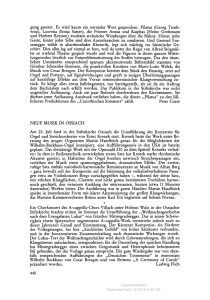

![[Argos]. Ein Gespräch mit Ernst Krenek.](http://s1.studylibde.com/store/data/002004288_1-78928ab95d7be3f14515f2d7710fa817-300x300.png)