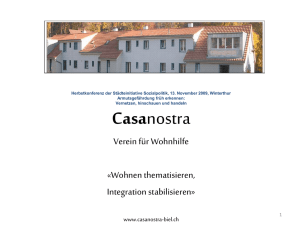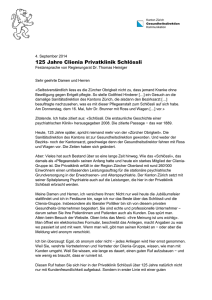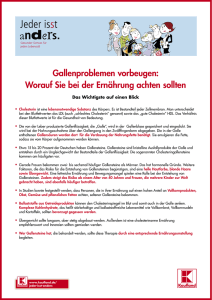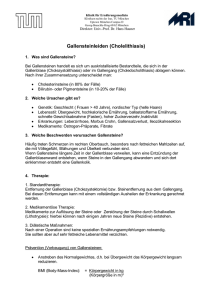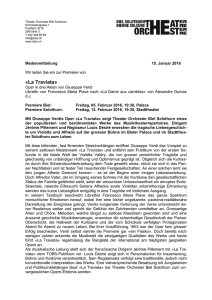Koronare Herzkrankheit
Werbung
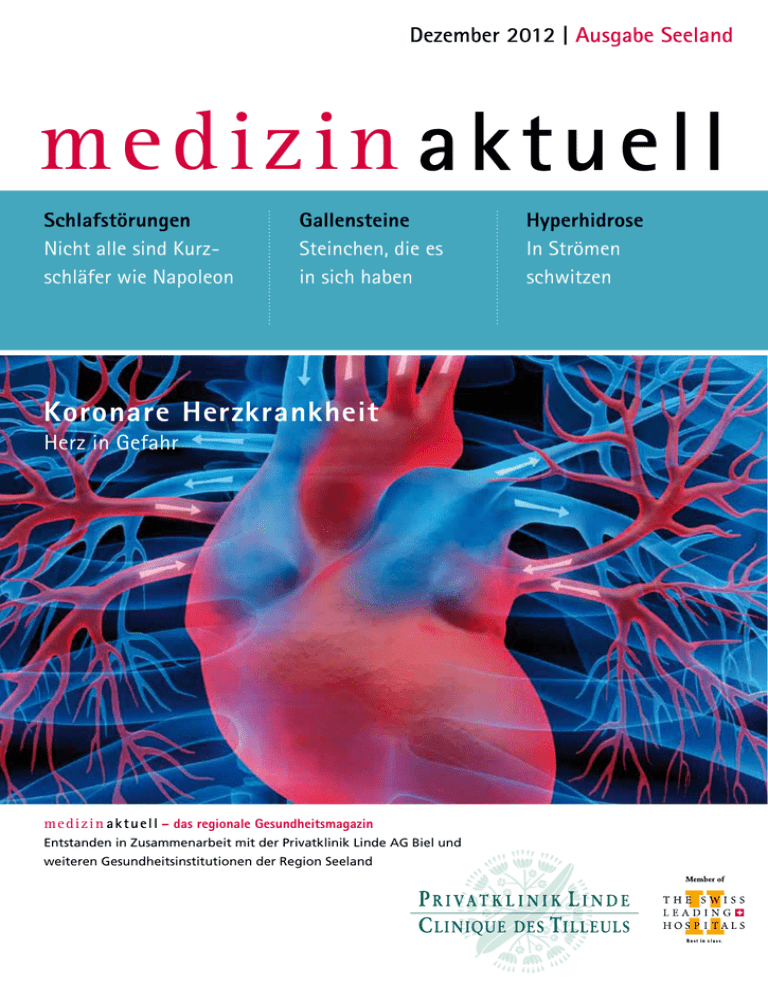
Dezember 2012 | Ausgabe Seeland me dizi n a k tu el l Schlafstörungen Nicht alle sind Kurz­ schläfer wie Napoleon Gallensteine Steinchen, die es in sich haben Koronare Herzkrankheit Herz in Gefahr me d izi n akt uel l – das regionale Gesundheitsmagazin Entstanden in Zusammenarbeit mit der Privatklinik Linde AG Biel und weiteren Gesundheits­institutionen der Region Seeland Hyperhidrose In Strömen schwitzen Orthopädische Hilfsmittel Mit Helfern mobil bleiben Menschen mit eingeschränkter Mobilität können ihre Unabhängigkeit länger wahren, wenn sie geeignete Hilfsmittel zur Unterstützung beiziehen. Die Botta Orthopädie AG in Biel bietet eine breite Produktepalette und kompetente, persönliche Beratung an. Wer älter und nicht mehr gut zu Fuss ist, Mühe mit alltäglichen Verrichtungen wie Anziehen, Schuhe binden, Essen einnehmen hat oder unter Krankhei­ ten leidet, welche die Mobilität einschränken oder wer Sturz gefährdet ist, der tendiert häufig dazu, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Das muss nicht sein, denn mittlerweile gibt es viele orthopä­ dische Hilfsmittel und nützliche «Alltagshelfer», die das Leben erleichtern sowie die Mobilität und so die Unabhängigkeit von fremder Hilfe fördern. «Mit wenig­Aufwand lassen sich häufig Unfälle vermei­ den, und die Betroffenen können ihre Selbstständig­ keit und Lebensqualität länger aufrechterhalten», sagt Rémy Botta, Co-Geschäftsinhaber der Botta Ortho­ pädie AG in Biel. Vielerlei speziell für Senioren oder Menschen mit Handicaps entwickelte Hilfsmittel kompensieren vor­ handene Defizite. Man unterscheidet dabei zwischen orthopädischen Hilfsmitteln und nützlichen «Alltags­ helfern». Zu den orthopädischen Hilfsmitteln zählen Bandagen, Kompressions- und Stützstrümpfe, Fuss­ stützen und Schuheinlagen, Brustprothesen und Spe­ zial-BHs oder Korsette. «Alltagshelfer» dagegen sind technische Hilfsmittel wie spezielle Gehstöcke (im Bild), Rollatoren, Geräte zur Unterstützung beim An­ ziehen, Aufstehen oder Geradestehen, Pflegebet­ ten und -stühle, Haltegriffe für WC und Bad, Bade­ wanneneinlagen, Instrumente zum Greifen, Ess- und Trinkhilfen. Kein falscher Stolz «Viele Menschen verzichten aus falschem Schamgefühl, Stolz auf Stöcke oder einen Rollator, weil sie sich noch nicht so alt fühlen oder weil sie das Etikett ‹behindert› oder ‹schwach› vermei­ den wollen», so Rémy Botta weiter, «dabei führen ge­ rade diese Geräte dazu, dass die Mitmenschen sie so als Person, die in ihrer Mobilität eingeschränkt ist, wahrnehmen und demzufolge auch mehr Rücksicht nehmen.» Ganz zu schweigen von der erhöhten Tritt­ sicherheit und der verminderten Sturzgefahr. «Gerade beim Wandern empfehle ich Stöcke, denn das entlas­ tet die Gelenke um bis zu 30 Prozent.» Aber auch an­ gemessenes Schuhwerk (auch solche mit Spikes) im Winter oder Socken mit Gumminoppen auf der Un­ terseite sind eine wichtige Sturzprävention, ebenso 2 medizin aktuell wie rutschfeste Gleitschutzmatten unter Teppichen oder spezielle Haltegriffe in WC, Dusche, Badewanne. «Spätestens dann, wenn man sich unsicher fühlt, die Wohnung zu verlassen, sollte man sich fachkundig beraten lassen», rät Rémy Botta. Sorgfältige Abklärung Die kleinen Alltagshelfer sollen ihre Nutzer nicht zur Unbeweglichkeit verfüh­ ren, sondern dazu motivieren, den gewohnten All­ tag möglichst gut und selbständig zu gestalten und lange mobil zu bleiben. Welche technischen Hilfsmit­ tel der einzelne Kunde benötigt, worin er Unterstüt­ zung bedarf, das wird sorgfältig abgeklärt: «In die­ sen Gesprächen lässt sich so manches Problem dann ganz einfach und allein mit guten Ratschlägen lösen. Häufig fassen die Kunden dann aber auch Mut und sagen uns, wo genau der ‹Schuh drückt›, was sie be­ sorgt – dies sind manchmal sehr intime Gespräche», sagt Rémy Botta und fährt fort: «Und so kommt es dann, dass in unserer Werkstatt manchmal ganz individuelle Lösungen entstehen, die auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden und sei­ ner Wohnung massgeschneidert werden.» Viele der Hilfsmittel werden von Krankenkas­ sen oder der Invalidenversicherung übernom­ men, manches lässt sich auch mieten. Botta: «Wer für eine bestimmte Zeit in seiner Mobili­ tät eingeschränkt ist, etwa nach einer Opera­ tion, der muss nicht gleich eine Gehhilfe oder ein Pflege­bett kaufen.» Die Auskunftspersonen Rémy Botta und Michel Botta (unten) Co-Geschäftsinhaber Botta Orthopädie AG und Sanitas Kontakt: Botta Orthopädie AG Karl Neuhausstrasse 24, 2502 Biel Tel. 032 328 40 80, [email protected] oder: Sanitas, Murtenstrasse 7, 2502 Biel Tel. 032 323 14 73, [email protected] Editorial | Inhalt In Sachen KHK, Gallensteine und Schlafstörungen KHK Nein, das ist weder das Kürzel für ein Virus noch ein Hoch­ schuldiplom, sondern für ein Volksleiden, das Tag für Tag Men­ schenleben fordert, weil ein Muskel auf einmal den Dienst versagt. Ein Muskel, der sich zwischen 70 und 80 Mal pro Minute an- und entspannt, etwa 2,8 Milliarden Mal, bis ein Mensch 70 Jahre alt ist; eine Höchstleistung für das faustgrosse, etwa 300 Gramm wiegende Organ, das, tausendfach besungen, vor Liebe überlaufen oder an Kummer zerbrechen kann: das Herz. Doch Zivilisationskrankhei­ ten setzen ihm zu. Übergewicht, Bluthochdruck, Cholesterin, Dia­ betes und Stress, diese «diabolischen Fünf» verursachen Koronare Herzkrankheit, KHK eben, «setzen dem Herz zu, still, unbemerkt, über Jahre», erklärt der Kardiologe Alex Thommen. «Und plötz­ lich kommts zum Crash, kann schon leichte körperliche Belastung, kurze Hektik oder ein kalter Wintertag zu viel sein.» (Seite 6) Gallensteine Die kleinen Klümpchen aus Kristallen und Ablage­ 4 Asthma Ringen um Luft 6 Koronare Herzkrankheit Herz in Gefahr 9 Hyperhidrose In Strömen schwitzen 10 Gallensteine Steinchen, die es in sich haben 12 Gebärmutterhalskrebs Spritze gegen den Krebs 14 Chiropraktik Arthrose soll Rheuma sein? Ja! 16 Sprunggelenk Drei Knochen, ein Gelenk rungen können enorme Schmerzen im Oberbauch verursachen. Über­ gewicht und Diabetes – schon wieder – gelten als Hauptrisikofak­ toren, ebenso wie das weibliche Geschlecht. «Frausein» als R ­ isiko? Ja, denn das Sexualhormon Östrogen begünstigt die Bildung von Gallensteinen. Hinweise darauf liefern zumindest Untersuchungen, die zeigen, dass die zusätzliche Zufuhr von Östrogen, etwa mit­ tels Antibabypille oder Hormontherapie, das Steinbildungsrisiko er­ höht. Und falsch liegt wer meint, von Gallensteinen seien nur ältere Menschen betroffen: Forscher fanden heraus, dass übergewichtige 10- bis 19-Jährige ein doppelt so hohes, fettleibige ein viermal und extrem fettleibige gar ein sechsmal höheres Erkrankungsrisiko ha­ ben als normalgewichtige Altersgenossen. Die Viszeralchirurgin Monika Richter sagt es so: «Vor Gallensteinen ist niemand gefeit. Doch fettarme, ballaststoffreiche Ernährung und das Vermeiden von Übergewicht wirkt sich mit Sicherheit positiv aus.» (Seite 10) 18 Wundbehandlung Schlafstörungen «Wer schlafen kann, darf glücklich sein», sagte Für die Augen nur das Beste: Neues Augenzentrum eröffnet Medizinvorträge: Agenda bis Juni 2013 Erich Kästner – doch das Glücklichsein ist längst nicht allen ver­ gönnt. Fast jede Zweite, jeder Zweiter im Land leidet regelmäs­ sig unter Schlafstörungen. Manche finden kaum Schlaf, wälzen sich Nacht für Nacht schwitzend im Bett herum; und schlafen sie dann endlich ein, wachen sie wenig später wieder auf, sind tags­ über schlapp und unkonzentriert. Dabei ist Schlaf lebenswichtig. «Zu wenig davon macht dick, dumm und krank», brachte es ein deutscher Schlafforscher letzthin auf den Punkt. Schlafstörungen können viele Ursachen haben, manchmal ist es nur die falsche Matratze, häufig aber sind es Stress und psychische Belastungen, die den Menschen den Schlaf rauben – und sie zu Medikamen­ ten greifen lassen. Doch die Mittel lösen das Schlafproblem nicht, «denn sie sind Helfer, keine Heiler», stellen die beiden Bieler Ärzte ­Claudio E. Graf und Herbert Schaufelberger übereinstimmend fest. (Seite 20) Bernhard Kummer Herausgeber Das Alter bremst die Heilung 20 Schlafstörungen Nicht alle sind Kurzschläfer wie Napoleon 22 Hodenkrebs Gute Heilungschancen 24 Körpertraining im Alter Bewegung als Medizin 26 E-Gesundheitsdossier Mehr Qualität und Sicherheit 28 Privatklinik Linde AG Biel Impressum Das Magazin «medizinaktuell» entsteht in Zusammen­ arbeit mit Gesundheitsinstitutionen der Region Biel-Seeland, die für den Inhalt ihrer Beiträge selber verantwortlich zeichnen. Auflage: Expl. 55 000 Erscheinungsweise, nächste Ausgabe: Das Magazin erscheint zwei Mal pro Jahr, die nächste Ausgabe im Mai 2013. Herausgeber und Konzept: kummer+partner gmbh, kommunikationsmanagement+medien, Dählenweg 4, 2503 Biel, Tel. 032 373 30 30, [email protected], www.kplusr.ch Redaktion: Kerstin Wälti (Leitung), Marianne Kaiser, ­ Bernhard Kummer, Sabine Vontobel Gestaltung: Renata Hubschmied, Grafische Gestaltung, Bern Druck: Rub Media AG, Wabern Distribution: Direct Mail Company Biel-Bienne DMB AG, Biel med izin ak tue l l 3 Asthma Ringen um Luft Das Lungenvolumen von Asthmatikern ist stark verringert, immer wieder rauben ihnen ­Attacken den Atem. Die Krankheit kann nicht geheilt, jedoch gut therapiert werden, sodass ein normales Leben möglich ist. Bei Asthmatikern herrscht eine ständige Entzündungsund Abwehrbereitschaft in den unteren Atem­wegen (Bronchien); bei einem Anfall reagieren die Atem­ wege auf den auslösenden Reiz besonders ausgeprägt. Die bereits gereizte Schleimhaut in den Bronchien schwillt an und produziert zähen Schleim. Zusätzlich verkrampfen sich die Muskeln der Atemwege und zie­ hen sich zusammen. Dadurch wird das Atmen, vor allem das Ausatmen, erschwert; mit Husten versucht der Körper, die Luftwege vom übermäs­sigen Schleim zu befreien. Wer also eines oder mehrere der fol­ genden Symptome bei sich beobachtet, sollte einen Arzt aufsuchen: pfeifende, rasselnde Atmung, über­ wiegend trockener Husten, Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit oder Atemnot, nachts und bei körper­ licher oder psychischer Belastung auftretende Be­ schwerden, besondere Empfindlichkeit gegenüber Zi­ ga­rettenrauch, Hitze, Kälte, Staub und Benzingeruch. Sekunden bis Stunden Asthma bronchiale, kurz Asthma genannt, ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen – im Kindesalter sogar die häufigste: Rund zehn Prozent der Kinder und sieben Prozent der Erwachsenen leiden in der Schweiz daran. Bei etwa der Hälfte aller asthmakranken Kinder bilden sich die Symptome bis zum Erwachsenenalter vollständig zurück und bedürfen keiner Behandlung mehr. Ein Kennzeichen von Asthma ist, dass die Beschwerden in vielen Fällen nach der Einnahme von Medikamen­ ten zurückgehen. Auch äussern sich die Symptome nicht immer gleich stark und häufig; in leichten Fäl­ len machen die Beschwerden den Patienten seltener als einmal pro Woche zu schaffen, in schweren Fäl­ len ringen Asthmatiker trotz regelmässiger Medika­ menteneinnahme täglich mehrmals um Luft. Ein An­ fall dauert von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden. Eine gefürchtete Komplikation ist der Sta­ tus asthmaticus, der lebensbedrohliche Asthmaanfall, der sich nicht mit Medikamenten durchbrechen lässt und über 24 Stunden und länger anhält. Dabei kann es dazu kommen, dass der Gasaustausch in der Lunge versagt und der Asthmapatient ungenügend mit Sau­ erstoff versorgt wird. Häufige Entzündungen in den Atemwegen können dazu führen, dass der Asthmati­ ker im Alter eine chronische Bronchitis und ein Lun­ genemphysem (Lungenüberblähung) entwickelt. 4 medizin aktuell Zwei Asthmaformen Die Medizin unterscheidet zwei Formen von Asthma: Beim allergischen Asthma sind die Auslöser bestimmte Stoffe wie Pflanzen­ pollen, Tierhaare, Staub oder Nahrungsmittel; häu­ fig liegt hier eine erbliche Veranlagung zu Grunde. Beim nicht-aller­gischen Asthma werden die Abwehrreaktionen im Körper nicht durch ein Asthma ist eine der Allergen, sondern durch einen anderen Aus­ löser hervorgerufen. Oft ist dies eine Infektion häufigsten chronischen der Atemwege, es können aber auch Medika­ Erkrankungen – mente, Stress, chemische Stoffe, Ozon, Rauch oder körperliche Belastung einen Asthmafall im Kindesalter sogar bewirken. In den meisten Fällen liegt bei den die häufigste. Patienten eine Mischform zwischen allergi­ schem und nicht-allergischem Asthma vor. Lungenfunktionstest Im Rahmen der Asthma-Dia­ gnose macht sich der Arzt einerseits ein genaues Bild von den Beschwerden, dies unter Berücksichtigung von früheren Erkrankungen, Allergien und Krankhei­ ten in der Familie, und er hört die Lungen ab. Zur Prüfung der Lungenfunktion wird ein Spirometer ein­ gesetzt: Dabei atmet der Patient in ein Messgerät, das die maximale Luftmenge erfasst, die ein Patient ein­ atmen kann sowie die Zeit, die er braucht, um die Luft wieder auszuatmen. Eine weitere Möglichkeit, die Lungenfunktion zu messen, ist die Peak-FlowMessung («stärkste Strömung»); dabei geht es darum herauszufinden, wie schnell und kraftvoll der Patient ausatmen kann. Diese Messung kann auch mit klei­ neren Geräten und zur Selbstkontrolle zu Hause er­ folgen, um den Verlauf des Asthmas zu kontrollieren. Ist der Lungenfunktionstest unauffällig, hilft ein Pro­ vokationstest weiter, die Diagnose zu sichern. Da­ bei wird eine Testsubstanz eingeatmet, welche die Bronchien verengt; Asthma-Patienten reagieren da­ rauf heftiger als Nicht-Betroffene. Ist das Asthma al­ lergisch bedingt, muss der Auslöser gesucht werden; dies geschieht durch Blutuntersuchungen und Haut­ tests. Beim sogenannten Prick-Test werden verschie­ dene Teststoffe unter die Haut gebracht; zeigen sich nach wenigen Minuten kleine Schwellungen oder Rö­ tungen auf der Haut, dann deutet das auf eine Aller­ gie gegen die betreffende Substanz hin. Darauf haben Asthmatiker im Winter zu achten Die Kälte zieht die Bronchien von Asthmatikern zu­ sammen, Viren, Bakterien oder Schadstoffe reizen die Bronchien zusätzlich. Mit einigen Verhaltensmass­ nahmen kann man sich aber gut schützen: •Erkältung und Unterkühlung vermeiden, sich re­ gelmässig an der frischen Luft bewegen und so die Lungen «trainieren», auf eine ausgewogene, vita­ minreiche Ernährung achten sowie auf einen gere­ gelten, harmonischen Tagesablauf • sich dem Wetter entsprechend warm anziehen • Nasenatmung wärmt die Atemluft vor und reizt die Atemwege dadurch weniger •Einnahme der verordneten Medikamente Mehrstufige Therapie Asthma lässt sich zwar nicht heilen, doch die heutigen Behandlungsmöglichkeiten sind sehr gut. Eine Behandlung besteht im Prinzip aus vier Säulen: Website: Lungenliga Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» • Medikamente, um die Beschwerden zu lindern und die Asthmaanfälle in den Griff zu bekommen. Die so­ genannten «Reliever» erweitern die Bronchien und werden bei einem Anfall sowie zur Vorbeugung von Atemnot bei Sport inhaliert. Sie haben keine entzün­ dungshemmende Wirkung und können auch die Häu­ figkeit, Stärke der Beschwerden nicht beeinflussen; das übernehmen die sogenannten «Controller» – Me­ dikamente, welche die ständige Entzündungsbereit­ schaft der Atemwege unterdrücken. Bei dauerhafter Anwendung bewirken diese Medikamente, zu denen auch topisch wirksame Corticosteroide gehören, ein Abschwellen der Bronchialschleimhaut, verringern die Schleimproduktion und hemmen die allergische Reaktion. Diese inhalativen Therapien sind sehr si­ cher und wirken nur in den Bronchien, also lokal. Somit sind Nebenwirkungen sehr selten, gelegent­ lich kommt es zu Heiserkeit und zu Trockenheit der Schleimhäute. Bei korrekter Anwendung lassen sich aber diese Nebenwirkungen kontrollieren. • Vermeiden von Asthma-Auslösern Sind die Auslö­ ser bekannt, sollten die Betroffenen diese so gut wie möglich meiden. Das gilt sowohl für Allergene wie auch für andere asthmaauslösende Reize wie kalte Luft, Nebel oder Staub. Atemwegsinfekte sollten so früh und effizient wie möglich therapiert werden. Bei einer Allergie gegen Pollen oder Hausstaubmilben kommt eventuell auch eine Hyposensibilisierung in Frage, bei der das Immunsystem langsam wieder an die entsprechenden Stoffe gewöhnt wird. • Asthmapatienten-Schulung Asthmapa­tienten müs­ sen sich darauf einstellen, dass die Krankheit sie ihr Leben lang begleitet. Deshalb sollten die Betroffenen lernen, wie sie den Alltag bewältigen können und vor allem, wie sie mit ihren Beschwerden umgehen. Dazu gehört die richtige Anwendung der jeweils ver­ ordneten Medikamente ebenso wie regelmässige Mes­ sungen mit dem Peak-Flow-Meter, die Einübung von Atem- und Entspannungstechniken sowie bestimm­ ter Körperhaltungen, um die Atmung während eines Asthmaanfalls zu erleichtern. • Kontrolle des Krankheitsverlaufs Wie für alle Chro­ nischkranken sind auch für Asthmapatienten regel­ mässige Arztbesuche und Lungenfunktionsprüfungen notwendig. So ist gewährleistet, dass die Therapie stets auf dem aktuellsten Stand und der eigenen Situ­ ation angepasst ist. Und zum Schluss: Die Lebenserwartung eines gut be­ handelten Asthmatikers entspricht derjenigen eines Gesunden. Auch Sporttreiben ist kein Problem, son­ dern empfehlenswert, denn körperliches Training ver­ bessert die Leistungsfähigkeit, stärkt die Atemmus­ keln und steigert die Ausdauer. Der Autor Urs Aebi, Dr. med. Facharzt FMH für Innere Medizin und Lungenkrankheiten Belegarzt der Privatklinik Linde AG Biel Praxis: Güterstrasse 27, 2502 Biel Tel. 032 323 61 60 [email protected] med izin ak tue l l 5 Koronare Herzkrankheit Herz in Gefahr Die koronare Herzkrankheit gehört in der Schweiz zu den häufigsten Herzerkrankungen; sie kann Angina pectoris verursachen oder gar zum Herzinfarkt führen. Eine der häufigsten Todesursachen bei Menschen ab 40 Jahren ist die sogenannte Koronare Herzkrank­ heit (KHK); sie ist für ungefähr einen Drittel aller To­ desfälle verantwortlich. KHK ist der Oberbegriff für Krankheitsbilder, bei der es infolge atherioskleroti­ scher Ablagerungen (Kalk, Fett und Cholesterin) zu einer fortschreitenden Verengung der Herzkranzge­ fässe (Koronararterien) kommt. Risikofaktoren Das Leitsymptom der KHK ist die Angina pectoris (Brustenge). Mit zunehmendem Fort­ schreiten der Erkrankung erhöht sich die Wahrschein­ lichkeit für das Auftreten von Begleiterscheinungen wie Herzrhythmusstörungen und Herz­schwäche sowie von lebensbedrohlichen Komplikationen wie Herz­ infarkt und plötzlicher Herztod. Die Krankheit ent­ wickelt sich meist schleichend, unbemerkt und über Jahre hinweg. Ob und wann sich bei einer Person eine KHK entwickelt, lässt sich schwer vorhersagen, doch es gibt Risikofaktoren, welche die Arteriosklerose und somit die KHK begünstigen. Zu den nicht-beeinflussba­ ren Risikofak­ toren zählen Nicht zuwarten: Alter, männliches Geschlecht Wer Risiken aufweist, und die fami­ liäre Disposi­ sollte sich untersuchen tion. Bei Männern nimmt die Krankheitshäufigkeit ab Al­ lassen, um Folge­ ter 45 zu, bei Frauen liegt schäden zu vermeiden. diese Grenze bei 55 Jahren. Zu den beeinflussbaren Ri­ sikofaktoren gehören: Blut­ hochdruck, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte (Choles­ terin), Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen – ein ungesunder Lebenswandel in jungen Jahren wirkt sich also im Alter oft aus. Schmerzen im Brustraum Eine KHK muss nicht in jedem Fall zu Symptomen führen, ein Herzinfarkt kann auch ohne jegliche Vorzeichen auftreten. Sind jedoch die Verengungen in den Blutbahnen so stark fortgeschritten, dass Herzmuskelabschnitte ungenü­ gend mit Blut und Sauerstoff versorgt werden, ruft dies in der Regel Beschwerden hervor. Unter körperli­ cher Belastung (allein Treppensteigen kann genügen), Stress oder bei Kälte (bewirkt ein Zusammenziehen der Gefässe) stellen sich anfallsartige Schmerzen in 6 medizin aktuell der Herzgegend ein, meistens verbunden mit einem Engegefühl im Brustraum und Atembeklemmungen (Angina pectoris). Gelegentlich strahlt der Schmerz in den linken Arm, in den Unterkiefer und die Schulter­ gegend aus oder ist begleitet von Luftnot, Angst und Schweissausbrüchen. Weil die Beschwerden teilweise so unterschiedlich sind, werden sie nicht selten als Zahn- oder Magenschmerzen missdeutet. Die Anfälle dauern meist zwischen Sekunden und 15 Minuten und lassen nach, wenn der Patient ruht und Medika­ mente einnimmt. Bei einem akuten Angina pectorisAnfall werden Nitroglycerinsprays oder -kapseln als Notfallmedikament eingesetzt; diese Substanz erwei­ tert die Herzkranzgefässe innerhalb von wenigen Mi­ nuten und lindert dadurch den Anfall. Herzinfarkt Die schwerste Komplikation der KHK ist der Herzinfarkt als Folge des plötzlichen Verschlus­ ses eines Herzkranzgefässes durch ein Blutgerinnsel. Der Teil des betroffenen, unterversorgten Herzmus­ kels stirbt infolge Sauerstoffmangels unwiderruflich ab, wenn es nicht innerhalb von drei bis höchstens sechs Stunden gelingt, das Gefäss wieder durchgän­ gig zu machen. Ein Herzinfarkt ist ein lebensbedroh­ licher Notfall, der die sofortige Spitaleinweisung er­ forderlich macht. Je rascher der Patient spitalärztlich versorgt werden kann, der Blutpfropfen geortet, die betroffenen Arterien und Gefässe behandelt wer­ den, umso besser die Überlebenschancen und umso niedriger die Wahrscheinlichkeit für bleibende Schä­ den. Zu den geeigneten Sofortmassnahmen gehören vor allem­die Ballondilatation und die Thrombolyse (medi­kamentöse Auflösung eines Blutpfropfens). Die für einen akuten Herzinfarkt typischen Symptome sind: • länger als fünf Minuten anhaltende heftige Schmer­ zen oder starker Druck in der Brust, ausstrahlend in Schulter, Arm, Unterkiefer oder Oberbauch • stärkere Schmerzen als bei der Angina pectoris, die sich nicht durch die Einnahme von Nitroglycerin­ spray bessern • Unruhegefühl bis hin zu Todesangst, Blässe, kalter Schweiss, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen EKG Eine bestehende KHK sollte möglichst früh fest­ gestellt werden, um Folgeschäden (Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Infarkt, Herzstillstand) zu vermeiden. In einigen Fällen kann der Arzt allein aus der Beschreibung der Symptome eine KHK diag­ nostizieren. Um sich ein differenziertes Bild über den Zustand der Herzkranzarterien, das Ausmass der Er­ krankung und die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels machen zu können, gelangen verschiedene Untersu­ chungsmethoden zur Anwendung. Das Ruhe-Elek­ trokardiogramm (EKG) stellt die elektrischen Ströme des Herzens dar. Der nächste Schritt in der Diagnos­ tik ist das Belastungs-EKG, welches meist mit einem Fahrradergometer aufgezeichnet wird. Liegt eine KHK vor, entwickelt sich unter körperlicher Anstrengung ein Sauerstoffmangel im Herzmuskel, der im EKG sichtbar wird. Vorhandene, aber noch nicht Kompli­ kationen verursachende Rhythmusstörungen des Her­ zens lassen sich mit einem Langzeit-EKG überprüfen (24-Stunden-Aufzeichnung der Herzströme). Website: Schweizerische Herzstiftung Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» Ein wichtiges nicht-invasives bildgebendes Diagnose­ verfahren ist die Ultraschalluntersuchung des Her­ zens, die Echokardiographie. Sie ermöglicht es, Grös­se und Funktion der Herzkammern zu erkennen, ist aber nicht geeignet, Herzkranzgefässe und eventuelle Ver­ änderungen direkt abzubilden. Dies ermöglicht ein weiteres nicht-invasives Verfahren, die Koronar-CTAngiographie, die Computertomographie des Herzens: Anhand dieser dreidimensionalen Querschnitt- oder Schichtaufnahmen lassen sich Herz und Herzkranzar­ terien innerhalb weniger Sekunden a­ bbilden. Untersuchung mit Herzkatheter Wenn der Ver­ dacht auf eine KHK durch andere Untersuchungen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, ist eine sogenannte Koronarangiographie angezeigt. Sie gilt nach wie vor als Goldstandard, um Verengungen der Herzkranzgefässe festzustellen. Von der Leiste aus wird ein Katheter bis zur verengten Stelle im Herz­ kranzgefäss vorgeschoben. Um die Blutgefässe er­ kennbar zu machen, wird über den Katheter Rönt­ genkontrastmittel eingespritzt. Der Vorteil dieser Untersuchung liegt darin, dass gleichzeitig eventuelle Behandlungen durchgeführt werden können, wie bei­ spielsweise eine Ballonerweiterung (Ballondilatation) oder eine Stent­implantation. Die Angiographie ist mit geringen Risiken verbunden und führt nur selten zu Komplikationen. Dennoch ist diese Untersuchungs­ methode idealerweise nur angezeigt, wenn die Wahr­ scheinlichkeit therapeutischer Konsequenzen gross ist. Der Eingriff dauert eine bis zwei Stunden, danach wird der Patient überwacht; in der Regel kann er das Spital am nächsten Tag verlassen. Medikamente In vielen Fällen steht am Anfang der Behandlung einer KHK eine Veränderung des Lebens­ stils und die medikamentöse Behandlung. Ziel ist es, mit Medikamenten die erwähnten Risikokrankheiten zu therapieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Sauerstoffbedarf des Herzens eingeschränkt wird, um einem weiteren Angina pectoris-Anfall vorzubeu­ gen. Dabei stehen unter anderem Betarezeptorenblo­ cker, Nitrate, Kalzium-Antagonisten und ACE-Hem­ mer zur Verfügung. Bei Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit wird eine Langzeittherapie mit einem gerinnungshemmenden Medikament durchgeführt. So sollen Thrombosen in den Herzkranzgefässen ver­ hindert werden. Minimal-invasiv Sind die Beschwerden durch Me­ dikamente nicht ausreichend kontrollierbar, müssen zusätzlich chirurgische Verfahren angewandt werden. Bei Patienten, deren Herzkranzgefässe nur einzelne, kleinere Verengungen aufweisen, kann eine Ballon­ katheterdilatation durchgeführt werden, um die Ge­ fässe zu dehnen und die Durchblutung wiederher­ zustellen. Wie bei der Koronarangiographie wird ein feiner Schlauch (Herzkatheter) mit zusammengefal­ tetem Ballon von der Leiste bis zur verengten Stelle in den Koronargefässen vorgeschoben; dort wird der Ballon aufgeblasen, um die Stelle auszudehnen. Da­ mit sich diese Stelle nicht wieder verengt, kann ein Stent eingesetzt werden. Dieses feine röhrenförmige Metallgitter dient als Gefässstütze. Invasiv Bei Patienten, bei denen bereits ausgedehnte atherosklerotische Verengungen vorliegen, besteht die einzige Behandlungsmöglichkeit in der Bypass­ operation. Dabei werden die verengten Gefässe mit einem Stück eines anderen Blutgefässes des Patien­ ten überbrückt. Als Bypassmaterial stehen grundsätz­ lich Brustwand- und Unterarmarterien sowie Venen aus den Ober- und Unterschenkeln zur Verfügung. Seltener werden auch Arterien aus dem Bauchraum verwendet. So erhält der zu versorgende Herzbereich trotz Verengung ausreichend Blut und Sauerstoff. Die med izin ak tue l l 7 Bypass-Operation wird unter Vollnarkose vorgenom­ men. Üblicherweise wird das Brustbein längs durch­ trennt. Dadurch können alle Abschnitte des Herzens am besten erreicht werden. Je nach Situation kön­ nen die Bypässe mit einer speziellen Operationstech­ nik weniger invasiv, ohne Einsatz der Herz-LungenMaschine, am schlagenden Herzen angelegt werden. Dieses schonende Operationsverfahren kann von er­ fahrenen Operateuren an allen wichtigen Herzkranz­ gefässen eingesetzt werden und ist daher schon zum Routine-Verfahren geworden. In Einzelfällen ist es auch möglich, eine minimal-invasive Operationstech­ nik durch einen kleinen Schnitt zwischen den links­ seitigen Rippen einzusetzen; dies ist für den Patienten deutlich schonender. Reizung des Herzbeutels bei der Operation entstehen. Blutgerinnsel, die sich an den Gefässwänden abge­ lagert haben, können sich lösen, mit dem Blutstrom fortgeschwemmt werden und an anderer Stelle eine Arterie verstopfen. Gelangt die Ablagerung bis in das Gehirn, kann es in seltenen Fällen zum Schlaganfall kommen. Die Operation dauert in der Regel zwei bis vier Stunden, anschliessend wird der Patient einen bis drei Tage auf der Intensivstation überwacht. Es folgt ein Spitalaufenthalt von einer bis zwei Wochen und eine Erholungszeit von mehreren Wochen. Komplikationen Wie jeder Eingriff im geöffneten Brustraum ist auch die Bypass-Operation nicht risiko­ frei. Die häufigsten Komplikationen sind Wundinfek­ tionen; diese sind trotz steriler Bedingungen im Ope­ rationssaal und vorbeugender Antibiotikagabe nicht immer vermeidbar. Bei Nachblutungen an den Naht­ stellen des Bypasses strömt Blut in den Spalt zwischen Herz und umliegendem Gewebe (Herzbeutel) und be­ hindert so die Pumpfunktion des Herzens. Bei dieser Komplikation ist eine Notfall-Operation nötig. Eine Herzbeutel-Entzündung (Perikarditis) kann durch die Der Autor Alex Thommen, Dr. med. Facharzt FMH für Kardiologie und für Innere Medizin Belegarzt der Privatklinik Linde AG Praxis: Ärztezentrum Localmed AG Bahnhofplatz 2, 2502 Biel Tel. 032 323 80 88 [email protected] WO FÜSSE FLIEGEN LERNEN ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK: Orthopädische Schuheinlagen Orthopädische Massschuhe Schuhkorrekturen Fussorthesen/Prothesen Bequem- und Spezialschuhe Bandagen/Kompressionstherapie Reparaturen Hermes GmbH | Bielstrasse 21 | 3250 Lyss Telefon 032 384 64 20 | www.hermes-lyss.ch 8 medizin aktuell Hyperhidrose In Strömen schwitzen Bei Hitze und körperlicher Anstrengung ist Schwitzen normal. Doch wer extrem stark und auch im Ruhezustand schwitzt, könnte an Hyperhidrose leiden. Davon Betroffene fühlen sich im Alltag massiv beeinträchtigt, manche getrauen sich gar nicht mehr in die Gesellschaft. Etwa vier Millionen Schweissdrüsen sondern bei Wärme oder körperlicher Aktivität pro Stunde zwi­ schen 100 Millilitern und zwei Litern Schweiss ab, kühlen so die Haut und beugen damit der Überhit­ zung vor. Schwitzen stellt eine Grundfunktion des ve­ getativen Nervensystems dar. Manche Menschen aber schwitzen deutlich stärker, unabhängig von Tempe­ ratur oder körperlicher Anstrengung. Von Hyperhi­ drose (übermässiger Schweissbildung) spricht man dann, wenn die Schweissabsonderung das zur nor­ malen Wärmeregulation erforderliche Mass über­ steigt. Ein bis drei Prozent der Bevölkerung leiden daran, schätzungsweise 300 000 Menschen, Männer tendenziell leicht häufiger als Frauen. Betroffen sind meist bestimmte Körperstellen, Die Grenze zwischen­ in der Regel Hände, Füsse oder Achselhöhlen, normalem und manchmal auch das Gesicht. Bei Hyperhid­ ­krankhaftem Schwitzen rose-Patienten ist die Steuerung des vegetati­ ven Nervensystems aus dem Lot geraten. Die verläuft fliessend. genauen Ursachen sind nicht bekannt, doch spielen emotionale Empfindungen wie Angst, Unwohlsein, Schmerzen oder Stress eine grosse Rolle – und damit beginnt für viele Betroffene ein Teufelskreis: Die Angst vor Situationen, die einem schwitzen lassen, regt die Schweissdrüsen an. Individueller Leidensdruck Die Grenzen zwischen normalem und krankhaftem Schwitzen werden un­ terschiedlich wahrgenommen. Besteht aber ein Lei­ densdruck, dann sollten die Betroffenen einen Arzt konsultieren. Es geht dabei auch darum, eine all­ fällige Grunderkrankung (metabolischer, infektiöser oder neurologischer Art) auszuschliessen. Für die Di­ agnose reicht in der Regel das Gespräch mit dem Pa­ tienten, bei Bedarf werden ergänzende Abklärungen und Analysen durchgeführt. Mehrstufige Therapie Die Behandlung richtet sich danach, an welcher Stelle die Schweissbildung auf­ tritt. Als ersten Behandlungsschritt bei einer soge­ nannten axillären Hyperhidrose (im Achselbereich) verschreibt der Arzt in der Regel Deodorantien oder aluminiumhaltige Antitranspirantien. Diese bewirken einen Verschluss der Schweissdrüsenausgänge und werden am Abend aufgetragen, um über Nacht ein­ wirken zu können. Zusätzlich gibt es Medikamente (Anticholinergika), welche die Aktivität jener Nerven, die für die Anregung der Schweissdrüsen sorgen, re­ gulieren. Eine weitere Behandlungsart, vor allem bei schwitzenden Händen und Füssen geeignet, ist die Iontophorese: Dabei werden die Hände oder Füsse in einer Wanne mit Wasser eingetaucht, durch die ein schwacher Gleichstrom geleitet wird. Botulinumtoxin Botulinumtoxin ist eine Substanz,­ welche jene Nervensignale blockiert, die die Schweiss­ drüsen regulieren. Insbesondere bei starkem Schwit­ zen in den Achselhöhlen lassen sich mit diesem Mittel ausgezeichnete Resultate erzielen. Vor Behandlungs­ beginn führt der Arzt einen sogenannten Iod-Stärke­ test durch, mittels dessen er die Hyperhidrose visuell darstellen und den zu behandelnden Bereich genau bestimmen kann. Anschliessend wird das Botulinum­ toxin in stark verdünnter Form und mit mehreren In­ jektionen, die sich wie Mückenstiche anfühlen, unter die Haut der betroffenen Körperstelle gespritzt. Die Wirkung der Behandlung kann bis zu einem Jahr an­ halten. Chirurgie Erst wenn alle Behandlungsmöglichkei­ ten ausgeschöpft sind, wird der Arzt zu chirurgi­ schen Massnahmen raten. Dabei stehen unterschied­ liche Verfahren zur Auswahl: die Entfernung der Schweissdrüsen im Bereich der Achselhöhlen mit­ tels Kürettage (Abschabung), Operation oder (in Aus­ nahmefällen) Durchtrennung zentraler Nervenfasern (Sympathektomie), welche für die Stimulierung der Schweissdrüsen sorgen. Der Autor Eugen Hübscher, Dr. med. Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie Praxis: Dermatologie Hübscher Dufourstrasse 17, 2502 Biel Tel. 032 322 53 22 [email protected] www.dermatologie-huebscher.ch med izin ak tue l l 9 Gallensteine Steinchen, die es in sich haben Es gibt Menschen, die ein Leben lang nichts von ihren Gallensteinen spüren. Bei anderen dagegen kann es zu Beschwerden oder gar heftigen Schmerzattacken, Koliken kommen. Die Gallenblase ist zwar kein lebenswichtiges Organ, hat aber dennoch eine massgebliche Funktion bei der Fettverdauung. Sie ist ein birnenförmiges Organ, be­ findet sich an der Unterfläche der Leber und dient als «Zwischenlager» für die Gallenflüssigkeit (Galle), welche für die Verdauung benötigt wird. Es gibt ver­ schiedene Erkrankungen der Gallenblase und der Gal­ lenwege, die wohl häufigste und bekannteste sind die Gallensteine. Bei Gallensteinen handelt es sich nicht um Steine im herkömmlichen Sinn, sondern um kör­ pereigene Bestandteile. Sie bestehen aus festen Abla­ gerungen der Gallenflüssigkeit und entstehen durch ein Ungleichgewicht der löslichen Stoffe in der Galle. Je nachdem, welche Stoffe im Ungleichgewicht ste­ hen (Lezithin, Bilirubin, Kalzium, Karbonat, Choleste­ rin), können Steine in unterschiedlicher Form, Farbe und Grösse (Sandkorn bis Kie­ selstein) in der Gallenblase oder ganz selten im Gallgengang Drei von vier ­ entstehen. Häufiger wandern Menschen mit GallenSteine aber aus der Gallenblase steinen haben keine in den Gallengang. Dort kön­ nen sie zum Hindernis für die Beschwerden. Gallenflüssigkeit werden und ernsthafte Folgen für die Ge­ sundheit haben. •gleichbleibend drückende Schmerzattacken mit ei­ ner Dauer von 15 Minuten bis zu 5 Stunden (soge­ nannte Gallenkoliken) •Schmerzen im rechten Oberbauch mit Ausstrahlung in den Rücken und die rechte Schulter •Schmerzen und Beschwerden, die bei oder nach dem Essen auftreten •eventuell auch Übelkeit und Erbrechen •Fieber und Schüttelfrost •Unverträglichkeit von bestimmten Nahrungsmitteln wie fettreiche Speisen, hartgekochte Eier, blähende Lebensmittel Besonders typische Beschwerden sind die Schmerz­ attacken, Übelkeit und Verdauungsstörungen tre­ ten auch bei anderen Erkrankungen auf. Wenn zu­ sätzlich zu den genannten Beschwerden noch eine Gelbfärbung der Haut und der Lederhaut der Au­ gen (das Weisse in den Augen) sowie ein bierbrauner Urin feststellbar sind, sitzt der Gallenstein mit höchs­ ter Wahrscheinlichkeit im Gallengang und verstopft den Gallenabluss. Dadurch staut dieses Sekret, was zu Entzündungen der Gallenblase, der Gallenwege oder Bauchspeicheldrüse, zu Gelbsucht und schweren Le­ berschäden führen kann. Die beschriebenen Schmerzzustände, eine Gelbver­ färbung der Haut und vor allem Fieber sollten die dass etwa jede fünfte Frau und jeder zehnte Mann Betroffenen veranlassen, sofort einen Arzt aufzusu­ über 40 Jahren Gallensteine hat. Bei über 75-Jährigen chen – auch wenn die Schmerzen von alleine ab­ kommen sie sogar noch häufiger vor. Diese Zahlen­ klingen. Wer ein Schmerzmittel geschluckt hat, um zeigen, dass sich im weiblichen Körper eher Gallen­ die Schmerzen zu betäuben, darf das Verschwinden steine bilden. Man nimmt an, dass das weibliche der Schmerzen ebenfalls nicht auf die leichte Schul­ Sexual­hormon Östrogen einen Risikofaktor für eine ter nehmen und sollte besser zum Hausarzt gehen. Gallensteinentstehung darstellt. Untersuchungen zei­ Eine Bösartigkeit der Krankheit ist derweil in der Re­ gen, dass die zusätzliche Zufuhr von Östrogen (Anti­ gel nicht zu befürchten. baby-Pille, Hormontherapie) das Risiko noch weiter erhöht. Auch Übergewicht, Diabetes oder schwere Diagnose beim Hausarzt Der Bericht über Dauer Lebererkrankungen begünstigen die Entwicklung und Art der Schmerzen, eine körperliche Untersu­ von Gallensteinen. Es gibt Menschen mit Gallenstei­ chung sowie das Erfragen der Risikofaktoren wird nen, die über Jahre hinweg beschwerdefrei leben. Es den behandelnden Arzt früh auf ein Gallensteinlei­ kommt sogar vor, dass sie niemals etwas von deren den hinweisen. Weitere Abklärungen (Laboranaly­ Existenz merken. Im Allgemeinen leidet lediglich ein sen, Ultralschalluntersuchungen) folgen und dienen Viertel der Patienten unter den typischen Sympto­ dazu, andere Erkrankungen sicher auszuschliessen men, drei Viertel haben keine Beschwerden. Typische und Sicherheit zu verschaffen, dass nicht andere Or­ Krankheitsan­zeichen sind: gane betroffen sind. Die Ultraschalluntersuchung ist Wer ist betroffen? Man kann davon ausgehen, 10 medizin aktuell Leber Magen Vorbeugende Massnahmen Gallenblase Bauchspeichel­ drüse (Pankreas) Gallengänge Hauptgallengang Pankreasgang Papille Dünndarm ein sicheres und für die Patienten sehr schonendes Verfahren. Dabei werden Gallensteine, Gallenwege, Gallenblase sowie Leber und meist auch die Bauch­ speicheldrüse dargestellt. Der Arzt erkennt, ob die Gallenblase in Form, Grösse und Wandbeschaffenheit verändert ist, ob Steine vorliegen und ob ein Gallen­ stau besteht. Die endoskopische Untersuchung wird vor allem bei konkretem Verdacht auf Steine im Gallengang durch­ geführt. Ein Endoskop ist ein schlauchartiges Gerät, bei dem man über eine eingebaute Videokamera di­ rekt in das Innere des Verdauungstraktes sehen kann. Dieses Gerät wird vom Arzt durch Mund, Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm bis vor die Mündung des Gallengangs gelenkt. Dann wird über einen Katheter ein Kontrastmittel eingebracht. Mittels Röntgenauf­ nahmen macht der Arzt schliesslich den Gallengang sichtbar. Gleichzeitig kann, wenn Gallensteine gefun­ den werden, der Mündungsbereich des Gallengangs in den Zwölffingerdarm mit einem Schnitt erweitert werden, um die Steine zu entfernen. Vor dem Eingriff erhält der Patient ein einschläferndes Medikament oder eine Vollnarkose, im Anschluss bleibt er solange in der Klinik oder beim Arzt, bis die Nachwirkungen der Narkose nachgelassen haben. Therapie Die Behandlung richtet sich danach, ob die Gallensteine in der Gallenblase oder im Gallen­ gang liegen, der Patient Beschwerden hat und ob Gallengang oder Gallenblase bereits entzündet sind. Bei Gallenkoliken werden in der Regel zunächst ein Schmerzmittel und ein die Gallenwege entspannendes Medikament abgegeben. Nach einer Gallenkolik soll­ ten die Patienten 24 Stunden keine Nahrung zu sich nehmen und sich anschliessend gesund ernähren. Auf lange Sicht ist es sinnvoll, die Gallenblase zu entfer­ nen (Cholezystektomie), wenn die Gallensteine immer wieder Schmerzattacken verursachen. Dadurch kön­ nen auch Komplikationen, wie zum Beispiel eine Gal­ lenblasenentzündung, verhindert werden. Wie bereits erwähnt, dient die Gallenblase als Vorratsbehälter für die Gallenflüssigkeit, sodass die Entfernung der Gal­ lenblase unproblematisch ist. Dies geschieht meist la­ paroskopisch, also mittels Schlüssellochchirurgie, nur selten ist eine offene Operation notwendig. Bei einer Niemand ist vollständig gegen Gallensteinen gefeit. Eine gesunde, ballaststoffreiche und fettreduzierte Er­ nährung ist sinnvoll. Des Weiteren ist auf das Gewicht zu achten – Übergewicht begünstigt die Entstehung von Gallensteinen. Und Patienten mit Stoffwechsel­ krankheiten (beispielsweise Diabetes) müssen optimal eingestellt sein. durch Steine ausgelösten Entzündung der Gallenblase ist die Entfernung der Gallensteine und der Gallen­ blase ebenfalls die beste Behandlung. In der Regel bekommen die Betroffenen begleitend ein Antibio­ tikum verordnet. Wird die Entzündung ausschliess­ lich mit Medikamenten behandelt, so kommt es mit grosser Wahrscheinlichkeit erneut zu Entzündungen. Bei Steinen im Gallengang werden diese endosko­ pisch entfernt. Eine spätere Gallenblasenentfernung ist sinnvoll, damit nicht wieder dieselben Probleme auftreten. Medikamente Die Möglichkeit der medikamentö­ sen Auflösung der Gallensteine und die Zertrümme­ rung durch Stosswellen kommen nur für einen klei­ nen Teil der Patienten in Frage und nur, wenn die Steine einzeln vorkommen, nicht verkalkt und grös­ ser als zwei Zentimeter sind. Die Gallenblase muss zudem voll funktionsfähig sein. Je nach Steingrösse, Typ und Menge ist mit einer Therapiedauer von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu rechnen. Das Risiko, innerhalb von fünf Jahren erneut Gallensteine zu ent­ wickeln, ist erheblich erhöht. Erfolgsaussichten Die Chancen auf Heilung und ­ eschwerdefreiheit sind nach Entfernung der Gallen­ B blase sehr gut. Insbesondere nach der laparoskopi­ schen Operation ist frühzeitig mit der Wiederherstel­ lung der Arbeitsfähigkeit zu rechnen. Diese Methode hat im Vergleich zur offenen Operation den Vorteil einer schnelleren Erholung und eines kürzeren Kli­ nikaufenthaltes. Auf lange Sicht kann sich aus einer chronisch entzündeten Gallenblase ein bösartiger Tu­ mor entwickeln. Insgesamt ist das Krebsrisiko bei Gal­ lensteinpatienten aber extrem gering (ein Prozent). Die Autorin Monika Richter, Dr. med. Fachärztin FMH für Chirurgie Belegärztin der Privatklinik Linde AG Praxis: Rebenweg 34, 2503 Biel Tel. 032 365 2705 [email protected] med izin ak tue l l 11 Gebärmutterhalskrebs Spritze gegen den Krebs Dem Gebärmutterhalskrebs liegt oft eine Infektion mit humanen Papillomaviren zugrunde. Mit einer Impfung im Mädchenalter kann man sich gegen die gefährlichsten Arten der Viren schützen. Genitalinfektionen mit humanen Papillomaviren (HPV) gehören mit jährlich rund 30 Millionen Neu­ infektionen weltweit zu den häufigsten sexuell über­ tragbaren Infektionen; 70 bis 80 Prozent der sexuell aktiven Männer und Frauen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit den Viren. HPV-Infektionen wer­ den am häufigsten bei jungen Frauen festgestellt, vor allem im Alter zwischen 18 und 28 Jahren. Bei den 12- bis 14-jährigen Mädchen sind 2 Prozent mit HPV infiziert, bei den 16- bis 25-jährigen Frauen sind es bereits 14 bis 16 Prozent. In den meisten Fällen verläuft die Infektion unbemerkt, und das Immunsystem bekämpft die Die regelmässige Krankheitserreger innerhalb kur­ ­Untersuchung beim zer Zeit. Die Betroffenen wissen Frauenarzt hilft, oft gar nicht, dass sie Virusträ­ ger sind oder es einmal waren. den Krebs früh zu Manchmal überleben die Viren erkennen. jedoch, nisten sich anhaltend in den Zellen der Haut oder der genitalen Schleimhaut ein und können über Jahre zu unkontrolliertem, tumorarti­ gem Wachstum führen. Die Häufigkeit der HPV-In­ fektionen steigt mit der Anzahl der Sexualpartner. Das Infektionsrisiko ist zu Beginn der sexuellen Ak­ tivität am höchsten. Senken lässt es sich mit einer guten Intimhygiene und teilweise mit dem Gebrauch von Kondomen, doch anders als beim HIV bieten Kondome gegen HP-Viren nicht ausreichend Schutz. Unterschiedliches Risiko Es gibt rund 100 ver­ schiedene HPV-Typen. Solche mit niedrigem Risiko zeigen sich, falls Symptome auftreten, als Hautver­ änderungen in Form von Warzen (Kondylome). Diese treten am äusseren Genitale sowie im Innern der Va­ gina oder im After auf und sind manchmal nur bei einer gezielten ärztlichen Untersuchung zu erkennen. Der Arzt behandelt sie medikamentös oder chirur­ gisch; leider treten bei bis zu 30 Prozent der Patien­ tinnen Rezidive auf, das heisst, die Warzen kommen wieder. Hochrisiko-Typen von HPV hingegen kön­ nen verschiedene Krebsvorstufen und -erkrankungen, unter anderem Gebärmutterhalskrebs, auslösen. Die zwei häufigsten krebserregenden HPV sind die Typen 12 medizin aktuell HPV 16 und HPV 18. Sie sind für rund 70 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Die­ ser Krebs, auch Zervixkarzinom genannt, entwickelt sich an der Stelle, wo die Gebärmutter in die Scheide hineinragt (Muttermund). In fortgeschrittenen Sta­ dien dringt der Krebs in angrenzende Organe ein oder er kann in weiter entfernten Organen Ableger bilden. Lange beschwerdefrei Das Zervixkarzinom berei­ tet in den meisten Fällen lange kaum Beschwerden. Erste Anzeichen können untypische Blutungen aus der Scheide sein, zum Beispiel nach dem Geschlechts­ verkehr. Zur Diagnose wird ein Abstrich («Pap-Test») vom Gebärmutterhals gemacht: Dabei werden Zellen vom Muttermund und Gebärmutterhals entnommen und im Labor auf krankhafte Veränderungen unter­ sucht. So lassen sich bereits Krebsvorstufen erken­ nen. Befindet sich der Krebs noch in einem Vorsta­ dium, wird «nur» der befallene Teil der Gebärmutter operativ entfernt (Kegeloperation – Konisation). Ist die Dia­gnose Krebs gesichert, muss fast immer die ganze Gebärmutter entnommen werden, Schwanger­ schaften sind dadurch nicht mehr möglich. Je nach Ausbreitung wird eine Strahlen- und/oder Chemo­ therapie nötig. Pro Jahr werden in der Schweiz rund 240 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs und etwa 5000 Krebsvorstufen diagnostiziert, etwa 90 Frauen sterben daran. Gebärmutterhalskrebs ist bei Frauen unter 50 Jahren die vierthäufigste Krebsart. Die grosse Chance im Kampf gegen den Gebärmut­ terhalskrebs ist sein langsames Wachstum; der Krebs braucht Jahre, manchmal gar Jahrzehnte, um sich auszudehnen. Die regelmässige Untersuchung beim Frauenarzt hilft, die Frühstadien oder Vorstufen des Krebses zu entdecken und rechtzeitig zu entfernen. Der erwähnte «Pap-Test», in der Schweiz seit den 70er-Jahren etabliert, ist die am weitesten verbreitete Methode zur Früherkennung. Er wird in der Schweiz bei unauffälligem Befund alle drei Jahre empfohlen (und von den Krankenkassen vergütet). Je nach Be­ fund und Ermessen des behandelnden Arztes kön­ nen weitere Untersuchungen angeschlossen werden. Durch diese Früherkennungsmassnahme ist die Häu­ figkeit des Leidens in westlichen Ländern um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Website: Bundesamt für Gesundheit zu HPV Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» Prävention Seit einigen Jahren gibt es zwei Impf­ stoffe gegen HPV. Der Impfstoff Gardasil® schützt vor einer Ansteckung mit den HP-Viren 6 und 11 (können Haut- und Genitalwarzen auslösen; NiedrigrisikoHPV-Typen sowie 16 und 18 Hochrisiko-HPV-Typen für Krebs). Cervarix® schützt vor einer Ansteckung mit den HP-Viren 16 und 18. Dank einer Impfung sinkt das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkran­ ken, deutlich – ganz eliminieren lässt es sich nicht. Am sinnvollsten ist die Impfung bei Mädchen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. In der Schweiz empfehlen Impfexperten, möglichst alle Mädchen im Alter von etwa 11 bis 14 Jahren zu impfen. In diesem Alter sind bei 99 Prozent der ge­ impften Mädchen Antikörper gegen HPV nachweis­ bar, was einer sehr hohen Wirksamkeit entspricht. Bei Frauen, die im Alter zwischen 15 und 26 geimpft werden, beträgt der Impfschutz 98 Prozent, solange sie sich nicht vorher infiziert haben. Wie lange der Impfschutz anhält, ist nicht geklärt, da noch keine Langzeitstudien vorliegen. Man nimmt aber an, dass der Schutz mindestens zehn Jahre, eventuell sogar le­ benslang, anhält. Die Impfung hat nach bisherigem Erkenntnisstand nur geringe Nebenwirkungen (lo­ kale Rötung oder Schwellung an der Impfstelle, ganz selten Fieber, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-­ Entzündung). Vorbeugende Impfung Im September 2008 hat der Bund kantonale Impfpro­ gramme gegen HPV eingeführt, Mädchen zwischen 11 und 19 Jahren können sich kostenlos impfen las­ sen. Seit dem Jahr 2011 steht auch Frauen von 20 bis 26 Jahren eine kostenlose Impfmöglichkeit zur Verfügung. Bei einer hohen Durchimpfung lassen sich mit der HPV-Impfung jedes Jahr rund 160 Fälle von Gebärmutterhalskrebs und 50 Todesfälle sowie rund 2000 chirurgische Eingriffe wegen Krebsvorstu­ fen verhindern. Die Impfung wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie von der eidgenössischen Kommission für Impffragen empfohlen. Für einen dauerhaften Schutz gegen Gebärmutter­ halskrebs sind bei Mädchen vor dem 15. Altersjahr zwei, nach dem 15. Altersjahr drei Injektionen not­ wendig. Auch für Frauen, die älter als 26 Jahre sind, kann eine Impfung sinnvoll sein. Dies muss jedoch vom Arzt individuell entschieden werden, und die Frau muss die Kosten selbst tragen. Am sinnvolls­ ten ist die Impfung vor Beginn der sexuellen Aktivi­ tät. Vier Jahre nach dem Start des Programms zeigt sich allerdings, dass zwar eine Impfung heute rund fünf Mal weniger kostet als zu Beginn, leider aber die Durchimpfrate deutlich unter den Erwartungen liegt. Kein 100%-Schutz Die HPV-Impfung ist keine Impfung gegen Krebs, sondern schützt nur vor der Ansteckung mit den oben genannten Krankheitser­ regern. Und sie schützt auch nicht vor anderen HPVTypen, die ebenfalls Krebs auslösen können. Deshalb kann auch eine Frau, die geimpft ist, an Gebärmut­ terhalskrebs erkranken. Hat sich hingegen eine Frau bereits vor der Impfung mit einem der vier HPV-Ty­ pen angesteckt, so ist die Impfung vermutlich wir­ kungslos. Da die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs darstellt, müssen auch geimpfte Frauen regelmässig an den empfoh­ lenen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Die Imp­ fung bewirkt übrigens auch bei Knaben die Bildung von Antikörpern gegen die vier HPV-Typen, in der Schweiz werden die Impfstoffe jedoch für Knaben und Männer nicht durch die Krankenkassen vergütet. Die Autorin Marion Beer, Dr. med. Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe Belegärztin der Privatklinik Linde AG Praxis: Dufourstrasse 17, 2502 Biel Tel. 032 323 05 85 [email protected] med izin ak tue l l 13 Chiropraktik Arthrose soll Rheuma sein? Ja! Unter den Begriff «Rheuma» fallen Erkrankungen wie Arthrose, Diskushernie, Tennisellbogen, Gicht, Arthritis. Und alle verursachen sie Schmerzen und schränken die Bewegung ein. Doch manche der Beschwerden lassen sich mit den Mitteln der Chiropraktik gut behandeln. Jeder fünfte Einwohner leidet unter rheumatischen Beschwerden, etwa 300 000 davon leben mit schwe­ ren, oft chronischen Rheumaformen, die mit einer Behinderung oder gar Pflegebedürftigkeit einherge­ hen können. Rheuma kann jeden treffen, nicht nur alte Menschen, sondern auch junge und sogar Kinder. Doch «Rheuma» ist weder eine Diag­ Oft bewirkt der nose noch eine spezielle Krank­ heit, sondern ein Oberbegriff ­Chiropraktor für über 200 unterschiedliche Schmerzlinderung, Krankheitsbilder. Es können ohne Medikamente. Gelenke, Wirbel, Knorpel, Ge­ lenkinnenhaut, Sehnen, Mus­ keln und Nerven betroffen sein. Die Medizin unterscheidet vier Hauptgruppen rheu­ matischer Beschwerden: • Abnützungsbedingt: Am häufigsten sind die abnüt­ zungsbedingten (degenerativen) Gelenk- und Wir­ belsäulenerkrankungen, zu denen die Arthrose und Bandscheibenschäden (wie Diskushernie) zählen. In diese Kategorie gehört auch die Abnützung infolge natürlicher Alterung. Erkrankungen manifestieren sich zum Beispiel durch schmerzende Glieder beim Aufstehen, Hexenschuss, durch blockierte Wirbelseg­ mente verursachte Kopfschmerzen oder Halskehren. • Weichteil-Rheumatimus: Fast jeder Mensch ist ir­ gendwann in seinem Leben von Weichteil-Rheuma­ tismus betroffen. Befallen werden Sehnen, Bindege­ webe und Muskeln. Grund für das Auftreten ist häufig eine Muskel-Überbelastung und Sehnenreizung. Auch psychische Spannungszustände können zu körper­ lichen Symptomen führen. Typische Krankheitsbilder dieser Gruppe sind «Tennisellbogen», Rückenschmer­ zen durch Fehlhaltung oder Fibromyalgie. • Entzündlich-rheumatisch: Was im Volksmund als «Rheuma» bezeichnet wird, umfasst meist die Gruppe der entzündlich-rheuma­ tischen Erkrankungen. Be­ troffene fühlen sich allgemein krank und in ihrer Leistung eingeschränkt, der entzünd­liche Prozess ist meist anhand der Entzündungswerte im Blut nach­ weisbar. Zu den entzündlich-rheumatischen Erkran­ 14 medizin aktuell kungen gehören beispielsweise die rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew (entzündliche Wirbel­ säulenerkrankung) oder die Zecken-Borreliose. • Stoffwechselbedingt: Zu dieser Gruppe zählen ge­ wisse Stoffwechselerkrankungen, die zu Ablagerun­ gen von Harnsäure oder Kalk im Gewebe sowie zu Knochen-Entkalkungen führen können. Bekannte Beispiele sind Osteo­ porose (Knochenverlust) und Gicht. Schmerz Fast alle rheumatischen Erkrankungen ver­ ursachen akute oder chronische Schmerzen. Wichtig ist eine frühe und genaue Diagnose durch den Arzt oder Chiropraktor, damit die therapeutischen Mass­ nahmen rasch und individuell auf den Patienten ab­ gestimmt werden können. Wo immer notwendig ar­ beiten Chiropraktoren, Hausärzte und Rheumatologen zusammen; oft ist auch der Beizug von Physiothera­ peuten, Masseuren und Fitness-Instruktoren hilfreich. Der Chiropraktor wird je nach Krankheitsbild unter­ schiedliche diagnostische Untersuchungen durchfüh­ ren oder veranlassen. Nach einer gründlichen Anam­ Chiropraktoren in der Region Biel, Grenchen, Lyss, Solothurn • Dr. Ueli Gerber Bahnhofstrasse 17, 3250 Lyss, Tel. 032 384 72 70 • Dres. Börge Jansen & Katrin Jansen Westbahnhofstrasse 1, 4500 Solothurn, Tel. 032 621 61 61 • Dr. Peter Kreienbühl Bielstrasse 26, 3250 Lyss, Tel. 032 384 01 21 • Dres. Marco Nardini & Sonja Nardini Kastelsstrasse 18, 2540 Grenchen, Tel. 032 652 84 20 • Dr. Olivier Perret Chemin du Parc 5, 2502 Biel, Tel. 032 323 31 21 • Dres. Roger Picard & Jean-Claude Mermod Rue de Flore 32, 2502 Biel, Tel. 032 323 66 88 • Dr. Roland Schönenberger Güterstrasse 2, 2502 Biel, Tel. 032 323 77 66 • Chiropraktik Seeland, Dres. Claude B. Supersaxo, Beatrice Zaugg, Fiona Scherrer Rafter, Jason A. Rafter Johann-Verresius-Strasse 18, 2502 Biel, Tel. 032 322 65 30 Arthrose und Arthritis nese sowie einer körperlichen Untersuchung sind daher auch Blutlabor, Röntgen- oder Ultraschallun­ tersuchungen möglich. Schmerzzustände, etwa Rü­ ckenschmerzen, sollten rechtzeitig behandelt werden, um zu vermeiden, dass das Schmerzempfinden chro­ nisch wird. Nutzen der Chiropraktik Oft hilft die fein dosierte manuelle Mobilisation der Wirbelsäule durch die Chi­ ropraktorin, den Chiropraktor. Das Nervensystem be­ ruhigt und normalisiert sich, Blockaden werden be­ hoben. Zur Chiropraktik gehören zudem eine Vielzahl von Techniken, welche die Weichteile behandeln und so dazu führen, dass die Muskulatur besser funktio­ niert. Film: ChiropraktikAusbildung an der Universität Zürich Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» Bei den durch Abnützung verursachten und weich­ teil-rheumatischen Erkrankungen sind vorwiegend Fehlhaltungen, Überbelastungen der Wirbelsäule und des Skeletts Hauptursache für die Beschwerden. Dies beeinflusst das Nervensystem negativ, wodurch eine erhöhte Muskelspannung sowie eine Über- oder Fehl­ belastung der Gelenke resultiert. Die daraus entste­ henden Beschwerden provozieren die Freisetzung entzündlicher Stoffe, was zu Schmerzen und Gelenk­ verschleiss führt. Oftmals bewirkt der Chiropraktor eine Schmerzlinderung, ohne Medikamente einzuset­ zen. Patientinnen und Patienten, die unter entzünd­ lich-rheumatischen Erkrankungen leiden, werden in der Regel von dafür spezialisierten Fachärzten, Rheu­ matologen, behandelt. In den Phasen zwischen den entzündlichen Schüben kann auch die Chiroprakto­ rin, der Chiropraktor die mechanisch-funktionellen Beschwerden des Rückens und anderer Gelenke be­ handeln, dafür sorgen, dass die Mobilität des Patien­ ten möglichst lange erhalten wird. Zusammenarbeit Der Erfolg der Behandlung hängt wesentlich davon ab, für die unterschiedlichen Krank­ heitsbilder und -situationen die jeweils richtige­Be­ Bei der Arthrose handelt es sich um eine degenera­ tive Gelenkerkrankung, die im Gegensatz zur Arthritis primär nicht-entzündlich ist. Es entsteht ein Schaden am Gelenkknorpel. Ursachen sind einerseits der nor­ male Alterungsprozess, andererseits eine übermässige oder falsche Belastung des Gelenks, aber auch Bewe­ gungsmangel sowie Verletzungen oder angeborene Knorpeldefekte. Typisch für eine beginnende Arthrose sind Gelenkschmerzen, die vor allem nach Ruhepha­ sen auftreten. Chiropraktoren spielen bei der Behand­ lung und Prävention von Arthrose eine zentrale Rolle. Die häufigste entzündliche Rheuma-Form ist die rheumatoide Arthritis, 0,5 bis 1 Prozent der Bevölke­ rung sind betroffen. Bei dieser Erkrankung ist die kör­ pereigene Abwehr fehlgesteuert; sie greift die eigenen Gelenke und verschiedenen Gewebe an und zerstört diese. Die Ursachen sind noch nicht vollständig be­ kannt. Typische Symptome sind nächtliche und mor­ gendliche Schmerzen der Fingergelenke sowie eine Morgensteifigkeit. In der Folge sind immer mehr Ge­ lenke betroffen, sie verformen sich und schmerzen. Zur Behandlung werden verschiedene spezifische Me­ dikamente eingesetzt sowie physikalische Therapien zur Schmerz-Reduktion und zur Erhaltung von Mobi­ lität und Muskelkraft. Chiropraktoren sind für Arthri­ tis-Patienten kompetente Ansprechpartner. handlungskombination, «massgeschneiderte» The­ rapie zusammenzustellen. Verschiedene Methoden stehen zur Auswahl: Chiropraktische Manipulatio­ nen, um Blockierungen und Funktionsstörungen in Gelenken zu behandeln, Nerven zu entlasten; Trigger­ punktbehandlung, um Muskeln zu entspannen; Phy­ siotherapie, Gymnastik, Medikamente oder C ­ hirurgie. Beratung Ein wichtiger Aspekt der chiro­praktischen Behandlung liegt in der Beratung betreffend Ergono­ mie am Arbeitsplatz, Bewegung und Training. Auch eine bewusste Ernährung kann Rheuma positiv be­ einflussen. Für Patienten heisst dies: mehr Gemüse, Früchte, vollwertige Getreide, Fisch, Hülsenfrüchte, weniger Fleisch, Eier, Kaffee,­Alkohol, Zucker. Der Autor Dr. Martin Wangler, Chiropraktor SCG/ECU Präsident der Berner Chiropraktorengesellschaft Kontakt: Bahnhofstrasse 15, 3400 Burgdorf Tel. 034 423 13 12 [email protected] www.chirobern.ch med izin ak tue l l 15 Sprunggelenk Drei Knochen, ein Gelenk Fuss aufsetzen, Fuss abrollen, Bein nach vorne bringen – und dies um die tausend Mal pro Tag. Das Sprunggelenk muss einiges aushalten und ist für den reibungslosen Bewegungsablauf unverzichtbar. Das Sprunggelenk ist die Verbindung zwischen Un­ terschenkel und Fuss. Es ist für das Heben und Sen­ ken des Fusses zuständig, für den Abrollvorgang beim Gehen, das Abstossen beim Springen und darum ist es das am stärksten belastete Gelenk des Körpers. Bei jedem Schritt hat es einen Druck auszuhalten, der bis das Siebenfache des Körpergewichtes erreicht. Da verwundert wenig, dass es im Sprunggelenkbereich zu Bänder-, Knorpelverletzungen (oft bedingt durch ein instabiles Sprunggelenk als Folge wiederholter Bänderrisse, -überdehnungen, sowie «Fuss-Umkni­ ckens») und Knochenbrüchen kommt. Häufige Spät­ folgen solcher Verletzungen sind Knorpelschäden des oberen Sprunggelenkes mit Entwicklung eines fort­ schreitenden Gelenkverschleisses, der Arthrose. Auch deshalb ist es wichtig, jede Sprunggelenksverletzung ernst zu nehmen, ärztlich abzuklären und bei Bedarf behandeln zu lassen – denn Früherkennung vermei­ det oft Folgeschäden. Ursachen, Symptome Das ist keine Seltenheit: Nach der sonntäglichen Wanderung, dem Jogging mit der Nachbarin, dem Plausch-Fussballmatch mit Kol­ legen schwillt das Sprunggelenk an, entzündet sich, schmerzt. Anfänglich treten Arthrose-Beschwerden nur gelegentlich und bei übermässiger Belastung auf, werden von den Patienten meist lange einfach hin­ genommen. Doch je weiter der Knorpelabbau im Ge­ lenk fortgeschritten ist, desto häufiger, länger und heftiger werden die Schmerzen – letzt­ lich plagen sie bei ganz alltäg­ Sprunggelenkarthrose, lichen Bewegungen, etwa beim häufig Spätfolge von Treppensteigen; typischerweise Bandinstabilitäten dann auch morgens, beim «An­ laufen», ja selbst nachts und und Frakturen, die wenn man ruht. Augenfällig differenziert behandelt zudem: Durch die schmerzbe­ dingte Schonung des Fusses werden können. kommt es zum Entlastungs­ hinken. Gründe für die Entstehung von Arthrose sind na­ türlicher Gelenkverschleiss infolge Alterung, unfall­ bedingte Arthrosebildung (verursacht auch durch sprunggelenkferne Knochenbrüchen zum Beispiel am 16 medizin aktuell Unterschenkel, die in Fehlstellung verheilt sind), Aus­ wirkungen von Stoffwechselkrankheiten, Infektionen oder rheumatische Grunderkrankungen. Nebst die­ sen «erworbenen» Ursachen für Arthrose gibt es auch «anlagebedingte» wie angeborene Klump-, Platt- oder Hohlfussstellungen, die zu einer Überbelastung des oberen Sprunggelenks führen können. Arthroseschäden manifestieren sich meist ab Alter 50. Im Laufe der Jahre nimmt die Abnutzung und Schä­ digung des Gelenkknorpels zu, die «stossdämpfende» Spalthöhe zum angrenzenden Knochen aber ab; so kommt es verstärkt zu Abrieb, der Knorpel wird rissig, raut auf, kleine Teile davon können sich ablösen und im Innern des Sprunggelenkes Knochenwülste bilden – all dies führt zu Bewegungseinschränkungen des Fusses und verursacht Entzündungen, Schmerzen. Untersuchung, nicht-operative Therapien Die sorgfältige Abklärung einer Sprunggelenksarthrose fusst auf dem Gespräch des Arztes mit dem Patien­ ten. Es gilt, frühere Verletzungen, rheumatische Er­ krankungen usw. genau zu erfragen. Hinzu kommt die körperliche Untersuchung, das Abtasten, Beur­ teilen von Haut und Weichteilen sowie der Funktion von Gelenk, Sehnen und Muskulatur. Schliesslich gelangen auch bildgebende diagnostische Verfah­ ren (Röntgen, Computer- und/oder Magnetresonanz­ tomographie) zur Anwendung, werden damit die Stellung von Unterschenkel-, Fuss- und Fersenkno­ chen zueinander sichtbar gemacht und genaue Aus­ sagen möglich über das Ausmass und die Ursache der Arthrose- und Gelenkknorpelschäden. Wird dann die Dia­gnose «Sprunggelenkarthrose» gestellt, so kommt das für viele Patienten unerwartet und verursacht ein mulmiges Gefühl. Doch wir Ärzte können beruhigen: Je nach Ursache und Stadium der Erkrankung stehen heute unterschiedliche und gut bewährte Methoden zur Auswahl, die helfen, den Verlauf der Arthrose zu verlangsamen oder die Schäden zu beheben. Und ganz klar: Wann immer möglich erhalten zunächst nichtoperative Behandlungen den Vorzug – etwa SpezialSchuheinlagen, physikalische Thera­ pien (Massage, Physiotherapie) oder die zeitlich beschränkte Verab­ reichung entzündungshemmender Medikamente und Schmerzmittel. Film: Kurzinterview mit Dr. med. Attila Vásárhelyi Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» Spezielle OP-Technik an der Privatklinik Linde Bei der Operation zur Sprunggelenk-Versteifung liegt der Patient auf dem Bauch, erfolgt der Eingriff von hinten, also posterior. Diese Operationslage beinhaltet gewichtige Vorteile: Die Dauer des Eingriffes nimmt ab, dauert etwa 60 Minuten, Sehnen und Bänder las­ sen sich maximal schonen, die Achsenstellung der Knochen und Gelenke können ideal kontrolliert wer­ den, und die Wundheilung verläuft besser als beim Sprunggelenk-Eingriff von vorne. Bei der Gelenk-Ver­ steifung kommt ein weiterer wesentlicher Pluspunkt dazu: Der posteriore Zugang ermöglicht den Ein­ satz spezieller Rückfuss-Arthrodesenplatten (im Bild: Röntgenaufnahme eines oberen Sprunggelenks nach Versteifung mit einer Talarlock-Platte), welche die so­ fortige volle Belastung nach dem Eingriff erlauben. Diese anatomisch vorgeformten und aus Titan beste­ henden Platten wurden durch den Autor entwickelt und werden heute an der Privatklinik Linde eingesetzt sowie an verschiedenen deutschen Universitätsklini­ ken und Spitälern in Schweden. Sie dienen als stabile «Aufhängung» und ermöglichen die optimale Verfesti­ gung von Sprunggelenk und Schienbeinknochen. Operative Therapien Stellte die Versteifung des • Sprunggelenk-Versteifung (Arthrodese): Dabei wird Sprunggelenks lange die einzige Behandlungsmöglich­ keit dar, so gibt es mittlerweile bei Gelenkverschleiss im Sprunggelenk für jedes Stadium eine Alternative – ohne dass Betroffene grosse Funktionseinbussen in Kauf nehmen müssen. Eine kurze Übersicht: • Sprunggelenk-Arthroskopie: Knöcherne Wuche­ rungen im Sprunggelenk werden in einem arthros­ kopischen Eingriff («Gelenktoilette») abgetragen. Da­ bei wird über einen kleinen Schnitt eine Mini-Kamera und über einen zweiten Hautschnitt das Operationsin­ strument in das Gelenk eingeführt. Selbst grosse knö­ cherne Wucherungen lassen sich so gewebeschonend entfernen. Zudem wird der Knorpelschaden geglättet und angebohrt, damit sich dort ein Reparationsknor­ pel bilden kann. Es können auch spezielle Membranen in den Defekt eingeklebt werden, die eine verbesserte Knorpelregeneration unterstützen. Die Arthrose wird damit nicht beseitigt, doch die Schmerzen verringern sich deutlich. Der Bewegungsspielraum nimmt zu, grössere Operationen lassen sich hinauszögern. • Sprunggelenk-Endoprothese: Ähnlich wie an Hüfte und Knie lässt sich heute auch das obere Sprungge­ lenk durch ein künstliches ersetzen. Auch noch nach zehn Jahren sind zwischen 85 bis 90 Prozent der ein­ gesetzten Prothesen einwandfrei intakt. Selbst eine Lockerung des künstlichen Sprunggelenks ist nicht unbedingt problematisch, da sich dieses in vielen Fäl­ len durch ein neues ersetzen lässt. Sollte der Ersatz nicht möglich sein, so verbleibt als weitere Lösung die Versteifung des Sprunggelenks. der Knorpelüberzug des Sprunggelenks entfernt und das Sprungbein mit dem Schienbeinknochen stabil verbunden, damit die Knochenpartner miteinander verheilen. Das so behandelte Sprunggelenk lässt sich später nahezu wieder unbegrenzt belasten. Die Ver­ steifung erfolgt mittels spezieller, anatomisch vorge­ formter Arthrodesenplatten. OP-Risiken Sowohl bei der Sprunggelenk-Verstei­ fung wie auch bei der Prothesen-Implantation kann es zu Komplikationen kommen, doch die Komplika­ tionsrate beträgt weniger als 5 Prozent. Zu den früh auftretenden Problemen zählen Wundheilungsstörun­ gen und Infekte, die Folgeoperationen nötig machen können. Mögliche Spätkomplikationen bei der Ver­ steifung sind das Nichtverheilen der Knochenpartner und die Überlastungsarthrose angrenzender Fussge­ lenke. Und bei der Prothese kann es zu Lockerungen kommen. Der Autor Attila Vásárhelyi, Dr. med. Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats Belegarzt der Privatklinik Linde AG Praxis: Rebenweg 34, 2503 Biel Tel. 032 323 12 12 [email protected] www.fusschirurgie-biel.ch med izin ak tue l l 17 Wundbehandlung Das Alter bremst die Heilung Gerade ältere Menschen leiden oft unter chronischen Wunden wie «offenes Bein» oder «diabetischer Fuss». Viele dieser Wunden lassen sich aber einfach und gut behandeln. Viele ältere Menschen stellen fest, dass sich manch­ mal kleine Hautwunden weniger schnell schliessen, als dies früher der Fall war. Das ist ein natürlicher Al­ terungsprozess, denn die Haut ist im Alter nicht mehr so gut durchblutet wie bei jungen Menschen. Zudem ist die Immunabwehr reduziert und die Fähigkeit des Körpers, Schädigungen zu reparieren, hat abgenom­ men. Mit zunehmendem Alter steigt zudem statistisch das Risiko für Krankheiten, welche die Wundheilung stören können. Das ist besonders dann der Fall, wenn diese Erkrankungen wegen Durchblutungsstörungen eine mangelnde Sauerstoffversorgung des Gewebes mit sich bringen. Offenes Bein Typische Beispiele dafür sind Diabe­ tes, Arteriosklerose oder Venenschwäche. Auch ein Mangel an Gerinnungsfaktoren kann die Wundhei­ lung beeinträchtigen, ebenso wie Infektionen, Krank­ heiten oder Medikamente, welche das Immunsystem schwächen. Die drei häufigsten chronischen Wund­ arten sind das «offene Bein» (Ulcus cruris genannt, ein schlecht heilendes Unterschenkelgeschwür), De­ kubitus (Druckgeschwüre durch Wundliegen) und das Diabetische Fusssyndrom (Hautveränderungen, Druckstellen oder offene Wunden an den Füssen von Zuckerkranken). Gerade bei chronischen Wunden ist es wichtig, zuerst die ursächliche Grunderkrankung zu finden und rich­ tig zu behandeln. Für die Wundbehandlung müssen Materialien verwendet werden, die dem Wundverhei­ lungsverlauf angepasst sind; wichtig ist auch, dass eine Fachperson oder ein Arzt die Wundpflege durch­ führt. «Die Heilungschancen bei offenen Beinen wer­ den von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Für eine Wundheilung sind gute Kompressionsver­ bände zwingend notwendig; es braucht aber seine Zeit und die Patienten müssen sich in Geduld üben», sagt Karin Eggenberger, dipl. Wundexpertin im Zent­ rum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG. Vorbeugung Viele der chronischen Wunden lassen sich mit einfachen Präventionsmassnahmen vermei­ den. «Ältere Personen müssen genügend Nährstoffe, vor allem Proteine und Vitamine zu sich nehmen», sagt Karin Eggenberger und fährt fort: «Viel Bewe­ 18 medizin aktuell gung fördert die Durchblutung in den Beinen, ist also gerade bei Beingeschwüren eine gute vorbeugende beziehungsweise heilungsunterstützende Massnahme. Wichtig ist aber auch, dass Schmerzen gelindert wer­ den. Denn Schmerzen lösen im Körper und der Psyche Stress aus und dies wiederum wirkt sich negativ auf die Wundheilung aus.» Interessante Analyse im «Schlössli» Die Pflegenden der Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG, kurz «Schlössli», haben die­ sen Frühling ihr Wundkonzept einer Prüfung unter­ zogen. In einem ersten Schritt wurden sämtliche Be­ handlungen des Jahres 2011 analysiert. Anschliessend erfassten die Pflegenden in einer ersten Audit-Phase während einem Monat alle Verbandswechsel und Wundbeurteilungen. In einer zweiten Audit-Phase von ebenfalls einem Monat Dauer vereinfachten die Pflegenden das Behandlungskonzept und führ­ ten sämtliche Wundbehandlungen mit dem immer gleichen Wundspray («1 Primary Wound Dressing») durch, unabhängig vom Wundstadium und der Art der Wunde. Dieser Spray verhindert das Ankleben der Auflage, wirkt antimikrobiell und schafft ein feuch­ tes Wundmilieu. Die Ergebnisse sind frappant: Im Jahr 2011 betru­ gen die durchschnittlichen Kosten für eine Wundbe­ handlung 14.80 Franken pro Tag. In der ersten Au­ dit-Phase wurden durchschnittliche Totalkosten pro Behandlungstag von 10.50 Franken ermittelt (minus 29 Prozent), die durchschnittliche Dauer für e­inen Verbandswechsel lag bei 18 Minuten. In der zwei­ ten Audit-Phase (mit neuem Produkt und vereinfach­ tem Wundkonzept) kostete ein Behandlungstag noch 8.50 Franken (42 Prozent weniger als im Jahr 2011), die Dauer eines Verbandswechsels betrug acht Mi­ nuten und die Anzahl unterschiedlicher Typen von Wundauflagen konnte von fünf auf zwei reduziert werden. Auch die Anzahl der Verbandswechsel, bei denen eine Wundreinigung nötig war, konnte um 53 Prozent gesenkt werden, die Notwendigkeit für ein Debridement (Wundtoilette mit Tupfer und Pinzette) sank um 83 Prozent. Kurzinterview mit Karin Eggenberger, Wundexpertin Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG Was es auch braucht: Geduld Weshalb hat sich das «Schlössli» zu einem Wundkonzept-Audit (siehe Box links) entschlossen? Karin Eggenberger: Wir hatten ein sehr umfassen­ des Wundkonzept, welches im Alltag in der Regel gut umgesetzt wurde. Doch die hohe Komplexität der einzelnen Wundsituationen sowie die grosse Anzahl unterschiedlicher Wundauflagen stellen eine grosse ­Herausforderung für die Pflegenden dar. Dies hat zu Unsicherheiten,­ manchmal auch zu ­unsachgemässen Ver­ bandswechseln geführt. Und natürlich war auch die Kosteneffizienz ein Thema; doch vor allem­ wollten wir auch an­ dere Produkte testen und neue Erkenntnisse in der Wundpflege be­ rücksichtigen. Bei allen Überlegungen standen aber die Bedürf­ nisse unserer Bewohne­ rinnen und Bewohner im Vordergrund: Ihnen wollen wir die bestmög­ liche Wundpflege zu­ kommen lassen, die für sie so angenehm wie möglich ist. Denn eine Wunde ist immer belastend, schränkt die Lebensqualität und die Mobilität im All­ tag ein. Wenn es also ein Produkt gibt, das sowohl die Wundheilung fördert als auch Schmerzen lindert und die Anzahl der Verbandswechsel reduziert, dann ist das nur positiv. Des weiteren sparen wir dank dem neuen Wundkon­ zept Geld – und vor allem Zeit. Letzteres kommt ganz besonders den Bewohnerinnen und Bewohnern zu­ gute, denn die Pflegenden finden jetzt auch wieder mehr Zeit und Gelegenheit zum Austausch, Gespräch. Jede Wunde wird jetzt immer gleich behandelt? Im «Schlössli» behandeln wir vor allem Abschürfun­ gen nach Stürzen, Dekubitus (Wundliegen), Feuchtig­ keitsläsionen sowie venös bedingte Wunden (offene Beine) – diese Wunden eignen sich gut für «1 Primary Wound Dressing». Dennoch gibt es Wundsituationen, in welchen wir auch weiterhin auf bereits vorher ver­ wendete Produkte zurückgreifen; dies betrifft vor al­ lem die postoperative oder palliative Versorgung. Worauf müssen ältere Menschen achten, wenn sie «offene Beine» selber behandeln wollen? Immer sinnvoll ist es, die Wunde abzudecken, denn dies schützt vor äusseren Einflüssen und dass zu viel Wärme abgeht. Zu Beginn, also beim ersten Verband, sollte die Wichtig: Keine Klebewunde Stelle desinfiziert wer­ den, doch nachher ist dies nicht verbände benutzen, mehr nötig, denn das belastet die denn diese «reissen» Wunde nur. Zur Reinigung ge­ die dünne Haut alter nügt Leitungswasser. Das Prob­ lem bei alten Menschen ist, dass Menschen auf. die Haut sehr dünn ist, sie sollten also keine Verbände anlegen, die kleben. Mit dem richtigen Ver­ band kann die Wundheilung positiv beeinflusst wer­ den; man sollte sich am besten von einer Fachperson beraten lassen. Vor allem aber braucht es viel Geduld, bis eine Wunde verheilt ist. Im Anschluss sollte die Narbenpflege nicht vergessen werden: Während meh­ rerer Wochen muss die Narbe morgens und abends mit einer fettenden Salbe eingerieben werden. Worin besteht denn der Vorteil des neuen Produkts, das Sie nun in Ihr Sortiment aufgenommen haben? Dank des neuen Sprays «1 Primary Wound Dressing» können wir unser Wundkonzept stark vereinfachen. Denn jetzt kommt immer dasselbe Produkt zur An­ wendung, egal, um welche Wunde es sich handelt und in welcher Phase der Heilung sich diese befindet. Das schützt vor Fehlentscheiden, denn die Pflegenden müssen die Wundbehandlung nicht immer neu beur­ teilen. Ich als Expertin bin zwar bei der Erstbeurtei­ lung immer dabei, aber ich habe bereits jetzt festge­ stellt, dass ich weniger häufig um Ratschläge gebeten werde, was die Wundpflege anbelangt. Die Auskunftsperson Karin Eggenberger Dipl. Wundexpertin und Bachelor of Science Pflege Kontakt: Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG Mühlestrasse 11, 2504 Biel Tel. 032 344 08 08 [email protected] www.schloessli-biel.ch med izin ak tue l l 19 Schlafstörungen Nicht alle sind Kurzschläfer wie Napoleon Die Daueraktiven unter uns «verschwenden» keine unnötige Zeit mit Rasten und Ruhen, kommen­mit wenig Schlaf aus. Für «Durchschnittsmenschen» dagegen sind Nacht-Ruhephasen lebenswichtig – doch immer mehr leiden unter Schlafproblemen. Die durchschnittliche Schlafdauer der Schweizer Be­ völkerung beträgt sieben Stunden. Fünf Prozent der Bevölkerung schlafen weniger als fünfeinhalb Stun­ den pro Nacht; sie gelten medizinisch als Kurzschläfer und – vorausgesetzt die durchwachte Nacht ist frei­ willig – gehören zur noblen Gesellschaft der Dauerak­ tiven, die wenig Zeit mit lästigem Rasten und Ruhen verschwenden, weil sie eine «Mission» zu erfüllen ha­ ben. Doch nicht alle sind wie Napoleon; der franzö­ sische Feldherr soll einmal gesagt haben: «Vier Stun­ den schlafen Männer, fünf Stunden schlafen Frauen, sechs Stunden schlafen Idioten.» Viele Schweizerin­ nen und Schweizer würden gerne mehr oder besser schlafen und greifen deswegen des Öfteren zu einem Hilfsmittel. Lebensgewohnheiten überprüfen Schlafprobleme sollten aber nie alleine nur mit Schlafmitteln behan­ delt werden. Vielmehr müssen zuerst Verhaltensmass­ nahmen getroffen werden wie die Strukturierung des Schlaf-wach-Rhythmus oder die Dokumentation des Schlafverhaltens während einiger Wochen. Zudem sollte eine Schlafstörung zuerst einmal nicht überbe­ wertet werden; sie kann etliche einfache Gründe ha­ ben und löst sich oft spontan wieder. Bevor mit einem Mittel nachgeholfen wird, sollte man sich selber über­ prüfen: Wann gehe ich zu Bett, wann stehe ich auf? Ist das regelmässig? Trinke ich vor dem Schlafen Al­ kohol? (Das kann zu Durchschlafstörungen führen). Wie viel Kaffee und Cola trinke ich im Verlauf des Ta­ ges? Nicht selten sind einem «gewöhnliche» Lebens­ gewohnheiten, die sich negativ auf den Schlaf aus­ wirken können, zu wenig bewusst. Zudem wird der Schlaf im Laufe des Lebens oberflächlicher. Wenn sich all dies ausschliessen lässt und der Schlaf trotzdem beeinträchtigt ist, sollte man beim Arzt vorstellig werden; dieser kann allfällige organische Gründe wie eine Schilddrüsenüberfunktion, Herz-, Lungen- oder Prostataprobleme abklären und be­ handeln. Wenn keine organische Ursache für die Schlafstörung gefunden wird und alle Verhaltens­ massnahmen (siehe Box rechts) zur Verbesserung des Schlafes keine Besserung bringen, dann sind Schlaf­ mittel res­pektive alternative Schlafmittel bei chroni­ schen Schlafstörungen sinnvoll. 20 medizin aktuell Verschiedene Wirkungsarten Bei Patienten mit Schlafstörungen wirkt oft ein sedierend (beruhigend) wirkendes Antidepressivum (Remeron, Trittico oder Seropram), allenfalls auch natürliche Johanniskraut­ extrakte (Hypericum). Wenn die Schlafstörungen trotzdem fortbestehen oder ein nicht-sedierendes Me­ dikament gewählt wird, ist die abendliche Gabe eines Benzo­diazepinpräparats oft hilfreich. Schlafhygiene •Genügend Bewegung (ein Abendspaziergang wirkt beruhigend und macht den Körper müde) •Stress über längere Zeit vermeiden •Psychische Belastungen (Arbeit, Partnerschaft, Geld­probleme) zu lösen versuchen •Vor dem Schlafengehen nicht zu viel und zu schwer essen, auf Kaffee und Alkohol verzichten •Gehirn entspannen, statt mit langem und aufpeit­ schendem TV-Konsum anregen •Regelmässiger Schlafrhythmus (immer ungefähr zur selben Zeit ins Bett gehen). Die Stunden vor Mitter­ nacht zählen entgegen der gängigen Meinung nicht «mehr» – wichtig ist vor allem die Regelmässigkeit •Tatsache ist: Es gibt Kurz- und Langschläfer •Das Schlafbedürfnis nimmt im Alter ab (Ausnah­ men: Demenzkranke oder alte Menschen, die Anti­ depressiva konsumieren) Natürliche Hilfsmittel •Vor dem Griff zur Tablette zum Beispiel ein Glas warme Milch mit etwas Honig drin trinken •Ein warmes Bad wirkt entspannend •Eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen eine Tasse Kräutertee trinken; besonders gut geeignet sind ­ Kräuter wie Goldmelisse, Baldrianwurzeln, Hopfen, Orangenblüten Die gängigsten Schlafmittel, die Benzodiazepine (ein­ gesetzt als angstlösende, muskelrelaxierende, sedie­ rende und schlaffördernde Arzneistoffe, sogenannte Tranquilizer), sollen den Schlaf in seiner Dauer und Qualität deutlich verbessern, dabei das natürliche Schlafmuster nicht verändern und nur in der Nacht, nicht aber am Tag wirken. Und ganz wichtig auch: Sie sollen frei von Nebenwirkungen und für den Kör­ per ungiftig sein, auch bei einer Langzeiteinnahme ihre volle Wirkung behalten, keine Abhängigkeit her­ vorrufen und das Absetzen des Mittels soll ohne Pro­ bleme möglich sein. Schwach wirksame Neuroleptika (Seroquel, Dipiperon und Haldol, das vor allem bei älteren Patienten eingesetzt wird) wirken stark beru­ higend, dämpfend, schlaffördernd und werden daher bei Erregungs-, Angst- und Spannungszuständen an­ gewendet. Vor- und Nachteile Der Pluspunkt einer Schlafmit­ teltherapie liegt in der unmittelbaren Entlastung des Patienten durch die Verbesserung der Ein- und Durch­ schlaffähigkeit. Damit kann bei akuten Schlafstörun­ gen eine Chronifizierung der Störung vermieden wer­ den. Bei chronischen Schlafstörungen wieder­um wird durch die verbesserte Schlafqualität der Entwicklung von Folgeproblematiken wie bei­ spielsweise schwe­ ren depressiven Verstimmungen oder Erschöpfungs­ zuständen vorgebeugt. Der grösste Nach­teil bei der medikamentösen Therapie von Schlaf­störungen liegt darin, dass die Medikamente nur eine (oft vorüber­ gehende) Beseitigung der Symptome bewirken, nicht aber deren Ursachen bekämpfen. Es sind also Helfer, aber keine Heiler. Die medikamentöse Therapie sollte daher immer in ein Gesamttherapiekonzept einge­ bunden sein, das auch andere, nicht-medikamentöse Massnahmen umfasst. Wichtig zu wissen auch: Ben­ zodiazepine führen unter anderem zu einer Vermin­ derung des Tiefschlafes, was nicht dem natürlichen Schlaf entspricht. Mögliche Risiken Je nach Wirkungsdauer des Me­ dikamentes kann es zu Beeinträchtigungen der Kon­ zentrations- und Leistungsfähigkeit sowie des Reak­ tionsvermögens (erhöhtes Risiko für Fahrzeuglenker) kommen. Abruptes Absetzen des Schlafmittels kann zu einer Reihe von Entzugssymptomen führen – Angstzustände, Zittern, Alpträume, Erregungs- und Unruhezustände. Bei einzelnen Personen können Schlafmittel nach einiger Zeit an Wirkung verlieren; eine Dosissteigerung ist die Folge. Aufgrund der Tole­ ranzentwicklung kann es zu einer weiteren Dosisstei­ gerung und (im Falle des plötzlichen Absetzen des Medikamentes) zu einer entsprechenden Entzugssym­ ptomatik kommen, sodass man hier von ­einer phy­ sischen Abhängigkeit spricht. Dieses Risiko ist zwar wesentlich geringer einzustufen als jenes, das beim Konsum von Drogen oder Suchtmitteln wie Al­ Schlafmittel sind kohol oder Nikotin entsteht, doch Helfer, keine die Gefahr steigt an mit zuneh­ ­Heiler und sollten mender Dosierung und Therapi­ edauer. Besonders gering wird Teil ­einer Gesamt­ das Abhängigkeitsrisiko bei den therapie sein. neuen Nichtbenzo­ diazepinen ein­ geschätzt. Von der körperlichen Abhängigkeit zu unterschei­ den ist die psychische Abhängigkeit: Bei jeder Form der Schlafmitteleinnahme besteht die Gefahr, dass der Patient über kurz oder lang zur Überzeugung ge­ langt, ohne Schlafmittel nicht mehr schlafen zu kön­ nen und er daher gewohnheitsmässig abends zur Tablette greift. Hat man das Medikament dann mal nicht dabei, etwa auf Reisen, so beginnen die Gedan­ ken zu kreisen – «ohne mein Schlafmittel kann ich nicht schlafen, also liege ich die ganze Nacht wach» – und das reicht dann aus, um den Schlaf effektiv zu vertreiben. Eine weitere Gefahr besteht in der Mus­ kelrelaxation: Benzo­diazepine habe eine muskelent­ spannende Wirkung, was die Sturzgefahr bei älteren Patienten – etwa beim nächtlichen Toilettengang – ansteigen lässt. Die Autoren Claudio E. Graf, Dr. med. Facharzt für FMH Innere Medizin Belegarzt der Privatklinik Linde AG Praxis: Dufourstrasse 7, 2502 Biel Tel. 032 323 32 32 [email protected] Herbert Schaufelberger, Dr. med. Facharzt FMH für Innere Medizin Belegarzt der Privatklinik Linde AG Praxis: Ärztezentrum Localmed AG Bahnhofplatz 2, 2502 Biel Tel. 032 329 55 00 [email protected] med izin ak tue l l 21 Hodenkrebs Gute Heilungschancen Hodenkrebs ist eine seltene, aber bösartige Tumorerkrankung, die gehäuft bei Männern im Alter zwischen 25 und 35 Jahren auftritt. Massgebend für den Behandlungserfolg ist, dass der Krebs frühzeitig erkannt wird. Die Hoden sind die männlichen Keimdrüsen. Jeder Hoden misst etwa fünf Zentimeter im Längsdurch­ messer und liegt in einer schützenden Hülle, im Ho­ densack. Die Hoden haben zwei Aufgaben: Sie bilden die Spermien sowie das männliche Geschlechtshor­ mon Testosteron, das die Samenproduktion reguliert. Zudem beeinflusst das Hormon die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale des Mannes – etwa die Stimmlage oder den Bartwuchs. Die Hoden sind aus unterschied­ lichen Arten von Zellen aufge­ Wer als Kind unter baut. Dementsprechend können Hodenhochstand verschiedene Arten von Tumo­ ren entstehen. Die häufigsten oder Leistenhoden Formen von Hodenkrebs sind die litt, hat ein erhöhtes Seminome und die Nicht-Semi­ Erkrankungsrisiko. nome (die Definition ist abhän­ gig davon, in welchem Zellentyp der Hodenkrebs seinen Ursprung hat). Die Unterscheidung ist wichtig, weil die Tu­ morarten unterschiedlich behandelt werden. Bei 95 Prozent der Patienten tritt die Krankheit nur in einem Hoden auf. Hodenkrebs ist eine seltene Erkrankung, doch trotz einer allgemein sehr niedrigen Anzahl von Neuerkrankungen entspricht der Hodenkrebs ei­ nem der häufigsten bösartigen Tumoren des jungen Mannes. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist ein An­ stieg in nahezu allen westlichen Ländern festzustel­ len. Am häufigsten erkranken Männer zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr. 88 Prozent der Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose unter 50 Jahre alt. Ohne Behandlung ist Hodenkrebs immer tödlich. Mit einer frühzeitigen Behandlung kann die Krankheit dagegen meistens geheilt werden. Ursachen und Risiken Bei erwachsenen Männern entstehen 90 Prozent aller bösartigen Hodentumoren aus den Keimzellen. Die Ursachen von Hodenkrebs sind nach wie vor nicht bekannt. Es zeigt sich eine Anhäufung bei Männern, die als Kinder unter Ho­ denhochstand oder Leistenhoden (fehlende Wande­ rung des Hodens aus der Bauchhöhle in den Hoden­ sack) gelitten haben. Sie haben ein bis zu zehnfach erhöhtes Risiko. Zeugungsunfähige Erwachsene und Männer, die früh in die Pubertät kamen sowie solche 22 medizin aktuell mit familiärer Vorbelastung sind ebenfalls öfter be­ troffen. Frühgeburtlichkeit ist anhand einiger Studien auch als Risikofaktor identifiziert worden. Anderseits erhalten Annahmen, dass ernährungsbedingte Fak­ toren die Krebsentstehung begünstigen, wieder ver­ mehrt Beachtung. Hormonrückstände in Milch- oder Fleischprodukten wurden insbesondere in den letz­ ten beiden Jahrzehnten nachgewiesen und lassen sich (bedingt) als Erklärung für die zunehmende Anzahl von Neuerkrankungen heranziehen. Knoten und Schwellungen Am Anfang der Krank­ heit zeigen sich fast keine Beschwerden. Ein leichtes Ziehen in der Leistengegend oder einseitige, schmerz­ lose Schwellungen sind möglich. Manchmal ist auch ein Knoten im Hoden ertastbar. Erst später kommt es häufig zu Schwellungen der Lymphknoten im Be­ reich des Beckens und der Wirbelsäule. Diese äussern sich als unspezifische Rückenschmerzen. Im fortge­ schrittenen Stadium haben sich oft schon Tochter­ geschwülste (Metastasen) in anderen Körperregionen gebildet. Echte Schmerzen sind Zeichen einer fortge­ schrittenen Erkrankung. Die monatliche Selbstunter­ suchung kann helfen, eine Hodenschwellung früh­ zeitig zu erkennen, eine Diagnose zu stellen und die nötigen Massnahmen einzuleiten. Die Motivation zur Selbstuntersuchung ist insbesondere bei sexu­ ell (noch) nicht aktiven jungen Männern zu fördern. Auch gilt es, die Berührungsängste mit dem Urologen oder dem Hausarzt zu mindern. Diagnose beim Arzt Ein erfahrener Arzt kann eine Verdachtsdiagnose bereits aufgrund des Tastbe­ funds stellen. Zusätzlich wird er eine Abklärung mit­ tels Ultra­ schall vornehmen. Definitiven Aufschluss gibt aber nur die feingewebliche Untersuchung des als Ganzes, über einen Leistenschnitt entfernten ver­ dächtigen Hodens. Für diesen Eingriff wird eine Spi­ nalanästhesie (rückenmarksnahe Regionalanästhesie) durchgeführt, und es ist mit einem kurzen Spitalauf­ enthalt zu rechnen. Eine blosse Gewebeprobe durch Punktion oder Teilentfernung ­ erlaubt keine sichere Diagnose und kann mög­licherweise die Ausbreitung in Blut- und Lymphgefässe fördern. Die weiteren Ab­ klärungen dienen dazu, eine allfällige Ausbreitung des Tumors zu beurteilen. Dazu sind Computertomo­ graphie, Ultraschallund eine Blutuntersu­ chung mit Bestimmung der sogenannten Tumor­ marker nötig. Danach wird die Art, Dauer und Intensität der Behand­ lung bestimmt. Therapien Grundsätz­ lich stehen Operation, Chemotherapie und Be­ strahlung zur Auswahl. Im Frühstadium, wenn nur der Hoden befallen ist – ohne Durchbruch durch die umgebenden Hüllen – wird lediglich der betref­ fende Hoden chirurgisch entfernt und zwar durch ei­ nen Hautschnitt in der Leiste. Die Zeugungsfähig­ keit bleibt dadurch erhalten. Die weitere Behandlung hängt vom Tumortyp und vom Krankheitsstadium ab. Bei Befall der Lymphknoten durch Seminome, die sehr strahlenempfindlich sind, werden die Lymph­ wege bestrahlt. Liegt ein Nicht-Seminom vor, so wird an die Hodenentfernung eine kurze, medikamentöse Behandlung (Chemotherapie) angeschlossen. Dabei unterscheiden sich die prophylaktische respektive die therapeutische Chemotherapie in Dauer und Intensi­ tät. Die intensive Chemotherapie läuft heute im Spi­ tal meist ohne grössere Probleme ab. Während der Behandlung können jedoch starke Nebenwirkungen auftreten. Neben Haut- und Schleimhautveränderun­ gen, Übelkeit und Erbrechen wird meist auch der vor­ übergehende Haarausfall von den Männern als belas­ tend empfunden. Nachsorge ist wichtig Vor allem bei Tumoren im Frühstadium ist eine engmaschige Nachkontrolle un­ erlässlich. Anfänglich erhöhte Tumormarker sollten nach der Hodenentfernung in den Normalbereich ab­ fallen. Sie werden im Abstand von ein bis zwei Mo­ naten, später in grösseren Intervallen kontrolliert. Steigen die Tumormarker im Blut wieder an, müssen weitere Abklärungen getroffen werden. Auch nach Jahren kann noch ein Tumor im gegenseitigen Ho­ den auftreten. Hodenersatz aus Silikon Mit einer Hodenprothese kann das Problem eines Hodenverlusts ästhetisch gelöst werden. Für die be­ troffenen Männer ist die Entfernung eines Hodens nicht nur ein kosmetisches Handicap, sondern kann auch zu psychischen Problemen und Minderwertig­ keitsgefühlen führen. Die Hodenimplantate sind un­ schädlich und qualitativ hochstehend. Eingesetzt werden Silikon- beziehungsweise Gelimplantate, de­ ren Material mit den eher bekannten Brustimplanta­ ten praktisch identisch ist. halb von zwei Jahren. Bei jungen Patienten wird vor der Einleitung der Therapie eine Spermienaservierung (Samenbank) empfohlen. Müssen beide Hoden operiert und/oder die Lymph­ knoten ausgedehnt bestrahlt werden, so führt dies zu Unfruchtbarkeit, nicht aber zu Impotenz. Eine regel­ mässige Zufuhr des Geschlechtshormons Testosteron ermöglicht in solchen Fällen weiterhin eine Erektion. Werden beide Hoden operiert, sollten aus kosmeti­ schen Gründen hodenförmige Prothesen in den Ho­ densack eingelegt werden (siehe Box oben). Wichtig ist, dass sich die Patienten und ihre Partnerinnen über Zeugungsfähigkeit und Schwangerschaftsverhütung beraten lassen. Heilungschancen Der Hodenkrebs hat dank der überaus erfolgreichen Kombinations-Chemotherapie eine sehr gute Heilungschance. Chirurgische Mass­ nahmen können zusammen mit einer Strahlen- und Chemotherapie die Fünf-Jahres-Überlebensrate deut­ lich verlängern. Sie liegt mittlerweile bei über 90 Prozent. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass meta­ stasierende Hodentumore als einzige Form von soge­ nannt soliden Tumoren durch die Operation und eine nachfolgende Chemotherapie in bis zu 90 Prozent der Fälle geheilt werden können. Leider gibt es kaum Möglichkeiten, dem Hodenkrebs vorzubeugen, da die Ursachen noch zu wenig bekannt sind. Knaben mit Leistenhoden oder Hodenhochstand sollten sich aller­ dings noch im Vorschulalter operieren lassen. Bleibende Folgen Falls der andere Hoden gesund Der Autor ist, sind nach der Entfernung des erkrankten Hodens keine Spätfolgen zu erwarten. Das Sexualleben der Betroffenen sowie ihre Zeugungsfähigkeit sind nicht beeinträchtigt, denn der gesunde Hoden produziert genügend Geschlechtshormone und Samenzellen. Al­ lerdings treten sogenannte Fertilitätsstörungen (Un­ fruchtbarkeit) bei Hodenkrebspatienten gehäuft auf. Meistens aber erholen sich die samenproduzierenden Zellen auch nach intensiver Chemotherapie inner­ Praxis: Roger Schwab, Dr. med. Facharzt FMH für Urologie, speziell operative Urologie Belegarzt der Privatklinik Linde AG Unterer Quai 92, 2502 Biel 032 323 38 85 [email protected] www.urologe.li med izin ak tue l l 23 Körpertraining im Alter Bewegung als Medizin «Es ist nie zu spät, neue Wege zu gehen» - nach diesem Credo baut das «Schlössli» in Biel sein Bewegungsangebot permanent aus. Neu gibts Rhythmiktraining und einen Schlössliparcours wir machten einen Augenschein und trafen Seniorinnen, Senioren, die Spass an Bewegung und Musik haben. Im hellen Dachstock sitzen zehn ältere Damen und Herren im Kreis und rollen sich auf Zurufen hin einen grossen Gymnastikball zu. Bei den meisten klappt das das ganz gut, wenige stupsen den Ball mit dem Fuss an oder benötigen etwas Unterstützung von Magda­ lena von Känel, der Rhythmikpädagogin, die so mit den Senioren nach der Methode «Jaques-Dalcroze» in ein leichtes Anwärmen wechselt und sich an den Konzertflügel setzt. Die zuvor gesummte Melodie ent­ wickelt sich zum Musikstück, zu der sich schwungvoll mit dem einen und anderen Arm kreisen lässt, um schlussendlich mit beiden Armen so gut es geht in der Luft einen grossen Kreis zu zeichnen. Als Zwischen­ teil zeigt die Kursleiterin, die auch ein Nachdiplom­ studium «Rhythmik für Senioren» abgeschlossen hat, wie sich Füsse und Beine durch Gehen und Stampfen an Ort bewegen lassen. Aber auch Beine ausstrecken, Füsse kreisen und Beine biegen gehört zum Kursinhalt dieses Morgens, sodass letztendlich alle angewandten Bewegungen zu einem abschliessenden Ganzen fin­ den – immer untermalt von Percussion- oder Klavier­ klängen oder Gesang. Sich vor- und zurückbeugen, aus der Kraft der Beine heraus aufstehen, Gewicht von einem Fuss auf den andern verlagern und mit erhobenem Blick das eigene Gleichgewicht (wieder) finden: Was einigen Teilnehmenden mühelos gelingt, erfordert bei anderen ein gehöriges Mass an Mut zum aufrechten Stand und Vertrauen in die Kraft der eige­ nen Beine. Zwei, drei Frauen benötigen die Unterstüt­ zung von Stühlen, andere schaffen das Stehen mü­ helos und scheinen das Sich-Bewegen-Können auch sichtlich zu geniessen. Ähnlich zeigt sich das Bild von noch Aktiveren gegenüber körperlich Schwächeren im Spiel mit dem farbigen Seil, das es zu formen und sich damit zu bewegen gilt: unterschiedliche Farben der Seile, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ausdrucksweisen und -möglichkeiten. Aber eines ha­ ben alle Teilnehmenden gemeinsam: sichtlich Freude an der Bewegung und der Musik. Angebote für jedermann, jederfrau • Rhythmik Jaques-Dalcroze: Emile Jaques-Dalcroze gründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Genf eine Methode der Musik- und Bewegungserziehung. Er entwickelte Übungen mit mehreren Bewegungsab­ läufen, die zu improvisierter Klaviermusik ausgeführt werden. Dieses «Training» soll den Menschen in sei­ ner Ganzheit ansprechen, seine geistige und körperli­ che Beweglichkeit verbessern und Freude an der Mu­ sik vermitteln. Zudem verbessern sich Gehsicherheit und Gleichgewicht, das Sturzrisiko wird vermindert. • Leichtigkeit im Alter: Alltagsaktivitäten wie Gehen, Aufstehen, Treppensteigen usw. werden im Hinblick auf die Aspekte Kraft, Gleichgewicht und Beweg­ lichkeit analysiert und neue Bewegungsmöglichkei­ 24 medizin aktuell Bilder: Olivier Sauter «Es ist nie zu spät, sich für die eigene Bewegung zu begeistern.» Dieser Leitsatz wird im Zentrum für Lang­ zeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG, kurz «Schlössli», aktiv zelebriert. Zur Auswahl stehen verschiedene Bewegungs-Angebote, die für alle älteren Menschen ­offen stehen. ten werden entdeckt und ausprobiert, denn zuweilen «geht» es auch anders, einfacher und leichter. • Kräftig altern: An speziellen Geräten lassen sich Kraft, Ausdauer und Koordination erarbeiten. Unter der fachkundigen Anleitung von Physiotherapeuten werden alle Muskelgruppen trainiert und geeignete Übungen für das Training zu Hause vermittelt. • Schlössliparcours: Seit Mitte September 2012 lässt sich auf dem Inhouse-Parcours durch Gänge und Ab­ teilungen an Sprossenwand, Zugapparat, Tritt oder Trampolin die Kraft und das Gleichgewicht trainieren. Kurzinterview mit Daniel Karau, Leiter ­Physiotherapie Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG «Beim Training rückt das Handicap in den Hintergrund» Verbesserte Beweglichkeit fördert das Wohlbefinden, erhält die Mobilität und stärkt das Selbstvertrauen - sagt man. Doch warum soll jemand im Seniorenalter mit dem Training beginnen, wenn er oder sie vorher ein «Sportmuffel» war? Daniel Karau: Im letzten Jahr haben sich Bewohne­ rinnen und Bewohner des «Schlössli» an einer Studie beteiligt: Die Studie von Eva van het Reve vom Ins­ titut für Bewegungswissenschaften und Sport der Eidgenössischen Hochschule Zürich ETH Dank Training bessere­ hat gezeigt, dass es sich auch noch im ho­ hen Alter lohnt, mit einem Training zu begin­ Balance, grössere­ nen (siehe Box rechts). Denn damit kann oft ­Beweglichkeit, aus einem Teufelskreis ausgebrochen werden: ­weniger Stürze - und Schmerzen führen dazu, dass sich die Men­ schen weniger bewegen, ihre Aktivitäten ein­ mehr Lebensfreude! schränken und das wiederum führt zum Ver­ lust von Fitness und zu Muskelschwäche sowie letztlich zur weiteren Verschlimmerung der Si­ tuation, in der sich die Betroffenen befinden. Geziel­ tes Training wirkt dem entgegen. Daraus resultiert meistens ein gesteigertes körperliches Wohlbefinden. Inwiefern unterscheiden sich die Fitnessgeräte im «Schlössli» Biel von jenen, die man andernorts in Fitnessstudios antrifft? Unsere neuen Kraftgeräte arbeiten mit Luftdruck und bieten die Möglichkeit, mit geringsten Widerständen zu arbeiten. Auf diese Weise ist es möglich, das Trai­ ning genau auf den älteren Menschen abzustimmen. So kann die Beweglichkeit mit weniger Kraft als bei herkömmlichen Maschinen trainiert werden. Website: Zentrum für Langzeitpflege Schlössli BielBienne AG Für SmartphoneBenutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» Das «Schlössli-Fitness» steht Heimbewohnern offen, gleichzeitig aber auch anderen älteren Menschen – welche Erfahrungen machen Sie damit? Gute! Das Training unter fachlicher Anleitung fördert nebst Kraft, Ausdauer und Bewegung auch das Ge­ meinschaftsgefühl, verschafft «Tapetenwechsel» und Gelegenheiten für soziale Kontakte mit anderen Men­ schen: Der Trainer wird zum Gesprächspartner und ist oft auch die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. Zudem stellen wir auch die Hilfsmittelversor­ gung ­sicher. Das Resultat der Studie von Frau van het Reve: Es lohnt, sich zu bewegen! Gehgeschwindigkeit Tiefe Geschwindigkeiten oder kurze und unregelmäs­ sige Schritte sind einige Faktoren, die zu einer er­ höhten Sturzgefahr führen. Ein Ziel der Trainings war es, die Qualität des Ganges anhand dieser Faktoren zu verbessern, um möglichst lange mobil zu bleiben. Nach drei Monaten Training konnte bei allen Bedin­ gungen die Gehgeschwindigkeit verbessert werden. Reaktionszeit Nach drei Monaten Training konnten die Probanden die Reaktionszeit ihrer Hände und Füsse deutlich sen­ ken. Dies hat eine sehr positive Bedeutung, denn bei einem drohenden Sturz kann in Zukunft vielleicht schneller reagiert werden. Beinkraft, Gehtest, Sturzangst Die Angst vor einem Sturz führt dazu, dass ein Mensch seine Gehgeschwindigkeit senkt und kleine Schritte macht. Diese Faktoren führen zu einer erhöh­ ten Sturzgefahr. Beim Fragebogen wurde eine mini­ mal reduzierte Sturzangst angegeben. Kognitiver Test Beim kognitiven Text mussten die Teilnehmer Zah­ len und Buchstaben verbinden. Diese Aufgabe konnte nach der Trainingsphase schneller ausgeführt werden. Die Auskunftspersonen Annegreth Birle Bewegungsbasierte Altersarbeit BFH Daniel Karau Leiter Physiotherapie Kontakt: Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG Mühlestrasse 11, 2504 Biel Tel. 032 344 08 08 [email protected] [email protected] www.schloessli-biel.ch med izin ak tue l l 25 E-Gesundheitsdossier Mehr Qualität und Sicherheit Noch immer werden Millionen von Arztberichten und Rechnungen auf Papier erstellt und per Post versandt. Das ist umständlich, teuer und müsste nicht sein. Der Wandel findet statt, wenn auch derzeit noch eher langsam: Immer mehr Ärzte und Spitäler verarbeiten, digitalisieren und speichern medizinische Daten und Unterlagen elektronisch. Das spart Zeit, ist effizien­ ter, das aufwändige Durcharbeiten papierener Kran­ kengeschichten entfällt. Stattdessen rufen die Ärzte über moderne IT-Sicherheitssysteme Informationen aus elektronischen Patientendossiers ab, greifen auf frühere Arztbefunde, Röntgenbilder oder Laborana­ lysen zu. Damit sind entscheidende Vorteile verbun­ den: Alle für die medizinische Behandlung notwendigen Vorin­ formationen sowie Gesundheits­ Alle Gesundheits­ daten über den Patienten sind daten sicher verfügsofort und rund um die Uhr ver­ bar, für sich und die fügbar. So lassen sich unnötige Doppeluntersuchungen vermei­ ­ganze Familie. den und die Behandlungsqualität und -sicherheit nimmt zu. Online-Gesundheitsdossier Doch die Entwicklung geht weiter: In Zukunft werden die medizinischen Daten nicht nur bei den Leistungserbringern elektro­ nisch verfügbar sein. Auch die Patientinnen und Pa­ tienten können ihre wichtigsten Daten rund um die eigene Gesundheit sicher elektronisch ablegen. Swiss­ com bietet mit dem kostenlosen Online-Gesundheits­ dossier Evita eine solche Lösung: In Evita können alle Informationen rund um die eigene Gesundheit und die der Familie vollständig und sicher im eigenen Ge­ sundheitsdossier hinterlegt werden. Damit sind diese Informationen jederzeit ortsunabhängig abrufbar. Jede Person kann ihre Daten und Informationen etwa über die Blutgruppe, Impfungen, einzunehmende Me­ dikamente, Allergien, Röntgenbilder, Spitalaustritts­ berichte sowie Blutdruck- und Gewichtsmessungen in Evita hinterlegen und im Internet über www.evita.ch oder über die Evita-iPhone-App abrufen. Sicherer Zugang Wichtig: Der Dossierinhaber pflegt seine Daten nicht nur selber, sondern er entscheidet auch selber darüber, wer Zugriff darauf erhält. So kann der Patient einem Arzt oder Familienmitglied den direkten Zugang auf sein Evita-Dossier erlauben oder nur auf Teilinformationen darin. Die in Evita enthaltenen Daten sind verschlüsselt auf einem Ser­ ver von Swisscom gespeichert und werden über einen sicheren Internetzugang abgerufen. Das mehrstufige Loginverfahren mit E-Mail-Adresse, Passwort und wenn gewünscht mit SMS-Code, wie dies auch im Online-Banking angewendet wird, bietet höchstmög­ lichen Schutz gegen unerlaubte Zugriffe. Zudem wird jeder Zugriff sorgfältig protokolliert, dieses Protokoll kann jeder Evita-Kunde in seinem Dossier einsehen. Das Evita Gesundheitsdossier kurz erklärt Evita ist das persönliche, kostenlose Online-Gesund­ heitsdossier für die ganze Familie. In Evita können Gesundheitsinformationen wie Impfdaten, Röntgen­ bilder, Spitalaustrittsberichte, Medikamente sowie Vitaldaten online erfasst werden. Die Dossiers von Familienmitgliedern können einfach über das eigene Dossier verwaltet werden. Das persönliche Evita-Dos­ sier kann über www.evita.ch oder die Evita-iPhone App eröffnet und gepflegt werden. Das Gesundheits­ dossier beinhaltet die folgenden Bereiche, Funktionen und Möglichkeiten: Persönliches: Stammdaten und Zugriffsrechte werden hier verwaltet Gesundheitsdaten: Blutgruppe, Allergien, Medika­ mente, Impfungen, Kontakte zu behandelnden Ärz­ 26 medizin aktuell ten, Dokumentation bisheriger Therapien und Diag­ nosen (etwa Laboranalysen, Röntgenbilder, CT- und MRT-Untersuchungen usw.) sind hier hinterlegt Vitaldaten: Die Werte zu Gewicht, Blutdruck oder Puls können einfach eingetragen werden, von Hand oder auch automatisch über Geräte von Withings (www. withings.com), die angebunden sind Spitalzugang: Der Kunde kann den Zugang zu seinen Daten im Spital freischalten lassen Notfallkontakte: Kontaktinformationen für Notfall­ situa­tionen werden hier hinterlegt Reisedokumente: Kopien von Reisepass, Ausweisen, Tickets oder Reservationen können abgespeichert werden, dies ist besonders auf Reisen sehr hilfreich, sollte mal etwas abhandenkommen Kurzinterview Höchste Sicherheit Warum soll jemand persönliche Gesundheitsdaten online hinterlegen und wie sicher ist dies? Das haben wir Stefano Santinelli von Swisscom Beteiligungen gefragt. Herr Santinelli, was «nützt» ein Online-Gesundheitsdossier? Swisscom und Gesundheit Swisscom verfolgt im Schweizer Gesundheitswesen einen ganzheitlichen Ansatz und setzt dabei auf in­ novative eHealth-Lösungen, die einfach zu bedienen sind und die echten Mehrwert schaffen – für Privat­ personen und Leistungserbringer. So hält Swisscom für Spitäler, Ärzte und andere professionelle Erbringer von Gesundheitsleistungen modernste Kommunika­ tionssysteme und -tools bereit. Auch Privat­personen nutzen verschiedene Produkte und Informations­ services für ihr persönliches Gesundheitsmanage­ ment. Neben dem Evita Gesundheitsdossier etwa auch ein Notrufgerät für zu Hause und unterwegs, das am Handgelenk getragen wird und über das via Knopf­ druck jederzeit die Notrufzentrale erreicht und Hilfe angefordert werden kann. Interessierte finden weitere Informationen zu •Swisscom eHealth-Diensten unter www.swisscom.ch/de/vernetzte-gesundheit Stefano Santinelli: Ein Online-Gesundheitsdossier bietet viele Vorteile: Der Kunde hat seine Gesund­ heitsdaten an einem sicheren Ort hinterlegt und kann jederzeit und überall auf seine gesundheitsbezogenen Daten zugreifen. So zum Beispiel auf Reisen, bei ei­ nem neuen Arzt oder im Notfall. In einem Online-Ge­ sundheitsdossier kann der Kunde auch Vitaldaten wie Gewicht, Blutdruck und Puls hinterlegen und hat so die Entwicklung seiner Werte immer im Griff. Einige sorgen sich darum, dass persönliche und hochsensible Daten in die falschen Hände gelangen – sind diese Bedenken unbegründet? Die Gesundheitsdaten sind natürlich sehr schützens­ wert. Wir benutzen bei Swisscom die besten heute verfügbaren Sicherheitstechnologien und halten uns strikt und mit grosser Sorgfalt an das Datenschutz­ gesetz sowie die Datenschutzverordnung. Die Daten in Evita sind nicht irgendwo im Internet gespeichert, sondern auf sicheren Servern bei Swisscom, wo sie verschlüsselt abgelegt sind. Die Daten können selbst­ verständlich durch niemanden eingesehen werden, auch nicht durch unsere Mitarbeitenden. Allein der Kunde entscheidet, wer auf seine Daten zugreifen darf, indem er die entsprechenden Berechtigungen selber vergeben kann, zum Beispiel seinem Arzt oder Familienangehörigen. Die Auskunftsperson •Evita-Gesundheitsdossier unter www.evita.ch Stefano Santinelli Head of Business Development Swisscom Beteiligungen Kontakt: [email protected] Für Smartphone-Benutzer: Bildcode scannen, etwa mit der App «ScanLife» med izin ak tue l l 27 Privatklinik Linde AG Biel aktuell Für die Augen nur das Beste ­ Medizinvorträge: Agenda bis Juni 2013 Die Privatklinik Linde verfügt über ein neues Augenzen­ trum. Auf 150 Quadratmetern steht seit Anfang September eine Einrichtung bereit, die eine hochqualifizierte Diagnostik und Behandlung auch von Patienten mit schweren 21. Januar Endometriose Referentin: Dr. med. Marion Beer Augenleiden erlaubt. 4. Februar Mit der Eröffnung des Augenzentrums Anfang September 2012 im Gebäude des Radio-Onkologiezentrums Biel-Seeland-Berner Jura AG, gleich vis-à-vis dem Klinik-Hauptgebäude, baute die Privat­ klinik Linde ihre Kapazitäten im OP-Bereich aus. Das wurde nötig, nahm doch die Anzahl ophthalmologischer Eingriffe in den letz­ ten Jahren stetig zu. Allein 2011 wurden in der Privat­klinik Linde über 3000 Augenopera­ tionen durchgeführt. «Mit dem neuen Augenzentrum schaffen wir die für die Zu­ kunft nötigen Kapazitäten und stellen sicher, dass die Patientinnen und Pa­tienten aus der Region Biel-See­ land sowie dem Berner Jura vor Ort, ohne Verzögerun­ gen und Wartezeiten be­ handelt werden können», erklärt Klinikdirektor Max Rickenbacher. Rund 1,5 Millionen Franken investierte die Privatklinik Linde in das neue Augenzentrum. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern sorgen dort nun die Linde-Belegärztinnen und Belegärzte Dr. med. Barbara Frank Dettwiler, Dr. med. Barbara Perren Zimmerli, Dr. med. Maria Wegmann Burns, Dr. med. Rainer Adam, Dr. med. Pe­ ter Trittibach und Dr. med. Beat Zbinden für eine optimale augen­ chirurgische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Das Be­ handlungsspektrum umfasst moderne mikrochirurgische Eingriffe zur Behandlung von Katarakt (Grauer Star) und Glaukom (Grüner Star), Operationen an Hornhaut und zur Behandlung des Schielens, Eingriffe an den Tränenwegen sowie künftig auch Lidkorrekturen, Netzhaut- und Glaskörperchirurgie. «Damit deckt das Augenzen­ trum der Privatklinik Linde ein Spektrum ab, das an die Leistungen eines Zentrums­spitals heranreicht», betont Max Rickenbacher. m ed i zi n akt u e ll Das Magazin erscheint wieder im Mai 2013 unter­anderem mit diesen Themen: Gebärmutterentfernung, wann ist sie nötig, wann nicht? | Kopfschmerzen, ihre Ausprägungen und Ursachen | Zahn­ medizin und -pflege 28 medizin aktuell Arthrose des oberen Sprunggelenks Referent: Dr. med. Attila Vásárhelyi 18. Februar Darmpolypen und -krebs Referentin: PD Dr. med. Maria-Anna Ortner 25. Februar Sausen, Pfeifen, Tinnitus Referent: Dr. med. Thomas Schweri 11. März Das Kunstgelenk an Hüfte und Knie Referent: Dr. med. Heiner Reichlin 25. März Hautkrebs Referenten: Dr. med. Eugen Hübscher und Dr. med. Raphael Wirth 27. Mai Schlafstörungen Referent: Dr. med. Urs Aebi 17. Juni Hämorrhoiden Referentin: Dr. med. Monika Richter Beginn jeweils um 19.00 Uhr im Restaurant der Privatklinik Linde AG, Blumenrain 105, Biel Die Vorträge sind öffentlich und kostenlos Anmeldung erforderlich unter Tel. 032 385 36 31 oder mit E-Mail an [email protected]