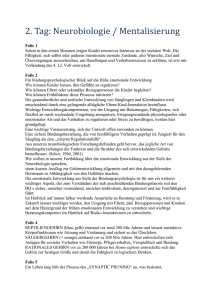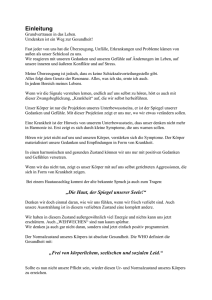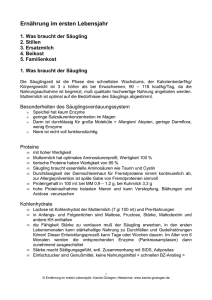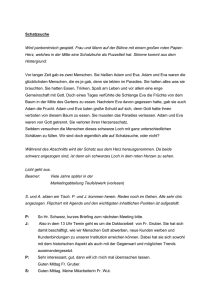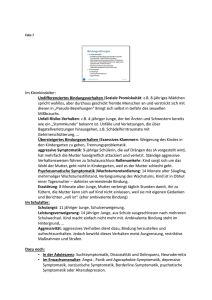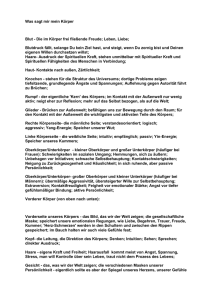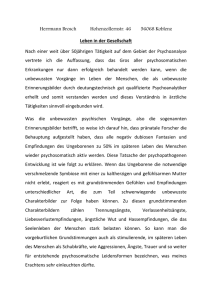Kinder aus Problemfamilien
Werbung

Kinder aus Problemfamilien Als Problemfamilien bezeichnen wir Familien, die einerseits besonderen äußeren Belastungsfaktoren, wie Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Trennung usw. ausgesetzt sind und die andererseits über mangelnde Bewältigungsmittel und -kompetenzen verfügen. Die moderne Armutsforschung erfasst im „Lebenslagenansatz“ neben dem Einkommen der Eltern auch Bildung, Wohnung, Gesundheit und die Fähigkeit der Betroffenen Notlagen realitätsgerecht wahrnehmen, verarbeiten und bewältigen zu können. (s. Altgeld, T. / Hofrichter, P. (Hrsg.) Reiches Land- Kranke Kinder? Gesundheitliche Folgen von Armut bei Kindern und Jugendlichen. Ffm 2000 ) Die Problematik lässt sich als ein Zusammenspiel zwischen äußeren Faktoren und individuellen, familienspezifischen Kompetenzen und Inkompetenzen beschreiben. Eltern, die für sich und ihre Familie keinen Weg aus der Notlage finden, leiden unter starken Minderwertigkeits- und Schamgefühlen und verlieren den Blick für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Kinder aus benachteiligten Familien haben das höchste Erkrankungsrisiko, für körperliche und seelische Krankheiten und soziale und seelische Entwicklungsstörungen. Unter seelischer Krankheit ist nicht das subjektive Leiden der Kinder an einer objektiv belastenden Situation zu verstehen, „Krankheit“ bezeichnet den Verlust oder die schwerwiegende Einschränkung der Fähigkeit, günstige Bedingungen und Hilfesysteme und –angebote zu nutzen. Eine Untersuchung des Zentralinstitutes für seelische Gesundheit in Mannheim, die die Entwicklung von Kindern mit Schwangerschaft- und Geburtsrisiken über viele Jahre verfolgt, kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder aus benachteiligten Familien „in allen Entwicklungsbereichen ungünstigere Kennwerte“ ausweisen, als unbelastete Kinder.( Laucht, M., u.a., Viereinhalb Jahre danach: Mannheimer Risikokinder im Vorschulalter. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 24. Jg., 1996, S. 67 ): Wissen und Lernfähigkeit von Kindern aus benachteiligten Familien sind bereits im Vorschulalter geringer entwickelt und ihre Bildungschancen verschlechtern sich im Laufe der Schulzeit weiter. Wahrnehmung und Umgang mit eigenen Gefühlen, Impulsen und Motiven befinden sich auf einem niedrigen Entwicklungsniveau. Soziale Kompetenz und Beziehungsfähigkeit sind gekennzeichnet durch eingeschränkte Konfliktfähigkeit, mangelndes Selbstwertgefühl, Rückzugstendenzen, Ohnmachtsgefühle und wenig ausgebildete Vorstellung von Wirkmächtigkeit. Der Wunsch nach Hilfe steht im Konflikt mit Scham und Wut über die Benachteiligung und der Sehnsucht sich aus eigener Kraft befreien zu können. Depressive Abhängigkeit mit übermäßiger Anspruchshaltung und/oder Aggressivität, Destruktivität, dissoziales Verhalten 1 usw. sind pathologische Versuche unerträglich erlebte Ausweglosigkeit und Abhängigkeit ins Gegenteil zu verkehren und zum Handelnden zu werden. Die Entwicklungsdefizite von Kindern aus Problemfamilien verstehen wir auf dem Hintergrund der chronischen Überforderung ihrer Eltern. Kleine Kinder bedürfen für ihre Entwicklung der zuverlässigen Verfügbarkeit von Erwachsenen. Erst durch die Erfahrung, dass ängstigende Situationen durch Schutz, Führsorge und Unterstützung gut ausgehen, erwerben Kinder die Sicherheit, Anforderungen und unbekannte Situationen als bewältigbare Herausforderung und nicht als lebensbedrohliche Gefahr wahrzunehmen. Die Bewältigung von Neuanforderungen stärkt das Vertrauen in die eigene Kompetenz und die Sicherheit von Beziehungen. Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, dass die Reifung des kindlichen Gehirns, die zunächst einem genetischen Programm folgt, im Verlauf der kindlichen Entwicklung in hohem Maße abhängig von der Erfahrung des Kindes ist, in der Auseinandersetzung mit seiner sozialen Umwelt funktionstüchtig zu sein. Chronisch überforderten Eltern, die sich in ihrer Lebensbewältigung als unzulänglich und als Verlierer der Gesellschaft erleben, kann es nur schwer gelingen, ihren Kindern ausreichend Orientierung und Sicherheit zu signalisieren. Im Gegenteil wünschen sie sich von ihren Kindern die Bestätigung und Anerkennung, die sie sonst vermissen. Ausreichend gute Bedingungen für die frühe Entwicklung Die ersten sechs Monate Vorstellungen über optimale Entwicklungsbedingungen und Anforderungen an das elterliche Verhalten werden polarisierend diskutiert, das tatsächliche Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern verändert sich dagegen wenig. Uns geht es nicht darum, die Vorraussetzungen für eine gute kindliche Entwicklung umfassend zu beschreiben. Wir beschäftigen uns mit einzelnen Aspekten der gelingenden und misslingenden Beziehung zwischen Eltern und Kind, um besser zu verstehen, wie Kindern, die offensichtlich ungenügende Bedingungen für ihre gute Entwicklung hatten, geholfen werden kann. Es überrascht uns immer wieder, wie gut sich manche Kinder unter schlechten Bedingungen entwickeln und andere trotz relativ guter Vorraussetzungen große Probleme haben. Jahrtausende menschlicher Entwicklung zeigen, dass wir eine robuste, anpassungsfähige Gattung sind, trotz bzw. wegen unserer besonderen Hilflosigkeit am Anfang unseres Lebens Die frühe Geburt des Menschen ermöglicht ihm eine besonders gute Anpassung an die bestehenden Lebensverhältnisse, macht ihn aber auch extrem abhängig davon, dass sich jemand seiner absoluten Abhängigkeit entsprechend verhält. 2 Das menschliche Neugeborene ist während seiner ersten Lebensmonate wegen seiner physiologischen Unreife auf eine umfassende Versorgung und die nahezu uneingeschränkte Verfügbarkeit eines verlässlichen anderen, z.B. die Mutter, angewiesen. Es hat keine Vorstellung davon, was es braucht und was zur Befriedigung seiner Bedürfnisse notwendig ist. Wir verstehen seinen Zustand als „absolute“ oder „doppelte Abhängigkeit“. Seine körperlichen Bedürfnisse lösen ängstliche Erregtheit aus, die der Säugling zunächst durch sofortiges, lautes Schreien, so als ginge es um sein Leben, zum Ausdruck bringt. Erst die schnelle Reaktion der Mutter, ihr Wissen, was dem Säugling fehlt und ihre Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass er bekommt, was er braucht, auch gegen seinen eventuellen Widerstand führen dazu, dass sich ein sehr unangenehmer Zustand in einen sehr angenehmen verwandelt, wütendes Gebrüll weicht wohligem Glucksen. Nähe, Aufmerksamkeit und Handlungsfähigkeit der Mutter geben dem Säugling Sicherheit bzw. signalisieren, „dass alles gut wird“ eine wichtige regulierende Funktion, die das Kind nur schrittweise selbst übernehmen kann. Das Gelingen der frühen Interaktion zwischen Mutter und Kind ist vorgebahnt durch biologisch-genetische Vorraussetzungen der beiden, der gesunde Säugling ist von Anfang an auf seine Mutter ausgerichtet, diese verfügt über korrespondierende Reflexe, um ihr Kind zu verstehen und entsprechend seiner Bedürfnisse zu versorgen. Störungen werden in der Regel gut bewältigt und tragen zu einer Entwicklung der Beziehung bei. Ein Misslingen der frühen Interaktion beruht auf verschiedenen, sich negativ verstärkender Faktoren. Die mütterliche Kompetenz kann durch traumatisierende Erfahrungen, Krankheit, schwerwiegende äußere Umstände geschwächt sein. Krankheit, Entwicklungsverzögerungen, Anpassungsstörungen, schwieriges Temperament des Kindes erschweren den Verständigungsprozess. Gelingt die Verständigung, entwickelt der Säugling schon nach kurzer Zeit so etwas wie Vertrauen, dass sich Unbehagen in Behagen verwandeln wird. Die Eltern beobachten, dass ihr Kind nicht mehr sofort aus vollem Halse brüllt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sondern vorher eine Weile durch Unruhe und Unlustgeräusche auf sich aufmerksam macht, erst wenn nicht die entsprechende Wirkung folgt, beginnt es mit dem Gebrüll. Zuverlässige Versorgung, bestätigendes, beruhigendes oder aufmunterndes Eingehen auf das Kind, regelmäßige, vorhersehbare Abläufe… führen dazu, dass das Kind sich geborgen fühlen kann, so als lebte es in einer Welt die ganz seinen Bedürfnissen angepasst ist. Trotz seiner absoluten Abhängigkeit braucht es sich nicht ausgesetzt und bedroht zu fühlen. Eine Illusion, die durch die Bereitschaft der Eltern, sich für eine kurze Zeit ganz auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzustellen zur Realität wird und zu dem führt, was wir 3 „Urvertrauen“ nennen, ein Vertrauen in sich und die Welt, bzw. eine Gewissheit des Kindes, dass es selbst und die Welt gut zusammen passen. Auf diesem Hintergrund entwickelt sich der Säugling rasant, nimmt sich als Ganzes innerhalb seiner Körpergrenzen wahr, unterscheidet innen und außen, sich und den anderen , erlebt Impulse und Gefühle von sich ausgehend, sich in seinen unterschiedlichen Verfassungen als derselbe und als jemand, der etwas bewirken kann. Entsprechend der Differenzierung seiner Selbst-Wahrnehmung nimmt er seine Umgebung, Handlungsabläufe und Zusammenhänge wahr und entsprechend differenziert sich auch die Vorstellung von der Mutter als erstem bedeutenden Anderen.. Am Anfang ist das Paar. „So etwas wie ein Baby gibt es nicht“ schreibt der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker D.W. Winnicott provozierend, weil ein Baby, ohne eine versorgende Person, die sich seiner Bedürftigkeit annimmt nicht überleben kann und weil die weitere Entwicklung des Kindes elementar davon abhängt, ob das Baby ausreichend gut versorgt wurde. Die Ergebnisse der Säuglingsforschung haben gezeigt, wie aktiv der Säugling von Anfang an ist und wie er die Kommunikation mit den Eltern aktiv mitgestaltet, wie er vehement darauf besteht, selbst etwas bewirken zu können. Gibt man z.B. dem Säugling durch eine Versuchsanordnung die Möglichkeit ein Klangmobile in Bewegung zu setzen, hält sein Interesse an dem Mobile dreißig mal länger an, als wenn er passiv verfolgt, wie jemand anderes an- und ausschaltet. (Vergl. Dornes, Der kompetente Säugling, die präverbale Entwicklung des Menschen,Ffnm 1993). Die Aktivität schon des jungen Säuglings im Kontakt mit seiner Umwelt, seine offensichtliche Lust am Spiel mit einem vertrauten Gegenüber, seine vielfältigen Kompetenzen Beziehung aufzunehmen und zu gestalten usw. machen sein angewiesen sein auf ein Gegenüber deutlich, dass versteht, antwortet und reagiert, als könne er sich schon differenziert ausdrücken. Paradox ist, dass der Säugling meistens noch nicht weiß, was er sucht, was ihm fehlt usw., erst die richtige Reaktion erzeugt das Gefühl, genau das gefunden zu haben, was er gesucht hat. Eine hohe Anforderung an die Souveränität der Mutter, so muss sie einerseits fähig sein sich emotional ganz auf den Säugling einzustellen und andererseits ganz bei sich und der Gewissheit bleiben, dass nur sie wissen kann, was zu tun ist und dass sie schon das richtige tun oder haben wird. Diese schwere Aufgabe könnte nicht gelingen, wenn wir Menschen keine genetischen Vorraussetzungen dafür mitbringen würden. Doch biologische Anlagen brauchen äußere Bedingungen um sich entfalten zu können, bzw. sind durch schlechte Bedingungen (zer)störbar. Gerade Menschen, die wenig gute Erfahrungen 4 während ihrer Kindheit gemacht haben, wünschen sich oft besonders sehnlich durch eigene Kinder endlich Geborgenheit, Sicherheit und bedingungslose Liebe zu finden. Bedürftigkeit in diesem Sinne ist eine schlechte Vorraussetzung für den guten Umgang mit einem Neugeborenen. „ Er konnte mich von Anfang an nicht leiden!“, antwortet eine Mutter, die wegen der Schwierigkeiten mit ihrem acht jährigen Sohn in meine Sprechstunde kam, auf die Frage, wann die Probleme angefangen hätten. Kurz nach der Geburt in einem Krankenhaus war ihr Sohn auf die Säuglingsstation verlegt worden, weil es Hinweise auf eine Infektion gab. Als er ihr am Abend des nächsten Tages wiedergebracht wurde, habe er sofort beim Anblick der Mutter angefangen zu schreien. Zwar hätten die Pflegerinnen beteuert, dass ihr Sohn sie liebe, aber sie habe ja gemerkt, dass das nicht stimmen könne und so sei es bis heute geblieben. Gegenüber anderen verhalte er sich ängstlich, schüchtern und sehr angepasst, zur Mutter sei er frech, habe schlimme Wutanfälle, beschimpfe sie, trete nach ihr, lüge und stehle ihr Geld aus dem Portemonnaie. Der Vater bestätigt, dass in den Wutanfällen des Sohnes ein Hass auf die Mutter zum Ausdruck komme, der ihn erschrecke. Diese Mutter hatte sich auf dem Hintergrund ihrer eigenen schlimmen Geschichte nichts sehnlicher gewünscht, als ein Kind, das sie so lieben und versorgen wollte, wie sie es selbst gebraucht hätte und durch das sie endlich die Bestätigung und Liebe erfahren würde, nach der sie sich schon so lange sehnte. Statt mit einem niedlichen Baby beglückt, wurde die Mutter mit einem wütend schreienden Etwas konfrontiert, sofort, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte, wurde sie von schlechten Gefühlen aus ihrer Vergangenheit überschwemmt. Selbstunsicher, verletzt und enttäuscht konnte sie ihr Kind nicht mehr als hilfloses Neugeborenes erkennen sondern fühlte sich unterlegen und abhängig von dessen Gunst und Anerkennung. Es entwickelte sich eine angespannte, schwierige Mutter-Kind-Beziehung. Aversive Gefühle der Mutter gegenüber dem Neugeborenen, anhaltender Schrecken darüber, dass es statt lieb und niedlich, schwierig, wütend, gierig usw. ist, verstärken Ängste und Spannungen des Kindes. Statt des Gefühls selbstverständlich in der Welt aufgehoben zu sein, entwickelt das Kind korrespondierend eine angestrengt defensive Haltung, die einen unbeschwerten, spontanen Zugang zur Welt verhindert und eine korrigierende Beziehungserfahrungen fast unmöglich macht. In ungezügelten Wutdurchbrüchen entladen sich Anspannung und aufgestaute Angst und Verzweiflung rauschhaft, letztlich bestätigen die Durchbrüche aber nur die Gewissheit von Ausweglosigkeit. 5 Das zweite Halbjahr Zurück zu der Entwicklung auf dem Hintergrund ausreichend guter Bedingungen, Im sechsten Lebensmonat ist die psychische Entwicklung des Kindes unter guten Bedingungen soweit fortgeschritten, dass es die Getrenntheit von sich und der Mutter/dem Vater realisiert, d. h. eine Trennung von Ich und Du vollzieht, lange bevor es dafür einen symbolischen/sprachlichen Ausdruck gibt. Hinweise für diese „Erkenntnis“ des Babys finden wir in seinem Verhalten: Bis jetzt hatte es jeden Gegenstand in seiner Nähe, der sein Interesse fand, gegriffen, mit sichtlicher Lust in den Mund gesteckt, darauf rumgekaut, damit hantiert und ihn nach einiger Zeit fallengelassen. Irgendwann im sechsten Monat können wir beobachten, dass sich das Verhalten des Kindes um eine bedeutungsvolle Komponente erweitert. Bevor es sich in einer fremden Umgebung Gegenstände, die sein lustvolles Interesse finden, greift, nimmt es jetzt Kontakt zu seiner Mutter/seinem Vater auf, erst wenn diese/r keine Bedenken signalisiert, greift es zu. Diese Verhaltensveränderung weist daraufhin, - dass das Kind begonnen hat, die Eltern als „Instanz“ wahrzunehmen, zu der es Kontakt aufnehmen kann bei der Erkundung einer Welt, die es noch nicht kennt; - dass es sich selbst als jemand wahrnimmt, der etwas vorhat - und dass es in seiner Vorstellung eine Welt gibt, außerhalb der Beziehung zwischen sich und der Mutter/dem Vater. Die Interaktion zwischen Eltern und Kind: ich habe etwas interessantes entdeckt, darf ich mich nähern, es greifen, aufessen, umwerfen, mich rein oder raufsetzen….. wiederholt sich in den folgenden Monaten entsprechend der motorischen Entwicklung des Kindes unzählige Male, von den Eltern meistens unbemerkt. Videoaufzeichnungen von Eltern und Kindern in gemeinsamen Situationen zeigen, dass fragende Impulse vom Kind und antwortende Reaktionen der Eltern in dieser Zeit mehrmals in einer Minute ausgetauscht werden, ohne dass die Eltern sich dessen bewusst sind. Mit seinen Eltern über ein sicheres „Navigationssystem“ verbunden lernt das Kind seine Umwelt kennen, den Umgang damit und traut sich, sich immer weiter von seinen Eltern zu entfernen. Durch die sichere “Navigation“ erscheint ihm einerseits die Welt regelhaft und verstehbar, andererseits bildet sich eine innere Sicherheit aus, dass es in verwirrenden, gefährlichen Situationen eine Sicherheit spendende Instanz gibt. Ob die Eltern ängstlich oder draufgängerisch sind spielt für das Sicherheitsgefühl des Kindes keine Rolle, wichtig ist, dass es ihre Signale als zuverlässig erlebt. Auch große Unterschiede in der Weltwahrnehmung der Eltern verunsichern es in der Regel nicht. Wir können 6 beobachten, dass das Kind sich in Gegenwart des Vaters entsprechend seiner Signale und in Gegenwart der Mutter entsprechend derer verhält, es lernt so zwei Möglichkeiten des Herangehens und Umgehens. Problematisch sind unzuverlässige Signale der Eltern, d.h. wenn das Kind sich nicht darauf verlassen kann, dass das wahrgenommene Signal, „mach nur“ in der Regel einen guten Ausgang der Aktion sichert. Z.B. wenn Eltern den Kontakt zu dem sich entfernenden Kind nicht gut aufrechterhalten können; seine Fähigkeiten über- oder unterschätzen; ihre Wünsche, wie das Kind sich verhalten soll, in krassem Wiederspruch zu ihren eigenen Möglichkeiten stehen. Eine ängstliche, sehr schüchterne Mutter z.B., die sich durch ihre Schüchternheit immer benachteiligt gefühlt und selbstbewusstere Menschen bewundert und beneidet hat, will auf jeden Fall verhindern, dass ihr Sohn, Kevin, genauso ängstlich wird, wie sie. Sie bestärkt ihn in seinem expansiven Verhalten, ist stolz, wenn er sich fordernd und draufgängerisch verhält, setzt ihm wenig Grenzen usw. Diese Mutter besucht nun, als Kevin Monate alt ist, mit ihm eine Krabbelgruppe. Die Kinder spielen auf einem Teppich mit Klötzen und Autos, die Mütter unterhalten sich. Plötzlich werden sie durch lautes Gebrüll unterbrochen. Kevin zerrt an einem Bagger, den ein anderes Kind festhält. Beide schreien. Kevin holt aus und haut dem anderen mit einem langen Klotz kräftig auf den Kopf. Dessen Mutter springt auf und trägt ihr weinendes Kind tröstend weg. Entsetzt blicken die anderen Mütter auf Kevins Mutter…. Kevins Mutter fühlt sich angegriffen, durch Kevins Verhalten bloßgestellt und beschämt. Wütend mit Kevin schimpfend und Strafe androhend verlässt sie die Krabbelgruppe. Eine Situation, die so oder ähnlich jeder Mutter, jedem Vater sich schon öfter passiert ist. Die Impulsivität ihrer Kinder bringt Erwachsene leicht in heikle Situationen, in denen sie überreagieren, danach tut es ihnen leid. Wenn das Kind regelhaft die Erfahrung macht, dass es dann, wenn es sich so verhält, wie die Eltern es wünschen, diese in Verlegenheit bringt und z.B. großer Ärger die Folge ist, bleibt es in sozialen Situation unsicher und orientierungslos. Kinder die keine sicheren Signale bekommen erleben einerseits eine verwirrende, wenig einschätzbare Welt ohne sichere Regeln und andererseits, dass es in gefährlichen Situationen keine sichernde Instanz gibt. Ihre Fähigkeit diese Funktion für sich selbst zu übernehmen, kann sich nur unzulänglich entwickeln, sie können lebenslang von äußerer Regulation abhängig bleiben. Bedeutung der Aggression für die kindliche Entwicklung 7 Ein gesundes, lebensfrisches Neugeborenes kaum auf der Welt, verhält sich hemmungslos aggressiv, es schreit, tritt, boxt, saugt, beißt und spuckt… rücksichtslos und absichtslos. Die Eltern reagieren beglückt, sie erleben das energievolle Agieren ihres Kindes als Ausdruck seiner Vitalität und Gesundheit, sein wütendes Gebrüll als Hinweis darauf, dass seine Bedürfnisse sofort befriedigt werden müssen. Bereitwillig lassen sie sich bei jeder Tätigkeit zu jeder Tageszeit unterbrechen und beugen sich dem Diktat der absoluten Bedürftigkeit. Sie können das, weil sie wissen (normalerweise), dass dieser Zustand vorübergeht. Vermittelt durch das Verhalten der Eltern erlebt der Säugling eine Welt, die ganz seinen Bedürfnissen entspricht, bzw. erlebt er eine Welt, in der seine Bedürfnisse deren Befriedigung erzeugen. Objektiv abhängig und ohnmächtig erlebt sich der Säugling wirkmächtig und stark. Kraftvolle Motorik signalisiert den Eltern Gesundheit und gutes Gedeihen, die sie freudig und stolz begleiten, so dass sich lustvolle Interaktionen ergeben, in denen der Säugling in seiner ganzen Lebendigkeit bestätigt wird. In diesem Sinne ist Aggressivität am Anfang des Lebens nichts anderes als Vitalität und deren lustvolles Erleben. Im sechsten Lebensmonat ist die psychische Entwicklung des Säuglings normalerweise soweit fortgeschritten, dass er sich, wie oben beschrieben, innerhalb seiner Körpergrenzen als Einheit erlebt, innen und außen unterscheidet, sich und andere als getrennt voneinander wahrnimmt, sich als Initiator seines Handelns und seine Impulse aus seinem Inneren kommend empfindet. Entsprechend seiner Vorstellungen von sich, entwickelt sich die Vorstellung des Säuglings von seiner Mutter als einer endlichen Person. Diese „Erkenntnis“ konfrontiert ihn mit seiner Abhängigkeit von der Mutter, von ihrem Funktionieren, von ihrer Anwesenheit und damit, dass seine Impulsivität und wilde Bedürftigkeit ihr möglicherweise schaden könnten. Die Vorstellung, dass ein sechs Monate altes Kind seiner Mutter schaden könnte ist angesichts der objektiven Größen- und Kraftverhältnisse nur schwer nachvollziehbar. Sie entspricht der Heftigkeit von Gefühlsstürmen, denen sich das kleine Kind ausgesetzt fühlt, die es als gewaltig, explosiv o.ä. erlebt und die es selbst noch nicht kontrollieren kann. Die erlebte Mächtigkeit löst, wenn sich das Kind wieder beruhigt hat, die Sorge aus, „der Anfall“ könnte einen entsprechend großen Schaden angerichtet haben. Im Ungang mit Kindern in diesem Alter kann man beobachten, dass sie , wenn sie sich wieder beruhigt haben, nach der Mutter sehen, Kontakt aufnehmen, eine freundliche Geste machen, ihr einen Gegenstand hinhalten o.ä. Diese Gesten haben Ähnlichkeit mit Entschuldigungsritualen von Erwachsenen, von denen das nicht mal einjährige Kind ja noch nichts wissen kann. Entsprechend bezeichnet Winnicott ( D.W. Winnicott, Die Entwicklung der Fähigkeit der Besorgnis (Concern) 1962, in: Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, Gießen 2001 ) der das 8 Verhalten der Kinder als „Wiedergutmachungsgeste“ und versteht sie als Ausdruck der Besorgnis des Kindes, die Personen, von denen es sich ganz abhängig fühlt, könnten beschädigt worden sein oder sich von ihm abwenden, weil es so schlimm war. Die „Besorgnis“ des Kindes hat also zwei Komponenten, das Erschrecken über das, was in ihm steckt, was es damit anrichten könnte und das Wohlergehen der für ihn wichtigsten Menschen. In der Zeit der absoluten Abhängigkeit von der Fürsorge der Eltern nimmt das Kind seine Abhängigkeit nicht wahr, es fühlt sich nur gut oder schlecht und weiß nicht, welcher Aufwand notwendig ist, damit es ihm gut geht. Unter normalen Umständen empfindet es eine selbstverständliche Verbundenheit in dieser Zeit. Schwerwiegende Mangelerfahrungen in dieser ersten Zeit werden entsprechend auch nicht als ein Versagen der Umwelt wahrgenommen, sondern als ein furchtbares Selbsterleben. Erst die Vorstellung von sich als einer Person ermöglicht die Vorstellung eines abgegrenzten anderen, von Abhängigkeit und Beziehung und löst die Angst aus, den anderen verlieren zu können. Während der folgenden Monate ist das Kind darauf angewiesen, dass seine Eltern haltbarer und robuster sind, als es befürchtet. Heftige Wut Attacken mit entsprechenden grandiosen Vorstellungen des Kindes werden dadurch relativiert, dass die Welt nach dem Wutanfall nicht anders aussieht als vorher, dass seine Eltern den Ausbruch unbeschadet überlebt haben. Ihr reales Überleben ermöglicht dem Kind Realität und Phantasie zu unterscheiden und die reale Welt, entgegen den Turbulenzen in seinem Inneren als zuverlässig und beständig zu erleben. In diesem Zusammenhang haben Zusammenstöße mit der Realität eine heilsame, beruhigende Wirkung. Erleichtert nimmt das Kind nach einem heftigen Wutanfall wahr, dass das Leben einfach weitergeht und dass es sich um seine Existenz keine Sorgen machen muss, weil seine Eltern auch weiterhin für es sorgen. Das Kind lernt, dass extreme Gefühle und monströse Phantasien die Beziehung nicht zerstören. Durch einen angemessenen, dem Alter des Kindes entsprechenden Umgang der Eltern, kann das Kind aggressive Gefühle und destruktive Phantasien als Teil von sich annehmen und einen angemessenen Umgang damit lernen. Entsprechend der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Eltern bilden sich innere Strukturen, die im weitern Verlauf Schritt für Schritt die regulierende Aufgabe der Eltern übernehmen und dem Kind Halt und Selbstsicherheit geben. Am Ende des zweiten Lebensjahres hat das Kind dann eine relativ stabile psychische Struktur erworben. Kinder, die obwohl sie in ihrer ersten Lebensphase gut versorgt wurden, deren Eltern sich in der beschriebenen zweiten Phase jedoch nicht als haltbar erweisen, verlieren das primär 9 erworbene Vertrauen in eine sichere, bergende Umwelt, so als hätte es sie nicht gegeben. Resultierende strukturelle Defizite stellen ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für psychische Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Beziehungsstörungen und psychosomatische Krankheiten dar. Vor dem Ende des zweiten Lebensjahres kann das Kind das „Versagen“ seiner Eltern noch nicht unabhängig von sich begreifen, bzw. von sich unabhängige Faktoren als Ursache ihres Ausfallens annehmen. Egal ob Mutter/Vater sterben, krank werden, das Kind verlassen, auf Grund eigener Belastungen dem Kind nicht gerecht werden können usw. das Kind erlebt sich, bzw. seine aggressiven und destruktiven Anteile als einzige Ursache. Entsprechend der jetzt wahrgenommenen eigenen Abhängigkeit, kann es sich seine Eltern nicht unabhängig von sich vorstellen, wie es sich überhaupt die Welt nicht unabhängig von sich selbst vorstellen kann. Gesunde Kinder in diesem Alter können die Trennung von ihrer Mutter für eine bestimmte Zeit gut überbrücken, ohne die innere Verbindung zu ihr zu verlieren. Im Spiel beschäftigen sie sich mit dem Erlebten, wiederholen Trennungssituationen und inszenieren Rückkehr und Wiedersehen, spielerisch geben sie den ausgelösten Gefühlen Ausdruck, in dem sie z.B. eine Puppe trösten, wegwerfen oder freudig begrüßen. Kehrt die Mutter zurück wird sie freudig begrüßt. Dauert die Trennung so lange, dass das Kind Angst bekommt, sie komme nicht wieder, kann es die ausgelösten Gefühle nicht mehr ausschließlich spielerisch bewältigen. Die Mutter wird bei ihrer Rückkehr mit Schmerz, Wut und Ablehnung konfrontiert, d.h. das Kind braucht die reale Anwesenheit und Unterstützung der Mutter, um ausgelöste Ängste verarbeiten zu können und sich innerhalb der Beziehung wieder sicher zu fühlen. Bleibt die Mutter noch länger weg, so dass die ausgelöste Wut nicht mehr bei ihr untergebracht und von ihr gehalten werden kann, verblasst das innere Bild der Mutter. Das Kind glaubt, den Verlust der Mutter verschuldet, verursacht zu haben. Es ist sich gewiss, dass es für die Menschen, die es braucht, gefährlich oder nicht auszuhalten ist. Ängstlich stellt es sich auf die neue Situation ein, orientiert sich an äußeren Bedingungen und vermeidet den Kontakt zu seinen Gefühlen, es wirkt gehemmt, unlebendig und übermäßig angepasst. Kommt die Mutter zurück oder nimmt sich eine andere Person zuverlässig des Kindes an, verharrt es lange Zeit in dieser eingefrorenen, defensiven, hoffnungslosen Haltung. Es verhält sich zurückhaltend, umgänglich und nimmt nur zögerlich freundliche Beziehungsangebote an. Erst wenn sich die Bemühungen um das Kind als dauerhaft erweisen, schöpft es Hoffnung, doch noch jemand gefunden zu haben, der die Wucht seiner Gefühle aushalten kann. Die aufkeimende Hoffnung bringt das Kind in Kontakt mit alten Sehnsüchten und schmerzlichen Erinnerungen und vor allem mit der Wut über die traumatisch erlebte Trennung. Plötzliche 10 Angriffe, Destruktivität und dissoziales Verhalten sind einerseits Ausdruck der ursprünglichen Wut über das Verlassen werden, andererseits Ausdruck der Hoffnung, jemand gefunden zu haben, der der erlebten Unbändigkeit standhalten kann. Nicht immer ist eine zu lange Trennung von der Mutter die Ursache für die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten, ähnlich reagieren Kinder, deren Eltern in dieser entscheidenden Entwicklungsphase krank oder aus anderen Gründen nicht belastbar waren, so dass sie ihren Kindern nicht ausreichend vermitteln konnten, dass sie deren Aggression und Wildheit gewachsen sind. Ob Kinder ihre Eltern als ausreichend haltbar erleben hängt nicht nur von deren objektiver Stärke ab, sondern auch von Temperament und Persönlichkeit des Kindes, z.B. sind ruhige, zarte Kinder leichter zu halten, als wilde, aufgeregte; freundliche Kinder, die vorsichtig Kontakt aufnehmen und sich gut auf ihr Gegenüber einstellen können werden besser behandelt, auch von ihren Eltern, als unfreundliche, abweisende Kinder usw. „Der kam schon mit schlechter Laune auf die Welt,“ sagt eine Mutter über ihren Sohn, mit dem sie nicht zurecht kommt, während sie mit seiner kleinen Schwester keine Probleme hat. Ab dem sechsten Lebensmonat, in dem das Kind begonnen hat, seine Eltern getrennt von sich zu sehen, überträgt es die Phantasie, selbst allmächtig zu sein, auf die idealisierten Eltern, die dann für alles verantwortlich sind. Auch Unfälle oder schwere Krankheiten der Kinder werden vom Kind als ein Versagen der Eltern erlebt, da sie ihre Eltern für omnipotent halten, bzw. keine Vorstellung davon haben, dass es Mächte außerhalb des Einflusses ihrer Eltern gibt. Wie können Kindergarten und Schule diesen Kindern helfen? Kinder, die zu früh gezwungen waren ihre vitalen Bedürfnisse zu unterdrücken, leben mit der Vorstellung, dass sie für andere und sich selbst gefährlich sind. Sie benehmen sich angepasst, wirken flach, unlebendig motivationslos und unkreativ. Wenn sie jedoch Vertrauen in eine Beziehung oder ein soziales Gefüge entwickelt haben, wird in ihnen die verborgene Hoffnung wach, diese Menschen, diese Gruppe könnte stark genug sein, ihre Aggressivität, Stärke, Energie usw. auszuhalten. Gesunde Kinder überschreiten Regeln und Grenzen, weil sie sie erkunden und überprüfen wollen, weil sie wissen möchten, wie groß der Spielraum ist, wann es ernst wird. Sie lernen dadurch, wie man sich in komplizierten, sozialen Systemen mit offiziellen und inoffiziellen Regeln zurechtfindet. Sie lernen, die Erwachsenen einzuschätzen; verstehen, dass deren Konsequenz auch von der aktuellen Befindlichkeit abhängt usw. All dies sind wichtige Aspekte des sozialen Lernens. 11 Kinder mit struktureller Schwäche greifen Regeln und Grenzen an mit der Hoffnung gehalten zu werden, sie suchen jemand, der sie aushält, der vor Konfrontation nicht zurückschreckt, nicht zurückweicht und nicht zurück schlägt. Sie brauchen ein soziales Gefüge, das ihrer Wut und Destruktivität standhält. Sie brauchen Erwachsene, die sich ihrer eigenen Grenzen sicher sind, zu ihren Ansprüchen und Wünschen stehen, bereit sind sich durchzusetzen und nicht vorschnell resignieren. Sie brauchen Erwachsene, die die Rahmenbedingungen unter denen sie mit den Kindern arbeiten kennen und anerkennen, die merken, wenn ein Kind mit den gegebenen Bedingungen überfordert ist, die entsprechende Entscheidungen treffen können. Grenzüberschreitung ist Selbst- und Objektsuche, wo pathologische Mechanismen beteiligt sind, hat Strafe für das entsprechende Kind keinen pädagogischen Effekt. Sie entlastet, weil die „Strafe“, die das Kind auf Grund seiner verletzenden Erfahrungen erwartet, immer drastischer ist, nämlich zerstörerisch, als das, was dann passiert. Strafe ist wichtig für diejenigen, die unter den Angriffen leiden, weil sie einen Ausgleich schafft, für das was sie erlitten haben und es ihnen dadurch leichter fällt, sich dem Kind wieder zuzuwenden. Ebenso wenig nützt bei diesen Kindern im Zusammenhang mit Angriffen auf Regeln und Grenzen positive Verstärkung, da die herausbrechende Aggression vom Kind nicht kontrollierbar ist, sie muss von außen begrenzt werden. Offene, unstrukturierte Situationen überfordern diese Kinder, sie wirken wie Verführungen. Das Kind braucht Erwachsene, die dafür sorgen, dass es keinen Schaden anrichtet, die es vor ihm selbst bewahren, damit es nicht aus der Gruppe ausgeschlossen wird. Bin ich auszuhalten und seid ihr stark genug mich auszuhalten ist die Frage die das Handeln dieser Kinder immer wieder bestimmt und sie können keine Ruhe geben, bevor sie nicht wirklich angekommen ist, bzw. ernst genommen wird. Erst wenn die Wut den anderen im Kern getroffen hat, kann sie beantwortet werden. Grundlage für die Antwort muss eine nüchterne Prüfung der realen Situation sein: wie schwer ist die Störung des Kindes? Kann in der gegebenen Situation so auf das Kind aufgepasst werden, dass kein Schaden entsteht? Fühlen sich die ErzieherInnen z.Zt. in der Lage, sich mit diesem Kind auseinander zu setzen? Hilfe für dieses Kind besteht darin, dass es die Erfahrung macht, dass es das Gute nicht zerstören kann. Auch wenn das bedeutet, dass es die Einrichtung verlassen muss und ein anderer Ort gefunden wird, an dem es vor seiner Destruktivität besser geschützt ist. Bevor diese Frage nicht aufgeworfen und anerkannt ist, kann das Kind mit seinem antisozialen Verhalten nicht aufhören. Eine schwerwiegende Komplikation besteht darin, dass seine frühkindliche Wut in ihrer ursprünglichen Wucht, nicht mehr von einem kleinen Kind agiert wird, sondern dass es dafür Kraft und Intelligenz seines jetzigen Alterns nutzt. Aus diesem 12 Grund ist es von großer Bedeutung die Störung frühzeitig ernst zu nehmen und entsprechend zu reagieren. Die Bedeutung von Regeln und festen Strukturen. Der Rahmen Eine pädagogische Einrichtung, Kindergarten, Hort o.ä. in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein Interesse an der Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder haben, die in ihrem pädagogischen Konzept sich nicht die Förderung von Selbstbewusstsein, Kreativität und soziale Kompetenz zum Ziel gesetzt hat, sondern die Kinder nur verwahrt, wird mit diesen Problemen nicht konfrontiert. In einem starren, autoritären System wird nicht die Hoffnung des Kindes auf Heilung geweckt. Das destruktive Potential bleibt verborgen. Die Symptomatik bleibt latent und entlädt sich andernorts. Ist die Zuwendung ernst gemeint, schöpft das Kind Hoffnung und die Problematik entfaltet sich. Es ist schwer, zu verkraften, wenn die Antwort auf Freundlichkeit und Engagement, Angriffe sind, die wirklich verletzten. Die Betroffenen schwanken in ihren emotionalen Reaktionen zwischen heftiger, oft übermäßiger Wut und Verharmlosung. Oft bilden sich auch zwei Lager, während die einen das Verhalten des Kindes verharmlosen „er will doch nur Aufmerksamkeit…“ reagieren die anderen mit übermäßiger Härte und wollen einen „Präzedenzfall“ schaffen. Der Streit zwischen den beiden Lagern lähmt die Arbeit, schwächt und zermürbt die einzelnen BetreuerInnen. Die Lösung liegt nicht im entweder oder, sondern darin, Verständnis und Anforderung in Einklang zu bringen, die ganze Situation und das einzelne Kind im Zusammenhang zu sehen. Um angemessen mit der Not des Kindes umgehen zu können, brauchen die betreuenden Erwachsenen einen Rahmen, der ihnen Sicherheit gibt, der sie schützt, auf den sie sich beziehen können und der es ihnen erlaubt, sich von der direkten, persönlichen Auseinandersetzung zu distanzieren. Nur so können sie das Verhalten des Kindes auf dem Hintergrund seiner Geschichte verstehen und eigene Reaktionen, Verletzungen, Kränkung usw. relativieren und professionell mit der Situation umgehen. Der Rahmen schützt auch vor einem sentimentalen Blick auf die Kinder. Sentimental heißt, die Wirkung der ursprünglichen Verletzung und die daraus resultierende berechtigte Wut nicht anzuerkennen. Bevor das Kind sehen und annehmen kann, was die neue Umwelt an gutem zu bieten hat, muss sich seine Wut auf die Welt zeigen dürfen, ohne dass sie zerstört und das Kind fallengelassen wird. Ein verbindlicher Rahmen, auf den sich die verantwortlichen Erwachsenen diskursiv verständigt haben symbolisiert eine zuverlässige Struktur, er schützt nach innen und außen, durch ihn wird ein Raum eröffnet, in dem spielerisch Impulse und Phantasien aus der inneren 13 Welt ausgedrückt und entfaltet werden können, ohne gefährliche Konsequenzen. Er ermöglicht Trennung und Wiederkehr, Erfahrung mit sich und anderen und konfrontiert mit angemessener Frustration. Regeln und Strukturen werden persönlich und einfühlsam vertreten und damit als menschlich und angreifbar erfahren. 14