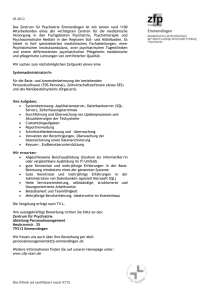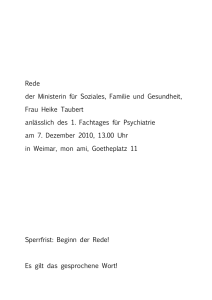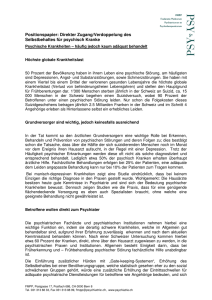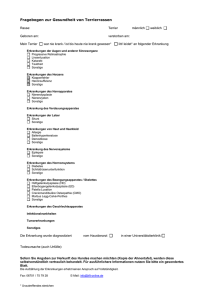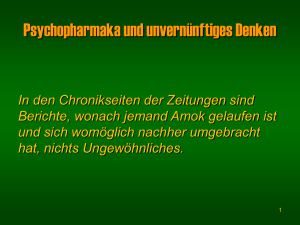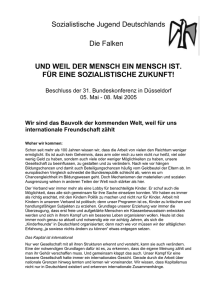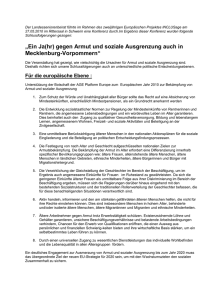Positionspapier_arm_und_psychisch_krank_FEBS_kurz
Werbung
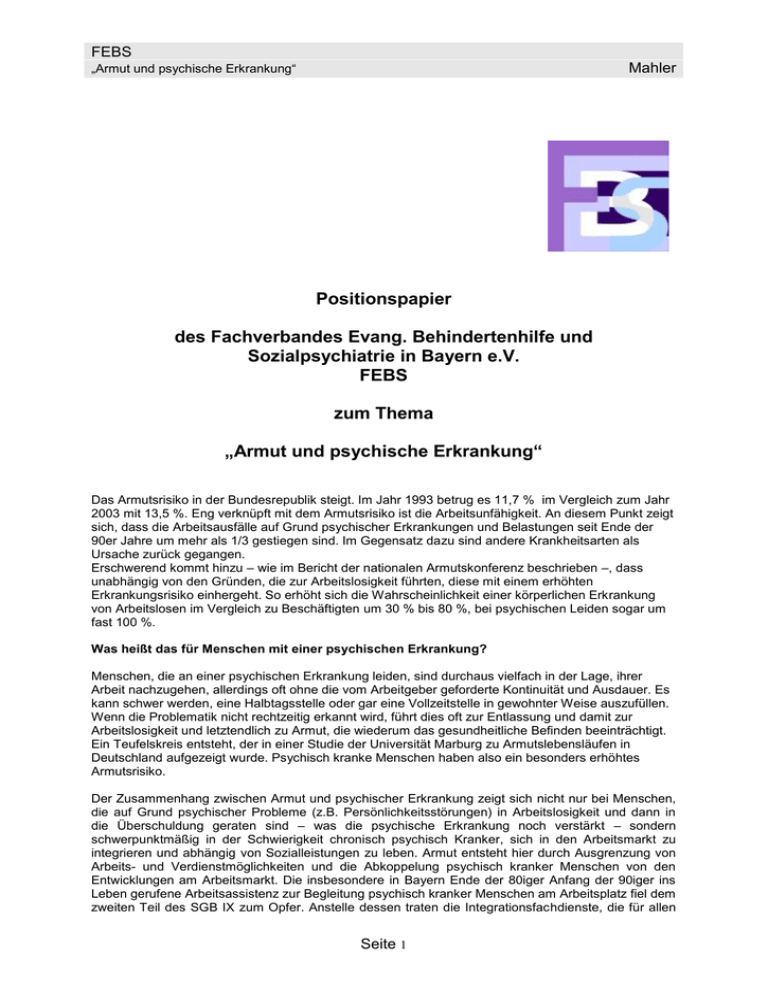
FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Positionspapier des Fachverbandes Evang. Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie in Bayern e.V. FEBS zum Thema „Armut und psychische Erkrankung“ Das Armutsrisiko in der Bundesrepublik steigt. Im Jahr 1993 betrug es 11,7 % im Vergleich zum Jahr 2003 mit 13,5 %. Eng verknüpft mit dem Armutsrisiko ist die Arbeitsunfähigkeit. An diesem Punkt zeigt sich, dass die Arbeitsausfälle auf Grund psychischer Erkrankungen und Belastungen seit Ende der 90er Jahre um mehr als 1/3 gestiegen sind. Im Gegensatz dazu sind andere Krankheitsarten als Ursache zurück gegangen. Erschwerend kommt hinzu – wie im Bericht der nationalen Armutskonferenz beschrieben –, dass unabhängig von den Gründen, die zur Arbeitslosigkeit führten, diese mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko einhergeht. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer körperlichen Erkrankung von Arbeitslosen im Vergleich zu Beschäftigten um 30 % bis 80 %, bei psychischen Leiden sogar um fast 100 %. Was heißt das für Menschen mit einer psychischen Erkrankung? Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, sind durchaus vielfach in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen, allerdings oft ohne die vom Arbeitgeber geforderte Kontinuität und Ausdauer. Es kann schwer werden, eine Halbtagsstelle oder gar eine Vollzeitstelle in gewohnter Weise auszufüllen. Wenn die Problematik nicht rechtzeitig erkannt wird, führt dies oft zur Entlassung und damit zur Arbeitslosigkeit und letztendlich zu Armut, die wiederum das gesundheitliche Befinden beeinträchtigt. Ein Teufelskreis entsteht, der in einer Studie der Universität Marburg zu Armutslebensläufen in Deutschland aufgezeigt wurde. Psychisch kranke Menschen haben also ein besonders erhöhtes Armutsrisiko. Der Zusammenhang zwischen Armut und psychischer Erkrankung zeigt sich nicht nur bei Menschen, die auf Grund psychischer Probleme (z.B. Persönlichkeitsstörungen) in Arbeitslosigkeit und dann in die Überschuldung geraten sind – was die psychische Erkrankung noch verstärkt – sondern schwerpunktmäßig in der Schwierigkeit chronisch psychisch Kranker, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und abhängig von Sozialleistungen zu leben. Armut entsteht hier durch Ausgrenzung von Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und die Abkoppelung psychisch kranker Menschen von den Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Die insbesondere in Bayern Ende der 80iger Anfang der 90iger ins Leben gerufene Arbeitsassistenz zur Begleitung psychisch kranker Menschen am Arbeitsplatz fiel dem zweiten Teil des SGB IX zum Opfer. Anstelle dessen traten die Integrationsfachdienste, die für allen Seite 1 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Menschen mit Behinderung zuständig sind und die Gruppe der psychisch kranken Menschen wurde durch mental stabile Personengruppen wie Menschen mit einer geistigen Behinderung und oder Körperbehinderung verdrängt. Heute wird nur noch ein Prozentsatz der psychisch kranken Menschen begleitet wie noch vor wenigen Jahren. Für chronisch psychisch kranke Menschen, die meistens Unterstützung über sozialpsychiatrische Angebote erhalten und in ein Versorgungsnetz eingebunden sind, ist es selbst dann, wenn medikamentöse Einstellung und diese ambulante Eingebundenheit eine gewisse Stabilität garantieren, schwierig, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Es besteht zwar ein abgestuftes System von Beschäftigungsangeboten, angefangen mit arbeitstherapeutischen Maßnahmen, über niedrig schwellige Zuverdienstmöglichkeiten über beschäftigte Unterstützung, WfbM bis hin zu den höher schwelligen Integrationsfirmen, die Schnittstelle zwischen diesen Angeboten und dem ersten Arbeitsmarkt erweist sich jedoch meistens als ein „zu tiefer Graben“. Oftmals sind die vom ersten Arbeitsmarkt geforderten Arbeitszeiten von psychisch kranken Menschen nicht leistbar und bilden ein unüberwindbares Hindernis für ein geregeltes Arbeitsleben gleichwohl die arbeitsnotwendigen Fähigkeiten vorhanden sind. Damit bleibt die Gruppe der psychisch Kranken nicht nur – trotz aller Integrationsbemühungen – als Sondergruppe gegenüber den „Gesunden“ bestehen; der Status als „Sondergruppe“ verstärkt sich noch dadurch, dass auf Grund der schwierigen finanziellen Situation nur Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden können, die keine Kosten verursachen. Die Integrationsmöglichkeiten werden dadurch geschmälert und das Ziel der Teilhabe deutlich erschwert. Ein Lebensbeispiel Frau B. hatte eine offiziell unauffällige Kindheit. Sie hat Abitur gemacht und studiert. Kurz vor Studierende brach bei ihr wie aus heiterem Himmel eine schizophrene Psychose aus. Sie fühlte sich verfolgt, vergiftet, hörte Stimmen und sah Personen, die andere nicht hörten oder sahen. Durch ihre Erkrankung und die anschließende langjährige stationäre und ambulante Behandlung konnte Frau B. ihr Studium niemals abschließen. Frau B. lebt allein in einer winzigen Wohnung. Derzeit bezieht sie Grundsicherung. Die alte Ausbildung abzuschließen bleibt für sie ein ferner Traum, ebenso eine neue Ausbildung zu beginnen, denn durch Krankheit und Medikamente ist sie nicht einmal mehr fähig, einen längeren Text zu lesen bzw. seinen Inhalt zu erfassen. Bei Reduktion der Medikation kommt es sofort wieder zu akuten Wahnvorstellungen und Stimmenhören. Auch einfache mecha-nische Tätigkeiten hält sie nicht durch, weil sie sich nicht lange genug konzentrieren kann. Sie hat nur wenig Antrieb. Ihre winzige Wohnung einigermaßen sauber zu halten bereitet ihr oft Schwierigkeiten. Die Medikamente verursachen bei Frau B. Heißhunger auf Süßes. Sie ist dick geworden, worauf sie in ihrer Verzweiflung über ihr Äußeres darauf verfiel, Essen wieder zu erbrechen. In der Folge hat sich die Bulimie verselbständigt und verschlingt im wahrsten Sinn des Wortes große Summen für Nahrungsmittel. Frau B. ernährt sich aktuell von Lebensmitteln der Tafel. In der Psychiatrie hat sich Frau B. das Rauchen angewöhnt. Schon oft hat sie versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, um Geld zu sparen. Ebenso oft wurde sie bei der ersten angebotenen oder geschnorrten Zigarette wieder rückfällig. Kinobesuche gibt es für sie nur, wenn sie dazu eingeladen wird. Die Eltern schießen des Öfteren Geld zu. Dadurch bleibt Frau B in deren Abhängigkeit, obwohl sie schon Mitte 30 ist. Manchmal rebelliert Frau B. gegen ihre zu eng gewordene Kleidung und ihre schmale Kasse und bestellt größere Mengen meist teurer Kleidung per Katalog, um nicht ständig nur im Second-HandLaden einkaufen zu müssen. Sie will ebenfalls teilhaben an dem, was für andere offenbar selbstverständlich ist. Die Bestellungen schickt sie dann meist wieder zurück mit der Begründung, die Kleidung würde nicht passen - aus Reue und weil sie sie nicht bezahlen kann. Sie hat Angst, auch noch an Kaufsucht zu erkranken. Frau B. hat aus nachvollziehbaren Gründen eine Betreuerin, die ihr das Geld nur noch wöchentlich zuteilt. Das erlebt Frau B. als Demütigung und Bevormundung. Sie selbst sieht keinen Ausweg aus ihrer psychischen und ihrer materiellen Not. Gelegentlich etwas dazu zu verdienen scheint ihr wohl möglich. Weil aber dieses „Einkommen“ bei der Grundsicherung angerechnet würde, (eine Tatsache, die sie als absolute Kränkung erlebt,) tut sie es nicht. Es grenzt an ein Wunder, dass sie sich ihr freundliches Wesen trotz allem noch bewahrt hat. Seite 2 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Wege aus der Armut und in die Gesellschaft Der Bevölkerungsanteil, der durch Überschuldung auffällt, fällt zu einem nicht geringen Prozentsatz auch in anderen sozialen Zusammenhängen auf, auch wenn eine psychische Erkrankung noch nicht diagnostiziert ist und sozialpsychiatrische Einrichtungen in der Regel (wenn auch inzwischen immer häufiger) noch nicht Anlaufstelle waren. Oft werden erst nach jahrelangen Auffälligkeiten in den verschiedensten Bereichen Persönlichkeitsstörungen erkannt, die als tatsächliche Ursache der vielschichtigen Problemlagen anzusehen sind. Bis dahin sind oft Arbeitslosigkeit, nicht selten auch kriminelle Handlungen und Überschuldung eingetreten. Eine frühe Integration in das sozialpsychologische und sozialpsychiatrische Hilfesystem mit geeigneter Unterstützung der betroffenen Personen kann die Problematik – wenn nicht verhindern, so doch entschärfen. Dieses Ziel ist durch bessere Vernetzung und Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen (kirchliche Sozialarbeit, Schuldnerberatung, Bewährungshilfe, Suchtberatung, sozialpsychiatrische Dienste, Behörden der Sozialverwaltung u.ä.) zu erreichen. Die Koordination der Hilfen kann dazu beitragen, Überschuldungen früher zu erkennen und damit ein „Leben in Armut“ zu verkürzen und dem Chronifizierungsprozess der hieraus resultierenden psychischen Probleme entgegen zu wirken. Wege zur Vermeidung von Armut "Arm sein in Deutschland" bedeutet nicht immer, unter existenzieller Not zu leiden, sondern einen Mangel an Chancen: auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auf Bildung und wie ausführlich oben beschrieben auf Arbeit - die ja in der Regel den Zugang zu all diesen Chancen verschafft. Diesen Teufelskreis zeigt der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung "Lebenslagen in Deutschland" eindrucksvoll auf. Der Bericht trägt zur Enttabuisierung des Themas „Armut“ bei und gibt Hoffnung, dass man sich deren Bekämpfung annimmt. Seine Grundaussage lautet: „Armut heißt, dass Mittel zur Lebensgestaltung fehlen.“ Hier kann man mit wirkungsvollen Konzepten ansetzen: Die Voraussetzung ist die notwendige Grundsicherung: eine Wohnung verbunden mit einem Bürgergeld, das ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Bürger und jedes Kind meint. Psychisch kranke Menschen erhalten darüber hinaus ein Teilhabegeld, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, um die behinderungsspezifischen Beeinträchtigungen wenn auch nicht auszugleichen, so doch zumindest ihnen entgegen zu wirken. Mitten in der Gesellschaft leben heißt aber noch nicht mitten in der Gesellschaft zu sein. Das Konzept des Community Care – die Verantwortung des Bürgers für seinen Mitbürger – zeigt Wege auf in die Partizipation. Das Konzept des Community Care ist eng mit der Inklusionsvorstellung einer vollständigen gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung verknüpft. Während Integration eher den an ein Defizit einer Person geknüpften Bedarf kennzeichnet (das „I-Kind“), liegt die Betonung des Inklusionsbegriffes auf der institutionellen Veränderung, die die Verschiedenheit der einzelnen Menschen als einen positiven Wert ansieht (vgl. BIEWER 2000). Parallel hierzu bedarf es der Aufklärung der Bürger über Armutsrisiken: - das immer löchriger werdende soziale Netz - das Alter - Arbeitslosigkeit - Krankheit - Risikovorsorge ohne Risiko Eine Aufgabe, die uns alle angeht ist, Ausgrenzungen zu vermeiden. Wenn es keine Tabuthemen gibt, haben Vorurteile keinen starken Nährboden und das Verständnis füreinander steigt. Für professionelle Begleiter psychisch kranker Menschen heißt dies im Besonderen, die jedem Menschen eigene Selbstbefähigungspotentiale gemeinsam ins Bewusstsein zu rücken. Die Selbstvertretung steht im Mittelpunkt des Empowermentansatzes und ist ihr Ziel. Für den AK Psychiatrie Gudrun Mahler September 2008 Seite 3 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Wo Armut offensichtlich ist Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Obdachlosenhilfe Nicht-psychiatrische Alternativen: ein Weg aus dem Dilemma zwischen Psychiatrie und Obdachlosigkeit Viola Balz, Barbara Manz, Weglaufhaus Berlin In den 90er Jahren gelangte zusehends ein neues Problem in den Fokus sozialpsychiatrischer Fragestellungen. Konfrontiert mit dem Problem, dass sich immer mehr psychiatrie-betroffene Menschen im Bereich der Wohnungslosenhilfe aufhalten oder auf der Straße leben, wurden vermehrt Studien ausgearbeitet, die das Verhältnis zwischen Psychiatrisierung und Obdachlosigkeit beleuchten sollen (vgl. Eichenbrenner 1991, IKP 1996, Landeskommission gegen Gewalt 1998, Der Spiegel 01/99). Dabei wurde deutlich, dass das Problem der Obdachlosigkeit eng mit dem der Psychiatrisierung verbunden zu sein scheint. Wie Greifenhagen und Fichter (1995) in einer Studie für den Großraum München herausstellen, waren etwa zwei Drittel der untersuchten Obdachlosen vorher ein oder mehrmals in der Psychiatrie. Ein Großteil der obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen sucht Unterstützung in den Angeboten der Wohnungslosenhilfe und lehnt eine sozialpsychiatrisch eingebundene Betreuung ab. In der Diskussion psychiatrischer Professioneller werden für diese Entwicklung v.a. drei Gründe genannt. Zum einen sei eine zunehmende Verschärfung der sozioökonomischen Bedingungen zu beobachten. Die Probleme der Wohnungsnot nähmen zu und würden sich am Beispiel Psychiatrie Betroffener noch zuspitzen. Dass Armut und Psychiatrisierung in einem engen Verhältnis zueinander stehen, gilt als einer der bestuntersuchten Zusammenhänge im sozialpsychiatrischen Bereich (vgl. Hollingshead/Redlich 1958). Gerade die psychiatrisierten Menschen seien, wie herausgestellt wird, häufig vom Verlust ihrer Wohnung bedroht. Sind sie nicht vorher schon in psychosoziale Krisensituationen geraten, die ihnen den Erhalt der eigenen Wohnung verunmöglichten, verlieren sie häufig spätestens nach einem erneuten Psychiatrieaufenthalt ihre Bleibe. Zum anderen, so eine gängige Argumentationsfigur sozialpsychiatrischer HelferInnen, sei zwar die Enthospitalisierung vorangetrieben, gleichzeitig aber nicht genügend Plätze in Therapeutischen Wohngemeinschaften bereitgestellt worden. Zudem setzten die bestehenden sozialpsychiatrischen Einrichtungen zu hochschwellige Eingangskriterien voraus, die eine schnelle und unbürokratische Aufnahme der Betroffenen verunmöglichten. So treffend einige der vorgebrachten Argumente auch sein mögen, erweisen sie ihre blinden Flecken, wenn man die Praxis der sozialpsychiatrischen Hilfen betrachtet. Es bleibt unerklärt, warum viele Psychiatrie-Betroffene das Wohnen in einer sozialpsychiatrischen Wohnform ablehnen, obwohl sie die Möglichkeit dazu haben. Wie auch das Institut für Kommunale Psychiatrie z.T. feststellt, sind die Gründe hierfür nicht nur darin zu suchen, dass diese Hilfen die Betroffenen nicht erreichen, vielmehr werden sie von letzteren häufig aus inhaltlichen Gründen abgelehnt. Denn die sozialpsychiatrischen Vorstellungen von Unterstützung sind denen der NutzerInnen oft diametral entgegengesetzt. So bezeichnen sozialpsychiatrische Einrichtungen ihre NutzerInnen als ‚psychisch Kranke‘, eine sog. ‚Krankheitseinsicht‘ setzen sie als Zugangsvoraussetzung. Demgegenüber erleben sich die Betroffenen nicht als ‚Kranke‘, sondern als Menschen mit individuellen Sinnzusammenhängen und Problemen, deren eventuelles Ver-rücken für den Außenbetrachter vielleicht nicht objektiv nachvollzieh- bzw. verstehbar, für die Betroffenen aber zumindest subjektiv-situativ sinnvoll ist. Durch die Bezeichnung ihrer Wahrnehmungen als ‚psychisch Kranke‘ wird den Betroffenen ihre Wahrnehmung jedoch sukzessive enteignet. Das Krankheitsparadigma stellt somit, wie auch K. Nouvertné (1996) herausarbeitet, für die Betroffenen häufig einen zu hohen Preis für die Inanspruchnahme sozialpsychiatrischer Hilfen dar. Das geschilderte Problem spitzt sich für die Betroffenen an der Kennzeichnung als ‚seelisch Behinderte‘, welche für die in Anspruchnahme einer Hilfe nach § 39 BSHG obligatorisch ist, noch zu, denn mit dieser Etikettierung wird den Betroffenen nicht nur eine ‚psychische Störung‘ oder ‚Erkrankung‘ attestiert, sondern dieselbe auch als chronisch definiert . Eine entsprechende Bezeichnung soll also nicht nur den Ist-Zustand festhalten, sondern auch Aussagen über zukünftiges Verhalten machen, was häufig als sich selbst erfüllende Prophezeiung wirken kann. Für die Betroffenen wird die Wirkung der psychiatrischen Prognose problematisch, da sie ihnen die Entwicklung ihres Lebens immer weiter aus der Hand nimmt und versucht, diese über eine Wahrscheinlichkeitsaussage bestimmbar zu machen. Jetzt und zukünftig als ‚Kranke‘ und ‚Unverständliche‘ definiert, erwarten die Betroffenen von den sozialpsychiatrischen Einrichtungen häufig keine Unterstützung bei der Regelung ihrer individuellen Probleme mehr. Zudem ist die Inanspruchnahme einer sozialpsychiatrischen Hilfe häufig an die Einnahme von Psychopharmaka gekoppelt. Viele Betroffene erleben die Psychopharmakolisierung für sich aber nicht Seite 4 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler als hilfreich (vgl. Nouvertné 1996, Greifenhagen/Fichter 1995), sondern betrachten sie als eine Interventionsform, die ihren Problemen noch ein weiteres hinzufügt. Eine Hilfemöglichkeit ohne Psychopharmaka bzw. die Möglichkeit des Absetzens derselben suchen sie in sozialpsychiatrischen Einrichtungen häufig vergebens. Die Vorstellungen der Professionellen von Hilfe in den sozialpsychiatrischen Einrichtungen divergieren ohnehin meist stark von denen der Betroffenen: In einer Befragung von Nouvertné im Solinger Raum gaben die Professionellen, gefragt nach ihren Vorstellungen von Hilfe für die Betroffenen v.a. Psychopharmaka, Rehabilitation und Therapie an. Dem hingegen rangieren diese Punkte in der Wertehierarchie der NutzerInnen eher auf den letzten Rängen. Sie wünschen sich viel eher Ruhe, Schutz und Schonraum, materielle Absicherung und die Möglichkeit von Lebensqualität - auch durch ein individuell sinnvolles Erleben verrückter Wahrnehmungen (Nouvertné 1996). Das Problem von Psychiatrie und Obdachlosigkeit, so könnte man folgern, ist nicht nur ein Problem der nicht flächendeckend ausgebauten und hochschwelligen sozialpsychiatrischen Versorgung. So wichtig die Möglichkeit der schnellen und leicht zu erreichenden psychiatrischen Hilfe für einen Teil der Betroffenen auch sein mag, so wenig erreicht sie diejenigen Betroffenen, die jede Form der psychiatrischen Hilfe aus den oben genannten Gründen ablehnen. Ihnen bleibt oft nur der Weg in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die sie zwar dem Stigma der Obdachlosigkeit, nicht aber demjenigen der ‚psychischen Krankheit‘ aussetzen. Neue Wege im Umgang mit diesem Problem werden von Seiten der Sozialpsychiatrie häufig in der Verständigung der Wohnungslosenhilfe und der Psychiatrie über gemeinsame Versorgungsziele gesehen. So wird die Frage gestellt, wie Strukturen geschaffen werden können, um eine psychiatrische Versorgung auch derjenigen Menschen sicherzustellen, die sich an der Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Obdachlosigkeit befinden. Als ein beispielhafter Versuch in diesem Bereich wird häufig das Kölner Kooperationsmodell angeführt, das die Vernetzung des Psychiatrie- und Obdachlosenbereiches schon weit vorangetrieben hat. Ziel ist es hier, psychiatriekompetente Fachkräfte in den Obdachlosenbereich einzubetten, um den Betroffenen so den Zugang zum psychiatrischen Hilfesystem zu erleichtern und mittels akzeptierender Arbeit einen Teil von ihnen dennoch zu erreichen. Dieser Ansatz birgt aber m. E. auch die Gefahr, dass sich psychiatriebetroffene NutzerInnen zunehmend aus dem Obdachlosenbereich zurückziehen. Ist der Bereich der Wohnungslosenhilfe für sie zur Zeit noch eine Nische, in der sie niedrigschwellige, akzeptierende nichtpsychiatrische Hilfeangebote finden, wird durch eine ‚Psychiatrisierung des Obdachlosenbereichs‘ der ‚Psychiatrische Blick‘ auch dort zur Gefahr. Es ist so zu befürchten, dass der Flucht vieler Psychiatriebetroffener aus der sozialpsychiatrischen Versorgung dann eine Flucht derselben aus dem Obdachlosenbereich folgt - doch wohin? Ohne entsprechende nichtpsychiatrische Alternativen ist zu vermuten, dass der Weg aus der Wohnungslosenhilfe häufig dort endet, wo er begann - auf der Straße. Die sozialpsychiatrische Hilfe würde sich in diesem Fall als paradoxe herausstellen. Indem sie an dem Problem von Psychiatrie und Obdachlosenbereich ansetzt, um, wie es das Institut für Kommunale Psychiatrie formuliert, zu verhindern, dass die Psychiatriebetroffenen „auf die Straße entlassen“ werden, würde für einige Psychiatriebetroffene so erst die Grundlage geschaffen, den Weg auf die Straße zu wählen. Erst die Möglichkeit, sich auch für eine nichtpsychiatrische Hilfe entscheiden zu können, schüfe hier die Basis dafür, eine psychiatrische Hilfe für diejenigen anzubieten, die sie wollen. Eine nichtpsychiatrische Hilfe hingegen böte den Betroffenen einen psychiatriefreien Raum, der die genannten Widersprüche des psychiatrischen Angebotes vermeidet und sich tatsächlich an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert. Gerade im Hinblick auf die schlechte gesundheitliche Situation der Psychiatrisierten formuliert Oesau (1996:157) deshalb für das Problem von Psychiatrie und Obdachlosigkeit: „Die Ziele eines solchen Einrichtungstyps [der die bestehenden Probleme lösen soll, V.B.] sollten sich stärker an den Problemen und Bedürfnissen der KlientInnen orientieren. Es ist notwendig, dass diesem Personenkreis eine menschenwürdige Nische ohne Veränderungsanspruch durch die Einrichtung geschaffen wird, wobei möglichst eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, mindestens aber eine Verhinderung einer Verschlechterung angestrebt und schließlich Hilfe zur Selbsthilfe geschaffen werden sollte“. Grundlegend für den geschilderten Einrichtungstyp wäre m.E. eine Hilfe, die in einem nichtpsychiatrischen Rahmen an den individuellen Verrückungen und Krisen der Betroffenen ansetzt, aber auch deren besondere gesundheitliche und soziale Situation berücksichtigt, die häufig durch einen schlechten allgemeinen Gesundheitszustand, vielfältigen unerwünschten Wirkungen von Psychopharmaka, prekären familiären Beziehungen und existenzieller Armut gekennzeichnet ist. Denn für die Betroffenen stellt eine wiederholte Psychiatrisierung zwar ein entscheidendes, aber häufig eben nur eines ihrer vielfältigen Probleme dar. Armut und Gesundheit wirken sich in der Problemkonstellation der Betroffenen hier oft diametral entgegen: so ist nicht nur ihre körperliche Seite 5 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Verfassung zumeist eine schlechte, auch ihre psychosoziale Situation ist durch eine Spirale von schwierigen sozialen Beziehungen, Wohnungsnot und dem Unterworfensein unter eine sog. ‚Expertenallmacht‘ gekennzeichnet. Wie in gemeindepsychologischen Studien herausgearbeitet wird, nimmt gerade die Ausgeliefertheit an die Macht der Professionellen proportional zur Armut der Betroffenen zu (vgl. u.a. Giese 1994). Selbstbestimmt über die eigene Hilfe entscheiden zu können, ist gerade für den beschriebenen Personenkreis häufig eine Illusion. Die Möglichkeit, nichtpsychiatrische Alternativen im Problemfeld von Psychiatrie und Obdachlosigkeit einzusetzen, stellt allerdings einen in der Diskussion um die sog. Schnittstellenproblematik häufig vernachlässigten Bereich dar. So versteht sich das Berliner Weglaufhaus im bundesdeutschen Raum als das einzige nicht- bzw. antipsychiatrische Projekt, das Psychiatriebetroffenen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, eine Alternative zur psychiatrischen Versorgung bereitstellt. Gerade die antipsychiatrische Grundhaltung bietet dabei einen Rahmen für die Erprobung von Hilfemöglichkeiten jenseits des psychiatrischen Dispositivs, die gerade für Menschen, die häufig unter der Expertenallmacht im psychiatrischen Bereich gelitten haben, eine neue Erfahrung darstellt. Die Weglaufhaus-Praxis soll deshalb im Folgenden kurz erläutert werden. Das Weglaufhaus versteht sich als Zufluchtsort für Psychiatriebetroffene; es ist als Ort konzipiert, an dem man sich von dem psychiatrisch geprägten Sozial- und Gesundheitssystem und dessen inhärenten hierarchischen Strukturen sicher fühlen soll, um jenseits von ÄrztInnen oder ärztlichem Personal einen Zugang zu den eigenen Krisen wieder herstellen zu können. Dabei wird hier ein besonderes Gewicht auf die Möglichkeit des Austausches mit anderen Psychiatrie-Betroffenen gelegt, denn dieser ermöglicht den Betroffenen auch, wieder einen selbstbestimmten Umgang mit ihren Krisen zu erproben; ein Weg, der ihnen durch die geschilderte, erlebte Expertenallmacht lange verstellt war. Um eine nutzerInnenorientierte und z.T. nutzerInnenkontrollierte Einrichtung zu schaffen, wird im Weglaufhaus größtmöglicher Wert auf Transparenz gelegt. Die BewohnerInnen sollen in jedem Moment die volle Kenntnis darüber haben, was für sie und mit ihnen getan wird. Es wird keinerlei Hilfeleistung ohne ausdrücklichen Auftrag ausgeführt, und alles, was die MitarbeiterInnen tun, ist nachvollzieh- und kontrollierbar (z. B. keine Gespräche mit Dritten ohne die ausdrückliche Zustimmung der BewohnerInnen, Einsehbarkeit der gesamten über sie geführten Korrespondenz etc.). Die BewohnerInnen halten sich freiwillig im Weglaufhaus auf und werden dort keinen Zwangsmaßnahmen wie z.B. zwangsweiser Medikation, Verschluss der Haustür etc. unterworfen. Lediglich die allgemeinen Regeln für das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft - gegenseitige Rücksichtnahme, Verbot von Gewalt und Gewaltandrohung, Alkohol- und Drogenkonsum im Haus – sind für alle BewohnerInnen bindend und können bei Missachtung in Einzelfällen auch zum Ausschluss aus dem gemeinsamen Wohnprojekt führen. Ein wichtiger Punkt der Arbeit des Weglaufhauses ist der Versuch, das verrückte Verhalten, aber auch die individuellen Probleme der Betroffenen aus dem medizinischen Kontext herauszunehmen und mit den Betroffenen neue Wege in der Bewältigung tiefgreifender sozialer und psychischer Probleme zu erschließen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, einen eigenen Umgang mit ihrer Verrücktheit zu erproben. Aus diesem Grund wird sowohl der psychiatrische Krankheitsbegriff als auch psychiatrische Diagnostik abgelehnt. So wenig Letztere den Besonderheiten des verrückten Erlebens der Einzelnen gerecht wird, desto mehr bietet sie, wie schon oben dargestellt, die Grundlage für die Bezeichnung von Verhalten als ‚krankem‘ und ‚unverständlichem‘ und ordnet sie einem medizinisch-psychiatrischen Hilfesystem zu. Grundlage des psychiatrischen Diagnosesystems ist immer auch die Verbundenheit mit psychiatrischen Interventionen, die in den meisten Fällen die Verabreichung von Psychopharmaka mit einschließt. Wie bereits erläutert, werden Letztere häufig aber nicht als Hilfe, sondern als ‚chemische Knebel‘ empfunden (Lehmann 1986). Im Weglaufhaus finden die Betroffenen einen Raum, in dem sie Hilfe beim Absetzen der Psychopharmaka erhalten bzw. auch in Krisensituationen ohne Psychopharmaka leben können. Dieses Angebot, mit einer rund-um-die-Uhr Betreuung Psychopharmaka abzusetzen, ist ein in der Bundesrepublik einmaliges Angebot. Für den Prozess der Psychopharmakareduktion wird aber auch ein Ort benötigt, der Raum für verrücktes Verhalten bietet und dieses nicht als ein defizitäres wahrnimmt. Toleranz gegenüber ungewöhnlichen Erlebens- und Verhaltensweisen von Seiten der MitarbeiterInnen, aber auch der BewohnerInnen des Weglaufhauses gehören ebenso dazu wie die Überzeugung, dass Krisen und verrückte Phasen immer einen Sinn haben. Sie ver-rücken das Verhältnis zu sich selbst und der Umwelt und rücken zugleich die Wahrnehmungen von der herrschenden Normalität weg. Dieses Verständnis von Krisen führt im Weglaufhaus dazu, die Begleitung von Ver-rückheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt an die Bedürfnisse, Kompetenzen und Erfahrungen der Betroffenen anzupassen und sie radikal individuell zu gestalten. Dazu gehört, das individuelle Wissen der Betroffenen darüber, was ihnen in solchen Phasen gut tun könnte, zu nutzen, aber auch das gemeinsame Entwickeln neuer Strategien im Umgang mit den Krisen der Einzelnen. Seite 6 FEBS „Armut und psychische Erkrankung“ Mahler Die Herangehensweise des Weglaufhauses, aber auch die vielfältigen Möglichkeiten nichtpsychiatrischer Alternativen z. B. auch im ambulanten Bereich, wo sie weitgehend fehlen, gilt es weiter auszubauen und für das Problem von Psychiatrie und Obdachlosigkeit nutzbar zu machen. So ist es den meisten Psychiatriebetroffenen zurzeit in Berlin nahezu unmöglich , eine nichtpsychiatrische Unterstützung in der Wohnung in Anspruch zu nehmen, wollen sie nicht auf die zeitlich sehr begrenzten Möglichkeiten der Wohnungslosenhilfe zurückgreifen. Gerade eine Unterstützung jenseits des ‚Psychiatrischen Blicks‘ schafft häufig erst die Voraussetzung dafür, den Betroffenen ein Angebot machen zu können, in dem sie sich nicht der Expertenallmacht ausgeliefert fühlen müssen, sondern der ihnen einen Raum gibt, sich ihrer eigenen Bedürfnisse und Ziele wieder bewusst zu werden und einen selbstbestimmten Umgang mit ihren Krisen und Ver-rückungen zu entwickeln. Diese Möglichkeit schließt selbstverständlich die Notwendigkeit mit ein, mit den Betroffenen auch Wege zu erschließen, aus der ihre Möglichkeiten stark begrenzenden Armut zu entkommen. Denn das Postulat eines ‚selbstbestimmten Lebens in Armut‘ wird für sie sonst weiterhin ein zynisches Paradoxon bleiben. Seite 7