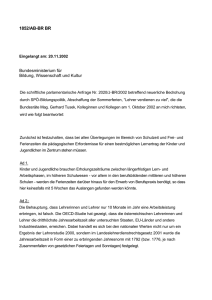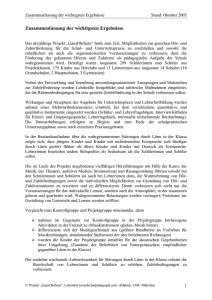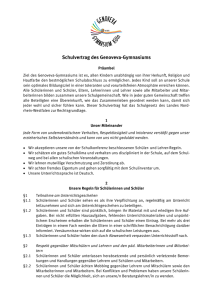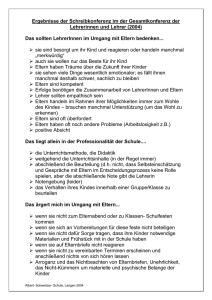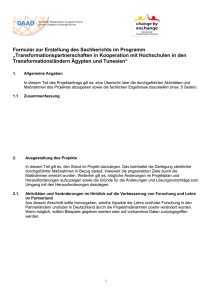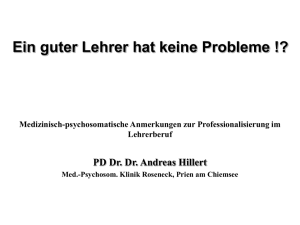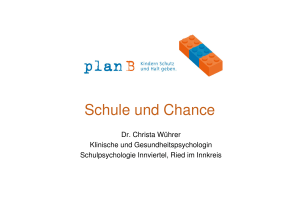Beitrag der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts
Werbung

Prof. Dr. Werner Freigang Fax: Hochschule N e u b r a n d e n b u r g University of Applied Sciences (0395) 5693-405 (0395) 5693-499 Email: [email protected] FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT, BILDUNG UND ERZIEHUNG 13. Mai 2016 Beitrag der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts Die wissenschaftliche Begleitung dieses Modellprojekts hatte im Wesentlichen zwei Aufgaben, die sich auch in diesem Teil des Abschlussberichtes wiederfinden: Die neutrale, außen stehende Kontrolle der Prozesse und möglicher Resultate des Projektes Dies beinhaltet Erhebungen zur Ausgangssituation durch eine Befragung von Schülern und Lehrern, die Begleitung des Prozesses durch eine Diplomandin, zuletzt eine Befragung von LehrerInnen zu Ergebnissen des Projektes. Die Beratung und Irritation der Akteure des Projektes. Die wissenschaftliche Begleitung nahm an zahlreichen Sitzungen der Akteure des Projekts – vertreten durch die Schulleiterin, die MitarbeiterInnen der Erziehungsberatung und der Schulsozialarbeit – sowie des Projektbeirats teil. Dabei ging es oft um die Frage, was das Modellhafte und Weiterführende an der aktuell entwickelten Praxis wäre und welche grundsätzlichen Fragen im Verhältnis Schule und Sozialpädagogik die Wahrnehmung von Problemen und Lösungsmöglichkeiten beeinflussten. Einige grundsätzliche Fragen sollen der „Erfolgsbilanz“ des Projektes vorangestellt werden, einige noch offene tauchen in der Bilanz auf. An ihnen kann deutlich werden, dass die Schwierigkeiten, mit denen das Projekt zeitweilig zu kämpfen hatte, weniger durch die Schwächen der handelnden Personen als durch strukturelle Faktoren hervorgerufen worden waren. 1 Zur Kooperation von Systemen Koexistenz – Konkurrenz - Kooperation Schule und Beratung/Schulsozialarbeit gehören unterschiedlichen Systemen an. Systeme können koexistieren – friedlich und aneinander anerkennend, aneinander nicht interessiert oder aber verärgert über fehlende wechselseitige Bezogenheit. Schule und Wirtschaft oder Schule und Gesundheitssystem liefern Beispiele für mehr oder weniger friedliche und befriedigende Koexistenz. Systeme können konkurrieren, und auch dies lässt sich positiv verstehen als Wettbewerb um beste Lösungen oder negativ als Kampf gegeneinander, der möglicherweise zu Lasten derjenigen geht, um die es eigentlich gehen sollte, in unserem Fall der SchülerInnen und deren Eltern. Ein drittes Verhältnis von Systemen, Institutionen oder Personen stellt die 1 Kooperation dar. Kooperation wird allgemein als die positivste Variante angesehen, seltsamerweise wird sie trotzdem weniger betrieben als propagiert. Das Denken an Kooperation setzt das gleichzeitige Denken an Konkurrenz voraus, das Bestehen auf der Existenzberechtigung und Erhalt des eigenen Systems, darauf bezogen die Konkurrenz um finanzielle Mittel und materielle Ressourcen. Die Unterschiede zwischen den Systemen müssen stabil sein, um Kooperation zu ermöglichen. Dann erst gilt, dass sich gemeinsam mehr erreichen lässt, dass es für alle Beteiligten vernünftig ist, zu profitieren. Kosten-Nutzen-Optimierung Man weiß aus der Sozialisations- und Lernforschung, dass schon sehr kleine Kinder lernen, Aufwand sehr effizient einzusetzen. Ein Lächeln kann Aufmerksamkeit bringen, ein Quengeln zur richtigen Zeit ein Bonbon. Dies ist nicht irgendwie moralisch verwerflich, es dient vor allem der Gattung Mensch zur Weiterentwicklung. Nicht nur der einzelne Mensch ist ein Kosten-Nutzen-Optimierer, sondern auch Institutionen lassen sich so wahrnehmen. Kooperation mit anderen muss profitabel sein, nicht sofort, aber in einer langfristigen Bilanz, sonst ist sie auf Dauer eine Belastung und wird besser abgebrochen. Kooperation, so ließe sich feststellen, funktioniert nur in – modern gesprochen – „win-win-Situationen“, wobei tatsächlich die Kooperierenden die Gewinner sein müssen und nicht nur Dritte, wie etwa die Schüler. Langfristig stabile Kooperationsbeziehungen setzen voraus, dass die beteiligten Akteure von der Kooperation profitieren müssen bzw. es so wahrnehmen müssen. Für das Projekt bedeutete dies auf der einen Seite die Fragestellung „brauchen LehrerInnen SozialpädagogInnen, um gut Schule machen zu können und für was?“, auf der anderen Seite: „Brauchen SozialpädagogInnen LehrerInnen, um ihre Arbeit gut machen zu können und für welche Ziele und Zwecke?“ Verschiedenheit Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen haben unterschiedliche Zugänge zum Feld Schule, zu den Schülerinnen und zu den Eltern. Während die Bildungsinstitution Schule die Kinder vor allem als Lernende mit auf diesen Aspekt bezogenen Potentialen, Störungen und Problemen wahrnimmt, sieht Sozialpädagogik Schule auch als Lebensort, an dem sich biographische Erfahrungen aktualisieren, Bewältigungsstrategien erworben und modifiziert werden, besondere soziale Probleme und Lernchancen bestehen. Die Professionen definieren ihr Aufgaben entsprechend differenziert und kommunizieren auf der Grundlage ihres Selbstverständnisses. Deshalb ist wechselseitiges Verstehen nicht selbstverständlich, sondern muss erarbeitet werden. Gleichheit und Hierarchie Es ist inzwischen guter Brauch, sich am Jahresende bei Dienstleistern für die gute Zusammenarbeit zu bedanken, doch Kooperation im Sinne des Projektes ist etwas anderes. Sie setzt Gleichwertigkeit der Professionen und Systeme voraus, keine Hierarchie der Systeme und keine Subordination, sondern wie es zur Zeit gerne formuliert wird „Augenhöhe“. Gleichheit ist zwischen Schule und Jugendhilfe nicht selbstverständlich gegeben. Trotz aller Kritik – insbesondere seit Pisa – ist Lehrerin ein allgemein geachteter Beruf, ist die Notwendigkeit von Schule nicht wirklich in Frage gestellt und auch bei der Bezahlung gibt es Ungleichheit. Schule ist anerkannt wichtig, es ist ein anerkanntes Ziel, dass Jugendhilfe dazu beitragen soll, dass Schule besser funktioniert – während es für manche befremdlich ist, von der Schule zu erwarten, dass sie einen Beitrag zum Gelingen von Jugendhilfe leisten soll. 2 Im Alltag taucht Ungleichheit der Institutionen / Systeme auch als unterschiedliche Größe auf. Wenn auf 30 oder 50 Lehrerinnen eine Schulsozialarbeiterin oder ein/e Beraterin kommt, erzeugt dies unterschiedliche Angewiesenheit auf Kooperation. Würde jede Lehrerin täglich oder auch nur wöchentlich mit der Sozialpädagogin kommunizieren wollen, könnte dies die Sozialarbeiterin für andere Aufgaben fast lahm legen, d.h. umgekehrt, jede Lehrerin bekommt nur sehr wenig „vom Kuchen der Sozialpädagogik ab“. Zusammenfassung: Voraussetzungen gelingender Kooperation Damit Kooperation auf Dauer gelingen kann, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein: Es muss einen gemeinsamen Gegenstand geben und Wissen über den jeweils anderen Zugang auf diesen Gegenstand. Es bedarf eines Mindestmaßes an gemeinsamen Zielen und geteilten Überzeugungen. Ein grundlegendes Vertrauen ist Fundament von Kooperation. Obwohl dies im Grunde erst aus gemeinsamen Erfahrungen erwachsen kann,. ist es – paradoxerweise – auch Voraussetzung, sich auf gemeinsame Prozesse einzulassen. Die Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern muss auf wechselseitiger Akzeptanz, gegenseitigem Respekt und prinzipieller Gleichheit beruhen. Die Beteiligten müssen sich einen Gewinn von der Kooperation versprechen und diesen auch in einem überschaubaren Zeitraum erleben können. Kooperationen sind immer auch personenabhängig, dennoch brauchen sie Strukturen, Verfahren und Regeln, die die Personen schützen und entlasten. Wege, ohne Kooperation zu größerem Nutzen zu kommen – etwa durch die Abschiebung von „Problemfällen“ an andere Institutionen - müssen versperrt oder wenigstens unbequem sein. Die Zusammenarbeit muss mit zeitlichen und materiellen Ressourcen ausgestattet sein. Wenn dies alles (weitgehend) gegeben ist, können Kinder und Jugendlichen einen großen Nutzen aus solchen Projekten ziehen. Denn Kinder brauchen Erwachsene als Modell, die verschieden sind, aber in der Lage, sich produktiv auseinanderzusetzen. 2. Ausgangslage Von den Projektpartnern wurde die bernsteinSchule definiert als eine Schule, die Bedarf, also ein solches Projekt nötig hat und zugleich als eine Schule, in der ein solches Projekt Erfolg versprechend durchgeführt werden kann. Damit ein Modellprojekt vergeben wird, muss entsprechend definiert werden, einerseits muss ein Problem als gravierend dargestellt sein, andererseits die Kompetenz der Institutionen, dieses Problem mit den Mitteln des Projekts zu bearbeiten, hervorgehoben werden. 3 Erfolgsaussichten: Gute Erfahrungen mit Schulsozialarbeit und top-down-Motivation Warum dieses Projekt Erfolg versprechend war, lässt sich anhand der Berichte der Akteure nachvollziehen. Insbesondere durch die Schulleiterin war eine außergewöhnliche Bereitschaft der Schule gegeben, neue Wege zu beschreiten, sich auf andere Sichtweisen einzulassen und Lehrerinnen zu unterstützen, die sich aktiv am Projekt beteiligen. Das Projekt war insofern auf der Seite der Schule zunächst ein Schulleiterinnenprojekt, das „top-down“ auf die Schule als ganzes ausgedehnt werden sollte. Das, so muss man festhalten, ist kein sozialpädagogischer Einstieg in ein solches Projekt (in der sozialen Arbeit wird in der Regel sehr viel Wert darauf gelegt, dass Modelle vor ihrer Implementierung von der Basis mitentwickelt, zumindest mitgetragen werden), dennoch hat sich dieser Weg pragmatisch als vernünftig erwiesen: Wahrscheinlich hätte das Projekt sonst bis heute nicht begonnen. Zu erwarten, dass die gesamte Lehrerschaft begeistert in ein solches Vorhaben einsteigen würde, wäre illusorisch gewesen. Das widerspräche der Berufssozialisation von Lehrerinnen ebenso wie der langen getrennten Geschichte der Systeme. Widerstände von Lehrerinnen waren natürlich nachvollziehbar unter dem Blickwinkel, dass das Projekt ein „Eindringen“ von Sozialpädagogik in ihren Hoheitsbereich bedeutete, damit Schule als Problem wahrgenommen wurde und Lehrerinnen als nicht in der Lage definiert wurden, die Probleme der Schule zu bearbeiten. 2.1 Ausgangslage am Ort des Projektes, unter Schülern und Eltern Um die Ausgangslage unter den Schülern und Eltern festzuhalten, haben wir zu Beginn des Projektes standardisierte Befragungen durchgeführt, mit einigen Lehrern wurden offene Interviews zu deren Sicht der Situation und des Veränderungsbedarfs geführt. Die Ergebnisse der Befragungen seien hier kurz skizziert. Schülerinnenbefragung Bei den SchülerInnen hatten wir einen Rücklauf von 432 Fragebögen, wobei Mädchen in den unteren Klassen nur in sehr geringem Umfang antworteten, in den höheren Klassen sich aber deutlich häufiger als Jungen äußerten. 4 Nicht ungewöhnlich ist, dass die meisten der Befragten sich für mittelmäßige SchülerInnen halten, nur 5,6% halten sich für ziemlich oder sehr schlecht, immerhin 40,3% empfinden sich als gute oder sehr gute SchülerInnen. Folglich gehen auch etwas mehr Kinder gerne in die Schule als ungern, bei den jüngeren ist es etwas stärker verbreitet, gerne in die Schule zu gehen, in den Klassen 7 bis 9 ist die Schulunlust relativ am größten. . 5 Die Einschätzung der Lehrer im Hinblick auf deren Interesse an den SchülerInnen fiel in den 5. und 6. Klassen noch gut aus, danach glauben immer weniger, dass man sie mit seinem/seiner Lehrer/in über alles reden kann, in der 9. Klasse fühlte sich gar fast ein Sechstel nicht besonders gemocht. Bei einigen Themen zeigte sich, dass in der 10. Klasse das Klima wiederum anders ist und durch einen entspannteren, eher partnerschaftlichen Umgang gekennzeichnet ist. Als kleine Randnotiz ist festzuhalten, dass das Wissen um die Existenz eines Vertrauenslehrers in den unteren Klassen weitaus stärker verbreitet ist als in den höheren Jahrgangsstufen. 6 Eine zentrale Frage vor Beginn des Projektes war natürlich die nach der Problembelastung der SchülerInnen und ihren Möglichkeiten, diese mit Erwachsenen oder Gleichaltrigen angemessen zu bearbeiten. Die Ergebnisse fallen nicht aus dem Rahmen vergleichbarer Untersuchungen, sie machen jedoch deutlich, dass LehrerInnen nur in geringem Umfang aus erster Hand über die Probleme an ihrer Schule informiert werden und dass die Einbeziehung der Eltern mit zunehmendem Alter auch immer geringer wird. Bei den Gleichaltrigen fällt auf, dass Klassenkameraden eine deutlich geringere Bedeutung haben als andere Freunde, die soziale Bedeutung der Klasse gegenüber den Cliquen also offenbar deutlich abgenommen hat. Bei den Problemen mit anderen Kindern in der Schule werden LehrerInnen von den unteren Jahrgängen deutlich stärker mit einbezogen als von den höheren Klassen, wo es offenbar unschicklicher ist zu „petzen“ oder man sich weniger Hilfe verspricht. Immerhin 6 – 7% der SchülerInnen geben an, mit niemandem über ihre Probleme zu sprechen. Von diesen wiederum fühlten sich 8 ganz unsicher an der Schule, dass ist immerhin der höchste prozentuale Anteil an Unsicherheit bei allen Befragten. 7 Bei den Problemen zwischen den Schülerinnen bzw. den Problemen mit anderen Kindern und Jugendlichen gab es die Möglichkeit für die Befragten, mehrere anzugeben, die Hälfte der SchülerInnen benannte dabei die Ausgrenzung Schwächerer, nur knapp gefolgt von Gewalt. Diebstahl und Streit zwischen verschiedenen Cliquen wurde von jeder/m fünften Befragten benannt, Abziehen und Erpressung kam auf einen geringeren Anteil als dies nach Beschreibungen im Vorfeld zu erwarten gewesen wäre. 8 Während sich SchülerInnen der 5. Jahrgangsstufe offenbar ziemlich sicher in der Schule fühlen, ist in den mittleren Jahrgängen, insbesondere bei den SchülerInnen des 7. Schuljahrs ein zum Teil erhebliches Maß an Unsicherheit zu erkennen, das sich dann wieder reduziert, wenn man selbst zu den ganz Großen an der Schule gehört. Insbesondere die letzten Ergebnisse bestätigten den Initiatoren des Projektes den gegebenen Bedarf und regten im Kollegium der Schule Diskussionen an. Elternbefragung Bei den Eltern hatten wir erwartungsgemäß eine weitaus geringere Rücklaufquote als bei den SchülerInnen. Ergebnisse können deshalb als weitaus weniger repräsentativ gesehen werden, wobei Repräsentativität auch nicht das zentrale Anliegen der Befragung war. 130 Fragebogen standen zur Auswertung zur Verfügung, ganz überwiegend von Müttern ausgefüllt. Im Wesentlichen wollten wir von den Eltern wissen, welche Probleme in den Familien aus ihrer Sicht von besonderer Bedeutung sind, mit wem sie diese Probleme besprechen (würden, falls aktuell nicht betroffen) und welche Bedeutung Beratungsinstitutionen, Ämter (Jugendamt, Sozialamt) und insbesondere LehrerInnen dabei haben. Die uns zur Verfügung stehende Stichprobe scheint keine besondere soziale Auswahl zu sein, das durchschnittliche Einkommen der befragten Familien war relativ gering, Arbeitslosigkeit verbreitet, auch einige alleinerziehende Mütter waren unter den Befragten. So ist es nicht verwunderlich, dass weitgehend Übereinstimmung darin bestand, dass finanzielle Probleme in 9 den Familien besonders häufig vorkommen. Aber auch Schulprobleme werden als Bestandteil einer normalen schulischen Laufbahn wahrgenommen. Zwar ist der Anteil derer, die Erziehungsprobleme für die Familien als nicht so bedeutsam einschätzen oder es nicht wissen, höher als bei Schulproblemen, ein Drittel der befragten Elternteile schätzen jedoch ein, dass Erziehungsprobleme in den Familien häufig vorkommen. 10 Obwohl es sehr verbreitet ist, Probleme innerhalb der Familie zu belassen, so ist doch bei Schulproblemen noch die Schule die häufigste Anlaufstelle und auch bei anderen Problemen kann sich ein größerer Teil der Befragten vorstellen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Am häufigsten würde man bei Bedarf die bekannte Beratungsstelle aufsuchen, 17,5% aber auch eine Beratungsstelle, an der sie unbekannt sind, mehr als 20% der Befragten würden eine schriftliche oder telephonische Beratungsform bevorzugen. 11 3 Bemerkenswertes aus dem Verlauf des Projektes Die Faktoren, die im Verlaufe des Projektes bearbeitet werden mussten, um die Ziele umzusetzen, die Bedingungen des Erfolges des Projektes gehen aus den Berichten der Akteure deutlich hervor: Zunächst sind die Personen von Bedeutung, sowohl auf Seiten der Beratungsstelle und Schulsozialarbeit als auch in der Schulleitung und Lehrerschaft. Kooperationen sind abhängig von Personen, aber sie bedürfen auch fester Strukturen und Prozesse, die die Personen entlassen. Um solche Strukturen und Prozesse, so lässt sich bei den Akteuren nachlesen, gab es ein zähes Ringen. Die räumliche Lage war zurecht durchaus Gegenstand von Kontroversen. Auch in der Elternbefragung war ja deutlich geworden, dass die Nähe einer Beratungsstelle durchaus ambivalent wahrgenommen werden kann und andererseits die Nähe erforderlich ist, um die Schule tatsächlich zu erreichen. Erfolg wurde möglich, als es immer stärker gelang, diese Frage unideologisch zu sehen und Strukturen zu ermöglichen, in denen beides möglich werden kann, kurze Wege und individuell bestimmbare Distanz. Schule ist ein von Lehrern definiertes System. Für den Erfolg des Projektes war es wichtig, dass die Beratung mit der A19 gleichfalls ihr eigenes Revier und eigene Ressourcen hatte. Denn es geht nicht nur um räumliche und dienstrechtliche Hoheit, sondern um Definitionsmacht, um einen Raum mit anderen Regeln, der weder von Lehrern noch von Schülern und Eltern in jeder Hinsicht mit Schule gleichgesetzt wird. Der Austausch der Projektverantwortlichen auf einer Ebene jenseits des Alltags war gleichfalls eine wichtige Voraussetzung zum Gelingen des Projektes. Beim Projektbeirat oder bei anderen Treffen gab es die Chance zu grundlegenden Verständigungsprozessen und –moderierten - Auseinandersetzungen Schwierigkeiten bei der Verständigung der Systeme Es gibt Unterschiede zwischen den beiden an der Kooperation beteiligten Systeme, auch wenn die Ziele scheinbar ähnlich sind. Die Angehörigen der Systeme definieren Ziele, Handlungsbedarf und Erfolgskriterien nach ihren jeweils eigenen Kriterien. Dabei besteht auch die Erwartung, Angehörige des anderen Systems von ihrer eigenen Systemlogik überzeugen zu können. SozialpädagogInnen arbeiten an einer Sozialpädagogisierung der Schule, Schule versucht Sozialpädagogik an die gesellschaftliche Leitungsorientierung heranzuführen Es gibt eine große Differenz zwischen Lehrern und SozialpädagogInnen in der Frage, wann man sich selbst in seiner Rolle und Position thematisieren muss. Während es bei – systemisch orientierten - SozialpädagogInnen als selbstverständlich gilt, sich auch als Bestandteil des Problems wahrzunehmen, das man gerade bearbeitet, ist diese Sichtweise bei LehrerInnen eher tabuisiert. Beteiligung an Problemen und eigener Beratungsbedarf gelten eher als Schwäche denn als Normalität, auch das Reden über Probleme ist weniger angesehen und in der Alltagsstruktur auch nicht vorgesehen. LehrerInnen wie auch Sozialarbeiter/sozialpädagogInnen nehmen einander traditionell eher an den Unterschieden war: LehrerInnen fällt die fehlende Struktur bei der Vermittlung von Themen und Veranstaltungen auf, die Zeit, die sie für scheinbar fruchtlose Gespräche zur Verfügung haben oder zur Verfügung stellen, die ständige Betonung der Bedeutung von Beziehungen. SozialpädagogInnen bemerken an den LehrerInnen eher eine geringe Neigung zu Selbstreflexion, die Selbstverständlichkeit, mit der auf herkömmliche Machtquellen (im Sinne von 12 Norbert Elias, der Macht verstand als das, was den anderen auf mich angewiesen sein lässt) wie Kompetenzvorsprung, Steuerungsmöglichkeit von Karrierechancen zurückgegriffen wird, gleichzeitig aber die Machtquellen der SchülerInnen – etwa Verweigerung („Du Lehrer bist auf meine Aufmerksamkeit angewiesen“) – als sehr belastend erlebt werden. Es scheint bei allen Schwierigkeiten im Einzelnen mehr Verständnis füreinander entstanden zu sein, z. T. sogar eine weitgehende Übereinkunft im Hinblick auf den wechselseitigen Respekt vor dem jeweils anderen Wirklichkeitszugang. 4. Resultate des Projekts Nach dem oben geschilderten ist es nicht verwunderlich, dass bei den MitarbeiterInnen der Erziehungsberatung wie auch bei der Schulleitung noch Anfang 2008 Verunsicherung darüber herrschte, ob und wann welche Effekte durch das Modellprojekt erreicht wurden. Zur Kultur des Umgangs miteinander gehört es noch nicht, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben. Die lange Geschichte institutioneller Trennung der Systeme Jugendhilfe und Schule hat es notwendig gemacht, dass grundlegende Verständigungsprozesse noch eingeübt werden müssen. So kam es, dass die Ergebnisse der standardisierten Befragung von Lehrern im November so etwas wie eine Überraschung und Befreiung darstellten. Ergebnisse der Lehrerbefragung am Ende des Projektes Im November 2007 befragten wir Lehrerinnen der Schule über ihre Erfahrungen mit dem Modellprojekt. Ziel dieser standardisierten Befragung waren Erkenntnisse über die Wirkungen des Modellprojekts – aus Einzelfällen konnte man keine Sicherheit gewinnen, wie die Beratungsmöglichkeit von der Lehrerschaft wahrgenommen und bewertet wird. Ggf. sollten die Ergebnisse Chancen zur Korrektur und Nachsteuerung des Projektes geben. 34 LehrerInnen füllten den Fragebogen aus, entsprechend der Zusammensetzung des Kollegiums meist Lehrerinnen mit langjähriger Berufserfahrung 13 Das zentrale Ergebnis der Befragung liegt in der Erkenntnis, dass die konkrete Berührung mit dem Projekt ein positives Bild erzeugt. Die Mehrheit der Lehrkräfte schreibt dem Modellprojekt eine positive Wirkung zu. Während bei denjenigen ohne direkte Zusammenarbeit allerdings lediglich ein knappes Viertel der Befragten dieser Ansicht sind, sind bei denjenigen, die schon mehrfach mit dem Projekt zusammengearbeitet haben, immerhin 85% vom positiven Einfluss überzeugt. Dieses Ergebnis scheint übrigens unabhängig davon, wie „sozialpädagogisch“ diese LehrerInnen eingestellt sind, also ob sie z.B. der Überzeugung sind, dass sie an der Entstehung von Problemen beteiligt sind oder nicht, offenbar waren die Erfahrungen in der Kooperation so, dass Unterschiedlichkeit der Professionen kein Hemmnis darstellte. Entsprechend wurde von den Lehrkräften mit Kooperationserfahrung so gut wie keine Konkurrenz von Seiten der Erziehungsberatung wahrgenommen. 14 Interessant erscheinen die Antworten nach den größten Problemen in der Schule. Von den immerhin 39%, die mangelnde Leistungsbereitschaft der Schüler als größtes Problem angaben, benannte fast die Hälfte Disziplinschwierigkeiten und ein Drittel Konflikte zwischen Lehrern und Schüler als zweitgrößtes Problem. Nimmt man noch diejenigen hinzu, die Disziplinschwierigkeiten als größtes Problem benennen, wird deutlich, dass fast die Hälfte der Lehrkräfte sich vor allem von den SchülerInnen an der Wahrnehmung ihres Bildungsauftrags behindert sieht. 15 Wenn wir abschließend noch einmal zum Erfolg des Modellprojektes kommen und diesen an der einer der oben genannten Bedingungen messen, können wir unter dem Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Optimierung dem Projekt einen vollen Erfolg bescheinigen. Allerdings muss auch die Einschränkung benannt werden, dass noch nicht alle LehrerInnen direkt in der fallbezogenen Zusammenarbeit erreicht wurden. Im Projekt war es wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass Erfolge nach langer Trennung der Systeme auch Zeit bedürfen. Finnland und andere in der Pisa-Debatte häufig angeführte Beispiele können immerhin auf z. T. 80 Jahre eines völlig anderen Selbstverständnisses zurückblicken, auf sich multiprofessionell verstehende Teams, etablierte Strukturen von Kooperation. Das Projekt hat noch Zeit, bis es sich mit solchen Maßstäben messen lassen muss – und 77 Jahre wird es nach dem bis heute erreichten Zwischenstand sicher nicht dauern. 16